Das Amtsgericht Ludwigshafen hat nun durch rechtskräftiges Urteil einen 42 Jahre alten Mann zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt und diese zur Bewährung ausgesetzt. Dies kann einer Pressemitteilung der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V. (GVU) vom 21.10.2011 entnommen werden. Der Tatvorwurf lautete zum einen auf gemeinschaftliches Betreiben eines Trackers, also dem organisatorischen Betrieb eines BitTorrent-Netzwerkes, zum anderen wurde dem Verurteilten die unerlaubte Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken nachgewiesen.
http://www.lbr-law.de/lbr-blog/urteil-in-raubkopierer-fall-%E2%80%93-ein-jahr-freiheitsstrafe-auf-bewahrung
http://www.gvu-online.de/25_177_Pressemitteilung.htm
In meinem Buch Urheberrechtsfibel (2009) schreibe ich zu § 106 UrhG
"§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung
eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Am 6 Mai 2004 verurteilte das Amtsgericht Cottbus – Az.: 95 Ds 1653 Js
15556/04 (57/04) – einen etwa 23-jährigen Angeklagten zu einer
Geldstrafe von 80 Tagessätzen (zu je 5 Euro), weil er ohne Erlaubnis der
jeweiligen Rechteinhaber 272 Titel (unter anderem von Rosenstolz, 214
Grönemeyer und Nena) kopiert und zum Download in der Tauschbörse KaZaA angeboten hatte.
Neben zivilrechtlichen Vorschriften mit Sanktionscharakter wie etwa
dem § 98 kennt das Urheberrecht auch Strafvorschriften. § 106 bezieht
sich grundsätzlich auf den gesamten Bereich der Verwertungsrechte,
also auch auf Bagatellverstöße. Ein Vorstoß, solche Bagatellfälle, also
insbesondere die urheberrechtliche „Schulhofkriminalität“, von der
Strafbarkeit auszunehmen, wurde 2005 vom Bundestag nicht umgesetzt,
da Bagatellfälle ohnehin nicht verfolgt würden.
Es heißt, der gesetzgeberische Einsatz von Strafrecht dürfe immer
nur „letztes Mittel“ (ultima ratio) sein, wenn andere Sanktionsmöglichkeiten nicht ausreichen. Angesichts der empfindlichen finanziellen
Schäden, den das zivilrechtliche Instrumentarium des Urheberrechts
(Paragrafen 97 und folgende) anbietet und das ja von der Abmahnindustrie weidlich ausgenutzt wird, ist nicht einzusehen, wieso sozialschädlichem Verhalten auf dem Gebiet des Urheberrechts zwingend mit
dem Schwert des Strafrechts zu begegnen ist. Urheberrechtsverletzungen von Verbrauchern zu kriminalisieren trägt sicher nicht zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Urheberrechts bei.
Viel zu wenig beachtet wird von den Urheberrechtlern der Bestimmtheitsgrundsatz aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz: Der Bürger
soll von vornherein wissen können, was strafrechtlich verboten ist, damit er sein Verhalten darauf einstellen kann. Zwar sind Generalklauseln
durchaus zulässig, aber dass der Bürger vor Nutzung eines Internetanschlusses ein Jurastudium absolvieren müsse, um einen Urheberrechtskommentar verstehen zu können, ist vielleicht doch etwas viel verlangt.
Wenn die zentrale Norm für die Vervielfältigung § 53 in entscheidenden Abschnitten schlicht und einfach unverständlich ist, kann sich aus
einem Verstoß, meine ich, auch keine Strafbarkeit ableiten.
Nur vorsätzlich begangene Urheberrechtsverletzungen sind strafbar.
Bedingter Vorsatz reicht aus, Fahrlässigkeit nicht. Beim bedingten Vorsatz hält es der Täter für möglich, wenngleich nicht für sicher, fremde
Rechtsgüter zu verletzen, findet sich damit aber ab. Es kommt auf die
„Parallelwertung in der Laiensphäre“ an. Wer nicht im Mindesten damit rechnet, etwas Verbotenes zu tun, kann sich auch nicht strafbar
machen.
Zum Verbotsirrtum hat sich das Berliner Kammergerichts am
28. März 2000 (Az.: (4) 1 Ss 397/98) geäußert. Der bei juris zitierte
Orientierungssatz lautet: „Es ist rechtsfehlerhaft, wenn das erkennende
Gericht einem Angeklagten (hier: in einem Strafverfahren wegen ge-215
werbsmäßigen Vergehens gegen UrhG §§ 106, 108, 108a) deshalb keine
günstige Sozialprognose iSd StGB § 56 Abs 1 stellt, weil er in der (Berufungs-)Hauptverhandlung erklärt hat, ‚daß ihm gar nicht bewußt gewesen sei, sich strafbar gemacht zu haben‘, was zeige, ‚daß der Angeklagte
sein bisheriges Verhalten nicht reflektiert habe‘. Diese Darlegungen
lassen besorgen, daß das erkennende Gericht das Geltendmachen eines
Verbotsirrtums unzulässigerweise zum Nachteil des Angeklagten berücksichtigt hat. Einem Angeklagten darf es nicht zum Nachteil gereichen, wenn er keine Schuldeinsicht oder Reue zeigt oder sich auf einen
Verbotsirrtum beruft.“ Das Landgericht hatte genau entgegengesetzt
argumentiert.
Strafrechtliche Verurteilungen auf dem Gebiet des Urheberrechts
sind außerordentlich rar. Allerdings werden von der „Abmahnindustrie“ sehr viele Verfahren nur deshalb angestrengt, um über die Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Filesharer identifizieren zu können.
Für entsprechende Auskünfte gelten die vergleichsweise umständlichen
Vorschriften des § 101, die via Staatsanwaltschaft leicht umgangen werden können. Allerdings beginnen sowohl die Staatsanwaltschaften als
auch die Gerichte inzwischen, diese Instrumentalisierung des Strafrechts kritisch zu sehen.
Soweit ein Sanktionsbedürfnis gegen gewerbliche Urheberrechtsverletzung besteht, könnte man eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit
erwägen. Dies hätte den Vorteil, dass sie das Unternehmen selbst treffen
kann, während das Strafrecht auf die umständliche Regelung der Vertreterhaftung (§ 14 Strafgesetzbuch) angewiesen ist.
Man könnte gegen die Abschaffung des Strafrechts im Urheberrecht
einwenden, die Strafverfahren spielten nur deshalb in der Praxis eine
untergeordnete Rolle, weil eben die Abschreckung greife. Dieses Argument erinnert ein wenig an den Witz, den Paul Watzlawick in seiner
„Anleitung zum Unglücklichsein“ wiedergab: Ein Mann klatscht alle
zehn Sekunden in die Hände. Man fragt ihn, warum er das tue. „Um die
Elefanten zu verscheuchen.“ „Aber es gibt hier doch gar keine!“ „Na,
also! Sehen Sie?“
Die Kriminalisierung von Urheberrechtsverstößen ist Teil einer
Hochrüstungs-Strategie, die in eine Sackgasse führt. Die Konsequenz kann daher nur sein: Weg mit dem Urheberstrafrecht! "
http://www.lbr-law.de/lbr-blog/urteil-in-raubkopierer-fall-%E2%80%93-ein-jahr-freiheitsstrafe-auf-bewahrung
http://www.gvu-online.de/25_177_Pressemitteilung.htm
In meinem Buch Urheberrechtsfibel (2009) schreibe ich zu § 106 UrhG
"§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung
eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Am 6 Mai 2004 verurteilte das Amtsgericht Cottbus – Az.: 95 Ds 1653 Js
15556/04 (57/04) – einen etwa 23-jährigen Angeklagten zu einer
Geldstrafe von 80 Tagessätzen (zu je 5 Euro), weil er ohne Erlaubnis der
jeweiligen Rechteinhaber 272 Titel (unter anderem von Rosenstolz, 214
Grönemeyer und Nena) kopiert und zum Download in der Tauschbörse KaZaA angeboten hatte.
Neben zivilrechtlichen Vorschriften mit Sanktionscharakter wie etwa
dem § 98 kennt das Urheberrecht auch Strafvorschriften. § 106 bezieht
sich grundsätzlich auf den gesamten Bereich der Verwertungsrechte,
also auch auf Bagatellverstöße. Ein Vorstoß, solche Bagatellfälle, also
insbesondere die urheberrechtliche „Schulhofkriminalität“, von der
Strafbarkeit auszunehmen, wurde 2005 vom Bundestag nicht umgesetzt,
da Bagatellfälle ohnehin nicht verfolgt würden.
Es heißt, der gesetzgeberische Einsatz von Strafrecht dürfe immer
nur „letztes Mittel“ (ultima ratio) sein, wenn andere Sanktionsmöglichkeiten nicht ausreichen. Angesichts der empfindlichen finanziellen
Schäden, den das zivilrechtliche Instrumentarium des Urheberrechts
(Paragrafen 97 und folgende) anbietet und das ja von der Abmahnindustrie weidlich ausgenutzt wird, ist nicht einzusehen, wieso sozialschädlichem Verhalten auf dem Gebiet des Urheberrechts zwingend mit
dem Schwert des Strafrechts zu begegnen ist. Urheberrechtsverletzungen von Verbrauchern zu kriminalisieren trägt sicher nicht zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Urheberrechts bei.
Viel zu wenig beachtet wird von den Urheberrechtlern der Bestimmtheitsgrundsatz aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz: Der Bürger
soll von vornherein wissen können, was strafrechtlich verboten ist, damit er sein Verhalten darauf einstellen kann. Zwar sind Generalklauseln
durchaus zulässig, aber dass der Bürger vor Nutzung eines Internetanschlusses ein Jurastudium absolvieren müsse, um einen Urheberrechtskommentar verstehen zu können, ist vielleicht doch etwas viel verlangt.
Wenn die zentrale Norm für die Vervielfältigung § 53 in entscheidenden Abschnitten schlicht und einfach unverständlich ist, kann sich aus
einem Verstoß, meine ich, auch keine Strafbarkeit ableiten.
Nur vorsätzlich begangene Urheberrechtsverletzungen sind strafbar.
Bedingter Vorsatz reicht aus, Fahrlässigkeit nicht. Beim bedingten Vorsatz hält es der Täter für möglich, wenngleich nicht für sicher, fremde
Rechtsgüter zu verletzen, findet sich damit aber ab. Es kommt auf die
„Parallelwertung in der Laiensphäre“ an. Wer nicht im Mindesten damit rechnet, etwas Verbotenes zu tun, kann sich auch nicht strafbar
machen.
Zum Verbotsirrtum hat sich das Berliner Kammergerichts am
28. März 2000 (Az.: (4) 1 Ss 397/98) geäußert. Der bei juris zitierte
Orientierungssatz lautet: „Es ist rechtsfehlerhaft, wenn das erkennende
Gericht einem Angeklagten (hier: in einem Strafverfahren wegen ge-215
werbsmäßigen Vergehens gegen UrhG §§ 106, 108, 108a) deshalb keine
günstige Sozialprognose iSd StGB § 56 Abs 1 stellt, weil er in der (Berufungs-)Hauptverhandlung erklärt hat, ‚daß ihm gar nicht bewußt gewesen sei, sich strafbar gemacht zu haben‘, was zeige, ‚daß der Angeklagte
sein bisheriges Verhalten nicht reflektiert habe‘. Diese Darlegungen
lassen besorgen, daß das erkennende Gericht das Geltendmachen eines
Verbotsirrtums unzulässigerweise zum Nachteil des Angeklagten berücksichtigt hat. Einem Angeklagten darf es nicht zum Nachteil gereichen, wenn er keine Schuldeinsicht oder Reue zeigt oder sich auf einen
Verbotsirrtum beruft.“ Das Landgericht hatte genau entgegengesetzt
argumentiert.
Strafrechtliche Verurteilungen auf dem Gebiet des Urheberrechts
sind außerordentlich rar. Allerdings werden von der „Abmahnindustrie“ sehr viele Verfahren nur deshalb angestrengt, um über die Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Filesharer identifizieren zu können.
Für entsprechende Auskünfte gelten die vergleichsweise umständlichen
Vorschriften des § 101, die via Staatsanwaltschaft leicht umgangen werden können. Allerdings beginnen sowohl die Staatsanwaltschaften als
auch die Gerichte inzwischen, diese Instrumentalisierung des Strafrechts kritisch zu sehen.
Soweit ein Sanktionsbedürfnis gegen gewerbliche Urheberrechtsverletzung besteht, könnte man eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit
erwägen. Dies hätte den Vorteil, dass sie das Unternehmen selbst treffen
kann, während das Strafrecht auf die umständliche Regelung der Vertreterhaftung (§ 14 Strafgesetzbuch) angewiesen ist.
Man könnte gegen die Abschaffung des Strafrechts im Urheberrecht
einwenden, die Strafverfahren spielten nur deshalb in der Praxis eine
untergeordnete Rolle, weil eben die Abschreckung greife. Dieses Argument erinnert ein wenig an den Witz, den Paul Watzlawick in seiner
„Anleitung zum Unglücklichsein“ wiedergab: Ein Mann klatscht alle
zehn Sekunden in die Hände. Man fragt ihn, warum er das tue. „Um die
Elefanten zu verscheuchen.“ „Aber es gibt hier doch gar keine!“ „Na,
also! Sehen Sie?“
Die Kriminalisierung von Urheberrechtsverstößen ist Teil einer
Hochrüstungs-Strategie, die in eine Sackgasse führt. Die Konsequenz kann daher nur sein: Weg mit dem Urheberstrafrecht! "
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 22:55 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.themorgan.org/collections/works/BlackHours/manuscript.asp
The Morgan's Black Hours is awaiting conservation treatment. In the meantime, we are pleased to offer a virtual facsimile.
"Black Hours," for Rome use. Belgium, Bruges, c. 1470 (MS M.493).

The Morgan's Black Hours is awaiting conservation treatment. In the meantime, we are pleased to offer a virtual facsimile.
"Black Hours," for Rome use. Belgium, Bruges, c. 1470 (MS M.493).

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 22:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.facebook.com/groups/WorldPaperFreeDay/
"The World Paper Free Day ( #WPFD ) is an initiave by AIIM international to create awareness for the benefits of electronic media, electronic communication and electronic information management - to save paper. "
"The World Paper Free Day ( #WPFD ) is an initiave by AIIM international to create awareness for the benefits of electronic media, electronic communication and electronic information management - to save paper. "
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 17:00 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Open-Access-Erfolgsgeschichten präsentiert:
http://www.oastories.org/
Was kostet die wissenschaftliche Welt, fragt Christian Hauschke:
http://plan3t.info/2011/10/27/was-kostet-die-wissenschaftliche-welt/
Und Ben Kaden zerlegt den Angriff von Günter Krings (CDU-MdB) auf DFG und Zweitveröffentlichungsrecht (wo schrieb Krings? natürlich im Zentralorgan der Reußianer, der FAZ):
http://www.iuwis.de/krings_dfg_10_2011
Weiterer Kommentar zu Krings:
http://blog.die-linke.de/digitalelinke/gunter-krings-gegen-open-access-der-professorenversteher/

http://www.oastories.org/
Was kostet die wissenschaftliche Welt, fragt Christian Hauschke:
http://plan3t.info/2011/10/27/was-kostet-die-wissenschaftliche-welt/
Und Ben Kaden zerlegt den Angriff von Günter Krings (CDU-MdB) auf DFG und Zweitveröffentlichungsrecht (wo schrieb Krings? natürlich im Zentralorgan der Reußianer, der FAZ):
http://www.iuwis.de/krings_dfg_10_2011
Weiterer Kommentar zu Krings:
http://blog.die-linke.de/digitalelinke/gunter-krings-gegen-open-access-der-professorenversteher/

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 16:48 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die BSG-Jahresbände 1913-1974 wurden gescannt, OCR-erfasst, strukturiert und auf der Seite retro.seals.ch unter der Rubrik "DDC-940: Geschichte Europas" aufgeschaltet.
http://www.nb.admin.ch/aktuelles/03147/03569/03932/index.html?lang=de
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=bsg-001&id=browse&id2=browse1
http://www.nb.admin.ch/aktuelles/03147/03569/03932/index.html?lang=de
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=bsg-001&id=browse&id2=browse1
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 16:11 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://infobib.de/blog/2011/10/26/kein-plus-mehr-in-der-google-suche/
Statt mit einem vorangestellten Pluszeichen muss man nun einen Begriff, der exakt so gefunden werden soll, in Anführungszeichen setzen.
Ergebnisse für klaus garf
Der Operator + wurde ersetzt.
Verwenden Sie für die Suche nach einem genauen Wort oder einer genauen Wortgruppe doppelte Anführungszeichen: klaus "garf"
Statt mit einem vorangestellten Pluszeichen muss man nun einen Begriff, der exakt so gefunden werden soll, in Anführungszeichen setzen.
Ergebnisse für klaus garf
Der Operator + wurde ersetzt.
Verwenden Sie für die Suche nach einem genauen Wort oder einer genauen Wortgruppe doppelte Anführungszeichen: klaus "garf"
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.urheberrecht.org/news/4399/
http://buskeismus-lexikon.de/324_O_196/11_-_15.07.11_-_Was_in_der_Kunst_erlaubt_ist,_bestimmen_die_Richter
Das LG Hamburg hat am 14. Oktober 2011 zu Gunsten des klagenden Moderators Günther Jauch entschieden und den Inhaber des Solibro Verlags, in dem das Buch »Ich war Günther Jauchs Punching-Ball!« von Peter Wiesmeier erschienen ist, zur Unterlassung verurteilt (Az.: 324 O 196/11; Veröffentlichung in ZUM oder ZUM-RD folgt). Dabei stützte es sich auf die »Ron Sommer«-Entscheidung des BVerfG vom 14. Februar 2005 zur Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Fotomontage.
Das BVerfG führt in der vom LG Hamburg herangezogenen Entscheidung aus: »Der Träger des Persönlichkeitsrechts hat zwar kein Recht darauf, von Dritten nur so wahrgenommen zu werden, wie er sich selbst gerne sehen möchte (...), wohl aber ein Recht, dass ein fotografisch erstelltes Abbild nicht manipulativ entstellt ist, wenn es Dritten ohne Einwilligung des Abgebildeten zugänglich gemacht wird. Die Bildaussage wird jedenfalls dann unzutreffend, wenn das Foto über rein reproduktionstechnisch bedingte und für den Aussagegehalt unbedeutende Veränderungen hinaus verändert wird. Solche Manipulationen berühren das Persönlichkeitsrecht, einerlei ob sie in guter oder in verletzender Absicht vorgenommen werden oder ob Betrachter die Veränderung als vorteilhaft oder nachteilig für den Dargestellten bewerten«.
Die herangezogene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts werte ich als klare und eindeutige Fehlentscheidung, die entscheidend die Kunstfreiheit verkennt, indem sie bei Personendarstellungen ein absolutes Verbot von Bildbearbeitung verhängt. Dass Satiriker zwar in zeichnungen karikieren dürfen, aber Fotoveränderungen nicht erlaubt sind, greift entscheidend in die Freiheit der Kunst ein.
http://buskeismus-lexikon.de/324_O_196/11_-_15.07.11_-_Was_in_der_Kunst_erlaubt_ist,_bestimmen_die_Richter
Das LG Hamburg hat am 14. Oktober 2011 zu Gunsten des klagenden Moderators Günther Jauch entschieden und den Inhaber des Solibro Verlags, in dem das Buch »Ich war Günther Jauchs Punching-Ball!« von Peter Wiesmeier erschienen ist, zur Unterlassung verurteilt (Az.: 324 O 196/11; Veröffentlichung in ZUM oder ZUM-RD folgt). Dabei stützte es sich auf die »Ron Sommer«-Entscheidung des BVerfG vom 14. Februar 2005 zur Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Fotomontage.
Das BVerfG führt in der vom LG Hamburg herangezogenen Entscheidung aus: »Der Träger des Persönlichkeitsrechts hat zwar kein Recht darauf, von Dritten nur so wahrgenommen zu werden, wie er sich selbst gerne sehen möchte (...), wohl aber ein Recht, dass ein fotografisch erstelltes Abbild nicht manipulativ entstellt ist, wenn es Dritten ohne Einwilligung des Abgebildeten zugänglich gemacht wird. Die Bildaussage wird jedenfalls dann unzutreffend, wenn das Foto über rein reproduktionstechnisch bedingte und für den Aussagegehalt unbedeutende Veränderungen hinaus verändert wird. Solche Manipulationen berühren das Persönlichkeitsrecht, einerlei ob sie in guter oder in verletzender Absicht vorgenommen werden oder ob Betrachter die Veränderung als vorteilhaft oder nachteilig für den Dargestellten bewerten«.
Die herangezogene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts werte ich als klare und eindeutige Fehlentscheidung, die entscheidend die Kunstfreiheit verkennt, indem sie bei Personendarstellungen ein absolutes Verbot von Bildbearbeitung verhängt. Dass Satiriker zwar in zeichnungen karikieren dürfen, aber Fotoveränderungen nicht erlaubt sind, greift entscheidend in die Freiheit der Kunst ein.
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 12:54 - Rubrik: Archivrecht
Goldene Worte, auch der Besuch schon ein paar Jahre zurückliegt (2007):
Zu Anfang wurden die Besucher durch den Grafen Droste zu Vischerering (Erbdroste) begrüßt, der zur Geschichte des Schlosses und aller Anwesen eingehende und sehr erläuternde Ausführungen machte. Alsbald stieß ein Mitarbeiter mit in unsere Gruppe. Dieser führte uns im Beisein des Grafen in das Archiv. Hier wurde allgemein festgestellt, dass das Archiv an Größe, Ordnung und Sauberkeit seinesgleichen sucht. Anschließend bat man uns in ein Besprechungszimmer, in dem der Mitarbeiter sehr gut vorbereitet anhand von Unterlagen und Wortbeiträgen über Haus Bevern berichtete.
Anschließend durften wir noch in der Stattelkammer die blank gewienerten Pferdegeschiere ansehenden. Dies war ein seltener Anblick. Gleichfalls herrschten hier besondere Sauberkeit und Ordnung. Es bleibt hervorzuheben, dass von Alter nichts zu sehen war.
http://www.heimatvereinostbevern.de/bildergalerie-einzel-heimatverein-ostbevern.php?backDat=bildergalerie-heimatverein-ostbevern.php&galid=9
#histverein
Zu Anfang wurden die Besucher durch den Grafen Droste zu Vischerering (Erbdroste) begrüßt, der zur Geschichte des Schlosses und aller Anwesen eingehende und sehr erläuternde Ausführungen machte. Alsbald stieß ein Mitarbeiter mit in unsere Gruppe. Dieser führte uns im Beisein des Grafen in das Archiv. Hier wurde allgemein festgestellt, dass das Archiv an Größe, Ordnung und Sauberkeit seinesgleichen sucht. Anschließend bat man uns in ein Besprechungszimmer, in dem der Mitarbeiter sehr gut vorbereitet anhand von Unterlagen und Wortbeiträgen über Haus Bevern berichtete.
Anschließend durften wir noch in der Stattelkammer die blank gewienerten Pferdegeschiere ansehenden. Dies war ein seltener Anblick. Gleichfalls herrschten hier besondere Sauberkeit und Ordnung. Es bleibt hervorzuheben, dass von Alter nichts zu sehen war.
http://www.heimatvereinostbevern.de/bildergalerie-einzel-heimatverein-ostbevern.php?backDat=bildergalerie-heimatverein-ostbevern.php&galid=9
#histverein
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Oktober 2011, 12:19 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 31. Oktober 2011, 22:04 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Trailer Chico y Rita from estudiomariscal on Vimeo.
".... Chico & Rita ist das Werk von Regisseur und Oscar-Preisträger Fernando Trueba, Spaniens renommiertesten Designer Javier Mariscal und Tono Errando. Die wundervolle Musik, welche die Bilder begleitet, stammt von dem bereits 93-jährigen Komponisten Bebo Valdés, der auch Chicos Klavierspiel im Film übernahm. Ritas Gesang kam von Idania Valdés. Flamenco-Star Estrella Morente spielte sich selbst in dem Film.
Chico & Rita präsentiert ein Havanna, das nach alten Stadtplänen detailgenau rekonstruiert wurde. Mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gingen dem Trickfilm ganze vier Wochen Dreharbeiten im wahren Kuba voraus. Mariscal verschaffte sich Zugriff zu Bildern Havannas im Jahre 1949 aus dem Stadtarchiv, um sich ein genaues Bild des Szenarios zu kreieren, in das er die Protagonisten einbetten wollte. Die Orte, Straßen und Häuser - sowohl ihre Fassaden, als auch ihre Räume - sind dem originalen Havanna der 1950er nachempfunden und verleihen den Bildern der Geschichte von Chico & Rita, die sich zu eben dieser Zeit abspielen, ein historisch realistisches Ambiente und sehr viel Authentizität. Aber auch die Figuren des Films sind in ihrer Ausdrucksweise, in ihren Bewegungen, in der Gestik und Mimik den realen Einwohnern Havannas nachempfunden. Das Ergebnis ist eine Welt, in die der Betrachter nur zu gerne eintaucht und seine reale Umgebung vergisst, um sich völlig auf die Geschichte von Chico & Rita einzulassen. ..."
Quelle: Negativ, 24.10.11
Filmhomepage
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 22:22 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: Pumpwerk Siegburg
"Rosemarie Stuffer hat rund 40 Gemälde und Objekte aus Ton und Papier im Siegburger Pumpwerk ausgestellt. Die Künstlerin hat sich vom eingestürzten Stadtarchiv inspirieren lassen.
Die Bilder haben sich ins Gedächtnis eingebrannt: Mauerteile, Trümmer, aufgerissene Fassaden an der Stelle, an der einmal das Historische Archiv der Stadt Köln stand. Zwei junge Männer wurden aus dem Leben gerissen, das Gedächtnis einer Stadt zerstört, zerfetzt, vergraben im Schutt. Der Einsturz des Stadtarchivs im März 2009 erschütterte auch die Mucher Künstlerin Rosemarie Stuffer:„Ich bin nach Köln an den Unglücksort in die Severinstraße gefahren“, erzählt sie. „Mir war sofort klar, dass ich das künstlerisch verarbeiten muss.“
Die Trümmer, die Zerstörung, das Chaos thematisierte sie noch im selben Jahr in einer Serie aus Gemälden und Objekten, in denen sie die Formen aus dem Bild ins Dreidimensionale übersetzte. Zerstörung, Chaos – das sind die Themen der 70-Jährigen. „Reines Chaos wäre schrecklich“, sagt sie. „Aber Chaos ist Nährboden für Veränderungen, und die wiederum haben Einfluss auf die Menschen. Sich selbst zu verändern ist das Schwierigste überhaupt.“ „Veränderungen“ ist auch der Titel der aktuellen Ausstellung der Künstlerin im Siegburger Pumpwerk. Neben der Reihe „Gedächtnis der Stadt“ werden rund 30 weitere Bilder und Objekte aus den letzten Jahren gezeigt: Farbintensive Bilder, filigrane Papierarbeiten, Objekte aus Ton. „Ich habe mit Skulpturen begonnen, die Malerei kam später dazu“, erzählt Rosemarie Stuffer. „Ich wollte über den Tellerrand schauen dürfen.“
Interdisziplinäres Arbeiten ist ihr wichtig: Immer wieder durchkreuzen stilisierte Stadtpläne ihre Bilder, hat sie Entwurfszeichnungen aus ihrer Zeit als Stadtplanerin in Bergisch Gladbach eingearbeitet. Sie spachtelt Bitumen auf die Leinwand, klebt Zellulose an Draht, brennt ihre Ton-Objekte nach einer japanischen Tradition aus dem 16. Jahrhundert. „Raku“ heißt die Technik, bei der die Keramik in einem mit Holz befeuerten im Ofen im Freien gebrannt wird und in Laub abkühlt. „Weil meine Objekte so groß sind, muss ich sie mit einem Flaschenzug aus dem Ofen holen“, berichtet sie. Risse, Sprünge, Farbverlauf – kein Objekt gleicht dem anderen. Durch den Raku-Brand ergeben sich spannende Veränderungen: „Durch den Brand bekommt das Werk eine Eigendynamik, es lässt sich nie vorhersagen, wie es aussehen wird.“
„Veränderungen“ bis 4.11. im Pumpwerk, Bonner Straße 65, Siegburg. ☎ 02241/97 14 20 "
Quelle: Sandra Ebert und Sophie Jung, Kölner Stadt-Anzeiger20.10.11
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 22:14 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Von der Einführung des Farbfernsehens bis zum Mauerfall, von Rosemarie Nitribitt bis Rainer Barschel, von den ›Hitler-Tagebüchern‹ bis zur Rechtschreibreform – Isabel Kreitz hat prägende Ereignisse deutscher Nachkriegsgeschichte in faszinierende Bildergeschichten von je einer Seite umgesetzt. Sie verpackt die große Geschichte in kleine Geschichten, kreiert Szenen, in denen sich zeigt, wie Historie den Alltag der Bürger veränderte – sei es für einen Tag, sei es für ein ganzes Leben."
Verlagswerbung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 22:10 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit etwa 600 Millionen Teilen ist das ehemalige Stasi-Archiv wohl das größte Puzzle der Welt. Um aus den Papierschnitzeln die in den letzten Tagen der DDR hastig zerrissenen Spitzelakten wiederherzustellen, wurde am Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) der E-Puzzler entwickelt, ein Computersystem, das die einzelnen Fragmente analysiert und – in den meisten Fällen – wieder korrekt zusammensetzt. Nach dem erfolgreichen Start des Stasi-Aufarbeitungsprojekts soll diese Technologie nun unter dem Stichwort „Kulturrekonstruktion“ weiter genutzt werden.
Eines der nächsten Großprojekte, in dem das Verfahren zum Einsatz kommen soll, ist die virtuelle Rettung des eingestürzten Kölner Stadtarchivs, in dem mehrere Kilometer dicht gestapelter Dokumente unter Schlamm und Trümmern begraben wurden.
Die Vorbereitung zur virtuellen Rekonstruktion erfordert freilich noch jede Menge Handarbeit: Die Einzelteile müssen auseinandergeklaubt und eingescannt werden, ehe der E-Puzzler seine Arbeit aufnehmen kann. Im Fall der Stasi-Archive handelte es sich um 15.000 Säcke mit Papierschnitzel, wobei einzelne Seiten mit offenbar besonders brisantem Inhalt in 50 und mehr Stücke zerrissen wurden.
„Der E-Puzzler ist eine von uns selbst entwickelte Rekonstruktionssoftware, die mit komplexen Algorithmen der Bildverarbeitung und der Mustererkennung Papierfragmente automatisiert zu vollständigen Seiten zusammensetzt“, beschreibt Bertram Nickolay, Abteilungsleiter für Sicherheitstechnik am IPK, das Herzstück des Systems. So werden verschiedene Merkmale wie etwa Linienmuster, Papierstrukturen, Risskanten und Schriftzeichen extrahiert und gespeichert, und dann mit anderen Fragmenten verglichen. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird das Ergebnis gespeichert, und später, wenn neue Scans hinzugekommen sind, erneut in die Analyse miteinbezogen.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie sind vielfältig. So lässt sich das Verfahren beispielsweise in der Verbrechensbekämpfung einsetzen, um geschredderte Notizen wiederherzustellen, in Südamerika und Nordafrika sind bereits Regierungen an das IPK herangetreten, um mithilfe des E-Puzzlers die Missetaten früherer Regimes aufzudecken.
Über 2,5- zur 3-D-Rekonstruktion
Aber auch in der klassischen Archäologie sieht Nickolay ein breites Einsatzgebiet. So können zerfallene, ägyptische Papyrusrollen durch den E-Puzzler wieder lesbar gemacht werden, aber auch die Rekonstruktion dreidimensionaler Objekte wie etwa Skulpturen oder gar Bauwerke ist mit diesem Verfahren denkbar. Derzeit arbeiten die Forscher am IPK noch an den entsprechenden Algorithmen, wobei einen wichtigen Zwischenschritt die sogenannte 2,5-D-Rekonstruktion darstellt. Von zerbrochenen Steintafeln oder Wandfresken wird die Oberfläche zweidimensional abfotografiert und um die zugehörigen Tiefeninformationen ergänzt. „Aus mehreren 2,5-D-Aufnahmen, die alle Bereiche der Oberfläche eines Objekts abbilden, können in einem weiteren Schritt vollständige 3-D-Objekte gebildet werden“, erklärt Nickolay. Vereinfacht könnte dieser Prozess in Zukunft durch neue Scan-Methoden, die die Objekte gleich dreidimensional erfassen.
Letztendlich denkt man am Fraunhofer Institut aber auch über eine kommerzielle Verwertung nach und sucht in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien nach Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodellen. Schon jetzt arbeitet das IPK mit zahlreichen Unternehmen wie SAP oder dem österreichischen Sicherheitsdienstleister SEC Consulting bei der Weiterentwicklung und möglichen Vermarktung der Forschungsergebnisse eng zusammen."
Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2011
Eines der nächsten Großprojekte, in dem das Verfahren zum Einsatz kommen soll, ist die virtuelle Rettung des eingestürzten Kölner Stadtarchivs, in dem mehrere Kilometer dicht gestapelter Dokumente unter Schlamm und Trümmern begraben wurden.
Die Vorbereitung zur virtuellen Rekonstruktion erfordert freilich noch jede Menge Handarbeit: Die Einzelteile müssen auseinandergeklaubt und eingescannt werden, ehe der E-Puzzler seine Arbeit aufnehmen kann. Im Fall der Stasi-Archive handelte es sich um 15.000 Säcke mit Papierschnitzel, wobei einzelne Seiten mit offenbar besonders brisantem Inhalt in 50 und mehr Stücke zerrissen wurden.
„Der E-Puzzler ist eine von uns selbst entwickelte Rekonstruktionssoftware, die mit komplexen Algorithmen der Bildverarbeitung und der Mustererkennung Papierfragmente automatisiert zu vollständigen Seiten zusammensetzt“, beschreibt Bertram Nickolay, Abteilungsleiter für Sicherheitstechnik am IPK, das Herzstück des Systems. So werden verschiedene Merkmale wie etwa Linienmuster, Papierstrukturen, Risskanten und Schriftzeichen extrahiert und gespeichert, und dann mit anderen Fragmenten verglichen. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird das Ergebnis gespeichert, und später, wenn neue Scans hinzugekommen sind, erneut in die Analyse miteinbezogen.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie sind vielfältig. So lässt sich das Verfahren beispielsweise in der Verbrechensbekämpfung einsetzen, um geschredderte Notizen wiederherzustellen, in Südamerika und Nordafrika sind bereits Regierungen an das IPK herangetreten, um mithilfe des E-Puzzlers die Missetaten früherer Regimes aufzudecken.
Über 2,5- zur 3-D-Rekonstruktion
Aber auch in der klassischen Archäologie sieht Nickolay ein breites Einsatzgebiet. So können zerfallene, ägyptische Papyrusrollen durch den E-Puzzler wieder lesbar gemacht werden, aber auch die Rekonstruktion dreidimensionaler Objekte wie etwa Skulpturen oder gar Bauwerke ist mit diesem Verfahren denkbar. Derzeit arbeiten die Forscher am IPK noch an den entsprechenden Algorithmen, wobei einen wichtigen Zwischenschritt die sogenannte 2,5-D-Rekonstruktion darstellt. Von zerbrochenen Steintafeln oder Wandfresken wird die Oberfläche zweidimensional abfotografiert und um die zugehörigen Tiefeninformationen ergänzt. „Aus mehreren 2,5-D-Aufnahmen, die alle Bereiche der Oberfläche eines Objekts abbilden, können in einem weiteren Schritt vollständige 3-D-Objekte gebildet werden“, erklärt Nickolay. Vereinfacht könnte dieser Prozess in Zukunft durch neue Scan-Methoden, die die Objekte gleich dreidimensional erfassen.
Letztendlich denkt man am Fraunhofer Institut aber auch über eine kommerzielle Verwertung nach und sucht in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien nach Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodellen. Schon jetzt arbeitet das IPK mit zahlreichen Unternehmen wie SAP oder dem österreichischen Sicherheitsdienstleister SEC Consulting bei der Weiterentwicklung und möglichen Vermarktung der Forschungsergebnisse eng zusammen."
Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2011
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 22:06 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein türkisch-deutsches Theaterprojekt des Stadtarchivs Nürnberg, des Bildungszentrums und des Staatstheaters Nürnberg mit Unterstützung des Amtes für Kultur und Freizeit Sie kamen als „Gastarbeiter“ vor 50 Jahren nach Nürnberg.
Doch viele Türkinnen und Türken kehrten nicht wieder in ihre Heimat zurück, sondern holten ihre Familien nach, viele Kinder kamen erst hier zur Welt. Was ist aus diesen Menschen geworden?
Wie war das vor 50 Jahren? Wie sieht das Leben der so genannten Deutsch-Türken heute aus? Leiden sie noch unter dem „Culture Clash“? Was weiß die dritte Generation von den Anfängen ihrer Großeltern?
Die Kulturwissenschaftlerin und Regisseurin Jessica Glause ist zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Bildungszentrum" diesen Fragen nachgegangen, hat vor Ort recherchiert und daraus gemeinsam mit türkischen Zeitzeugen und dem Staatstheater Nürnberg ein Stück entwickelt.
Mit: Josephine Köhler, Marion Schweizer, Julian Keck,
Rainer Matschuck und Sabri Yaman.
Uraufführung am 1. Dezember 2011, um 20.15 Uhr, Blue Box,
Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner Platz 2
Einführungsmatinee am 27. November 2011, um 11 Uhr, Blue Box"
Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, Flyer
Doch viele Türkinnen und Türken kehrten nicht wieder in ihre Heimat zurück, sondern holten ihre Familien nach, viele Kinder kamen erst hier zur Welt. Was ist aus diesen Menschen geworden?
Wie war das vor 50 Jahren? Wie sieht das Leben der so genannten Deutsch-Türken heute aus? Leiden sie noch unter dem „Culture Clash“? Was weiß die dritte Generation von den Anfängen ihrer Großeltern?
Die Kulturwissenschaftlerin und Regisseurin Jessica Glause ist zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Bildungszentrum" diesen Fragen nachgegangen, hat vor Ort recherchiert und daraus gemeinsam mit türkischen Zeitzeugen und dem Staatstheater Nürnberg ein Stück entwickelt.
Mit: Josephine Köhler, Marion Schweizer, Julian Keck,
Rainer Matschuck und Sabri Yaman.
Uraufführung am 1. Dezember 2011, um 20.15 Uhr, Blue Box,
Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner Platz 2
Einführungsmatinee am 27. November 2011, um 11 Uhr, Blue Box"
Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, Flyer
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:55 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In Kooperation mit dem Landesarchiv Schleswig-Holstein und der Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, findet am 27. Oktober 2011 um 20 Uhr in der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund eine Podiumsdiskussion zwischen Archivaren und Kulturwissenschaftlern statt:
„Wissen ist Macht“ – dieser Satz wird in unserer Informationsgesellschaft immer bedeutender. Archive sind die Wissensspeicher und zentrale Faktoren modernen Wissensmanagements.
Nachgegangen werden soll der Frage, ob sie daher auch Macht hätten – und ggf. welcher Art diese sei. Zudem soll die daraus resultierende Bedeutung für unsere Gesellschaft erörtert werden. Ein neues Verständnis von Archiven in der Postmoderne betont eine bislang unbeachtete Facette dieser in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Institutionen – vor diesem Hintergrund werden erstmals in einer interdisziplinären, vom Landesarchiv Schleswig-Holstein, der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin und von der Universität der Künste Berlin ausgerichteten Podiumsdiskussion Archivare, Archivwissenschaftler und Historiker zusammengebracht, um über diese Fragen zu diskutieren. Im Mittelpunkt soll anhand von konkreten Beispielen das Spannungsverhältnis von Macht und Ohnmacht stehen, das sich mit Blick auf die Archive in vielen Aspekten zeigt.
Die Einführung und Moderation übernimmt Prof. Dr. Martin Dinges. An der Diskussion nehmen Prof. Dr. Knut Ebeling, Prof. Dr. Rainer Hering, Prof. Dr. Robert Kretzschmar sowie Dr. Dietmar Schenk teil. Die Teilnahme ist nur für persönlich eingeladene Gäste nach Anmeldung möglich."
Quelle: datensicherheit.de, 20.10.2011
„Wissen ist Macht“ – dieser Satz wird in unserer Informationsgesellschaft immer bedeutender. Archive sind die Wissensspeicher und zentrale Faktoren modernen Wissensmanagements.
Nachgegangen werden soll der Frage, ob sie daher auch Macht hätten – und ggf. welcher Art diese sei. Zudem soll die daraus resultierende Bedeutung für unsere Gesellschaft erörtert werden. Ein neues Verständnis von Archiven in der Postmoderne betont eine bislang unbeachtete Facette dieser in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Institutionen – vor diesem Hintergrund werden erstmals in einer interdisziplinären, vom Landesarchiv Schleswig-Holstein, der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin und von der Universität der Künste Berlin ausgerichteten Podiumsdiskussion Archivare, Archivwissenschaftler und Historiker zusammengebracht, um über diese Fragen zu diskutieren. Im Mittelpunkt soll anhand von konkreten Beispielen das Spannungsverhältnis von Macht und Ohnmacht stehen, das sich mit Blick auf die Archive in vielen Aspekten zeigt.
Die Einführung und Moderation übernimmt Prof. Dr. Martin Dinges. An der Diskussion nehmen Prof. Dr. Knut Ebeling, Prof. Dr. Rainer Hering, Prof. Dr. Robert Kretzschmar sowie Dr. Dietmar Schenk teil. Die Teilnahme ist nur für persönlich eingeladene Gäste nach Anmeldung möglich."
Quelle: datensicherheit.de, 20.10.2011
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:49 - Rubrik: Veranstaltungen

Der Lesesaal ist nicht groß, aber gemütlich. Vier Nutzer finden Platz. Quelle: Nomen obscurum, 18.10.2011, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
"Das Hohenlohe-Zentralarchiv auf Schloss Neuenstein verwahrt die Überlieferung aller hohenlohischen Territorien aus der Zeit des Alten Reichs. Die umfangreichen Bestände bieten reichhaltiges Material zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte des hohenlohischen Landes, des fränkischen Reichskreises, des Reiches und seiner Institutionen wie auch des Adels im allgemeinen. Nach der Mediatisierung der hohenlohischen Fürstentümer 1806 blieb den einzelnen Linien ein umfangreicher Grundbesitz, dessen Verwaltung den Schwerpunkt der späteren Überlieferung ausmacht. Nachlässe zu vielen Mitgliedern des Hauses Hohenlohe ergänzen die Überlieferung.
Mit annähernd fünf laufenden Kilometern Archivgut gehört das Hohenlohe-Zentralarchiv zu den größten Privatarchiven Deutschlands. Das Archivgut ist Eigentum des Gesamthauses Hohenlohe und wird vom Landesarchiv Baden-Württemberg fachlich betreut. Die Nutzung des Hohenlohe-Zentralarchivs steht allen interessierten Wissenschaftlern wie auch Heimat- und Familienforschern offen.
Dieses Album entstand im Sommer 2011 als Begleitprodukt einer Projektarbeit zur Erschließung des Partikulararchivs Oehringen. Aus dessen Beständen stammen auch die meisten Beispiele.
Hohenlohe-Zentralarchiv: http://www.landesarchiv-bw.de/web/47260"
Link zur Dia-Show
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:41 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Bilbiothekenlandschaft in Leipzig zeichnet sich vor allem durch ein breites, vielfältiges und zum Teil sehr extravagantes Angebot aus. Den eigenen Horizont erweitern, egal zu welchem Interessengebiet - dafür bietet die mannigfältige Bücherlandschaft Leipzigs eine Garantie. Ein Beispiel ist das Rosa Archiv. ... Zudem bietet die Leipziger Bibliothekenlandschaft allerlei innovative Konzepte, die sich den verschiedenen gesellschaftlichen Bedürfnissen annehmen.
Eine weitere Besonderheit stellt die 1894 gegründete "Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig" dar, die erste ihrer Art in Deutschland. Hier wird Blinden und Sehbehinderten ein breites Sortiment von Hörbüchern und Literatur in Punktschrift geboten.
Andere spezielle Interessengebiete werden zum Beispiel durch die "Umweltbibliothek Leipzig", die "Geographische Zentralbibliothek" oder die "Frauenbibliothek MONAliesA" abgedeckt. Zudem bieten die zahlreichen städtischen Bibliotheken ein umfangreiches Informationsangebot.
So liegt der Fokus des "Rosa Archiv Leipzigs", welches vor 25 Jahren von Jürgen Zehnle gegründet wurde, auf sexualwissenschaftlichen Themen, insbesondere auf Homosexualität, sowie HIV und AIDS. Die Bibliothek befindet sich in zentraler Lage und steht Interessenten montags bis freitags zur Verfügung.
mephisto 97.6 Reporterin Laura Perschon sprach mit Jürgen Zehnle über die außergewöhnliche Bibliothek "Rosa Archiv" "
Link zum Radiobeitrag
Eine weitere Besonderheit stellt die 1894 gegründete "Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig" dar, die erste ihrer Art in Deutschland. Hier wird Blinden und Sehbehinderten ein breites Sortiment von Hörbüchern und Literatur in Punktschrift geboten.
Andere spezielle Interessengebiete werden zum Beispiel durch die "Umweltbibliothek Leipzig", die "Geographische Zentralbibliothek" oder die "Frauenbibliothek MONAliesA" abgedeckt. Zudem bieten die zahlreichen städtischen Bibliotheken ein umfangreiches Informationsangebot.
So liegt der Fokus des "Rosa Archiv Leipzigs", welches vor 25 Jahren von Jürgen Zehnle gegründet wurde, auf sexualwissenschaftlichen Themen, insbesondere auf Homosexualität, sowie HIV und AIDS. Die Bibliothek befindet sich in zentraler Lage und steht Interessenten montags bis freitags zur Verfügung.
mephisto 97.6 Reporterin Laura Perschon sprach mit Jürgen Zehnle über die außergewöhnliche Bibliothek "Rosa Archiv" "
Link zum Radiobeitrag
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:36 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"..... Eine konkrete Gefahr für das Vermächtnis des Menschen sieht Kerstin Schenke dennoch nicht. Die Archivarin arbeitet für das Bundesarchiv in Koblenz und berät Behörden beim Umgang mit elektronischen Akten. Die ersten vollständig digitalen Nachlässe von Privatpersonen seien bereits im Bundesarchiv eingegangen, sagt sie. Die Archive sind längst dabei, sich auf das Zeitalter der E-Akten einzustellen, denn auch Behörden werden in Zukunft vermehrt digitale Unterlagen weiterreichen. Das Problem mit unterschiedlichen Formaten und Datenträgern ist bekannt. Das Bundesarchiv nimmt elektronische Daten vor allem in einem Format namens Pdf/A auf. „Das ist ein Iso-Standard, der über lange Zeit stabil bleibt“, sagt Kerstin Schenke. Gespeichert wird sowohl auf Festplatten als auch auf Magnetbändern.
Die elektronische Bearbeitung führt in den Behörden ebenfalls zu einer Vermehrung der Daten, sagt Kerstin Schenke. Obwohl digitale Daten weniger Platz einnehmen, wird das Bundesarchiv weiterhin aussortieren. Nur, was historisch relevant ist, wird aufbewahrt. Momentan kämpfe man allerdings eher noch mit einer Revolution der 70er Jahre: Damals ließ das Kopiergerät die Akten anschwellen."
Quelle: Anna Sauerbrey, Tagesspiegl, 22.10.11
Die elektronische Bearbeitung führt in den Behörden ebenfalls zu einer Vermehrung der Daten, sagt Kerstin Schenke. Obwohl digitale Daten weniger Platz einnehmen, wird das Bundesarchiv weiterhin aussortieren. Nur, was historisch relevant ist, wird aufbewahrt. Momentan kämpfe man allerdings eher noch mit einer Revolution der 70er Jahre: Damals ließ das Kopiergerät die Akten anschwellen."
Quelle: Anna Sauerbrey, Tagesspiegl, 22.10.11
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:31 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Gesamtprojekt Landesarchiv NRW besteht aus drei wesentlichen Programmbauteilen, die funktional und im Wachstum miteinander verbunden sind: Speicherflächen, Büro- und Werkstattflächen des Landesarchivs, sowie zunächst fremdgenutzte Büroflächen, die später zu weiteren Archivflächen umgenutzt werden. Die Herausforderung ist die Wandlungs- fähigkeit einer Gebäudestruktur, die als Ganzes errichtet werden soll und sukzessive umgewandelt werden kann.
Maßstabsgebender Auftakt in Volumen, Gliederung und Höhe ist der historische RWSG-Speicher. Er ist wird in seiner Erscheinung im Wesentlichen unverändert belassen. Ein skulpturaler Neubaukörper bildet sowohl den Bezug zum Speicher als auch zu den anschließenden kammartigen Bürostrukturen im Innenhafen. Die Verbindung von altem und neuem Speicher, von denkmalgeschützter und moderner Architektur, liefert dem Landesarchiv eine spannungsvolle Erscheinung.
Besondere räumliche Gegebenheiten des historischen Speichers werden mit öffentlichen Nutzungen versehen. So lagern sich im Erdgeschoss Foyer-, Ausstellungsbereiche und die Lesesäle an. Im Dachgeschoss wird ein großzügiger Konferenzbereich ausgebildet, der einen guten Blick über die Stadt ermöglicht. Die Bürobereiche der Archivmitarbeiter liegen als verbindendes Bauteil genau im Zentrum zwischen den Magazinflächen im alten Speicher und denen im Neubauteil. Ein zentraler Erschließungsflur durchzieht als Rückgrat alle Geschosse und Gebäudeteile.
Das Material und die Erscheinung der Fassaden stellen Alt- und Neubau in einen spannungsvollen Kontrast und sind doch aufeinander abgestimmt. Dabei wird der historische Speicher mit seinen Ziegelfassaden weitestgehend so belassen und der Neubau im Sinne einer modernen Interpretation des Speichers mit einer changierenden Metallfassade verkleidet. Die Hauptgebäude von historischem Speicher und Neubau werden durch drei große fensterartige Einschnitte nuanciert, nach Lage unterschieden, in der Ausstrahlung verbunden. Die Ausgestaltung diese Einschnitte ist nach Auffassung der Verfasser eine kulturelle Aufgabe. Sie können in unterschiedlicher Form bespielt werden. Von rein farbigen künstlerischen Gestaltungen über historische Zitate bis zu programmierbaren Lichtinstallationen sind unterschiedliche Ausformungen möglich. Hier gehen die präzise Plastizität der Baukörper, der kostbare Inhalt und die kulturelle Botschaft Hand in Hand und strahlen über Hafen, Stadt, Region und Land.
PROJEKTDATEN
Auftraggeber
Kölbl Kruse GmbH, Essen
Planungs- und Bauzeit
Gutachterverfahren mit drei geladenen Architekturbüros
Planung 2007
Größe
BGF Bestand: 11.750 qm
BGF Neubau: 21.200 qm
Mitarbeiter
Zafer Bildir, Richart Büsching, Christian Dieckmann, Ulrich Hundsdörfer, Rüdiger Hundsdörfer, Till Hoinkis, Dorothee Heidrich, Sabine Kovacs, Christoph Lajendäcker, Valentin Niessen, Steffen Wurzbacher"
Quelle: Homepage ASTOC
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:20 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Monika Mann in den 1940er Jahren in Pacific Palisades
"Die Monacensia, Literaturarchiv und Bibliothek München, präsentiert auf diesen Seiten erstmals einen Nachlass vollständig in digitalisierter Form. 120 Briefe, annähernd 400 Manuskripte und 17 Fotos von Monika Mann sind im Maßstab 1 zu 1 im hochauflösenden, einwandfrei lesbarem Format einsehbar. Der Zugang steht jedem Interessierten ohne Einschränkung offen und ist kostenfrei. ....."
 Signatur: Monacensia, MM 1
Signatur: Monacensia, MM 1Quelle: http://www.mann-digital.de/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 21:07 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach wie vor sind Jaffés Regesta pontificum Romanorum ein unverzichtbares Hilfsmittel für Historiker des frühen und hohen Mittelalters. Seit längerem (vgl. auch die Anzeige in Archivalia) gibt es im "Virtuellen Lesesaal" der MGH-Bibliothek ein gut nutzbares Digitalisat.
Allerdings kann man in diesem nur nach Seitenzahlen navigieren, zitiert wird der Jaffé aber ausnahmslos nach Regestennummer mit vorangestelltem Kürzel der jeweiligen Bearbeiter.
Um sich das mühsame Hin- und Herblättern in den Bänden zu ersparen, kann man jetzt ein Hilfsmittel verwenden, das Annette Grabowsky erstellt hat: eine Liste mit Direktlinks in Hunderterschritten. Das heißt, wenn man eine Nummer sucht, muss man in der Regel nur noch wenig Klicken, bis man an der gewünschten Stelle ist.
Allerdings kann man in diesem nur nach Seitenzahlen navigieren, zitiert wird der Jaffé aber ausnahmslos nach Regestennummer mit vorangestelltem Kürzel der jeweiligen Bearbeiter.
Um sich das mühsame Hin- und Herblättern in den Bänden zu ersparen, kann man jetzt ein Hilfsmittel verwenden, das Annette Grabowsky erstellt hat: eine Liste mit Direktlinks in Hunderterschritten. Das heißt, wenn man eine Nummer sucht, muss man in der Regel nur noch wenig Klicken, bis man an der gewünschten Stelle ist.
Clemens Radl - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 15:19 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zfda.de/beitrag.php?id=978
Naja. Diese Mäkelei greift zu kurz und gefällt mir nicht. Ich meine: Auch nicht-katalogisierte Handschriften haben digitalisiert einen Wert. Ein nationales Portal für Handschriftendigitalisate zu fordern ist völlig rückständig. Für deutschsprachige Handschriften wäre auf den Handschriftencensus hinzuweisen gewesen, für lateinische muss zwingend von Anfang an auf eine internationale Metasuche gesetzt werden. Nicht angesprochen wird die Frage der Auflösung, die wirklich zentral ist.
Naja. Diese Mäkelei greift zu kurz und gefällt mir nicht. Ich meine: Auch nicht-katalogisierte Handschriften haben digitalisiert einen Wert. Ein nationales Portal für Handschriftendigitalisate zu fordern ist völlig rückständig. Für deutschsprachige Handschriften wäre auf den Handschriftencensus hinzuweisen gewesen, für lateinische muss zwingend von Anfang an auf eine internationale Metasuche gesetzt werden. Nicht angesprochen wird die Frage der Auflösung, die wirklich zentral ist.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 14:25 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die SLUB Dresden bildet sich unendlich viel auf ihre digitalen Angebote ein, bietet aber ein Minimum an Benutzerfreundlichkeit. Selbst die BSB übertrifft mit ihren gravierenden Mängeln locker die Dresdener Zumutungen.
Nicht nur, dass Digitalisate verschwunden sind und alte URLs ohne Weiterleitung nicht mehr funktionieren.
Nicht nur, dass es etwa ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis nach dem Relaunch der Website im letzten Jahr wieder ein RSS-Feed für die neuen Digitalisate zur Verfügung stand.
Die Benutzeroberfläche der Digitalisate ist absolut nicht eingängig. Wie man an die kompletten Metadaten gelangt, wissen nur erfahrene Benutzer.
Zeitweilig ist man auf die Idee gekommen, zitierbare/permanente/persistente/was auch immer Internetadressen für Einzelseiten anzubieten. Auch hier hat man sich überlegt, wie man dem Benutzer am geringsten entgegenkommen kann und eine wahrhaft geniale Lösung gefunden. Diese Adressen sind nicht etwa anklickbar und nicht einfach aus der persistenten URL des Bandes abgeleitet.
http://digital.slub-dresden.de/id324444737/17
funktioniert zwar, steht aber nicht auf dem Scan. Dort steht
http://digital.slub-dresden.de/ppn324444737/17
Besonders gut macht sich schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund. Und als I-Tüpfelchen tritt man auch Leuten mit schlechten Augen vors Schienbein, denn in der Vergrößerungsstufe verschwinden die Seiten-URLs!
Früher konnte man eine Liste der digitalisierten Handschriften nach Signaturen abrufen. Das ging dann nach dem Relaunch nicht mehr. Und nun gibt es auch keine Kollektion Handschriften mehr:
http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/kollektionen/
Die aufgeblasenen Dresdener Digitalisierer werden vermutlich versichern, dass irgendwann in den nächsten Jahren unter den "Ausgewählten Kollektionen" auch die Handschriften wieder vertreten sein werden. Wenn München oder Heidelberg oder Karlsruhe usw. es schaffen, eine Liste der digitalisierten Handschriften mit Schlagzeile ins Netz zu stellen, die dem elementaren Bedürfnis des Benutzers entgegenkommt, einfach zu wissen, welche Handschriften digitalisiert sind und zwar möglichst getrennt nach Handschriftengruppen, dann setzt sich die SLUB zum Ziel, dem Wissenschaftler die Arbeit möglichst zu erschweren.
Nicht nur, dass Digitalisate verschwunden sind und alte URLs ohne Weiterleitung nicht mehr funktionieren.
Nicht nur, dass es etwa ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis nach dem Relaunch der Website im letzten Jahr wieder ein RSS-Feed für die neuen Digitalisate zur Verfügung stand.
Die Benutzeroberfläche der Digitalisate ist absolut nicht eingängig. Wie man an die kompletten Metadaten gelangt, wissen nur erfahrene Benutzer.
Zeitweilig ist man auf die Idee gekommen, zitierbare/permanente/persistente/was auch immer Internetadressen für Einzelseiten anzubieten. Auch hier hat man sich überlegt, wie man dem Benutzer am geringsten entgegenkommen kann und eine wahrhaft geniale Lösung gefunden. Diese Adressen sind nicht etwa anklickbar und nicht einfach aus der persistenten URL des Bandes abgeleitet.
http://digital.slub-dresden.de/id324444737/17
funktioniert zwar, steht aber nicht auf dem Scan. Dort steht
http://digital.slub-dresden.de/ppn324444737/17
Besonders gut macht sich schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund. Und als I-Tüpfelchen tritt man auch Leuten mit schlechten Augen vors Schienbein, denn in der Vergrößerungsstufe verschwinden die Seiten-URLs!
Früher konnte man eine Liste der digitalisierten Handschriften nach Signaturen abrufen. Das ging dann nach dem Relaunch nicht mehr. Und nun gibt es auch keine Kollektion Handschriften mehr:
http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/kollektionen/
Die aufgeblasenen Dresdener Digitalisierer werden vermutlich versichern, dass irgendwann in den nächsten Jahren unter den "Ausgewählten Kollektionen" auch die Handschriften wieder vertreten sein werden. Wenn München oder Heidelberg oder Karlsruhe usw. es schaffen, eine Liste der digitalisierten Handschriften mit Schlagzeile ins Netz zu stellen, die dem elementaren Bedürfnis des Benutzers entgegenkommt, einfach zu wissen, welche Handschriften digitalisiert sind und zwar möglichst getrennt nach Handschriftengruppen, dann setzt sich die SLUB zum Ziel, dem Wissenschaftler die Arbeit möglichst zu erschweren.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Oktober 2011, 04:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 18:29 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ernst von Siemens Kunststiftung hat bei einem Pariser Antiquariat ein von Vincenzo Scamozzi eigenhändig annotiertes Exemplar der ersten Gesamtausgabe (Venedig 1551) von Sebastiano Serlios Büchern zur Architektur erworben und der Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
http://bvbm1.bib-bvb.de/view/custom/DisplayPersistentURL.jsp?pid=2464388
http://scamozzi.zikg.eu/index.php?id=2
http://bvbm1.bib-bvb.de/view/custom/DisplayPersistentURL.jsp?pid=2464388
http://scamozzi.zikg.eu/index.php?id=2
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 18:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nicht unbedingt Unsinn
siehe auch Kommentare von http://archiv.twoday.net/stories/49589203/
"Der 1984 in Weißrussland geborene Publizist Evgeny Morozov ist einer der prominentesten Internetskeptiker. Bekannt wurde er für seinen Widerspruch gegen die populäre Sichtweise, das Internet führe nahezu automatisch zum Sturz und zur Demokratisierung von autoritären Staaten. Unrechtsregime, so Morozov, könnten das Internet genauso effektiv für ihre Zwecke verwenden: zur Überwachung, zur Verbreitung nationalistischer Propaganda und zur Verfolgung von Dissidenten. Morozov ist derzeit Stipendiat an der Universität Stanford."
Autor eines internetskeptischen Artikels in FAZ online:
http://goo.gl/fdq3D
Das Elend der Internetintelektuellen
siehe auch Kommentare von http://archiv.twoday.net/stories/49589203/
"Der 1984 in Weißrussland geborene Publizist Evgeny Morozov ist einer der prominentesten Internetskeptiker. Bekannt wurde er für seinen Widerspruch gegen die populäre Sichtweise, das Internet führe nahezu automatisch zum Sturz und zur Demokratisierung von autoritären Staaten. Unrechtsregime, so Morozov, könnten das Internet genauso effektiv für ihre Zwecke verwenden: zur Überwachung, zur Verbreitung nationalistischer Propaganda und zur Verfolgung von Dissidenten. Morozov ist derzeit Stipendiat an der Universität Stanford."
Autor eines internetskeptischen Artikels in FAZ online:
http://goo.gl/fdq3D
Das Elend der Internetintelektuellen
vierprinzen - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 17:57 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem in MIAMI in den letzten Jahren in Sachen Retrodigitalisierung nichts mehr lief, gibt es nun ein neues Portal:
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/
Es gibt schon viele Werke aus der Barockbibliothek Nünning, der Sammlung Erhard zur Reformationsgeschichte und der Büchersammlung der Freiherrn von Haxthausen. Außerdem viel zur westfälischen Landesgeschichte.
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/
Es gibt schon viele Werke aus der Barockbibliothek Nünning, der Sammlung Erhard zur Reformationsgeschichte und der Büchersammlung der Freiherrn von Haxthausen. Außerdem viel zur westfälischen Landesgeschichte.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 17:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1
Über 50.000 Objekte sind online verfügbar. Man kann auch ein Tagging-Spiel spielen.
Über 50.000 Objekte sind online verfügbar. Man kann auch ein Tagging-Spiel spielen.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 16:48 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pressemitteilung des BGH:
Der Kläger nimmt die Beklagte wegen der Verbreitung einer ehrenrührigen Tatsachenbehauptung im Internet auf Unterlassung in Anspruch.
Die Beklagte mit Sitz in Kalifornien stellt die technische Infrastruktur und den Speicherplatz für eine Website und für die unter einer Webadresse eingerichteten Weblogs (Blogs) zur Verfügung. Hinsichtlich der Blogs, journal- oder tagebuchartig angelegten Webseiten, fungiert die Beklagte als Hostprovider. Ein von einem Dritten eingerichteter Blog enthält unter anderem eine Tatsachenbehauptung, die der Kläger als unwahr und ehrenrührig beanstandet hat.
Das Landgericht hat der Unterlassungsklage hinsichtlich der Verbreitung einer Behauptung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hatte insoweit keinen Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte die angestrebte Klageabweisung weiter.
Der u.a. für das Persönlichkeitsrecht zuständige VI. Zivilsenat hat die Auffassung der Vorinstanzen, dass die deutschen Gerichte international zuständig seien und dass deutsches Recht Anwendung finde, gebilligt.
Zur Frage der Haftung der Beklagten nach deutschem Recht ist die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden. Der Bundesgerichtshof hat die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen ein Hostprovider als Störer für von ihm nicht verfasste oder gebilligte Äußerungen eines Dritten in einem Blog auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann.
Dies setzt voraus, dass der Hostprovider die im Folgenden dargelegten Pflichten verletzt hat:
Ein Tätigwerden des Hostproviders ist nur veranlasst, wenn der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer - das heißt ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung - bejaht werden kann.
Regelmäßig ist zunächst die Beanstandung des Betroffenen an den für den Blog Verantwortlichen zur Stellungnahme weiterzuleiten. Bleibt eine Stellungnahme innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist aus, ist von der Berechtigung der Beanstandung auszugehen und der beanstandete Eintrag zu löschen. Stellt der für den Blog Verantwortliche die Berechtigung der Beanstandung substantiiert in Abrede und ergeben sich deshalb berechtigte Zweifel, ist der Provider grundsätzlich gehalten, dem Betroffenen dies mitzuteilen und gegebenenfalls Nachweise zu verlangen, aus denen sich die behauptete Rechtsverletzung ergibt. Bleibt eine Stellungnahme des Betroffenen aus oder legt er gegebenenfalls erforderliche Nachweise nicht vor, ist eine weitere Prüfung nicht veranlasst. Ergibt sich aus der Stellungnahme des Betroffenen oder den vorgelegten Belegen auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Äußerung des für den Blog Verantwortlichen eine rechtswidrige Verletzung des Persönlichkeitsrechts, ist der beanstandete Eintrag zu löschen.
Durch die Zurückverweisung an das Berufungsgericht wird den Parteien Gelegenheit gegeben, dazu vorzutragen, ob die Beklagte die ihr obliegenden Pflichten erfüllt hat.
Urteil vom 25. Oktober 2011 - VI ZR 93/10
Landgericht Hamburg – Urteil vom 22. Mai 2009 - 325 O 145/08
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Urteil vom 2. März 2010 - 7 U 70/09
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2011&Sort=3&nr=57957&pos=0&anz=169&Blank=1
Der Kläger nimmt die Beklagte wegen der Verbreitung einer ehrenrührigen Tatsachenbehauptung im Internet auf Unterlassung in Anspruch.
Die Beklagte mit Sitz in Kalifornien stellt die technische Infrastruktur und den Speicherplatz für eine Website und für die unter einer Webadresse eingerichteten Weblogs (Blogs) zur Verfügung. Hinsichtlich der Blogs, journal- oder tagebuchartig angelegten Webseiten, fungiert die Beklagte als Hostprovider. Ein von einem Dritten eingerichteter Blog enthält unter anderem eine Tatsachenbehauptung, die der Kläger als unwahr und ehrenrührig beanstandet hat.
Das Landgericht hat der Unterlassungsklage hinsichtlich der Verbreitung einer Behauptung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hatte insoweit keinen Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte die angestrebte Klageabweisung weiter.
Der u.a. für das Persönlichkeitsrecht zuständige VI. Zivilsenat hat die Auffassung der Vorinstanzen, dass die deutschen Gerichte international zuständig seien und dass deutsches Recht Anwendung finde, gebilligt.
Zur Frage der Haftung der Beklagten nach deutschem Recht ist die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden. Der Bundesgerichtshof hat die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen ein Hostprovider als Störer für von ihm nicht verfasste oder gebilligte Äußerungen eines Dritten in einem Blog auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann.
Dies setzt voraus, dass der Hostprovider die im Folgenden dargelegten Pflichten verletzt hat:
Ein Tätigwerden des Hostproviders ist nur veranlasst, wenn der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer - das heißt ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung - bejaht werden kann.
Regelmäßig ist zunächst die Beanstandung des Betroffenen an den für den Blog Verantwortlichen zur Stellungnahme weiterzuleiten. Bleibt eine Stellungnahme innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist aus, ist von der Berechtigung der Beanstandung auszugehen und der beanstandete Eintrag zu löschen. Stellt der für den Blog Verantwortliche die Berechtigung der Beanstandung substantiiert in Abrede und ergeben sich deshalb berechtigte Zweifel, ist der Provider grundsätzlich gehalten, dem Betroffenen dies mitzuteilen und gegebenenfalls Nachweise zu verlangen, aus denen sich die behauptete Rechtsverletzung ergibt. Bleibt eine Stellungnahme des Betroffenen aus oder legt er gegebenenfalls erforderliche Nachweise nicht vor, ist eine weitere Prüfung nicht veranlasst. Ergibt sich aus der Stellungnahme des Betroffenen oder den vorgelegten Belegen auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Äußerung des für den Blog Verantwortlichen eine rechtswidrige Verletzung des Persönlichkeitsrechts, ist der beanstandete Eintrag zu löschen.
Durch die Zurückverweisung an das Berufungsgericht wird den Parteien Gelegenheit gegeben, dazu vorzutragen, ob die Beklagte die ihr obliegenden Pflichten erfüllt hat.
Urteil vom 25. Oktober 2011 - VI ZR 93/10
Landgericht Hamburg – Urteil vom 22. Mai 2009 - 325 O 145/08
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Urteil vom 2. März 2010 - 7 U 70/09
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2011&Sort=3&nr=57957&pos=0&anz=169&Blank=1
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 12:38 - Rubrik: Archivrecht
Annelen Ottermann:
"Wir wollen uns einsetzen für den Verbleib der historisch gewachsenen Sammlung als Ganzes, im städtischen Besitz und nach Möglichkeit im räumlichen Verbund mit dem Stadtarchiv.
Nur wenn wir das Ganze in den Blick nehmen, erhalten wir den Wert und die Gebrauchsfähigkeit unserer Bibliothek.
Wir brauchen den Ensembleschutz für die Handschriftensammlung, die Rara, die Sammlung Moyat, die Kinderbuch- und Spiele-Sammlung Scholz-Mainz, das Peter-Cornelius-Archiv, die Theaterbibliothek, die Klosterprovenienzen und die kurfürstlichen Drucke, die Restbestände der Bibliotheca Palatina, die Stiftungen von Bürgern und Institutionen über 200 Jahre, die Moguntinen und Rhenohassiaca, die Schriften der Mainzer Jakobiner, das von den Alliierten 1945 separierte NS-Schrifttum, die Pflichtexemplare, die moderne Gebrauchsliteratur und die Forschungsbibliothek zu Handschriften und Altbeständen zusammen in den Blick nimmt.
Wenn Sie sich dafür in verschiedenen Gremien, Konstellationen und Organisationen stark machen wollen,
dann richten Sie Ihre Protestnoten gerne an den Oberbürgermeister der Stadt Mainz, an die Kultur- und Baudezernentin der Stadt und an den Direktor der Bibliotheken der Stadt Mainz. Der Protest wir außerdem gebündelt über den Vorsitzenden der Mainzer Bibliotheksgesellschaft: http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de Hier werden demnächst auch Informationen zur Lage der Mainzer Stadtbibliothek eingestellt werden."
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2011-October/date.html
"Wir wollen uns einsetzen für den Verbleib der historisch gewachsenen Sammlung als Ganzes, im städtischen Besitz und nach Möglichkeit im räumlichen Verbund mit dem Stadtarchiv.
Nur wenn wir das Ganze in den Blick nehmen, erhalten wir den Wert und die Gebrauchsfähigkeit unserer Bibliothek.
Wir brauchen den Ensembleschutz für die Handschriftensammlung, die Rara, die Sammlung Moyat, die Kinderbuch- und Spiele-Sammlung Scholz-Mainz, das Peter-Cornelius-Archiv, die Theaterbibliothek, die Klosterprovenienzen und die kurfürstlichen Drucke, die Restbestände der Bibliotheca Palatina, die Stiftungen von Bürgern und Institutionen über 200 Jahre, die Moguntinen und Rhenohassiaca, die Schriften der Mainzer Jakobiner, das von den Alliierten 1945 separierte NS-Schrifttum, die Pflichtexemplare, die moderne Gebrauchsliteratur und die Forschungsbibliothek zu Handschriften und Altbeständen zusammen in den Blick nimmt.
Wenn Sie sich dafür in verschiedenen Gremien, Konstellationen und Organisationen stark machen wollen,
dann richten Sie Ihre Protestnoten gerne an den Oberbürgermeister der Stadt Mainz, an die Kultur- und Baudezernentin der Stadt und an den Direktor der Bibliotheken der Stadt Mainz. Der Protest wir außerdem gebündelt über den Vorsitzenden der Mainzer Bibliotheksgesellschaft: http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de Hier werden demnächst auch Informationen zur Lage der Mainzer Stadtbibliothek eingestellt werden."
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2011-October/date.html
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 12:26 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Informationen und Eindrücke über die Größe des Archivbestandes bekamen interessierte Besucher gestern in Recklinghausen. Anlass der Sonntagsöffnung war die Neueröffnung des Instituts für Stadtgeschichte und des Vestische Archivs. Ein besonderer Anziehungspunkt dabei: Die Ausstellung wertvoller Dokumente, darunter die Stadtgründungsurkunde aus dem Jahr 1236.
Quelle: http://media.wmtv-online.de/
Wolf Thomas - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 11:33 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Siehe die ausführliche Meldung
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18188
Vorarlberg, Tirol und das Burgenland haben keine Archivgesetze.
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18188
Vorarlberg, Tirol und das Burgenland haben keine Archivgesetze.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 01:06 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christoph Schnabel, Referent beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, behandelt in K & R 2011, S. 626-631 ein Thema, das uns auch hier immer wieder beschäftigte:
http://archiv.twoday.net/search?q=ifg+urhg
Den Ergebnissen von Schnabel ist zuzustimmen. Sie liegen auf der Linie der Position wohl der meisten Informationsfreiheitsbeauftragten.
Zunächst schließt Schnabel bei den Rechten, für die die sog. Registeröffentlichkeit gilt (z.B. Patentrecht), einen Geheimhaltungsanspruch aus. Hinsichtlich des Urheberrechts schließt er sich der herrschenden Meinung an, wonach die Behörde nicht für ihr eigenes geistiges Eigentum Vorbehalte geltend machen kann, die der Einsicht entgegenstünden.
Bei Werken Dritter argumentiert Schnabel mit dem EuGH-Urteil, das eine Verbreitung nur dann bejaht, wenn ein Eigentumsübergang erfolgt. Die Gewährung bloßer Einsichtnahme sei keine urheberrechtliche Verbreitung. Privatkopien dürften vom Benutzer gemacht werden, ohne dass die Behörde verpflichtet sei, deren Voraussetzungen zu prüfen.
Eine Anwendung von § 45 UrhG bei der Abgabe von Kopien sei keineswegs zirkelschlüssig. Recht kurz wird die brisante Frage, ob die Einsichtsgewährung eine dem Urheber vorbehaltene Veröffentlichung darstelle, abgehandelt. Schon die Übergabe an eine IFG-verpflichtete Behörde könne eine Veröffentlichung darstellen.
Der informationsfreiheits-freundliche Aufsatz verdient Beachtung, zumal sich seine Ergebnisse auf die archivrechtliche Frage, ob die bloße Vorlage unveröffentlichter urheberrechtlich geschützter Dokumente zulässig ist, in der Tendenz übertragen lassen. Ich sehe meine hier wiederholt vertretene Position bestätigt.
http://archiv.twoday.net/search?q=ifg+urhg
Den Ergebnissen von Schnabel ist zuzustimmen. Sie liegen auf der Linie der Position wohl der meisten Informationsfreiheitsbeauftragten.
Zunächst schließt Schnabel bei den Rechten, für die die sog. Registeröffentlichkeit gilt (z.B. Patentrecht), einen Geheimhaltungsanspruch aus. Hinsichtlich des Urheberrechts schließt er sich der herrschenden Meinung an, wonach die Behörde nicht für ihr eigenes geistiges Eigentum Vorbehalte geltend machen kann, die der Einsicht entgegenstünden.
Bei Werken Dritter argumentiert Schnabel mit dem EuGH-Urteil, das eine Verbreitung nur dann bejaht, wenn ein Eigentumsübergang erfolgt. Die Gewährung bloßer Einsichtnahme sei keine urheberrechtliche Verbreitung. Privatkopien dürften vom Benutzer gemacht werden, ohne dass die Behörde verpflichtet sei, deren Voraussetzungen zu prüfen.
Eine Anwendung von § 45 UrhG bei der Abgabe von Kopien sei keineswegs zirkelschlüssig. Recht kurz wird die brisante Frage, ob die Einsichtsgewährung eine dem Urheber vorbehaltene Veröffentlichung darstelle, abgehandelt. Schon die Übergabe an eine IFG-verpflichtete Behörde könne eine Veröffentlichung darstellen.
Der informationsfreiheits-freundliche Aufsatz verdient Beachtung, zumal sich seine Ergebnisse auf die archivrechtliche Frage, ob die bloße Vorlage unveröffentlichter urheberrechtlich geschützter Dokumente zulässig ist, in der Tendenz übertragen lassen. Ich sehe meine hier wiederholt vertretene Position bestätigt.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 00:42 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Frankreich wollen sich Juristen und Historiker darauf vorbereiten. Eine kommentierte Ausgabe, die Open Access zur Verfügung steht, ist aus meiner Sicht einem teuren Buchhandelsprodukt vorzuziehen, will man den E-Text nicht brauen Rattenfängern überlassen.
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/9922
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/9922
KlausGraf - am Dienstag, 25. Oktober 2011, 00:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Offizielle Website:
http://www.openaccessweek.org/
Es gibt dieses Mal noch nicht einmal mehr eine Übersicht der deutschen Teilnehmer. Open-access.net verweist nur auf die internationale Seite, bei der ein Filtern nach Land nicht vorgesehen ist. Die Suche nach Germany erbringt gerade mal 6 Treffer.
Einige deutsche Teilnehmer bringt die folgende Google-Suche zu Tage:
http://goo.gl/iEKyP
Meine Beiträge zur Open-Access-Woche 2010:
http://archiv.twoday.net/stories/8404435/
***
In Telepolis plädiert Oliver Tacke für Open Science:
http://www.heise.de/tp/artikel/35/35760/1.html
Es geht nicht um das Präsentieren von fertigen Inhalten, sondern um das Erstellen, Prüfen, Verbessern dieser Inhalte durch Forscher, Praktiker und begeisterte Amateure. Wer an der Entwicklung von Wissen mitwirkt, versteht viel besser, was Wissenschaft eigentlich ausmacht und bedeutet. Andersherum bleiben Forscher vielleicht eher auf dem Boden der Tatsachen und erhalten so den Blick für das Ganze zurück, der bei ihrer Spezialisierung verloren gegangen sein könnte.
***
Einen deutschsprachigen Handbuchbeitrag zu Open Educational Ressources durften die Autoren Open Access in Netz stellen:
http://elearningblog.tugraz.at/archives/4776
***
Ob es Heuchelei sei, wird in den "Stimmen" gefragt, wenn Michael Hagner den grünen Weg von Open Access befürwortet, zugleich aber kaum etwas selbstarchiviert.
http://plan3t.info/2011/10/24/michael-hagner-und-open-access/
***
Überlegungen zur Open-Access-Ökonomie bietet:
http://svpow.wordpress.com/2011/10/22/economics-of-open-source-publishing/
That means the money that Elsevier alone takes out of academia — not its turnover but its profits, which are given to shareholders who have nothing to do with scholarly work — is enough to fund every research article in every field in the world as open access at PLoS ONE’s rate.

http://www.openaccessweek.org/
Es gibt dieses Mal noch nicht einmal mehr eine Übersicht der deutschen Teilnehmer. Open-access.net verweist nur auf die internationale Seite, bei der ein Filtern nach Land nicht vorgesehen ist. Die Suche nach Germany erbringt gerade mal 6 Treffer.
Einige deutsche Teilnehmer bringt die folgende Google-Suche zu Tage:
http://goo.gl/iEKyP
Meine Beiträge zur Open-Access-Woche 2010:
http://archiv.twoday.net/stories/8404435/
***
In Telepolis plädiert Oliver Tacke für Open Science:
http://www.heise.de/tp/artikel/35/35760/1.html
Es geht nicht um das Präsentieren von fertigen Inhalten, sondern um das Erstellen, Prüfen, Verbessern dieser Inhalte durch Forscher, Praktiker und begeisterte Amateure. Wer an der Entwicklung von Wissen mitwirkt, versteht viel besser, was Wissenschaft eigentlich ausmacht und bedeutet. Andersherum bleiben Forscher vielleicht eher auf dem Boden der Tatsachen und erhalten so den Blick für das Ganze zurück, der bei ihrer Spezialisierung verloren gegangen sein könnte.
***
Einen deutschsprachigen Handbuchbeitrag zu Open Educational Ressources durften die Autoren Open Access in Netz stellen:
http://elearningblog.tugraz.at/archives/4776
***
Ob es Heuchelei sei, wird in den "Stimmen" gefragt, wenn Michael Hagner den grünen Weg von Open Access befürwortet, zugleich aber kaum etwas selbstarchiviert.
http://plan3t.info/2011/10/24/michael-hagner-und-open-access/
***
Überlegungen zur Open-Access-Ökonomie bietet:
http://svpow.wordpress.com/2011/10/22/economics-of-open-source-publishing/
That means the money that Elsevier alone takes out of academia — not its turnover but its profits, which are given to shareholders who have nothing to do with scholarly work — is enough to fund every research article in every field in the world as open access at PLoS ONE’s rate.

KlausGraf - am Montag, 24. Oktober 2011, 19:16 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 24. Oktober 2011, 02:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_loves_monuments_2011/Preistr%C3%A4ger_Deutschland
Die Auswahl der Jury überzeugt nicht, es dominiert das Postkartenhafte. Völlig durchschnittliche Bilder wie das von M. Cyron erhielten einen Preis - woran das wohl liegen mag? Wieso muss unter den preisgekrönten Motiven die Burg Eltz vertreten sein? Fachwerkhäuser noch und nöcher, darunter auch eins, das als solches gar nicht erkennbar ist ( Nr. 88). Was ist z.B. an diesem Bild von DerHexer (Wikipedia-Steward) so Besonderes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gie%C3%9Fen-Allendorf_(DerHexer)_WLMMH_61838_2011-09-22_04.jpg
Siegerbild von Memorino: Die Anhäuser Mauer

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Zu Recht zum Landessieger Hessen gekürt: „© DerHexer, Wikimedia Commons, CC-by-sa 3.0“ (mit ätzender Lizenzerläuterung)
commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbach-Frischborn_(DerHexer)_WLMMH_66500_2011-09-18_02.jpg

Die Auswahl der Jury überzeugt nicht, es dominiert das Postkartenhafte. Völlig durchschnittliche Bilder wie das von M. Cyron erhielten einen Preis - woran das wohl liegen mag? Wieso muss unter den preisgekrönten Motiven die Burg Eltz vertreten sein? Fachwerkhäuser noch und nöcher, darunter auch eins, das als solches gar nicht erkennbar ist ( Nr. 88). Was ist z.B. an diesem Bild von DerHexer (Wikipedia-Steward) so Besonderes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gie%C3%9Fen-Allendorf_(DerHexer)_WLMMH_61838_2011-09-22_04.jpg
Siegerbild von Memorino: Die Anhäuser Mauer

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Zu Recht zum Landessieger Hessen gekürt: „© DerHexer, Wikimedia Commons, CC-by-sa 3.0“ (mit ätzender Lizenzerläuterung)
commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbach-Frischborn_(DerHexer)_WLMMH_66500_2011-09-18_02.jpg

Teil I:
http://archiv.twoday.net/stories/49590238/
Schauen wir uns nun mal Quellen und Literatur von
Alexander Schubert, Städtekrieg, 1387/1389, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45561 (10.10.2011)
an. Kein einziger Online-Nachweis, obwohl z.B. das JffL ein offizielles Angebot der BSB ist, von den Retrodigitalisaten der BSB ganz zu schweigen.
Literatur:
Heinz Angermeier, Städtebünde und Landfriede im 14. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 76 (1956), 34-54
Eberhard Holtz, Reichsstädte und Zentralgewalt unter König Wenzel (1376-1400) (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 4), Warendorf 1993.
Theodor Lindner, Zur Geschichte des schwäbischen Städtebundes, in: Forschungen zur deutschen Geschichte 19 (1879), 42-58
http://de.wikisource.org/wiki/Forschungen_zur_Deutschen_Geschichte
Joachim Schneider, "Denn wo das Ende böse ist ...". Gründe und Begründungen für den ersten süddeutschen Städtekrieg in den Äußerungen der Chronisten, in: Horst Brunner (Hg.), Der Krieg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht (Imagines Medii Aevi 3), Wiesbaden 1999, 139-182
Ludwig Schnurrer, König Wenzel und die Reichsstadt Rothenburg, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 34/35 (1974/75), 681-720
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048807/image_748
Alexander Schubert, Der Stadt Nutz oder Notdurft? Die Reichsstadt Nürnberg und der Städtekrieg von 1388/89 (Historische Studien 476), Husum 2003
Theodor Straub, Bayerns Rolle im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler/Andreas Kraus (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte. 2. Band: Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 2. Auflage 1988, 225-232
Martin Weindl, Der Städtekrieg von 1388, in: Peter Morsbach/Peter Brielmaier/Uwe Moosburger (Hg.), Regensburg. Metropole im Mittelalter, Regensburg 2007, 225
Joseph Würdinger, Erster und zweiter Städtekrieg in Schwaben, Franken und am Rhein 1370-1390, in: Jahresbericht des Historischen Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg 33 (1868), 85-136
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333433_00090.html
Joseph Würdinger, Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1347-1506. 1. Band, München 1868
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374387-2
Quellen:
Die Chroniken der Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, hg. von der Historischen Commission bei der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig/Göttingen 1862-1968
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chroniken_der_deutschen_St%C3%A4dte
Julius Weizsäcker (Hg.), Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe. 1.-3. Band: Unter König Wenzel, Gotha u. a. 1867-1877
http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Reichstagsakten
http://archiv.twoday.net/stories/49590238/
Schauen wir uns nun mal Quellen und Literatur von
Alexander Schubert, Städtekrieg, 1387/1389, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45561 (10.10.2011)
an. Kein einziger Online-Nachweis, obwohl z.B. das JffL ein offizielles Angebot der BSB ist, von den Retrodigitalisaten der BSB ganz zu schweigen.
Literatur:
Heinz Angermeier, Städtebünde und Landfriede im 14. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 76 (1956), 34-54
Eberhard Holtz, Reichsstädte und Zentralgewalt unter König Wenzel (1376-1400) (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 4), Warendorf 1993.
Theodor Lindner, Zur Geschichte des schwäbischen Städtebundes, in: Forschungen zur deutschen Geschichte 19 (1879), 42-58
http://de.wikisource.org/wiki/Forschungen_zur_Deutschen_Geschichte
Joachim Schneider, "Denn wo das Ende böse ist ...". Gründe und Begründungen für den ersten süddeutschen Städtekrieg in den Äußerungen der Chronisten, in: Horst Brunner (Hg.), Der Krieg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht (Imagines Medii Aevi 3), Wiesbaden 1999, 139-182
Ludwig Schnurrer, König Wenzel und die Reichsstadt Rothenburg, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 34/35 (1974/75), 681-720
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048807/image_748
Alexander Schubert, Der Stadt Nutz oder Notdurft? Die Reichsstadt Nürnberg und der Städtekrieg von 1388/89 (Historische Studien 476), Husum 2003
Theodor Straub, Bayerns Rolle im Reich und im Städtekrieg, in: Max Spindler/Andreas Kraus (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte. 2. Band: Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 2. Auflage 1988, 225-232
Martin Weindl, Der Städtekrieg von 1388, in: Peter Morsbach/Peter Brielmaier/Uwe Moosburger (Hg.), Regensburg. Metropole im Mittelalter, Regensburg 2007, 225
Joseph Würdinger, Erster und zweiter Städtekrieg in Schwaben, Franken und am Rhein 1370-1390, in: Jahresbericht des Historischen Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg 33 (1868), 85-136
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333433_00090.html
Joseph Würdinger, Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1347-1506. 1. Band, München 1868
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374387-2
Quellen:
Die Chroniken der Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, hg. von der Historischen Commission bei der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig/Göttingen 1862-1968
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chroniken_der_deutschen_St%C3%A4dte
Julius Weizsäcker (Hg.), Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe. 1.-3. Band: Unter König Wenzel, Gotha u. a. 1867-1877
http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Reichstagsakten
KlausGraf - am Sonntag, 23. Oktober 2011, 22:39 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch die neuesten Artikel weisen nicht online verfügbare Quellen und Literatur nach. So sollte man im Artikel zu den Grafen von Kirchberg statt eines völlig überflüssigen unwissenschaftlichen E-Textes eines Lieds des Minnesängers Konrad von Kirchberg beispielsweise das Württembergische Urkundenbuch online oder Stälins Geschichte verlinken:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45827
Beschämend ist, dass man die Bucelin-Ansicht von Kloster Wiblingen in denkbar schlechter Schwarzweißqualität präsentiert. Hatte man kein Geld oder keine Zeit, sich eine Reproduktion der WLB zu besorgen?
Absolut inakzeptabel ist, dass die Quelle für das Aquarell des Wiblinger Epitaphs in der Bildunterschrift nicht genannt wird:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/document/artikel_45827_bilder_value_6_kirchberg5.jpg
[Ein Foto des erhaltenen Grabmals:
http://oberkirchberg.blogspot.com/ ]
Und wieso gibt es keine Stammtafel? Sicher: die "geneaolgischen [SIC] Verhältnisse der Kirchberger sind undurchsichtig" - aber wenigsten für die jüngeren Generationen hätte man eine Stammtafel erwarten dürfen.
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0043?sid=59d995141c67d9350179e5226504c42f Sollte man annehmen, dass es etwas Dümmeres gibt, als diesen Link zu verwenden, wenn die UB Heidelberg eindeutig den permanenten Link vorgibt?
Die BSB stümpert weiter ...
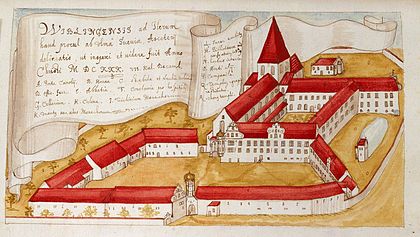
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bucelin_wiblingen.jpg
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45827
Beschämend ist, dass man die Bucelin-Ansicht von Kloster Wiblingen in denkbar schlechter Schwarzweißqualität präsentiert. Hatte man kein Geld oder keine Zeit, sich eine Reproduktion der WLB zu besorgen?
Absolut inakzeptabel ist, dass die Quelle für das Aquarell des Wiblinger Epitaphs in der Bildunterschrift nicht genannt wird:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/document/artikel_45827_bilder_value_6_kirchberg5.jpg
[Ein Foto des erhaltenen Grabmals:
http://oberkirchberg.blogspot.com/ ]
Und wieso gibt es keine Stammtafel? Sicher: die "geneaolgischen [SIC] Verhältnisse der Kirchberger sind undurchsichtig" - aber wenigsten für die jüngeren Generationen hätte man eine Stammtafel erwarten dürfen.
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0043?sid=59d995141c67d9350179e5226504c42f Sollte man annehmen, dass es etwas Dümmeres gibt, als diesen Link zu verwenden, wenn die UB Heidelberg eindeutig den permanenten Link vorgibt?
Die BSB stümpert weiter ...
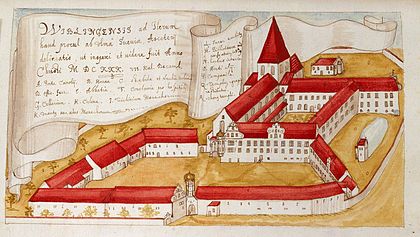
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bucelin_wiblingen.jpg
KlausGraf - am Sonntag, 23. Oktober 2011, 21:26 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Edition Helga Lengenfelder stellte bekanntlich auf ManuMed
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ (Direktlink nicht möglich)
diverse Beihefte als PDFs zur Verfügung. Weitere finden sich unter:
http://www.omifacsimiles.com/cats/lit.html
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ (Direktlink nicht möglich)
diverse Beihefte als PDFs zur Verfügung. Weitere finden sich unter:
http://www.omifacsimiles.com/cats/lit.html
KlausGraf - am Sonntag, 23. Oktober 2011, 18:42 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt RA Marcus Beckmann, der das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags bespricht:
http://www.beckmannundnorda.de/serendipity/index.php?/archives/687-Wissenschaftlicher-Dienst-des-Deutschen-Bundestages-veroeffentlicht-Gutachten-zu-Facebook-Fanpages,-dem-Gefaellt-Mir-Button-und-anderen-Social-Plugins.html
Das Gutachten kommt zu dem Schluss:
"Vielmehr ist das geltende Datenschutzrecht von Unsicherheiten geprägt und macht die eindeutige Beantwortung rechtlicher Fragen in diesem Bereich schwer. Eine gerichtliche Beurteilung der untersuchten Sachverhalte steht bislang aus. Die zur Frage der Personenbezogenheit einer IP-Adresse auch in der Rechtsprechung vertretenen verschiedenen Auffassungen machen zudem deutlich, dass selbst im Falle einer richterlichen Entscheidung nicht von einer endgültigen Klärung datenschutzrechtlichen Kontroversen ausgegangen werden kann. Es kann daher keine abschließende Empfehlung hinsichtlich einer Entfernung der durch das ULD als datenschutzrechtlich unzulässig bewerteten Angebote gegeben werden."
Beckmann kommentiert: "Das Gutachten zeigt abermals, dass sich das deutsche Datenschutzrecht in einem katastrophalen Zustand befindet. Leider ist nicht damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber in der Lage ist, eine zeitgemäßes, klares und funktionales Regelwerk zu schaffen. Es hilft dabei gar nichts, wenn Datenschützer wie das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein mit markigen Worten und Ordnungsgeldern drohen."
http://www.beckmannundnorda.de/serendipity/index.php?/archives/687-Wissenschaftlicher-Dienst-des-Deutschen-Bundestages-veroeffentlicht-Gutachten-zu-Facebook-Fanpages,-dem-Gefaellt-Mir-Button-und-anderen-Social-Plugins.html
Das Gutachten kommt zu dem Schluss:
"Vielmehr ist das geltende Datenschutzrecht von Unsicherheiten geprägt und macht die eindeutige Beantwortung rechtlicher Fragen in diesem Bereich schwer. Eine gerichtliche Beurteilung der untersuchten Sachverhalte steht bislang aus. Die zur Frage der Personenbezogenheit einer IP-Adresse auch in der Rechtsprechung vertretenen verschiedenen Auffassungen machen zudem deutlich, dass selbst im Falle einer richterlichen Entscheidung nicht von einer endgültigen Klärung datenschutzrechtlichen Kontroversen ausgegangen werden kann. Es kann daher keine abschließende Empfehlung hinsichtlich einer Entfernung der durch das ULD als datenschutzrechtlich unzulässig bewerteten Angebote gegeben werden."
Beckmann kommentiert: "Das Gutachten zeigt abermals, dass sich das deutsche Datenschutzrecht in einem katastrophalen Zustand befindet. Leider ist nicht damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber in der Lage ist, eine zeitgemäßes, klares und funktionales Regelwerk zu schaffen. Es hilft dabei gar nichts, wenn Datenschützer wie das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein mit markigen Worten und Ordnungsgeldern drohen."
KlausGraf - am Sonntag, 23. Oktober 2011, 16:25 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 23. Oktober 2011, 01:07 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur/schillers_ode_zu_teuer_fuer_die_oeffentliche_hand_1.13077702.html
Pech für die Stiftung Weimarer Klassik und die Öffentlichkeit: Die überraschend aufgetauchte Reinschrift von Friedrich Schillers berühmter «Ode an die Freude» gelangt in Privatbesitz. Bei der zweitägigen Autografen-Auktion, welche die Antiquariate Moirandat (Basel) und Stargardt (Berlin) am Freitag im grossen Saal von Basels Schmiedenhof begonnen haben, erhielt ein anonymer telefonischer Bieter den Zuschlag.
Das zweimal gefaltete und dann auf drei Seiten mit Tinte beschriebene Blatt von 1785, ein kleines Quartformat, war mit einem Schätz- bzw. Ausgabepreis von 150'000 Franken ausgerufen worden. Der Endpreis lag schliesslich bei einer halben Million Schweizer Franken.
Zwei Wochen vor Beginn der Auktion hatte sich die Stiftung Weimarer Klassik mit einem Spendenaufruf an die deutsche Öffentlichkeit mit der Bitte gewandt, ihr beim Erwerb von Schillers Autograf zu helfen. So unstrittig es von vornherein war, dass das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar der ideale Aufbewahrungsort dieser Gedicht-Handschrift wäre, so klar war dem Archiv auch, dass es sich «allein mit eigenen Mitteln bei der Versteigerung nicht erfolgreich behaupten können» würde.
Danke für den Hinweis an Karsten Schuldt
Text:
http://www.moirandat.ch/Auktion8_1_Literatur.pdf

Pech für die Stiftung Weimarer Klassik und die Öffentlichkeit: Die überraschend aufgetauchte Reinschrift von Friedrich Schillers berühmter «Ode an die Freude» gelangt in Privatbesitz. Bei der zweitägigen Autografen-Auktion, welche die Antiquariate Moirandat (Basel) und Stargardt (Berlin) am Freitag im grossen Saal von Basels Schmiedenhof begonnen haben, erhielt ein anonymer telefonischer Bieter den Zuschlag.
Das zweimal gefaltete und dann auf drei Seiten mit Tinte beschriebene Blatt von 1785, ein kleines Quartformat, war mit einem Schätz- bzw. Ausgabepreis von 150'000 Franken ausgerufen worden. Der Endpreis lag schliesslich bei einer halben Million Schweizer Franken.
Zwei Wochen vor Beginn der Auktion hatte sich die Stiftung Weimarer Klassik mit einem Spendenaufruf an die deutsche Öffentlichkeit mit der Bitte gewandt, ihr beim Erwerb von Schillers Autograf zu helfen. So unstrittig es von vornherein war, dass das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar der ideale Aufbewahrungsort dieser Gedicht-Handschrift wäre, so klar war dem Archiv auch, dass es sich «allein mit eigenen Mitteln bei der Versteigerung nicht erfolgreich behaupten können» würde.
Danke für den Hinweis an Karsten Schuldt
Text:
http://www.moirandat.ch/Auktion8_1_Literatur.pdf

KlausGraf - am Samstag, 22. Oktober 2011, 17:29 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dem kann ich nur zustimmen.
A discussion on whether scholars should take the time to write a blog about their work.
http://www.universityaffairs.ca/should-you-enter-the-academic-blogosphere.aspx
(Thanks to Mareike König.)
http://www.universityaffairs.ca/should-you-enter-the-academic-blogosphere.aspx
(Thanks to Mareike König.)
KlausGraf - am Samstag, 22. Oktober 2011, 16:19 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ über eine Studie die das e-book absolvieren soll, zeitgleich mit der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben
http://goo.gl/s9y2q
http://goo.gl/s9y2q
vierprinzen - am Samstag, 22. Oktober 2011, 13:58 - Rubrik: Miscellanea
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064880/image_11
Das Digitalisat ist eine in Rom 1469 gedruckte Inkunabel von Caesars De bello Gallico.
Das Provenienzregister zu BSB-Ink (nicht online) gibt Auskunft über den Eigner des Wappens:
Peck, Georg
aus Ulm; Dr. decr.; Kanoniker (seit 1465) und bischöflicher
Offizial (1465–86) in Augsburg; gest. 1486;
verwendete ein Wappen.
A‑450,3; A‑854,1; C‑23,1; L‑187,1.
Lit.: Haemmerle, Augsburg, S. 19. – MBK 3/1, 83.
Man vermisst den Hinweis auf den Freiburger Inkunabelkatalog von Vera Sack (den Needhams IPI hat):
Register:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1620_jpg.htm
Nr. 2168+2174 (Augsburger Isidor-Drucke 1472)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024b_b0725_JPG.htm
Beck, der Augsburger Kanoniker und Offizial war, ist auch als Autor lateinischer juristischer Texte in Handschriften greifbar:
Tübingen, UB, Mc 63
Consilium von 1486
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90630216,T
Augsburg, UB, Cod. II. 1. fol. 57
Informatio confessorum dioecesis Augustensis in tempore belli (1463)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90621013,T
Wie nicht selten hat ManuMed keineswegs alle Nachweise, die es eigentlich haben sollte. Der folgende Beleg kam über Google (findet sich aber auch bei Krämer, Scriptores):
Consilien Nr. 33 und 39
München, UB 2° 664
http://books.google.de/books?id=0pTjubri0ikC (Auszüge)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0054_b125_JPG.htm
Weitere biographische Nachweise bietet Elisabeth Wunderles Katalog der Dillinger Handschriften anlässlich der Erwähnung eines Jahrtags
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00045613/image_149
Hinweis auf Clm 3895:
http://www.google.de/search?&tbm=bks&q=%22+ego+georgius+peck+**%22
Beleg fürs Todesdatum 22. Dez. 1486
http://books.google.de/books?id=WZsrAQAAIAAJ&pg=PA241
Repertorium Germanicum hat ebenfalls Belege zu Beck.
Update 2015: GND
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025026241
#forschung

Das Digitalisat ist eine in Rom 1469 gedruckte Inkunabel von Caesars De bello Gallico.
Das Provenienzregister zu BSB-Ink (nicht online) gibt Auskunft über den Eigner des Wappens:
Peck, Georg
aus Ulm; Dr. decr.; Kanoniker (seit 1465) und bischöflicher
Offizial (1465–86) in Augsburg; gest. 1486;
verwendete ein Wappen.
A‑450,3; A‑854,1; C‑23,1; L‑187,1.
Lit.: Haemmerle, Augsburg, S. 19. – MBK 3/1, 83.
Man vermisst den Hinweis auf den Freiburger Inkunabelkatalog von Vera Sack (den Needhams IPI hat):
Register:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1620_jpg.htm
Nr. 2168+2174 (Augsburger Isidor-Drucke 1472)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024b_b0725_JPG.htm
Beck, der Augsburger Kanoniker und Offizial war, ist auch als Autor lateinischer juristischer Texte in Handschriften greifbar:
Tübingen, UB, Mc 63
Consilium von 1486
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90630216,T
Augsburg, UB, Cod. II. 1. fol. 57
Informatio confessorum dioecesis Augustensis in tempore belli (1463)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90621013,T
Wie nicht selten hat ManuMed keineswegs alle Nachweise, die es eigentlich haben sollte. Der folgende Beleg kam über Google (findet sich aber auch bei Krämer, Scriptores):
Consilien Nr. 33 und 39
München, UB 2° 664
http://books.google.de/books?id=0pTjubri0ikC (Auszüge)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0054_b125_JPG.htm
Weitere biographische Nachweise bietet Elisabeth Wunderles Katalog der Dillinger Handschriften anlässlich der Erwähnung eines Jahrtags
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00045613/image_149
Hinweis auf Clm 3895:
http://www.google.de/search?&tbm=bks&q=%22+ego+georgius+peck+**%22
Beleg fürs Todesdatum 22. Dez. 1486
http://books.google.de/books?id=WZsrAQAAIAAJ&pg=PA241
Repertorium Germanicum hat ebenfalls Belege zu Beck.
Update 2015: GND
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025026241
#forschung

KlausGraf - am Freitag, 21. Oktober 2011, 22:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die geplante Versteigerung von Teilen der Haller Waldauf-Bibliothek sorgt für Wirbel in der Fachwelt und der Salzstadt. [...]
Die Herkunft der bei Zisska & Schauer angebotenen Werke beschäftigt nun das BDA, derzeit prüfe die Rechtsabteilung, ob und welche Rechtsmittel ergriffen werden könnten, weiß Rampold. Bei Zisska & Schauer reagiert man mit Verwunderung: Der Bestand stamme aus Deutschland und aus Privatbesitz, sagt Herbert Schauer, Leiter des Auktionshauses. Und: „Wir haben alles unternommen, um die Herkunft zu klären.“
Gegenteiliger Meinung ist der deutsche Historiker und Archivar an der RWTH Aachen, Klaus Graf, der den Stein in seinem Webblog „Archivalia“ ins Rollen gebracht hat. Er schließt aus, dass die Werke „auf legalem Weg aus Österreich entfernt wurden“ und ist sich „ziemlich sicher“, dass es sich um die während des 2. Weltkriegs verlorenen Bestände handelt. Auf eine Einigung und den „Erhalt dieses Kulturguts für Tirol“ hofft indes UB-Direktor Martin Wieser: Es wäre ein „immenser Schaden“, würden die Bestände durch den Verkauf verstreut.
Ganzer Artikel: http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Freizeit/3608420-2/r%C3%A4tsel-um-kostbaren-haller-b%C3%BCcherschatz.csp
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/42999544/

Die Herkunft der bei Zisska & Schauer angebotenen Werke beschäftigt nun das BDA, derzeit prüfe die Rechtsabteilung, ob und welche Rechtsmittel ergriffen werden könnten, weiß Rampold. Bei Zisska & Schauer reagiert man mit Verwunderung: Der Bestand stamme aus Deutschland und aus Privatbesitz, sagt Herbert Schauer, Leiter des Auktionshauses. Und: „Wir haben alles unternommen, um die Herkunft zu klären.“
Gegenteiliger Meinung ist der deutsche Historiker und Archivar an der RWTH Aachen, Klaus Graf, der den Stein in seinem Webblog „Archivalia“ ins Rollen gebracht hat. Er schließt aus, dass die Werke „auf legalem Weg aus Österreich entfernt wurden“ und ist sich „ziemlich sicher“, dass es sich um die während des 2. Weltkriegs verlorenen Bestände handelt. Auf eine Einigung und den „Erhalt dieses Kulturguts für Tirol“ hofft indes UB-Direktor Martin Wieser: Es wäre ein „immenser Schaden“, würden die Bestände durch den Verkauf verstreut.
Ganzer Artikel: http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Freizeit/3608420-2/r%C3%A4tsel-um-kostbaren-haller-b%C3%BCcherschatz.csp
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/42999544/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 21. Oktober 2011, 19:17 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Skype kann Piraten verraten, Webcams lassen sich dank einer Lücke in Adobe Flash ausspionieren und PC-Tastatureingaben mit iPhones auslesen.
Wissenschaftler des Georgia Institute of Technology und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben in einer Studie namens «Ich weiss, wo du bist und was du teilst» skizziert, wie sich das Filesharing-Verhalten von Anwendern nachvollziehen lässt, die Skype und Bittorrent nutzen
http://www.nzz.ch/nachrichten/digital/skype_bittorent_ip_adresse_1.13072821.html
Wissenschaftler des Georgia Institute of Technology und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben in einer Studie namens «Ich weiss, wo du bist und was du teilst» skizziert, wie sich das Filesharing-Verhalten von Anwendern nachvollziehen lässt, die Skype und Bittorrent nutzen
http://www.nzz.ch/nachrichten/digital/skype_bittorent_ip_adresse_1.13072821.html
vierprinzen - am Freitag, 21. Oktober 2011, 13:55 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"... Das Landesarchiv in Duisburg wird offenbar noch teurer als erwartet. Fast 200 Millionen Euro soll der Bau kosten. Der Bund der Steuerzahler rügt den Neubau als Fallbeispiel für Steuerverschwendung. Ursprünglich veranschlagt waren 30 Millionen Euro.
Der Bau des Landesarchivs am Innenhafen wird offenbar noch mal teurer und sprengt fast die Grenze von 200 Millionen Euro. In der SPD-Landtagsfraktion und am Rande einer Kabinettssitzung soll die Zahl 196 Millionen Euro genannt worden sein. Die Düsseldorfer Staatskanzlei dementierte gegenüber der WAZ diese Zahl nicht. Auch im jetzt veröffentlichten Schwarzbuch 2011 des Bundes der Steuerzahler (BdSt) findet das Bauvorhaben unrühmliche Nennung als Fallbeispiel für Steuerverschwendung.
Erst vergangene Woche hatte die WAZ über den Neubau des Landesarchivs berichtet. Die erwartete Bausumme von genannten 170 Millionen Euro hat sich dabei offenbar schon wieder längst überholt. Über die Gründe der weiteren Kostenexplosion gibt es unterschiedliche Mutmaßungen. So sollen sie in zusätzlichen Baukosten wegen der aufwendigen Gründungen am Hafenbecken liegen. Auch eine weitere Risikovorsorge und höhere Bauleitzinsen werden genannt. Der Landesbau-Betrieb BLB räumt Kostensteigerung ein, will die Summe aber nicht bestätigen.
..."
Quelle: derwesten.de, 20.10.11
Der Bau des Landesarchivs am Innenhafen wird offenbar noch mal teurer und sprengt fast die Grenze von 200 Millionen Euro. In der SPD-Landtagsfraktion und am Rande einer Kabinettssitzung soll die Zahl 196 Millionen Euro genannt worden sein. Die Düsseldorfer Staatskanzlei dementierte gegenüber der WAZ diese Zahl nicht. Auch im jetzt veröffentlichten Schwarzbuch 2011 des Bundes der Steuerzahler (BdSt) findet das Bauvorhaben unrühmliche Nennung als Fallbeispiel für Steuerverschwendung.
Erst vergangene Woche hatte die WAZ über den Neubau des Landesarchivs berichtet. Die erwartete Bausumme von genannten 170 Millionen Euro hat sich dabei offenbar schon wieder längst überholt. Über die Gründe der weiteren Kostenexplosion gibt es unterschiedliche Mutmaßungen. So sollen sie in zusätzlichen Baukosten wegen der aufwendigen Gründungen am Hafenbecken liegen. Auch eine weitere Risikovorsorge und höhere Bauleitzinsen werden genannt. Der Landesbau-Betrieb BLB räumt Kostensteigerung ein, will die Summe aber nicht bestätigen.
..."
Quelle: derwesten.de, 20.10.11
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Oktober 2011, 13:45 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
".... Abzocke beim Landesarchiv
NRW. Im Frühjahr 2010 berichtete die Neue Ruhr Zeitung, dass das Land NRW bereits 2007 geplant hatte, ein altes Speichergrundstück im Duisburger Innenhafen für das neue Landesarchiv zu kaufen. Kosten: 2 Mio. Euro. Unmittelbar vor dem Notartermin verkaufte der Eigentümer sein Grundstück jedoch für 3,8 Mio. Euro an den Essener Projektentwickler Kölb Kruse. Zufall? Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) nahm zu einer entsprechenden Frage des BdSt keine Stellung. Kölb Kruse, die bereits mehrere Projekte im Duisburger Innenhafen verwirklicht hatten, sollten das Archiv nun bauen, das Land wollte das Gebäude mieten. Denn der politische Beschluss, das Landesarchiv am vorgesehenen Standort zu bauen, blieb weiter bestehen; der BLB erhielt keinen Auftrag, innerhalb oder außerhalb Duisburgs nach einer Alternative zu suchen. 3,8 Mio. Euro Miete jährlich waren zunächst vorgesehen, doch dann erhöhte Kölb Kruse die Forderung auf 12 Mio. Euro. Und noch immer hielt das Land am Duisburger Innenhafen fest. Aber anscheinend wurde ihm die Sache allmählich doch zu teuer. Kölb Kruse verkaufte das Grundstück samt einem Nachbargrundstück, das das Essener Unternehmen laut Presseberichten für rund 765.000 Euro der Stadt Duisburg abgekauft hatte. Das Land NRW zahlte die stolze Summe von fast 30 Mio. Euro. Der BLB betont auf Anfrage des BdSt, dass diese Kosten nicht nur die Grundstücke abdeckten, sondern auch „andere Kosten, z. B. für verausgabte Planungsleistungen“. Nach Presseberichten schlug allein der Ausstieg aus dem Mietvertrag mit gut 8 Mio. Euro zu Buche. Auf die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen, erklärt der BLB dem BdSt, dass „bei der Anbahnung von Grundstücksgeschäften des Landes typischerweise ein öffentlicher Bekanntheitsgrad unvermeidbar ist, der tendenziell preissteigernd wirkt“. Tendenziell preissteigernd? Das klingt angesichts der Summen und der finanziellen Lage des Landes wie blanker Hohn. Hinzu kommt, dass es nicht bei den ursprünglich veranschlagten Baukosten von 80 Mio. Euro bleibt; inzwischen sind es mindestens 158 Mio. Euro. Mittlerweile ermittelt die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft in Wuppertal in dem Fall, im Februar 2011 berichteten die Medien in NRW über umfangreiche Razzien – nicht nur in Sachen Landesarchiv. So gebe es einen Anfangsverdacht für Untreue und Korruption auch bei anderen Projekten des BLB. ...."
Quelle: Schwarzbuch 2011
NRW. Im Frühjahr 2010 berichtete die Neue Ruhr Zeitung, dass das Land NRW bereits 2007 geplant hatte, ein altes Speichergrundstück im Duisburger Innenhafen für das neue Landesarchiv zu kaufen. Kosten: 2 Mio. Euro. Unmittelbar vor dem Notartermin verkaufte der Eigentümer sein Grundstück jedoch für 3,8 Mio. Euro an den Essener Projektentwickler Kölb Kruse. Zufall? Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) nahm zu einer entsprechenden Frage des BdSt keine Stellung. Kölb Kruse, die bereits mehrere Projekte im Duisburger Innenhafen verwirklicht hatten, sollten das Archiv nun bauen, das Land wollte das Gebäude mieten. Denn der politische Beschluss, das Landesarchiv am vorgesehenen Standort zu bauen, blieb weiter bestehen; der BLB erhielt keinen Auftrag, innerhalb oder außerhalb Duisburgs nach einer Alternative zu suchen. 3,8 Mio. Euro Miete jährlich waren zunächst vorgesehen, doch dann erhöhte Kölb Kruse die Forderung auf 12 Mio. Euro. Und noch immer hielt das Land am Duisburger Innenhafen fest. Aber anscheinend wurde ihm die Sache allmählich doch zu teuer. Kölb Kruse verkaufte das Grundstück samt einem Nachbargrundstück, das das Essener Unternehmen laut Presseberichten für rund 765.000 Euro der Stadt Duisburg abgekauft hatte. Das Land NRW zahlte die stolze Summe von fast 30 Mio. Euro. Der BLB betont auf Anfrage des BdSt, dass diese Kosten nicht nur die Grundstücke abdeckten, sondern auch „andere Kosten, z. B. für verausgabte Planungsleistungen“. Nach Presseberichten schlug allein der Ausstieg aus dem Mietvertrag mit gut 8 Mio. Euro zu Buche. Auf die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen, erklärt der BLB dem BdSt, dass „bei der Anbahnung von Grundstücksgeschäften des Landes typischerweise ein öffentlicher Bekanntheitsgrad unvermeidbar ist, der tendenziell preissteigernd wirkt“. Tendenziell preissteigernd? Das klingt angesichts der Summen und der finanziellen Lage des Landes wie blanker Hohn. Hinzu kommt, dass es nicht bei den ursprünglich veranschlagten Baukosten von 80 Mio. Euro bleibt; inzwischen sind es mindestens 158 Mio. Euro. Mittlerweile ermittelt die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft in Wuppertal in dem Fall, im Februar 2011 berichteten die Medien in NRW über umfangreiche Razzien – nicht nur in Sachen Landesarchiv. So gebe es einen Anfangsverdacht für Untreue und Korruption auch bei anderen Projekten des BLB. ...."
Quelle: Schwarzbuch 2011
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Oktober 2011, 13:40 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Aufmerksame Beobachter haben die Armada von Umzugswagen vor der Villa Plange registriert. Sie ist ein Vorbote von lange geplanten Veränderungen. Das Kreisarchiv zieht in diesen Tagen vom Soester Sigefridwall in das Kreishaus um. Denn in der Villa beginnen dringende Reparaturmaßnahmen.
Wasserschäden sind in einigen Räumen längst sichtbar. So funktioniert die Balkonentwässerung wegen defekter und nicht ausreichend dimensionierter Rohrleitungen nur unzureichend. Auch für andere Ver- und Entsorgungsleitungen besteht dringender Handlungsbedarf, wenn das denkmalgeschützte Gebäude keinen größeren Schaden nehmen soll. So stehen Heizungsarbeiten sowie Maßnahmen rund um Sanitär- und Elektroinstallation in den nächsten Monaten bevor. Daneben sollen Fenster und Türen ausgetauscht werden, vor allem aus energetischen Gründen. Aus dem Jahr 2010 stehen für das Projekt noch 110.000 Euro zur Verfügung, für 2011 hat der Kreistag 225.000 Euro an Haushaltsmitteln bereitgestellt.
Wegen des Umzugs bleibt das Archiv noch bis zum 28. Oktober geschlossen. Ab dem 31. Oktober ist das Kreisarchiv im Kreishaus am Hohen Weg unter der bekannten Telefonnummer 02921/302960 und der E-Mail-Adresse kreisarchiv@kreis-soest.de zu erreichen. Benutzungen des Archivs sind nach Voranmeldung möglich.
Das Magazin des Kreisarchivs verbleibt im Keller der Villa Plange. Zurzeit wird geprüft, ob die bisherigen Räume des Kreisarchivs im Ober- und Dachgeschoss der Villa Plange künftig von der jetzt noch im Kreishaus untergebrachten wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH genutzt werden können. Die Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen, bei denen die Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten sind, werden den Zeitraum bis Juli 2012 in Anspruch nehmen. Zur langfristigen Unterbringung des Kreisarchivs, für dessen Bestände mittlerweile weder in der
Villa Plange, noch im Kreishaus genügend Raumkapazitäten zur Verfügung stehen, prüft der Kreis Soest mehrere Alternativen. Das hängt auch vom Erfolg des Regionale-2013-Projekts Adam-Kaserne Soest ab. Der vorliegende Konzeptentwurf sieht die Ansiedlung des Kreisarchivs mit dem Stadtarchiv vor."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wasserschäden sind in einigen Räumen längst sichtbar. So funktioniert die Balkonentwässerung wegen defekter und nicht ausreichend dimensionierter Rohrleitungen nur unzureichend. Auch für andere Ver- und Entsorgungsleitungen besteht dringender Handlungsbedarf, wenn das denkmalgeschützte Gebäude keinen größeren Schaden nehmen soll. So stehen Heizungsarbeiten sowie Maßnahmen rund um Sanitär- und Elektroinstallation in den nächsten Monaten bevor. Daneben sollen Fenster und Türen ausgetauscht werden, vor allem aus energetischen Gründen. Aus dem Jahr 2010 stehen für das Projekt noch 110.000 Euro zur Verfügung, für 2011 hat der Kreistag 225.000 Euro an Haushaltsmitteln bereitgestellt.
Wegen des Umzugs bleibt das Archiv noch bis zum 28. Oktober geschlossen. Ab dem 31. Oktober ist das Kreisarchiv im Kreishaus am Hohen Weg unter der bekannten Telefonnummer 02921/302960 und der E-Mail-Adresse kreisarchiv@kreis-soest.de zu erreichen. Benutzungen des Archivs sind nach Voranmeldung möglich.
Das Magazin des Kreisarchivs verbleibt im Keller der Villa Plange. Zurzeit wird geprüft, ob die bisherigen Räume des Kreisarchivs im Ober- und Dachgeschoss der Villa Plange künftig von der jetzt noch im Kreishaus untergebrachten wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH genutzt werden können. Die Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen, bei denen die Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten sind, werden den Zeitraum bis Juli 2012 in Anspruch nehmen. Zur langfristigen Unterbringung des Kreisarchivs, für dessen Bestände mittlerweile weder in der
Villa Plange, noch im Kreishaus genügend Raumkapazitäten zur Verfügung stehen, prüft der Kreis Soest mehrere Alternativen. Das hängt auch vom Erfolg des Regionale-2013-Projekts Adam-Kaserne Soest ab. Der vorliegende Konzeptentwurf sieht die Ansiedlung des Kreisarchivs mit dem Stadtarchiv vor."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Oktober 2011, 13:07 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/print_11269021.htm
Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, inwieweit auch die Wissenschaftliche Stadtbibliothek von den Sparüberlegungen der Ampelkoalition betroffen sein könnte. Nach AZ-Informationen gibt es nun Planungen, die traditionsreiche Einrichtung an der Rheinallee zu schließen und von Grund auf umzustrukturieren: Das knapp 100-jährige, sanierungsbedürftige Jugendstilgebäude soll verkauft und die Bestände der Wissenschaftlichen Bibliothek auf drei Standorte aufgeteilt werden.
Das Stadtarchiv, dessen Bestand das Landesarchivgesetz garantiert, wird auf jeden Fall erhalten bleiben und könnte, so die Überlegungen, als eine Art historisches Zentrum für die Stadtgeschichtsforschung in eine der auslaufenden Grund- oder Hauptschulen im Stadtgebiet ziehen. Hierhin sollen auch Altbestände der Wissenschaftlichen Bibliothek mit archivarischem Charakter verlagert werden. Dieses erweiterte Stadtarchiv soll weiterhin für Jedermann öffentlich zugänglich sein.
Kooperation mit der Universität
Andere Teile der Wissenschaftlichen Bibliothek, wie etwa Handschriften oder Inkunabeln, sollen ins Gutenberg-Museum wandern, das lange Zeit Teil der Stadtbibliothek war und 1927 ins Haus zum Römischen Kaiser ausgegründet wurde. Die restlichen Bestände könnten, nach Vorstellungen der Ampel-Koalition, in dem künftigen Neubau der Universitätsbibliothek zusammengeführt werden.
Die dadurch entstehenden Synergieeffekte bedeuten aber auch, dass die Wissenschaftliche Stadtbibliothek keine neuen Anschaffungen – Bücher und Zeitschriften schlagen jährlich mit 130.000 Euro zu Buche – mehr tätigen könnte, die Bestände würden auf dem aktuellen Stand eingefroren.
Siehe auch
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mainz-gedaechtnisverlust-in-der-gutenbergstadt-11498815.html
Das wäre eine katastrophale Fehlentscheidung und ein völlig falsches Signal für die anderen Altbestandsbibliotheken in kommunaler Trägerschaft.
Annelen Ottermann dazu: Mein Credo, für das ich nach 26 Jahren als Altbestandsbibliothekarin an dieser Bibliothek in Mainz mit aller verbleibenden Kraft gegenüber den politischen Entscheidungsträgern kämpfen werde, lautet:
"Es gibt den Denkmalschutz für historische Gebäude. Wir brauchen den Ensembleschutz für historische Sammlungen!"
Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, inwieweit auch die Wissenschaftliche Stadtbibliothek von den Sparüberlegungen der Ampelkoalition betroffen sein könnte. Nach AZ-Informationen gibt es nun Planungen, die traditionsreiche Einrichtung an der Rheinallee zu schließen und von Grund auf umzustrukturieren: Das knapp 100-jährige, sanierungsbedürftige Jugendstilgebäude soll verkauft und die Bestände der Wissenschaftlichen Bibliothek auf drei Standorte aufgeteilt werden.
Das Stadtarchiv, dessen Bestand das Landesarchivgesetz garantiert, wird auf jeden Fall erhalten bleiben und könnte, so die Überlegungen, als eine Art historisches Zentrum für die Stadtgeschichtsforschung in eine der auslaufenden Grund- oder Hauptschulen im Stadtgebiet ziehen. Hierhin sollen auch Altbestände der Wissenschaftlichen Bibliothek mit archivarischem Charakter verlagert werden. Dieses erweiterte Stadtarchiv soll weiterhin für Jedermann öffentlich zugänglich sein.
Kooperation mit der Universität
Andere Teile der Wissenschaftlichen Bibliothek, wie etwa Handschriften oder Inkunabeln, sollen ins Gutenberg-Museum wandern, das lange Zeit Teil der Stadtbibliothek war und 1927 ins Haus zum Römischen Kaiser ausgegründet wurde. Die restlichen Bestände könnten, nach Vorstellungen der Ampel-Koalition, in dem künftigen Neubau der Universitätsbibliothek zusammengeführt werden.
Die dadurch entstehenden Synergieeffekte bedeuten aber auch, dass die Wissenschaftliche Stadtbibliothek keine neuen Anschaffungen – Bücher und Zeitschriften schlagen jährlich mit 130.000 Euro zu Buche – mehr tätigen könnte, die Bestände würden auf dem aktuellen Stand eingefroren.
Siehe auch
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mainz-gedaechtnisverlust-in-der-gutenbergstadt-11498815.html
Das wäre eine katastrophale Fehlentscheidung und ein völlig falsches Signal für die anderen Altbestandsbibliotheken in kommunaler Trägerschaft.
Annelen Ottermann dazu: Mein Credo, für das ich nach 26 Jahren als Altbestandsbibliothekarin an dieser Bibliothek in Mainz mit aller verbleibenden Kraft gegenüber den politischen Entscheidungsträgern kämpfen werde, lautet:
"Es gibt den Denkmalschutz für historische Gebäude. Wir brauchen den Ensembleschutz für historische Sammlungen!"
KlausGraf - am Freitag, 21. Oktober 2011, 12:58 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Situation der Freien Archive
von Jürgen Bacia
"Vor dem Hintergrund des Geschilderten müssen einige provozierende Fragen erlaubt sein. Sind wir in der Lage, verantwortlich mit unserer Geschichte umzugehen? Wollen wir alle einzeln untergehen oder gelingt uns eine gemeinsame Lösung?
Ist es möglich, Gegenstrukturen zu schaffen gegen das etablierte Archivwesen? Sollen politische Gruppen und Initiativen ihre Unterlagen lieber wegwerfen, als sie etablierten Archiven zur Verfügung zu stellen? Müssen alternative ArchivarInnen notwendigerweise am Hungertuch nagen oder ist es legitim, für bezahlte Stellen in Freien Archiven zu kämpfen?"
http://www.graswurzel.net/356/archiv.shtml
Graswurzelrevolution Nr. 356, Februar 2011
Nachtrag: Beim Stöbern bemerkte ich eben, dass es bereits einen Eintrag zu diesem Artikel gibt:
http://archiv.twoday.net/stories/14656210/
von Jürgen Bacia
"Vor dem Hintergrund des Geschilderten müssen einige provozierende Fragen erlaubt sein. Sind wir in der Lage, verantwortlich mit unserer Geschichte umzugehen? Wollen wir alle einzeln untergehen oder gelingt uns eine gemeinsame Lösung?
Ist es möglich, Gegenstrukturen zu schaffen gegen das etablierte Archivwesen? Sollen politische Gruppen und Initiativen ihre Unterlagen lieber wegwerfen, als sie etablierten Archiven zur Verfügung zu stellen? Müssen alternative ArchivarInnen notwendigerweise am Hungertuch nagen oder ist es legitim, für bezahlte Stellen in Freien Archiven zu kämpfen?"
http://www.graswurzel.net/356/archiv.shtml
Graswurzelrevolution Nr. 356, Februar 2011
Nachtrag: Beim Stöbern bemerkte ich eben, dass es bereits einen Eintrag zu diesem Artikel gibt:
http://archiv.twoday.net/stories/14656210/
SW - am Freitag, 21. Oktober 2011, 09:34 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

