Der heutige Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union ist Grund genug, einige kulturelle Links zu Kroatien zusammenzustellen.
Archivinformationssystem ARHiNET (dt)
http://arhinet.arhiv.hr/index.aspx
Croatian History
http://www.croatianhistory.net/
Angestaubt, aber materialreich
Digitalni akademski repozitorij (DAR) - Historische Dissertationen
http://dar.nsk.hr/
Siehe auch unten: Theater
Dubrovnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik
Video siehe unten.
Handbuch der historischen Buchbestände. Kroatien
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kroatien
Hrcak. Portal of scientific journals of Croatia - über 300 Open-Access-Zeitschriften
http://hrcak.srce.hr/
Inkunabeln in kirchlichen Einrichtungen
http://hrcak.srce.hr/search/?q=inkunabula
Die Aufsätze 1984/91 mit Provenienzangabensind im Volltext einsehbar
Kroatien bei Lexilogos
http://www.lexilogos.com/croate_dictionnaire.htm
Kroatisches Kulturerbe
http://www.kultura.hr/eng/
(Man darf nur im Ausnahmefall Digitalisate erwarten!)
Metelwin Digital Library
http://library.foi.hr/digi/en/index.php
Digitalisate aus kroatischen Institutionen, auch auf Deutsch
Nationalarchiv (en)
http://www.arhiv.hr/en/index.htm
Nationalbibliothek (en)
http://www.nsk.hr/en/
Mit Metasuche!
Nationale Museen
http://www.ep.liu.se/ecp/064/008/ecp64008.pdf
Aufsatz von 2011.
Open Access in Kroatien - Monographie von Ivana Hebrang Grgić (2011) (en)
http://darhiv.ffzg.hr/id/eprint/1397
Open Access-IR: Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository
http://darhiv.ffzg.hr/
Das meiste leider nur für registrierte Nutzer
Philosophische Gesellschaft
http://www.hrfd.hr/
Auch deutschsprachige Volltexte
Slavistik-Portal. Metasuche
http://www.slavistik-portal.de/
Tabula Hungariae, gemeinsam von Ungarn und Kroatien für das Weltdokumentenerbe eingereicht
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/europe-and-north-america/croatia/#c185018
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungarie
http://lazarus.elte.hu/~guszlev/lazar/
Theater, Deutsches in Zagreb 1780-1840
http://dar.nsk.hr/index.php?pub=1&p=7850&s=publ
Dissertation von 1937
UB Pula (dt)
http://www.escape.hr/skpu/index.php?german
UB Rijeka
http://www.svkri.uniri.hr/povijesnazbirka/popisgrade.html
Offenbar nur Schlüsselseiten aus dem Altbestand
Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien
Wikisource
http://de.wikisource.org/wiki/Kroatien
Zagreb
http://de.wikipedia.org/wiki/Zagreb
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=zagreb&qf=COUNTRY:croatia&rows=24
Zeitschriften-Digitalisate (historische)
http://dnc.nsk.hr/Journals/English.aspx
Zeitungen-Digitalisate
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/English.aspx
U.a. Kroatischer Korrespondent 1789 (dt)
Für Istrien: http://ino.com.hr
Rijeka: http://crolist.svkri.hr/liste/002n/
Split: http://dalmatica.svkst.hr/
Viel Spaß bei der virtuellen Reise!
Archivinformationssystem ARHiNET (dt)
http://arhinet.arhiv.hr/index.aspx
Croatian History
http://www.croatianhistory.net/
Angestaubt, aber materialreich
Digitalni akademski repozitorij (DAR) - Historische Dissertationen
http://dar.nsk.hr/
Siehe auch unten: Theater
Dubrovnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik
Video siehe unten.
Handbuch der historischen Buchbestände. Kroatien
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kroatien
Hrcak. Portal of scientific journals of Croatia - über 300 Open-Access-Zeitschriften
http://hrcak.srce.hr/
Inkunabeln in kirchlichen Einrichtungen
http://hrcak.srce.hr/search/?q=inkunabula
Die Aufsätze 1984/91 mit Provenienzangabensind im Volltext einsehbar
Kroatien bei Lexilogos
http://www.lexilogos.com/croate_dictionnaire.htm
Kroatisches Kulturerbe
http://www.kultura.hr/eng/
(Man darf nur im Ausnahmefall Digitalisate erwarten!)
Metelwin Digital Library
http://library.foi.hr/digi/en/index.php
Digitalisate aus kroatischen Institutionen, auch auf Deutsch
Nationalarchiv (en)
http://www.arhiv.hr/en/index.htm
Nationalbibliothek (en)
http://www.nsk.hr/en/
Mit Metasuche!
Nationale Museen
http://www.ep.liu.se/ecp/064/008/ecp64008.pdf
Aufsatz von 2011.
Open Access in Kroatien - Monographie von Ivana Hebrang Grgić (2011) (en)
http://darhiv.ffzg.hr/id/eprint/1397
Open Access-IR: Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository
http://darhiv.ffzg.hr/
Das meiste leider nur für registrierte Nutzer
Philosophische Gesellschaft
http://www.hrfd.hr/
Auch deutschsprachige Volltexte
Slavistik-Portal. Metasuche
http://www.slavistik-portal.de/
Tabula Hungariae, gemeinsam von Ungarn und Kroatien für das Weltdokumentenerbe eingereicht
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/europe-and-north-america/croatia/#c185018
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungarie
http://lazarus.elte.hu/~guszlev/lazar/
Theater, Deutsches in Zagreb 1780-1840
http://dar.nsk.hr/index.php?pub=1&p=7850&s=publ
Dissertation von 1937
UB Pula (dt)
http://www.escape.hr/skpu/index.php?german
UB Rijeka
http://www.svkri.uniri.hr/povijesnazbirka/popisgrade.html
Offenbar nur Schlüsselseiten aus dem Altbestand
Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien
Wikisource
http://de.wikisource.org/wiki/Kroatien
Zagreb
http://de.wikipedia.org/wiki/Zagreb
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=zagreb&qf=COUNTRY:croatia&rows=24
Zeitschriften-Digitalisate (historische)
http://dnc.nsk.hr/Journals/English.aspx
Zeitungen-Digitalisate
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/English.aspx
U.a. Kroatischer Korrespondent 1789 (dt)
Für Istrien: http://ino.com.hr
Rijeka: http://crolist.svkri.hr/liste/002n/
Split: http://dalmatica.svkst.hr/
Viel Spaß bei der virtuellen Reise!
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 22:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Wie immer lesenswert:
http://www.zeit.de/digital/internet/2013-07/kathrin-passig-haltbare-versus-digitale-medien
Als im letzten Winter der Verkauf der Stralsunder Archivbibliothek durch die Presse ging, drehte sich die gesamte Diskussion um die physischen Bücher: Die Gegenstände waren durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen, die Gegenstände waren verkauft worden. Dass diese Gegenstände auch Text enthalten, und dass man diese Inhalte eventuell besser zugänglich machen könnte als in einem feuchten und offenbar nicht besonders seriös verwalteten Archiv, davon war nicht die Rede.
Aufmerksamkeit auf den physischen Gegenstand Buch
Wenn die Stralsunder Bibliothek den Bestand vor dem Verkauf digitalisiert hätte, hätte man in der Diskussion immerhin trennen können zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die Bücher aus historischen Gründen in genau dieser Zusammenstellung an diesem Ort zu behalten. Der gedruckte Text lenkt die Aufmerksamkeit stark auf den physischen Gegenstand Buch, das beeinflusst das Nachdenken über Bücher und die Prioritäten beim Geldausgeben.
http://www.zeit.de/digital/internet/2013-07/kathrin-passig-haltbare-versus-digitale-medien
Als im letzten Winter der Verkauf der Stralsunder Archivbibliothek durch die Presse ging, drehte sich die gesamte Diskussion um die physischen Bücher: Die Gegenstände waren durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen, die Gegenstände waren verkauft worden. Dass diese Gegenstände auch Text enthalten, und dass man diese Inhalte eventuell besser zugänglich machen könnte als in einem feuchten und offenbar nicht besonders seriös verwalteten Archiv, davon war nicht die Rede.
Aufmerksamkeit auf den physischen Gegenstand Buch
Wenn die Stralsunder Bibliothek den Bestand vor dem Verkauf digitalisiert hätte, hätte man in der Diskussion immerhin trennen können zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die Bücher aus historischen Gründen in genau dieser Zusammenstellung an diesem Ort zu behalten. Der gedruckte Text lenkt die Aufmerksamkeit stark auf den physischen Gegenstand Buch, das beeinflusst das Nachdenken über Bücher und die Prioritäten beim Geldausgeben.
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 21:31 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liebe Leserinnen und Leser von Archivalia,
sicher haben die meisten von Ihnen schon Ihre Unterschrift auf
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
geleistet. Wer es noch nicht getan hat, den bitte ich höflich, umgehend mit seiner Unterschrift ein Zeichen der Solidarität mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln und der Kölner Museumsbibliothek zu setzen.

http://www.stadt-koeln.de/5/kulturstadt/historisches-archiv/07163/
sicher haben die meisten von Ihnen schon Ihre Unterschrift auf
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
geleistet. Wer es noch nicht getan hat, den bitte ich höflich, umgehend mit seiner Unterschrift ein Zeichen der Solidarität mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln und der Kölner Museumsbibliothek zu setzen.

http://www.stadt-koeln.de/5/kulturstadt/historisches-archiv/07163/
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 20:47 - Rubrik: Kommunalarchive
Jörn Leonhards Artikel in der Enzyklopädie der Neuzeit 2011 ist online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9090/
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9090/
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 19:44 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://humanitiesscienceblogs.collected.info/
Ein Aggregator für eine Reihe wichtiger deutschsprachiger Wissenschaftsblogs aus den Geisteswissenschaften. Archivalia ist dabei.
Ein Aggregator für eine Reihe wichtiger deutschsprachiger Wissenschaftsblogs aus den Geisteswissenschaften. Archivalia ist dabei.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gegen die Schnapsidee der HRK/DFG, die bei Plagiats-/Betrugsfällen die Information der Öffentlichkeit vor einer internen Untersuchung als unredlich verbieten will (siehe http://archiv.twoday.net/stories/434204837/ ), formiert sich Widerstand.
Stefan Heßbrüggen-Walter hat auch die englischsprachige Welt informiert:
http://www.newappsblog.com/2013/07/whistle-blowing-in-the-german-university-a-regulatory-scandal-in-the-making.html
Bemerkenswert deutlich kritisierte Benjamin Lahusen das Vorhaben:
http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/225-gute-wissenschaftliche-praxis.html
Aber tatsächlich ist es eine groteske, abstruse, geradezu erbärmliche Regel, die nicht die selbstauferlegte Zurückhaltung des Wissenschaftlers bezeugt, sondern in beklagenswerter Weise dokumentiert, wie weitreichend bereits die höchsten Gremien des Wissenschaftsbetriebs von administrativer Kleingeistigkeit beseelt sind. Denn die Wissenschaft ist kein Rechtsstaat, sie ist auch keine Demokratie, sie kennt keine Gewaltenteilung, keine Zuständigkeiten oder Verfahren, sondern im Idealfall nur den Austausch von Argumenten vor dem Forum der Öffentlichkeit. Dort kann sich jeder äußern, jeder kann Kritik üben, und jeder kann sich gegen Kritik verteidigen, ohne daß irgendein Beteiligter Strafe, Sanktionen oder den Einsatz von Juristen fürchten müßte. Es gibt keine Gremien, die kraft institutioneller Zuständigkeit darüber zu befinden hätten, welche Schriften in welcher Weise der Kritik zugänglich sind, es gibt keinen Staatsanwalt, keinen Richter und keinen Vollstrecker, es gibt keine „mutmaßlichen Plagiate“, die irgendwann zu „notorischen Plagiate“ o.ä. erklärt werden können, es gibt auch keine Wahrheitskommissionen oder Politbüros, es gibt nur eine Einheitsgewalt, und die repräsentiert jeder Wissenschaftler gleichermaßen. Wissenschaft ist nicht justitiabel. Es gibt deshalb auch keine wissenschaftliche Unschuldsvermutung, genausowenig wie es eine wissenschaftliche Schuldsvermutung gibt oder überhaupt irgendeine Vermutung. Wissenschaft ist kein adversarisches Verfahren, dessen letztgültige Entscheidung einem Schiedsrichter überantwortet werden könnte und schon gar nicht haben die Universitäten, an denen Wissenschaft in der Regel mehr oder wenig zufällig stattfindet, einen Anspruch auf das erste oder das letzte Wort darüber, wie ihre Produkte in der Öffentlichkeit zu rezipieren sind.
Update: Petition
http://archiv.twoday.net/stories/436952267/
Stefan Heßbrüggen-Walter hat auch die englischsprachige Welt informiert:
http://www.newappsblog.com/2013/07/whistle-blowing-in-the-german-university-a-regulatory-scandal-in-the-making.html
Bemerkenswert deutlich kritisierte Benjamin Lahusen das Vorhaben:
http://www.mops-block.de/bl-tagebuch/225-gute-wissenschaftliche-praxis.html
Aber tatsächlich ist es eine groteske, abstruse, geradezu erbärmliche Regel, die nicht die selbstauferlegte Zurückhaltung des Wissenschaftlers bezeugt, sondern in beklagenswerter Weise dokumentiert, wie weitreichend bereits die höchsten Gremien des Wissenschaftsbetriebs von administrativer Kleingeistigkeit beseelt sind. Denn die Wissenschaft ist kein Rechtsstaat, sie ist auch keine Demokratie, sie kennt keine Gewaltenteilung, keine Zuständigkeiten oder Verfahren, sondern im Idealfall nur den Austausch von Argumenten vor dem Forum der Öffentlichkeit. Dort kann sich jeder äußern, jeder kann Kritik üben, und jeder kann sich gegen Kritik verteidigen, ohne daß irgendein Beteiligter Strafe, Sanktionen oder den Einsatz von Juristen fürchten müßte. Es gibt keine Gremien, die kraft institutioneller Zuständigkeit darüber zu befinden hätten, welche Schriften in welcher Weise der Kritik zugänglich sind, es gibt keinen Staatsanwalt, keinen Richter und keinen Vollstrecker, es gibt keine „mutmaßlichen Plagiate“, die irgendwann zu „notorischen Plagiate“ o.ä. erklärt werden können, es gibt auch keine Wahrheitskommissionen oder Politbüros, es gibt nur eine Einheitsgewalt, und die repräsentiert jeder Wissenschaftler gleichermaßen. Wissenschaft ist nicht justitiabel. Es gibt deshalb auch keine wissenschaftliche Unschuldsvermutung, genausowenig wie es eine wissenschaftliche Schuldsvermutung gibt oder überhaupt irgendeine Vermutung. Wissenschaft ist kein adversarisches Verfahren, dessen letztgültige Entscheidung einem Schiedsrichter überantwortet werden könnte und schon gar nicht haben die Universitäten, an denen Wissenschaft in der Regel mehr oder wenig zufällig stattfindet, einen Anspruch auf das erste oder das letzte Wort darüber, wie ihre Produkte in der Öffentlichkeit zu rezipieren sind.
Update: Petition
http://archiv.twoday.net/stories/436952267/
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 18:32 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 1. Juli 2013, 18:29 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22766029
Ulinka Rublack macht um sie einen ziemlichen Wirbel, siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/404098185/
Wenn es im BBC-Artikel heißt: "The book is kept in a small museum in Braunschweig, Germany. It has not been widely studied until now and Schwarz himself has been viewed by historians as a bit of a curiosity, says Rublack, who rediscovered the book." Dann ist das glatt gelogen.
Im Vergleich zum British Museum mag wohl jedes deutsche Museum "klein" sein. Fakt ist, dass das Herzog Anton Ulrich-Museum eines der bedeutendsten deutschen Regionalmuseen ist.
Fakt ist auch, dass von einer "Wiederentdeckung" überhaupt keine Rede sein kann. Schon vor der Edition von August Fink 1963 waren die Trachtenbücher bekannt, und die Arbeit von Fink wurde und wird breit rezipiert:
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22
http://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22&btnG=&lr=
In der führenden deutschsprachigen Frühneuzeit-Zeitschrift (ZHF) publizierte Valentin Groebner schon 1998: "Die Kleider des Körpers des Kaufmanns".
[ http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a038739.pdf ]
Auch im englischsprachigen Bereich kann man von einer Wiederentdeckung nicht sprechen. 2003 erschien in der Zeitschrift Gender & History von Gabriele Mentges: Fashion, Time and the Consumption of a Renaissance Man in Germany: The Costume Book of Matthäus Schwarz of Augsburg, 1496–1564.
Die Hannover'sche Abschrift aus dem 18. Jahrhundert ist online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trachtenbuch_des_Matthaus_Schwarz_aus_Augsburg,1520_-_1560.PDF
Leider sind kaum Bilder aus der Originalhandschrift im Netz verfügbar.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022503742/
Ulinka Rublack macht um sie einen ziemlichen Wirbel, siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/404098185/
Wenn es im BBC-Artikel heißt: "The book is kept in a small museum in Braunschweig, Germany. It has not been widely studied until now and Schwarz himself has been viewed by historians as a bit of a curiosity, says Rublack, who rediscovered the book." Dann ist das glatt gelogen.
Im Vergleich zum British Museum mag wohl jedes deutsche Museum "klein" sein. Fakt ist, dass das Herzog Anton Ulrich-Museum eines der bedeutendsten deutschen Regionalmuseen ist.
Fakt ist auch, dass von einer "Wiederentdeckung" überhaupt keine Rede sein kann. Schon vor der Edition von August Fink 1963 waren die Trachtenbücher bekannt, und die Arbeit von Fink wurde und wird breit rezipiert:
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22
http://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=fink+%22schwarzschen+trachtenb%C3%BCcher%22&btnG=&lr=
In der führenden deutschsprachigen Frühneuzeit-Zeitschrift (ZHF) publizierte Valentin Groebner schon 1998: "Die Kleider des Körpers des Kaufmanns".
[ http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a038739.pdf ]
Auch im englischsprachigen Bereich kann man von einer Wiederentdeckung nicht sprechen. 2003 erschien in der Zeitschrift Gender & History von Gabriele Mentges: Fashion, Time and the Consumption of a Renaissance Man in Germany: The Costume Book of Matthäus Schwarz of Augsburg, 1496–1564.
Die Hannover'sche Abschrift aus dem 18. Jahrhundert ist online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trachtenbuch_des_Matthaus_Schwarz_aus_Augsburg,1520_-_1560.PDF
Leider sind kaum Bilder aus der Originalhandschrift im Netz verfügbar.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022503742/
KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 19:21 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Seit langem ist klar, dass Marino Massimo De Caro, ehemaliger Leiter der von ihm geplünderten Giroloamini-Bibliothek, umfangreiche Diebstähle in weiteren Altbestandsbibliotheken zu verantworten hat. Die jetzt beschlagnahmten Bücher stammen aus der Bibliothek des Landwirtschaftsministeriums. Der damalige Minister hatte ihm den Zutritt verschafft.
http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_21/recuperati-libri-rubati_a4a64f52-da54-11e2-9d67-b685cbe4cbd5.shtml
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini
http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_21/recuperati-libri-rubati_a4a64f52-da54-11e2-9d67-b685cbe4cbd5.shtml
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/06/new-acquisitions-in-manuscript-and-print.html
http://archiv.twoday.net/search?q=mendham
http://archiv.twoday.net/search?q=mendham
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.brown.edu/academics/libraries/john-carter-brown/events-publications/publications-online
Hierzulande heucheln die Bibliotheken Open Access: Die meisten denken überhaupt nicht daran, wenigstens ihre vergriffenen Publikationen zu scannen und ins Netz zu stellen oder die bereits in HathiTrust gescannten Publikationen freizugeben.
Zur Freigabe siehe
http://archiv.twoday.net/stories/38745443/
Hierzulande heucheln die Bibliotheken Open Access: Die meisten denken überhaupt nicht daran, wenigstens ihre vergriffenen Publikationen zu scannen und ins Netz zu stellen oder die bereits in HathiTrust gescannten Publikationen freizugeben.
Zur Freigabe siehe
http://archiv.twoday.net/stories/38745443/
KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 19:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Meint die WELT:
http://www.welt.de/kultur/article117547271/25-Kilometer-Akten-Millionen-von-Schicksalen.html
"Dabei stellen sich der Historikerin auch Fragen nach der Geschichte der eigenen Institution. Warum wurde eine historische Abteilung wieder geschlossen, die in den Fünfzigerjahren eine Dokumentation über die Todesmärsche erarbeitet hatte, eine Arbeit, die jetzt zum Abschluss gebracht wurde? Warum ist ein Haftstättenverzeichnis als Grundlage für die Beurteilung von Entschädigungsansprüchen erschienen, der geplante Ergänzungsband zu den Gettos aber nie?
Arolsen ist jetzt für Jedermann zugänglich. Die neue Leitung fühlt sich der Wissenschaft und der politisch-historischen Bildung verpflichtet. Aber die professionelle Historisierung der NS-Vergangenheit fremdelt noch etwas im hessischen Waldland. Krieg und Nachkrieg hängen hier nicht nur in den Akten, sondern ein bisschen auch noch in der Luft."
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/434213556/
der auf die Bibliographie
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/tantner/wiki/index.php?title=Suchdienst_des_Roten_Kreuz
hinweist.
http://www.welt.de/kultur/article117547271/25-Kilometer-Akten-Millionen-von-Schicksalen.html
"Dabei stellen sich der Historikerin auch Fragen nach der Geschichte der eigenen Institution. Warum wurde eine historische Abteilung wieder geschlossen, die in den Fünfzigerjahren eine Dokumentation über die Todesmärsche erarbeitet hatte, eine Arbeit, die jetzt zum Abschluss gebracht wurde? Warum ist ein Haftstättenverzeichnis als Grundlage für die Beurteilung von Entschädigungsansprüchen erschienen, der geplante Ergänzungsband zu den Gettos aber nie?
Arolsen ist jetzt für Jedermann zugänglich. Die neue Leitung fühlt sich der Wissenschaft und der politisch-historischen Bildung verpflichtet. Aber die professionelle Historisierung der NS-Vergangenheit fremdelt noch etwas im hessischen Waldland. Krieg und Nachkrieg hängen hier nicht nur in den Akten, sondern ein bisschen auch noch in der Luft."
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/434213556/
der auf die Bibliographie
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/tantner/wiki/index.php?title=Suchdienst_des_Roten_Kreuz
hinweist.
KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 18:50 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige Schätze aus dem Bayer-Filmarchiv, das vom Wirtschaftsarchivar Michael Frings betreut wird, präsentiert die Lokalzeit Bonn (ab 17' 40''). Rasch gucken, bevor depubliziert wird:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-bonn/videokompakt1374_size-L.html?autostart=true#banner
Via Monika Marner auf Archivfragen (geschlossene Gruppe auf Facebook = FB)
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-bonn/videokompakt1374_size-L.html?autostart=true#banner
Via Monika Marner auf Archivfragen (geschlossene Gruppe auf Facebook = FB)
KlausGraf - am Sonntag, 30. Juni 2013, 18:40 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anders als Schmalenstroer bin ich ja nicht do der Tech-Freak, aber nach Hinweis auf Twitter habe ich artig auf aufhttp://allyourfeed.ludios.org:8080/index.html
meinen Reader-Takeout (ZIP) hochgeladen, hoffe es hat geklappt. Wenn ich noch etwas anderes tun soll, kann Schmalenstroer mich ja noch kontaktieren.
Mehr dazu
http://schmalenstroer.net/blog/2013/06/projekt-gecachte-feeds-retten/
Alternativen zum Google-Reader
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/montag-ist-schluss-fuenf-alternativen-zum-google-reader-a-908316.html
meinen Reader-Takeout (ZIP) hochgeladen, hoffe es hat geklappt. Wenn ich noch etwas anderes tun soll, kann Schmalenstroer mich ja noch kontaktieren.
Mehr dazu
http://schmalenstroer.net/blog/2013/06/projekt-gecachte-feeds-retten/
Alternativen zum Google-Reader
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/montag-ist-schluss-fuenf-alternativen-zum-google-reader-a-908316.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr wahrscheinlich im Nürnberger Klarissenkloster entstand in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das deutschsprachige "St. Klara-Buch", Schriften zum Leben und Lob von Klara von Assisi.
Kurt Ruh im ²VL
http://www.libreka.de/9783110088380/593
Jüngst hat die SB Bamberg ihr Msc. hist. 146, geschrieben um 1380/90 von Nürnberger Klarissin Katharina Hofmann ins Netz gestellt:
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4703665
Freunde illuminierter Handschriften hätten sich dagegen über die Schwesterhandschrift hist. 147 eher gefreut.
Von den 9 Handschriften unter
http://www.handschriftencensus.de/werke/1735
liegen fünf digital vor (neu Bamberg hist. 146, zuvor schon beide Dresdener Codices, Cgm 5730 und Prag).
Ein anderes, von Sibylla von Bondorf in Straßburg illuminiertes Klarenbuch, das mit dem St. Klarabuch nicht verwechselt werden darf, liegt in Karlsruhe und ist online:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-11552

Kurt Ruh im ²VL
http://www.libreka.de/9783110088380/593
Jüngst hat die SB Bamberg ihr Msc. hist. 146, geschrieben um 1380/90 von Nürnberger Klarissin Katharina Hofmann ins Netz gestellt:
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4703665
Freunde illuminierter Handschriften hätten sich dagegen über die Schwesterhandschrift hist. 147 eher gefreut.
Von den 9 Handschriften unter
http://www.handschriftencensus.de/werke/1735
liegen fünf digital vor (neu Bamberg hist. 146, zuvor schon beide Dresdener Codices, Cgm 5730 und Prag).
Ein anderes, von Sibylla von Bondorf in Straßburg illuminiertes Klarenbuch, das mit dem St. Klarabuch nicht verwechselt werden darf, liegt in Karlsruhe und ist online:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-11552

KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 18:20 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/rotulus
Irgendwann 1987 erörterten wir bei der Kaffeerunde des GLA - damals war ich Referendar - die Frage, wie man denn wohl in der Sprache der Brauerschen Rubriken einen Rotulus benennen könnte. Wir kamen auf Rollsache.

Irgendwann 1987 erörterten wir bei der Kaffeerunde des GLA - damals war ich Referendar - die Frage, wie man denn wohl in der Sprache der Brauerschen Rubriken einen Rotulus benennen könnte. Wir kamen auf Rollsache.
KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 18:03 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4814
"Online stehen 56 der 75 ausgestellten Handschriften, von drei weiteren gibt es Teildigitalisate. Aus konservatorischen Gründen konnten nicht alle Handschriften gescannt werden."
Was man ausstellen kann, kann man auch digitalisieren.

"Online stehen 56 der 75 ausgestellten Handschriften, von drei weiteren gibt es Teildigitalisate. Aus konservatorischen Gründen konnten nicht alle Handschriften gescannt werden."
Was man ausstellen kann, kann man auch digitalisieren.

KlausGraf - am Samstag, 29. Juni 2013, 17:24 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vom 26. bis 29. Juni trafen sich die Archivare von Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen im Internationalen Archivrat (ICA-SUV) zu ihrer Jahreskonferenz auf dem Cave Hill Campus der University of the West Indies auf der Insel Barbados. Eingeladen hatten die Universität und The West Indies Federal Archives Centre. Die Tagung stand unter dem Leitthema „The New Age Archivist: Managing Archives in a Digital World“, um ein Forum zu bieten, auf dem Experten aus aller Welt neue Trends auf den Gebieten der Digitalisierung, der elektronischen Akten und der Möglichkeiten des Internets (Web 2.0, Social Media, Cloud Archiving) im Hinblick auf die tatsächlichen und noch erforderlichen Wechselwirkungen mit den archivischen Kernaufgaben zu erörtern. In sieben Arbeitssitzungen zeigten insgesamt 22 Referenten ihre Präsentationen zu den Themenbereichen, unter ihnen als Keynote Speakers Sir Hilary Beckles, Luciana Duranti, Henry Fraser und Kenneth Thibodeau.
Es folgt eine vorläufige Zusammenfassung, die sich auf einige wesentliche Konferenzgegenstände beschränkt und diese schlaglichtartig beleuchtet
Eine der Fragen, die sich explizit oder implizit wie ein roter Faden durch die Vorträge zog, war die nach der Rolle von Standards in der digitalen Archivierung und in der Auswertung digitaler Unterlagen in archivbezogenen Onlineangeboten, der sich als erster explizit Alan Bell in seinem Beitrag über die andauernde Relevanz professioneller Rahmenvorgaben in einer vernetzten Welt stellte.
Wenngleich sich die Teilnehmer über die grundsätzliche Bedeutung der jeweils im einzelnen einschlägigen Standards weitestgehend einig waren, wurde doch deutlich, dass bei den Archivaren eine gewisse Kompromissbereitschaft entstehen sollte, die insbesondere im Konfliktfall zwischen archivwissenschaftlicher Dogmatik und der mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik und Software zu erreichenden Umsetzbarkeit vorteilhaft sein könnte. Dabei blieben unverrückbare Anforderungen kompromisslos aufrechtzuerhalten, insbesondere, wenn es um rechtliche Vorgaben wie zum Beispiel des Daten- oder Persönlichkeitsschutz geht. Luciana Duranti ging in ihrem Vortrag auf das Problem der Vertrauenswürdigkeit digitaler Archivalien ein und beleuchtete Fragen der Sicherstellung von Authentizität und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Archiv. Bezug nehmend auf das InterPares Trust Projekt ging sie auf die Vertrauenswürdigkeit von Archivierung in der „Cloud“, also in unterschiedlich gestalteten webbasierten Speicherverfahren bei Drittanbietern ein. Es wurde sowohl hier als auch aus den Ergebnissen weiterer Referenten klar, dass ohne eindeutige und verbindliche Vorgaben der Archivare an solche Dritte eine Cloudarchivierung den Grundsätzen authentischer Überlieferungsbildung nicht oder wenigstens nicht nachprüfbar entsprechen kann.
Gravan McCarthy konzentrierte sich in seinem Beitrag auf den deskriptiven Standard EAC und stellte das Projekt „Find and Connect“ der australischen Regierung vor. Darin wird EAC nicht mehr nur zur Beschreibung von Überlieferungsbildnern, sondern generell zur Beschreibung von Entitäten genutzt, d.h. für Akteure ebenso wie zum Beispiel auch für Events. Karsten Kühnel veranschaulichte die Bedeutung der Beschreibung von Funktionen in einem Erschließungssystem, das Beziehungen und Beziehungsgemeinschaften zur Grundlage virtueller Bestandsbildung macht, und bemängelte dabei das Fehlen eines EAC-F-Profils, um Funktionen analog zum ISDF-Standard in einem digitalen Austauschformat beschreiben zu können.
Mit der archivischen Erschließung befasste sich auch Geoffrey Yeo, der nach einem Wandel der Möglichkeiten fragte, die Archivare in einer digitalen Umgebung zur Erhebung von Erschließungsinformation haben. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Fülle der während des administrativen Bearbeitungsprozesses entstehenden deskriptiven, aber auch präservativen Metadaten bei entsprechender Standardisierung im vorarchivischen Bereich einfach nur automatisch abgeschöpft werden könnten und damit die Erschließungstätigkeit in den Archiven langfristig spürbar entlastet würde. Bemerkenswert war sein Hinweis, dass dann möglicherweise mehr Zeit auf die Auswertung von Archivgut und auf die Erstellung sachthematischer oder projektbezogener Inventare verwandt werden könnte.
Eine Reihe von Beitragen befasste sich mit den Beziehungen zwischen der Anwendung von Social Media und der Archivierung von Social Media Records. Schwierig erschien in diesem Zusammenhang überhaupt die korrekte Verwendung des Begriffs „Records“. Es zeigte sich in der Diskussion, wie wichtig es ist, neben oder besser vor der Untersuchung über Möglichkeiten der Archivierung eine wenigstens abschätzende Bewertung vorzunehmen und die Funktion der Social Media Applikation in der eigenen Institution bzw. in den vom Archiv zu betreuenden Institutionen zu analysieren. In sehr vielen Fällen erscheint die institutionelle Social Media-Nutzung nicht zentraler Ausfluss einer Aufgabenwahrnehmung der Institution zu sein.
Wegen ihrer besonderen Thematik in dieser vorläufigen Zusammenfassung der Konferenz noch herauszuhebende Beiträge waren die von Jay Gaidmore über die Behandlung von Akten studentischer Organisationen, von Laura Jackson über die Archivierung und Auswertbarkeit von E-Mail-Accounts hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf die Aktenüberlieferung einer Provenienzstelle sowie der Beitrag von Ruth Frendo, die die unterschiedlichen methodischen Anforderungen in wissenschaftlichen Institutionen mit speziellen Mandaten verdeutlichte, die zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Signifikanz von Inhalts- und Kontextinformation führen können.
Die nächste SUV-Konferenz wird im Juli 2014 in Paris stattfinden. Der Call for Papers wird bereits in wenigen Wochen auf der Sektionswebsite http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php veröffentlicht werden.
Es folgt eine vorläufige Zusammenfassung, die sich auf einige wesentliche Konferenzgegenstände beschränkt und diese schlaglichtartig beleuchtet
Eine der Fragen, die sich explizit oder implizit wie ein roter Faden durch die Vorträge zog, war die nach der Rolle von Standards in der digitalen Archivierung und in der Auswertung digitaler Unterlagen in archivbezogenen Onlineangeboten, der sich als erster explizit Alan Bell in seinem Beitrag über die andauernde Relevanz professioneller Rahmenvorgaben in einer vernetzten Welt stellte.
Wenngleich sich die Teilnehmer über die grundsätzliche Bedeutung der jeweils im einzelnen einschlägigen Standards weitestgehend einig waren, wurde doch deutlich, dass bei den Archivaren eine gewisse Kompromissbereitschaft entstehen sollte, die insbesondere im Konfliktfall zwischen archivwissenschaftlicher Dogmatik und der mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik und Software zu erreichenden Umsetzbarkeit vorteilhaft sein könnte. Dabei blieben unverrückbare Anforderungen kompromisslos aufrechtzuerhalten, insbesondere, wenn es um rechtliche Vorgaben wie zum Beispiel des Daten- oder Persönlichkeitsschutz geht. Luciana Duranti ging in ihrem Vortrag auf das Problem der Vertrauenswürdigkeit digitaler Archivalien ein und beleuchtete Fragen der Sicherstellung von Authentizität und Vertrauenswürdigkeit im digitalen Archiv. Bezug nehmend auf das InterPares Trust Projekt ging sie auf die Vertrauenswürdigkeit von Archivierung in der „Cloud“, also in unterschiedlich gestalteten webbasierten Speicherverfahren bei Drittanbietern ein. Es wurde sowohl hier als auch aus den Ergebnissen weiterer Referenten klar, dass ohne eindeutige und verbindliche Vorgaben der Archivare an solche Dritte eine Cloudarchivierung den Grundsätzen authentischer Überlieferungsbildung nicht oder wenigstens nicht nachprüfbar entsprechen kann.
Gravan McCarthy konzentrierte sich in seinem Beitrag auf den deskriptiven Standard EAC und stellte das Projekt „Find and Connect“ der australischen Regierung vor. Darin wird EAC nicht mehr nur zur Beschreibung von Überlieferungsbildnern, sondern generell zur Beschreibung von Entitäten genutzt, d.h. für Akteure ebenso wie zum Beispiel auch für Events. Karsten Kühnel veranschaulichte die Bedeutung der Beschreibung von Funktionen in einem Erschließungssystem, das Beziehungen und Beziehungsgemeinschaften zur Grundlage virtueller Bestandsbildung macht, und bemängelte dabei das Fehlen eines EAC-F-Profils, um Funktionen analog zum ISDF-Standard in einem digitalen Austauschformat beschreiben zu können.
Mit der archivischen Erschließung befasste sich auch Geoffrey Yeo, der nach einem Wandel der Möglichkeiten fragte, die Archivare in einer digitalen Umgebung zur Erhebung von Erschließungsinformation haben. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Fülle der während des administrativen Bearbeitungsprozesses entstehenden deskriptiven, aber auch präservativen Metadaten bei entsprechender Standardisierung im vorarchivischen Bereich einfach nur automatisch abgeschöpft werden könnten und damit die Erschließungstätigkeit in den Archiven langfristig spürbar entlastet würde. Bemerkenswert war sein Hinweis, dass dann möglicherweise mehr Zeit auf die Auswertung von Archivgut und auf die Erstellung sachthematischer oder projektbezogener Inventare verwandt werden könnte.
Eine Reihe von Beitragen befasste sich mit den Beziehungen zwischen der Anwendung von Social Media und der Archivierung von Social Media Records. Schwierig erschien in diesem Zusammenhang überhaupt die korrekte Verwendung des Begriffs „Records“. Es zeigte sich in der Diskussion, wie wichtig es ist, neben oder besser vor der Untersuchung über Möglichkeiten der Archivierung eine wenigstens abschätzende Bewertung vorzunehmen und die Funktion der Social Media Applikation in der eigenen Institution bzw. in den vom Archiv zu betreuenden Institutionen zu analysieren. In sehr vielen Fällen erscheint die institutionelle Social Media-Nutzung nicht zentraler Ausfluss einer Aufgabenwahrnehmung der Institution zu sein.
Wegen ihrer besonderen Thematik in dieser vorläufigen Zusammenfassung der Konferenz noch herauszuhebende Beiträge waren die von Jay Gaidmore über die Behandlung von Akten studentischer Organisationen, von Laura Jackson über die Archivierung und Auswertbarkeit von E-Mail-Accounts hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf die Aktenüberlieferung einer Provenienzstelle sowie der Beitrag von Ruth Frendo, die die unterschiedlichen methodischen Anforderungen in wissenschaftlichen Institutionen mit speziellen Mandaten verdeutlichte, die zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Signifikanz von Inhalts- und Kontextinformation führen können.
Die nächste SUV-Konferenz wird im Juli 2014 in Paris stattfinden. Der Call for Papers wird bereits in wenigen Wochen auf der Sektionswebsite http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php veröffentlicht werden.
Kühnel Karsten - am Samstag, 29. Juni 2013, 06:50 - Rubrik: Universitaetsarchive
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/html
Nürnberg GNM Hs. 3994a von 1526 stammt aus dem Besitz von Bartholomäus Haller - Bl. 1r Allianzwappen Haller/Memminger http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/7/html - und wurde von Lotte Kurras beschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b029_JPG.htm
Als Überlieferung der Nürnberger Chronik Sigismund Meisterlins war die Handschrift für die Ausgabe in den Chroniken der deutschen Städte Bd. 3 (1864) von großem Wert:
http://books.google.de/books?id=fcgFAAAAQAAJ&pg=PA24
Einige Monate später, im August 1526, entstand eine Abschrift der Meisterlin-Chronik dieser Handschrift, die der gleiche Schreiber schrieb. Die "Chroniken" geben als Signatur Stadtbibliothek Nürnberg "Fol. Sch. 198" an.
Rätselhaft war für mich zunächst die Angabe in der Ausgabe der "Etlichen Geschichten 1488-1491" (in unserer Handschrift Bl. 125r-135v)
http://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n281/mode/2up
zu beigebundenen Handschriften von Hs. 3994a, da Kurras darauf nicht eingeht. Es handelt sich um Teile der Handschrift mit eigenen (Alt-)Signaturen! (Siehe auch
http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68 )
Christoph Scheurl trug Bl. 79r eigenhändig eine Notiz zu 906 ein.
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/165/html/z600
Bl. 81r-123v wird von Kurras als ein Autograph des Herolds Georg Rüxnerangegeben und zwar als eine Abschrift aus seinem später 1530 gedruckten Turnierbuch. Für den Text ab Bl. 82r und die Wappenbeischrift Bl. 81v besteht daran kein Zweifel. Ich kann aber weder Bl. 81r und die nachträglichen Überschriften als Rüxners Hand anerkennen. Die einzelnen (fiktiven) Turniere (Nürnberg, Würzburg, Regensburg und Schweinfurt) sind auf einzelne Papierlagen mit Leerseiten dazwischen geschrieben. Bl. 97v findet sich Rüxners Wappen und Unterschrift:
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/202/html/z600
(Dazu schon: http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ )
Kurras 1982 spricht von einem nachträglich eingefügten Titelblatt:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000985,00376.html
Bl. 81r nennt Blattzahlen (181, 214, 227, 234) und Nummern (12, 14, 15, 16) der Turniere aus einem Turnierbuch Pfalzgraf Johanns (II.) von Pfalz-Simmern, das in schwarzes Leder gebunden sei. Diese Angaben (ohne die Nummern der Turniere, wobei zu beachten ist, dass Rüxner selbst die Nummer nur beim 12. Nürnberger Turnier nennt) wurden nachträglich den Rüxner'schen Texten als Überschriften hinzugefügt. Ich bin wie Kurras bisher davon ausgegangen, dass eine handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs vorliegt, aber beweisbar erscheint mir das nicht mehr. Überprüfbar sind im Netz die Blattzahlen der in Simmern erschienenen Rodler'schen Ausgaben von 1530 (172, 202, 213, 218) und 1532, sie stimmen nicht überein. Die Druckvarianten der Ausgabe von 1532 variieren nicht in der Anzahl der Blätter.
Kann der VD 16 keine römischen Ziffern mehr lesen? "ccxiij[=214]" ist ja schon recht peinlich:
http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+21971
Für die Ausgabe von 1533 (noch nicht online) gilt die gleiche Kollation, abweichende Blattzahlen sind also nicht gegeben.
Auf die Haller als Besitzer der Ausgabe von 1532 verweist folgender Umstand: Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).
Bleibt die Hoffnung auf eine Auskunft aus dem Bayerischen Nationalmuseum, das am 14. August 2008 eine bibliographisch bislang nicht beschriebene (und daher auch nicht im VD 16, geschweige denn in Jakob Klingners überschätztem Buch zu den Minnereden im Druck, der die Rodler'sche Presse einmal mehr breittritt, präsente) Simmern'sche Rüxner-Ausgabe mitteilte (spätere Nachfragen aber unbeantwortet ließ):
ANfang / vrsprung vnd herkommen des Thurniers inn Teutscher nation...", "Getruckt zu Siemmern/ durch Jheronimus Rodler/ Secretarius daselbst. Vollendet auff den Fünffundzwentzigsten tag Februarius. Im jar als man zalt nach der geburt Cristi. D. M. xxxv." Die Mehrzahl der Holzschnitte ist koloriert. Das Buch verfügt über einen Ledereinband von 1537, der für Bartholmes Haller vom Hallerstain angefertigt wurde. (Eingeprägter Titel: DVRNIERBVCH DER XXXVI DVRNIER IM H RO REYCH GEHALTEN sowie das Reichswappen und ein Profilbildnis Karls V.). Später befand es sich nach einem Exlibris in der Bibliothek von Christoph Andreas Imhof, "Abet in Helmstatt". Signatur: Waffen 3657.
(Hinweis 2009 auf die Ausgabe von mir:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/ )
Also auch hier ein Exemplar aus der Bibliothek Bartholomäus Hallers.
Sollte nicht wider Erwarten diese Ausgabe die genannten Blattzahlen aufweisen (dass es sich bei der Vorlage der Nürnberger Vergleichs-Einträge um eine Handschrift handelt, wird nicht explizit gesagt), möchte ich eher an eine nach einer der Simmerner Ausgaben ab 1530 angefertigte handschriftliche Druckabschrift als an eine unbekannte handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs denken. Bl. 81r und die späteren Überschriften können ohne weiteres der Zeit nach 1530 angehören. Ein handschriftliches Turnierbuch Johanns II., das dem Druck vorangegangen ist, ist durch die Nürnberger Handschrift nicht schlüssig zu belegen.
Dass entgegen der Ansicht im Heidelberger Handschriftenkatalog der Widmungsbrief Rüxners
http://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_einen_F%C3%BCrsten_%28R%C3%BCxner%29
sich nicht notwendigerweise an Johann II. richtete, habe ich bereits früher betont (siehe Graf 2009 bei Freidok und http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ ).
Gegenüber dem gedruckten Turnierbuch von 1530 weicht, wie schon Kurras feststellte, die Handschrift erheblich ab, z.B. ist die Reihenfolge der Werber beim 16. Schweinfurter Turnier eine andere. (NB: alle Turniere der Nürnberger Handschrift sind von Rüxner erfunden!)
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/243/html/z600
zu vergleichen mit
http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT475
Der folgende beschreibende Text ist im Druck gekürzt (es fehlen die Namen der Turnierlande, am Schluss fehlen die Dänke). Im Druck folgt die Liste der Teilnehmer, während in der Handschrift die Bestellung von acht Personen sich anschließt, ohne dass wie im Druck Alte und Junge gekennzeichnet werden. Bei Jakob von Bodman hat der Druck Job. In der Handschrift steht irrtümlich "disse zwölff", was im Druck in "Diese Acht" korrigiert ist. Die Namen der 12 stimmen überein (abgesehen von orthographischen Differenzen). Bei den folgenden Jungfrauen hat der Druck "Freyburg", wo die Handschrift "Peussing" hat. Bei denjenigen, die man zu Blatt getragen hat und die die Seile hielten, lässt der Druck die erstere Eigenschaft weg. Die Namen sind identisch, die Reihenfolge ist anders. Das gilt auch für die Grieswertel. Die vier neuen Könige stehen in der Handschrift nach der folgenden Teilnehmerliste. Ein abschließender formelhafter Absatz zu den Dänken fehlt im Druck. Auch in der Teilnehmerliste gibt es Abweichungen - Details spare ich mir.
Da die Namen erfunden sind, sind die Abweichungen nur von Belang, wenn es um die historiographische Werkstatt Rüxners geht. Schon die Stichprobe zum Schweinfurter Turnier zeigt, dass Rüxner im Turnierbuch seine eigenen früheren Aufzeichnungen stark redigiert und teilweise geändert hat.
Zur Arbeitsweise Rüxners bei den Vierlandeturnieren habe ich einige Beobachtungen in meiner Beitragsreihe zu den Vierlandeturnieren vorgelegt:
http://archiv.twoday.net/search?q=vierlande
Die "Etlichen Geschichten" übergehend (siehe oben), komme ich nun zur Aufzeichnung Bl. 137r-144v über das Bamberger Turnier 1486 (in der Handschrift ohne die Nummer 34!), die nicht von Rüxners Hand stammt (aber auch nicht von der Hand der Meisterlin-Chronik und der deutlich jüngeren Hand der abschließenden Turnierordnung), aber sicher auf ihn zurückgeht. Die Abweichungen gegenüber dem gedruckten Turnierbuch wurden bereits im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1853 aufgelistet:
http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68
Ludwig Albert von Gumppenberg: Nachrichten über die Turniere zu Würzburg und Bamberg in den jahren 1479 und 1486. In: Archiv des Historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg 19 (1866), S. 164-210, hier S. 194-210 hat den Abschnitt vollständig abgedruckt:
https://books.google.de/books?id=tbxAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA194
Zu seinen Arbeiten:
http://archiv.twoday.net/stories/83809128/
Zum Bamberger Turnier 1486 nenne ich nur die ausführlichen Beschreibungen:
Gumppenberg aus Raidenbuchers Turnierbuch, das verschollen ist
http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&pg=PA132
Eyb'sches Turnierbuch Cgm 961
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_206
Rüxner 1530
http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT799
Die abschließende Turnierordnung Bl. 146r-152r druckte Gumppenberg 1862 als "Verhandlungen zu Nürnberg im Jahre 1482" aus dem verschollenen Turnierbuch Raidenbuchers, gab aber die Abweichungen der Nürnberger Handschrift an:
http://books.google.de/books?id=6NFAAAAAcAAJ&pg=PA83
Man hätte sich gewünscht, dass Kurras entgegen den drakonischen Vorgaben der DFG zur Beschreibung neuzeitlicher Handschriften die beiden Gumppenberg-Abdrucke nachgewiesen hätte.
Das Nürnberger Digitalisat ermöglicht hinsichtlich der fiktiven Turniere einen willkommenen Einblick in Rüxners (Fälscher-)Werkstatt, für das Bamberger Turnier ermöglicht es die Kontrolle von Gumppenbergs Abdruck, für die Turnierordnung steht eine der beiden bekannten Überlieferungen und zwar die einzig noch greifbare nun im Netz. Grund genug, dem Germanischen Nationalmuseum für seine Handschriftendigitalisate zu danken.
#forschung
#fnzhss
Nürnberg GNM Hs. 3994a von 1526 stammt aus dem Besitz von Bartholomäus Haller - Bl. 1r Allianzwappen Haller/Memminger http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/7/html - und wurde von Lotte Kurras beschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b029_JPG.htm
Als Überlieferung der Nürnberger Chronik Sigismund Meisterlins war die Handschrift für die Ausgabe in den Chroniken der deutschen Städte Bd. 3 (1864) von großem Wert:
http://books.google.de/books?id=fcgFAAAAQAAJ&pg=PA24
Einige Monate später, im August 1526, entstand eine Abschrift der Meisterlin-Chronik dieser Handschrift, die der gleiche Schreiber schrieb. Die "Chroniken" geben als Signatur Stadtbibliothek Nürnberg "Fol. Sch. 198" an.
Rätselhaft war für mich zunächst die Angabe in der Ausgabe der "Etlichen Geschichten 1488-1491" (in unserer Handschrift Bl. 125r-135v)
http://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n281/mode/2up
zu beigebundenen Handschriften von Hs. 3994a, da Kurras darauf nicht eingeht. Es handelt sich um Teile der Handschrift mit eigenen (Alt-)Signaturen! (Siehe auch
http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68 )
Christoph Scheurl trug Bl. 79r eigenhändig eine Notiz zu 906 ein.
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/165/html/z600
Bl. 81r-123v wird von Kurras als ein Autograph des Herolds Georg Rüxnerangegeben und zwar als eine Abschrift aus seinem später 1530 gedruckten Turnierbuch. Für den Text ab Bl. 82r und die Wappenbeischrift Bl. 81v besteht daran kein Zweifel. Ich kann aber weder Bl. 81r und die nachträglichen Überschriften als Rüxners Hand anerkennen. Die einzelnen (fiktiven) Turniere (Nürnberg, Würzburg, Regensburg und Schweinfurt) sind auf einzelne Papierlagen mit Leerseiten dazwischen geschrieben. Bl. 97v findet sich Rüxners Wappen und Unterschrift:
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/202/html/z600
(Dazu schon: http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ )
Kurras 1982 spricht von einem nachträglich eingefügten Titelblatt:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000985,00376.html
Bl. 81r nennt Blattzahlen (181, 214, 227, 234) und Nummern (12, 14, 15, 16) der Turniere aus einem Turnierbuch Pfalzgraf Johanns (II.) von Pfalz-Simmern, das in schwarzes Leder gebunden sei. Diese Angaben (ohne die Nummern der Turniere, wobei zu beachten ist, dass Rüxner selbst die Nummer nur beim 12. Nürnberger Turnier nennt) wurden nachträglich den Rüxner'schen Texten als Überschriften hinzugefügt. Ich bin wie Kurras bisher davon ausgegangen, dass eine handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs vorliegt, aber beweisbar erscheint mir das nicht mehr. Überprüfbar sind im Netz die Blattzahlen der in Simmern erschienenen Rodler'schen Ausgaben von 1530 (172, 202, 213, 218) und 1532, sie stimmen nicht überein. Die Druckvarianten der Ausgabe von 1532 variieren nicht in der Anzahl der Blätter.
Kann der VD 16 keine römischen Ziffern mehr lesen? "ccxiij[=214]" ist ja schon recht peinlich:
http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+21971
Für die Ausgabe von 1533 (noch nicht online) gilt die gleiche Kollation, abweichende Blattzahlen sind also nicht gegeben.
Auf die Haller als Besitzer der Ausgabe von 1532 verweist folgender Umstand: Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).
Bleibt die Hoffnung auf eine Auskunft aus dem Bayerischen Nationalmuseum, das am 14. August 2008 eine bibliographisch bislang nicht beschriebene (und daher auch nicht im VD 16, geschweige denn in Jakob Klingners überschätztem Buch zu den Minnereden im Druck, der die Rodler'sche Presse einmal mehr breittritt, präsente) Simmern'sche Rüxner-Ausgabe mitteilte (spätere Nachfragen aber unbeantwortet ließ):
ANfang / vrsprung vnd herkommen des Thurniers inn Teutscher nation...", "Getruckt zu Siemmern/ durch Jheronimus Rodler/ Secretarius daselbst. Vollendet auff den Fünffundzwentzigsten tag Februarius. Im jar als man zalt nach der geburt Cristi. D. M. xxxv." Die Mehrzahl der Holzschnitte ist koloriert. Das Buch verfügt über einen Ledereinband von 1537, der für Bartholmes Haller vom Hallerstain angefertigt wurde. (Eingeprägter Titel: DVRNIERBVCH DER XXXVI DVRNIER IM H RO REYCH GEHALTEN sowie das Reichswappen und ein Profilbildnis Karls V.). Später befand es sich nach einem Exlibris in der Bibliothek von Christoph Andreas Imhof, "Abet in Helmstatt". Signatur: Waffen 3657.
(Hinweis 2009 auf die Ausgabe von mir:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/ )
Also auch hier ein Exemplar aus der Bibliothek Bartholomäus Hallers.
Sollte nicht wider Erwarten diese Ausgabe die genannten Blattzahlen aufweisen (dass es sich bei der Vorlage der Nürnberger Vergleichs-Einträge um eine Handschrift handelt, wird nicht explizit gesagt), möchte ich eher an eine nach einer der Simmerner Ausgaben ab 1530 angefertigte handschriftliche Druckabschrift als an eine unbekannte handschriftliche Vorstufe des Turnierbuchs denken. Bl. 81r und die späteren Überschriften können ohne weiteres der Zeit nach 1530 angehören. Ein handschriftliches Turnierbuch Johanns II., das dem Druck vorangegangen ist, ist durch die Nürnberger Handschrift nicht schlüssig zu belegen.
Dass entgegen der Ansicht im Heidelberger Handschriftenkatalog der Widmungsbrief Rüxners
http://de.wikisource.org/wiki/Brief_an_einen_F%C3%BCrsten_%28R%C3%BCxner%29
sich nicht notwendigerweise an Johann II. richtete, habe ich bereits früher betont (siehe Graf 2009 bei Freidok und http://archiv.twoday.net/stories/4993981/ ).
Gegenüber dem gedruckten Turnierbuch von 1530 weicht, wie schon Kurras feststellte, die Handschrift erheblich ab, z.B. ist die Reihenfolge der Werber beim 16. Schweinfurter Turnier eine andere. (NB: alle Turniere der Nürnberger Handschrift sind von Rüxner erfunden!)
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994a/243/html/z600
zu vergleichen mit
http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT475
Der folgende beschreibende Text ist im Druck gekürzt (es fehlen die Namen der Turnierlande, am Schluss fehlen die Dänke). Im Druck folgt die Liste der Teilnehmer, während in der Handschrift die Bestellung von acht Personen sich anschließt, ohne dass wie im Druck Alte und Junge gekennzeichnet werden. Bei Jakob von Bodman hat der Druck Job. In der Handschrift steht irrtümlich "disse zwölff", was im Druck in "Diese Acht" korrigiert ist. Die Namen der 12 stimmen überein (abgesehen von orthographischen Differenzen). Bei den folgenden Jungfrauen hat der Druck "Freyburg", wo die Handschrift "Peussing" hat. Bei denjenigen, die man zu Blatt getragen hat und die die Seile hielten, lässt der Druck die erstere Eigenschaft weg. Die Namen sind identisch, die Reihenfolge ist anders. Das gilt auch für die Grieswertel. Die vier neuen Könige stehen in der Handschrift nach der folgenden Teilnehmerliste. Ein abschließender formelhafter Absatz zu den Dänken fehlt im Druck. Auch in der Teilnehmerliste gibt es Abweichungen - Details spare ich mir.
Da die Namen erfunden sind, sind die Abweichungen nur von Belang, wenn es um die historiographische Werkstatt Rüxners geht. Schon die Stichprobe zum Schweinfurter Turnier zeigt, dass Rüxner im Turnierbuch seine eigenen früheren Aufzeichnungen stark redigiert und teilweise geändert hat.
Zur Arbeitsweise Rüxners bei den Vierlandeturnieren habe ich einige Beobachtungen in meiner Beitragsreihe zu den Vierlandeturnieren vorgelegt:
http://archiv.twoday.net/search?q=vierlande
Die "Etlichen Geschichten" übergehend (siehe oben), komme ich nun zur Aufzeichnung Bl. 137r-144v über das Bamberger Turnier 1486 (in der Handschrift ohne die Nummer 34!), die nicht von Rüxners Hand stammt (aber auch nicht von der Hand der Meisterlin-Chronik und der deutlich jüngeren Hand der abschließenden Turnierordnung), aber sicher auf ihn zurückgeht. Die Abweichungen gegenüber dem gedruckten Turnierbuch wurden bereits im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1853 aufgelistet:
http://books.google.de/books?id=9jYUAAAAYAAJ&pg=PP68
Ludwig Albert von Gumppenberg: Nachrichten über die Turniere zu Würzburg und Bamberg in den jahren 1479 und 1486. In: Archiv des Historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg 19 (1866), S. 164-210, hier S. 194-210 hat den Abschnitt vollständig abgedruckt:
https://books.google.de/books?id=tbxAAAAAcAAJ&pg=RA1-PA194
Zu seinen Arbeiten:
http://archiv.twoday.net/stories/83809128/
Zum Bamberger Turnier 1486 nenne ich nur die ausführlichen Beschreibungen:
Gumppenberg aus Raidenbuchers Turnierbuch, das verschollen ist
http://books.google.de/books?id=LeUSAAAAYAAJ&pg=PA132
Eyb'sches Turnierbuch Cgm 961
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_206
Rüxner 1530
http://books.google.de/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT799
Die abschließende Turnierordnung Bl. 146r-152r druckte Gumppenberg 1862 als "Verhandlungen zu Nürnberg im Jahre 1482" aus dem verschollenen Turnierbuch Raidenbuchers, gab aber die Abweichungen der Nürnberger Handschrift an:
http://books.google.de/books?id=6NFAAAAAcAAJ&pg=PA83
Man hätte sich gewünscht, dass Kurras entgegen den drakonischen Vorgaben der DFG zur Beschreibung neuzeitlicher Handschriften die beiden Gumppenberg-Abdrucke nachgewiesen hätte.
Das Nürnberger Digitalisat ermöglicht hinsichtlich der fiktiven Turniere einen willkommenen Einblick in Rüxners (Fälscher-)Werkstatt, für das Bamberger Turnier ermöglicht es die Kontrolle von Gumppenbergs Abdruck, für die Turnierordnung steht eine der beiden bekannten Überlieferungen und zwar die einzig noch greifbare nun im Netz. Grund genug, dem Germanischen Nationalmuseum für seine Handschriftendigitalisate zu danken.
#forschung
#fnzhss
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 21:27 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die umfangreiche maschinenschriftliche Leipziger (!) Diplomarbeit zur Geschichte des Sammelns von Karl-Heinz Janda 1957 ist gerade online gestellt worden von der Berliner Kunstbibliothek:
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377305/1/ (Text)
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749378018/1/ (Anmerkungen)
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377712/1/ (Abbildungen)
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377305/1/ (Text)
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749378018/1/ (Anmerkungen)
http://digiview.gbv.de/viewer/image/749377712/1/ (Abbildungen)
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 21:20 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hierzulande ist man in der Regel als erwischter Filesharer (zivilrechtlich) mit einigen hundert, allenfalls tausend Euro dabei. Anders in den USA:
"Ein US-Berufungsgericht hat das Filesharing-Urteil gegen den Studenten Joel Tenenbaum in dieser Woche erneut bestätigt. Tenenbaum war von einem US-Geschworenengericht im August 2009 wegen Urheberrechtsverstößen zu einer Gesamtstrafe von 675.000 US-Dollar (derzeit rund 517.000 Euro) verurteilt worden. [...]
Der Prozess gegen Tenenbaum ist einer der ersten und bisher einzigen beiden, die wegen eines Filesharing-Vergehens durch mehrere Instanzen geführt wurden. In dem anderen Verfahren wehrt sich die US-Bürgerin Jammie Thomas-Rasset bisher ebenfalls erfolglos gegen eine Strafe von 222.000 US-Dollar."
Ein Beweis mehr, wie verkommen das US-Rechtssystem ist.
"Ein US-Berufungsgericht hat das Filesharing-Urteil gegen den Studenten Joel Tenenbaum in dieser Woche erneut bestätigt. Tenenbaum war von einem US-Geschworenengericht im August 2009 wegen Urheberrechtsverstößen zu einer Gesamtstrafe von 675.000 US-Dollar (derzeit rund 517.000 Euro) verurteilt worden. [...]
Der Prozess gegen Tenenbaum ist einer der ersten und bisher einzigen beiden, die wegen eines Filesharing-Vergehens durch mehrere Instanzen geführt wurden. In dem anderen Verfahren wehrt sich die US-Bürgerin Jammie Thomas-Rasset bisher ebenfalls erfolglos gegen eine Strafe von 222.000 US-Dollar."
Ein Beweis mehr, wie verkommen das US-Rechtssystem ist.
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hb-law.de/alle-beitraege/11-urhr/322-bundestag-beendet-fliegenden-gerichtsstand-im-urhr
Der Bundestag hat heute das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen (vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/141/1714192.pdf ). Darin enthalten ist die vom Rechtsausschuss geforderte Einführung eines neuen §104a UrhG, welcher es insbesondere für Filesharingklagen in sich haben dürfte:
(1)
Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit verwendet, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn die beklagte Person im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.
(2) § 105 bleibt unberührt.
Das bedeutet, dass die Klagen zukünftig am Wohnsitzgericht des Beklagten und nicht mehr in Hamburg, München, Köln und Frankfurt seitens der Rechteinhaber erhoben werden können. Aufgrund der Sonderverweisung des § 105 UrhG gilt allerdings eine Spezialzuweisung an bestimmte Gerichte (sogenannte Konzentrationsermächtigung). In Bremen gibt es eine solche nicht, in Niedersachsen wären demnach zukünftig alle Klagen in Hannover anhängig zu machen.
Der Bundestag hat heute das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen (vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/141/1714192.pdf ). Darin enthalten ist die vom Rechtsausschuss geforderte Einführung eines neuen §104a UrhG, welcher es insbesondere für Filesharingklagen in sich haben dürfte:
(1)
Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit verwendet, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn die beklagte Person im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.
(2) § 105 bleibt unberührt.
Das bedeutet, dass die Klagen zukünftig am Wohnsitzgericht des Beklagten und nicht mehr in Hamburg, München, Köln und Frankfurt seitens der Rechteinhaber erhoben werden können. Aufgrund der Sonderverweisung des § 105 UrhG gilt allerdings eine Spezialzuweisung an bestimmte Gerichte (sogenannte Konzentrationsermächtigung). In Bremen gibt es eine solche nicht, in Niedersachsen wären demnach zukünftig alle Klagen in Hannover anhängig zu machen.
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:33 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wisspub.net/2013/06/28/bundestag-bringt-zweitveroffentlichungsrecht-auf-den-weg/
Der Bundestag hat Open Access mit diesem Recht einen Bärendienst erwiesen, da die Nachteile durch den Wegfall der Möglichkeit, im Zweifel sofort nach Erscheinen online selbstzuarchivieren, deutlich überwiegen. Besser wäre es gewesen, bei dem jetzigen § 38 UrhG zu bleiben und diesen nicht zu verschlimmbessern. Ich darf nicht nur Schmalenstroer auf die detaillierte Stellungnahme von BC Kaemper hier
http://archiv.twoday.net/stories/342796643/
und meine Hinweise
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg50240.html
aufmerksam machen.
Der Bundestag hat Open Access mit diesem Recht einen Bärendienst erwiesen, da die Nachteile durch den Wegfall der Möglichkeit, im Zweifel sofort nach Erscheinen online selbstzuarchivieren, deutlich überwiegen. Besser wäre es gewesen, bei dem jetzigen § 38 UrhG zu bleiben und diesen nicht zu verschlimmbessern. Ich darf nicht nur Schmalenstroer auf die detaillierte Stellungnahme von BC Kaemper hier
http://archiv.twoday.net/stories/342796643/
und meine Hinweise
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg50240.html
aufmerksam machen.
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 20:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Anzeige von
http://dbs.hab.de/mss/?list=browse&id=issued
funktioniert wieder.
Am 20. Februar kamen hinzu v.a. Briefe von Herzog August an Johann Valentin Andreae
http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-02-20
Am 25. Februar 2013 kam u.a. hinzu
Hermann Botes Schichtbuch (1514)
http://diglib.hab.de/mss/120-extrav/start.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0080_b069_jpg.htm
http://www.handschriftencensus.de/13319 (ohne das Digitalisat, bis jetzt)
Am 1. März 2013
Psalterium saec. XII ex.
Helmstedt, Ehemalige Universitätsbibliothek I Hs. 1
http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000037
Zur Bibliothek: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehemalige_Universit%C3%A4tsbibliothek_Helmstedt (wie üblich ohne Nachweis von Digitalisaten)
Auch I Hs. 2 ist online
http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000038&catalog=Lesser
Das Mitteldeutsche Evangelistar saec. XIV müsste im Handschriftencensus unter Helmstedt stehen, aber es gibt gar keinen Eintrag zu dieser Bibliothek!
Am 5. März ein Psalterium saec. XIII aus dem Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Cod. 2E
http://diglib.hab.de/mss/ed000032/start.htm
Am 10. Juni 10 Handschriften aus der Stiftsbibliothek Bad Gandersheim
http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-06-10
Zur Bibliothek:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0055.htm
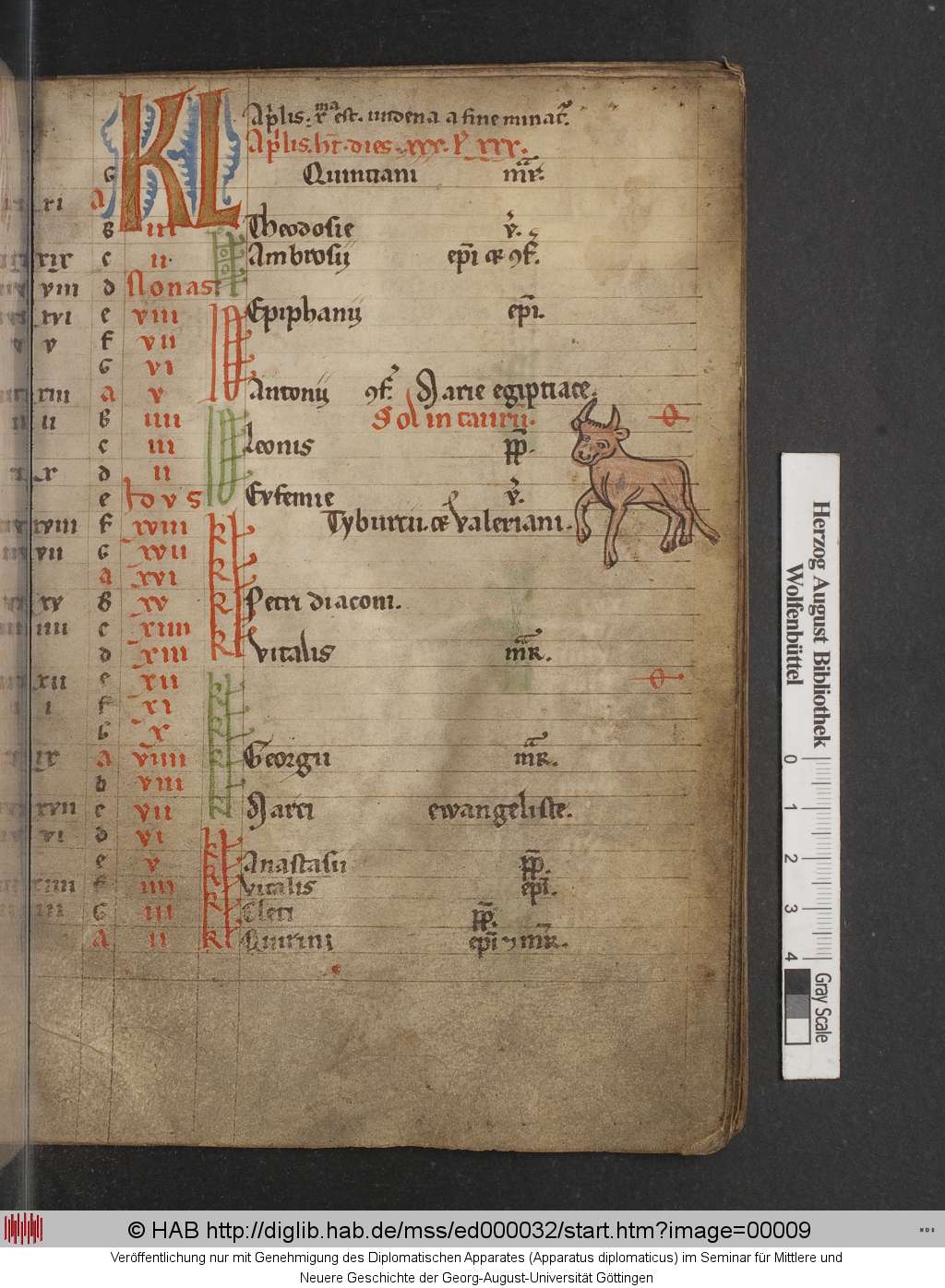
http://dbs.hab.de/mss/?list=browse&id=issued
funktioniert wieder.
Am 20. Februar kamen hinzu v.a. Briefe von Herzog August an Johann Valentin Andreae
http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-02-20
Am 25. Februar 2013 kam u.a. hinzu
Hermann Botes Schichtbuch (1514)
http://diglib.hab.de/mss/120-extrav/start.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0080_b069_jpg.htm
http://www.handschriftencensus.de/13319 (ohne das Digitalisat, bis jetzt)
Am 1. März 2013
Psalterium saec. XII ex.
Helmstedt, Ehemalige Universitätsbibliothek I Hs. 1
http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000037
Zur Bibliothek: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehemalige_Universit%C3%A4tsbibliothek_Helmstedt (wie üblich ohne Nachweis von Digitalisaten)
Auch I Hs. 2 ist online
http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=ed000038&catalog=Lesser
Das Mitteldeutsche Evangelistar saec. XIV müsste im Handschriftencensus unter Helmstedt stehen, aber es gibt gar keinen Eintrag zu dieser Bibliothek!
Am 5. März ein Psalterium saec. XIII aus dem Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Cod. 2E
http://diglib.hab.de/mss/ed000032/start.htm
Am 10. Juni 10 Handschriften aus der Stiftsbibliothek Bad Gandersheim
http://dbs.hab.de/mss/?list=issued&id=2013-06-10
Zur Bibliothek:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0055.htm
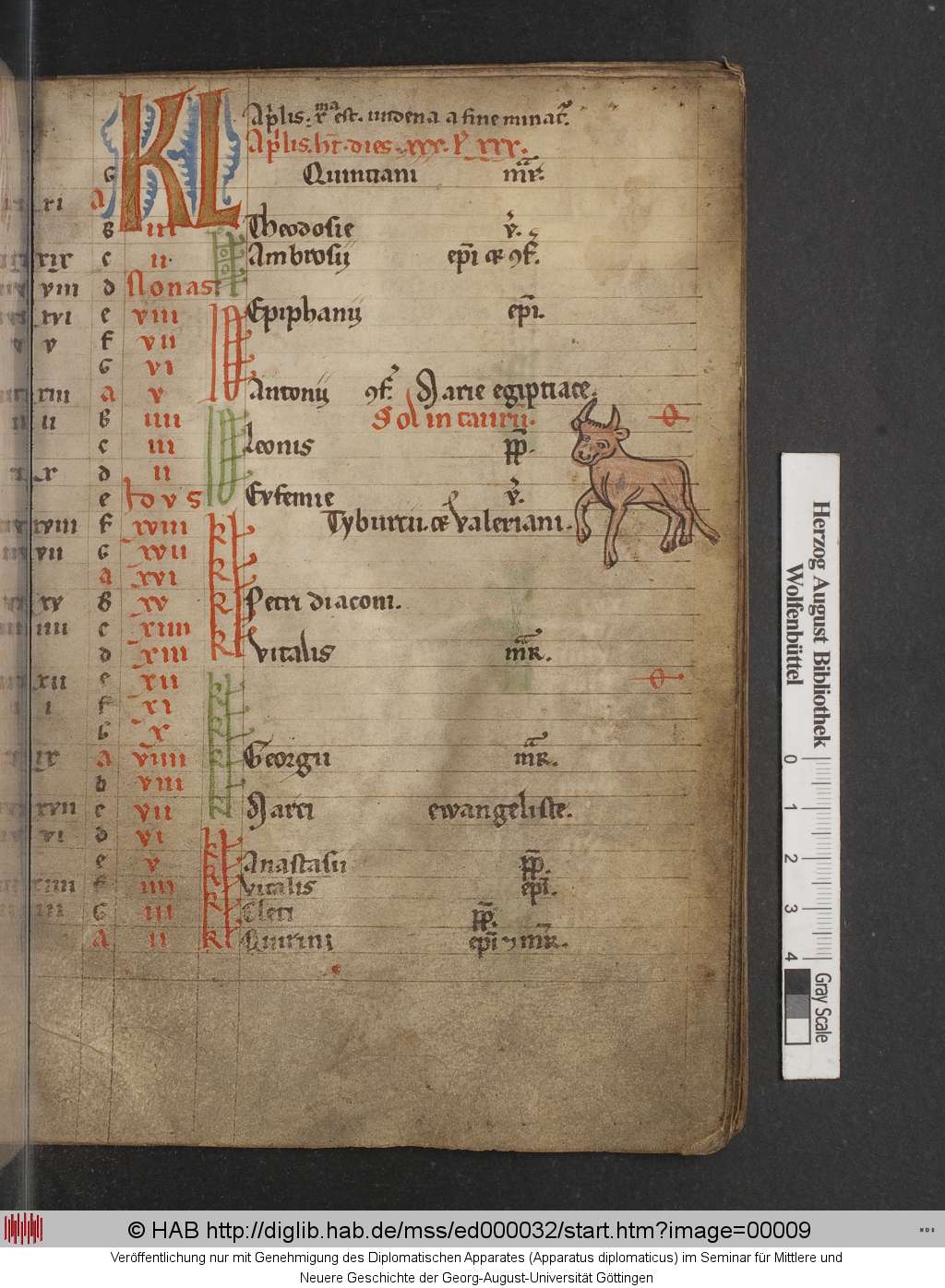
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 19:28 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ab Bd. 60, 2009:
http://www.hessische-kirchengeschichte.de/_private/rezensionen.htm
Wir merken nochmals an, wie unsäglich wir die Weigerung von Recensio.net halten, Rezensionen aus landesgeschichtlichen Zeitschriften aufzunehmen.
http://www.hessische-kirchengeschichte.de/_private/rezensionen.htm
Wir merken nochmals an, wie unsäglich wir die Weigerung von Recensio.net halten, Rezensionen aus landesgeschichtlichen Zeitschriften aufzunehmen.
KlausGraf - am Freitag, 28. Juni 2013, 19:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Das kommt mir vor wie die nachträgliche, politische Sanktionierung des Einsturzes. Nach dem Motto: Das Ding ist doch zurecht eingestürzt. ...."
Georg Quander zum aktuellen Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs in der Stadtrevue 6/2013
Informationen zur Petition für die Aufhebenung des Planungsstopps: https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln
Link zur Petition, die mindestens bis zur nächsten, hoffentlich entscheidenden Sitzung des Kölner Stadtrates am 18. Juli 2013 gezeichnet werden kann.
Georg Quander zum aktuellen Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs in der Stadtrevue 6/2013
Informationen zur Petition für die Aufhebenung des Planungsstopps: https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln
Link zur Petition, die mindestens bis zur nächsten, hoffentlich entscheidenden Sitzung des Kölner Stadtrates am 18. Juli 2013 gezeichnet werden kann.
Wolf Thomas - am Freitag, 28. Juni 2013, 08:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachtrag zu:
http://archiv.twoday.net/stories/434211600/
http://archive.org/details/MennelHabsburgerKalender ist ein Auszug aus Der „Habsburger Kalender“ des Jakob Mennel (Urfassung). In Abbildung aus dem Autograph (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart HB V 43). Hrsg. von Wolfgang Irtenkauf. Göppingen 1979. Die S. 5-28 enthalten Irtenkaufs Transkription der Handschrift (Kalender und Begräbnisse) und das Faksimile der Handschrift. Sie sind gemeinfrei.
Die UB Freiburg digitalisierte freundlicherweise Knaake, Joachim Karl Friedrich [Hrsg.]: Jahrbücher des deutschen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation
Leipzig, 1872
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/jb_dt_reich1872
Knaake edierte Drucke zum Augsburger Reichstag 1518.
Die dort nachgewiesene Übersetzung der Mennel-Schrift von August Tittel habe ich als Digitalisat ermittelt und nachgetragen:
http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel#Bericht_.C3.BCber_die_Erhebung_Albrechts_von_Brandenburg_zum_Kardinal
Nachtrag: UB Freiburg Hs. 178 ist nun auch online
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs178

http://archiv.twoday.net/stories/434211600/
http://archive.org/details/MennelHabsburgerKalender ist ein Auszug aus Der „Habsburger Kalender“ des Jakob Mennel (Urfassung). In Abbildung aus dem Autograph (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart HB V 43). Hrsg. von Wolfgang Irtenkauf. Göppingen 1979. Die S. 5-28 enthalten Irtenkaufs Transkription der Handschrift (Kalender und Begräbnisse) und das Faksimile der Handschrift. Sie sind gemeinfrei.
Die UB Freiburg digitalisierte freundlicherweise Knaake, Joachim Karl Friedrich [Hrsg.]: Jahrbücher des deutschen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation
Leipzig, 1872
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/jb_dt_reich1872
Knaake edierte Drucke zum Augsburger Reichstag 1518.
Die dort nachgewiesene Übersetzung der Mennel-Schrift von August Tittel habe ich als Digitalisat ermittelt und nachgetragen:
http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel#Bericht_.C3.BCber_die_Erhebung_Albrechts_von_Brandenburg_zum_Kardinal
Nachtrag: UB Freiburg Hs. 178 ist nun auch online
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs178

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 22:50 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Johanna Spyris Erzählungen "Heidi's Lehr- und Wanderjahre" (1880) und "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat" (1881) gehören mit ihren zahlreichen Auflagen und den Übersetzungen in mehr als 50 Sprachen zu den erfolgreichsten Kindererzählungen der Schweiz und der Welt überhaupt. Spyri zeichnete mit der Figur H. nicht nur ein unverbildetes Naturkind, sondern auch eine Art gute Fee. Das einfache Leben auf der Alp assoziierte sie mit Naturverbundenheit, Gesundheit, Fröhlichkeit und Liebe, das Leben in der Stadt mit Krankheit, steifem Benehmen, Naturferne. Die in den Erzählungen dargestellte Welt, das Dörfli und die Alp des Alp-Öhi, wurde zum Inbegriff der Schweiz und trug so zum Mythos einer Schweiz bei, in der die Menschen in Unschuld in der gesunden Luft der Alpen leben. " So das Historische Lexikon der Schweiz
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44036.php
Jüngst wurden bei e-rara.ch viele Publikationen von Johanna Spyri eingestellt, darunter auch die Erstausgaben der beiden Heidi-Bücher.
http://www.e-rara.ch/sikjm/content/titleinfo/5335213

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44036.php
Jüngst wurden bei e-rara.ch viele Publikationen von Johanna Spyri eingestellt, darunter auch die Erstausgaben der beiden Heidi-Bücher.
http://www.e-rara.ch/sikjm/content/titleinfo/5335213

KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 18:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jimmy Wales wird vorgeworfen, er habe versucht, den Wikipedia-Account des Whistleblowers Edward Snowden zu outen, was gegen das Recht der Wikipedianer auf Anonymität innerhalb des Projekts verstoßen würde. Wales bestreitet das.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Das_n.C3.A4chste_Fettn.C3.A4pfchen_des_Jimmy_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Incidents#Attempted_outing_of_Edward_Snowden
http://derstandard.at/1371170659116/Suche-nach-Snowden-Wikipedia-Gruender-bricht-eigene-Regeln
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:OUTING#Posting_of_personal_information
Via
http://blog.wikimedia.de/2013/06/27/wikimediawoche-262013/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Das_n.C3.A4chste_Fettn.C3.A4pfchen_des_Jimmy_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Incidents#Attempted_outing_of_Edward_Snowden
http://derstandard.at/1371170659116/Suche-nach-Snowden-Wikipedia-Gruender-bricht-eigene-Regeln
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:OUTING#Posting_of_personal_information
Via
http://blog.wikimedia.de/2013/06/27/wikimediawoche-262013/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dlib.gnm.de/item/Hs3994/html
Die Handschrift mit der lateinischen und deutschen Nürnberger Chronik Sigmund Meisterlins stammt erst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist beschrieben in:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b028_jpg.htm
Die Handschrift mit der lateinischen und deutschen Nürnberger Chronik Sigmund Meisterlins stammt erst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist beschrieben in:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0062_b028_jpg.htm
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 18:33 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
kathweb: "Akute Gefahr droht aber nun den 280.000 hebräischen und aramäischen Handschriften in der ägyptischen Nationalbibliothek Dar al-Kutub (Haus der Bücher). Der von Mursi im Mai zum Kulturminister ernannte Muslimbruder Alaa Abdel Aziz hat eine «Reinigung» der Bestände von allem Unislamischem angekündigt und zu diesem Zweck die gesamte Bibliotheksleitung gefeuert. "
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=27808
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=27808
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ich darf Sie auf die neueste Online-Publikation der Historischen Landeskommission für Steiermark hinweisen:
Kirk Patrick Fazioli, Technology, identity, and time. Studies in the archaeology and historical anthropology of the eastern alpine region from late antiquity to the early middle ages (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 60, Graz 2013)
Den Link zur Publikation finden Sie unter: http://www.hlkstmk.at/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=88
Das Werk ist nicht im Buchhandel erhältlich, steht aber im Sinne des open access kostenlos online zur Verfügung. Einige wenige gedruckte Exemplare werden ausgewählten Bibliotheken im In- und Ausland übergeben.
Mit freundlichen Grüßen
Meinhard Brunner"
Pfundig!
Kirk Patrick Fazioli, Technology, identity, and time. Studies in the archaeology and historical anthropology of the eastern alpine region from late antiquity to the early middle ages (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 60, Graz 2013)
Den Link zur Publikation finden Sie unter: http://www.hlkstmk.at/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=88
Das Werk ist nicht im Buchhandel erhältlich, steht aber im Sinne des open access kostenlos online zur Verfügung. Einige wenige gedruckte Exemplare werden ausgewählten Bibliotheken im In- und Ausland übergeben.
Mit freundlichen Grüßen
Meinhard Brunner"
Pfundig!
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 17:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In einer Rezension für die ZRG GA 2012 weist Wilhelm A. Eckhart auf einen Fund von Uta Löwenstein hin:
http://www.koeblergerhard.de/ZRG129Internetrezensionen2012/FrickeEberhard-DiewestfaelischeVeme.htm
Der meines Erachtens wichtigste Fund ist aber eine bisher unbekannte Handschrift des 15. Jahrhunderts, die in einem unverzeichneten Aktenpaket des Bestandes 141 b (Waldeck, Gerichte, Rüge- und Bußregister) im Staatsarchiv Marburg lag und jetzt die Signatur Bestand 147.1 (Waldeck, Handschriften) Nr. 2 trägt. Sie enthält (ohne einer genaueren Beschreibung vorgreifen zu wollen) Bl. 2r-10r Wigands Rechtsbuch A (Paul Wigand, Das Femgericht Westfalens, 2. Aufl., Halle 1893, Neudruck Aalen 1968, S. 425-431; Oppitz, Bd. 1, S. 69, Ziffer 10.7), Bl. 10r-19v die Ruprechtschen Fragen (Oppitz, S. 68, Ziffer 10.1), Bl. 19v-23v die Arnsberger Reformation (Oppitz, S. 69, Ziffer 10.2) in der Fassung B bis § 18: Item wert dat eynich wetten man eynen andern wetten man vorboden dede yn dat hemelike gerichte, dar umme dat hey em to den eren nicht antworden en wolde, unde vorbode sich dey geyn dey also geladen. Der Rest fehlt. Diese waldeckische Femrechtshandschrift wird bei künftigen Arbeiten über die Feme in der Grafschaft Waldeck gewiss eine Rolle spielen.
http://www.koeblergerhard.de/ZRG129Internetrezensionen2012/FrickeEberhard-DiewestfaelischeVeme.htm
Der meines Erachtens wichtigste Fund ist aber eine bisher unbekannte Handschrift des 15. Jahrhunderts, die in einem unverzeichneten Aktenpaket des Bestandes 141 b (Waldeck, Gerichte, Rüge- und Bußregister) im Staatsarchiv Marburg lag und jetzt die Signatur Bestand 147.1 (Waldeck, Handschriften) Nr. 2 trägt. Sie enthält (ohne einer genaueren Beschreibung vorgreifen zu wollen) Bl. 2r-10r Wigands Rechtsbuch A (Paul Wigand, Das Femgericht Westfalens, 2. Aufl., Halle 1893, Neudruck Aalen 1968, S. 425-431; Oppitz, Bd. 1, S. 69, Ziffer 10.7), Bl. 10r-19v die Ruprechtschen Fragen (Oppitz, S. 68, Ziffer 10.1), Bl. 19v-23v die Arnsberger Reformation (Oppitz, S. 69, Ziffer 10.2) in der Fassung B bis § 18: Item wert dat eynich wetten man eynen andern wetten man vorboden dede yn dat hemelike gerichte, dar umme dat hey em to den eren nicht antworden en wolde, unde vorbode sich dey geyn dey also geladen. Der Rest fehlt. Diese waldeckische Femrechtshandschrift wird bei künftigen Arbeiten über die Feme in der Grafschaft Waldeck gewiss eine Rolle spielen.
KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 17:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beispielbild vom 27. Juli 1991
Quelle: BArch, B 145 Bild-F088836-0033 / Joachim Thum (bearb. durch CC PLAY)
Über den Webauftritt "CC PLAY" können Personen und Momente der deutschen Geschichte spielerisch erlebt werden.
Im Rahmen der inzwischen beendeten Kooperation von Bundesarchiv und Wikimedia Deutschland e.V. wurden zehntausende Fotos des Bundesarchivs unter der Creative Commons (CC)-Lizenz 3.0 by-sa der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Aus diesem Fundus hat das Kölner Game Studio the Good Evil zahlreiche Bilder ausgewählt und das kostenlose digitale Puzzle-Spiel "CC PLAY" entwickelt.
Auf ungewöhnliche Weise erfahrbar werden so weite Teile der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Herausragende und alltägliche, heitere und sehr dunkle Momente u.a. aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport: "Vom Hitlerputsch 1923 bis zur Birkensafternte in Colditz 1985".
Link zum Spiel
Quelle: Bundesarchiv, 15.6.2013
Wolf Thomas - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 12:56 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Als Ergänzung meines Aufsatzes "Hohenurach und seine Gefangenen" und zur Entlastung des dortigen Anmerkungsapparats lege ich hier eine Liste der mir bis jetzt bekannt gewordenen Gefangenen auf dem Schloss bzw. der Festung Hohenurach vor. Es sind gut 50 Personen (gefangen in der Zeit 1471 bis 1765), wobei die meisten Hinweise Google Books verdankt werden. Soweit Angaben über die Dauer der Inhaftierung vorliegen, scheint es nicht selten gewesen zu sein, dass die Gefangenen mehrere Jahre auf Hohenurach blieben.
Ergänzungen und Korrekturen sind natürlich willkommen!
1471
Im Rahmen einer Fehde nahm Graf Eberhard im Bart von Württemberg im Oktober 1471 Hans von Geroldseck und drei seiner Söhne auf Burg Albeck gefangen und ließ sie nach Urach führen. 1472 kamen die Söhne, 1473 der Vater frei. Die mir bekannten Quellen geben nur den Ortsnamen Urach, doch erscheint es plausibel, dass man die Gefangenen auf der Höhenburg und nicht im Stadtschloss oder einem anderen Uracher Gefängnis verwahrt hat.
Den Hinweis auf die Urfehde des Hans von Geroldseck vom 11. Dezember 1473, Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 169 U 113, in der von der Gefangenschaft zu Urach die Rede ist, verdanke ich einem von Christoph Bühler freundlicherweise zur Verfügung gestellten Auszug aus seinen Geroldsecker Regesten.
OAB Sulz 1863: Hohenurach
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:OAB_Sulz.djvu/132
zuvor Köhler 1835: Hohenurach
http://books.google.de/books?id=A3QAAAAAcAAJ&pg=PA219
Bossert: Eberhard S. 22
https://archive.org/stream/EberhardImBart/Eberhard_im_Bart#page/n25/mode/2up
Steinhofer III, 1752: nach Urach geführt (nach Hertzog?)
http://books.google.de/books?id=7H4AAAAAcAAJ&pg=PA192
Martens 1847 mit Literaturangaben
http://books.google.de/books?id=Oqg4AAAAYAAJ&pg=PA143
Hertzog 1592: nach Urach
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/671675
Koch 1828: Hohenurach
http://books.google.de/books?id=rnIAAAAAcAAJ&pg=PA100
1476
Hans Bimwang genannt Schreiber, Bürger und Büttel zu Urach, wegen des "Handels" um die Gefangenschaft des Peter Hafenberg zu Urach gefangen, schwört Urfehde. 1476 August 19. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517381
1484
Hüglin, Sohn des Hug Claußen aus Straßburg, wegen "mercklichen Verschuldens" im Gefängnis des Grafen Eberhard d.Ä., von Württemberg gefangen, schwört Urfehde. 1484 August 12. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1160846
1490
Graf Heinrich von Württemberg wurde im August 1490 von Graf Eberhard im Bart als geisteskrank nach Hohenurach gebracht. Dort lebte er mit seiner Familie. Er befand sich auf Hohenurach - unterbrochen von einem Aufenthalt in Stuttgart bei seinem Sohn Herzog Ulrich - bis zu seinem Tod 1519.
Klaus Graf: Graf Heinrich von Württemberg († 1519) – Aspekte eines ungewöhnlichen Fürstenlebens, in: Württemberg und Mömpelgard 600 Jahre Begegnung. Montbéliard – Wurtemberg 600 Ans de Relations, hg. von Sönke Lorenz/Peter Rückert, Leinfelden-Echterdingen 1999, S. 107–120. Autorenversion mit Nachträgen:
http://web.archive.org/web/20120331005625/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/heinr.htm
Nachträge dazu: http://archiv.twoday.net/stories/6057224/
Akten zur Gefangenschaft online:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24894
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=101248342
1492
Urfehde von Hans Waldhauser, Steinmetzknecht aus Ichenhausen bei Ulm, unter dringendem Mordverdacht an einem Messerschmied, der bei Gächingen im Uracher Amt getötet worden war, gefangen. 1492 Juni 23. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517389
Ca. 1502
Konrad Holzinger, “Günstling” Herzog Eberhards II. von Württemberg, wurde auf Hohenurach gefangengehalten. Michel Ott von Echterdingen und seine Verwandten, die Brüder Peter und Michel Schott, wurden aufgrund der Kontakte zu Holzinger, der Ermöglichung von Schriftwechsel für Holzinger und des Plans, ihn zu befreien, viele Monate ins Gefängnis geworfen (Ott lag auf Hohentübingen, Peter Schott auf dem Hohenasperg).
Klaus Graf: Konrad Holzinger, Gefangener auf Hohenurach (um 1500), und Michel Ott von Echterdingen, in: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 21. Juni 2013
http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1453
Die Gefangenschaft Holzingers auch auf dem Hohenurach ergibt sich aus Hauptstaatsarchiv Stuttgart L 5 Bd. 3 (Tomus Austriacus), S. 1284 und den drei folgenden Urfehden.
Michel Ott aus Kirchheim unter Teck, zu Tübingen gefangen, nach Bezahlung seiner Atzung begnadigt und entlassen, schwört Urfehde. Er war als verpflichteter Kanzleischreiber mit einer im Gefängnis liegenden Person, die nicht mit ihm verwandt war, in Schriftwechsel gestanden. 1503 Juli 27
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-515681
Peter Schott von Grabenstetten, der als Schlosswächter auf Hohenurach einem Gefangenen Botschaft hatte zukommen lassen, schwört Urfehde. 1503 November 9. Er wurde wohl auf dem Hohenasperg gefangen gehalten.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-515410
Michel Schott von Unterlenningen, wegen Gefangenenbegünstigung im Gefängnis Herzog Ulrichs gelegen, jedoch auf Fürbitte gegen Bezahlung der Atzung aus der Haft entlassen, schwört Urfehde. 1503 August 2. "Sein Vergehen: Er hatte zugelassen, dass in seinem Haus zu Urach sein Vetter Michel Ott Briefe an seinen Bruder Peter, gewesenen Schlosswächter zu Hohen-Urach, übergab, die für eine auf Hohen-Urach gefangengehaltene Person bestimmt waren, und hatte dieses pflichtwidrige Verhalten seines Bruders nicht angezeigt; außerdem hatte er der betreffenden Person durch seinen Bruder ausrichten lassen, sein Vetter und er wollten helfen, ihn zu befreien, falls er ihnen die Kunst, derentwegen sein Vetter sich an ihn gewandt hat, mitteilen würde."
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1141779
GND Holzinger http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012274284
1516
Der ehemalige Tübinger Vogt Konrad Breuning, ein Gegner Herzog Ulrichs, wurde am 20. November 1516 verhaftet und zunächst auf Hohenurach, dann auf dem Hohenneuffen eingekerkert. Er wurde schon in Hohenurach grausam gefoltert. Am 27. September 1517 wurde er auf dem Stuttgarter Marktplatz hingerichtet.
Manfred Eimer: Konrad Breuning. Vogt zu Tübingen, Mitglied der Landschaft und des Regimentsrats. Um 1440-1517, in: Schwäbische Lebensbilder Bd. 4, Stuttgart 1948, S. 1-15, hier S. 10f.
Ohr: Ein Brief Conrad Breunings, Lit. Beilage des Staats-Anzeigers für Württ. 1904, S. 242-247 (nicht eingesehen)
Heyd: Herzog Ulrich
http://books.google.de/books?id=im8IAAAAQAAJ&pg=PA483
Bericht des Hans Breuning ed. Sophronizon
http://books.google.de/books?id=SeoaAAAAYAAJ&pg=RA3-PA26
ADB
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Breuning,_Konrad_von
Josef Forderer 1931
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/LXV198_22_1931_1/0006
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118515241
1525
Im Bauernkrieg wurde am 24. April 1525 ein Rädelsführer auf Hohenurach verbracht. Der Uracher Untervogt schrieb, er wolle den “Buben auf dem Schloß strecken lassen” (also foltern).
Zimmermann 1843
http://books.google.de/books?id=WRNMAAAAYAAJ&pg=PA360
1525
Aufgrund eines fälschen Gerüchts befahl der Schwäbischer Bund, den Tübinger Professor und Pfarrer Dr. Gallus Müller auf den Hohenurach zu bringen, wozu es aber nicht kam.
Anton Nägele: Dr. Gallus Müller von Fürstenberg a.D. und sein Wirken in und für Tübingen, Freiburg und Tirol, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), S. 97-164, hier S. 105f.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5968/
450 Jahre Evangelische Landeskirche in Württemberg. Teil 1: Reformation in Württemberg (Stuttgart 1984), S. 71 [Nr. 5.11: 31. Mai 1525 Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 54 Bü 16, Bl. 25: Verhaftungs- und Hinrichtungsbefehl des Schwäbischen Bundes an die Regierung in Württemberg mit der Anweisung 1. den Pfarrer Gall von Tübingen wegen aufrührerischer Predigten auf Hohenurach gefangenzusetzen, 2. Franz Gigelin von Stuttgart wegen lutherischer Neigungen foltern und richten zu lassen, 3. den Pfarrer von Schützingen hinzurichten.]
http://books.google.de/books?id=TovYAAAAMAAJ&q=hohenurach
Heyd: Herzog Ulrich
http://books.google.de/books?id=h1U9AAAAcAAJ&pg=PA266
[1525
Nach den eben genannten Belegen zu 1525 liegt es nahe anzunehmen, dass das in einigen Stuttgarter Urfehden - vor allem vom Herbst 1525 - genannte Gefängnis des Schwäbischen Bundes in Urach mit Hohenurach zu identifizieren ist.
Horst Carl (Gießen) danke ich für die Mitteilung, dass ihm aus seinen Unterlagen zum Schwäbischen Bund nichts zu diesem Gefängnis bekannt sei. Vielleicht werde man im großen Urfehde-Bestand des Stadtarchivs Augsburg weiter fündig.
Hans Pfuder zu Kohlberg, wegen des Verdachts, strafbare Handlungen begangen zu haben, im Gefängnis des Schwäbischen Bundes zu Urach gefangen
1519 Dezember 7
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518037
Georg Dietz aus Veringen (wohl die Grafschaft), Pfarrer zu Hausen an der Lauchert, wegen Teilnahme an den Bauernunruhen einige Zeit im Gefängnis des Schwäbischen Bundes zu Urach gefangen
1525 September 2
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517703
Baltus Schleifer aus Reutlingen, wegen Teilnahme am Bauernaufstand und Plünderung etlicher Gotteshäuser ins Gefängnis der gemeinen Bundesstände gekommen
1525 September 2
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518042
Bütsch Ludlin aus Mägerkingen, einige Zeit im Gefängnis der Bundesstände zu Urach gefangen, weil er beim Einfall Herzog Ulrichs von Württemberg um Fastnacht (28. Febr.), als Erzherzog Ferdinand von Österreich gegen ihn nach Tübingen ins Feld zog, unter einem Haufen der Landschaft gesagt hatte, wie man es wohl anstelle, den Dietrich Spät dem Herzog auszuliefern, und auch sonst während der Bauernunruhen feindliche Reden gegen die österreichische Regierung geführt hatte
1525 September 11
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517718
Henslin Miller, Sohn des + Hans Miller, B. zu Urach, einige Zeit im
Gefängnis des Schwäbischen Bundes festgehalten, weil er sich während des vergangenen Bauernaufstands mit unziemlichen Reden gegen die Obrigkeit empört, auch in den gebannten Gewässern der Herrschaft gefischt hatte
1525 September 18
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517448
Christian Auberlin zu Gruorn, eine Zeitlang im Gefängnis der
Bundesstände zu Urach gefangen, weil er Briefe der wider die Obrigkeit und den Schwäbischen Bund aufrührerischen Bauern befördert hatte
1525 September 23
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517701
Alexander Teufel, ein Pfeifer, seßhaft zu Mägerkingen, im Gefängnis der Bundesstände gef., weil er mit etlichen Pfeifern den Bauern zugezogen und bei ihnen geblieben war, auch mitgeholfen hatte, dem Kloster Zwiefalten bei Maßhalderbuch das Vieh und anderes wegzunehmen und demselben großen Schaden zugefügt hatte,
1525 Oktober 27
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517719 ]
1535
Der Tübinger Keller Wilhelm Dachtler genannt Gilg wurde 1535 wegen Agitation gegen Herzog Ulrich nach Hohenurach verbracht und kam erst Anfang 1537 gegen Urfehde wieder frei.
"Nach längerer Haft auf Hohenurach kam er Anfang 1537 zwar frei, mußte aber 1000 Gulden Strafe zahlen und beschwören, an keiner »Winkelzusammenkunft« mehr teilzunehmen, sich nur noch mit den engsten Anverwandten, und zwar jeweils nicht mehr als acht Personen, zusammenzusetzen, keine Badstube zu betreten und das Amt Tübingen nicht zu verlassen, wobei seine 15 Bürgen unter Stellung von 3000 Gulden verpflichtet wurden, ihn im Übertretungsfall zur Verhaftung anzuzeigen" (Janssen S. 316)
Roman Janssen: Mittelalter in Herrenberg, Ostfildern 2008, S. 131, 316
http://books.google.de/books?id=x80jAQAAIAAJ&q=hohenurach
1538
Lukas Götz (gest. 1546), Abt des Zisterzienserklosters Herrenalb, wurde 1538 wegen Unterschlagung verhaftet und nach Hohenurach verbracht. Man ließ ihn erst gegen Urfehde vom 2. Juli 1543 wieder frei.
Hermann Ehmer: Die Reformation in Herrenalb. Das Ende des Klosters und der Versuch eines Neubeginns, in: 850 Jahre Kloster Herrenalb, hg. von Peter Rückert/Hansmartin Schwarzmaier, Stuttgart 2001, S. 139-166, hier S. 149f.
Siegfried Frey: Das württembergische Hofgericht (1460-1618). Stuttgart 1989, S. 175
http://books.google.de/books?id=xSdoAAAAMAAJ&q=hohenurach
Konrad Rothenhäusler: Die Abteien und Stifte des Herzogthums Württemberg im Zeitalter der Reformation, Stuttgart 1886, S. 31f. mit unrichtiger Darstellung
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n53/mode/2up
1540
Berichte des Burgvogts von Hohenurach in Sachen Michael Löffler (Gefangener auf Hohenurach)
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518167
[Peter Rückert teilte freundlicherweise mit Mail vom 3. Dezember 2013 mit: Nach einem der Urfehde beiliegenden Bericht des Burgvogts von Hohenurach (Signatur A 44 U6032) kann die Haft Michael Löffler auf Hohenurach belegt werden.]
1543
Im Herbst 1543 fielen der Rentkammerrat Martin Nüttel und der Landschreiber Johann Hafenberg in Ungnade und wurden auf Hohenurach gefangen gesetzt. Hafenberg wurde zu demnicht weiter bekannten Klingenschmied in den Turm gelegt, Nüttel kam in das Gemach, das der Herrenalber Abt Lukas Götz bewohnt hatte. Hafenberg kam erst am 25. Mai 1548 gegen Schwören einer Urfehde wieder frei bzw. wechselte in den lebenslangen Arrest in seinem Stuttgarter Haus.
Gustav Bossert d. J.: Der Beamtenwechsel in Württemberg um 1544, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 8 (1944-1948), S. 280-297, hier S. 285
Walter Bernhardt: Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre Beamten 1520-1629, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 337 (Hafenberg), 524f. (Nüttel)
Frey: Hofgericht S. 221 (Hafenberg)
Gerhard Seibold: Die Entlassung des Erbmarschalls Hans Konrad Thumb von Neuburg, in: Genealogisches Jahrbuch 40 (2000), S. 87-104 [mit widersprüchlichen Angaben zur Gefangenschaft Nüttels. S. 99 Hafenberg gemeinsam mit Nüttel verhaftet und auf Hohenurach festgesetzt; S. 97: Nach der Verhaftung zunächst nach Oberwittlingen gebracht, starb auf dem Ritt nach Urach. Anders Bossert. Vgl. auch Pfeilsticker - wie unten - 1 § 1684: auf Hohenurach gebracht, Folter 31.3.1544 auf Hohenwittlingen.]
[1543
Endris Rieger, Klingenschmied von Augsburg, im Gefängnis Herzog Ulrichs gelegen wegen Entführung der Tochter des Wolf Schenk von Stauffenberg zu Ditzingen, schwört Urfehde 1548 März 22. Das Gefängnis Herzog Ulrichs und die Tatsache, dass zwei Uracher Bürger siegeln, verweist auf Hohenurach.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-522044
Akten dazu
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-10333
Bezeugt wird ein späterer Aufenthalt durch Pfeilsticker: Neues württ. Dienerbuch 2 (1963) § 2951: Burgvogt empfängt Atzungsgeld für ihn und zwar 10 Kreuzer/Tag von Dezember 1552 bis 1.10.1553.
Gustav Bossert: Aus der Zeit der Fremdherrschaft 1519-1534. In: Württembergische Jahrbücher 1911, S. 49-78, hier S. 78: Der Viehhändler Rieger habe die Frau, die ihn heiraten wollte, um ihrem Elternhaus zu entfliehen, 1542 mit ihrem Einverständnis entführt. Er habe die Tat aber mit 6 Jahren Haft auf Hohenurach und Hohenwittlingen büßen müssen.
http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076054152?urlappend=%3Bseq=116 US ]
1553
Abt Andreas Boxler (gest. nicht vor 1572) der Zisterzienserabtei Königsbronn wurde am 10. März 1553 verhaftet. Er lebte als Gefangener seines Ordens zunächst im Kloster Bebenhausen, dann im Kloster Maulbronn und kam nach einem gescheiterten Fluchtversuch im November 1555 nach Hohenurach. Am 6. April 1557 unterzeichnete er eine umfangreiche Urfehde und versprach, auf der Markung Urach zu bleiben.
Horst Boxler: Ambrosius Boxler. Der letzte katholische Abt von Königsbronn, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 54 (1995), S. 121-140, hier S. 136-139
Klaus Schreiner
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000313,00235.html
Briefwechsel Herzog Christoph zu 1555
http://archive.org/stream/briefwechseldes03chrigoog#page/n411/mode/2up
= http://books.google.de/books?id=uUEOAQAAIAAJ&pg=PA339 (US)
Rothenhäusler S. 104
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n127/mode/2up =
http://books.google.de/books?id=pm8wAQAAMAAJ&pg=PA104 (US)
"Ambrosius Boxler, vormaliger Abt von Königsbronn, stellt nach seiner Entlassung von der Feste Hohenurach dem Herzog eine Verschreibung aus, dass er alles, was er von der Befestigung und deren Bewachung wahrgenommen habe, bei dem von ihm geschworenen Eide geheim halten werde."
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-455371
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1019470208
1557
Joachim Riekhart aus "Kirchen" (= Kirchheim unter Teck?), Knecht auf Hohenurach, daselbst gefangen, weil er ohne Erlaubnis seines Hauptmanns - wiewohl mit Wissen der Knechte - nach Stuttgart gezogen war, jedoch auf Fürbitte der im Artikelbrief für solche Vergehen bestimmten Strafe enthoben und mit der Auflage freigelassen, sich künftig wohl zu verhalten und seinen Dienst getreulich zu versehen, gelobt dies eidlich und schwört Urfehde. 1557 Januar 12
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517472
1562
Christian Tubingius, Abt der Benediktinerabtei Blaubeuren (gest. 1563?), wurde wegen angeblicher Unterschlagung von Klostergeldern gemeinsam mit dem Prior und Kellerer 1562 nach Hohenurach gebracht, wo sie gesondert voneinander in Haft lagen. 1563 kam er nach Stuttgart und starb wohl noch im gleichen Jahr in Bebenhausen.
Christian Tubingius: Burrensis coenobii annales. Die Chronik des Klosters Blaubeuren, hg. von Gertrud Brösamle, Stuttgart 1966, S. LII-LV
Hermann Ehmer, in: Blaubeuren, Sigmaringen 1986, S. 288 (Brösamle und die GND gehen davon aus, dass Tubingius 1563 in Bebenhausen gestorben sei. Ehmer nennt 1564, beruft sich aber auf Rothenhäusler, wo man aber nichts dazu findet.)
Rothenhäusler S. 144f.
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n167/mode/2up
[Besold:
http://books.google.de/books?id=FoOBivNYp-gC&pg=PR73 ]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012368068
1562
Der 1548 zum Abt von Alpirsbach gewählte Jakob Hochrüttiner, der 1559 auf sein Amt verzichtet hatte, wurde aufgrund von Streitigkeiten über seinen Wohnsitz im Kloster im Sommer 1562 zunächst in Maulbronn, dann auf einem blinden Ross nach Hohenurach überführt. 1563 konnte er, nun wieder in Maulbronn, fliehen.
Hermann Ehmer: Die Klosterschule 1556-1595, in: Alpirsbach. Zur Geschichte von Kloster und Stadt. Textband 2, Stuttgart 2001, S. 677-707, hier S. 682. Das blinde Ross nach Rothenhäusler S. 164
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n187/mode/
Abt Jakob von Alpirsbach
Karl J. Glatz: Geschichte des Klosters Alpirsbach auf dem Schwarzwalde, Straßburg 1877, S. 161
http://archive.org/stream/geschichtedesklo00glatuoft#page/160/mode/2up
[Pfeilsticker 2 § 3273: 3.12.1562 verhaftet und "mit seinen Zugeordneten" nach Hohenurach geführt.]
1568
Der spanische Barfüßermönch Vincenz Forer traf 1568 aus den Niederlanden in Württemberg ein, wurde als angeblicher Konvertit ins Stift aufgenommen, erwies sich aber als katholischer Spion. Er wurde zunächst auf der Burg Württemberg festgesetzt, ist 1569/70 auf Hohenwittlingen und später auf Hohenurach bezeugt, wo er 1592 (Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 206 Bü 5075 Nr. 3) nach 25jähriger Haft vergeblich um Verlegung bat.
Gustav Bossert: Die Liebestätigkeit der evangelischen Kirche Württembergs von der Zeit des Herzogs Christoph bis 1650, in Württembergische Jahrbücher 1905, Heft 1, S. 1-28; Heft 2, S. 66-117; 1906, Heft 1, S. 44-94, hier 1905, Heft 2, S.81(nicht eingesehen), 1906, Heft 1, S. 45, 50f.
[Bossert 1905
http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433062747591?urlappend=%3Bseq=779 US]
Bossert 1906:
http://books.google.de/books?id=-MpLAAAAYAAJ&pg=PA51 (US)
http://archive.org/stream/WuerttembergischeJahrbuecherFuerStatistik-1906#page/n83/mode/2up
Der Mönch befand sich 1569/70 auf Hohenwittlingen, wo er Paul Glock traf.
Gustav Bossert: Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer. Bd. 1: Herzogtum Württemberg, Leipzig 1930, S. 1101 mit Anm. 2, 1103
BWKG 1893, 85ff.
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_0008&DMDID=DMDLOG_0045
Gustav Bossert: Aus der nebenkirchlichen religiösen Bewegung der Reformationszeit in Württemberg (Wiedertäufer und Schwenckfelder), in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte NF 33 (1929) 1-41, hier S. 29
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0033&DMDID=DMDLOG_0003&LOGID=LOG_0006&PHYSID=PHYS_0030#navi
Krekler 1999: Vincentius Foreiro, Frater aus Lissabon (Kupferstich 1602)
http://books.google.de/books?id=jEfxmFIicv8C&pg=PA96
[Auf Burg Württemberg kam Frischlin in ein Gemach, in dem früher ein spanischer Mönch lag
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA471 ]
1582
1586 erfährt man: Hans Dauber ist in das 6. Jahr auf Hohenurach “wiedertauffs halb” in Haftung gelegen
Gustav Bossert: Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer. Bd. 1: Herzogtum Württemberg, Leipzig 1930, S. 639
Zum Wiedertäufer Hans Dauber, der später auf Hohenwittlingen inhaftiert wurde, siehe ebd. das Register S. 1142 und
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/dauber_hans_16th_century/
Die meisten Wiedertäufer lagen auf Schloss Hohenwittlingen, siehe
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/hohenwittlingen_baden_wurttemberg_germany
Paul Glocks Gefangenschaft auf Hohenurach ist dagegen nicht zu belegen. So aber
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/glock_paul_d._1585/
Der dortige Hinweis auf
http://hdl.handle.net/2027/uc1.31158011334116?urlappend=%3Bseq=737
ist jedoch nicht ausreichend.
Die Gefangenschaft von Wiedertäufern auf Hohenurach legt nahe Bossert: Wiedertäufer S. 1184 (Register s.v. Urach), explizit ist sie bezeugt S. 496 (bei der Geistlichen Verwaltung Urach sind für die Wiedertäufer und Mönche zu Hohenwittlingen und Urach 1559/76 über 3076 Pfund Heller aufgelaufen, 1576/77 364 Pfund Heller), S. 670 (Verhaftete auf Hohenurach und Wittlingen)
Siehe auch Otto Herding: Räte empfehlen Isolation wie bei den Wiedertäufern auf Hohenurach und Wittlingen
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048768/image_86
[Frischlin kommt in das "widertüeffers gemach"
Hedwig Röckelein/Casimir Bumiller: ... ein unruhig Poet. Nikodemus Frischlin 1547-1590, Balingen 1990, S. 124]
1590
Der neulateinische Dichter Nikodemus Frischlin lag vom 17. April 1590 bis zu seinem Tod bei einem gescheiterten Fluchtversuch am 29. November 1590 auf Hohenurach.
David Friedrich Strauß: Leben und Schriften des Dichters und Philologen Nicodemus Frischlin. Frankfurt am Main 1856, S. 549-558, 579-583
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA549
[Röckelein/Bumiller S. 121-133]
Literarische Texte über Frischlins Todessturz
http://de.wikisource.org/wiki/Hohenurach#Texte_auf_den_Tod_Nikodemus_Frischlins_bei_seinem_Fluchtversuch_1590
Text von Hans Joachim Schädlich “Kurzer Bericht vom Todfall des Nikodemus Frischlin” in der ZEIT 1977
http://www.zeit.de/1977/35/kurzer-bericht-vom-todfall-des-nikodemus-frischlin/komplettansicht
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118693719
1591
Andreas Eyb war 1574 bis 1590 evangelischer Abt in Anhausen, wurde von Friedrich I. abgesetzt und 1591 auf Hohenurach inhaftiert, wo er am 2. August 1597 starb.
Harald Drös/Gerhard Fritz: Die Inschriften des Rems-Murr-Kreises (1994), S. 120f. Nr. 222
Wilhelm Glässner: Waiblingen in Chroniken des 16. Jahrhunderts (1978), S. 41 (“zu Urach im ewigen Gefängnis”), 97, 115
[1590 wurde für den Abt von Anhausen, der sich "wegen grober Unsittlichkeit" in Untersuchung befand, ein Gemach auf Burg Württemberg vorbereitet:
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA471
Pfeilsticker 2 § 3292. Siehe auch die Kommentare.]
1597
Burkhard von Berlichingen (gest. 1623), Obervogt zu Waiblingen und Cannstatt, wurde am 14. Juli 1597 aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten ins Gefängnis (Tübingen, Stuttgart, Hohenurach) geworfen und aufgrund kaiserlicher Intervention am 24. September 1599 freigelassen.
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 155
Harald Drös: Die Inschriften des Landkreises Göppingen, Wiesbaden 1997, S. 273
Sattler
http://hdl.handle.net/2027/nnc1.0036699039?urlappend=%3Bseq=226
Hinweis auf RKG-Akten über Botendienste für Berlichingen auf Hohenurach
https://www.google.de/search?q=burkhard%20berlichingen%20hohenurach&&tbm=bks
[siehe jetzt unten zu 1608]
GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136185827
1608
Am 29. Januar 1608 starb Herzog Friedrich I. Schon am nächsten Tag wurden Magdalena Möringer, der man Kuppelei vorwarf, und weitere Frauen verhaftet. Acht Tage später kam Möringer auf Hohenurach, wo sie bis zur Freilassung gegen Urfehde am 5. September 1614 verblieb.
Ruth Blank: Magdalena Möringer. Eine Gefangene auf der Festung Hohenurach, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 65 (2006), S. 49-95
Auf Hohenurach lagen drei weitere Frauen, die verhaftet worden waren (Blank S. 59). Eine Aufzählung der in Urach liegenden Frauen: Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 48b Bü 4 (9.12.1608), so Blank S. 55 Anm. 33
[Die Akte im Online-Findmittel:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1294353
Die mir in Kopie vorliegende Aufzählung gehört nach freundlicher Mitteilung von Peter Rückert zu einem Schreiben vom 9. Dezember 1608. Es ist die Rede von Verhafteten auf Hohenurach und Albeck. Genannt werden: Sabina Scheyhing, deren Haft auf Hohenurach anderweitig bezeugt ist (siehe unten), Anna Maria, Ehefrau des Trabanten Hans Jakob Stählin im Harnischhaus (Stuttgarter Zeughaus?), Dorothea, Christoph Lindners gewesenen Lichtkämmerers Ehefrau auf (Hohen-)Tübingen und die Möringerin.
Zu allen diesen Personen gibt es biographische Informationen in:
Ruth Blank, Margaretha Matthiä, Ursula Dorothea Linder, Sabina Scheyhing. Drei Kupplerinnen in Diensten Herzog Friedrichs v. Württemberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 29 (2011), S. 63-74.
Für Stählin und Lindner sehe ich im Augenblick keinen Beleg bezüglich der Unterbringung auf Hohenurach, sie könnten auch auf Albeck inhaftiert gewesen sein.
Nicht nur dem Burghauptmann Schweitzer - siehe unten - und seinem Vorgänger Urban Stierle/Stierlin (vgl. Blank 2006 S. 72) wurde Unterstützung der Möringerin vorgeworfen, sondern auch dessen Sohn Hans Ludwig Stierle, später Hauptmann der Stadt Ulm. Dieser soll auch Botendienste für den inhaftierten Burkhard von Berlichingen geleistet haben, was er bestritt. RKG-Akten von 1617/18: Alexander Brunotte/Raimund J. Weber: Akten des Reichskammergerichts im Hauptstaatsarchiv Stuttgart S-T, Stuttgart 2005, S. 371f. Nr. 4130.
Ursula Stierlin, die Tochter des Burghauptmanns Urban Stierle, diente als eine Art Magd der Magdalena Möringer und trug für sie
Briefe und Botenlohn aus der Festung (Blank 2006 S. 72).
Zum weiteren Kontext des "Großreinemachens" nach dem Tod des Herzogs siehe auch die Hinweise in den Württ. Landtagsakten:
http://hdl.handle.net/2027/inu.39000000527353?urlappend=%3Bseq=78 US
Dort wird verwiesen auf Spittlers Werke 12, S. 290
http://hdl.handle.net/2027/wu.89094327889?urlappend=%3Bseq=306
und Georg Henghers Chronik, Stuttgart WLB, Cod. hist. fol. 320, S. 309.]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012773566
1608
Sabina Sauter, Ehefrau des Hausschneiders auf Schloss Hellenstein in Heidenheim Ludwig Scheyhing, wurde aus den gleichen Gründen wie die Möringerin verhaftet, blieb allerdings nur zehn Monate auf der Festung (bis zum 17. Februar 1609), zeitweilig (ab Juni 1608) in einem Gemach mit der Möringerin, da diese suizidgefährdet war.
Blank 2006 S. 55 Anm. 35, 64, 72
[Auch ihr Mann Ludwig Scheyhing wurde nach seiner Entlassung auf den Hohenurach verbracht. RKG-Klage (1610/30) dazu: Brunotte/Weber S-T, S. 117f. Nr. 3794
http://books.google.de/books?id=5VYrAQAAIAAJ&q=urfehde+1609+schindelin
Siehe ausführlich zu Sabina: Blank 2011, insbesondere S. 66: Am 13. April 1608 nach Hohenurach verbracht.]
1610
Matthäus Enzlin, Geheimer Rat Herzog Friedrichs I. und dessen engster Vertrauter, hatte sich die Landstände zum Feind gemacht und wurde nach dem Tod des Herzogs 1608 verhaftet. 1609 kam er auf den Hohenneuffen, 1610 nach Hohenurach. Er wurde vor allem aufgrund des Bruchs seiner Urfehde zum Tode verurteilt und am 22. November 1613 auf dem Uracher Marktplatz hingerichtet.
Oliver Auge: Holzinger, Enzlin, Oppenheimer. Günstlingsfälle am spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hof der Württemberger, in: Der Fall des Günstlings (2004), S. 365-399, hier S. 393 (zu Enzlins Verhandlungen)
Ronald G. Asch: Der Sturz des Favoriten. Der Fall Matthäus Enzlins und die politische Kultur des deutschen Territorialstaates an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 57 (1998), S. 37-63
Asch 1999 (Auszüge)
http://books.google.de/books?id=X_m0duZWftcC&pg=PA96
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 265-270
Ermittlungen und Maßnahmen gegen Enzlin und das Wachpersonal auf Hohenurach
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1213966
Siehe auch
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1213965
Pfaff: Plutarch 1830
http://books.google.de/books?id=LlsKAAAAIAAJ&pg=PA11
WJbb. 1828
http://books.google.de/books?id=wgYAAAAAMAAJ&pg=PA189
Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon
http://books.google.de/books?id=jTpjQyaqNY4C&pg=PA139
Haftumstände in RKG-Akten
http://books.google.de/books?id=P5lnAAAAMAAJ&q=haftumstände+hohenurach
[= Brunotte/Weber E-G (1995), S. 141f. Nr. 925f. zu 1613/14. Vgl. auch Dieselben H (1999), S. 252 Nr. 1875 zu Enzlins Schwiegersohn Imhof.]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119663805
[1610
Aus dem Bericht des Leonberger Obervogts Burkhard Stickel vom 21. Mai 1610: Enzlin "uf Hohenurach verführt ins Berlingers Losament" - wer war Berlinger? Burkhard von Berlichingen?
Die "Frau von Treffen" könnte auf Wittlingen oder auf Hohenurach "ins Früschlins Losament" gelegt werden.
Wer war die Frau von Treffen?
Hugo Gmelin: Über Burkhard Stickel und dessen Kriegsfeldordnung vom Jahr 1607. In: Württembergische Vierteljahrshefte 12 (1889), S. 4-10, hier S. 8
http://books.google.de/books?id=8SI8AAAAMAAJ&pg=PA8 US ]
1613
Der Hohenuracher Burghauptmann Hans Schweitzer, dem man die Begünstigung der Möringerin und Enzlins vorwarf, wurde im Frühjahr 1613 auf der zuvor von ihm geleiteten Festung gefangen gehalten. Schweitzer und der Guardiknecht Michael Ruthard wurden am 5. Juli 1613 auf dem Uracher Marktplatz enthauptet.
Blank 2006 S. 78.
[Maurer 1975, S. 6
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2151
Württ. Jbb, 1824
http://books.google.de/books?id=U0ScLKH4YSkC&pg=PA161 ]
1630
Vier Monate [Vom 25. Januar 1630 bis zur Durchsetzung der Anordnung der Haftentlassung durch Ferdinand II. am 12. März 1630 über vier Wochen später] lag Dr. Wilhelm Bidembach auf Hohenurach, weil er öffentlich eine für Württemberg unvorteilhafte juristische Beurteilung der Frage der Klösterrestitution vertreten hatte.
“Welchermassen Dr. Wilhelm Bidembach, Professor zu Tübingen, wegen eines in der Frankfurter Zeitung eingerückten Passus von einer Untreue der Professoren zu Tübingen in Stellung eines Bedenkens wegen Restitution der Klöster an die Katholischen und seiner ausgestoßenen bedrohlichen Reden verdächtig, darüber ex Senatu removiert und nach Hohenurach gefänglich gesetzt worden”
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-780589
[Bernhard Zaschka: Die Lehrstühle der Universität Tübingen im Dreißigjährigen Krieg, Tübingen 1993, S. 96
"... helfen zu graben den Brunnen des Lebens", Tübingen 1977, S. 100f.: verhaftet 25.1.1630, nach dem kaiserlichen Mandat 12.3.1630 an die Universität Tübingen dauerte es aber noch mehr als vier Wochen.
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 170f. mit falschen Angaben zur Gefangenschaft]
Siehe auch
Volker Schäfer: Die Universität Tübingen zur Zeit Schickards, in: Zum 400. Geburtstag von Wilhelm Schickard, hg. von Friedrich Seck, Sigmaringen 1995, S. 9-26, hier S. 11
http://books.google.de/books?id=xcNiR4i07OwC&pg=PA11
Günter:Restitutionsedikt 1901
http://archive.org/stream/dasrestitutions00gngoog#page/n78/mode/2up
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1014358329
(1648)
Nein! “Prophet” Hans Keyl aus Gerlingen wurde 1648 nicht auf Hohenurach, sondern auf dem Hohenneuffen gefangen gehalten! So aber irrtümlich Sabine Holtz: Theologie und Alltag (1993), S. 298
http://books.google.de/books?id=qqr7wUqhe9QC&pg=PA298 (Auszug)
Siehe die angegebene Quelle (Dreher, in: BWKG 1904, S. 48)
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0008&DMDID=DMDLOG_0006&LOGID=LOG_0010&PHYSID=PHYS_0040#navi
http://books.google.de/books?id=AzY2AQAAMAAJ&pg=PA48 US
Ebenso Norbert Haag, in: ZWLG 48 (1989), S. 128; David Warren Sabean: Das zweischneidige Schwert (1986), S. 103
1660
Kapitän Wagaw
Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 202 Bü 2342
1681
Der ehemalige Markgröninger Schullehrer Magister Johann Georg Hingher wurde wegen seiner Geisteskrankheit (“ob delirium”) ab 1681 auf Hohenurach, später auf Hohenneuffen untergebracht. Dort blieb er über 30 Jahre. Er starb 1715 auf Hohenneuffen.
Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 284/99 Bü 183 (Akten über seine Versorgung).
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1280347 (mit falscher Namensform)
http://forum.ahnenforschung.net/archive/index.php/t-47930.html (* 1645 in Stockholm)
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22eindringliche+Ermahnung+mit+auf+den+Weg+geben+lassen%2C+sich+**%22 (zur Tätigkeit in Markgröningen)
[Pfeilsticker 2 § 3345]
[ https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB3494 Hengher]
1729
Der Gardetrompeter Heinrich Dünger wurde gemäß Dekret Ludwigsburg 31. Januar 1729 auf ein halbes Jahr Jahr als Gefangener dem Kommandanten Krumholtz auf Hohenurach übergeben. Am 3. Februar 1729 wurde er völlig pardonniert unter der Bedingung, dass er ständig in Diensten bliebe.
Walther Pfeilsticker: Neues Württembergisches Dienerbuch, Bd. 1, Stuttgart 1957, § 305
https://www.google.de/search?q=pfeilsticker%20ludwigsburg%20hohenurach&tbm=bks
1731
In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1731 wurde Christina Wilhelmina Reichsgräfin von Würben und Freudental geborene von Grävenitz (gest. 1744), Mätresse von Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg und als “Landverderberin” geschmäht, auf ihrem Gut Freudental verhaftet und nach Urach gebracht, wo sie auch auf Hohenurach gefangen lag. Sie kam im Frühjahr 1733 wieder frei.
Sybille Osswald-Bargende: Die Mätresse, der Fürst und die Macht. Christina Wilhelmina von Grävenitz und die höfische Gesellschaft, Frankfurt am Main 2000, S. 182
http://books.google.de/books?id=e2SsLKwJ6JgC&pg=PA182
Paul Sauer 2008
http://www.libreka.de/9783874077989/216
Gratianus 1831
http://books.google.de/books?id=vGgAAAAAcAAJ&pg=PA388
Hänle 1847
http://books.google.de/books?id=E1AAAAAAcAAJ&pg=PA15
Steiff-Mehring S. 615
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_317.jpg
Süskind 1856
http://books.google.de/books?id=Y-tUAAAAcAAJ&pg=PA48 auch Referendarius Pfeil und Regierungsrat Vollmann auf Hohenurach genannt
Siehe dazu Osswald-Bargende: Ein Teil der Graevenitz-Partei "fand sich - wie Oberhofmarschall Friedrich Wilhelm von Grävenitz d.J., die Regierungsräte Scheid und Vollmann oder Kirchenratsdirektor von Pfeil - im Dezember 1733 nach der Regierungsübernahme Herzog Carl Alexanders auf den Festungen Hohenasperg, Hohenneuffen und Hohenurach wieder" (S. 76).
http://books.google.de/books?id=e2SsLKwJ6JgC&pg=PA76
Steiff-Mehring S. 640: Hohenurach genannt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_330.jpg (Vollmann kam auf den Hohenasperg)
[Liste der Verhafteten vom Dezember 1733 bei Spittler:
http://books.google.de/books?id=AphJAAAAYAAJ&pg=PA414
Zeitungsmeldung über Entlassung 1735:
http://books.google.de/books?id=5iEoAAAAYAAJ&pg=PA89
Geheimer Kabinettssekretär Karl Ludwig Vollmann: Pfeilsticker 1 § 1216. Untersuchungsakten zu ihm:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275438
Regierungsrat Johann Friedrich Scheid: Pfeilsticker 1 § 1229. Akten:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275441
Konsistorialdirektor Joachim Friedrich Pfeil: Pfeilsticker 1 § 1709: Gefangener auf Hohentwiel. Akten:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275437]
GND Grävenitz http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118696955
1733
Zwei berühmte herzogliche Baumeister, Donato Giuseppe Frisoni und Paolo Retti, wurden sofort nach dem Tod Herzog Eberhard Ludwigs (Oktober 1733) festgenommen und zunächst nach Hohenurach, dann nach Hohenneuffen gebracht. Am 6. September 1735 entlassen, wurden sie noch im gleichen Monat wieder in Dienst genommen. [Wenige Monate später starb Frisoni am 29. 11.1735.]
Werner Fleischhauer: Barock im Herzogtum Württemberg, Stuttgart 1958, S. 232. [Ebd.: "Man warf ihnen vor, herzogliche Gelder veruntreut, sich betrügerisch bereichert und große Kapitalien bei einem oberschwäbischen Prälaten und beim Schwäbischen Kreis stehen zu haben."]
http://books.google.de/books?id=i9PqAAAAMAAJ&q=verhaftet+hohenurach
Siehe auch
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=hohenurach+frisoni+retti+ludwigsburg
GND Frisoni http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119045001
GND Retti http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136232124
1736
Von November bis Dezember 1736 wurden der pietistische Pfarrer Johann Jakob Rues von Dürrmenz, der viele seiner Gemeinde vom Abendmahl ausgeschlossen hatte, und neun Bürger aus Dürrmenz auf der Festung gefangen gehalten. Die neun Bürger mussten Ziegel den Berg hinauftragen.
Friedrich Fritz: Johann Jakob Rues (1681-1745), ein pietistischer Seelsorger und seine Schicksale unter Herzog Karl Alexander, in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 28 (1924), S. 130-143, hier S. 139
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0028&DMDID=DMDLOG_0012&LOGID=LOG_0016&PHYSID=PHYS_0136#navi
Martin Brecht 1995
http://books.google.de/books?id=m-rxK5nsNVAC&pg=PA241
Siehe auch
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=hohen+urach+rues+d%C3%BCrrmenz
1765
Damals weigerten sich zahlreiche Balinger Bürger, ihre Steuerzettel in Empfang zu nehmen. Am Karfreitag wurde ein Dragonerregiment nach Balingen gelegt, viele Bürger kamen in Arrest, vier wurden auf den Hohenurach gebracht.
Wilhelm Wik: Balinger Bürger als Gefangene auf dem Hohen-Urach, in: Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen 5 (1958), S. 244. Online:
http://www.heimatkundliche-vereinigung.de/download/HKB-pdf/Heimatkundliche%20Blaetter%2005_1958%20S%20193%20-%20244.pdf
Nachtrag: Preprint meines Aufsatzes "Hohenurach und seine Gefangenen"
http://academia.edu/4033911/Hohenurach_und_seine_Gefangenen_-_PREPRINT
#forschung
Archivversion: http://www.webcitation.org/6HsExuVPj
 Urach und Hohenurach ca. 1616
Urach und Hohenurach ca. 1616
Ergänzungen und Korrekturen sind natürlich willkommen!
1471
Im Rahmen einer Fehde nahm Graf Eberhard im Bart von Württemberg im Oktober 1471 Hans von Geroldseck und drei seiner Söhne auf Burg Albeck gefangen und ließ sie nach Urach führen. 1472 kamen die Söhne, 1473 der Vater frei. Die mir bekannten Quellen geben nur den Ortsnamen Urach, doch erscheint es plausibel, dass man die Gefangenen auf der Höhenburg und nicht im Stadtschloss oder einem anderen Uracher Gefängnis verwahrt hat.
Den Hinweis auf die Urfehde des Hans von Geroldseck vom 11. Dezember 1473, Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 169 U 113, in der von der Gefangenschaft zu Urach die Rede ist, verdanke ich einem von Christoph Bühler freundlicherweise zur Verfügung gestellten Auszug aus seinen Geroldsecker Regesten.
OAB Sulz 1863: Hohenurach
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:OAB_Sulz.djvu/132
zuvor Köhler 1835: Hohenurach
http://books.google.de/books?id=A3QAAAAAcAAJ&pg=PA219
Bossert: Eberhard S. 22
https://archive.org/stream/EberhardImBart/Eberhard_im_Bart#page/n25/mode/2up
Steinhofer III, 1752: nach Urach geführt (nach Hertzog?)
http://books.google.de/books?id=7H4AAAAAcAAJ&pg=PA192
Martens 1847 mit Literaturangaben
http://books.google.de/books?id=Oqg4AAAAYAAJ&pg=PA143
Hertzog 1592: nach Urach
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/671675
Koch 1828: Hohenurach
http://books.google.de/books?id=rnIAAAAAcAAJ&pg=PA100
1476
Hans Bimwang genannt Schreiber, Bürger und Büttel zu Urach, wegen des "Handels" um die Gefangenschaft des Peter Hafenberg zu Urach gefangen, schwört Urfehde. 1476 August 19. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517381
1484
Hüglin, Sohn des Hug Claußen aus Straßburg, wegen "mercklichen Verschuldens" im Gefängnis des Grafen Eberhard d.Ä., von Württemberg gefangen, schwört Urfehde. 1484 August 12. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1160846
1490
Graf Heinrich von Württemberg wurde im August 1490 von Graf Eberhard im Bart als geisteskrank nach Hohenurach gebracht. Dort lebte er mit seiner Familie. Er befand sich auf Hohenurach - unterbrochen von einem Aufenthalt in Stuttgart bei seinem Sohn Herzog Ulrich - bis zu seinem Tod 1519.
Klaus Graf: Graf Heinrich von Württemberg († 1519) – Aspekte eines ungewöhnlichen Fürstenlebens, in: Württemberg und Mömpelgard 600 Jahre Begegnung. Montbéliard – Wurtemberg 600 Ans de Relations, hg. von Sönke Lorenz/Peter Rückert, Leinfelden-Echterdingen 1999, S. 107–120. Autorenversion mit Nachträgen:
http://web.archive.org/web/20120331005625/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/heinr.htm
Nachträge dazu: http://archiv.twoday.net/stories/6057224/
Akten zur Gefangenschaft online:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24894
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=101248342
1492
Urfehde von Hans Waldhauser, Steinmetzknecht aus Ichenhausen bei Ulm, unter dringendem Mordverdacht an einem Messerschmied, der bei Gächingen im Uracher Amt getötet worden war, gefangen. 1492 Juni 23. Siegler: Burgvogt von Hohenurach, daher Haft auf Hohenurach anzunehmen
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517389
Ca. 1502
Konrad Holzinger, “Günstling” Herzog Eberhards II. von Württemberg, wurde auf Hohenurach gefangengehalten. Michel Ott von Echterdingen und seine Verwandten, die Brüder Peter und Michel Schott, wurden aufgrund der Kontakte zu Holzinger, der Ermöglichung von Schriftwechsel für Holzinger und des Plans, ihn zu befreien, viele Monate ins Gefängnis geworfen (Ott lag auf Hohentübingen, Peter Schott auf dem Hohenasperg).
Klaus Graf: Konrad Holzinger, Gefangener auf Hohenurach (um 1500), und Michel Ott von Echterdingen, in: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 21. Juni 2013
http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1453
Die Gefangenschaft Holzingers auch auf dem Hohenurach ergibt sich aus Hauptstaatsarchiv Stuttgart L 5 Bd. 3 (Tomus Austriacus), S. 1284 und den drei folgenden Urfehden.
Michel Ott aus Kirchheim unter Teck, zu Tübingen gefangen, nach Bezahlung seiner Atzung begnadigt und entlassen, schwört Urfehde. Er war als verpflichteter Kanzleischreiber mit einer im Gefängnis liegenden Person, die nicht mit ihm verwandt war, in Schriftwechsel gestanden. 1503 Juli 27
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-515681
Peter Schott von Grabenstetten, der als Schlosswächter auf Hohenurach einem Gefangenen Botschaft hatte zukommen lassen, schwört Urfehde. 1503 November 9. Er wurde wohl auf dem Hohenasperg gefangen gehalten.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-515410
Michel Schott von Unterlenningen, wegen Gefangenenbegünstigung im Gefängnis Herzog Ulrichs gelegen, jedoch auf Fürbitte gegen Bezahlung der Atzung aus der Haft entlassen, schwört Urfehde. 1503 August 2. "Sein Vergehen: Er hatte zugelassen, dass in seinem Haus zu Urach sein Vetter Michel Ott Briefe an seinen Bruder Peter, gewesenen Schlosswächter zu Hohen-Urach, übergab, die für eine auf Hohen-Urach gefangengehaltene Person bestimmt waren, und hatte dieses pflichtwidrige Verhalten seines Bruders nicht angezeigt; außerdem hatte er der betreffenden Person durch seinen Bruder ausrichten lassen, sein Vetter und er wollten helfen, ihn zu befreien, falls er ihnen die Kunst, derentwegen sein Vetter sich an ihn gewandt hat, mitteilen würde."
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1141779
GND Holzinger http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012274284
1516
Der ehemalige Tübinger Vogt Konrad Breuning, ein Gegner Herzog Ulrichs, wurde am 20. November 1516 verhaftet und zunächst auf Hohenurach, dann auf dem Hohenneuffen eingekerkert. Er wurde schon in Hohenurach grausam gefoltert. Am 27. September 1517 wurde er auf dem Stuttgarter Marktplatz hingerichtet.
Manfred Eimer: Konrad Breuning. Vogt zu Tübingen, Mitglied der Landschaft und des Regimentsrats. Um 1440-1517, in: Schwäbische Lebensbilder Bd. 4, Stuttgart 1948, S. 1-15, hier S. 10f.
Ohr: Ein Brief Conrad Breunings, Lit. Beilage des Staats-Anzeigers für Württ. 1904, S. 242-247 (nicht eingesehen)
Heyd: Herzog Ulrich
http://books.google.de/books?id=im8IAAAAQAAJ&pg=PA483
Bericht des Hans Breuning ed. Sophronizon
http://books.google.de/books?id=SeoaAAAAYAAJ&pg=RA3-PA26
ADB
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Breuning,_Konrad_von
Josef Forderer 1931
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/LXV198_22_1931_1/0006
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118515241
1525
Im Bauernkrieg wurde am 24. April 1525 ein Rädelsführer auf Hohenurach verbracht. Der Uracher Untervogt schrieb, er wolle den “Buben auf dem Schloß strecken lassen” (also foltern).
Zimmermann 1843
http://books.google.de/books?id=WRNMAAAAYAAJ&pg=PA360
1525
Aufgrund eines fälschen Gerüchts befahl der Schwäbischer Bund, den Tübinger Professor und Pfarrer Dr. Gallus Müller auf den Hohenurach zu bringen, wozu es aber nicht kam.
Anton Nägele: Dr. Gallus Müller von Fürstenberg a.D. und sein Wirken in und für Tübingen, Freiburg und Tirol, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), S. 97-164, hier S. 105f.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5968/
450 Jahre Evangelische Landeskirche in Württemberg. Teil 1: Reformation in Württemberg (Stuttgart 1984), S. 71 [Nr. 5.11: 31. Mai 1525 Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 54 Bü 16, Bl. 25: Verhaftungs- und Hinrichtungsbefehl des Schwäbischen Bundes an die Regierung in Württemberg mit der Anweisung 1. den Pfarrer Gall von Tübingen wegen aufrührerischer Predigten auf Hohenurach gefangenzusetzen, 2. Franz Gigelin von Stuttgart wegen lutherischer Neigungen foltern und richten zu lassen, 3. den Pfarrer von Schützingen hinzurichten.]
http://books.google.de/books?id=TovYAAAAMAAJ&q=hohenurach
Heyd: Herzog Ulrich
http://books.google.de/books?id=h1U9AAAAcAAJ&pg=PA266
[1525
Nach den eben genannten Belegen zu 1525 liegt es nahe anzunehmen, dass das in einigen Stuttgarter Urfehden - vor allem vom Herbst 1525 - genannte Gefängnis des Schwäbischen Bundes in Urach mit Hohenurach zu identifizieren ist.
Horst Carl (Gießen) danke ich für die Mitteilung, dass ihm aus seinen Unterlagen zum Schwäbischen Bund nichts zu diesem Gefängnis bekannt sei. Vielleicht werde man im großen Urfehde-Bestand des Stadtarchivs Augsburg weiter fündig.
Hans Pfuder zu Kohlberg, wegen des Verdachts, strafbare Handlungen begangen zu haben, im Gefängnis des Schwäbischen Bundes zu Urach gefangen
1519 Dezember 7
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518037
Georg Dietz aus Veringen (wohl die Grafschaft), Pfarrer zu Hausen an der Lauchert, wegen Teilnahme an den Bauernunruhen einige Zeit im Gefängnis des Schwäbischen Bundes zu Urach gefangen
1525 September 2
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517703
Baltus Schleifer aus Reutlingen, wegen Teilnahme am Bauernaufstand und Plünderung etlicher Gotteshäuser ins Gefängnis der gemeinen Bundesstände gekommen
1525 September 2
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518042
Bütsch Ludlin aus Mägerkingen, einige Zeit im Gefängnis der Bundesstände zu Urach gefangen, weil er beim Einfall Herzog Ulrichs von Württemberg um Fastnacht (28. Febr.), als Erzherzog Ferdinand von Österreich gegen ihn nach Tübingen ins Feld zog, unter einem Haufen der Landschaft gesagt hatte, wie man es wohl anstelle, den Dietrich Spät dem Herzog auszuliefern, und auch sonst während der Bauernunruhen feindliche Reden gegen die österreichische Regierung geführt hatte
1525 September 11
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517718
Henslin Miller, Sohn des + Hans Miller, B. zu Urach, einige Zeit im
Gefängnis des Schwäbischen Bundes festgehalten, weil er sich während des vergangenen Bauernaufstands mit unziemlichen Reden gegen die Obrigkeit empört, auch in den gebannten Gewässern der Herrschaft gefischt hatte
1525 September 18
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517448
Christian Auberlin zu Gruorn, eine Zeitlang im Gefängnis der
Bundesstände zu Urach gefangen, weil er Briefe der wider die Obrigkeit und den Schwäbischen Bund aufrührerischen Bauern befördert hatte
1525 September 23
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517701
Alexander Teufel, ein Pfeifer, seßhaft zu Mägerkingen, im Gefängnis der Bundesstände gef., weil er mit etlichen Pfeifern den Bauern zugezogen und bei ihnen geblieben war, auch mitgeholfen hatte, dem Kloster Zwiefalten bei Maßhalderbuch das Vieh und anderes wegzunehmen und demselben großen Schaden zugefügt hatte,
1525 Oktober 27
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517719 ]
1535
Der Tübinger Keller Wilhelm Dachtler genannt Gilg wurde 1535 wegen Agitation gegen Herzog Ulrich nach Hohenurach verbracht und kam erst Anfang 1537 gegen Urfehde wieder frei.
"Nach längerer Haft auf Hohenurach kam er Anfang 1537 zwar frei, mußte aber 1000 Gulden Strafe zahlen und beschwören, an keiner »Winkelzusammenkunft« mehr teilzunehmen, sich nur noch mit den engsten Anverwandten, und zwar jeweils nicht mehr als acht Personen, zusammenzusetzen, keine Badstube zu betreten und das Amt Tübingen nicht zu verlassen, wobei seine 15 Bürgen unter Stellung von 3000 Gulden verpflichtet wurden, ihn im Übertretungsfall zur Verhaftung anzuzeigen" (Janssen S. 316)
Roman Janssen: Mittelalter in Herrenberg, Ostfildern 2008, S. 131, 316
http://books.google.de/books?id=x80jAQAAIAAJ&q=hohenurach
1538
Lukas Götz (gest. 1546), Abt des Zisterzienserklosters Herrenalb, wurde 1538 wegen Unterschlagung verhaftet und nach Hohenurach verbracht. Man ließ ihn erst gegen Urfehde vom 2. Juli 1543 wieder frei.
Hermann Ehmer: Die Reformation in Herrenalb. Das Ende des Klosters und der Versuch eines Neubeginns, in: 850 Jahre Kloster Herrenalb, hg. von Peter Rückert/Hansmartin Schwarzmaier, Stuttgart 2001, S. 139-166, hier S. 149f.
Siegfried Frey: Das württembergische Hofgericht (1460-1618). Stuttgart 1989, S. 175
http://books.google.de/books?id=xSdoAAAAMAAJ&q=hohenurach
Konrad Rothenhäusler: Die Abteien und Stifte des Herzogthums Württemberg im Zeitalter der Reformation, Stuttgart 1886, S. 31f. mit unrichtiger Darstellung
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n53/mode/2up
1540
Berichte des Burgvogts von Hohenurach in Sachen Michael Löffler (Gefangener auf Hohenurach)
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-518167
[Peter Rückert teilte freundlicherweise mit Mail vom 3. Dezember 2013 mit: Nach einem der Urfehde beiliegenden Bericht des Burgvogts von Hohenurach (Signatur A 44 U6032) kann die Haft Michael Löffler auf Hohenurach belegt werden.]
1543
Im Herbst 1543 fielen der Rentkammerrat Martin Nüttel und der Landschreiber Johann Hafenberg in Ungnade und wurden auf Hohenurach gefangen gesetzt. Hafenberg wurde zu dem
Gustav Bossert d. J.: Der Beamtenwechsel in Württemberg um 1544, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 8 (1944-1948), S. 280-297, hier S. 285
Walter Bernhardt: Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre Beamten 1520-1629, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 337 (Hafenberg), 524f. (Nüttel)
Frey: Hofgericht S. 221 (Hafenberg)
Gerhard Seibold: Die Entlassung des Erbmarschalls Hans Konrad Thumb von Neuburg, in: Genealogisches Jahrbuch 40 (2000), S. 87-104 [mit widersprüchlichen Angaben zur Gefangenschaft Nüttels. S. 99 Hafenberg gemeinsam mit Nüttel verhaftet und auf Hohenurach festgesetzt; S. 97: Nach der Verhaftung zunächst nach Oberwittlingen gebracht, starb auf dem Ritt nach Urach. Anders Bossert. Vgl. auch Pfeilsticker - wie unten - 1 § 1684: auf Hohenurach gebracht, Folter 31.3.1544 auf Hohenwittlingen.]
[1543
Endris Rieger, Klingenschmied von Augsburg, im Gefängnis Herzog Ulrichs gelegen wegen Entführung der Tochter des Wolf Schenk von Stauffenberg zu Ditzingen, schwört Urfehde 1548 März 22. Das Gefängnis Herzog Ulrichs und die Tatsache, dass zwei Uracher Bürger siegeln, verweist auf Hohenurach.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-522044
Akten dazu
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-10333
Bezeugt wird ein späterer Aufenthalt durch Pfeilsticker: Neues württ. Dienerbuch 2 (1963) § 2951: Burgvogt empfängt Atzungsgeld für ihn und zwar 10 Kreuzer/Tag von Dezember 1552 bis 1.10.1553.
Gustav Bossert: Aus der Zeit der Fremdherrschaft 1519-1534. In: Württembergische Jahrbücher 1911, S. 49-78, hier S. 78: Der Viehhändler Rieger habe die Frau, die ihn heiraten wollte, um ihrem Elternhaus zu entfliehen, 1542 mit ihrem Einverständnis entführt. Er habe die Tat aber mit 6 Jahren Haft auf Hohenurach und Hohenwittlingen büßen müssen.
http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076054152?urlappend=%3Bseq=116 US ]
1553
Abt Andreas Boxler (gest. nicht vor 1572) der Zisterzienserabtei Königsbronn wurde am 10. März 1553 verhaftet. Er lebte als Gefangener seines Ordens zunächst im Kloster Bebenhausen, dann im Kloster Maulbronn und kam nach einem gescheiterten Fluchtversuch im November 1555 nach Hohenurach. Am 6. April 1557 unterzeichnete er eine umfangreiche Urfehde und versprach, auf der Markung Urach zu bleiben.
Horst Boxler: Ambrosius Boxler. Der letzte katholische Abt von Königsbronn, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 54 (1995), S. 121-140, hier S. 136-139
Klaus Schreiner
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000313,00235.html
Briefwechsel Herzog Christoph zu 1555
http://archive.org/stream/briefwechseldes03chrigoog#page/n411/mode/2up
= http://books.google.de/books?id=uUEOAQAAIAAJ&pg=PA339 (US)
Rothenhäusler S. 104
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n127/mode/2up =
http://books.google.de/books?id=pm8wAQAAMAAJ&pg=PA104 (US)
"Ambrosius Boxler, vormaliger Abt von Königsbronn, stellt nach seiner Entlassung von der Feste Hohenurach dem Herzog eine Verschreibung aus, dass er alles, was er von der Befestigung und deren Bewachung wahrgenommen habe, bei dem von ihm geschworenen Eide geheim halten werde."
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-455371
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1019470208
1557
Joachim Riekhart aus "Kirchen" (= Kirchheim unter Teck?), Knecht auf Hohenurach, daselbst gefangen, weil er ohne Erlaubnis seines Hauptmanns - wiewohl mit Wissen der Knechte - nach Stuttgart gezogen war, jedoch auf Fürbitte der im Artikelbrief für solche Vergehen bestimmten Strafe enthoben und mit der Auflage freigelassen, sich künftig wohl zu verhalten und seinen Dienst getreulich zu versehen, gelobt dies eidlich und schwört Urfehde. 1557 Januar 12
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-517472
1562
Christian Tubingius, Abt der Benediktinerabtei Blaubeuren (gest. 1563?), wurde wegen angeblicher Unterschlagung von Klostergeldern gemeinsam mit dem Prior und Kellerer 1562 nach Hohenurach gebracht, wo sie gesondert voneinander in Haft lagen. 1563 kam er nach Stuttgart und starb wohl noch im gleichen Jahr in Bebenhausen.
Christian Tubingius: Burrensis coenobii annales. Die Chronik des Klosters Blaubeuren, hg. von Gertrud Brösamle, Stuttgart 1966, S. LII-LV
Hermann Ehmer, in: Blaubeuren, Sigmaringen 1986, S. 288 (Brösamle und die GND gehen davon aus, dass Tubingius 1563 in Bebenhausen gestorben sei. Ehmer nennt 1564, beruft sich aber auf Rothenhäusler, wo man aber nichts dazu findet.)
Rothenhäusler S. 144f.
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n167/mode/2up
[Besold:
http://books.google.de/books?id=FoOBivNYp-gC&pg=PR73 ]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012368068
1562
Der 1548 zum Abt von Alpirsbach gewählte Jakob Hochrüttiner, der 1559 auf sein Amt verzichtet hatte, wurde aufgrund von Streitigkeiten über seinen Wohnsitz im Kloster im Sommer 1562 zunächst in Maulbronn, dann auf einem blinden Ross nach Hohenurach überführt. 1563 konnte er, nun wieder in Maulbronn, fliehen.
Hermann Ehmer: Die Klosterschule 1556-1595, in: Alpirsbach. Zur Geschichte von Kloster und Stadt. Textband 2, Stuttgart 2001, S. 677-707, hier S. 682. Das blinde Ross nach Rothenhäusler S. 164
http://archive.org/stream/DieAbteienUndStifteDesHerzogthumsWuerttemberg#page/n187/mode/
Abt Jakob von Alpirsbach
Karl J. Glatz: Geschichte des Klosters Alpirsbach auf dem Schwarzwalde, Straßburg 1877, S. 161
http://archive.org/stream/geschichtedesklo00glatuoft#page/160/mode/2up
[Pfeilsticker 2 § 3273: 3.12.1562 verhaftet und "mit seinen Zugeordneten" nach Hohenurach geführt.]
1568
Der spanische Barfüßermönch Vincenz Forer traf 1568 aus den Niederlanden in Württemberg ein, wurde als angeblicher Konvertit ins Stift aufgenommen, erwies sich aber als katholischer Spion. Er wurde zunächst auf der Burg Württemberg festgesetzt, ist 1569/70 auf Hohenwittlingen und später auf Hohenurach bezeugt, wo er 1592 (Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 206 Bü 5075 Nr. 3) nach 25jähriger Haft vergeblich um Verlegung bat.
Gustav Bossert: Die Liebestätigkeit der evangelischen Kirche Württembergs von der Zeit des Herzogs Christoph bis 1650, in Württembergische Jahrbücher 1905, Heft 1, S. 1-28; Heft 2, S. 66-117; 1906, Heft 1, S. 44-94, hier 1905, Heft 2, S.81
[Bossert 1905
http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433062747591?urlappend=%3Bseq=779 US]
Bossert 1906:
http://books.google.de/books?id=-MpLAAAAYAAJ&pg=PA51 (US)
http://archive.org/stream/WuerttembergischeJahrbuecherFuerStatistik-1906#page/n83/mode/2up
Der Mönch befand sich 1569/70 auf Hohenwittlingen, wo er Paul Glock traf.
Gustav Bossert: Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer. Bd. 1: Herzogtum Württemberg, Leipzig 1930, S. 1101 mit Anm. 2, 1103
BWKG 1893, 85ff.
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_0008&DMDID=DMDLOG_0045
Gustav Bossert: Aus der nebenkirchlichen religiösen Bewegung der Reformationszeit in Württemberg (Wiedertäufer und Schwenckfelder), in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte NF 33 (1929) 1-41, hier S. 29
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0033&DMDID=DMDLOG_0003&LOGID=LOG_0006&PHYSID=PHYS_0030#navi
Krekler 1999: Vincentius Foreiro, Frater aus Lissabon (Kupferstich 1602)
http://books.google.de/books?id=jEfxmFIicv8C&pg=PA96
[Auf Burg Württemberg kam Frischlin in ein Gemach, in dem früher ein spanischer Mönch lag
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA471 ]
1582
1586 erfährt man: Hans Dauber ist in das 6. Jahr auf Hohenurach “wiedertauffs halb” in Haftung gelegen
Gustav Bossert: Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer. Bd. 1: Herzogtum Württemberg, Leipzig 1930, S. 639
Zum Wiedertäufer Hans Dauber, der später auf Hohenwittlingen inhaftiert wurde, siehe ebd. das Register S. 1142 und
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/dauber_hans_16th_century/
Die meisten Wiedertäufer lagen auf Schloss Hohenwittlingen, siehe
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/hohenwittlingen_baden_wurttemberg_germany
Paul Glocks Gefangenschaft auf Hohenurach ist dagegen nicht zu belegen. So aber
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/glock_paul_d._1585/
Der dortige Hinweis auf
http://hdl.handle.net/2027/uc1.31158011334116?urlappend=%3Bseq=737
ist jedoch nicht ausreichend.
Die Gefangenschaft von Wiedertäufern auf Hohenurach legt nahe Bossert: Wiedertäufer S. 1184 (Register s.v. Urach), explizit ist sie bezeugt S. 496 (bei der Geistlichen Verwaltung Urach sind für die Wiedertäufer und Mönche zu Hohenwittlingen und Urach 1559/76 über 3076 Pfund Heller aufgelaufen, 1576/77 364 Pfund Heller), S. 670 (Verhaftete auf Hohenurach und Wittlingen)
Siehe auch Otto Herding: Räte empfehlen Isolation wie bei den Wiedertäufern auf Hohenurach und Wittlingen
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048768/image_86
[Frischlin kommt in das "widertüeffers gemach"
Hedwig Röckelein/Casimir Bumiller: ... ein unruhig Poet. Nikodemus Frischlin 1547-1590, Balingen 1990, S. 124]
1590
Der neulateinische Dichter Nikodemus Frischlin lag vom 17. April 1590 bis zu seinem Tod bei einem gescheiterten Fluchtversuch am 29. November 1590 auf Hohenurach.
David Friedrich Strauß: Leben und Schriften des Dichters und Philologen Nicodemus Frischlin. Frankfurt am Main 1856, S. 549-558, 579-583
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA549
[Röckelein/Bumiller S. 121-133]
Literarische Texte über Frischlins Todessturz
http://de.wikisource.org/wiki/Hohenurach#Texte_auf_den_Tod_Nikodemus_Frischlins_bei_seinem_Fluchtversuch_1590
Text von Hans Joachim Schädlich “Kurzer Bericht vom Todfall des Nikodemus Frischlin” in der ZEIT 1977
http://www.zeit.de/1977/35/kurzer-bericht-vom-todfall-des-nikodemus-frischlin/komplettansicht
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118693719
1591
Andreas Eyb war 1574 bis 1590 evangelischer Abt in Anhausen, wurde von Friedrich I. abgesetzt und 1591 auf Hohenurach inhaftiert, wo er am 2. August 1597 starb.
Harald Drös/Gerhard Fritz: Die Inschriften des Rems-Murr-Kreises (1994), S. 120f. Nr. 222
Wilhelm Glässner: Waiblingen in Chroniken des 16. Jahrhunderts (1978), S. 41 (“zu Urach im ewigen Gefängnis”), 97, 115
[1590 wurde für den Abt von Anhausen, der sich "wegen grober Unsittlichkeit" in Untersuchung befand, ein Gemach auf Burg Württemberg vorbereitet:
http://books.google.de/books?id=K-w5AAAAcAAJ&pg=PA471
Pfeilsticker 2 § 3292. Siehe auch die Kommentare.]
1597
Burkhard von Berlichingen (gest. 1623), Obervogt zu Waiblingen und Cannstatt, wurde am 14. Juli 1597 aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten ins Gefängnis (Tübingen, Stuttgart, Hohenurach) geworfen und aufgrund kaiserlicher Intervention am 24. September 1599 freigelassen.
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 155
Harald Drös: Die Inschriften des Landkreises Göppingen, Wiesbaden 1997, S. 273
Sattler
http://hdl.handle.net/2027/nnc1.0036699039?urlappend=%3Bseq=226
Hinweis auf RKG-Akten über Botendienste für Berlichingen auf Hohenurach
https://www.google.de/search?q=burkhard%20berlichingen%20hohenurach&&tbm=bks
[siehe jetzt unten zu 1608]
GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136185827
1608
Am 29. Januar 1608 starb Herzog Friedrich I. Schon am nächsten Tag wurden Magdalena Möringer, der man Kuppelei vorwarf, und weitere Frauen verhaftet. Acht Tage später kam Möringer auf Hohenurach, wo sie bis zur Freilassung gegen Urfehde am 5. September 1614 verblieb.
Ruth Blank: Magdalena Möringer. Eine Gefangene auf der Festung Hohenurach, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 65 (2006), S. 49-95
Auf Hohenurach lagen drei weitere Frauen, die verhaftet worden waren (Blank S. 59). Eine Aufzählung der in Urach liegenden Frauen: Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 48b Bü 4 (9.12.1608), so Blank S. 55 Anm. 33
[Die Akte im Online-Findmittel:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1294353
Die mir in Kopie vorliegende Aufzählung gehört nach freundlicher Mitteilung von Peter Rückert zu einem Schreiben vom 9. Dezember 1608. Es ist die Rede von Verhafteten auf Hohenurach und Albeck. Genannt werden: Sabina Scheyhing, deren Haft auf Hohenurach anderweitig bezeugt ist (siehe unten), Anna Maria, Ehefrau des Trabanten Hans Jakob Stählin im Harnischhaus (Stuttgarter Zeughaus?), Dorothea, Christoph Lindners gewesenen Lichtkämmerers Ehefrau auf (Hohen-)Tübingen und die Möringerin.
Zu allen diesen Personen gibt es biographische Informationen in:
Ruth Blank, Margaretha Matthiä, Ursula Dorothea Linder, Sabina Scheyhing. Drei Kupplerinnen in Diensten Herzog Friedrichs v. Württemberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 29 (2011), S. 63-74.
Für Stählin und Lindner sehe ich im Augenblick keinen Beleg bezüglich der Unterbringung auf Hohenurach, sie könnten auch auf Albeck inhaftiert gewesen sein.
Nicht nur dem Burghauptmann Schweitzer - siehe unten - und seinem Vorgänger Urban Stierle/Stierlin (vgl. Blank 2006 S. 72) wurde Unterstützung der Möringerin vorgeworfen, sondern auch dessen Sohn Hans Ludwig Stierle, später Hauptmann der Stadt Ulm. Dieser soll auch Botendienste für den inhaftierten Burkhard von Berlichingen geleistet haben, was er bestritt. RKG-Akten von 1617/18: Alexander Brunotte/Raimund J. Weber: Akten des Reichskammergerichts im Hauptstaatsarchiv Stuttgart S-T, Stuttgart 2005, S. 371f. Nr. 4130.
Ursula Stierlin, die Tochter des Burghauptmanns Urban Stierle, diente als eine Art Magd der Magdalena Möringer und trug für sie
Briefe und Botenlohn aus der Festung (Blank 2006 S. 72).
Zum weiteren Kontext des "Großreinemachens" nach dem Tod des Herzogs siehe auch die Hinweise in den Württ. Landtagsakten:
http://hdl.handle.net/2027/inu.39000000527353?urlappend=%3Bseq=78 US
Dort wird verwiesen auf Spittlers Werke 12, S. 290
http://hdl.handle.net/2027/wu.89094327889?urlappend=%3Bseq=306
und Georg Henghers Chronik, Stuttgart WLB, Cod. hist. fol. 320, S. 309.]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012773566
1608
Sabina Sauter, Ehefrau des Hausschneiders auf Schloss Hellenstein in Heidenheim Ludwig Scheyhing, wurde aus den gleichen Gründen wie die Möringerin verhaftet, blieb allerdings nur zehn Monate auf der Festung (bis zum 17. Februar 1609), zeitweilig (ab Juni 1608) in einem Gemach mit der Möringerin, da diese suizidgefährdet war.
Blank 2006 S. 55 Anm. 35, 64, 72
[Auch ihr Mann Ludwig Scheyhing wurde nach seiner Entlassung auf den Hohenurach verbracht. RKG-Klage (1610/30) dazu: Brunotte/Weber S-T, S. 117f. Nr. 3794
http://books.google.de/books?id=5VYrAQAAIAAJ&q=urfehde+1609+schindelin
Siehe ausführlich zu Sabina: Blank 2011, insbesondere S. 66: Am 13. April 1608 nach Hohenurach verbracht.]
1610
Matthäus Enzlin, Geheimer Rat Herzog Friedrichs I. und dessen engster Vertrauter, hatte sich die Landstände zum Feind gemacht und wurde nach dem Tod des Herzogs 1608 verhaftet. 1609 kam er auf den Hohenneuffen, 1610 nach Hohenurach. Er wurde vor allem aufgrund des Bruchs seiner Urfehde zum Tode verurteilt und am 22. November 1613 auf dem Uracher Marktplatz hingerichtet.
Oliver Auge: Holzinger, Enzlin, Oppenheimer. Günstlingsfälle am spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hof der Württemberger, in: Der Fall des Günstlings (2004), S. 365-399, hier S. 393 (zu Enzlins Verhandlungen)
Ronald G. Asch: Der Sturz des Favoriten. Der Fall Matthäus Enzlins und die politische Kultur des deutschen Territorialstaates an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 57 (1998), S. 37-63
Asch 1999 (Auszüge)
http://books.google.de/books?id=X_m0duZWftcC&pg=PA96
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 265-270
Ermittlungen und Maßnahmen gegen Enzlin und das Wachpersonal auf Hohenurach
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1213966
Siehe auch
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1213965
Pfaff: Plutarch 1830
http://books.google.de/books?id=LlsKAAAAIAAJ&pg=PA11
WJbb. 1828
http://books.google.de/books?id=wgYAAAAAMAAJ&pg=PA189
Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon
http://books.google.de/books?id=jTpjQyaqNY4C&pg=PA139
Haftumstände in RKG-Akten
http://books.google.de/books?id=P5lnAAAAMAAJ&q=haftumstände+hohenurach
[= Brunotte/Weber E-G (1995), S. 141f. Nr. 925f. zu 1613/14. Vgl. auch Dieselben H (1999), S. 252 Nr. 1875 zu Enzlins Schwiegersohn Imhof.]
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119663805
[1610
Aus dem Bericht des Leonberger Obervogts Burkhard Stickel vom 21. Mai 1610: Enzlin "uf Hohenurach verführt ins Berlingers Losament" - wer war Berlinger? Burkhard von Berlichingen?
Die "Frau von Treffen" könnte auf Wittlingen oder auf Hohenurach "ins Früschlins Losament" gelegt werden.
Wer war die Frau von Treffen?
Hugo Gmelin: Über Burkhard Stickel und dessen Kriegsfeldordnung vom Jahr 1607. In: Württembergische Vierteljahrshefte 12 (1889), S. 4-10, hier S. 8
http://books.google.de/books?id=8SI8AAAAMAAJ&pg=PA8 US ]
1613
Der Hohenuracher Burghauptmann Hans Schweitzer, dem man die Begünstigung der Möringerin und Enzlins vorwarf, wurde im Frühjahr 1613 auf der zuvor von ihm geleiteten Festung gefangen gehalten. Schweitzer und der Guardiknecht Michael Ruthard wurden am 5. Juli 1613 auf dem Uracher Marktplatz enthauptet.
Blank 2006 S. 78.
[Maurer 1975, S. 6
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2151
Württ. Jbb, 1824
http://books.google.de/books?id=U0ScLKH4YSkC&pg=PA161 ]
1630
“Welchermassen Dr. Wilhelm Bidembach, Professor zu Tübingen, wegen eines in der Frankfurter Zeitung eingerückten Passus von einer Untreue der Professoren zu Tübingen in Stellung eines Bedenkens wegen Restitution der Klöster an die Katholischen und seiner ausgestoßenen bedrohlichen Reden verdächtig, darüber ex Senatu removiert und nach Hohenurach gefänglich gesetzt worden”
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-780589
[Bernhard Zaschka: Die Lehrstühle der Universität Tübingen im Dreißigjährigen Krieg, Tübingen 1993, S. 96
"... helfen zu graben den Brunnen des Lebens", Tübingen 1977, S. 100f.: verhaftet 25.1.1630, nach dem kaiserlichen Mandat 12.3.1630 an die Universität Tübingen dauerte es aber noch mehr als vier Wochen.
Bernhardt: Zentralbehörden 1, S. 170f. mit falschen Angaben zur Gefangenschaft]
Siehe auch
Volker Schäfer: Die Universität Tübingen zur Zeit Schickards, in: Zum 400. Geburtstag von Wilhelm Schickard, hg. von Friedrich Seck, Sigmaringen 1995, S. 9-26, hier S. 11
http://books.google.de/books?id=xcNiR4i07OwC&pg=PA11
Günter:Restitutionsedikt 1901
http://archive.org/stream/dasrestitutions00gngoog#page/n78/mode/2up
GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1014358329
(1648)
Nein! “Prophet” Hans Keyl aus Gerlingen wurde 1648 nicht auf Hohenurach, sondern auf dem Hohenneuffen gefangen gehalten! So aber irrtümlich Sabine Holtz: Theologie und Alltag (1993), S. 298
http://books.google.de/books?id=qqr7wUqhe9QC&pg=PA298 (Auszug)
Siehe die angegebene Quelle (Dreher, in: BWKG 1904, S. 48)
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0008&DMDID=DMDLOG_0006&LOGID=LOG_0010&PHYSID=PHYS_0040#navi
http://books.google.de/books?id=AzY2AQAAMAAJ&pg=PA48 US
Ebenso Norbert Haag, in: ZWLG 48 (1989), S. 128; David Warren Sabean: Das zweischneidige Schwert (1986), S. 103
1660
Kapitän Wagaw
Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 202 Bü 2342
1681
Der ehemalige Markgröninger Schullehrer Magister Johann Georg Hingher wurde wegen seiner Geisteskrankheit (“ob delirium”) ab 1681 auf Hohenurach, später auf Hohenneuffen untergebracht. Dort blieb er über 30 Jahre. Er starb 1715 auf Hohenneuffen.
Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 284/99 Bü 183 (Akten über seine Versorgung).
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1280347 (mit falscher Namensform)
http://forum.ahnenforschung.net/archive/index.php/t-47930.html (* 1645 in Stockholm)
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22eindringliche+Ermahnung+mit+auf+den+Weg+geben+lassen%2C+sich+**%22 (zur Tätigkeit in Markgröningen)
[Pfeilsticker 2 § 3345]
[ https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:GNDPFB3494 Hengher]
1729
Der Gardetrompeter Heinrich Dünger wurde gemäß Dekret Ludwigsburg 31. Januar 1729 auf ein halbes Jahr Jahr als Gefangener dem Kommandanten Krumholtz auf Hohenurach übergeben. Am 3. Februar 1729 wurde er völlig pardonniert unter der Bedingung, dass er ständig in Diensten bliebe.
Walther Pfeilsticker: Neues Württembergisches Dienerbuch, Bd. 1, Stuttgart 1957, § 305
https://www.google.de/search?q=pfeilsticker%20ludwigsburg%20hohenurach&tbm=bks
1731
In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1731 wurde Christina Wilhelmina Reichsgräfin von Würben und Freudental geborene von Grävenitz (gest. 1744), Mätresse von Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg und als “Landverderberin” geschmäht, auf ihrem Gut Freudental verhaftet und nach Urach gebracht, wo sie auch auf Hohenurach gefangen lag. Sie kam im Frühjahr 1733 wieder frei.
Sybille Osswald-Bargende: Die Mätresse, der Fürst und die Macht. Christina Wilhelmina von Grävenitz und die höfische Gesellschaft, Frankfurt am Main 2000, S. 182
http://books.google.de/books?id=e2SsLKwJ6JgC&pg=PA182
Paul Sauer 2008
http://www.libreka.de/9783874077989/216
Gratianus 1831
http://books.google.de/books?id=vGgAAAAAcAAJ&pg=PA388
Hänle 1847
http://books.google.de/books?id=E1AAAAAAcAAJ&pg=PA15
Steiff-Mehring S. 615
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_317.jpg
Süskind 1856
http://books.google.de/books?id=Y-tUAAAAcAAJ&pg=PA48 auch Referendarius Pfeil und Regierungsrat Vollmann auf Hohenurach genannt
Siehe dazu Osswald-Bargende: Ein Teil der Graevenitz-Partei "fand sich - wie Oberhofmarschall Friedrich Wilhelm von Grävenitz d.J., die Regierungsräte Scheid und Vollmann oder Kirchenratsdirektor von Pfeil - im Dezember 1733 nach der Regierungsübernahme Herzog Carl Alexanders auf den Festungen Hohenasperg, Hohenneuffen und Hohenurach wieder" (S. 76).
http://books.google.de/books?id=e2SsLKwJ6JgC&pg=PA76
Steiff-Mehring S. 640: Hohenurach genannt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_330.jpg (Vollmann kam auf den Hohenasperg)
[Liste der Verhafteten vom Dezember 1733 bei Spittler:
http://books.google.de/books?id=AphJAAAAYAAJ&pg=PA414
Zeitungsmeldung über Entlassung 1735:
http://books.google.de/books?id=5iEoAAAAYAAJ&pg=PA89
Geheimer Kabinettssekretär Karl Ludwig Vollmann: Pfeilsticker 1 § 1216. Untersuchungsakten zu ihm:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275438
Regierungsrat Johann Friedrich Scheid: Pfeilsticker 1 § 1229. Akten:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275441
Konsistorialdirektor Joachim Friedrich Pfeil: Pfeilsticker 1 § 1709: Gefangener auf Hohentwiel. Akten:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1275437]
GND Grävenitz http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118696955
1733
Zwei berühmte herzogliche Baumeister, Donato Giuseppe Frisoni und Paolo Retti, wurden sofort nach dem Tod Herzog Eberhard Ludwigs (Oktober 1733) festgenommen und zunächst nach Hohenurach, dann nach Hohenneuffen gebracht. Am 6. September 1735 entlassen, wurden sie noch im gleichen Monat wieder in Dienst genommen. [Wenige Monate später starb Frisoni am 29. 11.1735.]
Werner Fleischhauer: Barock im Herzogtum Württemberg, Stuttgart 1958, S. 232. [Ebd.: "Man warf ihnen vor, herzogliche Gelder veruntreut, sich betrügerisch bereichert und große Kapitalien bei einem oberschwäbischen Prälaten und beim Schwäbischen Kreis stehen zu haben."]
http://books.google.de/books?id=i9PqAAAAMAAJ&q=verhaftet+hohenurach
Siehe auch
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=hohenurach+frisoni+retti+ludwigsburg
GND Frisoni http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119045001
GND Retti http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136232124
1736
Von November bis Dezember 1736 wurden der pietistische Pfarrer Johann Jakob Rues von Dürrmenz, der viele seiner Gemeinde vom Abendmahl ausgeschlossen hatte, und neun Bürger aus Dürrmenz auf der Festung gefangen gehalten. Die neun Bürger mussten Ziegel den Berg hinauftragen.
Friedrich Fritz: Johann Jakob Rues (1681-1745), ein pietistischer Seelsorger und seine Schicksale unter Herzog Karl Alexander, in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 28 (1924), S. 130-143, hier S. 139
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN720885019_2_0028&DMDID=DMDLOG_0012&LOGID=LOG_0016&PHYSID=PHYS_0136#navi
Martin Brecht 1995
http://books.google.de/books?id=m-rxK5nsNVAC&pg=PA241
Siehe auch
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=hohen+urach+rues+d%C3%BCrrmenz
1765
Damals weigerten sich zahlreiche Balinger Bürger, ihre Steuerzettel in Empfang zu nehmen. Am Karfreitag wurde ein Dragonerregiment nach Balingen gelegt, viele Bürger kamen in Arrest, vier wurden auf den Hohenurach gebracht.
Wilhelm Wik: Balinger Bürger als Gefangene auf dem Hohen-Urach, in: Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen 5 (1958), S. 244. Online:
http://www.heimatkundliche-vereinigung.de/download/HKB-pdf/Heimatkundliche%20Blaetter%2005_1958%20S%20193%20-%20244.pdf
Nachtrag: Preprint meines Aufsatzes "Hohenurach und seine Gefangenen"
http://academia.edu/4033911/Hohenurach_und_seine_Gefangenen_-_PREPRINT
#forschung
Archivversion: http://www.webcitation.org/6HsExuVPj
 Urach und Hohenurach ca. 1616
Urach und Hohenurach ca. 1616KlausGraf - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 06:07 - Rubrik: Landesgeschichte
Der Twitter-Hashtag für die ICA-Konferenz der Sektion der Archivare an Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen (SUV) lautet #ICASUV2013!
Kühnel Karsten - am Donnerstag, 27. Juni 2013, 04:47 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hinweise und Links von Maria Rottler anlässlich einer von ihr durchgeführten Veranstaltung in Regensburg:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4772
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4772
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 22:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Autoren durften bisher nicht-mandatierte Autorenversionen ihrer bei dem Wissenschaftsverlag Springer (nicht zu verwechseln mit der Axel Springer GmbH) veröffentlichten Arbeiten sofort veröffentlichen, dürfen dies jetzt nur noch auf ihrer eigenen Website, nicht in einem Repositorium.
http://poynder.blogspot.de/2013/06/open-access-springer-tightens-rules-on.html
Das Mantra der Harnadianer, dass mit grünem OA der Übergang zu goldenem OA erzwungen werden kann, ist für mich schon lange unplausibel.
http://archiv.twoday.net/stories/285824796/
http://poynder.blogspot.de/2013/06/open-access-springer-tightens-rules-on.html
Das Mantra der Harnadianer, dass mit grünem OA der Übergang zu goldenem OA erzwungen werden kann, ist für mich schon lange unplausibel.
http://archiv.twoday.net/stories/285824796/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 22:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://aes.hypotheses.org/165
In den 1960er Jahren hatten die verantwortungslosen Verantwortlichen den größten Teil der rechtswissenschaftlichen Drucke nach Kanada verkauft:
http://archiv.twoday.net/stories/3389005/
In den 1960er Jahren hatten die verantwortungslosen Verantwortlichen den größten Teil der rechtswissenschaftlichen Drucke nach Kanada verkauft:
http://archiv.twoday.net/stories/3389005/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://science.orf.at/stories/1720283/
" Autoren könnten ihre Rechte freiwillig an die DPLA abgeben. Das klingt jetzt vielleicht naiv. Warum sollten Autoren so etwas tun? Ich glaube die Antwort ist ziemlich überzeugend. Die meisten Bücher lassen sich nämlich nur in den ersten Monaten beziehungsweise Jahren nach ihrem Erscheinen verkaufen. Das kommerzielle Leben eines Buches ist sehr kurz."
" Autoren könnten ihre Rechte freiwillig an die DPLA abgeben. Das klingt jetzt vielleicht naiv. Warum sollten Autoren so etwas tun? Ich glaube die Antwort ist ziemlich überzeugend. Die meisten Bücher lassen sich nämlich nur in den ersten Monaten beziehungsweise Jahren nach ihrem Erscheinen verkaufen. Das kommerzielle Leben eines Buches ist sehr kurz."
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 22:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/434211667/#434212264
Kennt der Staatsanwalt das Bundesarchivgesetz nicht, das in jedem Fall einem datenschutzrechtlichen Vernichtungsgebot vorgeht?
Zum Thema Verwahrungsbruch:
http://archiv.twoday.net/search?q=verwahrungsbruch
Kennt der Staatsanwalt das Bundesarchivgesetz nicht, das in jedem Fall einem datenschutzrechtlichen Vernichtungsgebot vorgeht?
Zum Thema Verwahrungsbruch:
http://archiv.twoday.net/search?q=verwahrungsbruch
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 22:15 - Rubrik: Archivrecht
Ehrhardts Abhandlung von 1754 bei der UPenn online:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4295748
#fnzhss
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4295748
#fnzhss
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 21:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://strafblog.de/2013/06/26/verbotene-mitteilungen-uber-gerichtsverhandlungen-ich-muss-nicht-kluger-als-der-bgh-sein-oder-vielleicht-doch
Zurecht behauptet Rainer Pohlen: "Die Veröffentlichung des Beschlusses des Landgerichts Augsburg vom 28.08.2012 – 9 Qs 447/12 – auf strafblog.de erfüllt nicht den Tatbestand des § 353d Nr. 3 StGB oder ist jedenfalls gem. § 34 StGB gerechtfertigt."
Siehe auch zum Fall Mollath:
http://strafblog.de/2013/06/24/mag-die-staatsanwaltschaft-augsburg-engagierte-strafverteidiger-nicht/
Zurecht behauptet Rainer Pohlen: "Die Veröffentlichung des Beschlusses des Landgerichts Augsburg vom 28.08.2012 – 9 Qs 447/12 – auf strafblog.de erfüllt nicht den Tatbestand des § 353d Nr. 3 StGB oder ist jedenfalls gem. § 34 StGB gerechtfertigt."
Siehe auch zum Fall Mollath:
http://strafblog.de/2013/06/24/mag-die-staatsanwaltschaft-augsburg-engagierte-strafverteidiger-nicht/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 21:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Libreka! wird als Ebook-Verkaufsplattform abgewickelt. Leider sagt Dörte Böhner nicht, ob die für die Wissenschaft wichtige Buchsuche eingestellt wird:
http://bibliothekarisch.de/blog/2013/06/26/e-book-store-von-libreka-vor-dem-aus/
http://bibliothekarisch.de/blog/2013/06/26/e-book-store-von-libreka-vor-dem-aus/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 21:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-mails-an-landesarchiv-gericht-verhilft-archiv-zu-mails.a740609f-1682-481c-96ac-e61fb35cb6a4.html
Im Rechtsstreit um die Mails von Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) sieht sich das Landesarchiv Baden-Württemberg schon jetzt als Gewinner. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung begrüßte es der Präsident der Behörde, Professor Robert Kretzschmar, dass mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe „das Wissen um die Aufgaben und Funktionen des Landesarchivs und die Sensibilität im Umgang mit Daten verstärkt werden“. Zugleich zeigte sich Kretzschmar bereit, die Mailkorrespondenz „sehr zeitnah zu übernehmen, zu bewerten und dauerhaft zu sichern“. Man erwarte eine Kontaktaufnahme durch das Staatsministerium, sobald der Streit zwischen Mappus und der grün-roten Landesregierung rechtskräftig geklärt sei.
Siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=mappus
Im Rechtsstreit um die Mails von Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) sieht sich das Landesarchiv Baden-Württemberg schon jetzt als Gewinner. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung begrüßte es der Präsident der Behörde, Professor Robert Kretzschmar, dass mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe „das Wissen um die Aufgaben und Funktionen des Landesarchivs und die Sensibilität im Umgang mit Daten verstärkt werden“. Zugleich zeigte sich Kretzschmar bereit, die Mailkorrespondenz „sehr zeitnah zu übernehmen, zu bewerten und dauerhaft zu sichern“. Man erwarte eine Kontaktaufnahme durch das Staatsministerium, sobald der Streit zwischen Mappus und der grün-roten Landesregierung rechtskräftig geklärt sei.
Siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=mappus
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 19:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fulda. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte dem VdA mit Schreiben vom 18. Juni 2013 mit, dass die Vorermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz eingestellt wurden.
Der VdA hatte am 29. Juni 2012 bei der Staatsanwaltschaft Köln Strafanzeige wegen Verwahrungsbruch (§ 133 StGB) erstattet. Laut Staatsanwaltschaft Köln wurde nun das Verfahren eingestellt, da „ein die Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen berechtigender Anfangsverdacht eines strafrechtlich relevanten Handelns des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz […] oder Dritter nicht gegeben ist.“
Der VdA prüft derzeit, gegen den Verzicht auf ein Strafverfahren Beschwerde einzureichen. Siehe auch aktuellen Beitrag des WDR „Vernichtung von NSU-Akten bleibt ohne Folgen“.
http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/234.html
Leider wurde mir die Begründung der Staatsanwaltschaft nicht zugänglich gemacht:
http://archiv.twoday.net/stories/434211667/#434212021
Der VdA hatte am 29. Juni 2012 bei der Staatsanwaltschaft Köln Strafanzeige wegen Verwahrungsbruch (§ 133 StGB) erstattet. Laut Staatsanwaltschaft Köln wurde nun das Verfahren eingestellt, da „ein die Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen berechtigender Anfangsverdacht eines strafrechtlich relevanten Handelns des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz […] oder Dritter nicht gegeben ist.“
Der VdA prüft derzeit, gegen den Verzicht auf ein Strafverfahren Beschwerde einzureichen. Siehe auch aktuellen Beitrag des WDR „Vernichtung von NSU-Akten bleibt ohne Folgen“.
http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/234.html
Leider wurde mir die Begründung der Staatsanwaltschaft nicht zugänglich gemacht:
http://archiv.twoday.net/stories/434211667/#434212021
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 19:34 - Rubrik: Archivrecht
Eine Diplomarbeit von Daniel Jeller (Wien 2013) zur Archivalien-Digitalisierung:
http://cluster.nettek.at/?post_type=document&p=1118
(Hinweis Mareike König, G+)
http://cluster.nettek.at/?post_type=document&p=1118
(Hinweis Mareike König, G+)
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 16:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PPN=PPN720885019
"Später kann jeder angemeldete Bibliotheksbenutzer der Landeskirchlichen Zentralbibliothek die BWKG mit einer moving wall von fünf Jahren bis zum aktuellen Jahrgang online benutzen." (Auskunft des Landeskirchl. Archivs). Ob die neuesten Jahrgänge dann auch für Vereinsmitglieder nutzbar sein werden?
Update: Ich erhielt heute eine Mail von Michael Bing aus dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, der behauptete: "die Blätter für württembergische Kirchengeschichte sind bis ca. 1950 mittlerweile digitalisiert und online zugänglich". Beigegeben waren Links zu Aufsätzen von 1893, 1924 und 1929, nach denen ich gefragt hatte. Ich stellte auch fest, dass Scans der jüngsten aufgeführten Jahrgänge (wenngleich ohne Inhaltsverzeichnis) frei verfügbar waren. Daher formulierte ich obigen Eintrag. Nun wurde ich von einer Leserin darauf hingewiesen, dass die BWKG nur bis 1925 Open Access zur Verfügung stehen, zusätzlich ist auch der Jahrgang 1929 verfügbar.
Ich finde es superschäbig, dass der Verein für württembergische Kirchengeschichte, dem ich seit langem angehöre, seine Vereinszeitschrift nicht komplett Open Access zur Verfügung stellt.
Weiteres Update: Ich habe nichts zurückzunehmen, oder richtigzustellen. Die Entscheidung ist eine Entscheidung gegen Open Access, auch wenn die Möglichkeit bestehen wird, mit einem Benutzerausweis der Landeskirchlichen Zentralbibliothek die Jahrgänge bis zur moving wall elektronisch einzusehen. Selbstverständlich schadet diese Voraussetzung der Wissenschaft, zumal der durchschnittliche DigiZeitschriftenbenutzer ohnehin nichts von dieser Möglichkeit weiß. Persönliche Benutzer der Zentralbibliothek werden in der Regel auch die happigen Benutzungsgebühren der Württembergischen Landesbibliothek zahlen, und dort gibt es den DigiZeitschriftenzugriff von Zuhause ebenfalls. Alle anderen, die keinen Zugriff auf DigiZeitschriften haben, schauen bei einem spontanen Nutzungsbedürfnis in die Röhre.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 15:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikisource.org/wiki/RE
ist nun bei Clio online erfasst:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/websites/id=487
http://www.clio-online.de/site/lang__de/ItemID__27072/mid__10311/67/default.aspx
 Foto: Jonathan Groß http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
Foto: Jonathan Groß http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
ist nun bei Clio online erfasst:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/websites/id=487
http://www.clio-online.de/site/lang__de/ItemID__27072/mid__10311/67/default.aspx
 Foto: Jonathan Groß http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
Foto: Jonathan Groß http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.deKlausGraf - am Mittwoch, 26. Juni 2013, 00:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS-Dokumente/Grundsatzdokumente/_inhalt.html?nn=1704304
Leider keine Faksimiles!
Gilt auch für
http://www.ddr-im-blick.de/
Leider keine Faksimiles!
Gilt auch für
http://www.ddr-im-blick.de/
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 23:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/id=2157&type=nachrichten
"Reflecting the deep malaise amongst historians, archivists, journalists and other social groups on the indefinite closure of, and unwarranted denial of access to, historical documents of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation and the Ministry of Defense of Spain, H-SPAIN requests the competent authorities the immediate reopening of all such archives and to ensure their accessibility for all researchers as soon as possible."
"Reflecting the deep malaise amongst historians, archivists, journalists and other social groups on the indefinite closure of, and unwarranted denial of access to, historical documents of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation and the Ministry of Defense of Spain, H-SPAIN requests the competent authorities the immediate reopening of all such archives and to ensure their accessibility for all researchers as soon as possible."
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 23:54 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anspruchsvolles zur Bewertung von Karsten Kühnel (Universitätsarchiv Bayreuth):
http://archive20.hypotheses.org/693
Update: Teil 2
http://archive20.hypotheses.org/699
http://archive20.hypotheses.org/693
Update: Teil 2
http://archive20.hypotheses.org/699
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 18:36 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_13_27/index.html
Leider steht da nicht, wieviele Drucke bisher digitalisiert bzw. ins Netz gestellt wurden und welchen Anteil an der geschätzten Gesamtzahl der Titel die im VD 18 erfassten haben.
Laut http://vd18.de/ sind 103.586 Drucke online verfügbar. Nach http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2435/24_BIS03-09_Druck.pdf schätzte man 2009 etwa 600.000 Titel. Demnach liegt die Quote bei etwa 17 %.
Leider steht da nicht, wieviele Drucke bisher digitalisiert bzw. ins Netz gestellt wurden und welchen Anteil an der geschätzten Gesamtzahl der Titel die im VD 18 erfassten haben.
Laut http://vd18.de/ sind 103.586 Drucke online verfügbar. Nach http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2435/24_BIS03-09_Druck.pdf schätzte man 2009 etwa 600.000 Titel. Demnach liegt die Quote bei etwa 17 %.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 18:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.change.org/de/Petitionen/rettet-die-villa-kolberger-5-f%C3%BCr-lebensqualit%C3%A4t-im-m%C3%BCnchener-herzogpark
Der Walmdachvilla in der Kolbergerstraße 5 von 1923 am Eingang zum Münchner Herzogpark wurde im Januar 2013 überraschend die bisherige Denkmaleigenschaft aberkannt - nach Begutachtung des Landesamts für Denkmalpflege auf Antrag einer Investorenfirma, mit fragwürdiger Begründung. Die Villa ist ein typisches Beispiel für die frühe Bebauung der Gartenstadt Herzogpark und prägt gemeinsam mit den benachbarten Denkmälern dieses Münchner Viertel in seinem Kernbereich. Jetzt drohen Abbruch und Nachverdichtung durch Neubebauung mit einem Wohnblock (15 Luxus-Eigentumswohungen). Bedroht ist damit der alte Baumbestand auf einem großzügigen Gartengrundstück, wertvoller Lebensraum für Singvögel und Kleintiere. Abriss und Neubau würden der städtebaulichen Gesamtwirkung der umliegenden Straßenzüge einen nicht wieder gut zu machenden Schaden zufügen.
Siehe auch
http://www.kulturgutherzogpark.de/
Der Walmdachvilla in der Kolbergerstraße 5 von 1923 am Eingang zum Münchner Herzogpark wurde im Januar 2013 überraschend die bisherige Denkmaleigenschaft aberkannt - nach Begutachtung des Landesamts für Denkmalpflege auf Antrag einer Investorenfirma, mit fragwürdiger Begründung. Die Villa ist ein typisches Beispiel für die frühe Bebauung der Gartenstadt Herzogpark und prägt gemeinsam mit den benachbarten Denkmälern dieses Münchner Viertel in seinem Kernbereich. Jetzt drohen Abbruch und Nachverdichtung durch Neubebauung mit einem Wohnblock (15 Luxus-Eigentumswohungen). Bedroht ist damit der alte Baumbestand auf einem großzügigen Gartengrundstück, wertvoller Lebensraum für Singvögel und Kleintiere. Abriss und Neubau würden der städtebaulichen Gesamtwirkung der umliegenden Straßenzüge einen nicht wieder gut zu machenden Schaden zufügen.
Siehe auch
http://www.kulturgutherzogpark.de/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nachdem die Vereinigung der europäischen Wissenschafts- und Förderorganisationen Science Europe bereits im April „Principles on the Transition to Open Access to Research Publications“ veröffentlichte und der Global Research Council im Mai einen „Action Plan towards Open Access to Publications“ vorstellte, haben die Wissenschaftsministerinnen und -Minister der G8-Staaten im Juni in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung von Open Access für die Industrienationen gewürdigt.
Erfreulich ist, dass die G8-Staaten nicht nur dem offenen Zugang zu wissenschaftliche Artikeln hervorheben, sondern auch die Bedeutung des Zugangs zu Forschungsdaten betonen. Angelehnt an den Open-Science-Report der Royal Society stellen die Wissenschaftsminister fest: „Open scientific research data should be easily discoverable, accessible, assessable, intelligible, useable, and wherever possible interoperable to specific quality standards.“ In der ebenfalls verabschiedeten „G8 Open Data Charter and Technical Annex“ werden auch Daten aus Wissenschaft und Forschung ausdrücklich zur Nachnutzung empfohlen. "
Aus dem Helmholtz-Open-Access-Newsletter
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=339
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
Erfreulich ist, dass die G8-Staaten nicht nur dem offenen Zugang zu wissenschaftliche Artikeln hervorheben, sondern auch die Bedeutung des Zugangs zu Forschungsdaten betonen. Angelehnt an den Open-Science-Report der Royal Society stellen die Wissenschaftsminister fest: „Open scientific research data should be easily discoverable, accessible, assessable, intelligible, useable, and wherever possible interoperable to specific quality standards.“ In der ebenfalls verabschiedeten „G8 Open Data Charter and Technical Annex“ werden auch Daten aus Wissenschaft und Forschung ausdrücklich zur Nachnutzung empfohlen. "
Aus dem Helmholtz-Open-Access-Newsletter
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=339
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 15:42 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 15:33 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Willuhn, Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Köln, 18.6.2013 (Az.: 121 Js 572/12):
"[D]as auch aufgrund Ihrer o. a. Strafanzeige [Anm.: v. 2. Juli 2012] eingeleitete Verfahren habe ich nach Durchführung umfänglicher Vorermittlungen als eingestellt ablegen müssen, da ein die Aufnahme staatsanwaltlicher Ermittlungen berechtigender Anfangsverdacht eines strafrechtlichen relevanten Handelns des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (im Folgenden BfV) oder Dritter nicht gegeben ist. Insbesondere konnten keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme gewonnen werden, die die Verwirklichung der Straftaten der Strafvereitlung gemäß § 258 StGB, der Urkundenunterdrückung gemäß § 274 StGB oder des Verwahrungsbruches gemäß § 133 StGB nahelegten. ....."
"[D]as auch aufgrund Ihrer o. a. Strafanzeige [Anm.: v. 2. Juli 2012] eingeleitete Verfahren habe ich nach Durchführung umfänglicher Vorermittlungen als eingestellt ablegen müssen, da ein die Aufnahme staatsanwaltlicher Ermittlungen berechtigender Anfangsverdacht eines strafrechtlichen relevanten Handelns des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (im Folgenden BfV) oder Dritter nicht gegeben ist. Insbesondere konnten keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme gewonnen werden, die die Verwirklichung der Straftaten der Strafvereitlung gemäß § 258 StGB, der Urkundenunterdrückung gemäß § 274 StGB oder des Verwahrungsbruches gemäß § 133 StGB nahelegten. ....."
Wolf Thomas - am Dienstag, 25. Juni 2013, 08:00 - Rubrik: Archivrecht
In "Mit Geisterforschung zum Doktortitel: Esoterik an der Wiener Universität" wettert Christa Federspiel gegen Esoterisches am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien:
http://derstandard.at/1371169859668/Mit-Geisterforschung-zum-Doktortitel-Esoterik-an-der-Wiener-Universitaet
(Danke an MR)
http://derstandard.at/1371169859668/Mit-Geisterforschung-zum-Doktortitel-Esoterik-an-der-Wiener-Universitaet
(Danke an MR)
KlausGraf - am Dienstag, 25. Juni 2013, 03:22 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
