Blue Shield: In vier Tagen fast 2 km Archivgut abgearbeitet
Vierter und letzter Tag, Auszüge:
Eine Reihe von Dingen ist uns in den letzten Tagen aufgefallen. Zunächst ist es auffallend, dass die deutschen Archivare Archive vornehmlich als Verwaltung betrachten und viel weniger als Überlieferung. Ferner scheint in Deutschland viel minderes Archivmaterial [nicht] vernichtet zu werden, wodurch die Archive aus niederländischer Perspektive mit allerlei Dokumenten, die nicht relevant oder sogar doppelt sind, „zugemüllt“ zu sein scheinen. Auch wird in Deutschland viel weniger umgebettet als in den Niederlanden. Wir treffen noch viele Dokumente in originaler Verpackung (die manchmal durchaus die Dokumente gerettet haben) oder in Ordnern. Nieten und Clips sind auch nicht systematisch entfernt.
Nach Ablauf unserer Arbeitswoche stimmen wir darin überein, dass unsere deutschen Kollegen die Sachen gut organisiert haben. Das Regeln von Unterkunft, Essen und Transport für beinahe 80 ausländische Freiwillige ist keine Kleinigkeit. Die Begleitung während der Arbeit selbst könnte aber verbessert werden. Die deutschen Kollegen arbeiten selbst hart mit, ohne deutlich Regie zu führen. Dadurch kann es für die Freiwilligen, die keinen archivistischen Hintergrund haben, undeutlich sein, wir die Archivalien registriert werden mussten. Wenn man weiß, dass man die Bestands- oder Accessionsnummer suchen muss, geht es auf jeden Fall ein Stück schneller und effizienter. Auffallend war auch, dass unsere Arbeit nicht kontrolliert wird. Vielleicht setzt die Organisation auf Tempo? Das ist jedenfalls geglückt. Wir haben in vier Tagen beinahe zwei Kilometer Archiv weggearbeitet!
http://vincentrobijn.blogspot.com/
http://archiv.twoday.net/stories/5674007
http://archiv.twoday.net/stories/5673315
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
Vierter und letzter Tag, Auszüge:
Eine Reihe von Dingen ist uns in den letzten Tagen aufgefallen. Zunächst ist es auffallend, dass die deutschen Archivare Archive vornehmlich als Verwaltung betrachten und viel weniger als Überlieferung. Ferner scheint in Deutschland viel minderes Archivmaterial [nicht] vernichtet zu werden, wodurch die Archive aus niederländischer Perspektive mit allerlei Dokumenten, die nicht relevant oder sogar doppelt sind, „zugemüllt“ zu sein scheinen. Auch wird in Deutschland viel weniger umgebettet als in den Niederlanden. Wir treffen noch viele Dokumente in originaler Verpackung (die manchmal durchaus die Dokumente gerettet haben) oder in Ordnern. Nieten und Clips sind auch nicht systematisch entfernt.
Nach Ablauf unserer Arbeitswoche stimmen wir darin überein, dass unsere deutschen Kollegen die Sachen gut organisiert haben. Das Regeln von Unterkunft, Essen und Transport für beinahe 80 ausländische Freiwillige ist keine Kleinigkeit. Die Begleitung während der Arbeit selbst könnte aber verbessert werden. Die deutschen Kollegen arbeiten selbst hart mit, ohne deutlich Regie zu führen. Dadurch kann es für die Freiwilligen, die keinen archivistischen Hintergrund haben, undeutlich sein, wir die Archivalien registriert werden mussten. Wenn man weiß, dass man die Bestands- oder Accessionsnummer suchen muss, geht es auf jeden Fall ein Stück schneller und effizienter. Auffallend war auch, dass unsere Arbeit nicht kontrolliert wird. Vielleicht setzt die Organisation auf Tempo? Das ist jedenfalls geglückt. Wir haben in vier Tagen beinahe zwei Kilometer Archiv weggearbeitet!
http://vincentrobijn.blogspot.com/
http://archiv.twoday.net/stories/5674007
http://archiv.twoday.net/stories/5673315
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
Dietmar Bartz - am Montag, 4. Mai 2009, 23:08 - Rubrik: Kommunalarchive
Auf thesecretmirror.com beschreibt Jim Gerencser ausführlich, wie mit Hilfe des Content Management Systems Drupal am Archiv des Dickinson College ein Weblog über Recherche-Anfragen geführt wird und wie Archivare und Nutzer davon profitieren. Eine Präsentation zu den technischen Hintergründen gibt es auch zu sehen.
Clemens Radl - am Montag, 4. Mai 2009, 23:04 - Rubrik: Weblogs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ENDLICH steht dieses lange vergriffene Grundlagenwerk auch online zur Verfügung:
http://www.ajbd.de/veroeff/arbheft08.pdf
http://www.ajbd.de/veroeff/arbheft08.pdf
KlausGraf - am Montag, 4. Mai 2009, 20:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bereits zum zweiten Mal helfen die staatlichen Archive Bayerns bei der Bergung und Sicherung der beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs beschädigten Bücher und Dokumente. Am Montag reisten mehrere Experten zur Unglücksstelle. Die Solidarität mit den Kollegen in Köln stehe im Vordergrund dieser Aktivitäten, sagte die Sprecherin der staatlichen Archive. .....
Eine dritte bayerische Helfergruppe wird Ende Mai nach Köln geschickt. Auch dieser Experteneinsatz soll eine Woche dauern."
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/KULTUR/1500954.html
Eine dritte bayerische Helfergruppe wird Ende Mai nach Köln geschickt. Auch dieser Experteneinsatz soll eine Woche dauern."
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/KULTUR/1500954.html
Wolf Thomas - am Montag, 4. Mai 2009, 20:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unter diesem Motto steht der Tag der Archive am 6./7. März 2010. Via VdA-Mitgliedermail 2/2009.
Wolf Thomas - am Montag, 4. Mai 2009, 19:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wortlaut der gemeinsamen Pressemitteilung von VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., ICA – International Council on Archives und Blue Shield Nederland vom 30. April 2009:
"David Leitch, der Generalsekretär des Internationalen Archivrats (ICA), und Prof. Dr. Robert Kretzschmar, der Vorsitzende des VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. haben am 29. April 2009 die Einsturzstelle des Stadtarchivs Köln sowie das Erstversorgungszentrum zur Bergung des Archivguts besucht, um sich vor Ort über die aktuelle Situation zu informieren.
Sie wurden von Marjan Otter von der internationalen Kulturgutschutzorganisation Blue Shield begleitet, die seit kurzem die Bergungsarbeiten aktiv unterstützt. Derzeit sind 85 Archivarinnen und Archivare sowie Restauratorinnen und Restauratoren aus den Niederlanden, Frankreich, den USA, der Schweiz, Schweden, Bosnien-Herzogewina und dem Vereinigten Königreich in Köln aktiv, deren Beteiligung vom Blue Shield-Büro in Den Haag organisiert wird. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass Blue Shield die
Koordination der Hilfe auf der internationalen Ebene übernommen hat und sich auch weiterhin hier engagieren wird“, sagten Leitch und Kretzschmar. „Das Stadtarchiv wird noch lange Zeit vielfältige Unterstützung brauchen.“
Überaus beeindruckt angesichts des sichtbaren Ausmaßes der Katastrophe waren beide von der hervorragenden Organisation der Bergungsarbeiten, die von der Direktorin des Stadtarchivs, Dr. Bettina Schmidt-Czaia, und ihren Mitarbeitern bei einer Ortsbegehung vorgestellt wurde. Es sei bewundernswert, was bereits zu Rettung des Archivguts geleistet sei. Das große Engagement aller, die an den Bergungsarbeiten beteiligt sind, sei überwältigend. Besonders zu würdigen seien dabei auch die Kölner Mitbürgerinnen und Bürger und alle Kolleginnen und Kollegen aus der Fachwelt, die sich vielfach
in ihrer Freizeit und ihrem Urlaub zur Verfügung stellten. Dieses persönliche, freiwillige Engagement von außen sei als Zeichen lokaler, nationaler und nun auch internationaler Solidarität ermutigend, zugleich aber auch eine Verpflichtung aller Verantwortlichen in der Politik, ihren Part zur Bewältigung der Situation zu erfüllen. Vordringlich sei vor allem, das Stadtarchiv möglichst rasch an einer geeigneten Stelle unter Beachtung aller zu beachtenden Standards unterzubringen. Auch seien weiterhin alle Maßnahmen zur Rettung des Archivguts voranzutreiben. „Die Politik darf das freiwillige, keineswegs selbstverständliche Engagement nicht enttäuschen“, sagte Leitch. „Die nationalen und
internationalen Fachverbände erwarten konkrete und überzeugende Planungen“, ergänzte Kretzschmar, der im Gespräch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen darauf hinwies, dass der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare für 2012 plant, den Deutschen Archivtag in Köln zu veranstalten."
Quelle:
http://www.vda.archiv.net/pdf/PM20090430.pdf
"David Leitch, der Generalsekretär des Internationalen Archivrats (ICA), und Prof. Dr. Robert Kretzschmar, der Vorsitzende des VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. haben am 29. April 2009 die Einsturzstelle des Stadtarchivs Köln sowie das Erstversorgungszentrum zur Bergung des Archivguts besucht, um sich vor Ort über die aktuelle Situation zu informieren.
Sie wurden von Marjan Otter von der internationalen Kulturgutschutzorganisation Blue Shield begleitet, die seit kurzem die Bergungsarbeiten aktiv unterstützt. Derzeit sind 85 Archivarinnen und Archivare sowie Restauratorinnen und Restauratoren aus den Niederlanden, Frankreich, den USA, der Schweiz, Schweden, Bosnien-Herzogewina und dem Vereinigten Königreich in Köln aktiv, deren Beteiligung vom Blue Shield-Büro in Den Haag organisiert wird. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass Blue Shield die
Koordination der Hilfe auf der internationalen Ebene übernommen hat und sich auch weiterhin hier engagieren wird“, sagten Leitch und Kretzschmar. „Das Stadtarchiv wird noch lange Zeit vielfältige Unterstützung brauchen.“
Überaus beeindruckt angesichts des sichtbaren Ausmaßes der Katastrophe waren beide von der hervorragenden Organisation der Bergungsarbeiten, die von der Direktorin des Stadtarchivs, Dr. Bettina Schmidt-Czaia, und ihren Mitarbeitern bei einer Ortsbegehung vorgestellt wurde. Es sei bewundernswert, was bereits zu Rettung des Archivguts geleistet sei. Das große Engagement aller, die an den Bergungsarbeiten beteiligt sind, sei überwältigend. Besonders zu würdigen seien dabei auch die Kölner Mitbürgerinnen und Bürger und alle Kolleginnen und Kollegen aus der Fachwelt, die sich vielfach
in ihrer Freizeit und ihrem Urlaub zur Verfügung stellten. Dieses persönliche, freiwillige Engagement von außen sei als Zeichen lokaler, nationaler und nun auch internationaler Solidarität ermutigend, zugleich aber auch eine Verpflichtung aller Verantwortlichen in der Politik, ihren Part zur Bewältigung der Situation zu erfüllen. Vordringlich sei vor allem, das Stadtarchiv möglichst rasch an einer geeigneten Stelle unter Beachtung aller zu beachtenden Standards unterzubringen. Auch seien weiterhin alle Maßnahmen zur Rettung des Archivguts voranzutreiben. „Die Politik darf das freiwillige, keineswegs selbstverständliche Engagement nicht enttäuschen“, sagte Leitch. „Die nationalen und
internationalen Fachverbände erwarten konkrete und überzeugende Planungen“, ergänzte Kretzschmar, der im Gespräch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen darauf hinwies, dass der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare für 2012 plant, den Deutschen Archivtag in Köln zu veranstalten."
Quelle:
http://www.vda.archiv.net/pdf/PM20090430.pdf
Wolf Thomas - am Montag, 4. Mai 2009, 19:38 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.thenextlayer.org/node/1005
Wer eine Version mit Links lesen möchte, möge bitte die angegebene Adresse ansteuern.
Posted May 4th, 2009 by Armin Medosch in Deutsch Article Heidelberger Erklärung open access
Die sogenannte Heidelberger Erklärung und die Kampagne namhafter deutschsprachiger Medien gegen Open Access und Google Books verrät nicht nur ihre Arroganz und Borniertheit gegenüber neuen Formen der Produktion und Dissemination von Kultur und Wissen, sondern offenbart auch anti-liberale, autoritäre Züge - die bürgerlichen Medien haben ihre liberalen Wurzeln wohl vergessen oder verdrängt. Die "intellektuelle Finsternis", die von FAZ und Die Zeit auf Grund der "unheimlichen Kräfte" des Internet befürchtet wird, ist bereits da und von ihnen selbst mitverschuldet. Was jedoch wirklich gebraucht wird, anstatt drakonischer Urteile und Netzsperren, sind neue Wege der Vergütung kultureller Produktion, die an den etablierten, im Niedergang befindlichen Instanzen vorbei gehen.
In einer Titelgeschichte in der Wochenzeitung Die Zeit holte Reporterin Susanne Gaschke kürzlich zu einer umfassenden Polemik gegen die, wie sie es nennt, "Umsonst-Mentalität" des Internet aus. (siehe Im Netz der Piraten). Sie folgt dabei der breiten Schneise, welche die sogenannte Heidelberger Erklärung zuvor schon im deutschen Blätterwald geschlagen hatte. In diesem von mehr als 1600 Autoren, Autorinnen und Verlagen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum unterzeichneten Aufruf fordert Roland Reuß, Philologe und Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg, "das bestehende Urheberrecht, die Publikationsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre entschlossen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen." Die Rhetorik der Freiheit vermischt, wie Matthias Spielkamp von irights.de gezeigt hat, zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Der großangelegte Versuch von Google Books, alle Bücher dieser Welt zur Not auch ohne vorhergehende Zustimmung der Autoren einzuscannen, wird mit den Bemühungen der Open-Access-Bewegung, die fordert, dass mit öffentlichen Geldern geförderte wissenschaftliche Textproduktion auch öffentlich zugänglich sein solle, "zusammengequirlt", so Spielkamp. (Siehe Open Excess: Der Heidelberger Appell)
Die Autorin der Zeit-Titelgeschichte, Susanne Gaschke, ist selbst Unterzeichnerin des Heidelberger Appells, genauso übrigens wie Zeit-Herausgeber und ehemaliger deutscher Bundeskulturbeauftragter Michael Naumann. Die Zeit-Polemik strotzt nur so von kulturkonservativen Vorurteilen. The Pirate Bay wird als "Anleitungsbörse für Film- und Musikdiebstahl" verunglimpft und die Haft- und potenziell - sofern diese nicht widerrufen werden - Existenzen verkrüppelnden Urteile ausdrücklich begrüßt. Die "Pose der harmlosen Kulturvermittler" wird den schwedischen Copyleft-Aktivisten nicht abgenommen und ihr Vorgehen in die Nähe der Verfügbarmachung von Kinderpornografie gerückt. Netzsperren fordert Gaschke, auch wenn diese technisch umgangen werden können, denn entscheidend sei, dass "die Gesellschaft eine andauernde Rechtsverletzung ächtet." Die Pläne von Google-Books zur "Digitalisierung des Wissens der Welt" werden als "unheimlich" bezeichnet. Gemeinsam mit den Unterzeichnern der Heidelberger Erklärung wünscht sie sich ein "Stoppsignal". Denn "wer wird die Nachtwachen und die Einsamkeit literarischer Produktion noch auf sich nehmen", wenn man dafür nicht einmal die 10 Prozent vom Verkaufspreis bekommt, die Verlage Autoren üblicherweise zugestehen? In ihrer Schlusssalve spielt sie das "unlektorierte Mitteilungsbedürfnis der Nutzermassen" im Netz gegen die "intellektuelle Finsternis" aus, die drohen würde, wenn das "hohe Verfassungsgut" der "Freiheit von Literatur, Kunst und Wissenschaft" nicht gegen solchen Vandalismus verteidigt werde.
Der schon irgendwie nur mehr ironisch zu verstehende Verweis auf die "intellektuelle Finsternis" mag manche daran erinnern, dass bei der ZEIT selbst 1996 beinahe die Lichter ausgegangen wären, wenn nicht die Holtzbrinck Verlagsgruppe hilfreich eingesprungen wäre. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ist laut Wikipedia der sechstgrößte Medienkonzern Deutschlands. Neben Publikumsverlagen wie Rohwolt, S.Fischer und Kiepenheuer & Witsch besitzt die Gruppe den US-amerikanischen Macmillan Verlag und hat damit eine starke Präsenz auch im Bereich der wissenschaftlichen Publikationen mit Titeln wie Scientific American, Nature und Spektrum der Wissenschaft. Nach der aufsehenerregenden Übernahme des deutschen Studentennetzwerkes StudiVZ für kolportierte bis zu 100 Mio Euro im Jahr 2007 kam der ansonsten als "stiller Riese" bezeichnete Konzern gerade eben wieder in die Schlagzeilen, durch einen familieninternen Verkauf der überregionalen Tageszeitungen, darunter ein fünfzigprozentiger Anteil an Die Zeit, an Dieter von Holtzbrinck. Die Übernahme der Zeit 1996 durch Holtzbrinck leitete eine Kehrtwende ein. Das anschließende Re-design und die Veränderung der redaktionellen Linie hin zu kürzeren und stärker populistisch betitelten Artikeln haben eine Erholung der Verkausfszahlen bewirkt, aber möglicherweise jene Senkung der redaktionellen Standards bewirkt, die solche Artikel möglich machen. (siehe: Die Gräfin gruselt es)
Was ist an dem Zeit-Artikel zu Google Books und Open Access falsch? So ziemlich alles, darin ist sich die Bloggerszene (siehe z.B. Susanne Gascke versteht das Netz nicht) mit Heise Online einig.
Wie Heise Online ebenfalls berichtete, wirft das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" den Unterzeichnern der Heidelberger Erklärung vor, eine "verantwortungslose Kampagne gegen den freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen" gestartet zu haben. Denn anders als von der Erklärung unterstellt, ist die Open-Access-Bewegung eben keine Verschwörung aus dem Internet, sondern wird von nahmhaften ForscherInnen und Forschungsinstituten getragen. Hierbei geht es darum, dass der Staat gleich zweimal für wissenschaftliche Publikationen bezahlt, einmal, indem die Gehälter für die Forscher und Akademiker vom Staat bezahlt werden, die diese Texte erstellen, und ein zweites Mal, indem Universitätsbibliotheken hohe Gebühren an privatwirtschaftliche Verlage zahlen müssen, damit Personal und Studenten Zugang zu diesen Artikeln bekommen. Denn Bedingung für die Aufnahme eines Artikels in eines der Peer-Reviewed Wissenschafts-Magazine, in denen zu publizieren für WissenschafterInnen geradezu Pflicht ist, ist, dass die Autoren, die übrigens nichts bezahlt bekommen, Exklusivrechte an die Wissenschaftsverlage abtreten. Alles was die Open-Access-Bewegung will, ist die Möglichkeit, nichtexklusiver Rechte, so dass gleichzeitig im Wissenschaftsverlag und auf der eigenen Homepage oder in der Open-Access-Datenbank publiziert werden kann. Die bisherige Praxis hat die Öffentlichkeit von diesen hochwertigen Publikationen ausgeschlossen (Preise von 30 Euro und mehr für einzelne Artikel kommen einem defacto-Ausschluss gleich) und Verlage wie Springer (nicht zu verwechseln mit der Axel-Springer AG), Reed Elsevier oder Taylor and Francis reich gemacht. Holtzbrink mischt übrigens, via Macmillan und Nature-Gruppe auch kräftig im wissenschaftlichen Publikationsgeschäft mit. In Zeiten der Krise und Kürzungen bei Bildungsbudgets können sich Bibliotheken die teuren Subskriptionen immer weniger leisten. Kein Wunder dass das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" den Initiatoren der Heidelberger Kampagne "ein rückwärts gerichtetes und pur individualistisches Verständnis von Freiheit und Rechten" (Heise Online, siehe oben) vorwirft.
Der Zeit-Artikel und der Heidelberger Ordnungsruf sind symptomatisch für ein in der Presse grassierendes, extrem einseitiges Verständnis von "Urheberrecht". Offensichtlich werden als "Urheber" nur jene verstanden, die in den Copyright-geschützten Publikationen der Kulturindustrie publizieren, wie bereits ein Kommentator auf Netzpolitik.org bemerkte. Ebenso auffällig ist die historische Unkenntnis über den Charakter des geistigen Eigentums. Es wird unterstellt, dass die mit dem geistigen Eigentum verwandten Rechte reine Individualrechte sei. Dem ist aber nicht so. Die verschiedenen Facetten des geistigen Eigentums (Urheberrecht, bzw. Copyright, Patente, Markenrechte) haben sich historisch entwickelt, um eine Balance zwischen dem Interesse der Urheber, bzw. Rechteinhaber (wie z.B. Verlage) und dem Interesse der Öffentlichkeit an der Verfügbarkeit der Werke zu erzielen - das Urheberrecht ist keine Einbahnstraße. (siehe hierzu die von internationalen Urheberrechtsexperten erstellte Adelphi Charter der Royal Society of the Arts, sowie ein Artikel von Creative Commons Mitbegründer James Boyle Protecting the public domain). Erst in den neunziger Jahren, als mit dem Aufkommen des Internet und der digitalen Speicher- und Verfielfältigungstechnologien die Verlage und die Musik- und Filmindustrie ihr am Copyright orientiertes Geschäftsmodell in Frage gestellt sahen, kam es zu einer massiven Verschärfung des Copyright. Nachdem Frankreich ein Gesetz zur Sperre von Peer-to-Peer Downloadern erlassen hat, ist auch die EU auf dem Weg dazu, solche Netzsperren für Downloader zu implementieren.
Immer wieder gelingt es den Copyright-Industrien, ahnungslose AutorInnen (und noch ahnungslosere Politiker) auf ihre Seite zu ziehen, um solche drakonischen Gesetze auf den Weg zu bringen. Gerne benutzt man dazu das Argument, dass niemand die Mühen der Schöpfung auf sich nehmen würde, wenn es keinen extrem verschärften und auf tausend Jahre ausgedehnten Schutz des Copyright gäbe. Doch dieses Argument ist nicht nur löchrig, sondern empirisch widerlegt. Beginnen wir mit letzterem. Das Intellectuell Property Policy Research Centre der Universität Bournemouth hat eine vergleichende Studie zum Zusammenhang zwischen Copyright und dem Einkommen von englischen und deutschen Autoren erstellt (siehe Study on the Income of Authors). Das Ergebnis ist, dass die verbreitete Policy, die darauf beruhte, in starkem Urheberrechtsschutz einen Anreiz für kulturelle Produktion zu sehen, schlichtweg falsch ist. Nur eine Minderheit von AutorInnen wie J.K. Rowling oder Daniel Kehlmann verdienen wirklich gut. Über 60% der AutorInnen benötigen ein Nebeneinkommen aus einer anderen Tätigkeit und dieses kombinierte Einkommen wird zusätzlich oft dadurch ergänzt, dass der oder die Autorin mit einem besserverdienendem Partner zusammenlebt. Denn nur so können AutorInnen überhaupt existieren, die aus ihrer Arbeit in Deutschland laut Studie durchschnittlich ein Jahreseinkommen von 12.000 Euro (in den Jahren 2004/2005) erzielten, was 42% des nationalen Durchschnitteinkommens ausmacht. Und dennoch produzieren sie.
Das Argument ist darüber hinaus auch löchrig, weil es unterstellt, dass Kultur- und Wissensprodukte von vorneherein als Waren zu begreifen seien. Es klafft wohl nirgendwo eine größere Lücke zwischen Nutzwert und Tauschwert als in diesem Bereich. Die Warenform der kulturellen Güter (im weitesten Sinn, einschließlich wissenschaftlicher Publikationen) ist eine sehr junge "Errungenschaft", wenn man das so nennen kann, und steht oft im Gegensatz zum intrinsischen Interesse der Gesellschaft an einer freien Zirkulation dieser Werke. Das einseitige Verständnis von Kulturgütern als Waren beschneidet die vielfältigen Fäden, die Autoren und Publikum, Werk und Wirkung miteinander verbinden. Die Leser produzieren nicht nur das Werk durch ihre Rezeptionsleistung, die Gesellschaft ist zugleich auch jener Apparat, der die Produzierenden produziert und somit automatisch ein (Mit)Recht an ihren Produkten hat. Die individual-anarchistische Auffassung, dass "mein Werk" mir und nur mir allein gehört, ist wohl ein Ergebniss eines falsch verstandenen Individualismus- und Schöpferkults, denn kulturelle Produktion ist immer schon per se gesellschaftlich. Was jemand allein im Wald erzeugt, hat der Unabomber exemplarisch klar gemacht. Nicht zuletzt ist jegliche Produktion, ob Literatur oder Wissenschaft, von vorherigen Produktionen abhängig. Die Produktion ist dialogisch, insofern sie sich auf vorhergegangene Werke stützt, sie verwirft oder kritisiert oder über sie hinausgeht und neue Wege aufzeigt.
Indem Die Zeit sich der Kampagne gegen Google Books, Pirate Bay und Open Access anschließt, zeigt sie sich als treue Dienerin ihrer adeligen Großmedienbesitzer und demonstriert so ganz nebenbei, dass das einstmals als "liberal" geltende Blatt die Bedeutung des Liberalismus
verlernt hat. Das Internet ist eben keine geheimniskrämerische Verschwörung finsterer Mächte, wie der Heidelberger Literaturprofessor und seine fehlgeleiteten Unterstützer uns weis machen wollen, sondern im Gegtenteil, beruht auf offenen und öffentlich einsehbaren Standards, den sogenannten Internetprotokollen, oder RFCs. Jeder kann diese Protokolle nutzen oder auch neue entwickeln, ohne vorher um Erlaubnis fragen zu müssen. Google ist jene Firma, die es zum gegenwärtigen Stand der Dinge am besten verstanden hat, diesen Open-Source-Liberalismus zu nutzen. Google ist ja primär immer noch eine Suchmaschine, welche die im Internet veröffentlichten Inhalte zugänglich macht, gratis für die Nutzer. Dagegen kann man sich wohl kaum beschweren. Dass Google diese Funktion so gut erfüllt, dass daraus eine quasi-Monopolstellung erwachsen ist, die Google enorme Werbeeinnahmen beschert und das Unternehmen kürzlich wieder zur teuersten Marke der Welt werden ließ, liegt im Wesen des Kapitalismus, der zur Monopolbildung tendiert. Die Einscan-Aktion von Google Books ist sicherlich kontrovers. Aber immerhin macht Google dadurch viele vergriffene und antiquarische Bücher weltweit zugänglich. In meinem persönlichen Nutzerverhalten hat ein Treffer bei Google Books schon öfter zum anschließenden Kauf des Druckwerks geführt. Und immerhin zahlt Google den Autoren in den USA 63% der Werbeeinnahmen, was sich gegenüber den 10% vom Verkaufspreis, die deutsche Verlage üblicherweise an Autoren zahlen, relativ großzügig ausnimmt. In seiner ganzen Funktionsweise ist Google, ob man das nun gut findet oder nicht, der perfekte Ausdruck des radikalen Wirtschaftsliberalismus eines Friedrich von Hayek. Dieser der liberalen "österreichischen Schule" angehörige Ökonom vertrat eine strikte Ideologie des freien Marktes auch dann noch, als die Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929 den Wirtschaftsliberalismus in Verruf gebracht hatte. Nach dem Zweiten Weltrkieg ein relativ einsamer Gegner des Keynisianismus, wurde Hayek seit dem Einsetzen des Neoliberalismus eine späte Renaissance zuteil. Seine Theorien des "verteilten Wissens" wurden zunehmend auch von den Schwarmtheoretikern und Artificial-Life-Forschern in der Informatik aufgegriffen.
Die Attacken der Heidelberger Unterzeichner und der deutschen Presse (siehe z.B.auch diesen Artikel in der FAZ Unter Piraten) gegen das freie Publizieren im Internet, gekoppelt mit Rufen nach "Stoppsignalen", "Netzsperren" und der Befürwortung harter Strafen, offenbaren den zutiefst antiliberalen Grundzug in weiten Teilen der deutschen "Geisteseliten". Ähnlich wie die Musikindustrie versucht man, den Status Quo mit allen Mitteln zu verteidigen. So werden Hierarchien zwischen anerkannten und freien Produzenten einzementiert und dringend benötigte Reformen verhindert . Denn die Frage ist in der Tat, wie hochwertige kulturelle Produktion finanziert werden kann. Der Weg der privaten Medien in den letzten 30 Jahren war, zunehmend von Werbung abhängig zu werden. In der Folge hat sich auch der inhaltliche Spielraum in der Medienlandschaft immer mehr verengt. Kritische Autoren haben kaum noch Orte, wo sie publizieren können und weichen auf unabhängige Formate wie eben eigene Blogs aus. Ich habe es schon längst aufgegeben, Artikel in deutschen Printmedien publizieren zu wollen. Die paar Euro sind mir die Verwässerung meiner Ideen nicht wert. Die zunehmend dünner werdende, werbefinanzierte Soße - das Zeit-Magazin "Leben" mag als Beispiel dafür dienen, ebenso wie alle anderen Life-Style-Supplemente aller großen Zeitungen - braucht redaktionelle Inhalte nur noch zur Auflockerung der vielen Inserate.Die Zeitungen führen sich auf, als wären sie die einzigen Garanten der Meinungsfreiheit und demokratischen Kontrolle, dabei haben sie sich längst an den schrankenlosen Konsum-Kapitalismus verkauft, und schlittern dennoch immer tiefer ins Finanzloch (siehe Endlose Verluste für Zeitungen).
Insofern braucht die "intellektuelle Finsternis" nicht erst durch das Internet herbeigeführt zu werden, sie ist bereits da, und das Netz bietet einen der wenigen Lichtblicke. Opportunistische Artikel über die Finanzkrise in den Organen der Presse können nicht überspielen, dass es sich um eine Krise der liberalen Marktwirtschaft und der Demokratien nach westlichem Muster handelt, die in ihrer Panik zunehmend zu autoritäten Mitteln greifen. Anstatt das "schrankenlose Mitteilungsbedürfnis der Nutzergemeinschaften" zu geißeln, sollte man lieber anerkennen, dass im Netz eine neue Breite und Tiefe der aktiven Partizipation bereits entstanden ist und dass es eine geeignete Plattform für die vielfältigsten Formen der Wissensproduktion und -Distribution bietet. Da die alten Geschäftsmodelle der Content-Industrien brüchig geworden sind, sollte man über neue Wege der Finanzierung geistiger Produktion nachdenken. Als Radio und Fernsehen noch neue Medien waren, zweifelte niemand daran, dass der Staat eine gewichtige Rolle in der Regulierung von Produktion und Distribution einnehmen sollte. Daraus entstand das System der mit Lizenzgebühren finanzierten, von direkter Regierungseinflussnahme unabhängigen öffentlich-rechtlichen Anstalten, die von den Zeitungsherausgebern nur zu gern kritisiert werden. Die Öffnung des Internet fiel in die Hochphase des Neoliberalismus und mit dem Bangemann-Report 1994 einigte man sich EU-weit darauf, dass das Internet den Marktkräften überlassen sein solle. Der wirtschaftliche Liberalismus lässt sich jedoch nicht von den radikal libertären Kräften trennen, welche die Entwicklung von Peer-to-Peer-Protokollen für Filesharing vorantreiben, also z.B. die Hacker hinter Initiativen wie The Pirate Bay und die Entwickler der Bittorrent-Protokolle.Offiziell sanktionierter Wirtschaftsliberalismus und der ultralibertäre Flügel der Open-Source-Community sind auf der selben Seite der selben Medaille (die Rückseite dieser Medialle bildet die Kultur des elektronischen Underground, siehe Netzpiraten - die Kultur des elektronischen Verbrechens, Medosch und Röttgers, dpunkt 2001). Jetzt, da man die Geister, die man rief, nicht mehr los wird, versuchen Sarkozy, Hollywood, Holtzbrinck und Co autoritär durchzugreifen. Dadurch untergräbt man jedoch die Fundamente der "Wissensgesellschaft", die man angeblich so liebt. Deshalb sollte man über radikale neue Modelle nachdenken, wie z.B. einen Fonds für freie Wissens- und KulturproduzentInnen, ob gedruckt oder im Netz, die neue Wege gehen und außerhalb der etablierten Medien und Hierarchien arbeiten, wie z.B. Thenextlayer.org. Finanzieren könnte sich ein solcher Fonds z.B. aus einer Tobin-Steuer. Dafür verzichte ich dann auch gerne weiterhin auf Google-Ads auf den Seiten von thenextlayer.org.
Dieser Artikel kann von nicht-kommerziellen Publikationen übernommen werden. Die Wiederverwertung ist mit einem ausdrücklichen Link auf thenextlayer.org ebenso wie mit einem Link auf den Artikel selbst zu verbinden, und es wäre nett, mich davon in Kenntnis zu setzen. Auch kommerzielle Medien können diesen Artikel oder eine Version davon gegen Bezahlung gerne verwenden und mögen sich zu diesem Zweck mit mir in Verbindung setzen.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Gern würde ich Medosch von der Wiederveröffentlichung hier in Kenntnis setzen, aber es ist mir nicht gelungen, ein Impressum oder eine Kontaktmail ausfindig zu machen.
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Wer eine Version mit Links lesen möchte, möge bitte die angegebene Adresse ansteuern.
Posted May 4th, 2009 by Armin Medosch in Deutsch Article Heidelberger Erklärung open access
Die sogenannte Heidelberger Erklärung und die Kampagne namhafter deutschsprachiger Medien gegen Open Access und Google Books verrät nicht nur ihre Arroganz und Borniertheit gegenüber neuen Formen der Produktion und Dissemination von Kultur und Wissen, sondern offenbart auch anti-liberale, autoritäre Züge - die bürgerlichen Medien haben ihre liberalen Wurzeln wohl vergessen oder verdrängt. Die "intellektuelle Finsternis", die von FAZ und Die Zeit auf Grund der "unheimlichen Kräfte" des Internet befürchtet wird, ist bereits da und von ihnen selbst mitverschuldet. Was jedoch wirklich gebraucht wird, anstatt drakonischer Urteile und Netzsperren, sind neue Wege der Vergütung kultureller Produktion, die an den etablierten, im Niedergang befindlichen Instanzen vorbei gehen.
In einer Titelgeschichte in der Wochenzeitung Die Zeit holte Reporterin Susanne Gaschke kürzlich zu einer umfassenden Polemik gegen die, wie sie es nennt, "Umsonst-Mentalität" des Internet aus. (siehe Im Netz der Piraten). Sie folgt dabei der breiten Schneise, welche die sogenannte Heidelberger Erklärung zuvor schon im deutschen Blätterwald geschlagen hatte. In diesem von mehr als 1600 Autoren, Autorinnen und Verlagen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum unterzeichneten Aufruf fordert Roland Reuß, Philologe und Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg, "das bestehende Urheberrecht, die Publikationsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre entschlossen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen." Die Rhetorik der Freiheit vermischt, wie Matthias Spielkamp von irights.de gezeigt hat, zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Der großangelegte Versuch von Google Books, alle Bücher dieser Welt zur Not auch ohne vorhergehende Zustimmung der Autoren einzuscannen, wird mit den Bemühungen der Open-Access-Bewegung, die fordert, dass mit öffentlichen Geldern geförderte wissenschaftliche Textproduktion auch öffentlich zugänglich sein solle, "zusammengequirlt", so Spielkamp. (Siehe Open Excess: Der Heidelberger Appell)
Die Autorin der Zeit-Titelgeschichte, Susanne Gaschke, ist selbst Unterzeichnerin des Heidelberger Appells, genauso übrigens wie Zeit-Herausgeber und ehemaliger deutscher Bundeskulturbeauftragter Michael Naumann. Die Zeit-Polemik strotzt nur so von kulturkonservativen Vorurteilen. The Pirate Bay wird als "Anleitungsbörse für Film- und Musikdiebstahl" verunglimpft und die Haft- und potenziell - sofern diese nicht widerrufen werden - Existenzen verkrüppelnden Urteile ausdrücklich begrüßt. Die "Pose der harmlosen Kulturvermittler" wird den schwedischen Copyleft-Aktivisten nicht abgenommen und ihr Vorgehen in die Nähe der Verfügbarmachung von Kinderpornografie gerückt. Netzsperren fordert Gaschke, auch wenn diese technisch umgangen werden können, denn entscheidend sei, dass "die Gesellschaft eine andauernde Rechtsverletzung ächtet." Die Pläne von Google-Books zur "Digitalisierung des Wissens der Welt" werden als "unheimlich" bezeichnet. Gemeinsam mit den Unterzeichnern der Heidelberger Erklärung wünscht sie sich ein "Stoppsignal". Denn "wer wird die Nachtwachen und die Einsamkeit literarischer Produktion noch auf sich nehmen", wenn man dafür nicht einmal die 10 Prozent vom Verkaufspreis bekommt, die Verlage Autoren üblicherweise zugestehen? In ihrer Schlusssalve spielt sie das "unlektorierte Mitteilungsbedürfnis der Nutzermassen" im Netz gegen die "intellektuelle Finsternis" aus, die drohen würde, wenn das "hohe Verfassungsgut" der "Freiheit von Literatur, Kunst und Wissenschaft" nicht gegen solchen Vandalismus verteidigt werde.
Der schon irgendwie nur mehr ironisch zu verstehende Verweis auf die "intellektuelle Finsternis" mag manche daran erinnern, dass bei der ZEIT selbst 1996 beinahe die Lichter ausgegangen wären, wenn nicht die Holtzbrinck Verlagsgruppe hilfreich eingesprungen wäre. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ist laut Wikipedia der sechstgrößte Medienkonzern Deutschlands. Neben Publikumsverlagen wie Rohwolt, S.Fischer und Kiepenheuer & Witsch besitzt die Gruppe den US-amerikanischen Macmillan Verlag und hat damit eine starke Präsenz auch im Bereich der wissenschaftlichen Publikationen mit Titeln wie Scientific American, Nature und Spektrum der Wissenschaft. Nach der aufsehenerregenden Übernahme des deutschen Studentennetzwerkes StudiVZ für kolportierte bis zu 100 Mio Euro im Jahr 2007 kam der ansonsten als "stiller Riese" bezeichnete Konzern gerade eben wieder in die Schlagzeilen, durch einen familieninternen Verkauf der überregionalen Tageszeitungen, darunter ein fünfzigprozentiger Anteil an Die Zeit, an Dieter von Holtzbrinck. Die Übernahme der Zeit 1996 durch Holtzbrinck leitete eine Kehrtwende ein. Das anschließende Re-design und die Veränderung der redaktionellen Linie hin zu kürzeren und stärker populistisch betitelten Artikeln haben eine Erholung der Verkausfszahlen bewirkt, aber möglicherweise jene Senkung der redaktionellen Standards bewirkt, die solche Artikel möglich machen. (siehe: Die Gräfin gruselt es)
Was ist an dem Zeit-Artikel zu Google Books und Open Access falsch? So ziemlich alles, darin ist sich die Bloggerszene (siehe z.B. Susanne Gascke versteht das Netz nicht) mit Heise Online einig.
Wie Heise Online ebenfalls berichtete, wirft das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" den Unterzeichnern der Heidelberger Erklärung vor, eine "verantwortungslose Kampagne gegen den freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen" gestartet zu haben. Denn anders als von der Erklärung unterstellt, ist die Open-Access-Bewegung eben keine Verschwörung aus dem Internet, sondern wird von nahmhaften ForscherInnen und Forschungsinstituten getragen. Hierbei geht es darum, dass der Staat gleich zweimal für wissenschaftliche Publikationen bezahlt, einmal, indem die Gehälter für die Forscher und Akademiker vom Staat bezahlt werden, die diese Texte erstellen, und ein zweites Mal, indem Universitätsbibliotheken hohe Gebühren an privatwirtschaftliche Verlage zahlen müssen, damit Personal und Studenten Zugang zu diesen Artikeln bekommen. Denn Bedingung für die Aufnahme eines Artikels in eines der Peer-Reviewed Wissenschafts-Magazine, in denen zu publizieren für WissenschafterInnen geradezu Pflicht ist, ist, dass die Autoren, die übrigens nichts bezahlt bekommen, Exklusivrechte an die Wissenschaftsverlage abtreten. Alles was die Open-Access-Bewegung will, ist die Möglichkeit, nichtexklusiver Rechte, so dass gleichzeitig im Wissenschaftsverlag und auf der eigenen Homepage oder in der Open-Access-Datenbank publiziert werden kann. Die bisherige Praxis hat die Öffentlichkeit von diesen hochwertigen Publikationen ausgeschlossen (Preise von 30 Euro und mehr für einzelne Artikel kommen einem defacto-Ausschluss gleich) und Verlage wie Springer (nicht zu verwechseln mit der Axel-Springer AG), Reed Elsevier oder Taylor and Francis reich gemacht. Holtzbrink mischt übrigens, via Macmillan und Nature-Gruppe auch kräftig im wissenschaftlichen Publikationsgeschäft mit. In Zeiten der Krise und Kürzungen bei Bildungsbudgets können sich Bibliotheken die teuren Subskriptionen immer weniger leisten. Kein Wunder dass das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" den Initiatoren der Heidelberger Kampagne "ein rückwärts gerichtetes und pur individualistisches Verständnis von Freiheit und Rechten" (Heise Online, siehe oben) vorwirft.
Der Zeit-Artikel und der Heidelberger Ordnungsruf sind symptomatisch für ein in der Presse grassierendes, extrem einseitiges Verständnis von "Urheberrecht". Offensichtlich werden als "Urheber" nur jene verstanden, die in den Copyright-geschützten Publikationen der Kulturindustrie publizieren, wie bereits ein Kommentator auf Netzpolitik.org bemerkte. Ebenso auffällig ist die historische Unkenntnis über den Charakter des geistigen Eigentums. Es wird unterstellt, dass die mit dem geistigen Eigentum verwandten Rechte reine Individualrechte sei. Dem ist aber nicht so. Die verschiedenen Facetten des geistigen Eigentums (Urheberrecht, bzw. Copyright, Patente, Markenrechte) haben sich historisch entwickelt, um eine Balance zwischen dem Interesse der Urheber, bzw. Rechteinhaber (wie z.B. Verlage) und dem Interesse der Öffentlichkeit an der Verfügbarkeit der Werke zu erzielen - das Urheberrecht ist keine Einbahnstraße. (siehe hierzu die von internationalen Urheberrechtsexperten erstellte Adelphi Charter der Royal Society of the Arts, sowie ein Artikel von Creative Commons Mitbegründer James Boyle Protecting the public domain). Erst in den neunziger Jahren, als mit dem Aufkommen des Internet und der digitalen Speicher- und Verfielfältigungstechnologien die Verlage und die Musik- und Filmindustrie ihr am Copyright orientiertes Geschäftsmodell in Frage gestellt sahen, kam es zu einer massiven Verschärfung des Copyright. Nachdem Frankreich ein Gesetz zur Sperre von Peer-to-Peer Downloadern erlassen hat, ist auch die EU auf dem Weg dazu, solche Netzsperren für Downloader zu implementieren.
Immer wieder gelingt es den Copyright-Industrien, ahnungslose AutorInnen (und noch ahnungslosere Politiker) auf ihre Seite zu ziehen, um solche drakonischen Gesetze auf den Weg zu bringen. Gerne benutzt man dazu das Argument, dass niemand die Mühen der Schöpfung auf sich nehmen würde, wenn es keinen extrem verschärften und auf tausend Jahre ausgedehnten Schutz des Copyright gäbe. Doch dieses Argument ist nicht nur löchrig, sondern empirisch widerlegt. Beginnen wir mit letzterem. Das Intellectuell Property Policy Research Centre der Universität Bournemouth hat eine vergleichende Studie zum Zusammenhang zwischen Copyright und dem Einkommen von englischen und deutschen Autoren erstellt (siehe Study on the Income of Authors). Das Ergebnis ist, dass die verbreitete Policy, die darauf beruhte, in starkem Urheberrechtsschutz einen Anreiz für kulturelle Produktion zu sehen, schlichtweg falsch ist. Nur eine Minderheit von AutorInnen wie J.K. Rowling oder Daniel Kehlmann verdienen wirklich gut. Über 60% der AutorInnen benötigen ein Nebeneinkommen aus einer anderen Tätigkeit und dieses kombinierte Einkommen wird zusätzlich oft dadurch ergänzt, dass der oder die Autorin mit einem besserverdienendem Partner zusammenlebt. Denn nur so können AutorInnen überhaupt existieren, die aus ihrer Arbeit in Deutschland laut Studie durchschnittlich ein Jahreseinkommen von 12.000 Euro (in den Jahren 2004/2005) erzielten, was 42% des nationalen Durchschnitteinkommens ausmacht. Und dennoch produzieren sie.
Das Argument ist darüber hinaus auch löchrig, weil es unterstellt, dass Kultur- und Wissensprodukte von vorneherein als Waren zu begreifen seien. Es klafft wohl nirgendwo eine größere Lücke zwischen Nutzwert und Tauschwert als in diesem Bereich. Die Warenform der kulturellen Güter (im weitesten Sinn, einschließlich wissenschaftlicher Publikationen) ist eine sehr junge "Errungenschaft", wenn man das so nennen kann, und steht oft im Gegensatz zum intrinsischen Interesse der Gesellschaft an einer freien Zirkulation dieser Werke. Das einseitige Verständnis von Kulturgütern als Waren beschneidet die vielfältigen Fäden, die Autoren und Publikum, Werk und Wirkung miteinander verbinden. Die Leser produzieren nicht nur das Werk durch ihre Rezeptionsleistung, die Gesellschaft ist zugleich auch jener Apparat, der die Produzierenden produziert und somit automatisch ein (Mit)Recht an ihren Produkten hat. Die individual-anarchistische Auffassung, dass "mein Werk" mir und nur mir allein gehört, ist wohl ein Ergebniss eines falsch verstandenen Individualismus- und Schöpferkults, denn kulturelle Produktion ist immer schon per se gesellschaftlich. Was jemand allein im Wald erzeugt, hat der Unabomber exemplarisch klar gemacht. Nicht zuletzt ist jegliche Produktion, ob Literatur oder Wissenschaft, von vorherigen Produktionen abhängig. Die Produktion ist dialogisch, insofern sie sich auf vorhergegangene Werke stützt, sie verwirft oder kritisiert oder über sie hinausgeht und neue Wege aufzeigt.
Indem Die Zeit sich der Kampagne gegen Google Books, Pirate Bay und Open Access anschließt, zeigt sie sich als treue Dienerin ihrer adeligen Großmedienbesitzer und demonstriert so ganz nebenbei, dass das einstmals als "liberal" geltende Blatt die Bedeutung des Liberalismus
verlernt hat. Das Internet ist eben keine geheimniskrämerische Verschwörung finsterer Mächte, wie der Heidelberger Literaturprofessor und seine fehlgeleiteten Unterstützer uns weis machen wollen, sondern im Gegtenteil, beruht auf offenen und öffentlich einsehbaren Standards, den sogenannten Internetprotokollen, oder RFCs. Jeder kann diese Protokolle nutzen oder auch neue entwickeln, ohne vorher um Erlaubnis fragen zu müssen. Google ist jene Firma, die es zum gegenwärtigen Stand der Dinge am besten verstanden hat, diesen Open-Source-Liberalismus zu nutzen. Google ist ja primär immer noch eine Suchmaschine, welche die im Internet veröffentlichten Inhalte zugänglich macht, gratis für die Nutzer. Dagegen kann man sich wohl kaum beschweren. Dass Google diese Funktion so gut erfüllt, dass daraus eine quasi-Monopolstellung erwachsen ist, die Google enorme Werbeeinnahmen beschert und das Unternehmen kürzlich wieder zur teuersten Marke der Welt werden ließ, liegt im Wesen des Kapitalismus, der zur Monopolbildung tendiert. Die Einscan-Aktion von Google Books ist sicherlich kontrovers. Aber immerhin macht Google dadurch viele vergriffene und antiquarische Bücher weltweit zugänglich. In meinem persönlichen Nutzerverhalten hat ein Treffer bei Google Books schon öfter zum anschließenden Kauf des Druckwerks geführt. Und immerhin zahlt Google den Autoren in den USA 63% der Werbeeinnahmen, was sich gegenüber den 10% vom Verkaufspreis, die deutsche Verlage üblicherweise an Autoren zahlen, relativ großzügig ausnimmt. In seiner ganzen Funktionsweise ist Google, ob man das nun gut findet oder nicht, der perfekte Ausdruck des radikalen Wirtschaftsliberalismus eines Friedrich von Hayek. Dieser der liberalen "österreichischen Schule" angehörige Ökonom vertrat eine strikte Ideologie des freien Marktes auch dann noch, als die Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929 den Wirtschaftsliberalismus in Verruf gebracht hatte. Nach dem Zweiten Weltrkieg ein relativ einsamer Gegner des Keynisianismus, wurde Hayek seit dem Einsetzen des Neoliberalismus eine späte Renaissance zuteil. Seine Theorien des "verteilten Wissens" wurden zunehmend auch von den Schwarmtheoretikern und Artificial-Life-Forschern in der Informatik aufgegriffen.
Die Attacken der Heidelberger Unterzeichner und der deutschen Presse (siehe z.B.auch diesen Artikel in der FAZ Unter Piraten) gegen das freie Publizieren im Internet, gekoppelt mit Rufen nach "Stoppsignalen", "Netzsperren" und der Befürwortung harter Strafen, offenbaren den zutiefst antiliberalen Grundzug in weiten Teilen der deutschen "Geisteseliten". Ähnlich wie die Musikindustrie versucht man, den Status Quo mit allen Mitteln zu verteidigen. So werden Hierarchien zwischen anerkannten und freien Produzenten einzementiert und dringend benötigte Reformen verhindert . Denn die Frage ist in der Tat, wie hochwertige kulturelle Produktion finanziert werden kann. Der Weg der privaten Medien in den letzten 30 Jahren war, zunehmend von Werbung abhängig zu werden. In der Folge hat sich auch der inhaltliche Spielraum in der Medienlandschaft immer mehr verengt. Kritische Autoren haben kaum noch Orte, wo sie publizieren können und weichen auf unabhängige Formate wie eben eigene Blogs aus. Ich habe es schon längst aufgegeben, Artikel in deutschen Printmedien publizieren zu wollen. Die paar Euro sind mir die Verwässerung meiner Ideen nicht wert. Die zunehmend dünner werdende, werbefinanzierte Soße - das Zeit-Magazin "Leben" mag als Beispiel dafür dienen, ebenso wie alle anderen Life-Style-Supplemente aller großen Zeitungen - braucht redaktionelle Inhalte nur noch zur Auflockerung der vielen Inserate.Die Zeitungen führen sich auf, als wären sie die einzigen Garanten der Meinungsfreiheit und demokratischen Kontrolle, dabei haben sie sich längst an den schrankenlosen Konsum-Kapitalismus verkauft, und schlittern dennoch immer tiefer ins Finanzloch (siehe Endlose Verluste für Zeitungen).
Insofern braucht die "intellektuelle Finsternis" nicht erst durch das Internet herbeigeführt zu werden, sie ist bereits da, und das Netz bietet einen der wenigen Lichtblicke. Opportunistische Artikel über die Finanzkrise in den Organen der Presse können nicht überspielen, dass es sich um eine Krise der liberalen Marktwirtschaft und der Demokratien nach westlichem Muster handelt, die in ihrer Panik zunehmend zu autoritäten Mitteln greifen. Anstatt das "schrankenlose Mitteilungsbedürfnis der Nutzergemeinschaften" zu geißeln, sollte man lieber anerkennen, dass im Netz eine neue Breite und Tiefe der aktiven Partizipation bereits entstanden ist und dass es eine geeignete Plattform für die vielfältigsten Formen der Wissensproduktion und -Distribution bietet. Da die alten Geschäftsmodelle der Content-Industrien brüchig geworden sind, sollte man über neue Wege der Finanzierung geistiger Produktion nachdenken. Als Radio und Fernsehen noch neue Medien waren, zweifelte niemand daran, dass der Staat eine gewichtige Rolle in der Regulierung von Produktion und Distribution einnehmen sollte. Daraus entstand das System der mit Lizenzgebühren finanzierten, von direkter Regierungseinflussnahme unabhängigen öffentlich-rechtlichen Anstalten, die von den Zeitungsherausgebern nur zu gern kritisiert werden. Die Öffnung des Internet fiel in die Hochphase des Neoliberalismus und mit dem Bangemann-Report 1994 einigte man sich EU-weit darauf, dass das Internet den Marktkräften überlassen sein solle. Der wirtschaftliche Liberalismus lässt sich jedoch nicht von den radikal libertären Kräften trennen, welche die Entwicklung von Peer-to-Peer-Protokollen für Filesharing vorantreiben, also z.B. die Hacker hinter Initiativen wie The Pirate Bay und die Entwickler der Bittorrent-Protokolle.Offiziell sanktionierter Wirtschaftsliberalismus und der ultralibertäre Flügel der Open-Source-Community sind auf der selben Seite der selben Medaille (die Rückseite dieser Medialle bildet die Kultur des elektronischen Underground, siehe Netzpiraten - die Kultur des elektronischen Verbrechens, Medosch und Röttgers, dpunkt 2001). Jetzt, da man die Geister, die man rief, nicht mehr los wird, versuchen Sarkozy, Hollywood, Holtzbrinck und Co autoritär durchzugreifen. Dadurch untergräbt man jedoch die Fundamente der "Wissensgesellschaft", die man angeblich so liebt. Deshalb sollte man über radikale neue Modelle nachdenken, wie z.B. einen Fonds für freie Wissens- und KulturproduzentInnen, ob gedruckt oder im Netz, die neue Wege gehen und außerhalb der etablierten Medien und Hierarchien arbeiten, wie z.B. Thenextlayer.org. Finanzieren könnte sich ein solcher Fonds z.B. aus einer Tobin-Steuer. Dafür verzichte ich dann auch gerne weiterhin auf Google-Ads auf den Seiten von thenextlayer.org.
Dieser Artikel kann von nicht-kommerziellen Publikationen übernommen werden. Die Wiederverwertung ist mit einem ausdrücklichen Link auf thenextlayer.org ebenso wie mit einem Link auf den Artikel selbst zu verbinden, und es wäre nett, mich davon in Kenntnis zu setzen. Auch kommerzielle Medien können diesen Artikel oder eine Version davon gegen Bezahlung gerne verwenden und mögen sich zu diesem Zweck mit mir in Verbindung setzen.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Gern würde ich Medosch von der Wiederveröffentlichung hier in Kenntnis setzen, aber es ist mir nicht gelungen, ein Impressum oder eine Kontaktmail ausfindig zu machen.
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
KlausGraf - am Montag, 4. Mai 2009, 15:27 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 4. Mai 2009, 03:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die lange angekündigte Edition des “Liber revelationum” von Richalm von Schöntal durch den Freiburger Emeritus Paul Gerhard Schmidt ist vor wenigen Wochen erschienen:
Richalm von Schöntal, Liber revelationum. Hrsg. von Paul Gerhard Schmidt (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 24). Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2009. LXXIV, 230 S.
http://www.mgh.de/home/aktuelles/newsdetails/richalm-von-schoental-liber-revelationum/47df5adc8b/
[Ausgabe jetzt online:
http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00066357_meta:titlePage.html?sortIndex=060:010:0024:010:00:00 ]
Nachdem der spannende Text bislang nur durch die schlechte und unvollständige Edition des Melker Benediktiners Bernhard Pez (1721) zugänglich war, sind nun die besten Voraussetzungen geschaffen, ihn erneut zu entdecken.
Richalms in Dialogform abgefasstes Buch gilt vor allem der Wahrnehmung von Dämonen durch den Schöntaler Zisterzienser: “Auditionen und Visionen bestimmten sein Leben. Er sah sich von Scharen von Teufeln umringt, die so zahlreich wie Schneeflocken in einem Wintersturm, wie Sandkörner am Meeresstrand und wie Wassertropfen bei einem Gewitterregen ihn überall umgaben, jeden seiner Schritte überwachten und ihn überallhin verfolgten (Kap. 46, 61)” (Schmidt S. XVI).
Aus der Sicht der mittellateinischen Philologie die Edition zu rühmen, will ich Berufeneren überlassen. Ich möchte mich auf drei Punkte konzentrieren, zu denen ich etwas ergänzen kann: auf die Lebenszeugnisse Richalms (I), die handschriftliche Überlieferung (II) und die Rezeption (III).
I. Zu den Lebenszeugnissen Richalms
Bis in die jüngste Zeit hält sich die auf den Abdruck von Pez zurückgehende Datierung des Werks auf 1270, obwohl schon im 19. Jahrhundert bekannt war, dass Richalms Abbatiat in die Zeit um 1219 gehört.
Zum in der Mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten Kloster Schöntal siehe die Online-Fassung des Württembergischen Klosterbuchs:
http://maja.bsz-bw.de/kloester-bw/kloster1.php?nr=134
Nur eine einzige Urkunde vom 22. November 1219, ausgestellt von Bischof Otto von Würzburg, nennt Richalm als Abt (“ex insinuatione dilecti nostri domini Richalmi abbatis et fratrum de Schonental, Cisterciensis ordinis”). Sie wurde im dritten Band des “Wirtembergischen Urkundenbuchs” (WUB) 1871 als Nr. 622 abgedruckt:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=946
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_089.jpg
In einer Urkunde vom 21. September 1214 (WUB 3, Nr. 561) erscheint Richalm noch als Prior:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=867
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_010.jpg
Es gibt also genau zwei urkundliche Nennungen Richalms.
Am 16. Juli 1216 amtierte noch sein Vorgänger Albert (WUB 3, Nr. 592), in einer nicht näher datierten Urkunde aus dem Jahr 1220 erscheint ein Gottfried als Klostervorsteher: WUB 3, Nr. 633 (Schmidt S. XII Anm. 9 hat den Druckfehler 363 statt 633):
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=963
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_105.jpg
Aus Richalms Werk geht hervor, dass er einmal als Prior zurückgetreten ist (Kap. 55, Schmidt S. 67). Man muss also mit der Möglichkeit rechnen, dass er nach wenigen Jahren als Abt - hierfür kommt maximal der Zeitraum von 1216 bis 1220 in Betracht - dieses Amt ebenfalls aufgegeben hat. Er könnte also durchaus länger als bis 1219 - so das in der Tradition überwiegend angegebene Todesjahr - gelebt haben.
Schmidt S. XI mit Anm. 4 ordnet Richalm aufgrund seines sehr seltenen Namens mit guten Gründen einer Ministerialenfamilie des Bischofs von Würzburg zu. Rätselhaft bleibt aber, wieso Schmidt das stärkste Indiz nicht anspricht, nämlich das Auftreten der Richalme mit Beinamen Hake in Schöntaler Urkunden! 1214 erscheint Richalmus Hacho als Zeuge bei einer Schenkung an Schöntal (WUB 3, Nr. 560), 1230 der miles Richalmus Hako gemeinsam mit Abt Gottfried (ebd. Nr. 777). 1233 treten die Brüder Richalm und Gottfried Haken als Salmänner bei einem Vermächtnis zugunsten von Schöntal auf (WUB 3, Nr. 831). Man wird in ihnen Verwandte von Abt Richalm sehen dürfen, auch wenn es sicher zu weit geht, Richalms Nachfolger Gottfried aufgrund seines Vornamens der gleichen Familie zuzuweisen.
Eine zusammenhängende kritische Auseinandersetzung mit der Schöntaler Tradition zu Richalm bietet Schmidt leider nicht. Man muss sich das Material aus verschiedenen Stellen seiner Einleitung zusammensuchen.
Vor dem 17. Jahrhundert scheint es keine Nachrichten zu Richalm zu geben, sieht man von der Translation von Richalm-Reliquien aus Mergenthal nach Schöntal unter Abt Konrad II. (1365-1371) ab, die Schmidt S. XXXVIII Anm. 30 leider ohne Quellenangabe erwähnt. S. XXXVII ist von Richalmreliquien in einer zu Schöntal gehörenden Kapelle in “Mergenthal” die Rede, was eher zutreffen dürfte als eine Translation von Mergenthal nach Schöntal. Ich zweifle nicht daran, dass es sich um die 1371 geweihte Kapelle des Schöntaler Stadthofes im heutigen Bad Mergentheim handelt, von der Schönhuths Chronik der Stadt Mergentheim meldet:
http://books.google.com/books?id=fXwAAAAAcAAJ&pg=PA25
Wenn man etwas weiterblättert, bestätigt sich diese Vermutung, da Schmidt S. LIV angibt, die Chronik von Angelus Hebenstreit (1664) kenne ebenfalls die Tradition, “wonach sich Reliquien im Altar der Schöntaler Kapelle zu Mergentheim befanden”.
Der Schöntaler Historiograph Bartholomäus Kremer (1589-661) schrieb eine große Klosterchronik, die als Handschrift in der Landesbibliothek Stuttgart liegt (Cod. hist. fol. 422), in der sich Kremer nach Schmidt S. XVIII Anm. 19 auf S. 175 über Richalm äußert. Entgegen den Angaben von Schmidt ist das aber nicht der Text, den Franz Josef Mone in seiner Quellensammlung der badischen Landesgeschichte Bd. 4,1, Karlsruhe 1867, S. 146 abdruckte und den Schmidt zitiert (es sei denn, der Text ist in den Handschriften absolut identisch). Mone gab eine vom Geistlichen Rat Grieshaber in Freiburg dem Karlsruher Generallandesarchiv mitgeteilte “Series abbatum” aus dem Jahr 1636 heraus, die er ebenfalls Kremer zuschrieb und die er als älteste Darstellung über Schöntal für wertvoller erachtete als die jüngere Chronik.
http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/258802596/
http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/258802596/images/Mone_Badische_Quellen_4.146.gif
Wenn die Angabe von Kremer in seiner Series zutreffen sollte, dass Richalms Vorgänger Albert auf dem Generalkapitel 1217 verstarb, hätte Richalm erst ab 1217 amtiert. Ansonsten referiert Kremer zu Richalm lediglich drei Urkunden aus seiner Abtszeit, von denen aber nur die erste von 1219 Richalm selbst nennt. Als Todesdatum wird angegeben: 1220 3. nonas Decembris (3. Dezember).
Schmidt zitiert Kremers Wiedergabe einer Urkunde von 1220 und merkt an (S. XVIII Anm. 19): “Die Namen der Zeugen in der zweiten Urkunde begegnen alle in Richalms Werk”. Das wäre ja nun ein durchaus bemerkenswerter Befund, den man nicht in einer Fußnote verstecken sollte. Nun schildert Richalm in Kap. 114 (S. 140) die Totenfeierlichkeiten für den Bruder Fridericus opilio. Wenn Richalm nach Schmidt wohl 1219 gestorben ist, wie konnte er den frühestens 1220 erfolgten Tod eines 1220 in einer Zeugenliste auftretenden Mönchs wiedergeben? Hat hier der Redaktor N., jener Schöntaler Mönch, der das Werk Richalms bearbeitete, seine Finger im Spiel gehabt und womöglich Richalm seine eigenen Erlebnisse untergeschoben? Des Rätsels Lösung ist weit banaler: Es gab gar keine solche Zeugenliste. Die von Kremer referierte Urkunde vom 12. April 1220 ist noch in der Ausfertigung erhalten und im WUB 3, Nr. 642 abgedruckt:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=970
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_117.jpg
“Fratres Albero caementarius, Fridericus opilio, Herilinus, Adelhardus, Adelboldus caecus” sucht man in der Urkunde vergebens. Mone, der die Schöntaler Urkunden nicht kannte, hat mit seinem interpretierenden Zusatz “[testes]” in die Irre geführt. Kremer gab keine Zeugenliste, sondern, den kurzen Eintrag zu Richalm abschließend, die Namen einiger Mönche an, die in der Zeit des Abtes Richalm lebten und entnahm diese Namen Richalms Werk! Kremer konnte 1636 offenbar schon auf die 1634/36 in Stams erstellte Abschrift des Schöntaler Mönchs Reinhold zurückgreifen, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass damals in Schöntal noch eine Handschrift greifbar war. Albero cementarius wird in Kap. 113 (Schmidt S. 140) erwähnt, Fridericus opilio in Kap. 114 (S. 140), Adelhardus in Kap. 31 (S. 36), Adelholdus cecus in Kap. 37 (S. 45). In Kap. 115 (S. 142) hört Richalm beim Tod des Bruders “He.” eine Stimme: “Hic est Heinzelinus”. Schmidts Variantenapparat gibt Auskunft, dass nur die Innsbrucker (früher Stamser) Handschrift, Vorlage der Abschrift Reinholds, “Herilinus” hat, alle anderen lesen Heinzelinus (mit orthographischen Abweichungen).
Sehr viel ausführlicher als Kremer beschäftigte sich Pater Angelus Hebenstreit (1626-1669) in seiner Schöntaler Chronik von 1664 mit Richalm. Schmidt S. LIV-LVI wertet diese Quelle aus, ohne sie jedoch kritisch zu analysieren. Angeblich war Richalm schon vor 1194 Novize in Schöntal. Die Ämterlaufbahn (Pförtner, Hospitalaufseher, Novizenmeister, Prior) scheint aus dem Werk erschlossen zu sein (vgl. Schmidt S. XI). Nach längerem Abwägen entscheidet sich Hebenstreit für den 2. Dezember 1219 als Todestag Richalms. Da Hebenstreit auch das im Pfarrarchiv Schöntal aufbewahrte “Mortilogium” von 1660 redigierte, auf das sich Schmidt S. XII Anm. 8 nach Mitteilung von Frau Dr. Maria Magdalena Rückert (Germania-Sacra-Bearbeiterin Schöntals) beruft, wundert es nicht, dass dort das Jahr 1219 und als Todestag der 2. Dezember angegeben wird. Ein älteres Anniversarienregister erwähnt Mone a.a.O. S. 143 nach Erwähnungen in der Zeitschrift “Wirtembergisch Franken”, doch dürfte Richalm darin nicht erwähnt werden. Den 2. Dezember 1219 erhielt im 17. Jahrhundert Gabriel Bucelin aus Schöntal mitgeteilt (Schmidt S. XXXVIII Anm. 30 zitiert die von Robert Schindele besorgte postume Ausgabe des “Menologium”-Supplements 1763, S. 276). Von Bucelin gelangte das Datum in Stadlers Heiligenlexikon:
http://www.zeno.org/Heiligenlexikon-1858/A/Richalmus
Ein 1698 verfasster Abtskatalog von Prior Joseph Müller und Richard Stöcklein (Stuttgart, Cod. Donaueschingen 600, Bl. 32r) schreibt Richalm ein Wappen und einen Wahlspruch zu, weiß von einem Distichon auf Richalm, gibt das Jahr 1200 als Beginn seines Priorats an und datiert die Wahl zum Abt auf 1216 (Schmidt S. XVIIIf.). Da das Wappen sicher nicht authentisch ist, wird man auch die detaillierten Angaben nicht gebrauchen können; sie verdanken sich offensichtlich dem Wunsch, die bisher bekannten allzu mageren Daten zu ergänzen und dürften erfunden sein, da nicht ersichtlich ist, welche hochmittelalterliche Quelle ihnen hätte zugrundeliegen können.
Hinsichtlich des Todesdatums steht nun der 3. Dezember 1220 bei Kremer 1636 gegen die sich später durchsetzende Hebenstreit-Version: 2. Dezember 1219. Letztere ist ja das Produkt gelehrter Erörterungen, während bei ersterer hinsichtlich des Todesjahrs nicht ausgeschlossen werden kann, dass Kremer sich an der Erwähnung von Richalms Nachfolger 1220 orientiert hat. Solange keine älteren oder neuen Quellen auftauchen, sollte man dem ältesten überlieferten Tagesdatum Priorität einräumen: 3. Dezember (eventuell auch: 2. Dezember). Beim Todesjahr erscheint ein “möglicherweise 1219/20, unter Umständen auch später” angebracht.
Dem Hinweis von Hermann Knaus in den Mittelalterlichen Bibliothekskatalogen 4/2 (1979), S. 872 ( auf den ich Schmidt 1989 aufmerksam machte) auf Notizen des 18. Jahrhunderts über Richalm in einer Handschrift der UB Würzburg ist Schmidt entweder nicht nachgegangen oder er erwies sich nicht als ergiebig. Nachrichten zur Geschichte Schöntals aus dem 17./18. Jahrhundert enthält UB Würzburg M.ch.f.258:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0371_b083_JPG.htm
Im Schöntaler Bestand B 503 II des Staatsarchivs Ludwigsburg gibt es eine Reihe historiographischer Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die von Schmidt nicht erwähnt werden, in denen aber mehr oder minder ausführliche Angaben über Richalms Abtszeit nicht fehlen dürften:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=17307&klassi=001&anzeigeKlassi=001.001.001
II. Zur Überlieferung des “Liber revelationum” Richalms von Schöntal
Zuerst wurde ich selbst auf Richalm Mitte der 1980er Jahre aufmerksam, als ich Norman Cohns “Europe’s Inner Demons” (1975) las, eine eindrucksvolle Studie zu den Wurzeln der Hexenprozesse. Dann begegneten mir Mones Notizen in seiner Quellensammlung, und ich stieß auch auf das Heldensagenzeugnis zu Sibicho in Grimms Heldensage (vgl. Schmidt S. XXXIX):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Die_deutsche_Heldensage_(Grimm_W.)_221.jpg
Besser dazu Müllenhoff in der ZfdA 12 (1865), S. 354f.
http://books.google.com/books?id=rPvgclbws1kC&pg=PA355
Nachdem ich erfahren hatte, dass Paul Gerhard Schmidt den Verfasserlexikon-Artikel zu Richalm übernommen hatte, wandte ich mich am 8. Januar 1989 an ihn. Schmidt sandte mir am 13. Februar sein Manuskript (“die Neuedition steht vor dem Abschluß”), worauf ich ihm einen Tag später meine gesammelten Notizen mitteilte. Der Hinweis auf die Kölner Handschrift GB 4̊ 214 erschien dann in Schmidts Richalm-Artikel in der Lieferung 1 von Bd. 8 des Verfasserlexikons 1990 (Sp. 42f.) mit meinem Namen, während er sich von der irreführenden Bezeichnung der Exzerpte (von ihm in der Edition jetzt brevis redactio genannt) als “Fragmente” nicht abbringen ließ. Clm 151, 245v-248r (aus Rebdorf, 1456), das unter den “Fragmenten” gelistet ist, hat mit Richalm nichts zu tun (siehe Carmen Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge 1200-1400, Leiden 2007, S. 359 nach Autopsie). Es fehlten die Innsbrucker Handschrift, die zweite Kölner, die Pariser und die Hebenstreit-Chronik in Ludwigsburg. 1987 war Neuhausers Innsbrucker Handschriftenkatalog erschienen, in dem ich am 3. November 1989 die ehemals Stamser Handschrift fand. Noch am gleichen Tag teilte ich das Schmidt mit, was für ihn eine “freudige Überraschung” war.
Nachdem mir vor kurzem freundlicherweise ein Exemplar der Ausgabe als Geschenk zugegangen war, machte ich mich an die Internetrecherche, um herauszufinden, was im World Wide Web zu Richalm Neues zu finden war. Ermitteln konnte ich mit Hilfe von Google Book Search zwei Schmidt unbekannt gebliebene Handschriften der Kurzform in Luxemburg und Padua. Bei der Mitüberlieferung dieser Kurzform stellte sich Johannes von Dambachs ‘Consolatio theologiae’ als wichtig heraus (4 von 7 Hss.). In der Pariser Handschrift konnte ein bislang unbekannter Textzeuge eines Traktats des Dirk von Herxen als Mitüberlieferung identifiziert werden.
Ich gebe eine Übersicht über die gesamte Überlieferung, da in den meisten Fällen Handschrifternbeschreibungen verlinkbar sind, die es ermöglichen, sich sofort einen Eindruck vom Inhalt der Handschrift zu verschaffen.
a) Vollständige Handschriften
Die Reihenfolge orientiert sich an der Chronologie der Handschriften.
Universitätsbibliothek Innsbruck, Cod. 36, Bl. 166ra-195vb (I), Pergament
Nach Schmidt S. XLIX, der sich der sehr gründlichen Beschreibung von Walter Neuhauser 1987 anschließt, “zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, aus den Zisterzen Stams oder Kaisheim”. Die älteste und beste Handschrift: “I bietet den Text ausführlicher und präziser als die anderen Handschriften” (S. LXIII). Sie ist im Stamser Katalog von 1341 nicht nachweisbar, trägt aber einen gotischen Stamser Einband aus dem 14. Jahrhundert. Seit 1808 ist sie in Innsbruck. Die Alternative der Entstehung in Kaisheim bezieht sich auf Neuhausers Ermittlungen zur Überlieferung des anderen Textes der Handschrift (Pseudo-Johannes Chrysostomus), als dessen Vorlage Neuhauser Clm 7945 (14. Jahrhundert, aus Kaisheim) annimmt.
Stadtbibliothek Trier, Cod. 581/1519, Bl. 54r-123v (T), Pergament
“Anfang des 15. Jahrhunderts, aus der Trierer Kartause St. Alban” (S. LII). Die Beschreibung Keuffers 1900 ist online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0731_b037_jpg.htm
Schmidt erwähnt nicht den von Keuffer nicht identifizierten, und nur mit einem ungenügenden Incipit “Fuit quedam” bezeichneten Text “De Magareta reclusa” Bl. 132-178. Er ist noch zu bestimmen.
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 7723, Bl. 1r-57r (M1)
Datiert Bl. 57r 1430, als Provenienz gibt Schmidt S. Lf. das Augustinerchorherrenstift Indersdorf an. Der einzige Textzeuge ohne Mitüberlieferung.
Der Katalog von Halm ist nichtssagend:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008267/images/index.html?seite=195
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 18595, Bl. 109-164 (M3)
(Teg. 595) 4o. s. XV. 204 f.
Vincentii de Friburga expositio canonis missae. f. 109 Richalmi abbatis reuelationes. f. 165 (Udalrici episcopi Brixiensis summula mysteriorum missae) ’Manuale simplicium sacerdotum libros non habentium’. Beschreibung von Halm 1878:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008254/images/index.html?seite=195
Schmidt S. LI nennt als Datierung ebenfalls nur das 15. Jahrhundert und als Provenienz die Benediktinerabtei Tegernsee, in deren Bibliothekskatalog 1483 von Ambrosius Schwerzenbeck (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz IV, 2, München 1979, S. 838) der Codex verzeichnet werde. Dagegen nennt Hannes Obermair im Artikel über den Brixener Bischof Ulrich Putsch (gest. 1437) im Verfasserlexikon 2. Aufl. 7 (1989), Sp. 926 bei der Überlieferung des ‘Manuale simplicium’ von Putsch als Datierung “vor 1439" und als Herkunft das Kloster Stams. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Obermair wurde diese Angabe von der Redaktion des Verfasserlexikons eingefügt, es könne sich um einen Irrtum handeln.
Der Melker Stiftsbibliothekar Bernhard Pez entdeckte die Tegernseer Handschrift 1717 und legte eine schlechte Abschrift von Romanus Krinner der fehlerhaften Tegernseer Handschrift seiner 1721 erschienenen Edition zugrunde (Anecdotorum thesaurus novissimus, Tomus I, Pars II, Augsburg 1721, Sp. 373-472).
Im versehentlich durch Google online zugänglich gemachten Register des Buchs von Christine Glassner, Neuzeitliche Handschriften aus dem Nachlass der Brüder Bernhard und Hieronymus Pez in der Bibliothek des Benediktinerstiftes Melk, Wien 2008 finde ich: “Richalmus de Speciosa Valle OCist: Liber revelationum 28, Nr. 1, 14r–70v”. Es gibt daher eine Abschrift in Melk, vielleicht diejenige Krinners.
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 17796, Bl. 48r-80r (M2)
(S. Mang 66) 4o. a. 1445-1466. 233
F. 1 et 22 Expositio canonis missae. f. 35 Sententiae philosophorum. f. 37 Georgii filii Grissaphani militis de Ungaria uisiones de purgatorio et paradiso habitae a. 1353. f. 47 Reuelationes factae Hichalmo abbati (de daemonibus). f.79 Collationes pro religiosis. f. 159 Exhortatio ad amatores mundi. f. 165 Articuli quorundam hereticorum carceri mandatorum in Eichstet a. 1461. f. 167 Rudolfi episc. Lauatini nuncii apost. ad Heinricum ep. Ratisb. literae de haeresi noua in dioec. Rat. zum Hösslein prope Egram a. 1466. f. 169 Seneca de remediis fortuitorum. f. 175 Joh. Gerson de X praeceptis, de peccatis et confessione et directione cuiuslibet Christiani, f. 191 confessionale. f. 197 Regula Benedicti. f. 230 Confessionale pro religiosis. f. 232 Interrogationes in confessione a religiosis. Beschreibung von Halm 1878, S. 121f.:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008254/images/index.html?seite=130
Nach Schmidt S. LI 1451 aus dem Augustinerchorherrenstift St. Mang in Regensburg. Schmidts Angabe der Blattzahl “85 Bl.” ist falsch. Laut Katalog sind es 233.
Visiones Georgii, hrsg. von Bernd Weitemeier, Berlin 2006, S. 125 (non vidi).
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Cod. Q 49, Bl. 118a-163a (W)
Schmidt S. LIIf. Der Text wurde wohl am Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts niedergeschrieben. Am ausführlichsten beschrieb den Codex bislang Paul Mitzschke 1889, S. 115-129:
http://books.google.com/books?id=0x0PAAAAYAAJ&pg=PA123 (US-Proxy)
Die Zuschreibung an Johannes Minzenberg als Schreiber ist mit Badstübner-Kizik 1993, S. 9-13 (non vidi) abzulehnen, denn Mitzschkes Vermutung ist doch sehr vage. Die neue Beschreibung durch Matthias Eifler ist noch nicht online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt_weimar.htm
b) Handschriften der Brevis Redactio
Historisches Archiv der Stadt Köln, GB 4̊ 214, Bl. 51r-54v (K1)
Schmidt S. LIII: um 1440-1455 aus dem Besitz der Kölner Kreuzherren. Bl. 37v-54v schrieb der auch sonst als Schreiber nachweisbare Conradus de Grunenberg.
Beschreibung online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0442_b179_JPG.htm
Stadtbibliothek Trier, Cod. 735/286, Bl. 1r-3r (T2)
Schmidt S. LVIIf.: Der Richalm-Text wurde von dem in Büren bei Paderborn tätigen Pleban Johannes Pilter 1461 aus einem Exemplar in Böddeken abgeschrieben. Er schenkte die Handschrift dem Augustinerchorherrenstift Eberhardsklausen.
Beschreibung von Kentenich 1910:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0732_b068_jpg.htm
[Die Handschrift ist im Virtuellen Skriptorium von St. Matthias online.]
Pilter nutzte seine bemerkenswert ausführlichen Schreibervermerke zu einer kleinen Chronik der Zeitereignisse, sie sind überwiegend von Kentenich wiedergegeben. Beschrieben ist die Handschrift auch von Falk Eisermann, ‘Stimulus amoris’, Tübingen 2001, S. 183.
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Cod. nouv. acq. lat. 727, Bl. 24v-29v (P), Pergament
Katalog: Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les années 1900-1902, in: BECh 64 (1903), S. 14:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1903_num_64_1_452310
Zuvor schon H. Omont
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1901_num_62_1_448078
Schmidt S. LVI, dessen Angabe “aus Schöntal (?)” zu streichen ist, da er selbst darauf aufmerksam macht, dass J. Bequet, Révue Bénédictine 76 (1966), S. 148 den Codex unbegründet Schöntal zuschreibt.
Die Beschreibungen und Schmidt, setzen die Pergamenthandschrift ins 15. Jahrhundert. Am Ende des Bandes befindet sich die Unterschrift von Marguerite de Rohan, der Großmutter Franz I. (gest. 1497). Ob dies Schlüsse auf die Entstehung des Bandes zulässt, ist unklar.
Der von Schmidt nicht identifizierte Traktat ‘De vanitate rerum mundanarum’, der dem Richalm-Text vorausgeht, ist die ‘Epistola contra detractores monachorum’, die auch in einer Kölner Handschrift begegnet:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0038_b109_JPG.htm
Ebenso in einer verschollenen Berliner Handschrift:
http://dtm.bbaw.de/HSA/Berlin_Graupe_700287840000.html
Teilweise in einer Kölner Handschrift:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0442_b106_JPG.htm
Mit der Pariser Handschrift liegt daher ein weiterer Textzeuge für den auch als ‘De utilitate monachorum’ bekannten Traktat des Dirk von Herxen (1381-1457), Rektor des Fraterhauses zu Zwolle, vor, den Marcel Haverals 1992 nach drei Handschriften (einer Antwerpener - Museum Plantin-Moretus M 107 - und den beiden Kölnern) edierte:
http://books.google.com/books?id=U-P6G5t-ZHMC&pg=PA241
Drei weitere Handschriften ergänzte nach Van Engen
http://books.google.com/books?id=Pxr7zsnBhvgC&pg=PA365
Theo Klausmann, Consuetudo, 2003, S. 116-118. Die Auskunft QuestionPoint in München half weiter, denn sie sah bei Klausmann S. 116, Anm. 107 für mich nach: Dort nennt der Verfasser zusätzlich “die Codices Trier, Bistumsarchiv, 95, 117, Düsseldorf, UB, B 64, fol. 102r-122r und Berlin,SB, Cod. 437, fol. 59r-69v” (ein auch in Manuscripta Mediaevalia erfasster Mischband, dort als Hdschr. 437 bezeichnet).
Damit sind nun sieben erhaltene und eine verschollene Handschrift des Werks von Herxen nachgewiesen.
Stadtbibliothek Trier, Cod. 195/1214, Bl. 141vb-142vb (T1)
Von Schmidt S. LVII und Petrus Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier, Berlin 1996, S. 189f.
http://books.google.com/books?id=6cE-4yYXtbQC&pg=PA189
nur allgemein ins 15. Jahrhundert gesetzt. Provenienz ist die Benediktinerabtei St. Eucharius/St. Matthias. Beschreibung Keuffers 1891:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0728_b113_jpg.htm
Biblioteca Antoniana Padua, Cod. Scaff. V Nr. 93
Nicht bei Schmidt. Der Text wird einem “Remigius” zugeschrieben, in dem Lebeuf, dem Handschriftenkatalog von 1842 folgend, Remigius von Auxerre sehen wollte:
http://books.google.com/books?id=aCQKAAAAIAAJ&pg=PA383
In dem Band L'école carolingienne d'Auxerre, Paris 1991, S. 498 (leider konnte ich nicht ermitteln, wer für diese Seite verantwortlich zeichnet, da Google sinnigerweise das Inhaltsverzeichnis nicht zugänglich macht)
http://books.google.com/books?id=YtQ8kcZcZ7wC&pg=PA498
wird der richtige Hinweis auf Richalm (und die Trierer Handschrift 195=T1) gegeben. Sowohl das Incipit “Horrendum est nos contra hostes” als auch die Mitüberlieferung (Johannes von Dambach) schließen jeden Zweifel aus, dass es sich um die Brevis Redactio handelt.
Beschreibungen:
Luigi M. D. Minciotti, Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella Biblioteca di Sant'Antonio, Padua 1842, S. 40
http://books.google.com/books?id=oq6X3Sg7RnEC&pg=PA40
Antonio Maria Josa, I codici manoscritti della Biblioteca Antoniana di Padova, Padua 1886, S. 219
http://books.google.com/books?id=UqdSS73xBSAC&pg=PA219 nur mit US-Proxy
[ http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=25039 ]
Bibliothèque nationale de Luxembourg, Cod. 57, Bl. 298-302
Nicht bei Schmidt. Von der Geschichte der Handschrift aus dem 15. Jahrhunderts ist nur bekannt, dass sie im 17. Jahrhundert den Luxemburger Jesuiten gehörte.
Beschreibung von Nicolas van Werveke, Catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliothèque de Luxembourg, Luxembourg 1894, S. 131f.
http://www.luxemburgensia.bnl.lu/cgi/luxonline1_2.pl?action=fv&sid=bnl_manu&vol=01&page=132&zoom=3
Fol. 298: Visiones beati Richalmi abbatis. Horrendum est nobis contra hostes invisibiles pugnare et nichil vel parum de insidiis eorum congnoscere; unde non pingit (sic) me vel ad me ipsius vel ad aliorum utilitatem revelaciones factas beate memorie abbati Richalmo quas ex opere eius diversis vicibus scripsi, hic simul conscribere, ut aliqua caliditatis demoniace vestigia quasi palpando possimus deprehendere. Igitur ad narracionem accedamus.
Dixit abbas Richalmus: In missa ..... — Fol. 302 : et non magis vult hiis semper intendere.
Historisches Archiv der Stadt Köln, Cod. W 33, Bl. 235v-238r (K2)
Schmidt S. LIII: “um 1550-1560, aus der Kölner Kartause”. Der Text ist im Vergleich zu den Schmidt bekannten anderen Handschriften der Brevis Redactio unvollständig.
Beschreibung von Vennebusch 1986:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0089_b009_jpg.htm
c) Exzerpte aus dem 17. Jahrhundert
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod. HB XV 68, Bl. 442r (S)
Beschreibung:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0073_b037_JPG.htm
Kollektaneen des Schöntaler Mönchs und Historiographen Bartholomäus Kremer, geschrieben zwischen ca. 1630 und 1651 (Schmidt S. LVII). Das Exzerpt (Cap. 130) steht I nahe. Vermutlich geht es auf die in Stams 1634/6 angefertigte Kopie aus I durch den Schöntaler Konventualen Edmund Reinhold zurück, die nicht erhalten ist.
Staatsarchiv Ludwigsburg, B 503 II Bü 10
Die Signatur von Schmidt (B 503 Nr. 10) wurde anhand des Online-Findbuchs korrigiert.
Schmidt S. LIII-LVI: Die Auszüge in Pater Angelus Hebenstreits ‘Chronicon abbatum monasterii Speciosae Vallis’ (1664) folgen der Handschrift aus Stams (I), auch wenn in einem Fall auch eine Lesart aus der verlorenen Exzerpthandschrift der Mainzer Kartause vermerkt wird.
d) Verlorene Handschriften
Augustinerchorherrenstift Böddeken
Carolus de Visch nennt in seinem ‘Auctarium’ 1665 die Handschrift (Schmidt S. LIX) und nennt sie vollständig im Gegensatz zu der Mainzer Handschrift. Eine Böddeker Handschrift war die Vorlage für Johannes Pilters Abschrift T2 (1461), doch wird man anders als Schmidt bezweifeln müssen, dass ein so kurzes Exzerpt wie die Brevis Redactio von Visch als vollständig bezeichnet worden wäre. Man hätte also mit zwei Codices in Böddeken zu rechnen, mit einer Vollhandschrift und einer Version der Brevis Redactio.
Kartause Erfurt
Schmidt S. LIXf.: Richalms Werk ist im Bibliothekskatalog der Erfurter Kartause vom Ende des 15. Jahrhunderts zu finden (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 2, 1928, S. 433).
Kreuzherren Köln
Schmidt S. LX: Erwähnung in einem ausradierten Inhaltsverzeichnis Köln, Historisches Archiv, GB 8̊ 87, Bl. 30r einer im 15. Jahrhundert aufgelösten Handschrift, von der kleine Teile in dieser Handschrift (wohl Mitte 15. Jahrhundert) erhalten sind. An ihr war der Schreiber von K1, Grunenberg, beteiligt. Vennebusch 1993, S. 84:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0039_b084_JPG.htm
Im Kreuzherrenkloster gab es also zwei Handschriften.
Kartause Mainz
Diese Handschrift erwähnt nicht nur de Visch 1665 (Schmidt S. LIX Anm. 65: mutila), sondern auch Hebenstreit 1664 (zitiert bei Schmidt S. LV): “rursus in Carthusia Moguntina, sed incompletum et in epitomem redactum, per quendam religiosum Ordinis Praedicatorum, ut apparet, Conventus Mariaevallensis vel Wimpinensis, qui plura ad litteram, et inter ea favorem de osculatis a BeatissimaVirgine Richalmi pedibus, transcripsit ex authore Schöntalensis et in usum Concionatorum selegit”. Die Handschrift wurde vom Prior der Karthause damals an Schöntal zur Abschrift überlassen. Schmidt zitiert das Zeugnis zwar, verwertet es aber nicht. Da er nur die Überlieferung der Brevis Redactio auflistet, aber nicht ihren Textbestand und auch keine Varianten gibt, bleibt offen, ob wir im für Predigtzwecke angelegten Werk des Wimpfener Dominikaners womöglich die Brevis Redactio sehen dürfen. Dass Johannes von Dambach, mit dessen Consolatio die meisten Handschriften der Kurzform überliefert werden, ebenfalls Dominikaner war, soll angemerkt werden.
Regularkanoniker Tongern
Schmidt S. LIX: Nach de Vischs Zisterzienserbibliographie von 1656 besaßen sie einen Codex. Antoine Sanderus, Bibliotheca belgica manuscripta, Bd. 2, Lille 1641, S. 195 nannte das Werk in einer 1638 erstellten Bibliotheksliste. Es handelt sich um Windesheimer Augustinerchorherren.
Abschließende Bemerkungen zur Überlieferung
An der Überlieferungsgeschichte des Textes war Schmidt leider nur wenig interessiert. Man erfährt eigentlich gar nichts über die Brevis Redactio. Schmidt hat nur die vollständigen Handschriften kollationiert. Gern hätte man auch erfahren, wie K1 den Richalm-Text einleitet - es steht nicht bei Schmidt (und nur unvollständig bei Vennebusch), aber in einem Google-Schnipsel:
http://tinyurl.com/c2542u
Schmidt gibt keinen Hinweis darauf, dass auch die Trierer Handschrift T1 neben K2 die Consolatio theologiae des Johannes von Dambach überliefert. Auers Monographie von 1928 habe ich leider nicht zur Hand, ich muss mich auf das stützen, was die Kataloge dazu sagen.
Die Abfolge in T1 ist nach Petrus Becker:
Bl. 115v-136r Consolatio theologiae
Bl. 136r-141v Ps.-Petrus von Blois: De utilitate tribulationum
Bl. 141v-142v Richalm
Die gleiche Abfolge findet sich auch in der Luxemburger Handschrift:
Bl. 196v-277v Consolatio theologiae
Bl. 278r-297v Ps.-Petrus von Blois: De utilitate tribulationum
Bl. 298r-302r Richalm
Im Codex aus Padua folgt Richalm auf die Consolatio, während in K2 die Consolatio und Richalm durch einen Text aus Gregors Homiliae getrennt werden. In vier von den sieben Handschriften der Brevis Redactio wird also das Werk des weit verbreitete Dominikaners Johannes von Dambach mitüberliefert. Ohne zu wissen, was die Brevis Redactio aus Richalm exzerpiert hat, wären allerdings weitere Aussagen über die Verwandtschaft der Consolatio und der Brevis Redactio pure Spekulation.
Erwähnt sei auch noch die eigenartige Textzusammenstellung in P, das nur 32 Blatt umfasst. Nach dem Herxen-Text, der Devotio moderna zuzuweisen, folgen die Brevis Redactio und danach französische Rondeaux!
Schmidt verweist S. LXIV bei T und W auf die monastischen Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts. In der Tat fällt auf, dass die Überlieferung des 15. Jahrhunderts, soweit die Handschriften zuzuordnen sind, auf Kartäuser, regulierte Chorherren und Benediktiner zurückzuführen ist.
Die Pergamenthandschrift T aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammt aus der Trierer Kartause, K2 aus der Kölner; verlorene Handschriften sind für die Kartausen Mainz und Erfurt belegt. Über die Affinität der Kartäuser zur Visionsliteratur handelte Johannes Mangei, in: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser, 2001:
http://books.google.com/books?id=Q7Y5Z1RuOIgC&pg=PA313
M1 stammt aus Indersdorf, dem wichtigsten oberdeutschen Reformzentrum der Kanonikerreform im 15. Jahrhundert. In Böddeken bei Paderborn gab es wohl zwei Handschriften des Werks. Auf die Devotio moderna verweisen nicht nur die Handschriften aus dem Kölner Kreuzherrenkloster, sondern auch der Nachweis einer Handschrift in Tongern und die Mitüberlieferung der vielleicht für eine weltliche Empfängerin bestimmten Pariser Handschrift.
M3 stammt aus dem Benediktinerkloster Tegernsee, ein Zentrum der Melker Reform in Bayern, W aus dem Bursfelder Kloster St. Peter in Erfurt, T1 aus St. Matthias in Trier.
Neben der Ordensreform erscheint mir aber auch jene Bewegung beachtenswert, die man den “Rückgriff des 15. Jahrhunderts auf die früh- und hochmittelalterliche Theologie und Spiritualität” nennen könnte. Dieser Rückgriff wurde wesentlich getragen von den Klosterreformen, ist aber auch auf das engste verbunden mit jenem “retrospektiven Syndrom”, das in den Klöstern des 15. Jahrhunderts als “monastischer Historismus” sichtbar wird. Näheres dazu in meiner Studie über St. Ulrich und Afra in Augsburg:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/
Besonders bemerkenswert ist die Weimarer Handschrift W, die hagiographische Texte aus dem Umkreis der Hirsauer Reform enthält: die Vita Wilhelms von Hirsau (zur Überlieferung sehe man meinen eben zitierten Aufsatz S. 140f.), Sigebotos Vita der heiligen Paulina (von Paulinzella) und die Vita Erminolds von Prüfening. In der Kreuzbrüderhandschrift K1 begegnen Texte von Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau.
III. Zur Rezeption von Richalms Werk
Schmidt S. XXXVI-XLIX handelt erfreulich ausführlich von “Rezeption und Forschungsstand”. Wer sich über die ganze Breite der Richalm-Rezeption ein Bild machen will, kann in Google Book Search nach richalm, richalmi oder richalmus suchen. Üblicherweise erscheint der Schöntaler Abt als “Gewährsmann für die kollektive Vorstellung von der Vielzahl der Teufel im Mittelallter” (S. XLIV). Beispielsweise bei Elias Canetti, William Gaddis, Carl Sagan oder Salman Rushdie.
Schmidt hat die wohl wichtigsten Werke ausgewählt. Besonders einflussreich erscheint die 1869 erschienene Geschichte des Teufels von dem protestantischen Theologen Roskoff, die auch die umfangreichsten deutschsprachigen Auszüge aus dem Text enthält (S. 335-343 der Originalausgabe) . Die Ausgabe ist einsehbar unter
http://www.archive.org/details/geschichtedesteu01roskuoft
http://books.google.com/books?id=kjYCAAAAQAAJ&pg=PA335 (mit US-Proxy)
Einen Hinweis verdient vielleicht auch Friedrich von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, Bd. 6, 3. Aufl. 1858, S. 538f., der kürzere Auszüge auf Deutsch gab:
http://books.google.com/books?id=T8ZWAAAAMAAJ&pg=PA538
Was in den “Blättern für literarische Unterhaltung” 1838 S. 460 aus Richalms Werk auf Deutsch zu lesen war, stimmt damit überein und dürfte einer Vorauflage entnommen sein:
http://books.google.com/books?id=7-QaAAAAYAAJ&pg=PA460
Schmidts Edition wird erfreulicherweise in einigen Jahren auf http://www.dmgh.de kostenfrei zur Verfügung stehen (es sei denn, die MGH ändert ihren Sinn). Wünschenswert wäre eine deutsche Übersetzung, da der Text nicht nur für jene von Interesse ist, die über hinreichende Lateinkenntnisse verfügen. Dem Editor ist für seine jahrelange Mühe mit dem Text sehr zu danken, der MGH, dass sie ihn in ihr Editionsprogramm aufgenommen hat, denn dies sichert ihm die nötige Publizität.
How to quote this entry?
Graf, Klaus. Neues zu Richalm von Schöntal. Archivalia . 2009-05-03. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5680268/. Accessed: 2009-05-03. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5gVVWEu0f )
#forschung
Richalm von Schöntal, Liber revelationum. Hrsg. von Paul Gerhard Schmidt (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 24). Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2009. LXXIV, 230 S.
http://www.mgh.de/home/aktuelles/newsdetails/richalm-von-schoental-liber-revelationum/47df5adc8b/
[Ausgabe jetzt online:
http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00066357_meta:titlePage.html?sortIndex=060:010:0024:010:00:00 ]
Nachdem der spannende Text bislang nur durch die schlechte und unvollständige Edition des Melker Benediktiners Bernhard Pez (1721) zugänglich war, sind nun die besten Voraussetzungen geschaffen, ihn erneut zu entdecken.
Richalms in Dialogform abgefasstes Buch gilt vor allem der Wahrnehmung von Dämonen durch den Schöntaler Zisterzienser: “Auditionen und Visionen bestimmten sein Leben. Er sah sich von Scharen von Teufeln umringt, die so zahlreich wie Schneeflocken in einem Wintersturm, wie Sandkörner am Meeresstrand und wie Wassertropfen bei einem Gewitterregen ihn überall umgaben, jeden seiner Schritte überwachten und ihn überallhin verfolgten (Kap. 46, 61)” (Schmidt S. XVI).
Aus der Sicht der mittellateinischen Philologie die Edition zu rühmen, will ich Berufeneren überlassen. Ich möchte mich auf drei Punkte konzentrieren, zu denen ich etwas ergänzen kann: auf die Lebenszeugnisse Richalms (I), die handschriftliche Überlieferung (II) und die Rezeption (III).
I. Zu den Lebenszeugnissen Richalms
Bis in die jüngste Zeit hält sich die auf den Abdruck von Pez zurückgehende Datierung des Werks auf 1270, obwohl schon im 19. Jahrhundert bekannt war, dass Richalms Abbatiat in die Zeit um 1219 gehört.
Zum in der Mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten Kloster Schöntal siehe die Online-Fassung des Württembergischen Klosterbuchs:
http://maja.bsz-bw.de/kloester-bw/kloster1.php?nr=134
Nur eine einzige Urkunde vom 22. November 1219, ausgestellt von Bischof Otto von Würzburg, nennt Richalm als Abt (“ex insinuatione dilecti nostri domini Richalmi abbatis et fratrum de Schonental, Cisterciensis ordinis”). Sie wurde im dritten Band des “Wirtembergischen Urkundenbuchs” (WUB) 1871 als Nr. 622 abgedruckt:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=946
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_089.jpg
In einer Urkunde vom 21. September 1214 (WUB 3, Nr. 561) erscheint Richalm noch als Prior:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=867
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_010.jpg
Es gibt also genau zwei urkundliche Nennungen Richalms.
Am 16. Juli 1216 amtierte noch sein Vorgänger Albert (WUB 3, Nr. 592), in einer nicht näher datierten Urkunde aus dem Jahr 1220 erscheint ein Gottfried als Klostervorsteher: WUB 3, Nr. 633 (Schmidt S. XII Anm. 9 hat den Druckfehler 363 statt 633):
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=963
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_105.jpg
Aus Richalms Werk geht hervor, dass er einmal als Prior zurückgetreten ist (Kap. 55, Schmidt S. 67). Man muss also mit der Möglichkeit rechnen, dass er nach wenigen Jahren als Abt - hierfür kommt maximal der Zeitraum von 1216 bis 1220 in Betracht - dieses Amt ebenfalls aufgegeben hat. Er könnte also durchaus länger als bis 1219 - so das in der Tradition überwiegend angegebene Todesjahr - gelebt haben.
Schmidt S. XI mit Anm. 4 ordnet Richalm aufgrund seines sehr seltenen Namens mit guten Gründen einer Ministerialenfamilie des Bischofs von Würzburg zu. Rätselhaft bleibt aber, wieso Schmidt das stärkste Indiz nicht anspricht, nämlich das Auftreten der Richalme mit Beinamen Hake in Schöntaler Urkunden! 1214 erscheint Richalmus Hacho als Zeuge bei einer Schenkung an Schöntal (WUB 3, Nr. 560), 1230 der miles Richalmus Hako gemeinsam mit Abt Gottfried (ebd. Nr. 777). 1233 treten die Brüder Richalm und Gottfried Haken als Salmänner bei einem Vermächtnis zugunsten von Schöntal auf (WUB 3, Nr. 831). Man wird in ihnen Verwandte von Abt Richalm sehen dürfen, auch wenn es sicher zu weit geht, Richalms Nachfolger Gottfried aufgrund seines Vornamens der gleichen Familie zuzuweisen.
Eine zusammenhängende kritische Auseinandersetzung mit der Schöntaler Tradition zu Richalm bietet Schmidt leider nicht. Man muss sich das Material aus verschiedenen Stellen seiner Einleitung zusammensuchen.
Vor dem 17. Jahrhundert scheint es keine Nachrichten zu Richalm zu geben, sieht man von der Translation von Richalm-Reliquien aus Mergenthal nach Schöntal unter Abt Konrad II. (1365-1371) ab, die Schmidt S. XXXVIII Anm. 30 leider ohne Quellenangabe erwähnt. S. XXXVII ist von Richalmreliquien in einer zu Schöntal gehörenden Kapelle in “Mergenthal” die Rede, was eher zutreffen dürfte als eine Translation von Mergenthal nach Schöntal. Ich zweifle nicht daran, dass es sich um die 1371 geweihte Kapelle des Schöntaler Stadthofes im heutigen Bad Mergentheim handelt, von der Schönhuths Chronik der Stadt Mergentheim meldet:
http://books.google.com/books?id=fXwAAAAAcAAJ&pg=PA25
Wenn man etwas weiterblättert, bestätigt sich diese Vermutung, da Schmidt S. LIV angibt, die Chronik von Angelus Hebenstreit (1664) kenne ebenfalls die Tradition, “wonach sich Reliquien im Altar der Schöntaler Kapelle zu Mergentheim befanden”.
Der Schöntaler Historiograph Bartholomäus Kremer (1589-661) schrieb eine große Klosterchronik, die als Handschrift in der Landesbibliothek Stuttgart liegt (Cod. hist. fol. 422), in der sich Kremer nach Schmidt S. XVIII Anm. 19 auf S. 175 über Richalm äußert. Entgegen den Angaben von Schmidt ist das aber nicht der Text, den Franz Josef Mone in seiner Quellensammlung der badischen Landesgeschichte Bd. 4,1, Karlsruhe 1867, S. 146 abdruckte und den Schmidt zitiert (es sei denn, der Text ist in den Handschriften absolut identisch). Mone gab eine vom Geistlichen Rat Grieshaber in Freiburg dem Karlsruher Generallandesarchiv mitgeteilte “Series abbatum” aus dem Jahr 1636 heraus, die er ebenfalls Kremer zuschrieb und die er als älteste Darstellung über Schöntal für wertvoller erachtete als die jüngere Chronik.
http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/258802596/
http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/258802596/images/Mone_Badische_Quellen_4.146.gif
Wenn die Angabe von Kremer in seiner Series zutreffen sollte, dass Richalms Vorgänger Albert auf dem Generalkapitel 1217 verstarb, hätte Richalm erst ab 1217 amtiert. Ansonsten referiert Kremer zu Richalm lediglich drei Urkunden aus seiner Abtszeit, von denen aber nur die erste von 1219 Richalm selbst nennt. Als Todesdatum wird angegeben: 1220 3. nonas Decembris (3. Dezember).
Schmidt zitiert Kremers Wiedergabe einer Urkunde von 1220 und merkt an (S. XVIII Anm. 19): “Die Namen der Zeugen in der zweiten Urkunde begegnen alle in Richalms Werk”. Das wäre ja nun ein durchaus bemerkenswerter Befund, den man nicht in einer Fußnote verstecken sollte. Nun schildert Richalm in Kap. 114 (S. 140) die Totenfeierlichkeiten für den Bruder Fridericus opilio. Wenn Richalm nach Schmidt wohl 1219 gestorben ist, wie konnte er den frühestens 1220 erfolgten Tod eines 1220 in einer Zeugenliste auftretenden Mönchs wiedergeben? Hat hier der Redaktor N., jener Schöntaler Mönch, der das Werk Richalms bearbeitete, seine Finger im Spiel gehabt und womöglich Richalm seine eigenen Erlebnisse untergeschoben? Des Rätsels Lösung ist weit banaler: Es gab gar keine solche Zeugenliste. Die von Kremer referierte Urkunde vom 12. April 1220 ist noch in der Ausfertigung erhalten und im WUB 3, Nr. 642 abgedruckt:
http://www.wubonline.de/index.php?wubid=970
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Wirtembergisches_Urkundenbuch_3_117.jpg
“Fratres Albero caementarius, Fridericus opilio, Herilinus, Adelhardus, Adelboldus caecus” sucht man in der Urkunde vergebens. Mone, der die Schöntaler Urkunden nicht kannte, hat mit seinem interpretierenden Zusatz “[testes]” in die Irre geführt. Kremer gab keine Zeugenliste, sondern, den kurzen Eintrag zu Richalm abschließend, die Namen einiger Mönche an, die in der Zeit des Abtes Richalm lebten und entnahm diese Namen Richalms Werk! Kremer konnte 1636 offenbar schon auf die 1634/36 in Stams erstellte Abschrift des Schöntaler Mönchs Reinhold zurückgreifen, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass damals in Schöntal noch eine Handschrift greifbar war. Albero cementarius wird in Kap. 113 (Schmidt S. 140) erwähnt, Fridericus opilio in Kap. 114 (S. 140), Adelhardus in Kap. 31 (S. 36), Adelholdus cecus in Kap. 37 (S. 45). In Kap. 115 (S. 142) hört Richalm beim Tod des Bruders “He.” eine Stimme: “Hic est Heinzelinus”. Schmidts Variantenapparat gibt Auskunft, dass nur die Innsbrucker (früher Stamser) Handschrift, Vorlage der Abschrift Reinholds, “Herilinus” hat, alle anderen lesen Heinzelinus (mit orthographischen Abweichungen).
Sehr viel ausführlicher als Kremer beschäftigte sich Pater Angelus Hebenstreit (1626-1669) in seiner Schöntaler Chronik von 1664 mit Richalm. Schmidt S. LIV-LVI wertet diese Quelle aus, ohne sie jedoch kritisch zu analysieren. Angeblich war Richalm schon vor 1194 Novize in Schöntal. Die Ämterlaufbahn (Pförtner, Hospitalaufseher, Novizenmeister, Prior) scheint aus dem Werk erschlossen zu sein (vgl. Schmidt S. XI). Nach längerem Abwägen entscheidet sich Hebenstreit für den 2. Dezember 1219 als Todestag Richalms. Da Hebenstreit auch das im Pfarrarchiv Schöntal aufbewahrte “Mortilogium” von 1660 redigierte, auf das sich Schmidt S. XII Anm. 8 nach Mitteilung von Frau Dr. Maria Magdalena Rückert (Germania-Sacra-Bearbeiterin Schöntals) beruft, wundert es nicht, dass dort das Jahr 1219 und als Todestag der 2. Dezember angegeben wird. Ein älteres Anniversarienregister erwähnt Mone a.a.O. S. 143 nach Erwähnungen in der Zeitschrift “Wirtembergisch Franken”, doch dürfte Richalm darin nicht erwähnt werden. Den 2. Dezember 1219 erhielt im 17. Jahrhundert Gabriel Bucelin aus Schöntal mitgeteilt (Schmidt S. XXXVIII Anm. 30 zitiert die von Robert Schindele besorgte postume Ausgabe des “Menologium”-Supplements 1763, S. 276). Von Bucelin gelangte das Datum in Stadlers Heiligenlexikon:
http://www.zeno.org/Heiligenlexikon-1858/A/Richalmus
Ein 1698 verfasster Abtskatalog von Prior Joseph Müller und Richard Stöcklein (Stuttgart, Cod. Donaueschingen 600, Bl. 32r) schreibt Richalm ein Wappen und einen Wahlspruch zu, weiß von einem Distichon auf Richalm, gibt das Jahr 1200 als Beginn seines Priorats an und datiert die Wahl zum Abt auf 1216 (Schmidt S. XVIIIf.). Da das Wappen sicher nicht authentisch ist, wird man auch die detaillierten Angaben nicht gebrauchen können; sie verdanken sich offensichtlich dem Wunsch, die bisher bekannten allzu mageren Daten zu ergänzen und dürften erfunden sein, da nicht ersichtlich ist, welche hochmittelalterliche Quelle ihnen hätte zugrundeliegen können.
Hinsichtlich des Todesdatums steht nun der 3. Dezember 1220 bei Kremer 1636 gegen die sich später durchsetzende Hebenstreit-Version: 2. Dezember 1219. Letztere ist ja das Produkt gelehrter Erörterungen, während bei ersterer hinsichtlich des Todesjahrs nicht ausgeschlossen werden kann, dass Kremer sich an der Erwähnung von Richalms Nachfolger 1220 orientiert hat. Solange keine älteren oder neuen Quellen auftauchen, sollte man dem ältesten überlieferten Tagesdatum Priorität einräumen: 3. Dezember (eventuell auch: 2. Dezember). Beim Todesjahr erscheint ein “möglicherweise 1219/20, unter Umständen auch später” angebracht.
Dem Hinweis von Hermann Knaus in den Mittelalterlichen Bibliothekskatalogen 4/2 (1979), S. 872 ( auf den ich Schmidt 1989 aufmerksam machte) auf Notizen des 18. Jahrhunderts über Richalm in einer Handschrift der UB Würzburg ist Schmidt entweder nicht nachgegangen oder er erwies sich nicht als ergiebig. Nachrichten zur Geschichte Schöntals aus dem 17./18. Jahrhundert enthält UB Würzburg M.ch.f.258:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0371_b083_JPG.htm
Im Schöntaler Bestand B 503 II des Staatsarchivs Ludwigsburg gibt es eine Reihe historiographischer Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die von Schmidt nicht erwähnt werden, in denen aber mehr oder minder ausführliche Angaben über Richalms Abtszeit nicht fehlen dürften:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=17307&klassi=001&anzeigeKlassi=001.001.001
II. Zur Überlieferung des “Liber revelationum” Richalms von Schöntal
Zuerst wurde ich selbst auf Richalm Mitte der 1980er Jahre aufmerksam, als ich Norman Cohns “Europe’s Inner Demons” (1975) las, eine eindrucksvolle Studie zu den Wurzeln der Hexenprozesse. Dann begegneten mir Mones Notizen in seiner Quellensammlung, und ich stieß auch auf das Heldensagenzeugnis zu Sibicho in Grimms Heldensage (vgl. Schmidt S. XXXIX):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Die_deutsche_Heldensage_(Grimm_W.)_221.jpg
Besser dazu Müllenhoff in der ZfdA 12 (1865), S. 354f.
http://books.google.com/books?id=rPvgclbws1kC&pg=PA355
Nachdem ich erfahren hatte, dass Paul Gerhard Schmidt den Verfasserlexikon-Artikel zu Richalm übernommen hatte, wandte ich mich am 8. Januar 1989 an ihn. Schmidt sandte mir am 13. Februar sein Manuskript (“die Neuedition steht vor dem Abschluß”), worauf ich ihm einen Tag später meine gesammelten Notizen mitteilte. Der Hinweis auf die Kölner Handschrift GB 4̊ 214 erschien dann in Schmidts Richalm-Artikel in der Lieferung 1 von Bd. 8 des Verfasserlexikons 1990 (Sp. 42f.) mit meinem Namen, während er sich von der irreführenden Bezeichnung der Exzerpte (von ihm in der Edition jetzt brevis redactio genannt) als “Fragmente” nicht abbringen ließ. Clm 151, 245v-248r (aus Rebdorf, 1456), das unter den “Fragmenten” gelistet ist, hat mit Richalm nichts zu tun (siehe Carmen Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge 1200-1400, Leiden 2007, S. 359 nach Autopsie). Es fehlten die Innsbrucker Handschrift, die zweite Kölner, die Pariser und die Hebenstreit-Chronik in Ludwigsburg. 1987 war Neuhausers Innsbrucker Handschriftenkatalog erschienen, in dem ich am 3. November 1989 die ehemals Stamser Handschrift fand. Noch am gleichen Tag teilte ich das Schmidt mit, was für ihn eine “freudige Überraschung” war.
Nachdem mir vor kurzem freundlicherweise ein Exemplar der Ausgabe als Geschenk zugegangen war, machte ich mich an die Internetrecherche, um herauszufinden, was im World Wide Web zu Richalm Neues zu finden war. Ermitteln konnte ich mit Hilfe von Google Book Search zwei Schmidt unbekannt gebliebene Handschriften der Kurzform in Luxemburg und Padua. Bei der Mitüberlieferung dieser Kurzform stellte sich Johannes von Dambachs ‘Consolatio theologiae’ als wichtig heraus (4 von 7 Hss.). In der Pariser Handschrift konnte ein bislang unbekannter Textzeuge eines Traktats des Dirk von Herxen als Mitüberlieferung identifiziert werden.
Ich gebe eine Übersicht über die gesamte Überlieferung, da in den meisten Fällen Handschrifternbeschreibungen verlinkbar sind, die es ermöglichen, sich sofort einen Eindruck vom Inhalt der Handschrift zu verschaffen.
a) Vollständige Handschriften
Die Reihenfolge orientiert sich an der Chronologie der Handschriften.
Universitätsbibliothek Innsbruck, Cod. 36, Bl. 166ra-195vb (I), Pergament
Nach Schmidt S. XLIX, der sich der sehr gründlichen Beschreibung von Walter Neuhauser 1987 anschließt, “zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, aus den Zisterzen Stams oder Kaisheim”. Die älteste und beste Handschrift: “I bietet den Text ausführlicher und präziser als die anderen Handschriften” (S. LXIII). Sie ist im Stamser Katalog von 1341 nicht nachweisbar, trägt aber einen gotischen Stamser Einband aus dem 14. Jahrhundert. Seit 1808 ist sie in Innsbruck. Die Alternative der Entstehung in Kaisheim bezieht sich auf Neuhausers Ermittlungen zur Überlieferung des anderen Textes der Handschrift (Pseudo-Johannes Chrysostomus), als dessen Vorlage Neuhauser Clm 7945 (14. Jahrhundert, aus Kaisheim) annimmt.
Stadtbibliothek Trier, Cod. 581/1519, Bl. 54r-123v (T), Pergament
“Anfang des 15. Jahrhunderts, aus der Trierer Kartause St. Alban” (S. LII). Die Beschreibung Keuffers 1900 ist online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0731_b037_jpg.htm
Schmidt erwähnt nicht den von Keuffer nicht identifizierten, und nur mit einem ungenügenden Incipit “Fuit quedam” bezeichneten Text “De Magareta reclusa” Bl. 132-178. Er ist noch zu bestimmen.
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 7723, Bl. 1r-57r (M1)
Datiert Bl. 57r 1430, als Provenienz gibt Schmidt S. Lf. das Augustinerchorherrenstift Indersdorf an. Der einzige Textzeuge ohne Mitüberlieferung.
Der Katalog von Halm ist nichtssagend:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008267/images/index.html?seite=195
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 18595, Bl. 109-164 (M3)
(Teg. 595) 4o. s. XV. 204 f.
Vincentii de Friburga expositio canonis missae. f. 109 Richalmi abbatis reuelationes. f. 165 (Udalrici episcopi Brixiensis summula mysteriorum missae) ’Manuale simplicium sacerdotum libros non habentium’. Beschreibung von Halm 1878:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008254/images/index.html?seite=195
Schmidt S. LI nennt als Datierung ebenfalls nur das 15. Jahrhundert und als Provenienz die Benediktinerabtei Tegernsee, in deren Bibliothekskatalog 1483 von Ambrosius Schwerzenbeck (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz IV, 2, München 1979, S. 838) der Codex verzeichnet werde. Dagegen nennt Hannes Obermair im Artikel über den Brixener Bischof Ulrich Putsch (gest. 1437) im Verfasserlexikon 2. Aufl. 7 (1989), Sp. 926 bei der Überlieferung des ‘Manuale simplicium’ von Putsch als Datierung “vor 1439" und als Herkunft das Kloster Stams. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Obermair wurde diese Angabe von der Redaktion des Verfasserlexikons eingefügt, es könne sich um einen Irrtum handeln.
Der Melker Stiftsbibliothekar Bernhard Pez entdeckte die Tegernseer Handschrift 1717 und legte eine schlechte Abschrift von Romanus Krinner der fehlerhaften Tegernseer Handschrift seiner 1721 erschienenen Edition zugrunde (Anecdotorum thesaurus novissimus, Tomus I, Pars II, Augsburg 1721, Sp. 373-472).
Im versehentlich durch Google online zugänglich gemachten Register des Buchs von Christine Glassner, Neuzeitliche Handschriften aus dem Nachlass der Brüder Bernhard und Hieronymus Pez in der Bibliothek des Benediktinerstiftes Melk, Wien 2008 finde ich: “Richalmus de Speciosa Valle OCist: Liber revelationum 28, Nr. 1, 14r–70v”. Es gibt daher eine Abschrift in Melk, vielleicht diejenige Krinners.
Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 17796, Bl. 48r-80r (M2)
(S. Mang 66) 4o. a. 1445-1466. 233
F. 1 et 22 Expositio canonis missae. f. 35 Sententiae philosophorum. f. 37 Georgii filii Grissaphani militis de Ungaria uisiones de purgatorio et paradiso habitae a. 1353. f. 47 Reuelationes factae Hichalmo abbati (de daemonibus). f.79 Collationes pro religiosis. f. 159 Exhortatio ad amatores mundi. f. 165 Articuli quorundam hereticorum carceri mandatorum in Eichstet a. 1461. f. 167 Rudolfi episc. Lauatini nuncii apost. ad Heinricum ep. Ratisb. literae de haeresi noua in dioec. Rat. zum Hösslein prope Egram a. 1466. f. 169 Seneca de remediis fortuitorum. f. 175 Joh. Gerson de X praeceptis, de peccatis et confessione et directione cuiuslibet Christiani, f. 191 confessionale. f. 197 Regula Benedicti. f. 230 Confessionale pro religiosis. f. 232 Interrogationes in confessione a religiosis. Beschreibung von Halm 1878, S. 121f.:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008254/images/index.html?seite=130
Nach Schmidt S. LI 1451 aus dem Augustinerchorherrenstift St. Mang in Regensburg. Schmidts Angabe der Blattzahl “85 Bl.” ist falsch. Laut Katalog sind es 233.
Visiones Georgii, hrsg. von Bernd Weitemeier, Berlin 2006, S. 125 (non vidi).
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Cod. Q 49, Bl. 118a-163a (W)
Schmidt S. LIIf. Der Text wurde wohl am Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts niedergeschrieben. Am ausführlichsten beschrieb den Codex bislang Paul Mitzschke 1889, S. 115-129:
http://books.google.com/books?id=0x0PAAAAYAAJ&pg=PA123 (US-Proxy)
Die Zuschreibung an Johannes Minzenberg als Schreiber ist mit Badstübner-Kizik 1993, S. 9-13 (non vidi) abzulehnen, denn Mitzschkes Vermutung ist doch sehr vage. Die neue Beschreibung durch Matthias Eifler ist noch nicht online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt_weimar.htm
b) Handschriften der Brevis Redactio
Historisches Archiv der Stadt Köln, GB 4̊ 214, Bl. 51r-54v (K1)
Schmidt S. LIII: um 1440-1455 aus dem Besitz der Kölner Kreuzherren. Bl. 37v-54v schrieb der auch sonst als Schreiber nachweisbare Conradus de Grunenberg.
Beschreibung online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0442_b179_JPG.htm
Stadtbibliothek Trier, Cod. 735/286, Bl. 1r-3r (T2)
Schmidt S. LVIIf.: Der Richalm-Text wurde von dem in Büren bei Paderborn tätigen Pleban Johannes Pilter 1461 aus einem Exemplar in Böddeken abgeschrieben. Er schenkte die Handschrift dem Augustinerchorherrenstift Eberhardsklausen.
Beschreibung von Kentenich 1910:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0732_b068_jpg.htm
[Die Handschrift ist im Virtuellen Skriptorium von St. Matthias online.]
Pilter nutzte seine bemerkenswert ausführlichen Schreibervermerke zu einer kleinen Chronik der Zeitereignisse, sie sind überwiegend von Kentenich wiedergegeben. Beschrieben ist die Handschrift auch von Falk Eisermann, ‘Stimulus amoris’, Tübingen 2001, S. 183.
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Cod. nouv. acq. lat. 727, Bl. 24v-29v (P), Pergament
Katalog: Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les années 1900-1902, in: BECh 64 (1903), S. 14:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1903_num_64_1_452310
Zuvor schon H. Omont
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1901_num_62_1_448078
Schmidt S. LVI, dessen Angabe “aus Schöntal (?)” zu streichen ist, da er selbst darauf aufmerksam macht, dass J. Bequet, Révue Bénédictine 76 (1966), S. 148 den Codex unbegründet Schöntal zuschreibt.
Die Beschreibungen und Schmidt, setzen die Pergamenthandschrift ins 15. Jahrhundert. Am Ende des Bandes befindet sich die Unterschrift von Marguerite de Rohan, der Großmutter Franz I. (gest. 1497). Ob dies Schlüsse auf die Entstehung des Bandes zulässt, ist unklar.
Der von Schmidt nicht identifizierte Traktat ‘De vanitate rerum mundanarum’, der dem Richalm-Text vorausgeht, ist die ‘Epistola contra detractores monachorum’, die auch in einer Kölner Handschrift begegnet:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0038_b109_JPG.htm
Ebenso in einer verschollenen Berliner Handschrift:
http://dtm.bbaw.de/HSA/Berlin_Graupe_700287840000.html
Teilweise in einer Kölner Handschrift:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0442_b106_JPG.htm
Mit der Pariser Handschrift liegt daher ein weiterer Textzeuge für den auch als ‘De utilitate monachorum’ bekannten Traktat des Dirk von Herxen (1381-1457), Rektor des Fraterhauses zu Zwolle, vor, den Marcel Haverals 1992 nach drei Handschriften (einer Antwerpener - Museum Plantin-Moretus M 107 - und den beiden Kölnern) edierte:
http://books.google.com/books?id=U-P6G5t-ZHMC&pg=PA241
Drei weitere Handschriften ergänzte nach Van Engen
http://books.google.com/books?id=Pxr7zsnBhvgC&pg=PA365
Theo Klausmann, Consuetudo, 2003, S. 116-118. Die Auskunft QuestionPoint in München half weiter, denn sie sah bei Klausmann S. 116, Anm. 107 für mich nach: Dort nennt der Verfasser zusätzlich “die Codices Trier, Bistumsarchiv, 95, 117, Düsseldorf, UB, B 64, fol. 102r-122r und Berlin,SB, Cod. 437, fol. 59r-69v” (ein auch in Manuscripta Mediaevalia erfasster Mischband, dort als Hdschr. 437 bezeichnet).
Damit sind nun sieben erhaltene und eine verschollene Handschrift des Werks von Herxen nachgewiesen.
Stadtbibliothek Trier, Cod. 195/1214, Bl. 141vb-142vb (T1)
Von Schmidt S. LVII und Petrus Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier, Berlin 1996, S. 189f.
http://books.google.com/books?id=6cE-4yYXtbQC&pg=PA189
nur allgemein ins 15. Jahrhundert gesetzt. Provenienz ist die Benediktinerabtei St. Eucharius/St. Matthias. Beschreibung Keuffers 1891:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0728_b113_jpg.htm
Biblioteca Antoniana Padua, Cod. Scaff. V Nr. 93
Nicht bei Schmidt. Der Text wird einem “Remigius” zugeschrieben, in dem Lebeuf, dem Handschriftenkatalog von 1842 folgend, Remigius von Auxerre sehen wollte:
http://books.google.com/books?id=aCQKAAAAIAAJ&pg=PA383
In dem Band L'école carolingienne d'Auxerre, Paris 1991, S. 498 (leider konnte ich nicht ermitteln, wer für diese Seite verantwortlich zeichnet, da Google sinnigerweise das Inhaltsverzeichnis nicht zugänglich macht)
http://books.google.com/books?id=YtQ8kcZcZ7wC&pg=PA498
wird der richtige Hinweis auf Richalm (und die Trierer Handschrift 195=T1) gegeben. Sowohl das Incipit “Horrendum est nos contra hostes” als auch die Mitüberlieferung (Johannes von Dambach) schließen jeden Zweifel aus, dass es sich um die Brevis Redactio handelt.
Beschreibungen:
Luigi M. D. Minciotti, Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella Biblioteca di Sant'Antonio, Padua 1842, S. 40
http://books.google.com/books?id=oq6X3Sg7RnEC&pg=PA40
Antonio Maria Josa, I codici manoscritti della Biblioteca Antoniana di Padova, Padua 1886, S. 219
http://books.google.com/books?id=UqdSS73xBSAC&pg=PA219 nur mit US-Proxy
[ http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=25039 ]
Bibliothèque nationale de Luxembourg, Cod. 57, Bl. 298-302
Nicht bei Schmidt. Von der Geschichte der Handschrift aus dem 15. Jahrhunderts ist nur bekannt, dass sie im 17. Jahrhundert den Luxemburger Jesuiten gehörte.
Beschreibung von Nicolas van Werveke, Catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliothèque de Luxembourg, Luxembourg 1894, S. 131f.
http://www.luxemburgensia.bnl.lu/cgi/luxonline1_2.pl?action=fv&sid=bnl_manu&vol=01&page=132&zoom=3
Fol. 298: Visiones beati Richalmi abbatis. Horrendum est nobis contra hostes invisibiles pugnare et nichil vel parum de insidiis eorum congnoscere; unde non pingit (sic) me vel ad me ipsius vel ad aliorum utilitatem revelaciones factas beate memorie abbati Richalmo quas ex opere eius diversis vicibus scripsi, hic simul conscribere, ut aliqua caliditatis demoniace vestigia quasi palpando possimus deprehendere. Igitur ad narracionem accedamus.
Dixit abbas Richalmus: In missa ..... — Fol. 302 : et non magis vult hiis semper intendere.
Historisches Archiv der Stadt Köln, Cod. W 33, Bl. 235v-238r (K2)
Schmidt S. LIII: “um 1550-1560, aus der Kölner Kartause”. Der Text ist im Vergleich zu den Schmidt bekannten anderen Handschriften der Brevis Redactio unvollständig.
Beschreibung von Vennebusch 1986:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0089_b009_jpg.htm
c) Exzerpte aus dem 17. Jahrhundert
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod. HB XV 68, Bl. 442r (S)
Beschreibung:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0073_b037_JPG.htm
Kollektaneen des Schöntaler Mönchs und Historiographen Bartholomäus Kremer, geschrieben zwischen ca. 1630 und 1651 (Schmidt S. LVII). Das Exzerpt (Cap. 130) steht I nahe. Vermutlich geht es auf die in Stams 1634/6 angefertigte Kopie aus I durch den Schöntaler Konventualen Edmund Reinhold zurück, die nicht erhalten ist.
Staatsarchiv Ludwigsburg, B 503 II Bü 10
Die Signatur von Schmidt (B 503 Nr. 10) wurde anhand des Online-Findbuchs korrigiert.
Schmidt S. LIII-LVI: Die Auszüge in Pater Angelus Hebenstreits ‘Chronicon abbatum monasterii Speciosae Vallis’ (1664) folgen der Handschrift aus Stams (I), auch wenn in einem Fall auch eine Lesart aus der verlorenen Exzerpthandschrift der Mainzer Kartause vermerkt wird.
d) Verlorene Handschriften
Augustinerchorherrenstift Böddeken
Carolus de Visch nennt in seinem ‘Auctarium’ 1665 die Handschrift (Schmidt S. LIX) und nennt sie vollständig im Gegensatz zu der Mainzer Handschrift. Eine Böddeker Handschrift war die Vorlage für Johannes Pilters Abschrift T2 (1461), doch wird man anders als Schmidt bezweifeln müssen, dass ein so kurzes Exzerpt wie die Brevis Redactio von Visch als vollständig bezeichnet worden wäre. Man hätte also mit zwei Codices in Böddeken zu rechnen, mit einer Vollhandschrift und einer Version der Brevis Redactio.
Kartause Erfurt
Schmidt S. LIXf.: Richalms Werk ist im Bibliothekskatalog der Erfurter Kartause vom Ende des 15. Jahrhunderts zu finden (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 2, 1928, S. 433).
Kreuzherren Köln
Schmidt S. LX: Erwähnung in einem ausradierten Inhaltsverzeichnis Köln, Historisches Archiv, GB 8̊ 87, Bl. 30r einer im 15. Jahrhundert aufgelösten Handschrift, von der kleine Teile in dieser Handschrift (wohl Mitte 15. Jahrhundert) erhalten sind. An ihr war der Schreiber von K1, Grunenberg, beteiligt. Vennebusch 1993, S. 84:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0039_b084_JPG.htm
Im Kreuzherrenkloster gab es also zwei Handschriften.
Kartause Mainz
Diese Handschrift erwähnt nicht nur de Visch 1665 (Schmidt S. LIX Anm. 65: mutila), sondern auch Hebenstreit 1664 (zitiert bei Schmidt S. LV): “rursus in Carthusia Moguntina, sed incompletum et in epitomem redactum, per quendam religiosum Ordinis Praedicatorum, ut apparet, Conventus Mariaevallensis vel Wimpinensis, qui plura ad litteram, et inter ea favorem de osculatis a BeatissimaVirgine Richalmi pedibus, transcripsit ex authore Schöntalensis et in usum Concionatorum selegit”. Die Handschrift wurde vom Prior der Karthause damals an Schöntal zur Abschrift überlassen. Schmidt zitiert das Zeugnis zwar, verwertet es aber nicht. Da er nur die Überlieferung der Brevis Redactio auflistet, aber nicht ihren Textbestand und auch keine Varianten gibt, bleibt offen, ob wir im für Predigtzwecke angelegten Werk des Wimpfener Dominikaners womöglich die Brevis Redactio sehen dürfen. Dass Johannes von Dambach, mit dessen Consolatio die meisten Handschriften der Kurzform überliefert werden, ebenfalls Dominikaner war, soll angemerkt werden.
Regularkanoniker Tongern
Schmidt S. LIX: Nach de Vischs Zisterzienserbibliographie von 1656 besaßen sie einen Codex. Antoine Sanderus, Bibliotheca belgica manuscripta, Bd. 2, Lille 1641, S. 195 nannte das Werk in einer 1638 erstellten Bibliotheksliste. Es handelt sich um Windesheimer Augustinerchorherren.
Abschließende Bemerkungen zur Überlieferung
An der Überlieferungsgeschichte des Textes war Schmidt leider nur wenig interessiert. Man erfährt eigentlich gar nichts über die Brevis Redactio. Schmidt hat nur die vollständigen Handschriften kollationiert. Gern hätte man auch erfahren, wie K1 den Richalm-Text einleitet - es steht nicht bei Schmidt (und nur unvollständig bei Vennebusch), aber in einem Google-Schnipsel:
http://tinyurl.com/c2542u
Schmidt gibt keinen Hinweis darauf, dass auch die Trierer Handschrift T1 neben K2 die Consolatio theologiae des Johannes von Dambach überliefert. Auers Monographie von 1928 habe ich leider nicht zur Hand, ich muss mich auf das stützen, was die Kataloge dazu sagen.
Die Abfolge in T1 ist nach Petrus Becker:
Bl. 115v-136r Consolatio theologiae
Bl. 136r-141v Ps.-Petrus von Blois: De utilitate tribulationum
Bl. 141v-142v Richalm
Die gleiche Abfolge findet sich auch in der Luxemburger Handschrift:
Bl. 196v-277v Consolatio theologiae
Bl. 278r-297v Ps.-Petrus von Blois: De utilitate tribulationum
Bl. 298r-302r Richalm
Im Codex aus Padua folgt Richalm auf die Consolatio, während in K2 die Consolatio und Richalm durch einen Text aus Gregors Homiliae getrennt werden. In vier von den sieben Handschriften der Brevis Redactio wird also das Werk des weit verbreitete Dominikaners Johannes von Dambach mitüberliefert. Ohne zu wissen, was die Brevis Redactio aus Richalm exzerpiert hat, wären allerdings weitere Aussagen über die Verwandtschaft der Consolatio und der Brevis Redactio pure Spekulation.
Erwähnt sei auch noch die eigenartige Textzusammenstellung in P, das nur 32 Blatt umfasst. Nach dem Herxen-Text, der Devotio moderna zuzuweisen, folgen die Brevis Redactio und danach französische Rondeaux!
Schmidt verweist S. LXIV bei T und W auf die monastischen Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts. In der Tat fällt auf, dass die Überlieferung des 15. Jahrhunderts, soweit die Handschriften zuzuordnen sind, auf Kartäuser, regulierte Chorherren und Benediktiner zurückzuführen ist.
Die Pergamenthandschrift T aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammt aus der Trierer Kartause, K2 aus der Kölner; verlorene Handschriften sind für die Kartausen Mainz und Erfurt belegt. Über die Affinität der Kartäuser zur Visionsliteratur handelte Johannes Mangei, in: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser, 2001:
http://books.google.com/books?id=Q7Y5Z1RuOIgC&pg=PA313
M1 stammt aus Indersdorf, dem wichtigsten oberdeutschen Reformzentrum der Kanonikerreform im 15. Jahrhundert. In Böddeken bei Paderborn gab es wohl zwei Handschriften des Werks. Auf die Devotio moderna verweisen nicht nur die Handschriften aus dem Kölner Kreuzherrenkloster, sondern auch der Nachweis einer Handschrift in Tongern und die Mitüberlieferung der vielleicht für eine weltliche Empfängerin bestimmten Pariser Handschrift.
M3 stammt aus dem Benediktinerkloster Tegernsee, ein Zentrum der Melker Reform in Bayern, W aus dem Bursfelder Kloster St. Peter in Erfurt, T1 aus St. Matthias in Trier.
Neben der Ordensreform erscheint mir aber auch jene Bewegung beachtenswert, die man den “Rückgriff des 15. Jahrhunderts auf die früh- und hochmittelalterliche Theologie und Spiritualität” nennen könnte. Dieser Rückgriff wurde wesentlich getragen von den Klosterreformen, ist aber auch auf das engste verbunden mit jenem “retrospektiven Syndrom”, das in den Klöstern des 15. Jahrhunderts als “monastischer Historismus” sichtbar wird. Näheres dazu in meiner Studie über St. Ulrich und Afra in Augsburg:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/
Besonders bemerkenswert ist die Weimarer Handschrift W, die hagiographische Texte aus dem Umkreis der Hirsauer Reform enthält: die Vita Wilhelms von Hirsau (zur Überlieferung sehe man meinen eben zitierten Aufsatz S. 140f.), Sigebotos Vita der heiligen Paulina (von Paulinzella) und die Vita Erminolds von Prüfening. In der Kreuzbrüderhandschrift K1 begegnen Texte von Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau.
III. Zur Rezeption von Richalms Werk
Schmidt S. XXXVI-XLIX handelt erfreulich ausführlich von “Rezeption und Forschungsstand”. Wer sich über die ganze Breite der Richalm-Rezeption ein Bild machen will, kann in Google Book Search nach richalm, richalmi oder richalmus suchen. Üblicherweise erscheint der Schöntaler Abt als “Gewährsmann für die kollektive Vorstellung von der Vielzahl der Teufel im Mittelallter” (S. XLIV). Beispielsweise bei Elias Canetti, William Gaddis, Carl Sagan oder Salman Rushdie.
Schmidt hat die wohl wichtigsten Werke ausgewählt. Besonders einflussreich erscheint die 1869 erschienene Geschichte des Teufels von dem protestantischen Theologen Roskoff, die auch die umfangreichsten deutschsprachigen Auszüge aus dem Text enthält (S. 335-343 der Originalausgabe) . Die Ausgabe ist einsehbar unter
http://www.archive.org/details/geschichtedesteu01roskuoft
http://books.google.com/books?id=kjYCAAAAQAAJ&pg=PA335 (mit US-Proxy)
Einen Hinweis verdient vielleicht auch Friedrich von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, Bd. 6, 3. Aufl. 1858, S. 538f., der kürzere Auszüge auf Deutsch gab:
http://books.google.com/books?id=T8ZWAAAAMAAJ&pg=PA538
Was in den “Blättern für literarische Unterhaltung” 1838 S. 460 aus Richalms Werk auf Deutsch zu lesen war, stimmt damit überein und dürfte einer Vorauflage entnommen sein:
http://books.google.com/books?id=7-QaAAAAYAAJ&pg=PA460
Schmidts Edition wird erfreulicherweise in einigen Jahren auf http://www.dmgh.de kostenfrei zur Verfügung stehen (es sei denn, die MGH ändert ihren Sinn). Wünschenswert wäre eine deutsche Übersetzung, da der Text nicht nur für jene von Interesse ist, die über hinreichende Lateinkenntnisse verfügen. Dem Editor ist für seine jahrelange Mühe mit dem Text sehr zu danken, der MGH, dass sie ihn in ihr Editionsprogramm aufgenommen hat, denn dies sichert ihm die nötige Publizität.
How to quote this entry?
Graf, Klaus. Neues zu Richalm von Schöntal. Archivalia . 2009-05-03. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5680268/. Accessed: 2009-05-03. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5gVVWEu0f )
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 22:24 - Rubrik: Kodikologie
" .... Nach einem beeindruckenden Fußmarsch über die Via Appia Antica erreichte die Pilgerschar die berühmten Katakomben San Callisto. Die nach dem heiligen Kallixtus, einem Papst des 3. Jahrhunderts, benannten Begräbnisstätten gelten als Archiv der frühen Kirche. Elf Meter steigt man in die Tiefe hinab und findet sich in einem System verwinkelter Gänge mit unzähligen Nischen und Kammern. Da und dort sind bunte Malereien erhalten, die christliche Symbole wie den Fisch oder Jesus als den guten Hirten zeigen......"
Quelle:
http://stephanscom.at/news/0/articles/2009/05/03/a16578/
Quelle:
http://stephanscom.at/news/0/articles/2009/05/03/a16578/
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 22:04 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„In diesem Archiv ist mehr Wahrheit zu finden als in den gesamten Stasi-Akten“, Peter Ensikat, von 1991 bis 2004 Chef-Autor und künstlerischer Leiter der Berliner „Distel“.
Quelle:
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/6783963.htm
Quelle:
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/6783963.htm
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 22:04 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Den emotionalsten Moment erlebten die Besucher im Foyer des Schauspielhauses, als Bettina Schmidt-Czaia, Direktorin des Historischen Archivs, ihre Erinnerungen an den Einsturz des Gebäudes schilderte. Trotz dieses Erlebnisses ist die Archivarin optimistisch. Bisher seien rund 24 der 30 Kilometer Archivalien geborgen, erläuterte sie im Gespräch mit Christian Hümmeler. „Von einem Gedächtnisverlust der Stadt kann man nicht sprechen, höchstens von einer partiellen Amnesie“, so Schmidt-Czaia. Es bestehe die Hoffnung, 70 bis 80 Prozent der Bestände wiederherstellen zu können. „Wir brauchen noch in dieser Legislaturperiode einen Ratsbeschluss für einen neuen Standort“, appellierte Schmidt-Czaia an die Politik. Sie setzt sich für eine innerstädtische Lösung ein. Von den vorgeschlagenen Standorten präferiere sie den Eifelwall und die Messecity in Deutz. ....."
Quelle:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966906451.shtml
Quelle:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966906451.shtml
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 22:03 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Bochumer Stadtarchiv hat einen Lagerraum für Material aus dem eingestürzten Archiv in Köln bereitgestellt. Zwei LKW-Ladungen erreichten jetzt die Ruhrstadt. Weitere sollen folgen. Das Bochumer Archiv ist erst vor zwei Jahren an die Wittener Straße umgezogen. Es ist Zufall, dass die Räume in der Kronenstraße noch nicht aufgegeben wurden. ....
Die gesammelten Fundstücke kommen jetzt unter anderem im Bochumer Archiv an. "Was in den Kisten genau drin ist, wissen wir nicht", erklärt Ingrid Wölk, Leiterin des Archivs. Sortieren muss sie das Chaos aber nicht: "Das macht das Stadtarchiv Köln, die schauen sich die Dinge hier an."
Zwei LKW-Ladungen sind allein am Donnerstag angekommen, weitere Transporte folgen - so lange, bis die Kapazität des Bochumer Archivs erschöpft ist. Acht Magazine sind noch frei.
Und dabei hatte man noch Glück. Das Bochumer Archiv ist erst vor zwei Jahren an die Wittener Straße umgezogen. Es ist Zufall, dass die Räume in der Kronenstraße noch nicht aufgegeben wurden...."
Quelle:
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bolo/Bochum;art932,550169
Die gesammelten Fundstücke kommen jetzt unter anderem im Bochumer Archiv an. "Was in den Kisten genau drin ist, wissen wir nicht", erklärt Ingrid Wölk, Leiterin des Archivs. Sortieren muss sie das Chaos aber nicht: "Das macht das Stadtarchiv Köln, die schauen sich die Dinge hier an."
Zwei LKW-Ladungen sind allein am Donnerstag angekommen, weitere Transporte folgen - so lange, bis die Kapazität des Bochumer Archivs erschöpft ist. Acht Magazine sind noch frei.
Und dabei hatte man noch Glück. Das Bochumer Archiv ist erst vor zwei Jahren an die Wittener Straße umgezogen. Es ist Zufall, dass die Räume in der Kronenstraße noch nicht aufgegeben wurden...."
Quelle:
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bolo/Bochum;art932,550169
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 22:02 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zum Bild:
http://www.wordmagazine.co.uk/content/mick-jones-lockup
http://www.wordmagazine.co.uk/content/mick-jones-lockup
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 21:01 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... „Als Westmünsterländer hat man ja ohnehin eine besondere Beziehung zu Köln. Und außerdem kommt die Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia doch auch aus Gütersloh“, winkt der gebürtige Coesfelder bescheiden ab. Das Angebot aus dem Kreis Gütersloh wurde denn auch dankend angenommen. .....
Diesen Arbeitsschritt haben die Verantwortlichen in Köln generalstabsmäßig geplant. Nachdem die Gütersloher Delegation in der Domstadt angekommen ist, wird sie zunächst im Bettensaal einer Kaserne in der Nähe der Mühlheimer Brücke untergebracht, bevor es nach einer Einweisung und einem Mittagessen von 14 bis 21 Uhr zur ersten Schicht ....."
Quelle:
http://www.die-glocke.de/gl/cgi/news/shownews.php?id=12602
Diesen Arbeitsschritt haben die Verantwortlichen in Köln generalstabsmäßig geplant. Nachdem die Gütersloher Delegation in der Domstadt angekommen ist, wird sie zunächst im Bettensaal einer Kaserne in der Nähe der Mühlheimer Brücke untergebracht, bevor es nach einer Einweisung und einem Mittagessen von 14 bis 21 Uhr zur ersten Schicht ....."
Quelle:
http://www.die-glocke.de/gl/cgi/news/shownews.php?id=12602
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 20:59 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Meldete die New York Times am 1. Mai 2009:
http://www.nytimes.com/2009/05/01/arts/design/01voge.html?_r=3
Wikipedia-Artikel zu Paik: http://de.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
s. a.: http://archiv.twoday.net/search?q=Paik
http://www.nytimes.com/2009/05/01/arts/design/01voge.html?_r=3
Wikipedia-Artikel zu Paik: http://de.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
s. a.: http://archiv.twoday.net/search?q=Paik
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 19:50 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... The essays seek “to enlarge and enrich the contexts of Plath’s writing with the archive as its informing matrix, unraveling tangled connections backward to the middle decades of the twentieth century and forward to issues raised by contemporary literary and cultural criticism” ...."
More on: http://readingarchives.blogspot.com/2009/05/unraveling-literary-archive.html
More on: http://readingarchives.blogspot.com/2009/05/unraveling-literary-archive.html
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Mai 2009, 19:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 18:10 - Rubrik: English Corner
http://blog.klett-cotta.de/websites/digital-und-kostenlos-open-access/
Wer sich über Open Access exklusiv auf Vortragsfolien (!) von C. Hauschke informiert, muss sich wirklich nach dem Geist fragen lassen.
Ist es wirklich zuviel verlangt, dass man http://www.open-access.net/aufruft kapiert?
Wer sich über Open Access exklusiv auf Vortragsfolien (!) von C. Hauschke informiert, muss sich wirklich nach dem Geist fragen lassen.
Ist es wirklich zuviel verlangt, dass man http://www.open-access.net/
KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 16:29 - Rubrik: Open Access
http://ub.hsu-hh.de/
Es werden - wie inzwischen in vielen ausländischen Katalogen - Links zur Google Buchsuche angezeigt, leider ohne Angabe, um welche Darbietungsform (vollständig, Vorschau, Schnipsel, bibliographischer Eintrag) es sich handelt.
So nützlich dieses Feature anmuten mag, ebenso wie bei Links zu Amazon stellt sich natürlich bei öffentlichrechtlich organisierten Bibliotheken das Problem der Gleichbehandlung anderer Anbieter (Art. 3 GG) wie z.B. des Internetarchivs.

Es werden - wie inzwischen in vielen ausländischen Katalogen - Links zur Google Buchsuche angezeigt, leider ohne Angabe, um welche Darbietungsform (vollständig, Vorschau, Schnipsel, bibliographischer Eintrag) es sich handelt.
So nützlich dieses Feature anmuten mag, ebenso wie bei Links zu Amazon stellt sich natürlich bei öffentlichrechtlich organisierten Bibliotheken das Problem der Gleichbehandlung anderer Anbieter (Art. 3 GG) wie z.B. des Internetarchivs.

KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 16:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.szon.de/lokales/lindau/region/200904290142.html
Via http://library-mistress.blogspot.com/2009/05/sie-sammeln-was-das-zeug-h.html
Via http://library-mistress.blogspot.com/2009/05/sie-sammeln-was-das-zeug-h.html
KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 16:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Codex_Cotta:_18th_century_sorting
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingeram-Codex

http://de.wikipedia.org/wiki/Ingeram-Codex

KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 15:29 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Vorstellung ist Hauptinhalt von Subers Newsletter für Mai:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/05-02-09.htm
Zum Thema Connotea:
http://archiv.twoday.net/stories/5677061/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/05-02-09.htm
Zum Thema Connotea:
http://archiv.twoday.net/stories/5677061/
KlausGraf - am Sonntag, 3. Mai 2009, 04:06 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://futurezone.orf.at/stories/1602907/
"Die Feiglinge von Yahoo haben ganz heimlich, still und leise angekündigt, dass sie GeoCities dichtmachen werden", schreibt Jason Scott am 24. April in seinem Weblog. "Sie wollen diesen beinahe 20 Jahre alten Hosting-Dienst abschalten, der über die Jahre zur Heimat von Millionen Nutzern geworden ist." Für den begeisterten Sammler virtueller Artefakte aus dem frühen Web der 1990er Jahre war sofort klar: "Das ist ein Teil unserer Geschichte. Unserer Kultur. Es ist etwas, das ich für künftige Generationen bewahren möchte."
Siehe auch das Weblog von Jason Scott
http://ascii.textfiles.com/
Scott auf Twitter:
http://twitter.com/textfiles
http://www.archiveteam.org/index.php?title=Main_Page
Danke an JP

"Die Feiglinge von Yahoo haben ganz heimlich, still und leise angekündigt, dass sie GeoCities dichtmachen werden", schreibt Jason Scott am 24. April in seinem Weblog. "Sie wollen diesen beinahe 20 Jahre alten Hosting-Dienst abschalten, der über die Jahre zur Heimat von Millionen Nutzern geworden ist." Für den begeisterten Sammler virtueller Artefakte aus dem frühen Web der 1990er Jahre war sofort klar: "Das ist ein Teil unserer Geschichte. Unserer Kultur. Es ist etwas, das ich für künftige Generationen bewahren möchte."
Siehe auch das Weblog von Jason Scott
http://ascii.textfiles.com/
Scott auf Twitter:
http://twitter.com/textfiles
http://www.archiveteam.org/index.php?title=Main_Page
Danke an JP

KlausGraf - am Samstag, 2. Mai 2009, 15:41 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 2. Mai 2009, 15:40 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 2. Mai 2009, 15:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dango.bham.ac.uk/Dango.Presentation.htm
"DANGO, the Database of Archives of UK NGOs since 1945, is an online, free-to-access database, enabling researchers to identify NGOs that interest them, and then access both existing and new information about the content, location and accessibility of archival holdings relating to those bodies."
Via
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2009/05/dango-database-of-archives-of-uk-ngos.html

"DANGO, the Database of Archives of UK NGOs since 1945, is an online, free-to-access database, enabling researchers to identify NGOs that interest them, and then access both existing and new information about the content, location and accessibility of archival holdings relating to those bodies."
Via
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2009/05/dango-database-of-archives-of-uk-ngos.html

KlausGraf - am Samstag, 2. Mai 2009, 15:25 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bodman Collection of Italian Renaissance Manuscripts
http://ccdl.libraries.claremont.edu/col/irm
In this digital collection are eleven autograph, signed letters written between members of the Medici family of Florence and others in their social and political circles, including Angelo Poliziano, the Sforza family, Palla Strozzi, and Francesco Guicciardini. Written between 1426 and 1522, the letters touch on a number of issues urgent to the House of Medici including military campaigns, political associations, and the trials of family life.
Fashion Plate Collection, 19th Century
http://ccdl.libraries.claremont.edu/col/fpc
Over 700 full-color fashion plates from the Macpherson Collection of the Ella Strong Denison Library at Scripps College were culled from a variety of women's periodicals and other mass-circulating works published between 1789 and 1914. The images are primarily from France, Britain, America, and Spain, and depict scenes of nineteenth-century middle- and upper-class life with an emphasis on the leisure practices of bourgeois women, men, and children. A number of plates also derive from trade journals for tailors, who used the images to create made-to-order garments for fashionable men.


http://ccdl.libraries.claremont.edu/col/irm
In this digital collection are eleven autograph, signed letters written between members of the Medici family of Florence and others in their social and political circles, including Angelo Poliziano, the Sforza family, Palla Strozzi, and Francesco Guicciardini. Written between 1426 and 1522, the letters touch on a number of issues urgent to the House of Medici including military campaigns, political associations, and the trials of family life.
Fashion Plate Collection, 19th Century
http://ccdl.libraries.claremont.edu/col/fpc
Over 700 full-color fashion plates from the Macpherson Collection of the Ella Strong Denison Library at Scripps College were culled from a variety of women's periodicals and other mass-circulating works published between 1789 and 1914. The images are primarily from France, Britain, America, and Spain, and depict scenes of nineteenth-century middle- and upper-class life with an emphasis on the leisure practices of bourgeois women, men, and children. A number of plates also derive from trade journals for tailors, who used the images to create made-to-order garments for fashionable men.

KlausGraf - am Samstag, 2. Mai 2009, 00:33 - Rubrik: English Corner
Artikel über die Katalogisierung der ca. 130 Stücke
http://sas-space.sas.ac.uk/dspace/bitstream/10065/1791/1/007+-+ATTAR+-+Alexandria+20+2.pdf
Erschließung mit Provenienzen, darunter auch deutsche, im OPAC:
http://193.63.81.241/search/mincunab*&l=z&Da=&Db=/mincunab*/1,137,140,E/limit?Ya=&Yb=&M=&L=&P=&W=&NAME=T&VALUE=.*
Nr. 45
ULL copy purchased from G. David, 29 Dec. 1953, £12.0s.0d. Armorial bookplate on front paste-down: Ex libris Liechtensteinianis (i.e. of Franz Josef II, Prince of Liechtenstein).
Nr. 53
ULL copy purchased 21 Mar. 1961 from Maggs, £40.0s.0d. Label on top left corner of front pastedown: Ex libris Jacobj Manzoni. Inscriptions: Ioannes Crisonman[?] VVV ex dono M. Choris[?] Wm haec autor, me possidet; H[e]nrij Aspacensis (16th-cent. hands, both t.p.); In usum F.F. Aspacensium (16th-cent. hand, head of A2r; pertains to Benedictine monastery at Asbach an der Rott, Bavaria); Cosmo Gordon (front pastedown).
Nr. 64
ULL copy is from the London Institution. Inscription at head of first leaf of text: Canon Regul. V. Corporis Chri. Coloniae.
Nr. 85
ULL copy is from the library of Sir Edwin Durning-Lawrence, purchased as lot 92 from Sotheby sale, 5 Dec. 1907, £1.3s.0d. Label of Georgius Kloss. Inscriptions on leaf pi1r of Hieronimus Eyselm de Mindelhaim (with motto) and of Johannes Schnapper, Gringorf[?], 1681. With marginal markings, underlinings and Latin annotations in early hands; some annotations partly lost through cropping.
Nr. 110:
ULL copy purchased 2 Jan. 1958 from Francis Edwards, £16.0s.0d, and presented in memory of Sir Edwin Deller. Purchased. Stamps of the Domus Gorheim, Soc. Jesu. T.p. inscription in early hand: "Pro Conventu Frommersbergensi Fratrum Minorum strict. observ[an]l[ic]e", i.e. of the Franciscan covent in Fremersberg, near Sinsheim village, near Baden, Germany.
(Frdl. Hinweis von Falk Eisermann.)
http://sas-space.sas.ac.uk/dspace/bitstream/10065/1791/1/007+-+ATTAR+-+Alexandria+20+2.pdf
Erschließung mit Provenienzen, darunter auch deutsche, im OPAC:
http://193.63.81.241/search/mincunab*&l=z&Da=&Db=/mincunab*/1,137,140,E/limit?Ya=&Yb=&M=&L=&P=&W=&NAME=T&VALUE=.*
Nr. 45
ULL copy purchased from G. David, 29 Dec. 1953, £12.0s.0d. Armorial bookplate on front paste-down: Ex libris Liechtensteinianis (i.e. of Franz Josef II, Prince of Liechtenstein).
Nr. 53
ULL copy purchased 21 Mar. 1961 from Maggs, £40.0s.0d. Label on top left corner of front pastedown: Ex libris Jacobj Manzoni. Inscriptions: Ioannes Crisonman[?] VVV ex dono M. Choris[?] Wm haec autor, me possidet; H[e]nrij Aspacensis (16th-cent. hands, both t.p.); In usum F.F. Aspacensium (16th-cent. hand, head of A2r; pertains to Benedictine monastery at Asbach an der Rott, Bavaria); Cosmo Gordon (front pastedown).
Nr. 64
ULL copy is from the London Institution. Inscription at head of first leaf of text: Canon Regul. V. Corporis Chri. Coloniae.
Nr. 85
ULL copy is from the library of Sir Edwin Durning-Lawrence, purchased as lot 92 from Sotheby sale, 5 Dec. 1907, £1.3s.0d. Label of Georgius Kloss. Inscriptions on leaf pi1r of Hieronimus Eyselm de Mindelhaim (with motto) and of Johannes Schnapper, Gringorf[?], 1681. With marginal markings, underlinings and Latin annotations in early hands; some annotations partly lost through cropping.
Nr. 110:
ULL copy purchased 2 Jan. 1958 from Francis Edwards, £16.0s.0d, and presented in memory of Sir Edwin Deller. Purchased. Stamps of the Domus Gorheim, Soc. Jesu. T.p. inscription in early hand: "Pro Conventu Frommersbergensi Fratrum Minorum strict. observ[an]l[ic]e", i.e. of the Franciscan covent in Fremersberg, near Sinsheim village, near Baden, Germany.
(Frdl. Hinweis von Falk Eisermann.)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.humi.keio.ac.jp/treasures/incunabula/B42/
Die weiteren digitalisierten Exemplare dieser berühmten Inkunabel listet auf:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gutenberg-Bibel&stable=0&shownotice=1#Digitalisierte_Exemplare

Die weiteren digitalisierten Exemplare dieser berühmten Inkunabel listet auf:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gutenberg-Bibel&stable=0&shownotice=1#Digitalisierte_Exemplare

KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 23:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 23:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.datenschutz-berlin.de/content/nachrichten/datenschutznachrichten/jahresbericht-2008
S. 111 ff. zum Fall Kinski
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
Der offenkundig archivrechtlich außerordentlich inkompetente Datenschutzbeauftragte beschönigt sein Fehlverhalten und lässt erneut erkennen, dass er das archivrechtliche ABC immer noch nicht kapiert hat.
Absolut inakzeptabel ist auch S. 162f. die Position zu Bewertungsportalen im Internet (hier: meinprof.de), die von Gerichten mehrfach als zulässig angesehen wurden.
S. 167 ff. wird zur Informationsfreiheit berichtet. Ein eigener Bericht dazu erschiene sinnvoll. Auch in diesem Bereich zeigt sich der Gärtner als Bock (S. 174ff.). Alle dargestellten Einzelfälle wurden informationsunfreundlich beschieden.
S. 111 ff. zum Fall Kinski
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
Der offenkundig archivrechtlich außerordentlich inkompetente Datenschutzbeauftragte beschönigt sein Fehlverhalten und lässt erneut erkennen, dass er das archivrechtliche ABC immer noch nicht kapiert hat.
Absolut inakzeptabel ist auch S. 162f. die Position zu Bewertungsportalen im Internet (hier: meinprof.de), die von Gerichten mehrfach als zulässig angesehen wurden.
S. 167 ff. wird zur Informationsfreiheit berichtet. Ein eigener Bericht dazu erschiene sinnvoll. Auch in diesem Bereich zeigt sich der Gärtner als Bock (S. 174ff.). Alle dargestellten Einzelfälle wurden informationsunfreundlich beschieden.
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 23:15 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.flickr.com/photos/field_museum_library/
http://www.fieldmuseum.org/research_collections/library/library_sites/photo_archives/flickr.htm

http://www.fieldmuseum.org/research_collections/library/library_sites/photo_archives/flickr.htm

KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 21:29 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 18:53 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mybiasedcoin.blogspot.com/2009/04/acm-does-not-support-open-access.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/04/acm-and-harvard-authors.html
Die ACM akzeptiert nicht Harvards Author Addendum, das (bescheidene) Nachnutzungsmöglichkeiten vorsieht. Nach wie vor repräsentieren die BBB-Definitionen von Open Access den Konsens der Open-Access-Community. Wer die Berliner Erklärung unterzeichnet, entscheidet sich eindeutig für libre Open Access. Harnad macht wie üblich aus seinem Herzen keine Mördergrube und hält libre Open Access für absolut nachrangig und Bedingungen, die libre Open Access vorsehen, für kontraproduktiv.
Meine Position ist diametral entgegengesetzt: Wir brauchen weit mehr libre Open Access, und wenn eine dubiose Fachgesellschaft, die ihre Publikationen in einem für ihre Mitglieder nur gegen Aufpreis zugänglichen kostenpflichtigen Angebot wegsperrt, sich mit Harvard anlegt, wird es spannend zu sehen, ob Harvards Position aufgeweicht wird. Nur libre Open Access ist voller Open Access.
Erinnert sei auch an meinen Beitrag von 2008, der aufzeigte, dass Data mining nach deutschem Urheberrecht für Forscher in kommerziellen Kontexten nicht möglich ist:
http://archiv.twoday.net/stories/4851871/
Nachtrag: Siehe nun auch
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/05/more-on-oa-journals-which-offer-gratis.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/04/acm-and-harvard-authors.html
Die ACM akzeptiert nicht Harvards Author Addendum, das (bescheidene) Nachnutzungsmöglichkeiten vorsieht. Nach wie vor repräsentieren die BBB-Definitionen von Open Access den Konsens der Open-Access-Community. Wer die Berliner Erklärung unterzeichnet, entscheidet sich eindeutig für libre Open Access. Harnad macht wie üblich aus seinem Herzen keine Mördergrube und hält libre Open Access für absolut nachrangig und Bedingungen, die libre Open Access vorsehen, für kontraproduktiv.
Meine Position ist diametral entgegengesetzt: Wir brauchen weit mehr libre Open Access, und wenn eine dubiose Fachgesellschaft, die ihre Publikationen in einem für ihre Mitglieder nur gegen Aufpreis zugänglichen kostenpflichtigen Angebot wegsperrt, sich mit Harvard anlegt, wird es spannend zu sehen, ob Harvards Position aufgeweicht wird. Nur libre Open Access ist voller Open Access.
Erinnert sei auch an meinen Beitrag von 2008, der aufzeigte, dass Data mining nach deutschem Urheberrecht für Forscher in kommerziellen Kontexten nicht möglich ist:
http://archiv.twoday.net/stories/4851871/
Nachtrag: Siehe nun auch
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/05/more-on-oa-journals-which-offer-gratis.html
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 18:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bne.es/BDH/index.htm
Die Inkunabeln werden als Schwarzweiß-PDFs in nicht akzeptabler schlechter Qualität dargeboten, der Viewer ist außerordentlich gewöhnungsbedürftig.

Die Inkunabeln werden als Schwarzweiß-PDFs in nicht akzeptabler schlechter Qualität dargeboten, der Viewer ist außerordentlich gewöhnungsbedürftig.

KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 17:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 17:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Suber hat für das neue Open Access Tracking Projekt die wissenschaftliche Tagging-Website Connotea, die vom kommerziellen Wissenschaftsverlag nature.com betrieben wird, bestimmt:
http://archiv.twoday.net/stories/5648330/
Zunächst einmal konnte ich das Bookmarklet nicht in Chrome, meinem gängigen Browser installieren; erst nachdem Suber mir den Code kopiert hatte, musste ich nicht mehr in den Firefox wechseln. Eine Mail an Connotea war ohne Antwort geblieben.
Heute stellte ich zusätzlich fest, dass inzwischen alle Einträge aus Archivalia nur mit einem Captcha, das unangemessene Inhalte verhindern soll, möglich sind. Sie werden nicht sofort allgemein freigegeben, sondern bleiben erst einmal in Quarantäne. Das ist schlicht und einfach nicht akzeptabel.
Update: Mail von Connotea "Sorry about that,
We have a set of heuristic rules for catching spam on the site. One
signature of spammers is using Connotea to repost splogs.
I'll add you to the whitelist, and the problem should go away for you.
It should be fixed by Tuesday."
http://archiv.twoday.net/stories/5648330/
Zunächst einmal konnte ich das Bookmarklet nicht in Chrome, meinem gängigen Browser installieren; erst nachdem Suber mir den Code kopiert hatte, musste ich nicht mehr in den Firefox wechseln. Eine Mail an Connotea war ohne Antwort geblieben.
Heute stellte ich zusätzlich fest, dass inzwischen alle Einträge aus Archivalia nur mit einem Captcha, das unangemessene Inhalte verhindern soll, möglich sind. Sie werden nicht sofort allgemein freigegeben, sondern bleiben erst einmal in Quarantäne. Das ist schlicht und einfach nicht akzeptabel.
Update: Mail von Connotea "Sorry about that,
We have a set of heuristic rules for catching spam on the site. One
signature of spammers is using Connotea to repost splogs.
I'll add you to the whitelist, and the problem should go away for you.
It should be fixed by Tuesday."
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 16:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 15:57 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 00:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kurzbericht von der Dresdener Urheberrechtstagung:
http://ebook-bibo.blog.de/2009/04/30/bericht-urheberrechtstagung-30-april-2009-dresden-6037629/
http://ebook-bibo.blog.de/2009/04/30/bericht-urheberrechtstagung-30-april-2009-dresden-6037629/
KlausGraf - am Freitag, 1. Mai 2009, 00:00 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dr. Ivo Geis mit einem Artikel zur Beweisqualität von eDokumenten, mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Unterlagen aus Wirtschaftsunternehmen.
Vgl.: Beweiskraft eDokumente aus Unternehmen
Auf die öV lässt sich der Artikel nur bedingt übertragen, da hier teilweise andere und engere rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere hinsichtlich der Schriftgutverwaltung, dem Scanning resp. der Langzeitspeicherung gelten. Hier sind folgende Leitfäden des BMWi zu empfehlen (es handelt um größere PDF-Dateien):
Beide Leitfäden sind für die öV zu empfehlen, da gescannte Unterlagen von originär elektronisch entstandenen Unterlagen bezgl. der rechtlichen Betrachtung abzugrenzen sind (gescannte Unterlagen stellen grundsätzlich Kopien der papiernen Originale dar) und die Problematik des Scannens im zweiten Leitfaden sehr umfassend ausgeführt wird. Beide Leitfäden sind im Ergebnis des Projekts "provet" entstanden, in dem u.a. die rechtlichen Rahmenbedingungen spez. Themen wie Beweiskraft von eDokumenten und deren Erhalt (der Beweiskraft) untersucht wurden. Maßgebliche Personen, die derzeit auch zum Maß der Dinge in diesem Themenkontext in der öV zählen sind:
Vgl.: Beweiskraft eDokumente aus Unternehmen
Auf die öV lässt sich der Artikel nur bedingt übertragen, da hier teilweise andere und engere rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere hinsichtlich der Schriftgutverwaltung, dem Scanning resp. der Langzeitspeicherung gelten. Hier sind folgende Leitfäden des BMWi zu empfehlen (es handelt um größere PDF-Dateien):
Beide Leitfäden sind für die öV zu empfehlen, da gescannte Unterlagen von originär elektronisch entstandenen Unterlagen bezgl. der rechtlichen Betrachtung abzugrenzen sind (gescannte Unterlagen stellen grundsätzlich Kopien der papiernen Originale dar) und die Problematik des Scannens im zweiten Leitfaden sehr umfassend ausgeführt wird. Beide Leitfäden sind im Ergebnis des Projekts "provet" entstanden, in dem u.a. die rechtlichen Rahmenbedingungen spez. Themen wie Beweiskraft von eDokumenten und deren Erhalt (der Beweiskraft) untersucht wurden. Maßgebliche Personen, die derzeit auch zum Maß der Dinge in diesem Themenkontext in der öV zählen sind:
- Dr. Alexander Roßnagel
- Dr. Stefanie Fischer-Dieskau
- Silke Jandt
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 30. April 2009, 21:28 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://netzwertig.com/2009/04/30/deutschland-degeneriert-in-ein-entwicklungsland-teil-2-von-3/
Zitat:
Propaganda-Nachplapperei, Heuchelei, was die Urheberrechtsdebatte angeht und einseitige Berichterstattung zum “Heidelberger Appell” .
Zitat:
Propaganda-Nachplapperei, Heuchelei, was die Urheberrechtsdebatte angeht und einseitige Berichterstattung zum “Heidelberger Appell” .
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 20:30 - Rubrik: Open Access
Dokumentiert die online vorliegende Ausgabe des mb:
http://mb.gbv.de/hefte/2009/pdf/MB%20140%20-%20April%202009%20-%20ONLINEAUSGABE.pdf
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=lasco
http://mb.gbv.de/hefte/2009/pdf/MB%20140%20-%20April%202009%20-%20ONLINEAUSGABE.pdf
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=lasco
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 20:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.boersenblatt.net/318671/
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und Kanzleramtsminister Thomas de Maizière haben den Heidelberger Appell zur Verteidigung des Urheberrechts begrüßt. Dies geht aus zwei Briefen an dessen Initiator, den Germanisten Roland Reuß (Heidelberg) hervor, die dem Börsenverein vorliegen.
Brigitte Zypries schreibt wörtlich: »Ich teile voll und ganz Ihre Empörung über die illegale Digitalisierung und Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Büchern durch das Unternehmen Google. Das Verhalten von Google, Bücher in großem Umfang ohne Einwilligung der Rechtsinhaber zu digitalisieren und zu veröffentlichen und erst danach über Vergütungen zu verhandeln, ist nicht akzeptabel.« Die Ministerin begrüßt ausdrücklich das gemeinsame Vorgehen von Börsenverein und VG Wort und schließt ihren Brief mit dem Bekenntnis: »Ich werde mich auch weiterhin intensiv dafür einsetzen, den Schutz der Urheber zu stärken und das Urheberrecht fit zu machen für das digitale Zeitalter.«
Auch Kanzleramtsminister Thomas de Maizière macht sich den Appell zu eigen: »Der Schutz geistigen Eigentums ist mir ein wichtiges Anliegen. Hierzu gehört selbstverständlich auch ein effektiver Schutz urheberrechtlich geschützter Werke im Internet.« Die Bundesregierung beteilige sich daher aktiv an den gegenwärtigen Überlegungen auf nationaler und europäischer Ebene, wie dieser Schutz verbessert werden kann. Man werde auch die Open-Access-Bewegung aufmerksam beobachten. Sollte sich die Erwartung, durch den erleichterten Zugang zu vorhandenen Erkenntnissen Wissenschaft und Forschung zu fördern, als unberechtigt erweisen, werde »ein regulatorischer Handlungsbedarf zu prüfen« sein.
Hier kann man Zypries zur Rede stellen:
http://www.abgeordnetenwatch.de/brigitte_zypries-650-5639.html
Hier kann man dem kanzleramtsminister Bescheid sagen:
Dr. Thomas de Maizière
c/o CDU Kreisgeschäftsstelle
Salzgasse 2
01558 Großenhain
Tel.: 03522/529831 Fax: 03522/38854
info@thomasdemaiziere.de
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und Kanzleramtsminister Thomas de Maizière haben den Heidelberger Appell zur Verteidigung des Urheberrechts begrüßt. Dies geht aus zwei Briefen an dessen Initiator, den Germanisten Roland Reuß (Heidelberg) hervor, die dem Börsenverein vorliegen.
Brigitte Zypries schreibt wörtlich: »Ich teile voll und ganz Ihre Empörung über die illegale Digitalisierung und Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Büchern durch das Unternehmen Google. Das Verhalten von Google, Bücher in großem Umfang ohne Einwilligung der Rechtsinhaber zu digitalisieren und zu veröffentlichen und erst danach über Vergütungen zu verhandeln, ist nicht akzeptabel.« Die Ministerin begrüßt ausdrücklich das gemeinsame Vorgehen von Börsenverein und VG Wort und schließt ihren Brief mit dem Bekenntnis: »Ich werde mich auch weiterhin intensiv dafür einsetzen, den Schutz der Urheber zu stärken und das Urheberrecht fit zu machen für das digitale Zeitalter.«
Auch Kanzleramtsminister Thomas de Maizière macht sich den Appell zu eigen: »Der Schutz geistigen Eigentums ist mir ein wichtiges Anliegen. Hierzu gehört selbstverständlich auch ein effektiver Schutz urheberrechtlich geschützter Werke im Internet.« Die Bundesregierung beteilige sich daher aktiv an den gegenwärtigen Überlegungen auf nationaler und europäischer Ebene, wie dieser Schutz verbessert werden kann. Man werde auch die Open-Access-Bewegung aufmerksam beobachten. Sollte sich die Erwartung, durch den erleichterten Zugang zu vorhandenen Erkenntnissen Wissenschaft und Forschung zu fördern, als unberechtigt erweisen, werde »ein regulatorischer Handlungsbedarf zu prüfen« sein.
Hier kann man Zypries zur Rede stellen:
http://www.abgeordnetenwatch.de/brigitte_zypries-650-5639.html
Hier kann man dem kanzleramtsminister Bescheid sagen:
Dr. Thomas de Maizière
c/o CDU Kreisgeschäftsstelle
Salzgasse 2
01558 Großenhain
Tel.: 03522/529831 Fax: 03522/38854
info@thomasdemaiziere.de
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 19:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zeit.de/online/2009/18/urheberrecht-open-access?page=1
Der Künstler als Vorwand
VON TINA KLOPP
Zitat:
Einige Wissenschaftsverlage erzielen Traummargen mit ihren Zeitschriften, denn Inhalte und Kontrolle derselben bekommen sie umsonst. Publikationen in renommierten Titeln fördern eben Karrieren. Doch sind die Zeitschriften mitunter so teuer, dass Unibibliotheken sie sich schon lange nicht mehr leisten. Die Open-Access-Initiative, die alle von ihr finanzierten Ergebnisse auch öffentlich verfügbar machen will, stört daher vor allem die Interessen dieser Fachverlage. Wahrnehmbar sind in der Debatte bislang aber nur die Wissenschaftler, die um ihre freie Wahl kämpfen. Die Verlage werden wissen, warum sie schweigen.
Der Künstler als Vorwand
VON TINA KLOPP
Zitat:
Einige Wissenschaftsverlage erzielen Traummargen mit ihren Zeitschriften, denn Inhalte und Kontrolle derselben bekommen sie umsonst. Publikationen in renommierten Titeln fördern eben Karrieren. Doch sind die Zeitschriften mitunter so teuer, dass Unibibliotheken sie sich schon lange nicht mehr leisten. Die Open-Access-Initiative, die alle von ihr finanzierten Ergebnisse auch öffentlich verfügbar machen will, stört daher vor allem die Interessen dieser Fachverlage. Wahrnehmbar sind in der Debatte bislang aber nur die Wissenschaftler, die um ihre freie Wahl kämpfen. Die Verlage werden wissen, warum sie schweigen.
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 18:43 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Catalog:
Manuscripts and archival materials are integrated in the general catalog; but you may execute your search either in the entire catalog or by typologies; for manuscripts, select "Manuscript and private papers"
Up to now, there are more than 7.000 notices, including medieval and renaissance codexs, XVII-XXth manuscripts and archival materials (over 200 private archives, mainly personal)
http://cataleg.bnc.cat/*eng#
Digitised Manuscripts
Documents are accessible through the webpage "Memoria digital de Catalunya"; again, there is a section devoted to manuscripts, that includes up to now 185 documents; the number should be largely increased this year.
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2FmanuscritBC
Via mail from
Anna Gudayol
Head of the Manuscript Department

Manuscripts and archival materials are integrated in the general catalog; but you may execute your search either in the entire catalog or by typologies; for manuscripts, select "Manuscript and private papers"
Up to now, there are more than 7.000 notices, including medieval and renaissance codexs, XVII-XXth manuscripts and archival materials (over 200 private archives, mainly personal)
http://cataleg.bnc.cat/*eng#
Digitised Manuscripts
Documents are accessible through the webpage "Memoria digital de Catalunya"; again, there is a section devoted to manuscripts, that includes up to now 185 documents; the number should be largely increased this year.
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2FmanuscritBC
Via mail from
Anna Gudayol
Head of the Manuscript Department
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 17:49 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://satundkabel.magnus.de/buntes/artikel/streit-um-krankenakte-von-schauspieler-klaus-kinski-beendet-vergleich.html
Der Streit um eine Krankenakte des Schauspielers Klaus Kinski (1926-1991) ist mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Kinskis Sohn Nikolai und das Berliner Landesarchiv einigten sich vor dem Verwaltungsgericht der Hauptstadt am Mittwoch darauf, dass künftig die Papiere der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aus dem Jahr 1950 nur nach Absprache mit Nikolai Kinski an Dritte herausgegeben werden dürfen. Klaus Kinski war damals drei Tage in der Klinik. Nikolai Kinski wollte mit seiner Klage erreichen, dass die Krankenakte seines Vaters unter Verschluss bleibt.
Der Krankenhauskonzern Vivantes hatte im Vorjahr zahlreiche Krankenakten vor allem aus der NS-Zeit an das Landesarchiv übergeben. [...]
Das Landesarchiv und der Datenschutzbeauftragte Alexander Dix hatten die Offenlegung mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass die zehnjährige Schutzfrist für Patientenakten von Personen der Zeitgeschichte bereits 2001 abgelaufen sei.
Kinski-Sohn darf küntig über Herausgabe von Akten bestimmen
Der Vergleich sieht laut Gericht vor, dass das Landesarchiv Nikolai Kinski informiert, wenn ein neuer Antrag auf Herausgabe gestellt wird. Dieser könne sich dann äußern. Sollte sich das Archiv gegen den Willen des Kinski-Sohnes zur Weitergabe entscheiden, könne dieser vor der Veröffentlichung gerichtlich dagegen vorgehen. Die Idee stamme aus dem Stasi-Unterlagen-Gesetz, sagte ein Gerichtssprecher.
Zum Fall:
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
Der Streit um eine Krankenakte des Schauspielers Klaus Kinski (1926-1991) ist mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Kinskis Sohn Nikolai und das Berliner Landesarchiv einigten sich vor dem Verwaltungsgericht der Hauptstadt am Mittwoch darauf, dass künftig die Papiere der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aus dem Jahr 1950 nur nach Absprache mit Nikolai Kinski an Dritte herausgegeben werden dürfen. Klaus Kinski war damals drei Tage in der Klinik. Nikolai Kinski wollte mit seiner Klage erreichen, dass die Krankenakte seines Vaters unter Verschluss bleibt.
Der Krankenhauskonzern Vivantes hatte im Vorjahr zahlreiche Krankenakten vor allem aus der NS-Zeit an das Landesarchiv übergeben. [...]
Das Landesarchiv und der Datenschutzbeauftragte Alexander Dix hatten die Offenlegung mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass die zehnjährige Schutzfrist für Patientenakten von Personen der Zeitgeschichte bereits 2001 abgelaufen sei.
Kinski-Sohn darf küntig über Herausgabe von Akten bestimmen
Der Vergleich sieht laut Gericht vor, dass das Landesarchiv Nikolai Kinski informiert, wenn ein neuer Antrag auf Herausgabe gestellt wird. Dieser könne sich dann äußern. Sollte sich das Archiv gegen den Willen des Kinski-Sohnes zur Weitergabe entscheiden, könne dieser vor der Veröffentlichung gerichtlich dagegen vorgehen. Die Idee stamme aus dem Stasi-Unterlagen-Gesetz, sagte ein Gerichtssprecher.
Zum Fall:
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 17:03 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liste von Digitalisaten der altgermanistischen Editionsreihe:
http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Texte_des_Mittelalters
Alle 13 aufgelistete Bände können auch ohne US-Proxy konsultiert werden.

http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Texte_des_Mittelalters
Alle 13 aufgelistete Bände können auch ohne US-Proxy konsultiert werden.

KlausGraf - am Donnerstag, 30. April 2009, 16:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei meinem letzten Köln-Besuch empfahl mir die "RvD" diese Publikation zur Notfallpanung, die aus einer Diplomarbeit der Kölner Fachhochschule hervorgegangen ist.
Aus der Verlagswerbung : "Katastrophen wie das Elbhochwasser oder das Feuer in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek zeigen das Problem fehlender Notfallpläne für Museen deutlich auf. Im aktuell erschienenen ersten Band „Notfallprävention und -planung für Museen, Galerien und Archive“ der Fachbuchreihe stellt der Autor Christoph Wenzel die Risikoanalyse und das Risikomanagement detailliert vor. Im nächsten Schritt beschreibt das Fachbuch die eigentliche Planung und Durchführung eines Notfallplans für Museen.
Darüber hinaus werden die folgende Fragen geklärt:
Welche Risiken bestehen für Sammlungsgut in deutschen Museen und Archiven?
Wer trägt die Verantwortung für die Notfallplanung innerhalb der Museen?
Welche Einrichtungen können die Museen, beratend oder finanziell, bei der Notfallplanung unterstützen?
Checklisten, Ablaufpläne sowie Empfehlungen zu stabilisierenden Maßnahmen an geschädigten Objekten im Anhang ergänzen die einzelnen Kapitel. "
Das Buch war heute nur noch über den Verlag direkt zu beziehen.
Link zur Werbung:
http://www.vds.de/Notfallpraevention-und-p.852.0.html
Aus der Verlagswerbung : "Katastrophen wie das Elbhochwasser oder das Feuer in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek zeigen das Problem fehlender Notfallpläne für Museen deutlich auf. Im aktuell erschienenen ersten Band „Notfallprävention und -planung für Museen, Galerien und Archive“ der Fachbuchreihe stellt der Autor Christoph Wenzel die Risikoanalyse und das Risikomanagement detailliert vor. Im nächsten Schritt beschreibt das Fachbuch die eigentliche Planung und Durchführung eines Notfallplans für Museen.
Darüber hinaus werden die folgende Fragen geklärt:
Welche Risiken bestehen für Sammlungsgut in deutschen Museen und Archiven?
Wer trägt die Verantwortung für die Notfallplanung innerhalb der Museen?
Welche Einrichtungen können die Museen, beratend oder finanziell, bei der Notfallplanung unterstützen?
Checklisten, Ablaufpläne sowie Empfehlungen zu stabilisierenden Maßnahmen an geschädigten Objekten im Anhang ergänzen die einzelnen Kapitel. "
Das Buch war heute nur noch über den Verlag direkt zu beziehen.
Link zur Werbung:
http://www.vds.de/Notfallpraevention-und-p.852.0.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 30. April 2009, 11:20 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://vincentrobijn.blogspot.com/
Tag 3: Für einen Archivar in Ausbildung ist die Arbeit in Köln eine besonders gute Schulung. Während des abgelaufenen Studienjahrs haben meine Kollegen und ich auf der Archivschule nur noch Theorie gehabt und keine Praxiserfahrung mit Inventarisieren. Hier in Köln ist keine Zeit für theoretische Reflexionen.Anpacken ist die Devise! ... Hunderte Dossiers mit Zwangssterilisierungen durch die Nazis, an denen auch andere Freiwillige arbeiteten, haben auf alle einen großen Eindruck gemacht.
Ein neuer Fernsehbeitrag mit dem Kollegen hier (2. Link unter dem Bild, "Deel 2" anklicken):
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FRotterdammers%20helpen%20Keulenaren%20met%20ingestort%20archief
siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5673315
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
Tag 3: Für einen Archivar in Ausbildung ist die Arbeit in Köln eine besonders gute Schulung. Während des abgelaufenen Studienjahrs haben meine Kollegen und ich auf der Archivschule nur noch Theorie gehabt und keine Praxiserfahrung mit Inventarisieren. Hier in Köln ist keine Zeit für theoretische Reflexionen.Anpacken ist die Devise! ... Hunderte Dossiers mit Zwangssterilisierungen durch die Nazis, an denen auch andere Freiwillige arbeiteten, haben auf alle einen großen Eindruck gemacht.
Ein neuer Fernsehbeitrag mit dem Kollegen hier (2. Link unter dem Bild, "Deel 2" anklicken):
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FRotterdammers%20helpen%20Keulenaren%20met%20ingestort%20archief
siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5673315
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
Dietmar Bartz - am Mittwoch, 29. April 2009, 22:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/1736570_Speichermedien-Wenn-der-PC-aus-dem-5.-Stock-faellt.html
Dazu der Kommentar:
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=6839
Meine Meinung:
Niemand hätte vor dem Kölner Ereignis vom 3. März 2009 damit gerechnet, dass eines der bedeutendsten Kommunalarchive Europas in einer Baugrube verschwinden würde. Originale sind unverzichtbar, aber nun einmal nicht mit den üblichen Sicherheitsmaßnahmen gegen Verlust zu versichern.
http://www.lockss.org/lockss/ "Lots of copies keep stuff safe". Wenn es dumm gelaufen wäre, wären die Kölner Sicherungsfilme womöglich zerstört oder einbetoniert. Den andernorts gesicherten Kopien (Barbarastollen, Hill Monastic Library) käme dann besonderer Wert zu.
Vervielfältigte Originale sind keine Originale mehr, das steht fest. Digitalisate lassen sich aber verlustfrei vervielfältigen und auf mehreren oder sogar vielen Servern lagern. Werden zukunftsoffene Datenformate verwendet, besteht zum Pessimismus keinerlei Anlass. Die großen Rechenzentren der öffentlichen Hand haben wirksame Routinen der Datensicherung. Lokale Medien wie der eigene CD, DVDs oder CDs sind in mancherlei Hinsicht dem traditionellen Buch unterlegen. Für verteilte Datenbestände, die regelmäßig gesichert werden und in Standardformaten abgespeichert sind, gilt das nicht.
Ein nicht vernachlässigbarer Teil der "digital born records" liegt in einer Form vor, die man nicht einfach ausdrucken kann (auf alterungsbeständigem Papier, mit alterungsbeständigem Toner). Wenn man nicht auf sie verzichten will, muss man sie digital erhalten. Initiativen wie NESTOR http://langzeitarchivierung.de/ zeigen, dass man an Lösungen arbeitet und Zuversicht begründet ist.
Dazu der Kommentar:
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=6839
Meine Meinung:
Niemand hätte vor dem Kölner Ereignis vom 3. März 2009 damit gerechnet, dass eines der bedeutendsten Kommunalarchive Europas in einer Baugrube verschwinden würde. Originale sind unverzichtbar, aber nun einmal nicht mit den üblichen Sicherheitsmaßnahmen gegen Verlust zu versichern.
http://www.lockss.org/lockss/ "Lots of copies keep stuff safe". Wenn es dumm gelaufen wäre, wären die Kölner Sicherungsfilme womöglich zerstört oder einbetoniert. Den andernorts gesicherten Kopien (Barbarastollen, Hill Monastic Library) käme dann besonderer Wert zu.
Vervielfältigte Originale sind keine Originale mehr, das steht fest. Digitalisate lassen sich aber verlustfrei vervielfältigen und auf mehreren oder sogar vielen Servern lagern. Werden zukunftsoffene Datenformate verwendet, besteht zum Pessimismus keinerlei Anlass. Die großen Rechenzentren der öffentlichen Hand haben wirksame Routinen der Datensicherung. Lokale Medien wie der eigene CD, DVDs oder CDs sind in mancherlei Hinsicht dem traditionellen Buch unterlegen. Für verteilte Datenbestände, die regelmäßig gesichert werden und in Standardformaten abgespeichert sind, gilt das nicht.
Ein nicht vernachlässigbarer Teil der "digital born records" liegt in einer Form vor, die man nicht einfach ausdrucken kann (auf alterungsbeständigem Papier, mit alterungsbeständigem Toner). Wenn man nicht auf sie verzichten will, muss man sie digital erhalten. Initiativen wie NESTOR http://langzeitarchivierung.de/ zeigen, dass man an Lösungen arbeitet und Zuversicht begründet ist.
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 22:12 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liest man in der taz:
http://www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/mit-kippa-und-totenkopfflagge/
Siehe dazu im Netz:
http://www.jewishjournal.com/up_front/article/ahoy_mateys_thar_be_jewish_pirates_20060915/
Buch von Edward Kritzler 2008:
http://www.amazon.com/Jewish-Pirates-Caribbean-Swashbuckling-Freedom/dp/0385513984

http://www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/mit-kippa-und-totenkopfflagge/
Siehe dazu im Netz:
http://www.jewishjournal.com/up_front/article/ahoy_mateys_thar_be_jewish_pirates_20060915/
Buch von Edward Kritzler 2008:
http://www.amazon.com/Jewish-Pirates-Caribbean-Swashbuckling-Freedom/dp/0385513984

KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 21:55 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Leserbrief
Was nicht im Internet existiert, wird verloren sein
Zu "Unsere Kultur ist in Gefahr" von Roland Reuß (F.A.Z. vom 25. April): Die Verächter des elektronischen Publizierens haben zuletzt auf polemische Weise wissentlich zwei Dinge durcheinandergeworfen, die es zu unterscheiden gilt. Einmal ist da die Google-Initiative, die urheberrechtsgebundene Werke kopiert und im Internet zur Verfügung stellt. Es dürfte außer Frage stehen, dass hiermit massiv gegen deutsches Recht verstoßen wird. Auf der anderen Seite ist das von vielen (eigentlich von allen) Wissenschaftsorganisationen propagierte Prinzip des "open access", dessen Vorteile in Sachen Sichtbarkeit und Kostengünstigkeit auf der Hand liegen. Dabei spielt der Aspekt der Sichtbarkeit eigentlich die Hauptrolle. Untersuchungen belegen, dass Publikationen im Internet schon jetzt mehr wahrgenommen werden als traditionell gedruckte. Wie mag das erst in Zukunft sein? Und an den Universitäten ist es ganz einfach so, dass Studierende Veröffentlichungen tendenziell nur noch wahrnehmen, wenn sie im Internet zur Verfügung stehen. Der Trend wird sich absehbar verstärken, und es sei die These gewagt, dass über kurz oder lang das, was nicht im Internet existiert, praktisch verloren ist.
Wer also seinen Kampf gegen die neuen Veröffentlichungsformen mit Untertönen versieht, die nach Verteidigung europäischer Kultur gegen amerikanischen Kulturimperialismus klingen, sollte sich fragen, ob er nicht das Gegenteil von dem tut, was er angeblich anstrebt. Ob er nicht zum Totengräber Europas dadurch wird, dass er ihm seine Präsenz in einem Medium verweigert, das seine Dominanz mit Macht durchsetzen wird. Das Problem dabei: Man muss in der Tat den Mut haben, die Kultur von der Zukunft her zu denken und nicht immer die Bedingungen der Vergangenheit absolut zu setzen, die gerade dabei sind, radikal verändert zu werden. Und man muss willens sein, der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, ob man sie mag oder nicht.
Eine zweite Polemik ist gleichfalls irreführend. Es wird so getan, als würden die Wissenschaftsfinanzierer, also insbesondere die DFG, ihre Förderung regelmäßig mit der Auflage verbinden, die Ergebnisse der Forschungen nach den Regeln des "open access" zu veröffentlichen. Als ehemaliges Mitglied eines DFG-Fachausschusses kann ich guten Gewissens sagen: Das Gegenteil ist der Fall. Zumindest in den Geisteswissenschaften wünschte man sich eher, dass eine solche Auflage ein wenig häufiger gemacht würde. Und kann es rechtswidrig sein, wenn ein Geldgeber Auflagen für die Mittelverwendung formuliert, Auflagen, deren Berechtigung inzwischen außer Frage steht?
Für die Wissenschaftsverlage ist der Trend zum "open access" vielleicht doch gar kein so großes Problem. Es spricht vieles dafür, dass vollständig im Internet vorliegende Texte trotzdem in Druckform gekauft werden, weil sich die Begeisterung, stundenlang zu lesen, offenbar in Grenzen hält. Dass sich die Verlage im Übrigen Gedanken machen müssen, wie sie mit dem und nicht gegen das Internet in Zukunft Geschäfte machen können, liegt gleichwohl auf der Hand.
PROFESSOR DR. HUBERTUS KOHLE, MÜNCHEN
F.A.Z., 30.04.2009, Nr. 100 / Seite 35
Was nicht im Internet existiert, wird verloren sein
Zu "Unsere Kultur ist in Gefahr" von Roland Reuß (F.A.Z. vom 25. April): Die Verächter des elektronischen Publizierens haben zuletzt auf polemische Weise wissentlich zwei Dinge durcheinandergeworfen, die es zu unterscheiden gilt. Einmal ist da die Google-Initiative, die urheberrechtsgebundene Werke kopiert und im Internet zur Verfügung stellt. Es dürfte außer Frage stehen, dass hiermit massiv gegen deutsches Recht verstoßen wird. Auf der anderen Seite ist das von vielen (eigentlich von allen) Wissenschaftsorganisationen propagierte Prinzip des "open access", dessen Vorteile in Sachen Sichtbarkeit und Kostengünstigkeit auf der Hand liegen. Dabei spielt der Aspekt der Sichtbarkeit eigentlich die Hauptrolle. Untersuchungen belegen, dass Publikationen im Internet schon jetzt mehr wahrgenommen werden als traditionell gedruckte. Wie mag das erst in Zukunft sein? Und an den Universitäten ist es ganz einfach so, dass Studierende Veröffentlichungen tendenziell nur noch wahrnehmen, wenn sie im Internet zur Verfügung stehen. Der Trend wird sich absehbar verstärken, und es sei die These gewagt, dass über kurz oder lang das, was nicht im Internet existiert, praktisch verloren ist.
Wer also seinen Kampf gegen die neuen Veröffentlichungsformen mit Untertönen versieht, die nach Verteidigung europäischer Kultur gegen amerikanischen Kulturimperialismus klingen, sollte sich fragen, ob er nicht das Gegenteil von dem tut, was er angeblich anstrebt. Ob er nicht zum Totengräber Europas dadurch wird, dass er ihm seine Präsenz in einem Medium verweigert, das seine Dominanz mit Macht durchsetzen wird. Das Problem dabei: Man muss in der Tat den Mut haben, die Kultur von der Zukunft her zu denken und nicht immer die Bedingungen der Vergangenheit absolut zu setzen, die gerade dabei sind, radikal verändert zu werden. Und man muss willens sein, der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, ob man sie mag oder nicht.
Eine zweite Polemik ist gleichfalls irreführend. Es wird so getan, als würden die Wissenschaftsfinanzierer, also insbesondere die DFG, ihre Förderung regelmäßig mit der Auflage verbinden, die Ergebnisse der Forschungen nach den Regeln des "open access" zu veröffentlichen. Als ehemaliges Mitglied eines DFG-Fachausschusses kann ich guten Gewissens sagen: Das Gegenteil ist der Fall. Zumindest in den Geisteswissenschaften wünschte man sich eher, dass eine solche Auflage ein wenig häufiger gemacht würde. Und kann es rechtswidrig sein, wenn ein Geldgeber Auflagen für die Mittelverwendung formuliert, Auflagen, deren Berechtigung inzwischen außer Frage steht?
Für die Wissenschaftsverlage ist der Trend zum "open access" vielleicht doch gar kein so großes Problem. Es spricht vieles dafür, dass vollständig im Internet vorliegende Texte trotzdem in Druckform gekauft werden, weil sich die Begeisterung, stundenlang zu lesen, offenbar in Grenzen hält. Dass sich die Verlage im Übrigen Gedanken machen müssen, wie sie mit dem und nicht gegen das Internet in Zukunft Geschäfte machen können, liegt gleichwohl auf der Hand.
PROFESSOR DR. HUBERTUS KOHLE, MÜNCHEN
F.A.Z., 30.04.2009, Nr. 100 / Seite 35
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 19:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Noch ehe Oberbürgermeister Schramma sie am 11. Mai zu einer ersten Informationsveranstaltung über den aktuellen Bergungsstand im Rathaus empfängt, haben mehrere Depositare einen Rechtsanwalt eingeschaltet, um Schadensersatz geltend zu machen. Einer von ihnen ist der Regisseur Franz-Josef Heumannskämper, der den ihm anvertrauten Nachlass des Baritons William Pearson (1934 bis 1995) dem Archiv 1998 übergeben hatte.
Wie der Kölner Anwalt Louis Peters, der Heumannskämper vertritt, in einem Schreiben an das Rechts- und Versicherungsamt der Stadt Köln darlegt, hat sich das Historische Archiv gemäß Vertrag verpflichtet, „größte Sorgfalt für die Erhaltung des Nachlasses walten zu lassen, das Archivgut instand zu halten und – bei Bedarf – instandzusetzen“. Schon als sich im September 2005 „bedrohliche Risse“ an der benachbarten Kirche St. Johann Baptist zeigten, so der Anwalt weiter, wäre es Aufgabe der Gebäudewirtschaft gewesen, „das Archivgut mit fremden Rechten durch Auslagerung in Sicherheit zu bringen“. Auch der Leitung des Archivs hält Peters Versäumnisse vor: „Wäre damals unsere Mandantschaft ordnungsgemäß informiert worden, so wäre der in 47 Kästen befindliche Nachlass sofort auf eigene Kosten zur Fremdlagerung zurück- und bis zum Abschluss des U-Bahn-Baus in sichere Verwahrung genommen worden.
Der Nachlass von William Pearson, der seit 1957 in Köln gelebt und als Protagonist der Avantgarde mit Komponisten wie Henze, Ligeti, Kagel, Schnebel oder Rihm korrespondiert hat, umfasst Noten, Partituren, Programme, Kritiken, Tonbänder, Fotos und Briefe. Sein Verlust erhellt die Auswirkungen der Katastrophe exemplarisch: So wollte ihm die University of Louisville, an der der Sänger studiert hat, 2009 eine Ausstellung ausrichten, die Heumannskämper, da sie ohne Berücksichtigung des Nachlasses nicht mehr möglich ist, ebenso absagen musste wie ein Filmprojekt über Pearson.
Schließlich hält Louis Peters, der entsprechende Regressansprüche auch namens weiterer Mandanten geltend macht, der Stadt Köln vor, dass die Bestandsverzeichnisse mit den Verträgen nach dem 3. März im erhalten gebliebenen Flachbau vorlagen, ohne dass die Leihgeber irgendeine Information erhalten hätten: „Ein solches Vertragsverhalten wäre unter Privatleuten völlig ausgeschlossen.“
Quelle: FAZ
Wie der Kölner Anwalt Louis Peters, der Heumannskämper vertritt, in einem Schreiben an das Rechts- und Versicherungsamt der Stadt Köln darlegt, hat sich das Historische Archiv gemäß Vertrag verpflichtet, „größte Sorgfalt für die Erhaltung des Nachlasses walten zu lassen, das Archivgut instand zu halten und – bei Bedarf – instandzusetzen“. Schon als sich im September 2005 „bedrohliche Risse“ an der benachbarten Kirche St. Johann Baptist zeigten, so der Anwalt weiter, wäre es Aufgabe der Gebäudewirtschaft gewesen, „das Archivgut mit fremden Rechten durch Auslagerung in Sicherheit zu bringen“. Auch der Leitung des Archivs hält Peters Versäumnisse vor: „Wäre damals unsere Mandantschaft ordnungsgemäß informiert worden, so wäre der in 47 Kästen befindliche Nachlass sofort auf eigene Kosten zur Fremdlagerung zurück- und bis zum Abschluss des U-Bahn-Baus in sichere Verwahrung genommen worden.
Der Nachlass von William Pearson, der seit 1957 in Köln gelebt und als Protagonist der Avantgarde mit Komponisten wie Henze, Ligeti, Kagel, Schnebel oder Rihm korrespondiert hat, umfasst Noten, Partituren, Programme, Kritiken, Tonbänder, Fotos und Briefe. Sein Verlust erhellt die Auswirkungen der Katastrophe exemplarisch: So wollte ihm die University of Louisville, an der der Sänger studiert hat, 2009 eine Ausstellung ausrichten, die Heumannskämper, da sie ohne Berücksichtigung des Nachlasses nicht mehr möglich ist, ebenso absagen musste wie ein Filmprojekt über Pearson.
Schließlich hält Louis Peters, der entsprechende Regressansprüche auch namens weiterer Mandanten geltend macht, der Stadt Köln vor, dass die Bestandsverzeichnisse mit den Verträgen nach dem 3. März im erhalten gebliebenen Flachbau vorlagen, ohne dass die Leihgeber irgendeine Information erhalten hätten: „Ein solches Vertragsverhalten wäre unter Privatleuten völlig ausgeschlossen.“
Quelle: FAZ
Wolf Thomas - am Mittwoch, 29. April 2009, 19:09 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 18:56 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1. Schupp, Volker (2006) Die Gründung der „Gesellschaft der Freunde vaterländischer Geschichte an den Quellen der Donau“ im Spiegel der geistesgeschichtlichen Strömungen der Zeit : Festvortrag zum 200-jährigen Jubiläum, gehalten in Donaueschingen am 22. Januar 2005 Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar 49 (2006), S. 8-27
2. Schupp, Volker (2004) Ekkehard von St. Gallen und "Konrad von Alzey" : zwei mittelalterliche Dichterfiguren im 19. Jahrhundert Andreas Bihrer (Hrsg.): Nova de veteribus: mittel- und neulateinische Studien für Paul Gerhard Schmidt. München: Saur, 2004, S. [1087]-1107
3. Schupp, Volker (2004) Mittelalterrezeption im deutschen Südwesten Hansmartin Schwarzmaier (Hrsg.): Das Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts am Oberrhein. Ostfildern: Thorbecke, 2004, S. [9]-30
4. Schupp, Volker (2004) Vitae parallelae Kettenbrüder: Joseph von Laßberg und Werner von Haxthausen : dem Donaueschinger Konrad Kunze zum 65. Geburtstag Badische Heimat 3 (2004), S. 354-369
5. Schupp, Volker (2002) Versteigerung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen Librarium: Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft 45 (2002), S. 17-22
6. Schupp, Volker (2001) Die Erneuerungsbewegung in Freiburg während der frühen Lebensreform : Emil Gött und sein Freundeskreis: Literatur und Leben Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 149 = N.F. 110 (2001), S. [393]-421
7. Schupp, Volker (2000) Der Bilderzyklus von Tristan und Isolde im Sommerhaus Helmut Rizzolli (Hrsg.): Schloß Runkelstein - die Bilderburg: ein neues kultur-touristisches Modell, "Die sanfte Erschließung". Bozen: Athesia, 2000, S. 331-350
8. Schupp, Volker (1998) Joseph von Laßberg : "Hartmann von Aue, ein Schweizer, und zwar ein Thurgauer?" André Schnyder (Hrsg.): Ist mir getroumet min leben? Vom Träumen und vom Anderssein: Festschrift für Karl-Ernst Geith zum 65. Geburtstag. Göppingen: Kümmerle, 1998, S. 127-139
9. Schupp, Volker (1997) Die Hilfe der Kodikologie beim Verständnis althochdeutscher Texte : Vortrag zur akademischen Gedenkfeier für Johanne Autenrieth am 17. Januar 1997 Freiburger Universitätsblätter 136 (1997), S. 57-77
10. Schupp, Volker (1996) Joseph von Laßberg, die Fürstlich-Fürstenbergische Handschriftensammlung und Johann Leonhard Hug, Professor an der Universität Freiburg : dem Andenken an Helmut Staubach Freiburger Universitätsblätter 131 (1996), S. 93-106
11. Schupp, Volker (1994) Zu Hartmann Schedels Weltchronik Heinrich Löffler (Hrsg.): Texttyp, Sprechergruppe, Kommunikationsbereich: Studien zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart; Festschrift für Hugo Steger zum 65. Geburtstag. Berlin: de Gruyter 1994, S. [52]-67
12. Schupp, Volker (1993) Joseph von Laßberg als Handschriftensammler Felix Heinzer (Hrsg.): "Unberechenbare Zinsen": bewahrtes Kulturerbe; Katalog zur Ausstellung der vom Land Baden-Württemberg erworbenen Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek; [Württ. Landesbibliothek, 28.10. - 18.12.1993 ...]. Stuttgart: WLB, 1993, S. 14-33
13. Schupp, Volker (1989) Die Nacht in Emmendingen, Johann Peter Hebel und das Oberland Rüdiger Schnell (Hrsg.): Gotes und der werlde hulde: Literatur in Mittelalter und Neuzeit; Festschrift für Heinz Rupp zum 70. Geburtstag. Bern: Franke, 1989, S. 312-331
14. Schupp, Volker (1985) Poetische Gipfelstürmer : die literarische Erstbesteigung der Schwarzwaldberge; Vortrag gehalten zur Eröffnung der Ausstellung "Johann Peter Hebel - eine Wiederbegegnung zum 225. Geburtstag" am 27. September 1985 in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe Vorträge / Badische Landesbibliothek ; 9. - 3-89065-010-4
15. Schupp, Volker (1984) Monumentum aere perennius? : vom Fortleben mittelhochdeutscher Dichtung Freiburger Universitätsblätter 83 (1984), S. 13-25
16. Schupp, Volker (1983) "Die Mönche von Kolmar" : ein Beitrag zur Phänomenologie und zum Begriff des schwarzen Humors Karl-Heinz Schirmer (Hrsg.): Das Märe: die mittelhochdeutsche Versnovelle des späteren Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. [229]-255
17. Schupp, Volker (1983) Der "Kurfürstenspruch" Reinmars von Zweter Rüdiger Schnell (Hrsg.): Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. 268-276
18. Schupp, Volker (1983) Die Mariencantilenen des Gottfried von Hagenau : Johanne Autenrieth zum 60. Geburtstag Mittellateinisches Jahrbuch 18 (1983), S. [256]-263
19. Schupp, Volker (1983) Reinmar von Zweter, Dichter Kaiser Friedrichs II. Rüdiger Schnell (Hrsg.): Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. 247-267
20. Schupp, Volker (1982) Die Ywain-Erzählung von Schloss Rodenegg Egon Kühebacher (Hrsg.): Literatur und bildende Kunst im Tiroler Mittelalter: die Iwein-Fresken von Rodenegg und andere Zeugnisse der Wechselwirkung von Literatur und bildender Kunst. Innsbruck: Inst. für Germanistik, 1982 (Innsbrucker Beitr. zur Kulturwiss.: Germanistische Reihe ; 15), S. 1-27
21. Schupp, Volker (1981) Sinclair in Wien Christoph Jamme (Hrsg.): Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte: Studien zum Freundeskreis um Hegel und Hölderlin. Stuttgart: Klett-Cotta, 1981, S. 231-244
22. Schupp, Volker (1980) Gregorius - der guote sündaere unter Rittern, Mönchen und Devoten Günter Schnitzler (Hrsg.): Bild und Gedanke: Festschrift für Gerhart Baumann zum 60. Geburtstag. München: Fink, 1980, S. 165-186
23. Schupp, Volker (1979) Heldenepik als Problem der Literaturgeschichtsschreibung : Überlegungen am Beispiel des "Buches von Bern" Egon Kühebacher (Hrsg.): Deutsche Heldenepik in Tirol. Bozen: Athesia-Verl., 1979, S. 68-104
24. Schupp, Volker (1978) Fünf Briefe des Freiherrn Joseph von Laßberg an Jacob und Wilhelm Grimm : Friedrich Maurer zum 80. Geburtstag Euphorion 72 (1978), S. [277]-301
25. Schupp, Volker (1978) Unbekannte Briefe des Reichsfreiherrn Joseph von Laßberg an Friedrich Carl Freiherrn von und zu Brenken Westfälische Zeitschrift 128 (1978), S. [119]-159
26. Schupp, Volker (1976) Literaturgeschichtliche Landeskunde? Alemannica: landeskundliche Beiträge; Festschrift für Bruno Boesch zum 65. Geburtstag [am 13. März 1976]. Bühl: Konkordia, 1976. (Alemannisches Jahrbuch ; 1973/75), S. 272-298
27. Schupp, Volker (1975) Kritische Anmerkungen zur Rezeption des deutschen Artusromans anhand von Hartmanns "Iwein" : Theorie, Text, Bildmaterial Frühmittelalterliche Studien 9 (1975), S. [405]-442, Taf.
28. Schupp, Volker (1972) Die Eigilviten des Candidus (Bruun) von Fulda : eine Studie zum Problem des "opus geminatum" Studi di letteratura religiosa tedesca: in memoria di Sergio Lupi. Firenze: Olschki, 1972 (Rivista di storia e letteratura religiosa : Biblioteca. Studi e testi ; 4), S. 177-220
29. Schupp, Volker (1968) Zur Datierung des "Grafen Rudolf" Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 97 (1968), H. 4, S. 37-56
30. Schupp, Volker (1959) Die "Auslegung des Vaterunsers" und ihre Bauform Der Deutschunterricht: Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftliche Grundlegung 11 (1959), H. 2, S. [25]-34
http://www.freidok.uni-freiburg.de/
2. Schupp, Volker (2004) Ekkehard von St. Gallen und "Konrad von Alzey" : zwei mittelalterliche Dichterfiguren im 19. Jahrhundert Andreas Bihrer (Hrsg.): Nova de veteribus: mittel- und neulateinische Studien für Paul Gerhard Schmidt. München: Saur, 2004, S. [1087]-1107
3. Schupp, Volker (2004) Mittelalterrezeption im deutschen Südwesten Hansmartin Schwarzmaier (Hrsg.): Das Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts am Oberrhein. Ostfildern: Thorbecke, 2004, S. [9]-30
4. Schupp, Volker (2004) Vitae parallelae Kettenbrüder: Joseph von Laßberg und Werner von Haxthausen : dem Donaueschinger Konrad Kunze zum 65. Geburtstag Badische Heimat 3 (2004), S. 354-369
5. Schupp, Volker (2002) Versteigerung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen Librarium: Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft 45 (2002), S. 17-22
6. Schupp, Volker (2001) Die Erneuerungsbewegung in Freiburg während der frühen Lebensreform : Emil Gött und sein Freundeskreis: Literatur und Leben Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 149 = N.F. 110 (2001), S. [393]-421
7. Schupp, Volker (2000) Der Bilderzyklus von Tristan und Isolde im Sommerhaus Helmut Rizzolli (Hrsg.): Schloß Runkelstein - die Bilderburg: ein neues kultur-touristisches Modell, "Die sanfte Erschließung". Bozen: Athesia, 2000, S. 331-350
8. Schupp, Volker (1998) Joseph von Laßberg : "Hartmann von Aue, ein Schweizer, und zwar ein Thurgauer?" André Schnyder (Hrsg.): Ist mir getroumet min leben? Vom Träumen und vom Anderssein: Festschrift für Karl-Ernst Geith zum 65. Geburtstag. Göppingen: Kümmerle, 1998, S. 127-139
9. Schupp, Volker (1997) Die Hilfe der Kodikologie beim Verständnis althochdeutscher Texte : Vortrag zur akademischen Gedenkfeier für Johanne Autenrieth am 17. Januar 1997 Freiburger Universitätsblätter 136 (1997), S. 57-77
10. Schupp, Volker (1996) Joseph von Laßberg, die Fürstlich-Fürstenbergische Handschriftensammlung und Johann Leonhard Hug, Professor an der Universität Freiburg : dem Andenken an Helmut Staubach Freiburger Universitätsblätter 131 (1996), S. 93-106
11. Schupp, Volker (1994) Zu Hartmann Schedels Weltchronik Heinrich Löffler (Hrsg.): Texttyp, Sprechergruppe, Kommunikationsbereich: Studien zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart; Festschrift für Hugo Steger zum 65. Geburtstag. Berlin: de Gruyter 1994, S. [52]-67
12. Schupp, Volker (1993) Joseph von Laßberg als Handschriftensammler Felix Heinzer (Hrsg.): "Unberechenbare Zinsen": bewahrtes Kulturerbe; Katalog zur Ausstellung der vom Land Baden-Württemberg erworbenen Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek; [Württ. Landesbibliothek, 28.10. - 18.12.1993 ...]. Stuttgart: WLB, 1993, S. 14-33
13. Schupp, Volker (1989) Die Nacht in Emmendingen, Johann Peter Hebel und das Oberland Rüdiger Schnell (Hrsg.): Gotes und der werlde hulde: Literatur in Mittelalter und Neuzeit; Festschrift für Heinz Rupp zum 70. Geburtstag. Bern: Franke, 1989, S. 312-331
14. Schupp, Volker (1985) Poetische Gipfelstürmer : die literarische Erstbesteigung der Schwarzwaldberge; Vortrag gehalten zur Eröffnung der Ausstellung "Johann Peter Hebel - eine Wiederbegegnung zum 225. Geburtstag" am 27. September 1985 in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe Vorträge / Badische Landesbibliothek ; 9. - 3-89065-010-4
15. Schupp, Volker (1984) Monumentum aere perennius? : vom Fortleben mittelhochdeutscher Dichtung Freiburger Universitätsblätter 83 (1984), S. 13-25
16. Schupp, Volker (1983) "Die Mönche von Kolmar" : ein Beitrag zur Phänomenologie und zum Begriff des schwarzen Humors Karl-Heinz Schirmer (Hrsg.): Das Märe: die mittelhochdeutsche Versnovelle des späteren Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. [229]-255
17. Schupp, Volker (1983) Der "Kurfürstenspruch" Reinmars von Zweter Rüdiger Schnell (Hrsg.): Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. 268-276
18. Schupp, Volker (1983) Die Mariencantilenen des Gottfried von Hagenau : Johanne Autenrieth zum 60. Geburtstag Mittellateinisches Jahrbuch 18 (1983), S. [256]-263
19. Schupp, Volker (1983) Reinmar von Zweter, Dichter Kaiser Friedrichs II. Rüdiger Schnell (Hrsg.): Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1983, S. 247-267
20. Schupp, Volker (1982) Die Ywain-Erzählung von Schloss Rodenegg Egon Kühebacher (Hrsg.): Literatur und bildende Kunst im Tiroler Mittelalter: die Iwein-Fresken von Rodenegg und andere Zeugnisse der Wechselwirkung von Literatur und bildender Kunst. Innsbruck: Inst. für Germanistik, 1982 (Innsbrucker Beitr. zur Kulturwiss.: Germanistische Reihe ; 15), S. 1-27
21. Schupp, Volker (1981) Sinclair in Wien Christoph Jamme (Hrsg.): Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte: Studien zum Freundeskreis um Hegel und Hölderlin. Stuttgart: Klett-Cotta, 1981, S. 231-244
22. Schupp, Volker (1980) Gregorius - der guote sündaere unter Rittern, Mönchen und Devoten Günter Schnitzler (Hrsg.): Bild und Gedanke: Festschrift für Gerhart Baumann zum 60. Geburtstag. München: Fink, 1980, S. 165-186
23. Schupp, Volker (1979) Heldenepik als Problem der Literaturgeschichtsschreibung : Überlegungen am Beispiel des "Buches von Bern" Egon Kühebacher (Hrsg.): Deutsche Heldenepik in Tirol. Bozen: Athesia-Verl., 1979, S. 68-104
24. Schupp, Volker (1978) Fünf Briefe des Freiherrn Joseph von Laßberg an Jacob und Wilhelm Grimm : Friedrich Maurer zum 80. Geburtstag Euphorion 72 (1978), S. [277]-301
25. Schupp, Volker (1978) Unbekannte Briefe des Reichsfreiherrn Joseph von Laßberg an Friedrich Carl Freiherrn von und zu Brenken Westfälische Zeitschrift 128 (1978), S. [119]-159
26. Schupp, Volker (1976) Literaturgeschichtliche Landeskunde? Alemannica: landeskundliche Beiträge; Festschrift für Bruno Boesch zum 65. Geburtstag [am 13. März 1976]. Bühl: Konkordia, 1976. (Alemannisches Jahrbuch ; 1973/75), S. 272-298
27. Schupp, Volker (1975) Kritische Anmerkungen zur Rezeption des deutschen Artusromans anhand von Hartmanns "Iwein" : Theorie, Text, Bildmaterial Frühmittelalterliche Studien 9 (1975), S. [405]-442, Taf.
28. Schupp, Volker (1972) Die Eigilviten des Candidus (Bruun) von Fulda : eine Studie zum Problem des "opus geminatum" Studi di letteratura religiosa tedesca: in memoria di Sergio Lupi. Firenze: Olschki, 1972 (Rivista di storia e letteratura religiosa : Biblioteca. Studi e testi ; 4), S. 177-220
29. Schupp, Volker (1968) Zur Datierung des "Grafen Rudolf" Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 97 (1968), H. 4, S. 37-56
30. Schupp, Volker (1959) Die "Auslegung des Vaterunsers" und ihre Bauform Der Deutschunterricht: Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftliche Grundlegung 11 (1959), H. 2, S. [25]-34
http://www.freidok.uni-freiburg.de/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://heidelbergerrechtshistorischegesellschaft.blog.uni-heidelberg.de/2009/04/23/ein-puzzle-fur-generationen-rettung-des-kolner-stadtarchivs/
Vortrag der Heidelberger Rechsthistorischen Gesellschaft
„Ein Puzzle für Generationen“ - Untergang und Rettung des Kölner Stadtarchivs
Öffentlicher Vortrag von Frau Diplom-Archivarin Sabrina Zinke, M.A., am
5. Mai 2009, 20.00 Uhr c.t.
im Bibliothekssaal des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft
Die Refrerentin ist Mitarbeiterin des UA HD:
http://www.uni-heidelberg.de/organe/uar/anschrift/mitar_dt.htm
Vortrag der Heidelberger Rechsthistorischen Gesellschaft
„Ein Puzzle für Generationen“ - Untergang und Rettung des Kölner Stadtarchivs
Öffentlicher Vortrag von Frau Diplom-Archivarin Sabrina Zinke, M.A., am
5. Mai 2009, 20.00 Uhr c.t.
im Bibliothekssaal des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft
Die Refrerentin ist Mitarbeiterin des UA HD:
http://www.uni-heidelberg.de/organe/uar/anschrift/mitar_dt.htm
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 18:18 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 17:40 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
On Tuesday, Judge Denny Chin of Federal District Court in New York, who is overseeing the settlement, postponed by four months the May 5 deadline for authors to opt out of the settlement and for other parties to oppose it or file briefs. The decision follows requests by groups of authors and their heirs, who argued that authors needed more time to review the settlement.
http://www.nytimes.com/2009/04/29/technology/internet/29google.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2009/04/29/technology/internet/29google.html?_r=2
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 16:57 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://vincentrobijn.blogspot.com/
(Auszüge, allgemein Bekanntes ist nicht übersetzt, und insgesamt: no comment)
Heute war der erste Tag der Blue-Shield-Rettungsaktion für das Stadtarchiv Köln. Um 6 Uhr fuhr der Pendelbus von unserer Unterkunft los, einer spartanisch eingerichteten Kaserne, die nur in Notfallzeiten gebraucht wird und gewaltig wie im Kalten Krieg wirkt. ... Ein Teil der Kollegen geht ins Obergeschoss zur Entfeuchtung, die anderen säubern und inventarisieren. ... Es ist gute Arbeit, die wir tun, wenn auch mühsam. Am Feierabend hatte ich den Staub sogar in meinen Ohren. ... Elf von 30 Kilometern sind nun aus dem Loch geholt. Es ist also noch genug zu tun. Glücklicherweise sind wir genügend Freiwillige. Durch einen Planungsfehler der Organisation sind nicht 70, sondern 140 Freiwillige her, wodurch hier viel los und der Arbeitsdruck etwas weniger stark ist.
Am zweiten Tag herrscht bereits Routine. .... Seit Montag haben wir mit dem ganzen Team aus deutschen und internationalen Freiwilligen bereits 700 blaue Wannen gefüllt. Das ergibt ungefähr 700 Meter. Wenn das so weitergeht, haben wir am Ende der Woche 1,5 Kilometer weggeschafft, ein prächtiges Resultat. Inzwischen wird in drei Schichten von je 40 Freiwilligen gearbeitet. Die deutsche Organsiation hat ziemlich viel zu tun. Alle die Menschen brauchen Essen, Trinken und Transport. Dass deswegen ab und zu etwas schief geht, ist dann auch logisch. Wir mussten heute zwei Stunden im Regen auf einen Bus warten, erhielten aber eine prima Kohlmahlzeit (mit Bratwurst). ... Morgen bekommen wir hohen Besuch: den Vorsitzenden des International Council of Archives und den Chef des deutschen Bundesarchivs.
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
(Auszüge, allgemein Bekanntes ist nicht übersetzt, und insgesamt: no comment)
Heute war der erste Tag der Blue-Shield-Rettungsaktion für das Stadtarchiv Köln. Um 6 Uhr fuhr der Pendelbus von unserer Unterkunft los, einer spartanisch eingerichteten Kaserne, die nur in Notfallzeiten gebraucht wird und gewaltig wie im Kalten Krieg wirkt. ... Ein Teil der Kollegen geht ins Obergeschoss zur Entfeuchtung, die anderen säubern und inventarisieren. ... Es ist gute Arbeit, die wir tun, wenn auch mühsam. Am Feierabend hatte ich den Staub sogar in meinen Ohren. ... Elf von 30 Kilometern sind nun aus dem Loch geholt. Es ist also noch genug zu tun. Glücklicherweise sind wir genügend Freiwillige. Durch einen Planungsfehler der Organisation sind nicht 70, sondern 140 Freiwillige her, wodurch hier viel los und der Arbeitsdruck etwas weniger stark ist.
Am zweiten Tag herrscht bereits Routine. .... Seit Montag haben wir mit dem ganzen Team aus deutschen und internationalen Freiwilligen bereits 700 blaue Wannen gefüllt. Das ergibt ungefähr 700 Meter. Wenn das so weitergeht, haben wir am Ende der Woche 1,5 Kilometer weggeschafft, ein prächtiges Resultat. Inzwischen wird in drei Schichten von je 40 Freiwilligen gearbeitet. Die deutsche Organsiation hat ziemlich viel zu tun. Alle die Menschen brauchen Essen, Trinken und Transport. Dass deswegen ab und zu etwas schief geht, ist dann auch logisch. Wir mussten heute zwei Stunden im Regen auf einen Bus warten, erhielten aber eine prima Kohlmahlzeit (mit Bratwurst). ... Morgen bekommen wir hohen Besuch: den Vorsitzenden des International Council of Archives und den Chef des deutschen Bundesarchivs.
http://archiv.twoday.net/stories/5667559
http://archiv.twoday.net/stories/5667521
Dietmar Bartz - am Mittwoch, 29. April 2009, 16:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 15:40 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vier Bände der Editionsreihe sind als PDFs online.
Via
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20090423-10131336
Via
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20090423-10131336
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 15:29 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dpma.de/service/aktuelles/startdpma-register/index.html
Gestern startete " DPMAregister für das Schutzrecht Marken einschließlich Geografischer Herkunftsangaben, die neue Internetplattform für die integrierte Veröffentlichung der amtlichen Publikationen und der Registerdaten mit aktuellen Rechts-und Verfahrensstandsinformationen zu einem Schutzrecht.
DPMAregister eignet sich insbesondere für die Recherche nach angemeldeten, eingetragenen und erteilten Schutzrechten, für die Ermittlung des aktuellen Rechtsstands zu einem Schutzrecht sowie für die regelmäßige und systematische Überprüfung neu publizierter Schutzrechte im Rahmen eines Monitoring.
Gleichzeitig werden die bisherigen Dienste DPINFO und DPMApublikationen für das Schutzrecht Marke abgeschaltet.
Die Integration der anderen Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster einschließlich Topografien und Geschmacksmuster in DPMAregister erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt."
So sah bisher die Suche bei DPINFO aus:
 Via markenblog.de
Via markenblog.de
Gestern startete " DPMAregister für das Schutzrecht Marken einschließlich Geografischer Herkunftsangaben, die neue Internetplattform für die integrierte Veröffentlichung der amtlichen Publikationen und der Registerdaten mit aktuellen Rechts-und Verfahrensstandsinformationen zu einem Schutzrecht.
DPMAregister eignet sich insbesondere für die Recherche nach angemeldeten, eingetragenen und erteilten Schutzrechten, für die Ermittlung des aktuellen Rechtsstands zu einem Schutzrecht sowie für die regelmäßige und systematische Überprüfung neu publizierter Schutzrechte im Rahmen eines Monitoring.
Gleichzeitig werden die bisherigen Dienste DPINFO und DPMApublikationen für das Schutzrecht Marke abgeschaltet.
Die Integration der anderen Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster einschließlich Topografien und Geschmacksmuster in DPMAregister erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt."
So sah bisher die Suche bei DPINFO aus:
 Via markenblog.de
Via markenblog.deKlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 15:17 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.jurablogs.com/
Auch wenn ich die zweispaltige Darstellung früherer Meldungen unübersichtlich fand, war es gut, so viele Meldungen auf der ersten Seite sichten zu können. Das Ranking erfasst nur 50 Blogs - Archivalia ist leider nicht darunter.
Auch wenn ich die zweispaltige Darstellung früherer Meldungen unübersichtlich fand, war es gut, so viele Meldungen auf der ersten Seite sichten zu können. Das Ranking erfasst nur 50 Blogs - Archivalia ist leider nicht darunter.
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 14:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jeanette Lamble, Pressesprecherin der Allianz "Schriftliches Kulturgut bewahren", hat dankenswerterweise die nachstehende Pressemitteilung zur Verfügung gestellt:
"Berlin, 28. April 2009
ZUKUNFT BEWAHREN
Bundespräsident Horst Köhler nimmt Denkschrift der Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten entgegen
Am 28. April übergab die Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten Bundespräsident Horst Köhler die Denkschrift ZUKUNFT BEWAHREN. Das Papier formuliert eine nationale Strategie sowie pragmatische Handlungsempfehlungen für die Sicherung der historischen bestände in Archiven und Bibliotheken. Bei der Übergabe appellierten die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin, Barbara Schneider-Kempf, der Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Thomas Bürger, der Präsident des Niedersächsischen Landesarchivs Hannover, Bernd Kappelhoff und der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar, Michael Knoche, vor allem an den Bund und die Länder, den Erhalt von originalen Dokumenten sowie deren Digitalisierung und Verfilmung effizienter zu organisieren und zu fördern. Die Denkschrift greift eine Forderung der Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" vom Dezember 2007 auf, eine nationale Konzeption für die Erhaltung von gefährdetem Kulturgut zu erarbeiten.
Das Elbehochwasser im Jahr 2002, der Brand in der Anna Amalia Bibliothek Weimar 2004, zuletzt der Einsturz des Stadtarchivs Köln rüttelten die Öffentlichkeit stets auf: Erschütterung über verlorenes Kulturgut und Freude über gerettete Bestände mündeten in spontane Hilfen. Der Bund sowie betroffene Länder und Kommunen legten Sonderfonds auf, Bibliotheken und Archive halfen mit fachlicher Kompetenz, Privatpersonen, Stiftungen und Firmen spendeten Geld. Durch diese Katastrophen nahm die Öffentlichkeit mehr als zuvor wahr, wie umfangreich und bedeutsam die kulturellen Schätze in deutschen Archiven und Bibliotheken sind. Dennoch fehlt es im föderal verfassten Deutschland noch immer an einer nationalen Strategie zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Deutschland, um den Schutz unserer wissenschaftlichen und kulturellen Überlieferung systematisch und nachhaltig zu organisieren.
Originale erhalten und digitalisieren
Originale – Archivgut, Handschriften, Nachlässe, seltene Druckwerke – müssen in ihrem Bestand gesichert werden. Die Anstrengungen der Bundesländer und Kommunen reichen nicht aus und sind unzureichend koordiniert. Ein national abgestimmtes Konzept soll festgelegen, welches Dokument, welcher Druck durch welche Einrichtung wie und wann im Original zu sichern ist. Für die jeweiligen Schadensbilder sind geeignete Therapien anzuwenden oder noch zu entwickeln, es kommt also auch auf die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen an.
Die häufigsten Schäden entstehen durch starke Benutzung und durch Materialveränderungen, z.B. Tintenfraß und Säurefraß, aber auch immer wieder durch unzureichende Lagerungs- und Klimabedingungen. Allein die Schäden durch säurehaltiges Papier, zwischen 1850 und 1990 überall verwendet, zeigen die Dimension der Aufgabe an: Etwa 9,6 Milliarden Blatt unikales Archivgut sowie etwa 60 Millionen Druckschriften in den Bibliotheken sind vom Säurefraß betroffen.
Noch immer sind umfangreiche Bestände aufgrund von Kriegsschäden nicht benutzbar und so der Forschung entzogen. Weitere zahlreiche Kostbarkeiten sind späteren Katastrophen (Feuer, Wasser, Einsturz von Gebäuden) zum Opfer gefallen und müssen so bald wie möglich zurück gewonnen werden.
Die Sicherung des Originals und seine nachfolgende Digitalisierung gehören heute zusammen. Ohne zeitliche und räumliche Begrenzung kann ein Dokument oder ein Objekt erforscht und dabei frei von Schäden gehalten werden. Die koordinierenden Strukturen für breit angelegte Digitalisierungsprogramme sind mit der Deutschen Digitalen Bibliothek auf nationaler Ebene bereits angelegt.
Defizite erkennen – gemeinsam handeln
In sieben Punkten fasst die Denkschrift ZUKUNFT BEWAHREN Handlungsempfehlungen an Bund und Länder zusammen:
Der Bund soll – in Abstimmung mit den Ländern - die Federführung für die Erarbeitung einer nationalen Konzeption für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes in Deutschland übernehmen. Nach gleichem Modell haben Bund und Länder bereits im Rahmen des Aufbaus der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammengearbeitet.
Die Länder sollen Landeskonzepte erarbeiten und miteinander abstimmen. Dazu müssen in den Archiven und Bibliotheken alle für die nationale Strategie relevanten Daten zusammengeführt werden. Die nötigen Infrastrukturen für diese Analysen sind einzurichten.
Zur Umsetzung der nationalen Strategie für Bestandserhaltung sollen der Bund und die Länder bei einer der großen Einrichtungen eine zentrale Koordinierungsstelle einrichten.
Die von den Unterhaltsträgern der Bibliotheken und Archive für Bestandserhaltung bereitgestellten Mittel müssen aufgestockt werden: Der Bund soll jährlich 10 Millionen € für den Erhalt von Originalen bereitstellen.
Die Entwicklung neuer und nachhaltiger Verfahren für die Sicherung von Archiv- und Bibliotheksgut sind mit Hilfe öffentlicher Stiftungen wie der Kulturstiftung der Länder oder der Kulturstiftung des Bundes weiter zu forcieren.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird gebeten, einen Teil ihrer Mittel darauf zu konzentrieren, die mit ihrer Hilfe nach 1950 erworbene ausländische Literatur ebenfalls dauerhaft zu erhalten.
Es wird weiterhin an die Öffentlichkeit appelliert, auch in Zukunft mit privatem Engagement die staatlichen Anstrengungen zu ergänzen, z.B. durch die Übernahme von Buchpatenschaften.
***
Folgende Einrichtungen sind an der Allianz beteiligt:
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main und Leipzig
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Niedersächsisches Landesarchiv Hannover
Bundesarchiv Koblenz und Berlin
Deutsches Literaturarchiv Marbach a. N.
Bayerische Staatsbibliothek München
Landesarchiv Baden-Württemberg Stuttgart
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
Vertreter folgender Institutionen nehmen an den Sitzungen der Allianz teil:
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Berlin
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Bonn
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Bonn
Deutscher Bibliotheksverband (mehrere Gremien)
Forum Bestandserhaltung, Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.
***
Kontakt zur Vorsitzenden der Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten:
Barbara Schneider-Kempf
Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Telefon: 030. 266 2301 oder 030. 266 1369 (Presse)"
Die Denkschrift ist seit heute Nachmittag auf der Startseite der Berliner Staatsbibliothek als PDF-Datei (Link) bereitgestellt.
"Berlin, 28. April 2009
ZUKUNFT BEWAHREN
Bundespräsident Horst Köhler nimmt Denkschrift der Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten entgegen
Am 28. April übergab die Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten Bundespräsident Horst Köhler die Denkschrift ZUKUNFT BEWAHREN. Das Papier formuliert eine nationale Strategie sowie pragmatische Handlungsempfehlungen für die Sicherung der historischen bestände in Archiven und Bibliotheken. Bei der Übergabe appellierten die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin, Barbara Schneider-Kempf, der Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Thomas Bürger, der Präsident des Niedersächsischen Landesarchivs Hannover, Bernd Kappelhoff und der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar, Michael Knoche, vor allem an den Bund und die Länder, den Erhalt von originalen Dokumenten sowie deren Digitalisierung und Verfilmung effizienter zu organisieren und zu fördern. Die Denkschrift greift eine Forderung der Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" vom Dezember 2007 auf, eine nationale Konzeption für die Erhaltung von gefährdetem Kulturgut zu erarbeiten.
Das Elbehochwasser im Jahr 2002, der Brand in der Anna Amalia Bibliothek Weimar 2004, zuletzt der Einsturz des Stadtarchivs Köln rüttelten die Öffentlichkeit stets auf: Erschütterung über verlorenes Kulturgut und Freude über gerettete Bestände mündeten in spontane Hilfen. Der Bund sowie betroffene Länder und Kommunen legten Sonderfonds auf, Bibliotheken und Archive halfen mit fachlicher Kompetenz, Privatpersonen, Stiftungen und Firmen spendeten Geld. Durch diese Katastrophen nahm die Öffentlichkeit mehr als zuvor wahr, wie umfangreich und bedeutsam die kulturellen Schätze in deutschen Archiven und Bibliotheken sind. Dennoch fehlt es im föderal verfassten Deutschland noch immer an einer nationalen Strategie zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Deutschland, um den Schutz unserer wissenschaftlichen und kulturellen Überlieferung systematisch und nachhaltig zu organisieren.
Originale erhalten und digitalisieren
Originale – Archivgut, Handschriften, Nachlässe, seltene Druckwerke – müssen in ihrem Bestand gesichert werden. Die Anstrengungen der Bundesländer und Kommunen reichen nicht aus und sind unzureichend koordiniert. Ein national abgestimmtes Konzept soll festgelegen, welches Dokument, welcher Druck durch welche Einrichtung wie und wann im Original zu sichern ist. Für die jeweiligen Schadensbilder sind geeignete Therapien anzuwenden oder noch zu entwickeln, es kommt also auch auf die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen an.
Die häufigsten Schäden entstehen durch starke Benutzung und durch Materialveränderungen, z.B. Tintenfraß und Säurefraß, aber auch immer wieder durch unzureichende Lagerungs- und Klimabedingungen. Allein die Schäden durch säurehaltiges Papier, zwischen 1850 und 1990 überall verwendet, zeigen die Dimension der Aufgabe an: Etwa 9,6 Milliarden Blatt unikales Archivgut sowie etwa 60 Millionen Druckschriften in den Bibliotheken sind vom Säurefraß betroffen.
Noch immer sind umfangreiche Bestände aufgrund von Kriegsschäden nicht benutzbar und so der Forschung entzogen. Weitere zahlreiche Kostbarkeiten sind späteren Katastrophen (Feuer, Wasser, Einsturz von Gebäuden) zum Opfer gefallen und müssen so bald wie möglich zurück gewonnen werden.
Die Sicherung des Originals und seine nachfolgende Digitalisierung gehören heute zusammen. Ohne zeitliche und räumliche Begrenzung kann ein Dokument oder ein Objekt erforscht und dabei frei von Schäden gehalten werden. Die koordinierenden Strukturen für breit angelegte Digitalisierungsprogramme sind mit der Deutschen Digitalen Bibliothek auf nationaler Ebene bereits angelegt.
Defizite erkennen – gemeinsam handeln
In sieben Punkten fasst die Denkschrift ZUKUNFT BEWAHREN Handlungsempfehlungen an Bund und Länder zusammen:
Der Bund soll – in Abstimmung mit den Ländern - die Federführung für die Erarbeitung einer nationalen Konzeption für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes in Deutschland übernehmen. Nach gleichem Modell haben Bund und Länder bereits im Rahmen des Aufbaus der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammengearbeitet.
Die Länder sollen Landeskonzepte erarbeiten und miteinander abstimmen. Dazu müssen in den Archiven und Bibliotheken alle für die nationale Strategie relevanten Daten zusammengeführt werden. Die nötigen Infrastrukturen für diese Analysen sind einzurichten.
Zur Umsetzung der nationalen Strategie für Bestandserhaltung sollen der Bund und die Länder bei einer der großen Einrichtungen eine zentrale Koordinierungsstelle einrichten.
Die von den Unterhaltsträgern der Bibliotheken und Archive für Bestandserhaltung bereitgestellten Mittel müssen aufgestockt werden: Der Bund soll jährlich 10 Millionen € für den Erhalt von Originalen bereitstellen.
Die Entwicklung neuer und nachhaltiger Verfahren für die Sicherung von Archiv- und Bibliotheksgut sind mit Hilfe öffentlicher Stiftungen wie der Kulturstiftung der Länder oder der Kulturstiftung des Bundes weiter zu forcieren.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird gebeten, einen Teil ihrer Mittel darauf zu konzentrieren, die mit ihrer Hilfe nach 1950 erworbene ausländische Literatur ebenfalls dauerhaft zu erhalten.
Es wird weiterhin an die Öffentlichkeit appelliert, auch in Zukunft mit privatem Engagement die staatlichen Anstrengungen zu ergänzen, z.B. durch die Übernahme von Buchpatenschaften.
***
Folgende Einrichtungen sind an der Allianz beteiligt:
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main und Leipzig
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Niedersächsisches Landesarchiv Hannover
Bundesarchiv Koblenz und Berlin
Deutsches Literaturarchiv Marbach a. N.
Bayerische Staatsbibliothek München
Landesarchiv Baden-Württemberg Stuttgart
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
Vertreter folgender Institutionen nehmen an den Sitzungen der Allianz teil:
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Berlin
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Bonn
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Bonn
Deutscher Bibliotheksverband (mehrere Gremien)
Forum Bestandserhaltung, Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.
***
Kontakt zur Vorsitzenden der Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten:
Barbara Schneider-Kempf
Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Telefon: 030. 266 2301 oder 030. 266 1369 (Presse)"
Die Denkschrift ist seit heute Nachmittag auf der Startseite der Berliner Staatsbibliothek als PDF-Datei (Link) bereitgestellt.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 29. April 2009, 14:18 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....Der Keller einer mittelgroßen Bibliothek / ein Antiquariat / ein Gemeindearchiv
Der Raum ist dunkel, riecht feucht und wirkt verlassen. Doch plötzlich wird man sich der Anwesenheit eines menschlichen Wesens bewußt, das an dem einzigen vorhandenen, kleinen Tisch hinter dem windschiefen Schrank sitzt. In einem Antiquariat steht dieser Tisch notgedrungen nicht weit von der Tür oder der Kasse entfernt. Eine Tasse mit lauwarmem Öko-Kaffee oder -Tee steht zwischen Stapeln aufgeschlagener Werke herum. Die Luft im Raum ist konzentrationsgeschwängert. Wehe dem, der die Ruhe stört, die Ordnung in einer Reihe von Nachschlagewerken verändert oder es wagt, ein Buch zum Bezahlen vorzulegen. ...."
Quelle:
Max de Bruijn: Wie werde ich Bill Gates? Aufzucht und Lebensweise des gemeinen Nerd. Frankfurt: Fischer Taschenbuch 2000, S. 48)
Dank an library mistress für den Fund !
Der Raum ist dunkel, riecht feucht und wirkt verlassen. Doch plötzlich wird man sich der Anwesenheit eines menschlichen Wesens bewußt, das an dem einzigen vorhandenen, kleinen Tisch hinter dem windschiefen Schrank sitzt. In einem Antiquariat steht dieser Tisch notgedrungen nicht weit von der Tür oder der Kasse entfernt. Eine Tasse mit lauwarmem Öko-Kaffee oder -Tee steht zwischen Stapeln aufgeschlagener Werke herum. Die Luft im Raum ist konzentrationsgeschwängert. Wehe dem, der die Ruhe stört, die Ordnung in einer Reihe von Nachschlagewerken verändert oder es wagt, ein Buch zum Bezahlen vorzulegen. ...."
Quelle:
Max de Bruijn: Wie werde ich Bill Gates? Aufzucht und Lebensweise des gemeinen Nerd. Frankfurt: Fischer Taschenbuch 2000, S. 48)
Dank an library mistress für den Fund !
Wolf Thomas - am Mittwoch, 29. April 2009, 10:58 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bivaldioai.gva.es/
Inzwischen sind eine stattliche Reihe Bücher digitalisiert, darunter auch Inkunabeln. 2004 musste man sich noch registrieren:
http://log.netbib.de/archives/2004/02/02/selected-digital-facsimile-sites/

Inzwischen sind eine stattliche Reihe Bücher digitalisiert, darunter auch Inkunabeln. 2004 musste man sich noch registrieren:
http://log.netbib.de/archives/2004/02/02/selected-digital-facsimile-sites/

KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 02:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 02:15 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/

See also the 70,000 digitized photographs in the database
http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/about.html

See also the 70,000 digitized photographs in the database
http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/about.html
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 01:55 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=2107
Hier bekommen die digitalen Skeptiker und Heidelberger Appellanten zurecht ihr Fett weg.
Wie sehr würde die "FAZ" oder Susanne Gaschke wohl wettern, würde heute in England ein Schreibtalent auftauchen, dass ganze Passagen aus historischen Standardwerken abschreibt, Geschichten anderer Autoren übernimmt oder Absätze aus den Werken Plutarchs? "An den Pranger mit ihm!" würden sie schrei(b)en und sofortige Inhaftierung fordern. Was natürlich schade wäre. Denn diese Person gab es schon einmal. Ihr Name ist William Shakespeare und gemeinhin gilt er als leidlich erträglicher Schreiber.
Hier bekommen die digitalen Skeptiker und Heidelberger Appellanten zurecht ihr Fett weg.
Wie sehr würde die "FAZ" oder Susanne Gaschke wohl wettern, würde heute in England ein Schreibtalent auftauchen, dass ganze Passagen aus historischen Standardwerken abschreibt, Geschichten anderer Autoren übernimmt oder Absätze aus den Werken Plutarchs? "An den Pranger mit ihm!" würden sie schrei(b)en und sofortige Inhaftierung fordern. Was natürlich schade wäre. Denn diese Person gab es schon einmal. Ihr Name ist William Shakespeare und gemeinhin gilt er als leidlich erträglicher Schreiber.
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 01:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die in der Kunstchronik 2008 S. 620f. abgedruckte Resolution der
kunsthistorischen Forschungseinrichtungen zum Copyright ist ein
wichtiger und richtiger Schritt. Wer sich über die Behinderung des
kunsthistorischen Publikationswesens durch Reproduktionsgebühren
informieren möchte, muss nur Susan Bielsteins lesenswertes Buch
"Permissions. A Survival Guide" von 2006 oder das "Open
Access"-Themenheft der Kunstchronik 2007 (S. 505-528) zur Hand nehmen
[1]. Bereits 2002 sorgte sich die führende Paläographen-Vereinigung:
"Das Bureau des Comité international de paléographie latine ruft [...]
alle nationalen und lokalen Verwaltungen sowie die Verantwortlichen in
privaten Bibliotheken und Archiven dazu auf, über die eigentlichen
Herstellungskosten hinaus keine zusätzlichen Gebühren zu erheben,
sofern es sich um rein wissenschaftliche Forschung ohne kommerziellen
Hintergrund handelt. Im übrigen ist es höchst widersinnig, Strafgelder
gerade auf jene Forschungsarbeit zu erheben, die die Bibliotheken
wissenschaftlich bereichert, den Autoren hingegen keinerlei Einkünfte
bringt" [2]. Auf einer Konferenz des Berliner MPI für
Wissenschaftsgeschichte im Januar 2008 wurden Empfehlungen für
verbesserten Zugang zu Bildern für wissenschaftliche Zwecke
beschlossen, die in die gleiche Richtung wie die RIHA-Resolution gehen
[3]. Zutreffend wird darin gefordert, Eigentumsrechte nicht mit
Urheberrechten zu vermischen. Denn in vielen Fällen werden die
Reproduktionsgebühren für Abbildungen zweidimensionaler gemeinfreier
Werke erhoben, an denen nach deutschem Recht kein Urheberrechtsschutz
besteht (siehe Kunstchronik 2008, S. 206-208). Es handelt sich also
eher um "Copyfraud" als um Copyright. Zuzustimmen ist auch der
Forderung der eben genannten Empfehlungen: "Scholars need high
resolution files, for work both on- and offline".
Zu begrüßen ist die von der RIHA-Resolution vorgenommene Einengung der
gewerblichen Nutzung. Wissenschaftliche Fachpublikationen in
Zeitschriften und Büchern, die in kommerziellen Verlagen erscheinen,
müssen im Interessse der Forschung von Reproduktionsgebühren
freigestellt werden. Einige Museen verwenden bereits Creative
Commons-Lizenzen, oft mit dem Ausschluss der gewerblichen Nutzung
("NC"). Das nützt aber den wissenschaftlichen Publikationen in
kommerziellen Verlagen nichts, denn diese Veröffentlichungen gelten im
Sinne der Lizenz nicht als nicht-kommerziell.
Um so erfreulicher ist es, dass etliche Institutionen umdenken und die
allgemeine Nutzung ihrer Bestände in reproduzierter Form erheblich
erleichtern. Zu nennen ist die Kooperation mit der Bildercommunity
Flickr.com, in deren Bereich "Flickr Commons" angesehen Institutionen
wie die Library of Congress oder das Niederländische Nationalarchiv
Bilder und Fotos mit "No known copyright restrictions" zur Nutzung
freigeben [4]. Im Dezember 2008 erregte eine Bilderspende des
deutschen Bundesarchivs an das Multimedia-Archiv Wikimedia Commons
Aufsehen. Die 100.000 Bilder in niedriger, aber für
Internetillustrationen brauchbarer Auflösung stehen unter der für die
Wikipedia tauglichen Lizenz CC-BY zur Verfügung [5]. Es ist sehr zu
hoffen, dass diese Bewegung sich verbreitert. Zudem sollten auch
weitere Verbände ähnliche Resolutionen wie die RIHA beschließen, die den überfälligen "Open Access" zu Kulturgut unterstützen.
[1] Vgl. auch die Hinweise auf Internetquellen unter
http://archiv.twoday.net/stories/5405864/ .
[2] http://la.boa-bw.de/archive/frei/653/0/www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
[3] http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing
[4] http://www.flickr.com/commons
[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/de
Abdruck (leicht geändert): Kunstchronik 62 (2009) H. 1, S. 59f.
kunsthistorischen Forschungseinrichtungen zum Copyright ist ein
wichtiger und richtiger Schritt. Wer sich über die Behinderung des
kunsthistorischen Publikationswesens durch Reproduktionsgebühren
informieren möchte, muss nur Susan Bielsteins lesenswertes Buch
"Permissions. A Survival Guide" von 2006 oder das "Open
Access"-Themenheft der Kunstchronik 2007 (S. 505-528) zur Hand nehmen
[1]. Bereits 2002 sorgte sich die führende Paläographen-Vereinigung:
"Das Bureau des Comité international de paléographie latine ruft [...]
alle nationalen und lokalen Verwaltungen sowie die Verantwortlichen in
privaten Bibliotheken und Archiven dazu auf, über die eigentlichen
Herstellungskosten hinaus keine zusätzlichen Gebühren zu erheben,
sofern es sich um rein wissenschaftliche Forschung ohne kommerziellen
Hintergrund handelt. Im übrigen ist es höchst widersinnig, Strafgelder
gerade auf jene Forschungsarbeit zu erheben, die die Bibliotheken
wissenschaftlich bereichert, den Autoren hingegen keinerlei Einkünfte
bringt" [2]. Auf einer Konferenz des Berliner MPI für
Wissenschaftsgeschichte im Januar 2008 wurden Empfehlungen für
verbesserten Zugang zu Bildern für wissenschaftliche Zwecke
beschlossen, die in die gleiche Richtung wie die RIHA-Resolution gehen
[3]. Zutreffend wird darin gefordert, Eigentumsrechte nicht mit
Urheberrechten zu vermischen. Denn in vielen Fällen werden die
Reproduktionsgebühren für Abbildungen zweidimensionaler gemeinfreier
Werke erhoben, an denen nach deutschem Recht kein Urheberrechtsschutz
besteht (siehe Kunstchronik 2008, S. 206-208). Es handelt sich also
eher um "Copyfraud" als um Copyright. Zuzustimmen ist auch der
Forderung der eben genannten Empfehlungen: "Scholars need high
resolution files, for work both on- and offline".
Zu begrüßen ist die von der RIHA-Resolution vorgenommene Einengung der
gewerblichen Nutzung. Wissenschaftliche Fachpublikationen in
Zeitschriften und Büchern, die in kommerziellen Verlagen erscheinen,
müssen im Interessse der Forschung von Reproduktionsgebühren
freigestellt werden. Einige Museen verwenden bereits Creative
Commons-Lizenzen, oft mit dem Ausschluss der gewerblichen Nutzung
("NC"). Das nützt aber den wissenschaftlichen Publikationen in
kommerziellen Verlagen nichts, denn diese Veröffentlichungen gelten im
Sinne der Lizenz nicht als nicht-kommerziell.
Um so erfreulicher ist es, dass etliche Institutionen umdenken und die
allgemeine Nutzung ihrer Bestände in reproduzierter Form erheblich
erleichtern. Zu nennen ist die Kooperation mit der Bildercommunity
Flickr.com, in deren Bereich "Flickr Commons" angesehen Institutionen
wie die Library of Congress oder das Niederländische Nationalarchiv
Bilder und Fotos mit "No known copyright restrictions" zur Nutzung
freigeben [4]. Im Dezember 2008 erregte eine Bilderspende des
deutschen Bundesarchivs an das Multimedia-Archiv Wikimedia Commons
Aufsehen. Die 100.000 Bilder in niedriger, aber für
Internetillustrationen brauchbarer Auflösung stehen unter der für die
Wikipedia tauglichen Lizenz CC-BY zur Verfügung [5]. Es ist sehr zu
hoffen, dass diese Bewegung sich verbreitert. Zudem sollten auch
weitere Verbände ähnliche Resolutionen wie die RIHA beschließen, die den überfälligen "Open Access" zu Kulturgut unterstützen.
[1] Vgl. auch die Hinweise auf Internetquellen unter
http://archiv.twoday.net/stories/5405864/ .
[2] http://la.boa-bw.de/archive/frei/653/0/www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
[3] http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing
[4] http://www.flickr.com/commons
[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/de
Abdruck (leicht geändert): Kunstchronik 62 (2009) H. 1, S. 59f.
KlausGraf - am Mittwoch, 29. April 2009, 01:33 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bislang nur mit US-Proxy zugänglich: http://books.google.com/books?id=dokDAAAAYAAJ
Das Buch ist in Europa gemeinfrei, wie sich aus den Lebensdaten des Stiftsbibliothekars P. Gabriel (Alwin) Meier von Baldingen
"Geboren 1845, Profess 1866, Gestorben 1924" ergibt.
[Update: Das Buch ist nun auch auf Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Meier_Einsiedler_Handschriftenkatalog ]
Das Digitalisat des Katalogs von Engelberg (Gottwald 1891) ist im Internetarchiv gespiegelt und daher unmittelbar nutzbar:
http://www.archive.org/details/cataloguscodicu00gottgoog
Das Buch ist in Europa gemeinfrei, wie sich aus den Lebensdaten des Stiftsbibliothekars P. Gabriel (Alwin) Meier von Baldingen
"Geboren 1845, Profess 1866, Gestorben 1924" ergibt.
[Update: Das Buch ist nun auch auf Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Meier_Einsiedler_Handschriftenkatalog ]
Das Digitalisat des Katalogs von Engelberg (Gottwald 1891) ist im Internetarchiv gespiegelt und daher unmittelbar nutzbar:
http://www.archive.org/details/cataloguscodicu00gottgoog
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 23:30 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Kommentar von Rainer Rudolph. Ohne Kommentar und mit der Bitte, ihn selbst zu lesen.
Link:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966894863.shtml
Link:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966894863.shtml
Wolf Thomas - am Dienstag, 28. April 2009, 23:21 - Rubrik: Kommunalarchive
Grauenhaft schlecht gescannt von Google aus dem Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek:
http://books.google.com/books?id=DoYAAAAAcAAJ
http://books.google.com/books?id=DoYAAAAAcAAJ
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 23:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die großen Archive und Bibliotheken in Deutschland schlagen Alarm und fordern eine "nationale Anstrengung" zur dauerhaften Sicherung ihrer Bestände. Das Elbehochwasser 2002, der Brand in der Anna Amalia Bibliothek Weimar 2004 und zuletzt der Einsturz des Kölner Stadtarchivs hätten die Öffentlichkeit aufgerüttelt und gleichzeitig deutlich gemacht, dass das schriftliche Kulturgut in Deutschland "nicht dauerhaft gesichert" sei. "Die Uhr tickt", hieß es von den Experten.
Die Direktoren von Staats- und Landesbibliotheken sowie Archiven übergaben am 28. April 2009 in Berlin Bundespräsident Horst Köhler eine Denkschrift zur Rettung des Kulturgutes auf lange Sicht. Das Staatsoberhaupt habe den Archivaren und Bibliothekaren "Mut gemacht und Rückendeckung versprochen", sagte der Dresdner Bibliotheksdirektor Thomas Bürger anschließend. "Der Bundespräsident hat mit leuchtenden Augen über die Bedeutung der Kultur für unsere Zukunft gesprochen." Die kostbaren Unterlagen seien millionenfach durch das früher verwendete säurehaltige Papier und den sogenannten Tintenfraß beschädigt und in größter Gefahr, sagte Bürger. "Das schaffen wir nicht mehr alleine." Sein Kollege von der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek, Michael Knoche, sprach von einer nationalen Aufgabe, für die es bisher auf Bundesebene nicht ausreichend Ansprechpartner gegeben habe.
Die Experten erinnerten an die altgriechische Herkunft des Wortes Archiv: "Schatzkammer", und sie wiesen darauf hin, dass Archive auch "den langen Prozess der Staatswerdung Deutschlands und seiner einzelnen Teile" widerspiegelten. Die Archive und Bibliotheken wollen jährlich einen "Nationalen Aktionstag zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts" veranstalten, der in der Zeit um den 2. September, dem Jahrestag des verheerenden Bibliotheksbrandes in Weimar, stattfindet. Allein in den deutschen Bibliotheken wiesen mehr als 60 Millionen Druckschriften heute Schäden auf, ein Drittel gelte als schwer geschädigt. Deutschland steht nach Ansicht der Experten in diesem Bereich vor drei großen Herausforderungen: die digitale Vernetzung, die langfristige Datensicherung und der Erhalt der Originale. Der Zerfall "sauren" Papiers bedrohe das gesamte Archivgut aus der Zeit zwischen etwa 1850 und 1990 und treffe die Archive existenziell.
Der Bund sollte jetzt die Federführung bei einer nationalen Konzeption zur Rettung und Sicherung des Kulturgutes übernehmen, zudem müssten Bund und Länder eine zentrale Koordinierungsstelle einrichten, fordern die Archiv- und Bibliotheksdirektoren, die sich zu einer "Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten" zusammengeschlossen haben. Auch die Mittel für die Bestandserhaltung sollten aufgestockt werden, der Bund müsse jährlich zehn Millionen Euro für den Erhalt von Originalen bereitstellen. Ein besonderes Augenmerk müsse auch immer noch auf jene älteren Bestände gerichtet werden, die durch die Schäden im Zweiten Weltkrieg und andere Katastrophen seit Jahrzehnten nicht benutzbar seien. Zu der "Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten" gehören unter anderem die Berliner und die Bayerische Staatsbibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main und Leipzig, die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek Weimar, die Sächsische Landesbibliothek, das Niedersächsische Landesarchiv, das Bundesarchiv Koblenz und Berlin sowie das Deutsche Literaturarchiv Marbach."
Quelle:
http://www.3sat.de/kulturzeit/news/133461/index.html
s.a.https://archiv.twoday.net/stories/5669483/
Die Direktoren von Staats- und Landesbibliotheken sowie Archiven übergaben am 28. April 2009 in Berlin Bundespräsident Horst Köhler eine Denkschrift zur Rettung des Kulturgutes auf lange Sicht. Das Staatsoberhaupt habe den Archivaren und Bibliothekaren "Mut gemacht und Rückendeckung versprochen", sagte der Dresdner Bibliotheksdirektor Thomas Bürger anschließend. "Der Bundespräsident hat mit leuchtenden Augen über die Bedeutung der Kultur für unsere Zukunft gesprochen." Die kostbaren Unterlagen seien millionenfach durch das früher verwendete säurehaltige Papier und den sogenannten Tintenfraß beschädigt und in größter Gefahr, sagte Bürger. "Das schaffen wir nicht mehr alleine." Sein Kollege von der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek, Michael Knoche, sprach von einer nationalen Aufgabe, für die es bisher auf Bundesebene nicht ausreichend Ansprechpartner gegeben habe.
Die Experten erinnerten an die altgriechische Herkunft des Wortes Archiv: "Schatzkammer", und sie wiesen darauf hin, dass Archive auch "den langen Prozess der Staatswerdung Deutschlands und seiner einzelnen Teile" widerspiegelten. Die Archive und Bibliotheken wollen jährlich einen "Nationalen Aktionstag zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts" veranstalten, der in der Zeit um den 2. September, dem Jahrestag des verheerenden Bibliotheksbrandes in Weimar, stattfindet. Allein in den deutschen Bibliotheken wiesen mehr als 60 Millionen Druckschriften heute Schäden auf, ein Drittel gelte als schwer geschädigt. Deutschland steht nach Ansicht der Experten in diesem Bereich vor drei großen Herausforderungen: die digitale Vernetzung, die langfristige Datensicherung und der Erhalt der Originale. Der Zerfall "sauren" Papiers bedrohe das gesamte Archivgut aus der Zeit zwischen etwa 1850 und 1990 und treffe die Archive existenziell.
Der Bund sollte jetzt die Federführung bei einer nationalen Konzeption zur Rettung und Sicherung des Kulturgutes übernehmen, zudem müssten Bund und Länder eine zentrale Koordinierungsstelle einrichten, fordern die Archiv- und Bibliotheksdirektoren, die sich zu einer "Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten" zusammengeschlossen haben. Auch die Mittel für die Bestandserhaltung sollten aufgestockt werden, der Bund müsse jährlich zehn Millionen Euro für den Erhalt von Originalen bereitstellen. Ein besonderes Augenmerk müsse auch immer noch auf jene älteren Bestände gerichtet werden, die durch die Schäden im Zweiten Weltkrieg und andere Katastrophen seit Jahrzehnten nicht benutzbar seien. Zu der "Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten" gehören unter anderem die Berliner und die Bayerische Staatsbibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main und Leipzig, die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek Weimar, die Sächsische Landesbibliothek, das Niedersächsische Landesarchiv, das Bundesarchiv Koblenz und Berlin sowie das Deutsche Literaturarchiv Marbach."
Quelle:
http://www.3sat.de/kulturzeit/news/133461/index.html
s.a.https://archiv.twoday.net/stories/5669483/
Wolf Thomas - am Dienstag, 28. April 2009, 22:34 - Rubrik: Bestandserhaltung
Peter Suber rekapituliert einmal mehr die einschlägigen Fakten:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/04/more-on-2004-cornell-calculation.html
Siehe dazu auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5646283/

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/04/more-on-2004-cornell-calculation.html
Siehe dazu auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5646283/

KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 22:23 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mehrere tausend Aktive des Technischen Hilfswerkes aus der gesamten Bundesrepublik halfen bereits in Köln, um auf dem Gelände des eingestürzten Stadtarchivs wertvolle und unersetzbare Archivalien zu bergen. Um Unterstützung hatte dafür die Berufsfeuerwehr Köln gebeten. Am gestrigen Montag brachen nun auch acht Grünberger THW-Helfer unter der Leitung von Zugführer Steffen Musch, begleitet von zwei Kameraden aus Bad Wildungen auf, um bis Donnerstag Hilfe zu leisten.
Verabschiedet wurden sie vom Hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Siegfried Fricke. Der CDU-Politiker, Kandidat seiner Partei für das Amt des Landrates im Kreis Gießen, nutzte den Besuch am Freitagabend, um sich über die Unterbringung und den Fahrzeugbestand des THW-Ortsverbandes Grünberg zu informieren. .....
Wie Gerrit Meenen erläuterte, werden die Grünberger in Köln bis in eine Tiefe von mittlerweile 26 Metern eingesetzt, hierbei könnte es zur benötigten Unterstützung für den Kampfmittelräumdienst kommen. Was dabei die oberhessischen Helfer leisten müssen, konnte Meenen am Freitag noch nicht genauer definieren.
Siegfried Fricke zeigte sich sehr interessiert und wünschte den THW-Mitgliedern bei ihrer Arbeit am Einsatzort viel Glück. ...."
Quelle: Giessener Allgemeine
Verabschiedet wurden sie vom Hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Siegfried Fricke. Der CDU-Politiker, Kandidat seiner Partei für das Amt des Landrates im Kreis Gießen, nutzte den Besuch am Freitagabend, um sich über die Unterbringung und den Fahrzeugbestand des THW-Ortsverbandes Grünberg zu informieren. .....
Wie Gerrit Meenen erläuterte, werden die Grünberger in Köln bis in eine Tiefe von mittlerweile 26 Metern eingesetzt, hierbei könnte es zur benötigten Unterstützung für den Kampfmittelräumdienst kommen. Was dabei die oberhessischen Helfer leisten müssen, konnte Meenen am Freitag noch nicht genauer definieren.
Siegfried Fricke zeigte sich sehr interessiert und wünschte den THW-Mitgliedern bei ihrer Arbeit am Einsatzort viel Glück. ...."
Quelle: Giessener Allgemeine
Wolf Thomas - am Dienstag, 28. April 2009, 21:59 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der FAZ leistet der Münchner Jurist Volker Rieble dem unsäglichen Roland Reuß juristische Schützenhilfe: Forscher seien keine normalen Angestellten.
Der „Heidelberger Appell“ von Roland Reuß sorgt sich um die Freiheit des Autors, selbst zu entscheiden, ob, wo und wie seine Werke veröffentlicht werden. Diese Freiheit ist in Gefahr, wenn Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse mit dem Argument einem „open-access-System“ überantworten müssen, dass der Staat ihre Forschung finanziere und deswegen verlangen könne, dass Forschungsergebnisse kostenfrei und insbesondere im Netz veröffentlicht werden.
Rieble erwähnt kurz das Arbeitnehmererfindungsrecht, das im Hochschulbereich das frühere Hochschullehrer-Privileg abgeschafft hat, um anschließlich das hohe Lied der Wissenschaftsfreiheit zu singen:
Die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG verleiht ihm das unentziehbare Recht, selbst zu entscheiden, ob, wo und wie seine Werke veröffentlicht werden. Ein publizistischer Anschluss- und Benutzungszwang (vergleichbar der kommunalen Wasserversorgung) ist verfassungswidrig. Diese Individualfreiheit gilt schon immer und ungeachtet des Umstandes, dass die Forschung an Universitäten und Großforschungseinrichtungen mit Steuergeldern finanziert ist. Der Staat erwirbt durch Wissenschaftsfinanzierung keine Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen. Das Grundgesetz baut darauf, dass Wissenschaftler eigenverantwortlich publizieren – und hierzu vom wissenschaftlichen Wettbewerb und von der persönlichen Neugier und Schaffenskraft angetrieben werden. Jedweder Publikationszwang ist damit unvereinbar. Abgesehen davon: In der Lebenswirklichkeit werden Publikationen nachts und am Wochenende, also in der Freizeit geschrieben. Da gehört der Forscher sich selbst.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, dass öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse auch publiziert werden. Ist dies nicht der Fall, werden Steuergelder schlicht und einfach verschwendet.
Der Forscher ist unter Umständen sogar verpflichtet, Forschungsergebnisse, an denen er Eigentum erworben hat, der Universität anzubieten, hat der BGH in seiner sonst vielfach kritikwürdigen Entscheidung Grabungsmaterialien entschieden:
http://lexetius.com/1990,13
Selbstverständlich werden in Projekten erarbeitete Publikationen in der Arbeitszeit geschrieben, mag das auch bei Herrn Rieble anders sein. Als Hochschullehrer kann er ja ohnehin weitgehend frei entscheiden, was Freizeit und was Dienstzeit ist. Und während Professor Rieble mal kurz einen FAZ-Artikel in seiner vermutlich allzu karg bemessenen Freizeit aus dem Ärmel schüttelt, gilt bei echter wissenschaftlicher Forschung, dass der eigentlichen Niederschrift immer zeitaufwändige Recherchen und Vorarbeiten vorangehen, wobei die Informationsversorgung bei Leuten wie Rieble die öffentliche Hand übernimmt, also bezahlt. Aus seiner Privatbibliothek kann er vielleicht einen schlechten FAZ-Artikel bestreiten, aber keine genuine Forschungsarbeit.
Weitere Falschaussagen folgen:
Eben darin liegt der Fehler der Open-access-Bewegung: Sie sieht Wissenschaftspublikationen nur unter Ertrags- und Kostengesichtspunkten und meint deswegen, auf das Publikationsrecht des steuerfinanzierten Autors Zugriff nehmen zu können. Verbindungen eines Wissenschaftlers zu einem Verlag sind keine „Profit- oder Vertriebsstrukturen“, sondern Ausdruck einer persönlichen und wissenschaftsgeprägten Vertrauensbeziehung. In welcher Zeitschrift und bei welchem Verlag er veröffentlichen möchte, entscheidet der Autor nach wissenschaftlichen und nicht nach ökonomischen Gründen. Dieses Recht würde schon durch eine Zweitveröffentlichungspflicht nachhaltig verwässert.
Warum? Ich kann beim besten Willen keine Beeinträchtigung der Vertrauensbeziehung zum Verlag durch grünen Open Access sehen, schließlich akzeptieren die weltweit größten Wissenschaftsverlage das Selbst-archivieren in Repositorien. Die Formel "nachhaltig verwässert" ist natürlich ein rhetorisches Falschspiel, denn es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob man eine bestimmte Publikationsform für die Primärpublikation vorschreibt oder - ggf. nach einem Embargo - eine kostenfreie Sekundärpublikation fordert.
Einfach nur perfide Polemik ist der Satz:
Man sieht: Frei ist bei Open access nur der Leser; seine Freiheit wird durch die „anti-autoritäre“ Entrechtung des Autors erkauft.
Halten wir fest: Von einem Zwang sind wir (leider) in Deutschland meilenweit entfernt. Unzählige deutsche Wissenschaftler unterstützen persönlich Open Access, veröffentlichen in Open-Access-Zeitschriften oder nützen die Hochschulschriftenserver, um ihre Veröffentlichungen dort unterzubringen. Open Access baut auf die freiwillige Einsicht der Wissenschaftler. Wenn die wichtigste Harvard-Fakultät einmütig für eine Verpflichtung für Open Access votiert - wer hat sie dazu gezwungen?
Die internationale Open-Access-Community setzt auf Mandate - der deutsche Sonderweg ist ihr nicht eigentlich vermittelbar. Ist Deutschland wirklich der allerletzte Hort der Wissenschaftsfreiheit? Geht diese in allen anderen wichtigen Forschungs-Staaten vor die Hunde, weil Open-Access-Verpflichtungen (Mandate) ausgesprochen werden?
Meine eigene Position habe ich mehrfach hier dargelegt: Ich bin ohne Wenn und Aber für Mandate auf der Grundlage von Hochschulsatzungen. Diese sind autonomes Hochschulrecht, nicht etwas "von oben" Aufgezwungenes.
http://archiv.twoday.net/search?q=mandat
http://archiv.twoday.net/stories/4369539/
Mein Vorschlag lautet:
Veröffentlichung von Publikationen nach den Grundsätzen von "Open Access".
(1) Hochschullehrer und Beschäftigte der Universität sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden sowie Buchveröffentlichungen an den Hochschulschriftenserver in elektronischer Form abzuliefern.
(2) Abzuliefern ist die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung.
(3) Solange den Hochschulschriftenserver keine Freigabe des Rechteinhabers bzw. Verlags erreicht hat, sind nur die Metadaten der jeweiligen Veröffentlichung für die Allgemeinheit zugänglich.
(4) Gibt der Rechteinhaber die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung frei, wird der Zugriff durch die Allgemeinheit freigegeben.
(5) Auf Antrag des Hochschullehrers oder Beschäftigten kann der Zugriff für die Allgemeinheit auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 gesperrt bleiben oder werden, wenn die berechtigten Interessen des Hochschullehrers oder Beschäftigten an der Nicht-Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver überwiegen. Ein solcher Antrag ist alle fünf Jahre zu erneuern.
Leider stehe ich damit damit in Deutschland allein auf weiter Flur. Open-Access-Unterstützer wie der Bibliotheksjurist Steinhauer lehnen Mandate als Zwang kompromisslos ab. Die herrschende juristische Meinung lehnt den Ertmann/Pflüger-Vorschlag ab, den ich als verfassungsrechtlich machbar ansehe:
http://archiv.twoday.net/stories/2962609/
Stattdessen wurde (insbesondere vom Bundesrat bei den Verhandlungen zum 2. Korb des Urheberrechts) der schlechte Hansen-Vorschlag favorisiert, der in die Vertragsbeziehungen zwischen Verlag und Wissenschaftler eingreift und dem Wissenschaftsautor das Recht verschafft, nach einer Frist von sechs Monaten seinen Beitrag in einem Repositorium einzustellen:
http://archiv.twoday.net/stories/2060875/
Zurück zu Reible. Seine Überlegungen zur "Staatsfreiheit der Wissenschaftspresse" sind abwegig. Einzig und allein öffentlichrechtliche Speicher können die dauerhafte Verfügbarkeit elektronischer Daten sicherstellen. Repositorien, die ohne Peer Review Publikationen dokumentieren, entsprechen einer universitätsweiten Pflichtexemplar-Sammlung und stellen keine Verlagskonkurrenz dar. Die Hochschulen gewähren ihren Wissenschaftlern ja auch Netzplatz, auf denen diese Forschungsergebnisse zum Abruf bereit stellen können, was zum Teil in erheblichem Umfang genutzt wird. Auch die traditionellen, im Selbstverlag der Universitäten erschienenen Publikationen waren selbstverständlich zulässig.
Es liegt doch auf der Hand, dass es Möglichkeiten geben muss, seriöse Forschung, die von Verlegern nicht oder nur um den Preis extremer Subventionen akzeptiert wird, dauerhaft elektronisch zu veröffentlichen. Wenn die Server öffentlichrechtlicher Institutionen das ermöglichen, nehmen sie den Verlagen kein Geschäft weg. Sie ermöglichen Publikationen, die Verlagen nicht lukrativ genug sind.
Rieble wiederholt das falsche Argument von den schlechten Dissertationen: Traditionelle Nutzer sind froh, wenn schlechte Dissertationen auf Servern verschimmeln.
Das Beispiel einer sehr schlechten Dissertation, die in erlesener Aufmachung vom traditionsreichen Winter-Verlag gedruckt wurde, habe ich hier vorgestellt:
http://archiv.twoday.net/stories/5531082/
Rieble stellt die Verhältnisse auf den Kopf, wenn er statt der ekelhaften Verlagsmonopole, die auf Profitmaximierung aus sind und bei denen es abweichende Meinungen bekanntlich auch schwer haben, die Gefahr eines übermächtigen Staatswissenschaftsservers an die Wand malt: Nur solange es eine Alternative zum staatlichen open-access-Server gibt, sind Wissenschaftler vor der Monopolmacht des Staatswissenschaftsverlages (oder -servers) geschützt. Man denke an die Zensurgefahr durch political correctness.
Ist es ein Zufall, dass die von der digitalen Revolution bedrohten traditionellen Printmedien vor allem kompetenzfreie Open-Access-Gegner zu Wort kommen lassen?
Repositorien sind anders als die FAZ politisch neutral und nur einem Mindeststandard an Wissenschaftlichkeit verpflichtet.
Abschließend resümiert der Münchner Hochschullehrer: Man kann also Roland Reuß und seinem „Heidelberger Appell“ zweifach zustimmen: Der einzelne Wissenschaftler darf nicht einmal „sanft“ an der freien Wahl des Veröffentlichungsmediums für seine Erkenntnisse gehindert werden. Universitäten und Großforschungseinrichtungen haben keine wissenschaftspublizistische Funktion. Wissenschafts- und Pressefreiheit setzen auf freie Autoren und freie Verleger. Das Kosten- und das Sparinteresse des Wissenschaftsverbrauchers rechtfertigt keine Freiheitsbeschränkung.
Aus der Wissenschaftsfreiheit folgt nicht, dass Wissenschaftsverlage auf alle Zeiten das Recht auf hohe Monopolgewinne haben und den Staat zwingen dürfen, öffentlich geförderte Forschung "zurückzukaufen".
Wir haben mit der Zeitschriftenkrise ein klassisches Marktversagen: wird mehr Geld in das System gepumpt, wird dies von den Monopolisten abgeschöpft.
Also muss es der Staat auch hier "richten", er muss regulierend eingreifen und die Wissenschaftskommunikation den aufregenden digitalen Möglichkeiten anpassen, da sich die fetten Wissenschaftsverlage dazu nicht in angemessener Weise bereit finden.
Niemand kann bestreiten, dass in den mittelalterlichen Klöstern oder Städten, die weitgehend "ehrenamtliche Schreiber" kannten, eine lebhafte intellektuelle Kultur herrschte - übrigens ganz ohne Urheberrechtsgesetze. Bücher auf Pergament waren teuer, dann kam das Papier und ein Aufschwung des allgemeinen Lesens.
Open Access unterstützt die Freiheit der Wissenschaft, da er die traditionellen Verbreitungsstrukturen durchbricht. Wissenschaft darf nicht länger in den Kerkern der Verlage schmachten, dazu ist sie zu wichtig. Der Staat als größter Wissenschaftsfinanzierer hat die Pflicht, nicht nur "sanft" die Öffentlichkeit von Wissenschaft durchzusetzen. Die absolute Entscheidungsfreiheit der Wissenschaftler muss da ebenso zurückstehen wie bei ethisch fragwürdigen Experimenten.
UPDATE: Steinhauer gegen Rieble
http://www.wissenschaftsurheberrecht.de/2009/04/29/open-access-staatsferne-wissenschaft-6027289/
IB-Weblog http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=6829
KOMMENTARE:
Norbert (anonym) meinte am 30. Apr, 12:29:
Ich vermute Herr Reuss ist deshalb unsäglich, weil er Texteditionen auf den Weg gebracht hat, während der Verfasser dieses Artikel nirgendwo publizieren könnte, wenn nicht in Open Access. Der Zwang zu "open acess" stellt die Looser, wie Graf, auf eine Stufe mit den Leistungsträgern. Deshalb der Veränderungsehrgeiz.
KlausGraf antwortete am 30. Apr, 16:44:
Ich ein Looser?
Bei über 200 gedruckten Publikationen (ohne Rezensionen und Zeitungsartikeln, u.a. FAZ) würde ich mal behaupten, das ist einfach anonyme Verleumdung. Wären Sie nicht anonym, würde ich mir überlegen, den Staatsanwalt einzuschalten.
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
Clemens Radl antwortete am 30. Apr, 16:50:
Nur echte Loser ...
... schreiben Loser mit Doppel-O, gell "Norbert"?
Den restlichen Mist an persönlichen Angriffen, der hier abgeladen wurde, habe ich mir zu löschen erlaubt. Die Kommentare sind geschlossen.
Der „Heidelberger Appell“ von Roland Reuß sorgt sich um die Freiheit des Autors, selbst zu entscheiden, ob, wo und wie seine Werke veröffentlicht werden. Diese Freiheit ist in Gefahr, wenn Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse mit dem Argument einem „open-access-System“ überantworten müssen, dass der Staat ihre Forschung finanziere und deswegen verlangen könne, dass Forschungsergebnisse kostenfrei und insbesondere im Netz veröffentlicht werden.
Rieble erwähnt kurz das Arbeitnehmererfindungsrecht, das im Hochschulbereich das frühere Hochschullehrer-Privileg abgeschafft hat, um anschließlich das hohe Lied der Wissenschaftsfreiheit zu singen:
Die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG verleiht ihm das unentziehbare Recht, selbst zu entscheiden, ob, wo und wie seine Werke veröffentlicht werden. Ein publizistischer Anschluss- und Benutzungszwang (vergleichbar der kommunalen Wasserversorgung) ist verfassungswidrig. Diese Individualfreiheit gilt schon immer und ungeachtet des Umstandes, dass die Forschung an Universitäten und Großforschungseinrichtungen mit Steuergeldern finanziert ist. Der Staat erwirbt durch Wissenschaftsfinanzierung keine Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen. Das Grundgesetz baut darauf, dass Wissenschaftler eigenverantwortlich publizieren – und hierzu vom wissenschaftlichen Wettbewerb und von der persönlichen Neugier und Schaffenskraft angetrieben werden. Jedweder Publikationszwang ist damit unvereinbar. Abgesehen davon: In der Lebenswirklichkeit werden Publikationen nachts und am Wochenende, also in der Freizeit geschrieben. Da gehört der Forscher sich selbst.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, dass öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse auch publiziert werden. Ist dies nicht der Fall, werden Steuergelder schlicht und einfach verschwendet.
Der Forscher ist unter Umständen sogar verpflichtet, Forschungsergebnisse, an denen er Eigentum erworben hat, der Universität anzubieten, hat der BGH in seiner sonst vielfach kritikwürdigen Entscheidung Grabungsmaterialien entschieden:
http://lexetius.com/1990,13
Selbstverständlich werden in Projekten erarbeitete Publikationen in der Arbeitszeit geschrieben, mag das auch bei Herrn Rieble anders sein. Als Hochschullehrer kann er ja ohnehin weitgehend frei entscheiden, was Freizeit und was Dienstzeit ist. Und während Professor Rieble mal kurz einen FAZ-Artikel in seiner vermutlich allzu karg bemessenen Freizeit aus dem Ärmel schüttelt, gilt bei echter wissenschaftlicher Forschung, dass der eigentlichen Niederschrift immer zeitaufwändige Recherchen und Vorarbeiten vorangehen, wobei die Informationsversorgung bei Leuten wie Rieble die öffentliche Hand übernimmt, also bezahlt. Aus seiner Privatbibliothek kann er vielleicht einen schlechten FAZ-Artikel bestreiten, aber keine genuine Forschungsarbeit.
Weitere Falschaussagen folgen:
Eben darin liegt der Fehler der Open-access-Bewegung: Sie sieht Wissenschaftspublikationen nur unter Ertrags- und Kostengesichtspunkten und meint deswegen, auf das Publikationsrecht des steuerfinanzierten Autors Zugriff nehmen zu können. Verbindungen eines Wissenschaftlers zu einem Verlag sind keine „Profit- oder Vertriebsstrukturen“, sondern Ausdruck einer persönlichen und wissenschaftsgeprägten Vertrauensbeziehung. In welcher Zeitschrift und bei welchem Verlag er veröffentlichen möchte, entscheidet der Autor nach wissenschaftlichen und nicht nach ökonomischen Gründen. Dieses Recht würde schon durch eine Zweitveröffentlichungspflicht nachhaltig verwässert.
Warum? Ich kann beim besten Willen keine Beeinträchtigung der Vertrauensbeziehung zum Verlag durch grünen Open Access sehen, schließlich akzeptieren die weltweit größten Wissenschaftsverlage das Selbst-archivieren in Repositorien. Die Formel "nachhaltig verwässert" ist natürlich ein rhetorisches Falschspiel, denn es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob man eine bestimmte Publikationsform für die Primärpublikation vorschreibt oder - ggf. nach einem Embargo - eine kostenfreie Sekundärpublikation fordert.
Einfach nur perfide Polemik ist der Satz:
Man sieht: Frei ist bei Open access nur der Leser; seine Freiheit wird durch die „anti-autoritäre“ Entrechtung des Autors erkauft.
Halten wir fest: Von einem Zwang sind wir (leider) in Deutschland meilenweit entfernt. Unzählige deutsche Wissenschaftler unterstützen persönlich Open Access, veröffentlichen in Open-Access-Zeitschriften oder nützen die Hochschulschriftenserver, um ihre Veröffentlichungen dort unterzubringen. Open Access baut auf die freiwillige Einsicht der Wissenschaftler. Wenn die wichtigste Harvard-Fakultät einmütig für eine Verpflichtung für Open Access votiert - wer hat sie dazu gezwungen?
Die internationale Open-Access-Community setzt auf Mandate - der deutsche Sonderweg ist ihr nicht eigentlich vermittelbar. Ist Deutschland wirklich der allerletzte Hort der Wissenschaftsfreiheit? Geht diese in allen anderen wichtigen Forschungs-Staaten vor die Hunde, weil Open-Access-Verpflichtungen (Mandate) ausgesprochen werden?
Meine eigene Position habe ich mehrfach hier dargelegt: Ich bin ohne Wenn und Aber für Mandate auf der Grundlage von Hochschulsatzungen. Diese sind autonomes Hochschulrecht, nicht etwas "von oben" Aufgezwungenes.
http://archiv.twoday.net/search?q=mandat
http://archiv.twoday.net/stories/4369539/
Mein Vorschlag lautet:
Veröffentlichung von Publikationen nach den Grundsätzen von "Open Access".
(1) Hochschullehrer und Beschäftigte der Universität sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden sowie Buchveröffentlichungen an den Hochschulschriftenserver in elektronischer Form abzuliefern.
(2) Abzuliefern ist die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung.
(3) Solange den Hochschulschriftenserver keine Freigabe des Rechteinhabers bzw. Verlags erreicht hat, sind nur die Metadaten der jeweiligen Veröffentlichung für die Allgemeinheit zugänglich.
(4) Gibt der Rechteinhaber die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung frei, wird der Zugriff durch die Allgemeinheit freigegeben.
(5) Auf Antrag des Hochschullehrers oder Beschäftigten kann der Zugriff für die Allgemeinheit auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 gesperrt bleiben oder werden, wenn die berechtigten Interessen des Hochschullehrers oder Beschäftigten an der Nicht-Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver überwiegen. Ein solcher Antrag ist alle fünf Jahre zu erneuern.
Leider stehe ich damit damit in Deutschland allein auf weiter Flur. Open-Access-Unterstützer wie der Bibliotheksjurist Steinhauer lehnen Mandate als Zwang kompromisslos ab. Die herrschende juristische Meinung lehnt den Ertmann/Pflüger-Vorschlag ab, den ich als verfassungsrechtlich machbar ansehe:
http://archiv.twoday.net/stories/2962609/
Stattdessen wurde (insbesondere vom Bundesrat bei den Verhandlungen zum 2. Korb des Urheberrechts) der schlechte Hansen-Vorschlag favorisiert, der in die Vertragsbeziehungen zwischen Verlag und Wissenschaftler eingreift und dem Wissenschaftsautor das Recht verschafft, nach einer Frist von sechs Monaten seinen Beitrag in einem Repositorium einzustellen:
http://archiv.twoday.net/stories/2060875/
Zurück zu Reible. Seine Überlegungen zur "Staatsfreiheit der Wissenschaftspresse" sind abwegig. Einzig und allein öffentlichrechtliche Speicher können die dauerhafte Verfügbarkeit elektronischer Daten sicherstellen. Repositorien, die ohne Peer Review Publikationen dokumentieren, entsprechen einer universitätsweiten Pflichtexemplar-Sammlung und stellen keine Verlagskonkurrenz dar. Die Hochschulen gewähren ihren Wissenschaftlern ja auch Netzplatz, auf denen diese Forschungsergebnisse zum Abruf bereit stellen können, was zum Teil in erheblichem Umfang genutzt wird. Auch die traditionellen, im Selbstverlag der Universitäten erschienenen Publikationen waren selbstverständlich zulässig.
Es liegt doch auf der Hand, dass es Möglichkeiten geben muss, seriöse Forschung, die von Verlegern nicht oder nur um den Preis extremer Subventionen akzeptiert wird, dauerhaft elektronisch zu veröffentlichen. Wenn die Server öffentlichrechtlicher Institutionen das ermöglichen, nehmen sie den Verlagen kein Geschäft weg. Sie ermöglichen Publikationen, die Verlagen nicht lukrativ genug sind.
Rieble wiederholt das falsche Argument von den schlechten Dissertationen: Traditionelle Nutzer sind froh, wenn schlechte Dissertationen auf Servern verschimmeln.
Das Beispiel einer sehr schlechten Dissertation, die in erlesener Aufmachung vom traditionsreichen Winter-Verlag gedruckt wurde, habe ich hier vorgestellt:
http://archiv.twoday.net/stories/5531082/
Rieble stellt die Verhältnisse auf den Kopf, wenn er statt der ekelhaften Verlagsmonopole, die auf Profitmaximierung aus sind und bei denen es abweichende Meinungen bekanntlich auch schwer haben, die Gefahr eines übermächtigen Staatswissenschaftsservers an die Wand malt: Nur solange es eine Alternative zum staatlichen open-access-Server gibt, sind Wissenschaftler vor der Monopolmacht des Staatswissenschaftsverlages (oder -servers) geschützt. Man denke an die Zensurgefahr durch political correctness.
Ist es ein Zufall, dass die von der digitalen Revolution bedrohten traditionellen Printmedien vor allem kompetenzfreie Open-Access-Gegner zu Wort kommen lassen?
Repositorien sind anders als die FAZ politisch neutral und nur einem Mindeststandard an Wissenschaftlichkeit verpflichtet.
Abschließend resümiert der Münchner Hochschullehrer: Man kann also Roland Reuß und seinem „Heidelberger Appell“ zweifach zustimmen: Der einzelne Wissenschaftler darf nicht einmal „sanft“ an der freien Wahl des Veröffentlichungsmediums für seine Erkenntnisse gehindert werden. Universitäten und Großforschungseinrichtungen haben keine wissenschaftspublizistische Funktion. Wissenschafts- und Pressefreiheit setzen auf freie Autoren und freie Verleger. Das Kosten- und das Sparinteresse des Wissenschaftsverbrauchers rechtfertigt keine Freiheitsbeschränkung.
Aus der Wissenschaftsfreiheit folgt nicht, dass Wissenschaftsverlage auf alle Zeiten das Recht auf hohe Monopolgewinne haben und den Staat zwingen dürfen, öffentlich geförderte Forschung "zurückzukaufen".
Wir haben mit der Zeitschriftenkrise ein klassisches Marktversagen: wird mehr Geld in das System gepumpt, wird dies von den Monopolisten abgeschöpft.
Also muss es der Staat auch hier "richten", er muss regulierend eingreifen und die Wissenschaftskommunikation den aufregenden digitalen Möglichkeiten anpassen, da sich die fetten Wissenschaftsverlage dazu nicht in angemessener Weise bereit finden.
Niemand kann bestreiten, dass in den mittelalterlichen Klöstern oder Städten, die weitgehend "ehrenamtliche Schreiber" kannten, eine lebhafte intellektuelle Kultur herrschte - übrigens ganz ohne Urheberrechtsgesetze. Bücher auf Pergament waren teuer, dann kam das Papier und ein Aufschwung des allgemeinen Lesens.
Open Access unterstützt die Freiheit der Wissenschaft, da er die traditionellen Verbreitungsstrukturen durchbricht. Wissenschaft darf nicht länger in den Kerkern der Verlage schmachten, dazu ist sie zu wichtig. Der Staat als größter Wissenschaftsfinanzierer hat die Pflicht, nicht nur "sanft" die Öffentlichkeit von Wissenschaft durchzusetzen. Die absolute Entscheidungsfreiheit der Wissenschaftler muss da ebenso zurückstehen wie bei ethisch fragwürdigen Experimenten.
UPDATE: Steinhauer gegen Rieble
http://www.wissenschaftsurheberrecht.de/2009/04/29/open-access-staatsferne-wissenschaft-6027289/
IB-Weblog http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=6829
KOMMENTARE:
Norbert (anonym) meinte am 30. Apr, 12:29:
Ich vermute Herr Reuss ist deshalb unsäglich, weil er Texteditionen auf den Weg gebracht hat, während der Verfasser dieses Artikel nirgendwo publizieren könnte, wenn nicht in Open Access. Der Zwang zu "open acess" stellt die Looser, wie Graf, auf eine Stufe mit den Leistungsträgern. Deshalb der Veränderungsehrgeiz.
KlausGraf antwortete am 30. Apr, 16:44:
Ich ein Looser?
Bei über 200 gedruckten Publikationen (ohne Rezensionen und Zeitungsartikeln, u.a. FAZ) würde ich mal behaupten, das ist einfach anonyme Verleumdung. Wären Sie nicht anonym, würde ich mir überlegen, den Staatsanwalt einzuschalten.
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
Clemens Radl antwortete am 30. Apr, 16:50:
Nur echte Loser ...
... schreiben Loser mit Doppel-O, gell "Norbert"?
Den restlichen Mist an persönlichen Angriffen, der hier abgeladen wurde, habe ich mir zu löschen erlaubt. Die Kommentare sind geschlossen.
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 20:25 - Rubrik: Open Access
The History of Medicine Division of the National Library of Medicine announces the launch of a new image platform for its premier database, Images from the History of Medicine (IHM). Using award winning software developed by Luna Imaging, Inc., NLM offers greatly enhanced searching and viewing capabilities to image researchers. Patrons can view search results in a multi-image display, download high resolution copies of their favorite images, zoom in on image details, move images into a patron-defined workspace for further manipulation, and create media groups for presenting images and sharing them via e-mail or posting on blogs. With these new capabilities, NLM greatly enhances usability of its image collection, where inspection and comparison of images is often as important as access to bibliographic data. IHM is available online, free of charge, at http://ihm.nlm.nih.gov.
Comprising almost 70,000 images from the Prints and Photographs and other collections held in the History of Medicine Division, IHM is one of the largest image databases in the world dedicated to images of medicine, dentistry, public health, the health professions, and health institutions.

Comprising almost 70,000 images from the Prints and Photographs and other collections held in the History of Medicine Division, IHM is one of the largest image databases in the world dedicated to images of medicine, dentistry, public health, the health professions, and health institutions.

KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 20:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/stpeter_pap32/
Prachtvolle Bilderhandschrift der Badischen Landesbibliothek von 1487 in guter Qualität präsentiert!

Prachtvolle Bilderhandschrift der Badischen Landesbibliothek von 1487 in guter Qualität präsentiert!

KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 15:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die WELT zieht über Google her, kritisiert aber immerhin die Vermischung mit dem Thema Open Access
http://www.welt.de/die-welt/article3637038/Ablasshandel-in-Sachen-geistiger-Enteignung.html
Das Urheberrechtsbündnis hat erneut zum Heidelberger Appell Stellung genommen und sich seinerseits an die Bundeskanzlerin gewandt:
http://immateriblog.de/?p=528
Der Urheber des "Augsburger Appells" http://archiv.twoday.net/stories/5667711/ stellt seine Position nun auch in Telepolis dar:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30210/1.html
http://www.welt.de/die-welt/article3637038/Ablasshandel-in-Sachen-geistiger-Enteignung.html
Das Urheberrechtsbündnis hat erneut zum Heidelberger Appell Stellung genommen und sich seinerseits an die Bundeskanzlerin gewandt:
http://immateriblog.de/?p=528
Der Urheber des "Augsburger Appells" http://archiv.twoday.net/stories/5667711/ stellt seine Position nun auch in Telepolis dar:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30210/1.html
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 12:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 02:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 02:17 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.juraf.de
Beim hier vorgestellten Ranking juristischer Fachzeitschriften - JuRaF - haben bis zum Auswertungsstichtag 248 Juristinnen und Juristen von 45 Universitäten 516 individuelle Rangfolgen der qualitativ hochwertigsten Fachzeitschriften erstellt. Diese Rangfolgen wurden nach Tätigkeit und nach Publikationsintensität gewichtet. Aufgenommen wurden Zeitschriften, die mindestens acht Nennungen erhielten.
Unter allen Zeitschriften ist eine einzige Open-Access-Zeitschrift:
http://www.zis-online.com/
Beim hier vorgestellten Ranking juristischer Fachzeitschriften - JuRaF - haben bis zum Auswertungsstichtag 248 Juristinnen und Juristen von 45 Universitäten 516 individuelle Rangfolgen der qualitativ hochwertigsten Fachzeitschriften erstellt. Diese Rangfolgen wurden nach Tätigkeit und nach Publikationsintensität gewichtet. Aufgenommen wurden Zeitschriften, die mindestens acht Nennungen erhielten.
Unter allen Zeitschriften ist eine einzige Open-Access-Zeitschrift:
http://www.zis-online.com/
KlausGraf - am Dienstag, 28. April 2009, 00:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
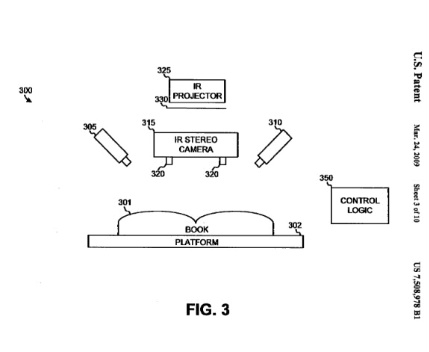
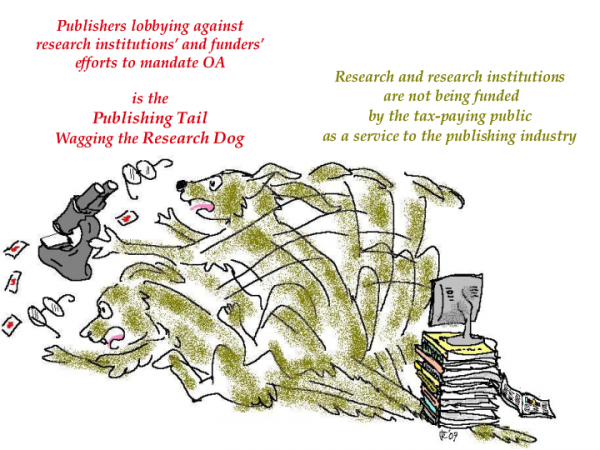



 Palazzo in Aquila
Palazzo in Aquila