http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/fischblog/allgemein/2011-01-03/wissenschaftsblog-auslese-2010-die-longlist
Wieder hat niemand einen Archivalia-Beitrag nominiert. Jetzt ist es zu spät.
Wieder hat niemand einen Archivalia-Beitrag nominiert. Jetzt ist es zu spät.
Keinen guten Eindruck macht die Liste mit Digitalisat-Nachweis unter
http://wiki-de.genealogy.net/Neue_Siebmacher
http://wiki-de.genealogy.net/Neue_Siebmacher
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 22:37 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 22:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Klaus Graf findet im AGFNZ-Weblog das neue Informationsangebot nicht überzeugend:
http://agfnz.historikerverband.de/?p=582
http://earlymodernarchitecture.com/
http://agfnz.historikerverband.de/?p=582
http://earlymodernarchitecture.com/
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 21:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/01/plos-one-now-worlds-largest-journal.html
Alles spricht dafür, dass das Flaggschiff des Open-Access-Verlags Public Library of Science, PLoS One mit 6749 Artikeln das größte wissenschaftliche Journal ist.
http://www.plosone.org
Update:
In a press release earlier today, the Nature Publishing Group announced a new journal that is covering biology, chemistry, earth sciences and physics,
is an open access journal, giving the authors the choice of two Creative Commons non-commercial licenses,
will publish all papers that are judged to be technically valid and original, and
uses article-level metrics to put the emphasis on the individual article rather than the journal as a whole.
The new journal is called Scientific Reports, and obviously resembles PLoS ONE in many ways, down to the article-processing charges which are $1350 for both journals (but will go up to $1700 for Scientific Reports in 2012). The journal is open for submissions and will publish the first papers this summer.
http://blogs.plos.org/mfenner/2011/01/06/new-journal-nature-one-launched-today/

Update:
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/01/15/a-ray-of-sunshine-in-the-open-access-future/
Alles spricht dafür, dass das Flaggschiff des Open-Access-Verlags Public Library of Science, PLoS One mit 6749 Artikeln das größte wissenschaftliche Journal ist.
http://www.plosone.org
Update:
In a press release earlier today, the Nature Publishing Group announced a new journal that is covering biology, chemistry, earth sciences and physics,
is an open access journal, giving the authors the choice of two Creative Commons non-commercial licenses,
will publish all papers that are judged to be technically valid and original, and
uses article-level metrics to put the emphasis on the individual article rather than the journal as a whole.
The new journal is called Scientific Reports, and obviously resembles PLoS ONE in many ways, down to the article-processing charges which are $1350 for both journals (but will go up to $1700 for Scientific Reports in 2012). The journal is open for submissions and will publish the first papers this summer.
http://blogs.plos.org/mfenner/2011/01/06/new-journal-nature-one-launched-today/

Update:
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/01/15/a-ray-of-sunshine-in-the-open-access-future/
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:52 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/786-guid.html
Der weltgrößte Wissenschaftsverlag gibt die Erlaubnis, eigene Postprints (Versionen, die die Änderungen des Peer Review berücksichtigen) einzustellen nicht mehr, wenn Repositorien mit einem Mandat betroffen sind. Kein Wunder, dass Mandat-Onkel Harnad schäumt.
Ich mag auch keine Mandate, da diese nach deutschen Recht als nicht vereinbar mit der Wissenschaftsfreiheit angesehen werden (eine Ansicht, die ich nicht teile) und da der empirische Nachweis, dass bessere Einstellungsraten kausal auf die Mandate und nicht auf die flankierenden Maßnahmen zurückgehen, bislang aussteht.
Der weltgrößte Wissenschaftsverlag gibt die Erlaubnis, eigene Postprints (Versionen, die die Änderungen des Peer Review berücksichtigen) einzustellen nicht mehr, wenn Repositorien mit einem Mandat betroffen sind. Kein Wunder, dass Mandat-Onkel Harnad schäumt.
Ich mag auch keine Mandate, da diese nach deutschen Recht als nicht vereinbar mit der Wissenschaftsfreiheit angesehen werden (eine Ansicht, die ich nicht teile) und da der empirische Nachweis, dass bessere Einstellungsraten kausal auf die Mandate und nicht auf die flankierenden Maßnahmen zurückgehen, bislang aussteht.
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:16 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Most genealogists are only using 10% or less of the resources behind Google when it comes to genealogy research. Learn from professional genealogist, Thomas MacEntee, about the other 90% and how these Google components can be leveraged for better search results. Google is more than just a search engine – it is a wealth of information much of which goes unnoticed by the average genealogist. Besides search, Google allows you to access maps, books, journals, abstracts, patents and much more. These components may be what is needed to make advances in your genealogy research."
Link zum Webinar. Video ist bis zum 5.2.11 online.
Link zum Handout (PDF)
Link zum Webinar. Video ist bis zum 5.2.11 online.
Link zum Handout (PDF)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:13 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wowter.net/2011/01/06/the-impact-factor-of-open-access-journals/
Download the list of 619 OA journals with impact factors at http://goo.gl/ONfBL
Download the list of 619 OA journals with impact factors at http://goo.gl/ONfBL
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:54 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A former Drew University student pleaded guilty this week to stealing valuable historical documents from the university's United Methodist Archives Center while working there as a paid student assistant.
http://www.dailyrecord.com/article/20110105/UPDATES01/301050013/Drew-University-student-admits-stealing-historic-documents-from-school
http://www.dailyrecord.com/article/20110105/UPDATES01/301050013/Drew-University-student-admits-stealing-historic-documents-from-school
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:49 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu unseren aktuellen Schatzregal-Beiträgen
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
passt gut die Buchbesprechung von Derek Fincham:
Metal Detecting and Archaeology
Edited by Suzie Thomas and Peter G. Stone (Heritage Matters 2). Pp. x + 224,
figs. 59, pls. 7, tables 3, maps 6. The Boydell Press, Woodbridge, England 2008.
$95. ISBN 978-1-84383-415-1 (cloth).
Archaeologists have a healthy skepticism
of the practice of metal detecting. This edited
volume attempts—with varying degrees of
success—to temper this skepticism. [...]
In summary, this collection offers new insights
into the tension between segments of
the public and archaeologists; it describes the
damage metal detectors can do but also notes
how they can enhance serious scientific study.
The positive examples discussed may help
change the widely held perception in the heritage
community that all users of metal detectors
are looters. Some certainly are—and this collection
of essays acknowledges that fact—yet
if we paint metal detectorists with too broad a
brush, we risk losing the assistance of skilled
and dedicated volunteers who can offer a better
understanding of sites and their contexts.
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
passt gut die Buchbesprechung von Derek Fincham:
Metal Detecting and Archaeology
Edited by Suzie Thomas and Peter G. Stone (Heritage Matters 2). Pp. x + 224,
figs. 59, pls. 7, tables 3, maps 6. The Boydell Press, Woodbridge, England 2008.
$95. ISBN 978-1-84383-415-1 (cloth).
Archaeologists have a healthy skepticism
of the practice of metal detecting. This edited
volume attempts—with varying degrees of
success—to temper this skepticism. [...]
In summary, this collection offers new insights
into the tension between segments of
the public and archaeologists; it describes the
damage metal detectors can do but also notes
how they can enhance serious scientific study.
The positive examples discussed may help
change the widely held perception in the heritage
community that all users of metal detectors
are looters. Some certainly are—and this collection
of essays acknowledges that fact—yet
if we paint metal detectorists with too broad a
brush, we risk losing the assistance of skilled
and dedicated volunteers who can offer a better
understanding of sites and their contexts.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Material in der Dokumenten-Sammlung Deutscher Werkbund - verschiedene Nachlässe und Teilnachlässe von Werkbund-Mitgliedern, Werkbund-Publikationen und sonstigen Materialien - rekonstruiert so facettenreich wie möglich die Organisationsgeschichte des Deutschen Werkbundes. Neben Originaldokumenten - Publikationen, Jahresberichten, Protokollen, Rundschreiben, Korrespondenzen und anderem - umfasst die Sammlung auch kopierte Fragmente von andernorts aufbewahrten Nachlässen und Archivbeständen, die wesentlichen Aufschluss über die Entwicklung des Werkbundes geben.
Zeitlich umfassen die Bestände die Zeit vor der Gründung, z. B. Dresdner Kunstgewerbeausstellung 1906 bis heute."
Quelle: Homepage des Archivs
Link zur Bestandsliste
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:37 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Platzierungen im Einzelnen:
01 Kleine Wasserfrösche (Pelophylax Lessonae)
02 Eiswürfel
03 Blaue Pfauenhenne
04 Glasbläserei
05 Fußgängerzone - Essen
06 Kino-Serie 01-10
07 Gasometer Oberhausen
08 Kunstraum Düsseldorf / Simon Rummel – Zeichenmaschine
09 Straßenmusiker in Unterführung
10 Radio-Sendersuchlauf Ukw
Das Blog "Jahrgangsgeräusche" lobte bereits zum 2. Mal das Geräusch des Jahres aus.
Link zum Blogeintrag
01 Kleine Wasserfrösche (Pelophylax Lessonae)
02 Eiswürfel
03 Blaue Pfauenhenne
04 Glasbläserei
05 Fußgängerzone - Essen
06 Kino-Serie 01-10
07 Gasometer Oberhausen
08 Kunstraum Düsseldorf / Simon Rummel – Zeichenmaschine
09 Straßenmusiker in Unterführung
10 Radio-Sendersuchlauf Ukw
Das Blog "Jahrgangsgeräusche" lobte bereits zum 2. Mal das Geräusch des Jahres aus.
Link zum Blogeintrag
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:32 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Seit jeher erhoffte man sich durch das Kartenwerk des Ptolemäus, einer der wichtigsten historischen Quellen, Auskunft über die germanischen Siedlungen. Mit einem Problem: Keiner der in der Karte von Germania genannten 93 Orte ließ sich einer archäologisch nachweisbaren Siedlung zuweisen. Dies gelang nun einem Team von Wissenschaftlern der TU Berlin mit dem Buch "Germania und die Insel Thule".
Claudius Ptolemäus' "Geographia" ist ursprünglich nur eine Sammlung von Zahlen, Koordinatenangaben mit Längen- und Breitengraden, von Orten mit germanischen Namen. Aufgeschrieben wurden sie von Händlern und Seefahrern, vor allem aber von römischen Vermessungsingenieuren im Dienst des Militärs. Darauf greift Ptolemäus zurück. Hieraus entstand erst viel später die Karte Germanias.
Hochkomplexe Formeln
"Ptolemäus hatte offensichtlich Kartenangaben, die er zusammenfügen musste", erklärt Dieter Lelgemann, der Wissenschaftsingenieur in der Expertenrunde. "Bei dieser Zusammenfügung kam es, wie es heutzutage genau so geschehen würde, zu Fehlern. Diese Fehler müssen zurückberechnet werden." Dazu musste das Team zunächst rekonstruieren, wie zu Zeiten von Ptolemäus gemessen wurde: mit einer hochpräzisen Sonnenuhr für die Breitengrade und durch bloßes Abschreiten für die Längengrade. Die Messfehler zeigten ein Muster. Was bei Ptolemäus kartografisch verzerrt war, wurde mit hochkomplexen Formeln aus einer ganz anderen Ecke der Wissenschaft korrigiert.
"Wir verwenden moderne Verfahren der Deformationsanalyse", so Lelgemann. "Die sind entwickelt worden, um die Deformationen von Tragflügeln von Flugzeugen genau zu untersuchen." Im entzerrten Germania erhalten die Ortsangaben von Ptolemäus nun einen Sinn: Sie liegen oft dort, wo heute große Städte liegen. Überraschend zeigt sich: Städte wie Jena, Eisenach, Leipzig und Dresden waren schon zu Zeiten der Römer besiedelt. Städte wie Braunschweig, Hannover, Hamburg und Essen sind wahrscheinlich bis zu 1000 Jahre älter als bisher gedacht - vorausgesetzt, die antike Besiedelung war nicht unterbrochen.
Muss die Geschichte neu geschrieben werden?
Heimatforscher und Archäologen sind nun aufgefordert, Beweise dafür zu liefern. Die Resonanz aus der Wissenschaft ist noch zögerlich. Denn die neuen Erkenntnisse machen einen Haufen wissenschaftlicher Literatur zu Makulatur. Manche Quelle, wie zum Beispiel Tacitus, muss neu gelesen werden: Historische Ereignisse wie die Varusschlacht werden neu lokalisiert. Nicht mehr Kalkriese, sondern Felsberg, das antike Amisia, 200 Kilometer weiter südöstlich, könnte nun der antike Schlachtort sein.
Viele Siedlungen lagen - anders als bisher vermutet - an antiken Handelsstraßen, zum Beispiel an der Bernsteinstraße von Nord nach Süd. Die Germanen standen im regen wirtschaftlichen Austausch mit ihren Nachbarn, auch den Römern. "Wir werden ganz sicherlich in kurzer Zeit einen sehr sauberen Überblick kriegen, wie Germania Magna im Altertum ausgesehen hat", so Dieter Lelgemann. Germania war also dichter besiedelt, zivilisierter und weltoffener als bisher angenommen."
Quelle: http://www.3sat.de/kulturzeit/lesezeit/150745/index.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:29 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/11497677/
Castell: Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1911902
Ahnenbilder und Jugenderinnerungen
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957379
Darin: reizvolle Kindheitserinnerungen an Landshut
Die Fahrt nach der alten Urkunde
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957711
Castell: Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1911902
Ahnenbilder und Jugenderinnerungen
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957379
Darin: reizvolle Kindheitserinnerungen an Landshut
Die Fahrt nach der alten Urkunde
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1957711
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 15:02 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Gebäude vom geheimen Archiv
Ist vor Alter ganz grau und schief.
Doch in seinen finsteren Gelassen
Kann man super die Geschichte fassen!
***
Bis zum 15.1.2010 23 Uhr 59 können höchsten Ansprüchen genügende Gedichte zum Thema Archivbau (Reim muss nicht seim) eingereicht werden. Anschließend entscheide ich, ob ich einen Preis vergebe.
Ist vor Alter ganz grau und schief.
Doch in seinen finsteren Gelassen
Kann man super die Geschichte fassen!
***
Bis zum 15.1.2010 23 Uhr 59 können höchsten Ansprüchen genügende Gedichte zum Thema Archivbau (Reim muss nicht seim) eingereicht werden. Anschließend entscheide ich, ob ich einen Preis vergebe.
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Januar 2011, 01:26 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
R. Bizzocchi, Genealogie incredibili (Markus Völkel)
In: Francia-Recensio, 2010-4, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815)
URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-4/FN/bizzocchi_voelkel
Eine Rezension, die etwas zum Schwafeln neigt - vermutlich wie das Buch selbst.
In: Francia-Recensio, 2010-4, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815)
URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-4/FN/bizzocchi_voelkel
Eine Rezension, die etwas zum Schwafeln neigt - vermutlich wie das Buch selbst.
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 22:30 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Exposition : Aix-en-Provence ville ouvrière
Hochgeladen von conseilgeneral13. - Neueste Nachrichten Videos.
"On connaissait Aix-en-Provence comme "la belle endormie". Le centre Aixois des archives départementales nous montre aussi qu'elle fut une ville ouvrière. Cette exposition présentée jusqu'au 29 janvier 2011 retrace le parcours ouvrier e la ville de 1850 à 1940. Manufactures, confiseries et autres chapellerie ont permis l'éclosion d'un mouvement ouvrier qui disparaitra au fil du temps...
http://www.cg13.fr "
Ist doch eigentlich ganz einfach, aber in Deutschland noch undenkbar, oder?
Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 21:29 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Files detail Thatcher's first year as PM
Hochgeladen von itnnews. - Nachrichtenvideos top aktuell.
Ob wir am 1.1.2013 auch die Aktenöffnung der Ära Kohl erleben?
Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 21:25 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Altes Stadtarchiv in der Südkapelle St. Johann, ca. 1955, Fotograf unbekannt
Signatur: J 02.21.05/80, © Stadtarchiv Schaffhausen
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 20:00 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
18. Januar 2011, 18.30 Uhr
Einführung in die Chronologie
Tobias Teyke stellt die Grundzüge der abendländischen Zeitrechnung vor und gibt eine Anleitung zur Auflösung von Zeit-Angaben in geschichtlichen Quellen.
8./15. Februar 2011, 18.30 Uhr
Lesekurs „Sütterlin“
Einführung in das Lesen der Deutschen Schreibschrift.
Telefonische Anmeldung erforderlich! Tel. (089) 233-0308.
Kurs-Gebühr: 16 €
22. Februar 2011, 18.30 Uhr
Historische Dokumente fachgerecht archivieren und aufbewahren
Dr. Brigitte Huber erläutert die Aufgabe von Archiven und gibt Tipps zur sachgerechten Aufbewahrung von Archivalien. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an kleine Privatarchive (Vereine, etc.).
15. März 2011, 18.30 Uhr
Gesucht und (hoffentlich) gefunden!
Anton Löffelmeier M.A. stellt klassische und digitale Recherche-Möglichkeiten im Stadtarchiv vor.
muenchen.de
Einführung in die Chronologie
Tobias Teyke stellt die Grundzüge der abendländischen Zeitrechnung vor und gibt eine Anleitung zur Auflösung von Zeit-Angaben in geschichtlichen Quellen.
8./15. Februar 2011, 18.30 Uhr
Lesekurs „Sütterlin“
Einführung in das Lesen der Deutschen Schreibschrift.
Telefonische Anmeldung erforderlich! Tel. (089) 233-0308.
Kurs-Gebühr: 16 €
22. Februar 2011, 18.30 Uhr
Historische Dokumente fachgerecht archivieren und aufbewahren
Dr. Brigitte Huber erläutert die Aufgabe von Archiven und gibt Tipps zur sachgerechten Aufbewahrung von Archivalien. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an kleine Privatarchive (Vereine, etc.).
15. März 2011, 18.30 Uhr
Gesucht und (hoffentlich) gefunden!
Anton Löffelmeier M.A. stellt klassische und digitale Recherche-Möglichkeiten im Stadtarchiv vor.
muenchen.de
Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:52 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:47 - Rubrik: Archivbau
http://goo.gl/Tbj9W
Die bisher hochgeladenen Bilder:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_State_Library_of_Queensland
Siehe auch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:State_Library_of_Queensland

Die bisher hochgeladenen Bilder:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_State_Library_of_Queensland
Siehe auch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:State_Library_of_Queensland

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:43 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digital.wienbibliothek.at/
Bislang gibt es nur ein paar Musikhandschriften von Hugo Wolf (1860–1903).
Bislang gibt es nur ein paar Musikhandschriften von Hugo Wolf (1860–1903).
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Es handelt sich um den Heidelberger Cod. Sal. VII, 114
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salVII114
Der Handschriftencensus hat (wen wunderts) das Digitalisat noch nicht registriert, schließlich darf man nicht erwarten, dass man auf die Idee kommt, den entsprechenden RSS-Feed der Bibliothek zu beziehen, wie ich das tue.
http://www.handschriftencensus.de/4960

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salVII114
Der Handschriftencensus hat (wen wunderts) das Digitalisat noch nicht registriert, schließlich darf man nicht erwarten, dass man auf die Idee kommt, den entsprechenden RSS-Feed der Bibliothek zu beziehen, wie ich das tue.
http://www.handschriftencensus.de/4960

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:38 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=325
"In einem vom Börsenverein in Auftrag gegebenen und in GRUR (ganz oder teilweise?) veröffentlichten Gutachtens zeigt Christian Berger auf – gewiss wider seiner Intention –, wie absurd für sich schon der § 52a UrhG angesichts der Bedürfnisse und der Praktiken in Bildung und Wissenschaft ist, und noch mehr, wie verquer der Kampf der Verlagswirtschaft gegen diesen Paragraphen ist."
"In einem vom Börsenverein in Auftrag gegebenen und in GRUR (ganz oder teilweise?) veröffentlichten Gutachtens zeigt Christian Berger auf – gewiss wider seiner Intention –, wie absurd für sich schon der § 52a UrhG angesichts der Bedürfnisse und der Praktiken in Bildung und Wissenschaft ist, und noch mehr, wie verquer der Kampf der Verlagswirtschaft gegen diesen Paragraphen ist."
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:35 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zwischen einem österreichischen Auktionshaus und dem Staatsarchiv in Eger (Cheb) ist ein Streit um historische Briefe entbrannt.
http://derstandard.at/1293370016492/Koeniglich-oder-bedeutungslos-Oesterreichisch-tschechischer-Streit-um-historische-Briefe
Siehe auch
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/11557182/
http://www.ct24.cz/domaci/111624-rakousko-historicke-dopisy-z-archivu-v-chebu-nevyda/ (benutzt via Google Translate)
Thomas Just kommentiert:
"Die Aussagen des Auktionshauses über die Schreibfähigkeiten der frühen Neuzeit sprechen für sich, einfach lächerlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briefe aus dem Archiv von Cheb (Eger) gestohlen wurden, ist sehr groß und das ganze ist eigentlich unfassbar, dass das versteigert wird."
http://arcana.twoday.net/stories/streit-zwischen-tschechischem-archiv-und-oesterreichischem-auktionshau/
http://derstandard.at/1293370016492/Koeniglich-oder-bedeutungslos-Oesterreichisch-tschechischer-Streit-um-historische-Briefe
Siehe auch
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/11557182/
http://www.ct24.cz/domaci/111624-rakousko-historicke-dopisy-z-archivu-v-chebu-nevyda/ (benutzt via Google Translate)
Thomas Just kommentiert:
"Die Aussagen des Auktionshauses über die Schreibfähigkeiten der frühen Neuzeit sprechen für sich, einfach lächerlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briefe aus dem Archiv von Cheb (Eger) gestohlen wurden, ist sehr groß und das ganze ist eigentlich unfassbar, dass das versteigert wird."
http://arcana.twoday.net/stories/streit-zwischen-tschechischem-archiv-und-oesterreichischem-auktionshau/
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 19:23 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=de
"Die in diesem Katalog aufgeführten Plakate stammen aus den Sammlungen der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB), der Bibliothèque de Genève (BGE), der Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU NE), der Médiathèque Valais und dem Verkehrshaus. Die Digitalisierung der Plakate wird von Memoriav gesponsert.
Die Bildaufnahmen der Plakate können online angesehen, dürfen allerdings aus Gründen des Copyright nicht weiterverwendet werden."
Zu weiteren Plakatsammlungen siehe etwa
http://www.onb.ac.at/koop-poster/datenpools/

"Die in diesem Katalog aufgeführten Plakate stammen aus den Sammlungen der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB), der Bibliothèque de Genève (BGE), der Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU NE), der Médiathèque Valais und dem Verkehrshaus. Die Digitalisierung der Plakate wird von Memoriav gesponsert.
Die Bildaufnahmen der Plakate können online angesehen, dürfen allerdings aus Gründen des Copyright nicht weiterverwendet werden."
Zu weiteren Plakatsammlungen siehe etwa
http://www.onb.ac.at/koop-poster/datenpools/

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 18:11 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/xW0Z2 mit Links zu den Diskussionen
Es geht um die stilisierte Schildkröte auf dem kanadischen Verkehrsschild, die absurderweise als urheberrechtlich geschütztes Werk betrachtet wird.

Es geht um die stilisierte Schildkröte auf dem kanadischen Verkehrsschild, die absurderweise als urheberrechtlich geschütztes Werk betrachtet wird.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 11:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.stadtarchiv-schaffhausen.ch/Bild/
Den Hinweis auf diese umfangreiche Bilddatenbank gab vorhin Joachim Kemper auf Facebook.

Den Hinweis auf diese umfangreiche Bilddatenbank gab vorhin Joachim Kemper auf Facebook.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 11:29 - Rubrik: Fotoueberlieferung
Blomberg. Es hat ein knappes Jahr gedauert, weil die Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II Vorrang hatten: Jetzt wird das Blomberger Stadtarchiv endlich saniert.
Ende Januar vor einem Jahr hatte eine defekte Heizung einen massiven Wasserschaden verursacht, der nicht nur die Lehmwände in allen Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen hat, sondern vor allem die im Keller gelagerten Archivalien.
Die Stadtverwaltung hatte das Gebäude zwar trocknen lassen. Aber dann ruhte die Baustelle, weil zu viele andere Maßnahmen aus dem Förderprogramm angestanden hatten. Jetzt ist die Ausschreibung der Arbeiten am Stadtarchiv so gut wie beendet, Mitte des Monats soll es losgehen.
Im Sommer sollen die mittlerweile getrockneten Akten dann vom Westfälischen Archivamt in Münster zurück nach Blomberg kommen.
Quelle: Lippische Landeszeitung 4.1.2011
Ende Januar vor einem Jahr hatte eine defekte Heizung einen massiven Wasserschaden verursacht, der nicht nur die Lehmwände in allen Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen hat, sondern vor allem die im Keller gelagerten Archivalien.
Die Stadtverwaltung hatte das Gebäude zwar trocknen lassen. Aber dann ruhte die Baustelle, weil zu viele andere Maßnahmen aus dem Förderprogramm angestanden hatten. Jetzt ist die Ausschreibung der Arbeiten am Stadtarchiv so gut wie beendet, Mitte des Monats soll es losgehen.
Im Sommer sollen die mittlerweile getrockneten Akten dann vom Westfälischen Archivamt in Münster zurück nach Blomberg kommen.
Quelle: Lippische Landeszeitung 4.1.2011
Olaf Piontek - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 07:52 - Rubrik: Kommunalarchive
http://agfnz.historikerverband.de/?p=563 macht darauf aufmerksa, dass Erlasse der Fürstbischöfe von Lüttich vom Diözesanarchiv online gestellt wurden:
http://www.evequesdeliege.be
Die jüngeren liegen gescannt und zoombar als Digitalisate vor.

http://www.evequesdeliege.be
Die jüngeren liegen gescannt und zoombar als Digitalisate vor.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 00:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Cgm 18
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002134/images/
Zur Überlieferung
http://www.handschriftencensus.de/werke/437
Bislang online sind von den vollständigen Handschriften die in Dresden, Heidelberg und der noch ältere Cgm 61.
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002134/images/
Zur Überlieferung
http://www.handschriftencensus.de/werke/437
Bislang online sind von den vollständigen Handschriften die in Dresden, Heidelberg und der noch ältere Cgm 61.
KlausGraf - am Mittwoch, 5. Januar 2011, 00:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/20478
Aug. perg. 253 (wieso man nicht an der eingeführten Signatur Aug. CCLIII festhält??)
Verlinkt sind leider nicht die Nachträge des alten Katalogs
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0720_c700_jpg.htm
Aug. perg. 253 (wieso man nicht an der eingeführten Signatur Aug. CCLIII festhält??)
Verlinkt sind leider nicht die Nachträge des alten Katalogs
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0720_c700_jpg.htm
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:46 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr110608.html
Das dem Beschwerdeführer auferlegte Publikationsverbot erstreckt sich allgemein auf die Verbreitung von nationalsozialistischem oder rechtsextremistischem Gedankengut. Mit dieser Umschreibung ist weder für den Rechtsanwender noch für den Rechtsunterworfenen das künftig verbotene von dem weiterhin erlaubten Verhalten abgrenzbar und damit im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch nicht hinreichend beschränkt. Schon bezüglich des Verbots der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts lässt sich dem Beschluss des Oberlandesgerichts nichts dazu entnehmen, ob damit jedes Gedankengut, das unter dem nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürregime propagiert wurde, erfasst sein soll oder nur bestimmte Ausschnitte der nationalsozialistischen Ideologie, und falls letzteres der Fall sein sollte, nach welchen Kriterien diese Inhalte bestimmt werden können. Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbreitung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist damit kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.
Das dem Beschwerdeführer auferlegte Publikationsverbot erstreckt sich allgemein auf die Verbreitung von nationalsozialistischem oder rechtsextremistischem Gedankengut. Mit dieser Umschreibung ist weder für den Rechtsanwender noch für den Rechtsunterworfenen das künftig verbotene von dem weiterhin erlaubten Verhalten abgrenzbar und damit im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch nicht hinreichend beschränkt. Schon bezüglich des Verbots der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts lässt sich dem Beschluss des Oberlandesgerichts nichts dazu entnehmen, ob damit jedes Gedankengut, das unter dem nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürregime propagiert wurde, erfasst sein soll oder nur bestimmte Ausschnitte der nationalsozialistischen Ideologie, und falls letzteres der Fall sein sollte, nach welchen Kriterien diese Inhalte bestimmt werden können. Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbreitung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist damit kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 23:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu http://archiv.twoday.net/stories/6243832/
Der Freispruch für Justiziar Dresen ist nunmehr rechtskräftig:
http://www.boersenblatt.net/408257/

Der Freispruch für Justiziar Dresen ist nunmehr rechtskräftig:
http://www.boersenblatt.net/408257/

KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im ZVAB derzeit zwischen 690 und 1200 Euro, ergibt sich aus einem Preisvergleich
http://www.boersenblatt.net/408553/
http://www.boersenblatt.net/408553/
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:43 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:40 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=10998
Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitungen online:
Der Bludenzer Anzeiger
Die Badener Zeitung
Die Österreichische Volks-Zeitung
Das (Neuigkeits) Welt Blatt
Das Kleine Blatt
Das Bregenzer (Vorarlberger) Tagblatt
Die Neue Warte am Inn
Die Tages-Post
Das Vorarlberger Volksblatt
Die Wiener Landwirtschaftliche Zeitung
Die Wiener neueste Nachrichten
Der Wienerwald-Bote
Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitschriften online:
Der Alpenfreund
Die Lokomotive
Die Salzburger Landeskunde
Das Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums
Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitungen online:
Der Bludenzer Anzeiger
Die Badener Zeitung
Die Österreichische Volks-Zeitung
Das (Neuigkeits) Welt Blatt
Das Kleine Blatt
Das Bregenzer (Vorarlberger) Tagblatt
Die Neue Warte am Inn
Die Tages-Post
Das Vorarlberger Volksblatt
Die Wiener Landwirtschaftliche Zeitung
Die Wiener neueste Nachrichten
Der Wienerwald-Bote
Das Jahr 1940 ist von folgenden Zeitschriften online:
Der Alpenfreund
Die Lokomotive
Die Salzburger Landeskunde
Das Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Aufsatz von Heiko Steuer aus Stefan Burmeister (Hrsg.): 2000 Jahre Varusschlacht-Konflikt Stuttgart: Theiss, 2009, S. 309-419 ist bei Freidok online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7891/
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7891/
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:25 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/01/04/digitizing-a-medieval-inquisitor/ zeigt die Digitalisierung durch die BM Toulouse an und beklagt die mangelhafte Auflösung der Digitalisate.
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:18 - Rubrik: Kodikologie
Nachdem ich Dilibri gestern auf zwei Lücken in der digitalisierten gemeinfreien Literatur zur Genovefa von Brabant aufmerksam machte, steht heute mit der Studie von Gottfried Kentenich bereits eines der beiden Werke online bereit, das andere soll folgen:
http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/397402
http://de.wikisource.org/wiki/Genoveva_von_Brabant
Update:
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/genoveva-von-brabant.html
Einen Tag später ist auch das zweite Buch online:
http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-17533
 Eigenes Foto
Eigenes Foto
http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/397402
http://de.wikisource.org/wiki/Genoveva_von_Brabant
Update:
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/genoveva-von-brabant.html
Einen Tag später ist auch das zweite Buch online:
http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-17533
 Eigenes Foto
Eigenes FotoKlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 22:07 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://finds.org.uk/
"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales. Every year many thousands of objects are discovered, many of these by metal-detector users, but also by people whilst out walking, gardening or going about their daily work. Such discoveries offer an important source for understanding our past."
Die Datenbank umfasst über 420.000 Datensätze! Beigegeben sind hochauflösende Fotos.
Eine gesetzliche Anzeigepflicht besteht bei Schatzfunden:
http://finds.org.uk/treasure
Für Ankäufe durch Museen gibt es Finanzierung durch diverse Stiftungen:
http://finds.org.uk/treasure/advice/museumacquistionfunding
Bilder des Portable Antiquities Scheme sind auch auf Flickr zu finden unter freier Lizenz
 CC-BY-SA
CC-BY-SA
Zum Kontext:
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales. Every year many thousands of objects are discovered, many of these by metal-detector users, but also by people whilst out walking, gardening or going about their daily work. Such discoveries offer an important source for understanding our past."
Die Datenbank umfasst über 420.000 Datensätze! Beigegeben sind hochauflösende Fotos.
Eine gesetzliche Anzeigepflicht besteht bei Schatzfunden:
http://finds.org.uk/treasure
Für Ankäufe durch Museen gibt es Finanzierung durch diverse Stiftungen:
http://finds.org.uk/treasure/advice/museumacquistionfunding
Bilder des Portable Antiquities Scheme sind auch auf Flickr zu finden unter freier Lizenz
 CC-BY-SA
CC-BY-SAZum Kontext:
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bericht über einen Gütetermin:
http://www.zeitung.schatzsuchen.de/post/schatzsucher/92/Klage-gegen-das-LfD-Hessen--Report-aus-dem-Gerichtssaal
Mehr dazu:
http://www.schatzsucher.de/Foren/showthread.php?t=60682
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
http://www.zeitung.schatzsuchen.de/post/schatzsucher/92/Klage-gegen-das-LfD-Hessen--Report-aus-dem-Gerichtssaal
Mehr dazu:
http://www.schatzsucher.de/Foren/showthread.php?t=60682
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=38&ausgabe=5940
Sonderheft 13 enthält eine Bibliographie zu 25 Jahren Residenzen-Kommission
http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/SH13.htm
Sonderheft 13 enthält eine Bibliographie zu 25 Jahren Residenzen-Kommission
http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/SH13.htm
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:44 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Termin: Di. 01.02.2011, 18:30
Veranstaltungsort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3 B, 55116 Mainz
Veranstaltet von: Stadtarchiv der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
Link
Veranstaltungsort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3 B, 55116 Mainz
Veranstaltet von: Stadtarchiv der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
Link
Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:25 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über zwei Pariser Ausstellungen berichtet:
http://www.fr-online.de/kultur/kunst/die-rettung-des-augenblicks/-/1473354/5058774/-/view/asFirstTeaser/-/index.html
Hier ergänzende Links, die die FR wie im Qualitätsjournalismus üblich, unterschlägt:
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.primitifs_calotype.html
http://goo.gl/hFA1Z
http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/editeur/PDF/pr%C3%A9sentation%20%C3%A9loge%20agents.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Talbotypie
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Calotypes
Photographie : un éloge du négatif au Petit Palais
Hochgeladen von mairiedeparis. - Kunst und Animation Videos.
http://www.fr-online.de/kultur/kunst/die-rettung-des-augenblicks/-/1473354/5058774/-/view/asFirstTeaser/-/index.html
Hier ergänzende Links, die die FR wie im Qualitätsjournalismus üblich, unterschlägt:
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.primitifs_calotype.html
http://goo.gl/hFA1Z
http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/editeur/PDF/pr%C3%A9sentation%20%C3%A9loge%20agents.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Talbotypie
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Calotypes
Photographie : un éloge du négatif au Petit Palais
Hochgeladen von mairiedeparis. - Kunst und Animation Videos.
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 20:12 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Dass es bisher fast keine Informationen über mögliche Euthanasie-Opfer in Hall gab, könnte laut Experten an einem "Vertuschungs-Skandal" in den 1960er-Jahren liegen. Historiker Schreiber: "Die Landesregierung hat 1963 gezielt einen Akt aus dem Landesarchiv ausgehoben und vernichtet. In dem Dokument ging es um die Verlegung von Patienten in andere Anstalten." Vor allem nach Schloss Hartheim bei Linz (OÖ) brachten die Nazis Tausende Menschen mit Behinderungen. Dort wurden zwischen 1940 und 1944 im Rahmen der NS-Euthanasiepolitik rund 30.000 Menschen ermordet. "
Quelle: oe24.at, 3.1.2011
Quelle: oe24.at, 3.1.2011
Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:43 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
Niederlande (neue Website):
http://www.innl.nl/
Deutschland
http://www.dhm.de/
Kann man eigentlich eine Museumswebsite heutzutage schlechter gestalten als das Deutsche Historische Museum?
http://www.innl.nl/
Deutschland
http://www.dhm.de/
Kann man eigentlich eine Museumswebsite heutzutage schlechter gestalten als das Deutsche Historische Museum?
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:25 - Rubrik: Museumswesen
Besonders dumm äußerte sich die ARD-Intendantin Monika Piel, die kostenlose Angebote als Geburtsfehler des Internets bezeichnete. Nix gepeilt, ne?
Eine Verschwördung der ARD mit der Verlagslobby mutmaßt:
http://mspr0.de/?p=1940
Zur Kritik an Piels Äußerungen siehe auch:
http://www.stefan-niggemeier.de/blog/frau-piel-wir-muessen-reden/
http://www.neunetz.com/2011/01/04/wirre-aussagen-zum-medienwandel-von-der-neuen-ard-vorsitzenden/
http://www.netzpolitik.org/2011/ard-vorsitzende-piel-will-geburtsfehler-des-internets-beseitigen/
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,737692,00.html
http://carta.info/37061/gestatten-monika-piel-erste-oeffentlich-rechtliche-verlegerin/
Ein Zitat aus § 13 13. Rundfunkstaatsvertrag: " Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkgebühren, Einnamen aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnamen; vorrangige Finanzierungsquelle ist die Rundfunkgebühr. Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrages gegen besonderes Entgelt sind unzulässig".
Weitere Resonanz:
http://rivva.de/http://www.tagesspiegel.de/medien/die-ard-steht-fuer-eine-allianz-gegen-google-bereit/3687510.html

Gemüsefoto von Monica Arellano-Ongpin http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Das findet man u.a., wenn man nach freien Bildern von Monika Piel in der Google Bildersuche sucht
Eine Verschwördung der ARD mit der Verlagslobby mutmaßt:
http://mspr0.de/?p=1940
Zur Kritik an Piels Äußerungen siehe auch:
http://www.stefan-niggemeier.de/blog/frau-piel-wir-muessen-reden/
http://www.neunetz.com/2011/01/04/wirre-aussagen-zum-medienwandel-von-der-neuen-ard-vorsitzenden/
http://www.netzpolitik.org/2011/ard-vorsitzende-piel-will-geburtsfehler-des-internets-beseitigen/
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,737692,00.html
http://carta.info/37061/gestatten-monika-piel-erste-oeffentlich-rechtliche-verlegerin/
Ein Zitat aus § 13 13. Rundfunkstaatsvertrag: " Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkgebühren, Einnamen aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnamen; vorrangige Finanzierungsquelle ist die Rundfunkgebühr. Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrages gegen besonderes Entgelt sind unzulässig".
Weitere Resonanz:
http://rivva.de/http://www.tagesspiegel.de/medien/die-ard-steht-fuer-eine-allianz-gegen-google-bereit/3687510.html

Gemüsefoto von Monica Arellano-Ongpin http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Das findet man u.a., wenn man nach freien Bildern von Monika Piel in der Google Bildersuche sucht
KlausGraf - am Dienstag, 4. Januar 2011, 19:01 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 4. Januar 2011, 10:48 - Rubrik: Unterhaltung
http://www.hathitrust.org
Most Google-digitized scans in Hathitrust are also available in Google, but a lot of European publications published after 1909 and before 1923 isn't in Google as fulltext while HathiTrust is offering access for US-citizen. There are also books before 1909 which are not in Google e.g.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433066646872
You can browse these books from outside the US by using an US proxy. (PDF-Download is limited to one page for not-affiliates of a HathiTrust partner institution.)
1. First choose a proxy
See e.g. the list at
http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Liste_aktueller_Web-Anonymizer
2. Go to the proxy URL
E.g. http://uethelp.us/
3. Enter the HatiTrust URL
4. Read!
See the screencast http://screenr.com/Uxt
or at http://www.youtube.com/watch?v=Jc5_QE1Gi_I
Most Google-digitized scans in Hathitrust are also available in Google, but a lot of European publications published after 1909 and before 1923 isn't in Google as fulltext while HathiTrust is offering access for US-citizen. There are also books before 1909 which are not in Google e.g.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433066646872
You can browse these books from outside the US by using an US proxy. (PDF-Download is limited to one page for not-affiliates of a HathiTrust partner institution.)
1. First choose a proxy
See e.g. the list at
http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Liste_aktueller_Web-Anonymizer
2. Go to the proxy URL
E.g. http://uethelp.us/
3. Enter the HatiTrust URL
4. Read!
See the screencast http://screenr.com/Uxt
or at http://www.youtube.com/watch?v=Jc5_QE1Gi_I
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 22:09 - Rubrik: English Corner
http://goo.gl/SHeVi
wenn Bücher so obsolet werden wie Kerzen, Vinylschallplatten oder Schreibmaschinen (immerhin Produkte, für die es noch einen bescheidenen Markt gibt), wie soll dann das Geschäftsmodell von Bibliotheken in Zukunft aussehen?
Zur Zukunft der Archive stehen Stellungnahmen zu meinen diesbezüglichen Ausführungen noch aus ...
http://goo.gl/uIoIm (PDF)
wenn Bücher so obsolet werden wie Kerzen, Vinylschallplatten oder Schreibmaschinen (immerhin Produkte, für die es noch einen bescheidenen Markt gibt), wie soll dann das Geschäftsmodell von Bibliotheken in Zukunft aussehen?
Zur Zukunft der Archive stehen Stellungnahmen zu meinen diesbezüglichen Ausführungen noch aus ...
http://goo.gl/uIoIm (PDF)
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 21:26 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 18:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://collections.mcny.org/
Das Museum der City of New York präsentiert seine Fotosammlung auch online.
Via Geschichtsweberin.
Das Museum der City of New York präsentiert seine Fotosammlung auch online.
Via Geschichtsweberin.
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 18:46 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die DEFA-Stiftung hat die letzten 26 Spielfilme der DEFA übernommen und da mit ihr DDR-Film-Archiv vervollständigt. Die Streifen seien von der Medien Bildungsgesellschaft Babelsberg erworben worden, teilte die Stiftung in Berlin mit. Sie seien als Dokumente der Zeitgeschichte äußerst wichtig für das Gesamtschaffen der DEFA, sagte Stiftungs-Vorstand Helmut Morsbach.
Die weithin unbekannten Filme entstanden zwischen 1990 und 1993 im ehemaligen staatlichen Spielfilmstudio der DDR in Potsdam-Babelsberg. Sie spiegelten die Atmosphäre dieser Umbruchsphase."
Quelle: 3satText 03.01.11 18:30:01 S.504
".... Zu den jetzt in das Archiv übernommenen Filmen gehören u.a. "Der Verdacht" von Frank Beyer, "Herzsprung" von Helke Misselwitz, "Stein" von Egon Günther und "Verfehlung" von Heiner Carow."
Quelle: rbbtext, S. 136, 3.1.2011
Link zur Homepage der DEFA-Stiftung
Bestand:
"Zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehören:
* Produktionen des DEFA-Studios für Dokumentarfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Spielfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Trickfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Synchronisationen,
* Dokumentarfilme, die im Auftrag für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten produziert wurden,
* Zeitzeugengespräche mit Künstlern der DEFA,
* Produktionen aus dem Zeitzeugen-Archiv Thomas Grimm,
* Produktionen der Cintec GmbH,
* nicht veröffentlichte und Restmaterialien aus den DEFA-Studios,
* im Prozeß der Produktion und Distribution entstandenes Schriftgut, Werbematerial - Fotos, Plakate, Noten, Drehbücher u.s.w.
Die zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehörenden Filme sind in der Datenbank auf dieser Website verzeichnet. Sie enthält alle wichtigen filmografischen Angaben und teilweise Inhaltsangaben und wird laufend ergänzt."
Die weithin unbekannten Filme entstanden zwischen 1990 und 1993 im ehemaligen staatlichen Spielfilmstudio der DDR in Potsdam-Babelsberg. Sie spiegelten die Atmosphäre dieser Umbruchsphase."
Quelle: 3satText 03.01.11 18:30:01 S.504
".... Zu den jetzt in das Archiv übernommenen Filmen gehören u.a. "Der Verdacht" von Frank Beyer, "Herzsprung" von Helke Misselwitz, "Stein" von Egon Günther und "Verfehlung" von Heiner Carow."
Quelle: rbbtext, S. 136, 3.1.2011
Link zur Homepage der DEFA-Stiftung
Bestand:
"Zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehören:
* Produktionen des DEFA-Studios für Dokumentarfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Spielfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Trickfilme,
* Produktionen des DEFA-Studios für Synchronisationen,
* Dokumentarfilme, die im Auftrag für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten produziert wurden,
* Zeitzeugengespräche mit Künstlern der DEFA,
* Produktionen aus dem Zeitzeugen-Archiv Thomas Grimm,
* Produktionen der Cintec GmbH,
* nicht veröffentlichte und Restmaterialien aus den DEFA-Studios,
* im Prozeß der Produktion und Distribution entstandenes Schriftgut, Werbematerial - Fotos, Plakate, Noten, Drehbücher u.s.w.
Die zum Filmstock der DEFA-Stiftung gehörenden Filme sind in der Datenbank auf dieser Website verzeichnet. Sie enthält alle wichtigen filmografischen Angaben und teilweise Inhaltsangaben und wird laufend ergänzt."
Wolf Thomas - am Montag, 3. Januar 2011, 18:30 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Er ist deshalb attraktiv, weil er unter anderem die Anzahl der Aufrufe angibt.
bibliothekarisch.de/blog/2010/12/31/lachen-bibliothekarinnen-persoenliche-eindruecke-unbeantwortete-fragen-ein-best-practice-beispiel-aus-oesterreich/
goo.gl/WHFFh
16 hours ago 61
Der Archivalia-Link auf bibliothekarisch.de Lachen BibliothekarInnen? wurde also 61mal angeklickt.
Länderauswertung
Germany
39
Netherlands
8
Austria
3
Switzerland
3
United States
2
Belgium
1
bibliothekarisch.de/blog/2010/12/31/lachen-bibliothekarinnen-persoenliche-eindruecke-unbeantwortete-fragen-ein-best-practice-beispiel-aus-oesterreich/
goo.gl/WHFFh
16 hours ago 61
Der Archivalia-Link auf bibliothekarisch.de Lachen BibliothekarInnen? wurde also 61mal angeklickt.
Länderauswertung
Germany
39
Netherlands
8
Austria
3
Switzerland
3
United States
2
Belgium
1
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein dringlicher Gesetzentwurf dazu wurde von den hessischen Regierungsparteien CDU und FDP im Dezember in den Landtag eingebracht (PDF der Drucksache 18/3479). Der zuständige Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat beschlossen, mich dazu schriftlich anzuhören. Ich dokumentiere im folgenden meine Stellungnahme und im Anschluss daran meine Rezension des Buchs von Fischer zu Cramburg über das Schatzregal (2002) mit aktualisierten Internetlinks.
***
Stellungnahme zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes Drucks. 18/3479
Mit der Änderung des § 24 Hessisches Denkmalschutzgesetz soll ein - mit der von Ralf Fischer zu Cramburg: Das Schatzregal, 2001, S. 151vorgeschlagenen Terminologie zu sprechen - "umfassendes Schatzregal"begründet werden, das neu entdeckte bewegliche Bodendenkmale dem Eigentum des Landes überweist. Damit tritt das landesrechtliche Schatzregal an die Stelle des bislang in Hessen maßgeblichen § 984 BGB, das bei Funden das Eigentum zur Hälfte dem Entdecker und zur anderen Hälfte dem Grundeigentümer zuspricht. Als Länder ohne Schatzregal verbleiben würden nurmehr Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Um es kurz zusammenzufassen: Der vorliegende Gesetzentwurf findet nicht meine Zustimmung.
Zur Begründung darf ich auf meine im Internet 2002 veröffentlichte Rezension der maßgeblichen Monographie von Fischer zu Cramburg verweisen:
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm
Wie einige mir bekannt gewordene Zitate im einschlägigen Schrifttum beweisen, hat diese Besprechung durchaus Beachtung gefunden. Ich halte meine damaligen Überlegungen auch heute noch für zutreffend.
Als Wissenschaftler und Publizist engagiere ich mich für den Schutz von Kulturgut, das ich als kulturelles Allgemeingut betrachte, für das es angemessene rechtliche Rahmenbedingungen zu entwickeln gilt. Archäologische Funde müssen der Forschung zugänglich sein und in der Regel in öffentlichen Sammlungen dauerhaft verwahrt werden. Im öffentlichen Interesse muss sowohl die Tätigkeit der Hobby-Archäologen/Sondengänger als auch der freie Handel mit archäologischen Objekten (einschließlich Münzen) gesetzlich reglementiert werden. Ich bezweifle aber, dass der zur Rede stehende Gesetzentwurf in diesem Sinn zweckmäßig ist.
(1) Ein landesgesetzliches Schatzregal ohne ausdrückliche Entschädigungsregelung für den Finder entspricht nicht der Billigkeit
Fischer zu Cramburg hat überzeugend herausgestellt, dass die seit dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz von 1971 in fast allen Bundesländern verankerten Schatzregale fiskalisch motiviert sind: Es geht im Kern darum, dass der Staat Geld spart. Nach einem Bericht der FAZ (Online-Ausgabe 14. Dezember 2010, http://goo.gl/FvMh7) soll das auch der Hintergrund des Dringlichen Gesetzentwurfs sein. Aufgrund hoher Summen, die das Land Hessen für die Auslösung sensationeller Funde in der Vergangenheit zahlen musste, will man nun aus der kleinen Gruppe der schatzregalfreien Bundesländer ausscheren.
Wer etwas findet, darf einen Finderlohn erwarten. Werden ehrliche Finder mit einem "Fachbuch" abgespeist, so ist der Anreiz, wertvolle Bodenfunde zu melden, kaum gegeben. Eine Schatzregal-Regelung, die auf eine angemessene Entschädigung verzichtet, schadet eher dem Denkmalschutz als dass sie ihm nützt. "Practical wisdom", schreibt der amerikanische Jurist Joseph L. Sax, "suggests that finders ordinarily need to be compensated generously or the public is unlikely to get the found objects, regardless of the formal rules" (Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 1999, S. 185).
Eine Norm, die sich gegen das Rechtsempfinden der Bürger stellt, kann nicht mit Akzeptanz rechnen. Wieso soll der ehrliche Finder von Bodendenkmalen, wie jetzt auch für Hessen vorgesehen, leer ausgehen? Findet jemand im Straßengraben eine Perlenkette im Wert von 500 Euro, erhält er 25 Euro Finderlohn, falls sich die Eigentümerin meldet. Falls nicht, darf er sie nach sechs Monaten behalten. Wird eine solche Perlenkette bei Bauarbeiten gefunden, z.B. weil sie bei der Flucht 1945 dort versteckt worden war, gehört sie zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstückseigentümer. Wieso kommt es auf das Bundesland an, ob die "hadrianische Teilung" des § 984 BGB gilt? Und wieso gibt es bei den landesrechtlichen Schatzregalen eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des Orts (z.B. Grabungsschutzgebiet) oder der Bedeutung des Funds? Ist der ehrliche Finder der Dumme?
Ob es in Hessen eine gewisse Entschädigung für den Finder geben soll, wie sie in Ländern mit Schatzregal üblich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn es sich so verhält, dann ist es geboten, diese als Rechtsanspruch im Gesetz zu formulieren.
§ 12 Absatz 2 des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes lautet daher sinnvollerweise:
"(2) Dem Entdecker zufälliger Funde, die nach Absatz 1 Eigentum des Landes werden, ist durch die Denkmalfachbehörde eine angemessene Belohnung in Geld zu gewähren, es sei denn, bewegliche Bodendenkmale sind bei unerlaubten Nachforschungen entdeckt worden."
Ob eine Entschädigung für den Finder sinnvoll ist, die dem Marktwert nahekommt, soll der Entscheidung des Landesgesetzgebers überlassen bleiben. Sie sollte aber die Höhe des gesetzlichen Finderlohns nicht unterschreiten, meiner Ansicht nach sogar deutlich überschreiten.
Gegen eine Entschädigung auch für den Grundstückseigentümer spricht, dass die Verhaltenssteuerung durch die Entschädigungsregelung vor allem auf den aktiv handelnden Finder abzielt, der davon abgehalten werden soll, Funde der archäologischen Denkmalpflege zu entziehen.
(2) Ein landesgesetzliches Schatzregal hat als Kollateralschaden eine Kriminalisierung derjenigen, die Funde verheimlichen, zur Folge.
Ein Schatzregal verlagert aufgrund der Regelung der Eigentumsdelikte im Strafgesetzbuch die Fundunterschlagung vom Ordnungswidrigkeitenrecht in das Strafrecht. Der Landesgesetzgeber muss diese Konsequenz und sich weiter daraus ableitbare Folgerungen bewusst bejahen, wenn er die vorgeschlagene Regelung beschließt. Das Strafrecht sollte aber immer "ultima ratio" des rechtlichen Sanktionsinventars bleiben. Ich bezweifle, dass eine Behandlung der Finder archäologischer Objekte, die diese nicht der Denkmalfachbehörde übergeben, als Straftäter rechtspolitisch in jeder Hinsicht zweckmäßig und angemessen ist.
(3) Eine einheitliche bundesrechtliche Regelung wäre vorzuziehen.
Ich teile die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen landesrechtliche Schatzregale, auch wenn das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hat. Aber nicht nur aus diesem Grund wäre zu überlegen, den föderalen Flickenteppich durch eine Ergänzung des § 984 BGB zu vereinheitlichen. Sie hätte den Übergang der archäologischen Funde in das Eigentum des betreffenden Bundeslandes, aber auch eine angemessene Entschädigung für den Finder anzuordnen. Zumindest für die deutschen Bundesländer wäre so dem "Fundtourismus", also der Anmeldung von Funden in einem schatzregalfreien Bundesland, wirksam begegnet.
(4) Die Eigentümerstellung des Landes ist gesetzlich zu beschränken.
In zweierlei Hinsicht droht Kulturgütern Gefahr durch den Staat als Eigentümer (sieht man vom faktischen Risiko der nicht sachgerechten Betreuung oder sogar Vernachlässigung in öffentlichen Sammlungen ab):
- 1. er ist durch gesetzliche Vorschriften nicht gehindert, archäologisches Kulturgut zu verkaufen und ihm dadurch die notwendige Zugänglichkeit für Forschung und Öffentlichkeit zu nehmen;
- 2. er kann Kulturgüter in unangemessener Weise zum Nachteil der Allgemeinheit immaterialgüterrechtlich vermarkten.
Zu Punkt 1: Dabei geht es üblicherweise um die sporadisch diskutierte Problematik der Museumsverkäufe, aber nach den im September 2006 bekannt gewordenen ungeheuerlichen Plänen der baden-württembergischen Landesregierung, Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe in den Handel zu geben (die Pläne konnten bekanntlich verhindert werden), wird man sich auch für das archäologische Fundgut die Frage zu stellen haben, ob der Hafen einer öffentlichen Sammlung des Landes tatsächlich so sicher ist, wie man traditionell anzunehmen geneigt war. Hinsichtlich des kommunalen Archivguts, das Sammlungsgut darstellt, hat das nordrhein-westfälische Archivgesetz in seiner Novelle 2010 bewusst davon abgesehen, es als unveräußerlich zu erklären: http://archiv.twoday.net/stories/6358735/. Rechtsvorschriften, die ein Ministerium daran hindern würden, die Denkmalfachbehörden anzuweisen, besonders hochwertige Stücke etwa auf einer Auktion zu veräußern, existieren nicht. Dass dergleichen, soweit bekannt, absolut nicht üblich ist, begründet kein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht.
Zu Punkt 2: Die immaterialgüterrechtliche Vermarktung der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, qua Schatzregal Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt, mittels des Urheberrechts (§ 71 UrhG) und des Markenrechts durch das Land Sachsen-Anhalt halte ich für völlig unangemessen, da es die Freiheit der Allgemeinheit, kulturelles Allgemeingut zu nutzen, unzuträglich einschränkt.
(5) Solange keine belastbaren empirischen Untersuchungen zu Auswirkungen des fachlich heftig umstrittenen Schatzregal vorliegen, ist die Behauptung der amtlichen Begründung, es sei aus "denkmalschutzfachlicher Sicht sinnvoll" unbewiesen und unzulässig.
Die Begründung setzt sich mit keiner Silbe mit den gravierenden Nachteilen auseinander, die Wissenschaftler und Fachleute für das Schatzregal namhaft machen (siehe etwa die Zusammenstellung bei Fischer zu Cramburg S. 194ff.). Es geht hier nicht darum, der Sondengänger-Lobby und der Handels-Lobby nach dem Munde zu reden, es geht einzig und allein um die nüchterne Abwägung, ob ein Schatzregal mehr nützt als schadet.
Zu erinnern ist an die pragmatisch motivierte Ablehnung des Schatzregals durch den renommierten hessischen Numismatiker Niklot Klüßendorf, die er 1992 (in: Mabillons Spur, S. 391ff.) begründete.
2003 schrieb Almuth Gumprecht aus der Sicht der nordrhein-westfälischen Denkmalpflege: "Ob der oftmals von Fachleuten vorgetragene Wunsch zur Einführung eines Schatzregals in NRW zur Verbesserung der tatsächlichen Situation beitragen würde, vermag ich nicht zu sagen. [...] Ob eine Änderung der rechtlichen Konstruktion Schatzsucher und Raubgräber aber eher dazu brächte, Fundmeldungen zu machen, bleibt zu bezweifeln. Die ehrlichen Finder (Sammler) würden weiterhin wie bisher den Fund anzeigen, ob man die Unehrlichen auf diese Weise auf den Pfad der Tugend brächte, ist angesichts der Erfahrungen aus Bundesländern mit Schatzregal unwahrscheinlich."
http://www.lwl.org/wmfah-download/pdf/Schatzregal.pdf
Die ZEIT zitierte 2010 einen hessischen Polizeibeamten, der die Wirksamkeit des Schatzregals ebenfalls bezweifelt: "»Es kommt immer wieder zur Fundortverschleppung«, sagt Polizeioberkommissar Eckhard Laufer, der sich in Hessen seit fast 15 Jahren um den Kulturgüterschutz kümmert. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es einen Raubgräber nicht interessiert, ob es ein Schatzregal gibt oder nicht gibt. »Ein Raubgräber will immer den größtmöglichen Gewinn erzielen«, sagt Laufer."
http://www.zeit.de/2010/16/Acker-Schatzsuche-Kasten
In einem undatierten "Vortrag über Sondengängertum", nachlesbar im Internet, konstatiert Hendrik Ludwig: "Unstrittig scheint in weiten Teilen der Literatur die Gefahr der Verheimlichung von Schatzfunden zu sein. Die Bereitschaft Funde zu melden und abzuliefern ist augenscheinlich, ohne die Möglichkeit des Entdeckers oder Grundeigentümers daran finanziell zu partizipieren, in Frage gestellt. Schafft man keine Anreize zur Meldung und Abgabe von Funden, so fördert das Schatzregal die Abwanderung derselben in Privatsammlungen und den Kunsthandel. Heute hat sich gezeigt, dass die abschreckende Wirkung des Schatzregals nicht allzu hoch einzuschätzen ist. Es kam im Gegenteil zu einer stärkeren Verheimlichung und einem Entziehen der Funde für die wissenschaftliche Forschung. So wurden beispielsweise in Baden-Württemberg, das das große Schatzregal eingeführt hat, pro Jahr nur 80 Fundmünzen zur Herkunftsbestimmung vorgelegt. Im regalfreien Bayern waren es dagegen, im gleichen Zeitraum 4000 bis 5000 Münzen."
http://www.archaeologie-krefeld.de/Bilder/news/Sondengaenger/vortragludwig.pdf
Schon allein diese wenigen Zitate legen es nahe, die Gesetzgebung endlich auf eine empirische Grundlage zu stellen und eine entsprechende Studie in Auftrag zu geben, die auch die Erfahrungen anderer europäischer Staaten (angeführt wird von Gegnern des Schatzregals immer wieder Großbritannien) zu berücksichtigen hätte. Nachdem Hessen lange bewusst ohne Schatzregal ausgekommen ist, ist nicht ersichtlich, was die besondere Eilbedürftigkeit des Gesetzesentwurfs begründet. Angesichts der möglichen Nachteile sollten die Kosten für eine solche empirische Studie und die Verzögerung der Einführung eines Schatzregals in Kauf genommen werden. Zugleich wäre es sinnvoll, sich mit den anderen Bundesländern abzustimmen.
Auch wenn der Landtag jetzt ein Schatzregal erlassen will, sollte er auf jeden Fall eine Befristung bzw. Evaluierung der Regelung aufgrund von empirischen Daten vorsehen.
Interessante Ausführungen aus Sicht der Ökonomie zum Schatzregal von Tobias Kalledat sind im Internet einsehbar:
http://www.kalledat.de/Scientifical_Stuff/Treasure_finding/Kalledat_Schatzfunde_und_ihr_rechtlich-okonomischer_Kontext.PDF
Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass zwar der Landeshaushalt entlastet wird, weil hohe Auslösesummen für einzelne spektakuläre Schatzfunde entfallen, aber auf breiter Basis erhebliche Schäden durch verstärkten Fundtourismus und Ausweitung des Schattenmarkts mit archäologischen Objekten entstehen. Dies kann unmöglich im Interesse der Denkmalpflege sein, die ja immer wieder darauf verweist, dass es ihr um die unscheinbaren Befunde ohne kommerziellen Wert geht. Die Einführung des Schatzregals wäre somit ein Pyrrhus-Sieg für die Denkmalpflege.
Hinsichtlich der Sondengängerszene erscheint es sicher, dass durch ein Schatzregal der notwendige und eigentlich alternativlose Dialog zwischen Denkmalfachbehörden und Sondengängern empfindlich gestört würde. Eine Kriminalisierung wäre absolut nicht hilfreich, sondern würde zur Verfestigung der Fronten beitragen. Der Denkmalschutz muss die einsichtigen Sondengänger für sein Anliegen gewinnen, da eine flächendeckende Überwachung aller potentiellen Fundstätten nun einmal nicht möglich ist.
Empfehlenswert ist die Lektüre der Entscheidung des VG Wiesbaden aus dem Jahr 2000, in der es heißt: "Die Behörde wird sich insgesamt aus dem behaglichen Areal, in dem sie bislang auf dem Gebiete der Archäologie von der Öffentlichkeit völlig ungestört arbeiten konnte, herausbewegen müssen".
http://www.digs-online.de/dokumente/vwgurteil.pdf
Aufschlussreich ist eine undatierte Fragebogenauswertung (ca. 500 Teilnehmer) einer sich denkmalschutzfreundlich gebenden Sondengängervereinigung:
http://www.digs-online.de/fragebogen.htm
Zitat: "Die Frage nach dem Schatzregal zeigt, dass 53% der beteiligten Sondengänger der Meinung sind, das Schatzregal müsse komplett abgeschafft werden, 47% stimmen für eine Beibehaltung mit leichten Änderungen, die darauf hinauslaufen, dass Entdecker und Grundstückseigner eine „Ablieferprämie“ erhalten, die sich am derzeitigen Verkehrswert, mindestens aber am Finderlohn wie bei verlorenen Gegenständen orientiert."
Dies bedeutet, dass nur eine knappe Mehrheit strikt gegen ein Schatzregal ist, der Rest aber mit einer großzügigen Entschädigungsregelung leben könnte.
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung nimmt einseitig Partei für die “Hardliner”, die im Schatzregal ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Raubgräber sehen. Und sie soll dem Land Hessen viel Geld sparen. Aber aus meiner Sicht dient sie nicht dem Rechtsfrieden und womöglich auch nicht den Interessen des Denkmalschutzes.
***
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm
Tippfehler wurden stillschweigend korrigiert.
Ralf Fischer zu Cramburg : Das Schatzregal. Der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an Schatzfunden in den deutschen Rechten, Hoehr-Grenzhausen: Numismatischer Verlag Gerd Martin Forneck 2001 [Veröffentlichungen der Gesellschaft für Historische Hilfswissenschaften 6]. 222 S., 48 EUR.
Rezensiert von
Dr. Klaus Graf, Universität Freiburg
Email: graf@uni-koblenz.de [obsolet]
Nicht nur die Kuratoren numismatischer Sammlungen finden in diesem Buch brisanten Lesestoff. Die Untersuchung gilt dem sogenannten Schatzregal, das definiert wird als "der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an beweglichen Sachen von materiellem oder wissenschaftlichem Wert [...], die solange verborgen waren, dass ein Eigentümer nicht (mehr) zu ermitteln ist" (S. 45). Das materialreiche Buch, sowohl rechtshistorisch als auch für die aktuelle Diskussion in Archäologie und Denkmalschutz von Belang, liest sich gut und argumentiert präzise. Dargestellt wird die Geschichte des Schatzregals seit der Antike.
Der Schwerpunkt liegt auf der juristischen Debatte um 1900 im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und auf den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer seit 1971. Hier wurde solide recherchiert, weshalb man durchaus von einem juristischen Standardwerk hinsichtlich des etwas abseitigen Themas sprechen darf. Doch sollten auch Historiker und mit der Fundproblematik befasste Archäologen, Denkmalschützer und Museumspraktiker diese verdienstvolle Studie nicht übersehen. Trotzdem möchte ich zwei Punkte kritisch beleuchten: historische Defizite, was Mittelalter und frühe Neuzeit angeht (I), und die rechtspolitisch motivierte These des Autors, die derzeit bestehenden landesrechtlichen Schatzregale seien verfassungswidrig (II).
I
Wem gehört der Schatz? Zwei Prinzipien prägen die rechtliche Behandlung von Schatzfunden seit der Antike: Auf den römischen Kaiser Hadrian geht die Halbierung zwischen dem Finder und dem Grundeigentümer zurück, die in § 984 BGB fixiert wurde. Das regalistische Alternativmodell weist den Fund dagegen dem König, Landesfürsten oder Staat zu. Die juristische Lehre führt die mit dem Etikett "deutschrechtlich" versehene Institution auf den Sachsenspiegel des Eike von Repgow aus dem frühen 13. Jahrhundert zurück, in dessen Landrecht (I 35 § 1) jeder Schatz, der tiefer in der Erde vergraben liegt, als ein Pflug geht, dem König zugesprochen wird. Daneben gab es Mischformen, wobei vor allem Drittelungen beliebt waren. Nach der Darstellung des gut erforschten antiken römischen Schatzrechts (S. 47-58) wendet sich der Autor dem Mittelalter zu.
Während die frühmittelalterlichen Quellen keine klare Aussage zulassen, gibt es im Hochmittelalter verstärkt Hinweise auf die Existenz eines Schatzregals. Fischer zu Cramburg hat aber im wesentlichen für die Zeit vor 1800 der vorliegenden, überwiegend älteren rechtshistorischen Literatur nachrecherchiert, was aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kaum befriedigen kann. Für die frühe Neuzeit konnte er sich freilich auf kenntnisreiche archivalische Vorarbeiten des Numismatikers Niklot Klüssendorf stützen. Eine mangelnde Vertrautheit mit den Gepflogenheiten der Rechtsgeschichte offenbart bereits die ungewöhnliche Zitierweise der Diplomata-Bände der MGH. Im Spätmittelalter verlässt sich der Autor fast ganz auf die Rechtsbücher, die punktuell durch andere normative Quellen ergänzt werden. So müssen die Aussagen über das landesfürstliche Schatzregal allzu vage bleiben. Eine breitere Literaturkenntnis und ein intensiveres Eindringen in die historische Literatur hätte zu der Einsicht verhelfen können, dass in Spätmittelalter und Neuzeit noch eine Fülle von Material zu entdecken ist. Die pragmatische Entscheidung, eine "Vorgeschichte" der Debatten um 1900 und in der Gegenwart vorzulegen und auf uferlose Erkundigungen zu verzichten, ist nachvollziehbar. Aber ein Blick auf einen kurz vor der Arbeit erschienenen Aufsatz von Wolfgang Schmid zum Schatz-Thema (vor allem anhand trierischer Beispiele) zeigt doch, wieviel Fischer zu Cramburg entgangen ist [1]. 1346 billigte Karl IV. dem Trierer Erzbischof in einem Sammelprivileg für seinen weltlichen Herrschaftsbereich das Berg- und das Schatzregal zu ("Preterea ius omnium argentiarium sive aliarum mineriarium in dominio deu districtu Treverensis ecclesie vel in ipsis dyocesi repertarum et reperiendarum necnon thesauros sub terra absconditos et in dictis terris inventos seu inveniendos ad prefatum archiepiscopum et ipsius successores volumus perpetuo pertinere [...]" [2]).
Dass es sich dabei keineswegs um eine theoretische Bestimmung gehandelt hat, zeigt die 1351 in einem grösseren Klagenkatalog vorgebrachte Beschwerde der Stadt Trier bei Erzbischof Balduin über die Gefangennahme eines Bürgers, der in seinem Erbe gegraben und unter anderem goldene Ringe gefunden hatte. Gegen das Schatzregal des Kurfürsten reklamierte die Stadtgemeinde den Fund für den Bürger [3]. Fischer zu Cramburg hat sich leider nicht eingehender mit dem verwandten Bergregal und auch nicht mit dem Strandregal (bzw. der Grundruhr) beschäftigt. Ebensowenig interessiert er sich für die mittelalterliche Diskussion über Regalien. Er erwähnt noch nicht einmal die fundamentale Tatsache, dass das Regalienweistum von Roncaglia (MGH D F I Nr. 237) in die "Libri feudorum" aufgenommen wurde [4]. Da der Autor sich strikt auf das deutsche Recht bezieht und die Verhältnisse in den Nachbarstaaten nicht berücksichtigt, kann er keine Erkenntnisfortschritte bei der Frage nach dem Ursprung der in verschiedenen europäischen Staaten üblichen Regalienkonzeption erzielen. Er hätte die oberitalienischen Juristen befragen müssen, wobei eine Lektüre des faszinierenden Buchs zur politischen Theologie des Königtums von Ernst H. Kantorowicz die richtige Richtung gewiesen hätte [5]. Wie kommt beispielsweise der bedeutendste englische Rechtsdenker des 13. Jahrhunderts, Bracton, der viele Gedanken mit den Juristen Kaiser Friedrichs II. teilte, dessen "Liber Augustalis" Fischer zu Cramburg als für "die Rechtslage in Deutschland nicht weiter aufschlussreich" (S. 66) abtut, dazu, den Schatzfund für den König zu beanspruchen [6]? Der Schlüssel liegt wohl in der Rechtskultur der gelehrten Legisten begründet, die bei den Regalien keine Einschränkungen zugunsten von Finder und Grundeigentümer mehr zulassen wollten.
Das vermeintliche deutschrechtliche Institut des Sachsenspiegels liesse sich so einem romanisierenden europäischen Rechtsdiskurs zuweisen. Was die frühe Neuzeit betrifft, so sind dem Autor leider alle Studien zum (magischen) Schatzgräbertum [7] unbekannt geblieben, sogar die kunsthistorische Monographie von Klinkhammer 1992 [8]. Der jüngste Aufsatz zu diesem Thema, der oberrheinische Akten des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgewertet hat, bietet aufschlussreiches Material auch zum Schatzregal [9]. Überhaupt wäre eine stärkere Öffnung der Rechtsgeschichte zur sozial- und kulturhistorisch orientierten Historischen Kriminalitätsforschung wünschenswert. Auf jeden Fall verspricht das Thema des juristischen Umgangs mit Schatzsuche und Schatzfunden in der frühen Neuzeit noch manche spannende und lehrreiche Geschichte - unter der Prämisse freilich, dass man über den traditionellen rechtshistorischen Tellerrand der normativen Qüllen hinausblickt.
II
1971 führte Baden-Württemberg in seinem Denkmalschutzgesetz ein "grosses" Schatzregal ein (§ 23) [10]. Wenn sie einen hervorragenden Wert haben, fallen nicht nur die bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten entdeckten beweglichen Kulturdenkmale an den Staat. Bis heute sind die meisten anderen Bundesländer dem Beispiel Baden-Württembergs gefolgt, nur die Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern kennen kein Schatzregal. In ihnen gilt § 984 BGB. Im März 1981 suchte ein Hobbyarchäologe mit einem Metalldetektor den "Runden Berg" bei Urach ab. Er stiess auf einen wichtigen Hortfund mit Metallgegenständen aus alemannischer Zeit, den er für sich behalten wollte. Seine gegen die Verurteilung wegen Unterschlagung - die Gegenstände beanspruchte das Land qua Schatzregal als Eigentum - gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschied mit Beschluss vom 18. Mai 1988 [11], das in den Dienst des Denkmalschutzes gestellte Schatzregal des Landes sei verfassungsgemäss. Um einen Fossilienfund ging es bei einem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), das mit Urteil vom 21. November 1996 die rheinland-pfälzische Regelung (§ 19a DSchPflG) mit dem Grundgesetz vereinbar erklärte [12]. Fischer zu Cramburg kann überzeugend darlegen, dass die Berufung des Bundesverfassungsgerichts auf das "hergebrachte Schatzregal" und den Sachsenspiegel verfehlt war. Das Schatzregal der Denkmalschutzgesetze ist eigentlich ein Altertums- oder Kulturdenkmalregal, es ist ein archaisierendes Recht, das mit der Bezeichnung als "Schatzregal" auf ein obsolet gewordenes Relikt zurückgreift und einen Traditionsbruch negiert [13]. Der Autor kann zeigen, dass bei den Beratungen vor der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Frage des Altertumsschutzes durchaus diskutiert wurde, dass ein Schatzregal damals so gut wie nicht mehr bestanden hat (allenfalls in Teilen Schleswigs und im thüringischen Kleinstaat Schwarzburg-Rudolstadt) und dass die Vorschrift des Art. 73 EGBGB, das die landesrechtlichen Regalien unberührt lässt, sich auf die Finanzregalien bezog. Die Motive des Gesetzgebers des BGB lassen die Neubegründung eines denkmalschutzrechtlichen Schatzregals als verfassungsrechtlich höchst fragwürdig erscheinen. Kurzum: Soweit die Entscheidung des BVerfG auf einer Auslegung des Regalienvorbehalts basiert, kann sie, wie schon Klaus-Peter Schröder in seiner Besprechung dargelegt hat [14], nicht überzeugen.
Der BGB-Redaktor Reinhold Johow schrieb bereits: "Ein Bedürfnis, der Landesgesetzgebung zur Schaffung neür Regalien Raum zu lassen, kann nicht anerkannt werden, da die Staaten mittels ihrer hoheitlichen Rechte dieselben Zwecke, welche ehedem durch das Institut der Regalien erstrebt wurden, in befriedigender Weise zu erreichen vermögen" [15]. Unmissverständlich hat zudem auch das BVerwG in seiner erwähnten Entscheidung von 1996 klargestellt, dass in Rheinland-Pfalz die Ablieferung von Fossilienfunden nicht auf den Regalienvorbehalt des Art. 73 EGBGB gestützt werden konnte, da es ein auf solche Funde bezogenes Regal nie gegeben habe. Nicht folgen möchte ich Fischer zu Cramburg, wenn er (S. 156-159) die Zuordnung des sogenannten Schatzregals zum öffentlichen Recht leugnet. Das BVerwG hat hier die besseren Argumente. Obwohl die Konkurrenz zu § 984 BGB de facto misslich ist, können die Vorschriften über die Eigentumszuordnung wissenschaftlich bedeutsamer, also denkmalwerter Funde zwanglos der Materie Denkmalschutzrecht, für die eine ausschliessliche Gesetzeskompetenz der Länder besteht, zugewiesen werden. Es liegt auch hier die Ueberlagerung zweier Rechtsordnungen im selben Sachbereich vor [16]. Der Landesgesetzgeber konnte die Belange der Allgemeinheit bei der Eigentumszuordnung rechtmässig ins Spiel bringen und den Inhalt des Eigentums eines kleinen Teils aller herrenlosen Sachen im Sinne von Art. 14 I GG bestimmen, ohne dass er in bestehende Rechtspositionen eingriff.
Das Denkmalaneigungsrecht der Länder darf - mindestens seit dem Nasskiesungs-Beschluss des BVerfG [wie Anm. 16] - nicht einseitig aus der Perspektive des Zivilrechts beurteilt werden. Das öffentliche Recht ist nicht nur befugt, die Beschränkungen des Eigentums (ausgleichspflichtig oder nicht) auf dem Gebiet des Denkmalschutzes regeln, es kann auch seinen Inhalt bestimmen, also festlegen, was bei Funden Privateigentum wird und was aus Gründen des Denkmalschutzes in das Landeseigentum übergeht. Ralf Fischer zu Cramburg, tätig als Rechtsanwalt am Deutschen Aktieninstitut e.V. in Frankfurt, ist Partei, er schreibt gegen das Schatzregal, um es zu Fall zu bringen. Wie man der Suchmaschine Google entnehmen kann, hat er nicht nur an einem Hearing der rheinland-pfälzischen FDP, die die Abschaffung des Schatzregals fordert, als Verteter des Verbands der Deutschen Münzhändler teilgenommen, sondern sammelt auch selbst (südasiatische) Münzen. Der Verband der Deutschen Münzhändler hat 1998 auch auf die FDP-Fraktion des Bundestags Einfluss genommen, die damals zum grossen Schaden des Kulturgutschutzes in Deutschland den Entwurf des Kulturgutschutz-Rahmengesetzes zu Fall gebracht hat [17].
Es ist nachvollziehbar, dass den Sondengängern, Sammlern und dem Handel das Schatzregal der meisten Bundesländer ein Dorn im Auge ist. Nichtsdestotrotz: Die allgemeinen rechtspolitischen Argumente, die gegen das Schatzregal ins Feld geführt werden, haben erhebliches Gewicht. Der renommierte hessische Numismatiker Niklot Klüssendorf hat schon 1992 überzeugende pragmatische Bedenken gegen das Schatzregal artikuliert [18]. Es führt zur Verschleppung und Verfälschung archäologischer Funde, zu einem wissenschaftlich höchst bedauerlichen "Fundtourismus", bei dem die gefundenen Stücke mit gefälschter Herkunft in einem Bundesland ohne Schatzregal registriert werden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist schlichtweg nicht gegeben: "Wer etwas wertvolles findet und meldet, möchte nicht leer ausgehen" [19]. Fischer zu Cramburg bemerkt zurecht, es schade der Diskussion, dass der einzige unumstrittene Vorteil des Schatzregals, die Schonung der Landeskassen, meist nicht offen genannt werde (S. 201). Werden ehrliche Finder - wie in Mecklenburg-Vorpommern üblich (S. 202) - mit einem "Fachbuch" abgespeist, so ist der Anreiz, wertvolle Bodenfunde zu melden, kaum gegeben. Eine Schatzregal-Regelung, die auf eine angemessene Entschädigung verzichtet, schadet eher dem Denkmalschutz als dass sie ihm nützt. "Practical wisdom", schreibt der amerikanische Jurist Joseph L. Sax in einer wunderbaren Monographie, "suggests that finders ordinarily need to be compensated generously or the public is unlikely to get the found objects, regardless of the formal rules" [20].
Das Schatzregal muss im Kontext der Diskussion über die Rolle der privaten Interessenten an archäologischen Funden gesehen werden. Die Fronten der Debatte [21] sind ideologisch verhärtet: Einflussreiche Hardliner in den Ämtern wollen in allen Sondengängern nur kriminelle Raubgräber sehen und den Handel mit archäologischem Fundgut ganz unterbinden. Auf der anderen Seite stehen die berechtigten Interessen von seriösen "Hobby-Archäologen", die in den Ämtern vielfach nur auf Ablehnung stossen. Mit Recht zitiert Fischer zu Cramburg S. 206 aus dem Urteil des Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 3. Mai 2000, das der hessischen Denkmalpflege folgendes ins Stammbuch schrieb: "Die Behörde wird sich insgesamt aus dem behaglichen Areal, in dem sie bislang auf dem Gebiete der Archäologie von der Öffentlichkeit völlig ungestört arbeiten konnte, herausbewegen müssen" [22]. Mit ihrer martialischen Rhetorik in Verbindung mit einer unangemessenen Kriminalisierung und der Verweigerung jeglichen Dialogs werden die Bodendenkmalpfleger die Schatzsucher-Szene gewiss nicht austrocknen können. Über Sinn und Unsinn eines Schatzregals müsste aufgrund einer - bislang nicht vorliegenden - empirischen Untersuchung über Fundmeldungen entschieden werden. Dabei könnten auch die Erfahrungen anderer Staaten [23] nützlich sein, die Fischer zu Cramburg leider nur sehr selektiv und nur dort, wo sie seiner Forderung entsprechen, berücksichtigt. Was ist etwa mit der benachbarten Schweiz, die in Art. 724 ZGB wissenschaftlich wertvolle Gegenstände dem Eigentum des Kantons zuweist, der aber den Finder zu entschädigen hat [24]? Eine breite öffentliche und fachliche Diskussion über das Schatzregal als Instrument des Denkmalschutzes hat in dem Buch von Fischer zu Cramburg einen exzellenten Ausgangspunkt. Die Debatte sollte sich aber nicht auf das staatliche normative Instrumentarium beschränken, sondern auch die Möglichkeit der Selbstverpflichtung durch Ethik-Codes (der Museen, Sammler, Händler, Wissenschaftler und Sondengänger) berücksichtigen. Solche Codes [25] hinreichend verbindlich auszugestalten und in einem kommunikativen Prozess aufeinander zu beziehen, wird gewiss keine leichte Aufgabe. Aber eine Denkmalpflege, die in absolutistischer Manier nur hoheitsvoll von oben herab agiert, sich ans Schatzregal klammert und sich dem öffentlichen Diskurs verweigert, hat mit Sicherheit auch keine Zukunft.
Anmerkungen:
[1] Wolfgang Schmid, Die Jagd nach dem verborgenen Schatz. Ein Schlüsselmotiv in der Geschichte des Mittelalters?, in: Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft. Festgabe für Franz Irsigler, hrsg. von Dietrich Ebeling u.a., Trier 2001, S. 347-400, hier besonders S. 379-383.
[2] Neues Archiv 33 (1908), S. 377. [Inzwischen online:
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN345858530_0033 ]
[3] Vgl. Lukas Clemens, in: Trier im Mittelalter, hrsg. von Hans Hubert Anton u. Alfred Haverkamp, Trier 1996, S. 192.
[4] Eine Wiedergabe des Weistums online: http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/AntWiSys/PVII.htm [Wayback: http://web.archive.org/web/20011223085244/http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/AntWiSys/PVII.htm ] Einige weitere Quellenbelege zur romanistischen Geschichte des Schatzfunds bietet eine akademische Seite aus Seoul: http://plaza.snu.ac.kr/~romanist/lecture/postgr/thesaur1.html [Wayback: http://web.archive.org/web/20020613130941/http://plaza.snu.ac.kr/~romanist/lecture/postgr/thesaur1.html ]
[5] Vgl. Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. "The King's Two Bodies". Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, München 1990, S. 183f. zu den Regalien (mit Erwähnung des Schatzregals).
[6] Lateinischer Text und englische Übersetzung der Stelle online: http://supct.law.cornell.edu/bracton/Unframed/Latin/v2/338.htm
[Nun http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/Unframed/Latin/v2/338.htm ]
http://supct.law.cornell.edu/bracton/Unframed/English/v2/338.htm [Nun http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/Unframed/English/v2/338.htm ]
[7] Die Literaturliste von Wolfgang Schmid dazu ist auch online verfügbar: http://www.listserv.dfn.de/htbin/wa.exe?A2=ind0110&L=hexenforschung&P=R9880 [Nun: http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0110&L=HEXENFORSCHUNG&P=R9880 ]
[8] Heide Klinkhammer, Schatzgräber, Weisheitssucher und Dämonenbeschwörer. Die motivische und thematische Rezeption des Topos der Schatzsuche in der Kunst vom 15. bis 18. Jahrhundert, Berlin 1992.
[9] Thomas Adam, "Viel tausend gulden laegeten am selbigen orth". Schatzgräberei und Geisterbeschwörung in Südwestdeutschland vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: Historische Anthropologie 9 (2001), S. 358-383, besonders S. 375-379.
[10] Derzeit gültiger Gesetzestext: http://www.landesdenkmalamt-bw.de/denkmalschutzgesetz.html [ http://www.denkmalpflege-bw.de/ ]. Weitere Gesetzestexte von Denkmalschutzgesetzen sind nachgewiesen unter: http://www.dhm.de/pipermail/demuseum/2002-January/002116.html http://www.dhm.de/pipermail/demuseum/2002-February/002129.html
[Stattdessen: http://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutzgesetz bzw. http://www.hendrik.maekeler.eu/denkmalschutzgesetze/ ]
[11] BVerfGE 78, S. 205 ff. [Online: http://servat.unibe.ch/dfr/bv078205.html ]
[12] NJW 1997, S. 1171 ff.
[13] Zu archaisierendem Recht vgl. meine Bemerkungen: http://www.uni-koblenz.de/~graf/strafj.htm [Nun: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/strafj.htm ]
[14] Klaus-Peter Schröder, Grundgesetz und Schatzregal, in: Juristen-Zeitung 1989, S. 676-679.
[15] Zitiert ebd., S. 679 Fn. 32.
[16] Vgl. Beschluss vom 15.7.1981, BVerfGE 58, 300 ff. - online: http://www.uni-würzburg.de/dfr/bv058300.html [Nun: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv058300.html ]
[17] Siehe Interviewfrage an Reinhardt Mussgnug und dessen Antwort in: Bewahren als Problem. Schutz archäologischer Kulturgüter, hrsg. von Martin Flashar, Freiburg i. Br. 2000, S. 122.
[18] Niklot Klüssendorf, Numismatik und Denkmalschutz. Aktuelle Probleme des Rechts an Münzfunden in den östlichen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, in: Mabillons Spur. [Festschrift] Walter Heinemeyer, hrsg. von Peter Rück, Marburg 1992, S. 391-410.
[19] Ebd., S. 405.
[20] Joseph L. Sax, Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 1999, S. 185. Hinweise zum Schatzregal in anderen Ländern ebd., S. 230 Anm. 30.
[21] Einen guten Einblick bietet das in Anm. 17 genannte Taschenbuch.
[22] Volltext online: http://www.sdiv.de/frames/recht/mythos.pdf [Stattdessen: http://www.digs-online.de/dokumente/vwgurteil.pdf ]
[23] Ausgewählte Internetquellen
Hinweise von S. P. Scott (1932) in seiner Justinian-Uebersetzung zu Titel 1 Nr. 39: http://www.constitution.org/sps/sps02_j1-2.htm Darstellungen zum Fundrecht ("Antiquities Law") von England, Wales, Schottland, Belgien und Isräl (International Numismatic Commission): http://www.amnumsoc.org/inc/ [Wayback: http://web.archive.org/web/20011202052000/http://www.amnumsoc.org/inc/ ]
[24] Vgl. z.B. die Hinweise bei Hans Rainer Künzle, Schweizerisches Bibliotheks- und Dokumentationsrecht, Zürich 1992, S. 113, 317f., 328f.
[25] Beispiele für Ethik-Codes aus dem Kulturgutbereich im WWW dokumentiert die VL Museumsrecht:
http://www.uni-koblenz.de/~graf/museumr.htm
[Nun: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/museumr.htm ]
© VL Museen
Alle Rechte beim Autor und VL Museen
Dokument erstellt am 1.3.2002
***
Stellungnahme zu dem Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes Drucks. 18/3479
Mit der Änderung des § 24 Hessisches Denkmalschutzgesetz soll ein - mit der von Ralf Fischer zu Cramburg: Das Schatzregal, 2001, S. 151vorgeschlagenen Terminologie zu sprechen - "umfassendes Schatzregal"begründet werden, das neu entdeckte bewegliche Bodendenkmale dem Eigentum des Landes überweist. Damit tritt das landesrechtliche Schatzregal an die Stelle des bislang in Hessen maßgeblichen § 984 BGB, das bei Funden das Eigentum zur Hälfte dem Entdecker und zur anderen Hälfte dem Grundeigentümer zuspricht. Als Länder ohne Schatzregal verbleiben würden nurmehr Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Um es kurz zusammenzufassen: Der vorliegende Gesetzentwurf findet nicht meine Zustimmung.
Zur Begründung darf ich auf meine im Internet 2002 veröffentlichte Rezension der maßgeblichen Monographie von Fischer zu Cramburg verweisen:
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm
Wie einige mir bekannt gewordene Zitate im einschlägigen Schrifttum beweisen, hat diese Besprechung durchaus Beachtung gefunden. Ich halte meine damaligen Überlegungen auch heute noch für zutreffend.
Als Wissenschaftler und Publizist engagiere ich mich für den Schutz von Kulturgut, das ich als kulturelles Allgemeingut betrachte, für das es angemessene rechtliche Rahmenbedingungen zu entwickeln gilt. Archäologische Funde müssen der Forschung zugänglich sein und in der Regel in öffentlichen Sammlungen dauerhaft verwahrt werden. Im öffentlichen Interesse muss sowohl die Tätigkeit der Hobby-Archäologen/Sondengänger als auch der freie Handel mit archäologischen Objekten (einschließlich Münzen) gesetzlich reglementiert werden. Ich bezweifle aber, dass der zur Rede stehende Gesetzentwurf in diesem Sinn zweckmäßig ist.
(1) Ein landesgesetzliches Schatzregal ohne ausdrückliche Entschädigungsregelung für den Finder entspricht nicht der Billigkeit
Fischer zu Cramburg hat überzeugend herausgestellt, dass die seit dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz von 1971 in fast allen Bundesländern verankerten Schatzregale fiskalisch motiviert sind: Es geht im Kern darum, dass der Staat Geld spart. Nach einem Bericht der FAZ (Online-Ausgabe 14. Dezember 2010, http://goo.gl/FvMh7) soll das auch der Hintergrund des Dringlichen Gesetzentwurfs sein. Aufgrund hoher Summen, die das Land Hessen für die Auslösung sensationeller Funde in der Vergangenheit zahlen musste, will man nun aus der kleinen Gruppe der schatzregalfreien Bundesländer ausscheren.
Wer etwas findet, darf einen Finderlohn erwarten. Werden ehrliche Finder mit einem "Fachbuch" abgespeist, so ist der Anreiz, wertvolle Bodenfunde zu melden, kaum gegeben. Eine Schatzregal-Regelung, die auf eine angemessene Entschädigung verzichtet, schadet eher dem Denkmalschutz als dass sie ihm nützt. "Practical wisdom", schreibt der amerikanische Jurist Joseph L. Sax, "suggests that finders ordinarily need to be compensated generously or the public is unlikely to get the found objects, regardless of the formal rules" (Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 1999, S. 185).
Eine Norm, die sich gegen das Rechtsempfinden der Bürger stellt, kann nicht mit Akzeptanz rechnen. Wieso soll der ehrliche Finder von Bodendenkmalen, wie jetzt auch für Hessen vorgesehen, leer ausgehen? Findet jemand im Straßengraben eine Perlenkette im Wert von 500 Euro, erhält er 25 Euro Finderlohn, falls sich die Eigentümerin meldet. Falls nicht, darf er sie nach sechs Monaten behalten. Wird eine solche Perlenkette bei Bauarbeiten gefunden, z.B. weil sie bei der Flucht 1945 dort versteckt worden war, gehört sie zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstückseigentümer. Wieso kommt es auf das Bundesland an, ob die "hadrianische Teilung" des § 984 BGB gilt? Und wieso gibt es bei den landesrechtlichen Schatzregalen eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des Orts (z.B. Grabungsschutzgebiet) oder der Bedeutung des Funds? Ist der ehrliche Finder der Dumme?
Ob es in Hessen eine gewisse Entschädigung für den Finder geben soll, wie sie in Ländern mit Schatzregal üblich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn es sich so verhält, dann ist es geboten, diese als Rechtsanspruch im Gesetz zu formulieren.
§ 12 Absatz 2 des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes lautet daher sinnvollerweise:
"(2) Dem Entdecker zufälliger Funde, die nach Absatz 1 Eigentum des Landes werden, ist durch die Denkmalfachbehörde eine angemessene Belohnung in Geld zu gewähren, es sei denn, bewegliche Bodendenkmale sind bei unerlaubten Nachforschungen entdeckt worden."
Ob eine Entschädigung für den Finder sinnvoll ist, die dem Marktwert nahekommt, soll der Entscheidung des Landesgesetzgebers überlassen bleiben. Sie sollte aber die Höhe des gesetzlichen Finderlohns nicht unterschreiten, meiner Ansicht nach sogar deutlich überschreiten.
Gegen eine Entschädigung auch für den Grundstückseigentümer spricht, dass die Verhaltenssteuerung durch die Entschädigungsregelung vor allem auf den aktiv handelnden Finder abzielt, der davon abgehalten werden soll, Funde der archäologischen Denkmalpflege zu entziehen.
(2) Ein landesgesetzliches Schatzregal hat als Kollateralschaden eine Kriminalisierung derjenigen, die Funde verheimlichen, zur Folge.
Ein Schatzregal verlagert aufgrund der Regelung der Eigentumsdelikte im Strafgesetzbuch die Fundunterschlagung vom Ordnungswidrigkeitenrecht in das Strafrecht. Der Landesgesetzgeber muss diese Konsequenz und sich weiter daraus ableitbare Folgerungen bewusst bejahen, wenn er die vorgeschlagene Regelung beschließt. Das Strafrecht sollte aber immer "ultima ratio" des rechtlichen Sanktionsinventars bleiben. Ich bezweifle, dass eine Behandlung der Finder archäologischer Objekte, die diese nicht der Denkmalfachbehörde übergeben, als Straftäter rechtspolitisch in jeder Hinsicht zweckmäßig und angemessen ist.
(3) Eine einheitliche bundesrechtliche Regelung wäre vorzuziehen.
Ich teile die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen landesrechtliche Schatzregale, auch wenn das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hat. Aber nicht nur aus diesem Grund wäre zu überlegen, den föderalen Flickenteppich durch eine Ergänzung des § 984 BGB zu vereinheitlichen. Sie hätte den Übergang der archäologischen Funde in das Eigentum des betreffenden Bundeslandes, aber auch eine angemessene Entschädigung für den Finder anzuordnen. Zumindest für die deutschen Bundesländer wäre so dem "Fundtourismus", also der Anmeldung von Funden in einem schatzregalfreien Bundesland, wirksam begegnet.
(4) Die Eigentümerstellung des Landes ist gesetzlich zu beschränken.
In zweierlei Hinsicht droht Kulturgütern Gefahr durch den Staat als Eigentümer (sieht man vom faktischen Risiko der nicht sachgerechten Betreuung oder sogar Vernachlässigung in öffentlichen Sammlungen ab):
- 1. er ist durch gesetzliche Vorschriften nicht gehindert, archäologisches Kulturgut zu verkaufen und ihm dadurch die notwendige Zugänglichkeit für Forschung und Öffentlichkeit zu nehmen;
- 2. er kann Kulturgüter in unangemessener Weise zum Nachteil der Allgemeinheit immaterialgüterrechtlich vermarkten.
Zu Punkt 1: Dabei geht es üblicherweise um die sporadisch diskutierte Problematik der Museumsverkäufe, aber nach den im September 2006 bekannt gewordenen ungeheuerlichen Plänen der baden-württembergischen Landesregierung, Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe in den Handel zu geben (die Pläne konnten bekanntlich verhindert werden), wird man sich auch für das archäologische Fundgut die Frage zu stellen haben, ob der Hafen einer öffentlichen Sammlung des Landes tatsächlich so sicher ist, wie man traditionell anzunehmen geneigt war. Hinsichtlich des kommunalen Archivguts, das Sammlungsgut darstellt, hat das nordrhein-westfälische Archivgesetz in seiner Novelle 2010 bewusst davon abgesehen, es als unveräußerlich zu erklären: http://archiv.twoday.net/stories/6358735/. Rechtsvorschriften, die ein Ministerium daran hindern würden, die Denkmalfachbehörden anzuweisen, besonders hochwertige Stücke etwa auf einer Auktion zu veräußern, existieren nicht. Dass dergleichen, soweit bekannt, absolut nicht üblich ist, begründet kein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht.
Zu Punkt 2: Die immaterialgüterrechtliche Vermarktung der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, qua Schatzregal Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt, mittels des Urheberrechts (§ 71 UrhG) und des Markenrechts durch das Land Sachsen-Anhalt halte ich für völlig unangemessen, da es die Freiheit der Allgemeinheit, kulturelles Allgemeingut zu nutzen, unzuträglich einschränkt.
(5) Solange keine belastbaren empirischen Untersuchungen zu Auswirkungen des fachlich heftig umstrittenen Schatzregal vorliegen, ist die Behauptung der amtlichen Begründung, es sei aus "denkmalschutzfachlicher Sicht sinnvoll" unbewiesen und unzulässig.
Die Begründung setzt sich mit keiner Silbe mit den gravierenden Nachteilen auseinander, die Wissenschaftler und Fachleute für das Schatzregal namhaft machen (siehe etwa die Zusammenstellung bei Fischer zu Cramburg S. 194ff.). Es geht hier nicht darum, der Sondengänger-Lobby und der Handels-Lobby nach dem Munde zu reden, es geht einzig und allein um die nüchterne Abwägung, ob ein Schatzregal mehr nützt als schadet.
Zu erinnern ist an die pragmatisch motivierte Ablehnung des Schatzregals durch den renommierten hessischen Numismatiker Niklot Klüßendorf, die er 1992 (in: Mabillons Spur, S. 391ff.) begründete.
2003 schrieb Almuth Gumprecht aus der Sicht der nordrhein-westfälischen Denkmalpflege: "Ob der oftmals von Fachleuten vorgetragene Wunsch zur Einführung eines Schatzregals in NRW zur Verbesserung der tatsächlichen Situation beitragen würde, vermag ich nicht zu sagen. [...] Ob eine Änderung der rechtlichen Konstruktion Schatzsucher und Raubgräber aber eher dazu brächte, Fundmeldungen zu machen, bleibt zu bezweifeln. Die ehrlichen Finder (Sammler) würden weiterhin wie bisher den Fund anzeigen, ob man die Unehrlichen auf diese Weise auf den Pfad der Tugend brächte, ist angesichts der Erfahrungen aus Bundesländern mit Schatzregal unwahrscheinlich."
http://www.lwl.org/wmfah-download/pdf/Schatzregal.pdf
Die ZEIT zitierte 2010 einen hessischen Polizeibeamten, der die Wirksamkeit des Schatzregals ebenfalls bezweifelt: "»Es kommt immer wieder zur Fundortverschleppung«, sagt Polizeioberkommissar Eckhard Laufer, der sich in Hessen seit fast 15 Jahren um den Kulturgüterschutz kümmert. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es einen Raubgräber nicht interessiert, ob es ein Schatzregal gibt oder nicht gibt. »Ein Raubgräber will immer den größtmöglichen Gewinn erzielen«, sagt Laufer."
http://www.zeit.de/2010/16/Acker-Schatzsuche-Kasten
In einem undatierten "Vortrag über Sondengängertum", nachlesbar im Internet, konstatiert Hendrik Ludwig: "Unstrittig scheint in weiten Teilen der Literatur die Gefahr der Verheimlichung von Schatzfunden zu sein. Die Bereitschaft Funde zu melden und abzuliefern ist augenscheinlich, ohne die Möglichkeit des Entdeckers oder Grundeigentümers daran finanziell zu partizipieren, in Frage gestellt. Schafft man keine Anreize zur Meldung und Abgabe von Funden, so fördert das Schatzregal die Abwanderung derselben in Privatsammlungen und den Kunsthandel. Heute hat sich gezeigt, dass die abschreckende Wirkung des Schatzregals nicht allzu hoch einzuschätzen ist. Es kam im Gegenteil zu einer stärkeren Verheimlichung und einem Entziehen der Funde für die wissenschaftliche Forschung. So wurden beispielsweise in Baden-Württemberg, das das große Schatzregal eingeführt hat, pro Jahr nur 80 Fundmünzen zur Herkunftsbestimmung vorgelegt. Im regalfreien Bayern waren es dagegen, im gleichen Zeitraum 4000 bis 5000 Münzen."
http://www.archaeologie-krefeld.de/Bilder/news/Sondengaenger/vortragludwig.pdf
Schon allein diese wenigen Zitate legen es nahe, die Gesetzgebung endlich auf eine empirische Grundlage zu stellen und eine entsprechende Studie in Auftrag zu geben, die auch die Erfahrungen anderer europäischer Staaten (angeführt wird von Gegnern des Schatzregals immer wieder Großbritannien) zu berücksichtigen hätte. Nachdem Hessen lange bewusst ohne Schatzregal ausgekommen ist, ist nicht ersichtlich, was die besondere Eilbedürftigkeit des Gesetzesentwurfs begründet. Angesichts der möglichen Nachteile sollten die Kosten für eine solche empirische Studie und die Verzögerung der Einführung eines Schatzregals in Kauf genommen werden. Zugleich wäre es sinnvoll, sich mit den anderen Bundesländern abzustimmen.
Auch wenn der Landtag jetzt ein Schatzregal erlassen will, sollte er auf jeden Fall eine Befristung bzw. Evaluierung der Regelung aufgrund von empirischen Daten vorsehen.
Interessante Ausführungen aus Sicht der Ökonomie zum Schatzregal von Tobias Kalledat sind im Internet einsehbar:
http://www.kalledat.de/Scientifical_Stuff/Treasure_finding/Kalledat_Schatzfunde_und_ihr_rechtlich-okonomischer_Kontext.PDF
Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass zwar der Landeshaushalt entlastet wird, weil hohe Auslösesummen für einzelne spektakuläre Schatzfunde entfallen, aber auf breiter Basis erhebliche Schäden durch verstärkten Fundtourismus und Ausweitung des Schattenmarkts mit archäologischen Objekten entstehen. Dies kann unmöglich im Interesse der Denkmalpflege sein, die ja immer wieder darauf verweist, dass es ihr um die unscheinbaren Befunde ohne kommerziellen Wert geht. Die Einführung des Schatzregals wäre somit ein Pyrrhus-Sieg für die Denkmalpflege.
Hinsichtlich der Sondengängerszene erscheint es sicher, dass durch ein Schatzregal der notwendige und eigentlich alternativlose Dialog zwischen Denkmalfachbehörden und Sondengängern empfindlich gestört würde. Eine Kriminalisierung wäre absolut nicht hilfreich, sondern würde zur Verfestigung der Fronten beitragen. Der Denkmalschutz muss die einsichtigen Sondengänger für sein Anliegen gewinnen, da eine flächendeckende Überwachung aller potentiellen Fundstätten nun einmal nicht möglich ist.
Empfehlenswert ist die Lektüre der Entscheidung des VG Wiesbaden aus dem Jahr 2000, in der es heißt: "Die Behörde wird sich insgesamt aus dem behaglichen Areal, in dem sie bislang auf dem Gebiete der Archäologie von der Öffentlichkeit völlig ungestört arbeiten konnte, herausbewegen müssen".
http://www.digs-online.de/dokumente/vwgurteil.pdf
Aufschlussreich ist eine undatierte Fragebogenauswertung (ca. 500 Teilnehmer) einer sich denkmalschutzfreundlich gebenden Sondengängervereinigung:
http://www.digs-online.de/fragebogen.htm
Zitat: "Die Frage nach dem Schatzregal zeigt, dass 53% der beteiligten Sondengänger der Meinung sind, das Schatzregal müsse komplett abgeschafft werden, 47% stimmen für eine Beibehaltung mit leichten Änderungen, die darauf hinauslaufen, dass Entdecker und Grundstückseigner eine „Ablieferprämie“ erhalten, die sich am derzeitigen Verkehrswert, mindestens aber am Finderlohn wie bei verlorenen Gegenständen orientiert."
Dies bedeutet, dass nur eine knappe Mehrheit strikt gegen ein Schatzregal ist, der Rest aber mit einer großzügigen Entschädigungsregelung leben könnte.
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung nimmt einseitig Partei für die “Hardliner”, die im Schatzregal ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Raubgräber sehen. Und sie soll dem Land Hessen viel Geld sparen. Aber aus meiner Sicht dient sie nicht dem Rechtsfrieden und womöglich auch nicht den Interessen des Denkmalschutzes.
***
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf02-1.htm
Tippfehler wurden stillschweigend korrigiert.
Ralf Fischer zu Cramburg : Das Schatzregal. Der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an Schatzfunden in den deutschen Rechten, Hoehr-Grenzhausen: Numismatischer Verlag Gerd Martin Forneck 2001 [Veröffentlichungen der Gesellschaft für Historische Hilfswissenschaften 6]. 222 S., 48 EUR.
Rezensiert von
Dr. Klaus Graf, Universität Freiburg
Email: graf@uni-koblenz.de [obsolet]
Nicht nur die Kuratoren numismatischer Sammlungen finden in diesem Buch brisanten Lesestoff. Die Untersuchung gilt dem sogenannten Schatzregal, das definiert wird als "der obrigkeitliche Anspruch auf das Eigentum an beweglichen Sachen von materiellem oder wissenschaftlichem Wert [...], die solange verborgen waren, dass ein Eigentümer nicht (mehr) zu ermitteln ist" (S. 45). Das materialreiche Buch, sowohl rechtshistorisch als auch für die aktuelle Diskussion in Archäologie und Denkmalschutz von Belang, liest sich gut und argumentiert präzise. Dargestellt wird die Geschichte des Schatzregals seit der Antike.
Der Schwerpunkt liegt auf der juristischen Debatte um 1900 im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und auf den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer seit 1971. Hier wurde solide recherchiert, weshalb man durchaus von einem juristischen Standardwerk hinsichtlich des etwas abseitigen Themas sprechen darf. Doch sollten auch Historiker und mit der Fundproblematik befasste Archäologen, Denkmalschützer und Museumspraktiker diese verdienstvolle Studie nicht übersehen. Trotzdem möchte ich zwei Punkte kritisch beleuchten: historische Defizite, was Mittelalter und frühe Neuzeit angeht (I), und die rechtspolitisch motivierte These des Autors, die derzeit bestehenden landesrechtlichen Schatzregale seien verfassungswidrig (II).
I
Wem gehört der Schatz? Zwei Prinzipien prägen die rechtliche Behandlung von Schatzfunden seit der Antike: Auf den römischen Kaiser Hadrian geht die Halbierung zwischen dem Finder und dem Grundeigentümer zurück, die in § 984 BGB fixiert wurde. Das regalistische Alternativmodell weist den Fund dagegen dem König, Landesfürsten oder Staat zu. Die juristische Lehre führt die mit dem Etikett "deutschrechtlich" versehene Institution auf den Sachsenspiegel des Eike von Repgow aus dem frühen 13. Jahrhundert zurück, in dessen Landrecht (I 35 § 1) jeder Schatz, der tiefer in der Erde vergraben liegt, als ein Pflug geht, dem König zugesprochen wird. Daneben gab es Mischformen, wobei vor allem Drittelungen beliebt waren. Nach der Darstellung des gut erforschten antiken römischen Schatzrechts (S. 47-58) wendet sich der Autor dem Mittelalter zu.
Während die frühmittelalterlichen Quellen keine klare Aussage zulassen, gibt es im Hochmittelalter verstärkt Hinweise auf die Existenz eines Schatzregals. Fischer zu Cramburg hat aber im wesentlichen für die Zeit vor 1800 der vorliegenden, überwiegend älteren rechtshistorischen Literatur nachrecherchiert, was aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kaum befriedigen kann. Für die frühe Neuzeit konnte er sich freilich auf kenntnisreiche archivalische Vorarbeiten des Numismatikers Niklot Klüssendorf stützen. Eine mangelnde Vertrautheit mit den Gepflogenheiten der Rechtsgeschichte offenbart bereits die ungewöhnliche Zitierweise der Diplomata-Bände der MGH. Im Spätmittelalter verlässt sich der Autor fast ganz auf die Rechtsbücher, die punktuell durch andere normative Quellen ergänzt werden. So müssen die Aussagen über das landesfürstliche Schatzregal allzu vage bleiben. Eine breitere Literaturkenntnis und ein intensiveres Eindringen in die historische Literatur hätte zu der Einsicht verhelfen können, dass in Spätmittelalter und Neuzeit noch eine Fülle von Material zu entdecken ist. Die pragmatische Entscheidung, eine "Vorgeschichte" der Debatten um 1900 und in der Gegenwart vorzulegen und auf uferlose Erkundigungen zu verzichten, ist nachvollziehbar. Aber ein Blick auf einen kurz vor der Arbeit erschienenen Aufsatz von Wolfgang Schmid zum Schatz-Thema (vor allem anhand trierischer Beispiele) zeigt doch, wieviel Fischer zu Cramburg entgangen ist [1]. 1346 billigte Karl IV. dem Trierer Erzbischof in einem Sammelprivileg für seinen weltlichen Herrschaftsbereich das Berg- und das Schatzregal zu ("Preterea ius omnium argentiarium sive aliarum mineriarium in dominio deu districtu Treverensis ecclesie vel in ipsis dyocesi repertarum et reperiendarum necnon thesauros sub terra absconditos et in dictis terris inventos seu inveniendos ad prefatum archiepiscopum et ipsius successores volumus perpetuo pertinere [...]" [2]).
Dass es sich dabei keineswegs um eine theoretische Bestimmung gehandelt hat, zeigt die 1351 in einem grösseren Klagenkatalog vorgebrachte Beschwerde der Stadt Trier bei Erzbischof Balduin über die Gefangennahme eines Bürgers, der in seinem Erbe gegraben und unter anderem goldene Ringe gefunden hatte. Gegen das Schatzregal des Kurfürsten reklamierte die Stadtgemeinde den Fund für den Bürger [3]. Fischer zu Cramburg hat sich leider nicht eingehender mit dem verwandten Bergregal und auch nicht mit dem Strandregal (bzw. der Grundruhr) beschäftigt. Ebensowenig interessiert er sich für die mittelalterliche Diskussion über Regalien. Er erwähnt noch nicht einmal die fundamentale Tatsache, dass das Regalienweistum von Roncaglia (MGH D F I Nr. 237) in die "Libri feudorum" aufgenommen wurde [4]. Da der Autor sich strikt auf das deutsche Recht bezieht und die Verhältnisse in den Nachbarstaaten nicht berücksichtigt, kann er keine Erkenntnisfortschritte bei der Frage nach dem Ursprung der in verschiedenen europäischen Staaten üblichen Regalienkonzeption erzielen. Er hätte die oberitalienischen Juristen befragen müssen, wobei eine Lektüre des faszinierenden Buchs zur politischen Theologie des Königtums von Ernst H. Kantorowicz die richtige Richtung gewiesen hätte [5]. Wie kommt beispielsweise der bedeutendste englische Rechtsdenker des 13. Jahrhunderts, Bracton, der viele Gedanken mit den Juristen Kaiser Friedrichs II. teilte, dessen "Liber Augustalis" Fischer zu Cramburg als für "die Rechtslage in Deutschland nicht weiter aufschlussreich" (S. 66) abtut, dazu, den Schatzfund für den König zu beanspruchen [6]? Der Schlüssel liegt wohl in der Rechtskultur der gelehrten Legisten begründet, die bei den Regalien keine Einschränkungen zugunsten von Finder und Grundeigentümer mehr zulassen wollten.
Das vermeintliche deutschrechtliche Institut des Sachsenspiegels liesse sich so einem romanisierenden europäischen Rechtsdiskurs zuweisen. Was die frühe Neuzeit betrifft, so sind dem Autor leider alle Studien zum (magischen) Schatzgräbertum [7] unbekannt geblieben, sogar die kunsthistorische Monographie von Klinkhammer 1992 [8]. Der jüngste Aufsatz zu diesem Thema, der oberrheinische Akten des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgewertet hat, bietet aufschlussreiches Material auch zum Schatzregal [9]. Überhaupt wäre eine stärkere Öffnung der Rechtsgeschichte zur sozial- und kulturhistorisch orientierten Historischen Kriminalitätsforschung wünschenswert. Auf jeden Fall verspricht das Thema des juristischen Umgangs mit Schatzsuche und Schatzfunden in der frühen Neuzeit noch manche spannende und lehrreiche Geschichte - unter der Prämisse freilich, dass man über den traditionellen rechtshistorischen Tellerrand der normativen Qüllen hinausblickt.
II
1971 führte Baden-Württemberg in seinem Denkmalschutzgesetz ein "grosses" Schatzregal ein (§ 23) [10]. Wenn sie einen hervorragenden Wert haben, fallen nicht nur die bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten entdeckten beweglichen Kulturdenkmale an den Staat. Bis heute sind die meisten anderen Bundesländer dem Beispiel Baden-Württembergs gefolgt, nur die Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern kennen kein Schatzregal. In ihnen gilt § 984 BGB. Im März 1981 suchte ein Hobbyarchäologe mit einem Metalldetektor den "Runden Berg" bei Urach ab. Er stiess auf einen wichtigen Hortfund mit Metallgegenständen aus alemannischer Zeit, den er für sich behalten wollte. Seine gegen die Verurteilung wegen Unterschlagung - die Gegenstände beanspruchte das Land qua Schatzregal als Eigentum - gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschied mit Beschluss vom 18. Mai 1988 [11], das in den Dienst des Denkmalschutzes gestellte Schatzregal des Landes sei verfassungsgemäss. Um einen Fossilienfund ging es bei einem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), das mit Urteil vom 21. November 1996 die rheinland-pfälzische Regelung (§ 19a DSchPflG) mit dem Grundgesetz vereinbar erklärte [12]. Fischer zu Cramburg kann überzeugend darlegen, dass die Berufung des Bundesverfassungsgerichts auf das "hergebrachte Schatzregal" und den Sachsenspiegel verfehlt war. Das Schatzregal der Denkmalschutzgesetze ist eigentlich ein Altertums- oder Kulturdenkmalregal, es ist ein archaisierendes Recht, das mit der Bezeichnung als "Schatzregal" auf ein obsolet gewordenes Relikt zurückgreift und einen Traditionsbruch negiert [13]. Der Autor kann zeigen, dass bei den Beratungen vor der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Frage des Altertumsschutzes durchaus diskutiert wurde, dass ein Schatzregal damals so gut wie nicht mehr bestanden hat (allenfalls in Teilen Schleswigs und im thüringischen Kleinstaat Schwarzburg-Rudolstadt) und dass die Vorschrift des Art. 73 EGBGB, das die landesrechtlichen Regalien unberührt lässt, sich auf die Finanzregalien bezog. Die Motive des Gesetzgebers des BGB lassen die Neubegründung eines denkmalschutzrechtlichen Schatzregals als verfassungsrechtlich höchst fragwürdig erscheinen. Kurzum: Soweit die Entscheidung des BVerfG auf einer Auslegung des Regalienvorbehalts basiert, kann sie, wie schon Klaus-Peter Schröder in seiner Besprechung dargelegt hat [14], nicht überzeugen.
Der BGB-Redaktor Reinhold Johow schrieb bereits: "Ein Bedürfnis, der Landesgesetzgebung zur Schaffung neür Regalien Raum zu lassen, kann nicht anerkannt werden, da die Staaten mittels ihrer hoheitlichen Rechte dieselben Zwecke, welche ehedem durch das Institut der Regalien erstrebt wurden, in befriedigender Weise zu erreichen vermögen" [15]. Unmissverständlich hat zudem auch das BVerwG in seiner erwähnten Entscheidung von 1996 klargestellt, dass in Rheinland-Pfalz die Ablieferung von Fossilienfunden nicht auf den Regalienvorbehalt des Art. 73 EGBGB gestützt werden konnte, da es ein auf solche Funde bezogenes Regal nie gegeben habe. Nicht folgen möchte ich Fischer zu Cramburg, wenn er (S. 156-159) die Zuordnung des sogenannten Schatzregals zum öffentlichen Recht leugnet. Das BVerwG hat hier die besseren Argumente. Obwohl die Konkurrenz zu § 984 BGB de facto misslich ist, können die Vorschriften über die Eigentumszuordnung wissenschaftlich bedeutsamer, also denkmalwerter Funde zwanglos der Materie Denkmalschutzrecht, für die eine ausschliessliche Gesetzeskompetenz der Länder besteht, zugewiesen werden. Es liegt auch hier die Ueberlagerung zweier Rechtsordnungen im selben Sachbereich vor [16]. Der Landesgesetzgeber konnte die Belange der Allgemeinheit bei der Eigentumszuordnung rechtmässig ins Spiel bringen und den Inhalt des Eigentums eines kleinen Teils aller herrenlosen Sachen im Sinne von Art. 14 I GG bestimmen, ohne dass er in bestehende Rechtspositionen eingriff.
Das Denkmalaneigungsrecht der Länder darf - mindestens seit dem Nasskiesungs-Beschluss des BVerfG [wie Anm. 16] - nicht einseitig aus der Perspektive des Zivilrechts beurteilt werden. Das öffentliche Recht ist nicht nur befugt, die Beschränkungen des Eigentums (ausgleichspflichtig oder nicht) auf dem Gebiet des Denkmalschutzes regeln, es kann auch seinen Inhalt bestimmen, also festlegen, was bei Funden Privateigentum wird und was aus Gründen des Denkmalschutzes in das Landeseigentum übergeht. Ralf Fischer zu Cramburg, tätig als Rechtsanwalt am Deutschen Aktieninstitut e.V. in Frankfurt, ist Partei, er schreibt gegen das Schatzregal, um es zu Fall zu bringen. Wie man der Suchmaschine Google entnehmen kann, hat er nicht nur an einem Hearing der rheinland-pfälzischen FDP, die die Abschaffung des Schatzregals fordert, als Verteter des Verbands der Deutschen Münzhändler teilgenommen, sondern sammelt auch selbst (südasiatische) Münzen. Der Verband der Deutschen Münzhändler hat 1998 auch auf die FDP-Fraktion des Bundestags Einfluss genommen, die damals zum grossen Schaden des Kulturgutschutzes in Deutschland den Entwurf des Kulturgutschutz-Rahmengesetzes zu Fall gebracht hat [17].
Es ist nachvollziehbar, dass den Sondengängern, Sammlern und dem Handel das Schatzregal der meisten Bundesländer ein Dorn im Auge ist. Nichtsdestotrotz: Die allgemeinen rechtspolitischen Argumente, die gegen das Schatzregal ins Feld geführt werden, haben erhebliches Gewicht. Der renommierte hessische Numismatiker Niklot Klüssendorf hat schon 1992 überzeugende pragmatische Bedenken gegen das Schatzregal artikuliert [18]. Es führt zur Verschleppung und Verfälschung archäologischer Funde, zu einem wissenschaftlich höchst bedauerlichen "Fundtourismus", bei dem die gefundenen Stücke mit gefälschter Herkunft in einem Bundesland ohne Schatzregal registriert werden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist schlichtweg nicht gegeben: "Wer etwas wertvolles findet und meldet, möchte nicht leer ausgehen" [19]. Fischer zu Cramburg bemerkt zurecht, es schade der Diskussion, dass der einzige unumstrittene Vorteil des Schatzregals, die Schonung der Landeskassen, meist nicht offen genannt werde (S. 201). Werden ehrliche Finder - wie in Mecklenburg-Vorpommern üblich (S. 202) - mit einem "Fachbuch" abgespeist, so ist der Anreiz, wertvolle Bodenfunde zu melden, kaum gegeben. Eine Schatzregal-Regelung, die auf eine angemessene Entschädigung verzichtet, schadet eher dem Denkmalschutz als dass sie ihm nützt. "Practical wisdom", schreibt der amerikanische Jurist Joseph L. Sax in einer wunderbaren Monographie, "suggests that finders ordinarily need to be compensated generously or the public is unlikely to get the found objects, regardless of the formal rules" [20].
Das Schatzregal muss im Kontext der Diskussion über die Rolle der privaten Interessenten an archäologischen Funden gesehen werden. Die Fronten der Debatte [21] sind ideologisch verhärtet: Einflussreiche Hardliner in den Ämtern wollen in allen Sondengängern nur kriminelle Raubgräber sehen und den Handel mit archäologischem Fundgut ganz unterbinden. Auf der anderen Seite stehen die berechtigten Interessen von seriösen "Hobby-Archäologen", die in den Ämtern vielfach nur auf Ablehnung stossen. Mit Recht zitiert Fischer zu Cramburg S. 206 aus dem Urteil des Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 3. Mai 2000, das der hessischen Denkmalpflege folgendes ins Stammbuch schrieb: "Die Behörde wird sich insgesamt aus dem behaglichen Areal, in dem sie bislang auf dem Gebiete der Archäologie von der Öffentlichkeit völlig ungestört arbeiten konnte, herausbewegen müssen" [22]. Mit ihrer martialischen Rhetorik in Verbindung mit einer unangemessenen Kriminalisierung und der Verweigerung jeglichen Dialogs werden die Bodendenkmalpfleger die Schatzsucher-Szene gewiss nicht austrocknen können. Über Sinn und Unsinn eines Schatzregals müsste aufgrund einer - bislang nicht vorliegenden - empirischen Untersuchung über Fundmeldungen entschieden werden. Dabei könnten auch die Erfahrungen anderer Staaten [23] nützlich sein, die Fischer zu Cramburg leider nur sehr selektiv und nur dort, wo sie seiner Forderung entsprechen, berücksichtigt. Was ist etwa mit der benachbarten Schweiz, die in Art. 724 ZGB wissenschaftlich wertvolle Gegenstände dem Eigentum des Kantons zuweist, der aber den Finder zu entschädigen hat [24]? Eine breite öffentliche und fachliche Diskussion über das Schatzregal als Instrument des Denkmalschutzes hat in dem Buch von Fischer zu Cramburg einen exzellenten Ausgangspunkt. Die Debatte sollte sich aber nicht auf das staatliche normative Instrumentarium beschränken, sondern auch die Möglichkeit der Selbstverpflichtung durch Ethik-Codes (der Museen, Sammler, Händler, Wissenschaftler und Sondengänger) berücksichtigen. Solche Codes [25] hinreichend verbindlich auszugestalten und in einem kommunikativen Prozess aufeinander zu beziehen, wird gewiss keine leichte Aufgabe. Aber eine Denkmalpflege, die in absolutistischer Manier nur hoheitsvoll von oben herab agiert, sich ans Schatzregal klammert und sich dem öffentlichen Diskurs verweigert, hat mit Sicherheit auch keine Zukunft.
Anmerkungen:
[1] Wolfgang Schmid, Die Jagd nach dem verborgenen Schatz. Ein Schlüsselmotiv in der Geschichte des Mittelalters?, in: Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft. Festgabe für Franz Irsigler, hrsg. von Dietrich Ebeling u.a., Trier 2001, S. 347-400, hier besonders S. 379-383.
[2] Neues Archiv 33 (1908), S. 377. [Inzwischen online:
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN345858530_0033 ]
[3] Vgl. Lukas Clemens, in: Trier im Mittelalter, hrsg. von Hans Hubert Anton u. Alfred Haverkamp, Trier 1996, S. 192.
[4] Eine Wiedergabe des Weistums online: http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/AntWiSys/PVII.htm [Wayback: http://web.archive.org/web/20011223085244/http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/AntWiSys/PVII.htm ] Einige weitere Quellenbelege zur romanistischen Geschichte des Schatzfunds bietet eine akademische Seite aus Seoul: http://plaza.snu.ac.kr/~romanist/lecture/postgr/thesaur1.html [Wayback: http://web.archive.org/web/20020613130941/http://plaza.snu.ac.kr/~romanist/lecture/postgr/thesaur1.html ]
[5] Vgl. Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. "The King's Two Bodies". Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, München 1990, S. 183f. zu den Regalien (mit Erwähnung des Schatzregals).
[6] Lateinischer Text und englische Übersetzung der Stelle online: http://supct.law.cornell.edu/bracton/Unframed/Latin/v2/338.htm
[Nun http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/Unframed/Latin/v2/338.htm ]
http://supct.law.cornell.edu/bracton/Unframed/English/v2/338.htm [Nun http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/Unframed/English/v2/338.htm ]
[7] Die Literaturliste von Wolfgang Schmid dazu ist auch online verfügbar: http://www.listserv.dfn.de/htbin/wa.exe?A2=ind0110&L=hexenforschung&P=R9880 [Nun: http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0110&L=HEXENFORSCHUNG&P=R9880 ]
[8] Heide Klinkhammer, Schatzgräber, Weisheitssucher und Dämonenbeschwörer. Die motivische und thematische Rezeption des Topos der Schatzsuche in der Kunst vom 15. bis 18. Jahrhundert, Berlin 1992.
[9] Thomas Adam, "Viel tausend gulden laegeten am selbigen orth". Schatzgräberei und Geisterbeschwörung in Südwestdeutschland vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: Historische Anthropologie 9 (2001), S. 358-383, besonders S. 375-379.
[10] Derzeit gültiger Gesetzestext: http://www.landesdenkmalamt-bw.de/denkmalschutzgesetz.html [ http://www.denkmalpflege-bw.de/ ]. Weitere Gesetzestexte von Denkmalschutzgesetzen sind nachgewiesen unter: http://www.dhm.de/pipermail/demuseum/2002-January/002116.html http://www.dhm.de/pipermail/demuseum/2002-February/002129.html
[Stattdessen: http://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutzgesetz bzw. http://www.hendrik.maekeler.eu/denkmalschutzgesetze/ ]
[11] BVerfGE 78, S. 205 ff. [Online: http://servat.unibe.ch/dfr/bv078205.html ]
[12] NJW 1997, S. 1171 ff.
[13] Zu archaisierendem Recht vgl. meine Bemerkungen: http://www.uni-koblenz.de/~graf/strafj.htm [Nun: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/strafj.htm ]
[14] Klaus-Peter Schröder, Grundgesetz und Schatzregal, in: Juristen-Zeitung 1989, S. 676-679.
[15] Zitiert ebd., S. 679 Fn. 32.
[16] Vgl. Beschluss vom 15.7.1981, BVerfGE 58, 300 ff. - online: http://www.uni-würzburg.de/dfr/bv058300.html [Nun: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv058300.html ]
[17] Siehe Interviewfrage an Reinhardt Mussgnug und dessen Antwort in: Bewahren als Problem. Schutz archäologischer Kulturgüter, hrsg. von Martin Flashar, Freiburg i. Br. 2000, S. 122.
[18] Niklot Klüssendorf, Numismatik und Denkmalschutz. Aktuelle Probleme des Rechts an Münzfunden in den östlichen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, in: Mabillons Spur. [Festschrift] Walter Heinemeyer, hrsg. von Peter Rück, Marburg 1992, S. 391-410.
[19] Ebd., S. 405.
[20] Joseph L. Sax, Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 1999, S. 185. Hinweise zum Schatzregal in anderen Ländern ebd., S. 230 Anm. 30.
[21] Einen guten Einblick bietet das in Anm. 17 genannte Taschenbuch.
[22] Volltext online: http://www.sdiv.de/frames/recht/mythos.pdf [Stattdessen: http://www.digs-online.de/dokumente/vwgurteil.pdf ]
[23] Ausgewählte Internetquellen
Hinweise von S. P. Scott (1932) in seiner Justinian-Uebersetzung zu Titel 1 Nr. 39: http://www.constitution.org/sps/sps02_j1-2.htm Darstellungen zum Fundrecht ("Antiquities Law") von England, Wales, Schottland, Belgien und Isräl (International Numismatic Commission): http://www.amnumsoc.org/inc/ [Wayback: http://web.archive.org/web/20011202052000/http://www.amnumsoc.org/inc/ ]
[24] Vgl. z.B. die Hinweise bei Hans Rainer Künzle, Schweizerisches Bibliotheks- und Dokumentationsrecht, Zürich 1992, S. 113, 317f., 328f.
[25] Beispiele für Ethik-Codes aus dem Kulturgutbereich im WWW dokumentiert die VL Museumsrecht:
http://www.uni-koblenz.de/~graf/museumr.htm
[Nun: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/museumr.htm ]
© VL Museen
Alle Rechte beim Autor und VL Museen
Dokument erstellt am 1.3.2002
Zu http://archiv.twoday.net/stories/6455470/
Die Stiftung erinnert an ihr Schreiben vom 5.8.2010 und ignoriert damit die Anregung der Behörde des Bundesbeauftragten für das IFG, von einer Vorschusszahlung von 250 Euro abzusehen.
Die Stiftung erinnert an ihr Schreiben vom 5.8.2010 und ignoriert damit die Anregung der Behörde des Bundesbeauftragten für das IFG, von einer Vorschusszahlung von 250 Euro abzusehen.
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 14:53 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Manchmal gönnt man sich ein Geschenk. Für 300 euro einschliesslich Versandkosten kaufte ich bei einem deutschen Antiquar die kompletten Jahrgänge 1930 - 1934 des Deutschen Adelsblattes (Wochenschrift). Mich interessiert vor allen Dingen die Atmosphäre die in diesen vergilbten Heften kondensierte. Gerade bin ich dabei, merkwürdige Artikel und Beiträge zu notieren. Das erfodert seine Zeit. Die markantesten Beiträge und Zitate werde ich bei Gelegenheit hier widergeben. Schon jetzt ein kleiner Hinweis: Auffällig die "Richtigstellungen und Berichtigungen" die jene publizieren die sich ängstigen, weil sie "schuldlos" als jüdisch "versippt" im Semi-Gotha geführt werden. Oder die Artikel zu EDDA (Das Eiserne Buch Deutschen Adels Deutscher Art) und vieles mehr. Die vornehme Distanz des "Adels" zum Nationalsozialismus ist eine leicht widerlegbare Legende.
Themen die einen hohen Stellenwert haben:
Erbhofrecht
Anerbenrecht
Lehensgüter
jüdische Propaganda
Ablehnung des bürgerlichen Gesetzbuches
Erblehre, Eugenik, Rasse
Blut und Boden
Scholle
Gebundenes Vermögen
junger Adel und Reichswehr
Nationalsozialismus in Frankreich ?
Deckblatt Heft 9 aus 1934: "Der Kronprinz" Buchtitel.."zeigt die Entwicklung des Kronprinzen zur vollen Bejahung des nationalsozialistischen Staates und sein mannhaftes Eintreten für diesen in der ausländischen Presse."
Heft 11 aus 1934: "die adlige Jugend gehört in die SA und SS"
"Schwert und Pflug in der Blut- und Boden Verbundenheit unserer Vorväter"
http://vierprinzen.blogspot.com/
Themen die einen hohen Stellenwert haben:
Erbhofrecht
Anerbenrecht
Lehensgüter
jüdische Propaganda
Ablehnung des bürgerlichen Gesetzbuches
Erblehre, Eugenik, Rasse
Blut und Boden
Scholle
Gebundenes Vermögen
junger Adel und Reichswehr
Nationalsozialismus in Frankreich ?
Deckblatt Heft 9 aus 1934: "Der Kronprinz" Buchtitel.."zeigt die Entwicklung des Kronprinzen zur vollen Bejahung des nationalsozialistischen Staates und sein mannhaftes Eintreten für diesen in der ausländischen Presse."
Heft 11 aus 1934: "die adlige Jugend gehört in die SA und SS"
"Schwert und Pflug in der Blut- und Boden Verbundenheit unserer Vorväter"
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Montag, 3. Januar 2011, 13:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"An der Einsturzstelle des Kölner Stadtarchivs werden am Vormittag Taucher in die Unglücksstelle unter der Erde eindringen. Sie sollen sich im Grundwasser darüber orientieren, wie viele Archivalien noch unter Trümmern begraben sind. Danach soll entschieden werden, wie diese Dokumente womöglich noch geborgen werden können."
Quelle: WDR.de, Studiuo Köln, Nachrichten v. 3.1.11
Quelle: WDR.de, Studiuo Köln, Nachrichten v. 3.1.11
Wolf Thomas - am Montag, 3. Januar 2011, 08:51 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-11.htm
Auszug:
The worst of 2010:
10. James Murdoch, heir to the Rupert Murdoch news empire. For objecting to the British Library plan to provide OA to its archive of historical newspapers on the ground that it would be bad for business.
9. English Heritage. For claiming to own the copyright on Stonehenge and demanding a cut of the profits from image libraries selling photos of the monument.
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/8398550/ ]
8. Todd Platts, Republican representative from Pennsylvania. For the bill (HR 5704) he introduced in the US House of Representatives, in 2005 and again in 2010, giving faculty at the US military academies copyrights in their scholarly writings ("in order to submit such works for publication"), and requiring them to transfer those copyrights to publishers.
7. A copyright reform bill before the Czech parliament drafted by the Ministry of Culture and the national collecting societies without input from other stakeholders. For giving effect to the author's open license only after the author notifies the collecting societies, and for placing the burden of proof for that notification on authors. For erecting new and needless bureaucratic hurdles in the way of anyone wanting to use open licenses.
6. The Swiss National Library. For using public funds to digitize public-domain books, and then selling the digital copies rather than making them OA.
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/6364984/ ]
5. "Misinformation and gatekeeper conservativism" in the field of communications (in the apt words of Bill Herman and the Ad Hoc Committee on Fair Use and Academic Freedom of the International Communication Association). For leading a fifth of surveyed researchers in the field to abandon research in progress because of copyright problems, leading a third to avoid research topics raising copyright issues, and forcing others to seek permission before discussing or criticizing copyrighted works.
4. The majority of OA journals that don't use open licenses, such as the 81% of journals in the Directory of Open Access Journals that don't use CC licenses. For failing to realize one of their potential advantages over most collections of green OA. For missing a golden opportunity to provide libre OA, make their articles more useful, and serve research and researchers.
3. The German Association of Higher Education (Deutscher Hochschulverband). For demanding an "education- and science-friendly" copyright policy that would put copyright protection ahead of education and science, and rule out OA mandates. For taking a public position without doing elementary research first. (Like last year's Heidelberg Appeal, the DHV confuses green OA mandates with gold OA mandates, and doesn't realize that green OA policies are compatible with the freedom to submit work to the journals of one's choice.)
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/6260317/]
2. BP. For hiring scientists to research the gulf oil spill under a contract that prohibits them from "publishing their research, sharing it with other scientists or speaking about the data that they collect for at least the next three years....[that requires them] to withhold data even in the face of a court order if BP decides to fight such an order...[and that] stipulates that scientists will be paid only for research approved in writing by BP...." For undermining both the integrity and the availability of research.
1. The American Psychological Association. For claiming in a Congressional hearing that requiring public access for publicly-funded research would violate President Obama's December 2009 memo on government transparency --not the transparency part of the memo, but the exceptions for national security, privacy, and "other genuinely compelling interests". For asserting that there is a genuinely compelling interest in putting the financial interests of private-sector publishers ahead of the research interests of researchers, even at government agencies whose mission is to advance research and put the public interest first.
Robert Heinlein responded to the APA position more than 70 years ago (Life-Line, 1939): "There has grown up in the minds of certain groups in this country the notion that because a man or corporation has made a profit out of the public for a number of years, the government and the courts are charged with the duty of guaranteeing such profit in the future, even in the face of changing circumstances and contrary to public interest. This strange doctrine is not supported by statute or common law. Neither individuals nor corporations have any right to come into court and ask that the clock of history be stopped, or turned back."
Übrigens bin ich in dem Text auch vertreten:
"Klaus Graf found that only one of the 24 articles published in 2008 by the Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Germany's leading LIS journal, was free online in 2010."
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
"Klaus Graf created a screencast to teach users outside the US how to use a US proxy to read Google Books."
Auszug:
The worst of 2010:
10. James Murdoch, heir to the Rupert Murdoch news empire. For objecting to the British Library plan to provide OA to its archive of historical newspapers on the ground that it would be bad for business.
9. English Heritage. For claiming to own the copyright on Stonehenge and demanding a cut of the profits from image libraries selling photos of the monument.
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/8398550/ ]
8. Todd Platts, Republican representative from Pennsylvania. For the bill (HR 5704) he introduced in the US House of Representatives, in 2005 and again in 2010, giving faculty at the US military academies copyrights in their scholarly writings ("in order to submit such works for publication"), and requiring them to transfer those copyrights to publishers.
7. A copyright reform bill before the Czech parliament drafted by the Ministry of Culture and the national collecting societies without input from other stakeholders. For giving effect to the author's open license only after the author notifies the collecting societies, and for placing the burden of proof for that notification on authors. For erecting new and needless bureaucratic hurdles in the way of anyone wanting to use open licenses.
6. The Swiss National Library. For using public funds to digitize public-domain books, and then selling the digital copies rather than making them OA.
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/6364984/ ]
5. "Misinformation and gatekeeper conservativism" in the field of communications (in the apt words of Bill Herman and the Ad Hoc Committee on Fair Use and Academic Freedom of the International Communication Association). For leading a fifth of surveyed researchers in the field to abandon research in progress because of copyright problems, leading a third to avoid research topics raising copyright issues, and forcing others to seek permission before discussing or criticizing copyrighted works.
4. The majority of OA journals that don't use open licenses, such as the 81% of journals in the Directory of Open Access Journals that don't use CC licenses. For failing to realize one of their potential advantages over most collections of green OA. For missing a golden opportunity to provide libre OA, make their articles more useful, and serve research and researchers.
3. The German Association of Higher Education (Deutscher Hochschulverband). For demanding an "education- and science-friendly" copyright policy that would put copyright protection ahead of education and science, and rule out OA mandates. For taking a public position without doing elementary research first. (Like last year's Heidelberg Appeal, the DHV confuses green OA mandates with gold OA mandates, and doesn't realize that green OA policies are compatible with the freedom to submit work to the journals of one's choice.)
[Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/6260317/]
2. BP. For hiring scientists to research the gulf oil spill under a contract that prohibits them from "publishing their research, sharing it with other scientists or speaking about the data that they collect for at least the next three years....[that requires them] to withhold data even in the face of a court order if BP decides to fight such an order...[and that] stipulates that scientists will be paid only for research approved in writing by BP...." For undermining both the integrity and the availability of research.
1. The American Psychological Association. For claiming in a Congressional hearing that requiring public access for publicly-funded research would violate President Obama's December 2009 memo on government transparency --not the transparency part of the memo, but the exceptions for national security, privacy, and "other genuinely compelling interests". For asserting that there is a genuinely compelling interest in putting the financial interests of private-sector publishers ahead of the research interests of researchers, even at government agencies whose mission is to advance research and put the public interest first.
Robert Heinlein responded to the APA position more than 70 years ago (Life-Line, 1939): "There has grown up in the minds of certain groups in this country the notion that because a man or corporation has made a profit out of the public for a number of years, the government and the courts are charged with the duty of guaranteeing such profit in the future, even in the face of changing circumstances and contrary to public interest. This strange doctrine is not supported by statute or common law. Neither individuals nor corporations have any right to come into court and ask that the clock of history be stopped, or turned back."
Übrigens bin ich in dem Text auch vertreten:
"Klaus Graf found that only one of the 24 articles published in 2008 by the Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Germany's leading LIS journal, was free online in 2010."
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
"Klaus Graf created a screencast to teach users outside the US how to use a US proxy to read Google Books."
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 02:00 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 01:48 - Rubrik: Kodikologie
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2011/01
Personenstandsurkunden im Stadtarchiv Kiel können nach der geltenden Benutzungsordnung vom 26.11.2009 nur bei den mehr als 110 Jahre alten Geburtsurkunden frei eingesehen werden. Ohne Einschränkungen werden Heiratsbücher nur vorgelegt, wenn sie älter als 115 (statt 80) Jahre sind, Sterberegister nur, wenn sie älter als 75 (statt 30) Jahre alt sind. Bei den 10 Jahre jüngeren Büchern wird eine Erklärung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Alle folgenden Jahrgänge sind nicht frei zugänglich, es werden aber Reproduktionen erstellt. Eine Begründung für diese vom Personenstandsgesetz abweichenden Fristen wird nicht gegeben.
Im Augsburger Stadtarchiv werden nur Auskünfte aus den Personenstandsunterlagen erteilt bzw. Kopien angefertigt. Dabei fallen natürlich Gebühren an. Die Bücher werden den Forschern nicht vorgelegt. Begründung: Berücksichtigung schutzwürdiger Belange Dritter.
Wie sind Ihre Erfahrungen in Ihrem Stadtarchiv? Schreiben Sie uns, wo es gut läuft und wo es Probleme bei der Familienforschung in den Archiven gibt. Oft werden auch Restriktionen durch neue Gebührenordnungen aufgebaut.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/11508662/
http://archiv.twoday.net/search?q=personenstands
Personenstandsurkunden im Stadtarchiv Kiel können nach der geltenden Benutzungsordnung vom 26.11.2009 nur bei den mehr als 110 Jahre alten Geburtsurkunden frei eingesehen werden. Ohne Einschränkungen werden Heiratsbücher nur vorgelegt, wenn sie älter als 115 (statt 80) Jahre sind, Sterberegister nur, wenn sie älter als 75 (statt 30) Jahre alt sind. Bei den 10 Jahre jüngeren Büchern wird eine Erklärung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Alle folgenden Jahrgänge sind nicht frei zugänglich, es werden aber Reproduktionen erstellt. Eine Begründung für diese vom Personenstandsgesetz abweichenden Fristen wird nicht gegeben.
Im Augsburger Stadtarchiv werden nur Auskünfte aus den Personenstandsunterlagen erteilt bzw. Kopien angefertigt. Dabei fallen natürlich Gebühren an. Die Bücher werden den Forschern nicht vorgelegt. Begründung: Berücksichtigung schutzwürdiger Belange Dritter.
Wie sind Ihre Erfahrungen in Ihrem Stadtarchiv? Schreiben Sie uns, wo es gut läuft und wo es Probleme bei der Familienforschung in den Archiven gibt. Oft werden auch Restriktionen durch neue Gebührenordnungen aufgebaut.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/11508662/
http://archiv.twoday.net/search?q=personenstands
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 01:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 3. Januar 2011, 01:28 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Veranstalter: Institut für Dokumentologie und Editorik in Zusammenarbeit mit dem International Center for Archival Researchund der Österreichischen Nationalbibliothek
Datum, Ort: 14.03.2011-18.03.2011, Wien
Die Erschließung der bilbiothekarischen und archivischen Überlieferung in philologisch und historisch zuverlässigen, kritischen Editionen gehört zu den grundlegenden und wesentlichen Aufgaben der geisteswissenschaftlichen Diziplinen. Im gegenwärtigen Medienwandel gewinnen die aufbereiteten Texte eine neue Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Mit der unmittelbaren Einbindung in die ebenfalls zunehmend online verfügbare inhaltliche Forschung steigt ihre Präsenz weiter an. Eine digitale Forschungslandschaft verändert aber auch die technischen und vor allem methodischen Rahmenbedingungen für die kritische Aufbereitung der Überlieferung. Der Überblick über die methodischen Implikationen des Medienwandels und solide Kenntnisse der grundlegenden Technologien sind wesentliche Voraussetzung für eine zeitgemäße Editorik.
Das dafür notwendige Handwerkszeug liegt abseits der etablierten Lehrinhalte der geisteswissenschaftlichen Fächer, eine Einbringung in die bestehenden Studienmodule ist deshalb nicht ohne weiteres möglich. Sowohl der transdisziplinäre Charakter der Editorik, als auch der hierfür notwendigen methodisch-technischen Grundfertigkeiten verlangt daher zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten, die hier in Form einer "Summer"-School unabhängig von fachlicher und institutioneller Anbindung angeboten werden.
Gemeinsam mit dem International Center for Archivali Research (ICARus) und der Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek richtet das Institut für Dokumentologie und Editorik eine School aus, welche Historiker, Philologen und Philosophen in die Lage zu versetzen, inhaltlich wie funktional hochwertige Editionen für die digitalen Medien (ggf. mit Spin-offs in den analogen Medien) zu konzipieren und sie zeitgemäßen methodischen und technischen Standards entsprechend durchzuführen, sowie Archivaren ein Bewußtsein dafür schafft, in welchen Umgebungen die von ihnen digital bereitgestellten Dokumente weiterverarbeitet werden. Die Unterrichtseinheiten werden von den Mitarbeitern des Instituts für Dokumentologie und Editorik (IDE) durchgeführt, einem Verbund von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die im Bereich der Digital Humanities an vielen einschlägigen Projekten beteiligt sind und über reiche Erfahrung in der Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen verfügen.
Im Zentrum der Veranstaltung stehen neben dem Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand digitaler Editionen vor allem die praktische Einübung der maßgeblichen Technologien aus dem Umfeld von XML (eXtensible Markup Language) und der Umgang mit dem international verbreiteten Standard der TEI (Text Encoding Initiative) oder der EAD (Encoded Archival Description) zur Kodierung digitaler Texte und Editionen. Ein eintägiges Propädeutikum zu den grundlegenden Anwendungen und Techniken des Internets und der digitalen Bildverarbeitung ist dem Kursprogramm vorgeschaltet. Die Teilnehmer sind gehalten, eigene Materialien und Projekte mitzubringen, an denen der Lehrstoff unmittelbar angewandt und erprobt werden kann. Der Kursablauf wird durch den Wechsel zwischen vormittäglichen Lehreinheiten und nachmittäglichen Übungseinheiten (mit betreuenden Tutoren) bestimmt.
Zielgruppe der Veranstaltung sind Archivare und aus den Universitäten vor allem Graduierte, Doktoranden, Postdoktoranden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum; auch fortgeschrittene Studenten können berücksichtigt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten melden sich mit einer ca. halbseitige Skizze eines digital zu verarbeitenden Editionsprojektes an bei SpringSchool2011@icar-us.eu.
Teilnahme
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessenten melden sich mit einer ca. halbseitige Skizze eines digital zu verarbeitenden Editionsprojektes an bei
ICARUS – International Centre for Archival Research
Erdberger Laende 6/7
A-1030 Vienna.
Vorläufiges Programm
Montag 14.3.2011: Einführung
14.00-18.00 Uhr:
(1.) Begrüßung; Zielstellungen: Digitale Editionen am Beispiel; Überblick: technische Standards und Architekturen [Georg Vogeler]
(2.) Kurzeinführung in XML; erste gemeinsame Übungen mit einer XML-verarbeitenden Software; Wege von der klassischen Textverarbeitung nach XML [Philipp Steinkrüger]
18.30 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
Dr. Thomas Aigner, Präsident des ICARus
18.45 Uhr: Abendvortrag: Gerhart Marckhgott (Direktor des oberösterreichischen Landesarchivs): Archive und Edition – Digitale Perspektiven
Anschließend Empfang
Dienstag 15.3.2011: Standards
09.00-13.00 Uhr:
(1.) eXtensible Markup Language (XML) und Text Encoding Initiative (TEI) [Oliver Duntze]
(2.) TEI für Editionen [Torsten Schaßan]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Besprechung einzelner Teilnehmerprojekte
(2.) Angeleitete Übungen zur Textauszeichnung
Mittwoch 16.3.2011: Methodische Hintergründe und technische Kontexte
09.00-13.00 Uhr:
(1.) Digitale Edition und ihr Grundlagenmaterial (Zum Verhältnis von Archiv und Edition in der Digitalen Welt) [Franz Fischer]
(2.) Vertiefung TEI-Richtlinien und ihre Anwendung [Torsten Schaßan]
14.00-17.00 Uhr:
Übungen in Textauszeichnung
Donnerstag 17.3.2011: Vertiefung
09.00-13.00 Uhr:
(1.) TEI für Register und Sacherschließung [Niels-Oliver-Walkowski]
(2.) Einführung in andere XML-Dialekte (CEI, EAD, METS) [Georg Vogeler]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Besprechung einzelner Teilnehmerprojekte
(2.) Übungen in XML-Verarbeitung
Freitag 18.3.2011: Ausblick
09.00-13.00 Uhr:
Wege zur Anzeige mit XSLT (eXtensible Stylesheet Language – Transformation) und SADE (Scalable Architecture for Digital Editions) [Christiane Fritze, Alexander Czmiel, Bernhard Assmann]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Erstellen von Präsentationsformen zu den Teilnehmermaterialien
(2.) Diskussion der Ergebnisse
Kontakt:
ICARus - International Centre for Archival Research
Erdberger Laende 6/7
A-1030 Vienna
SpringSchool2011@icar-us.eu
URL: http://www.i-d-e.de/spring-school-2011 "
Quelle: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=15397
Datum, Ort: 14.03.2011-18.03.2011, Wien
Die Erschließung der bilbiothekarischen und archivischen Überlieferung in philologisch und historisch zuverlässigen, kritischen Editionen gehört zu den grundlegenden und wesentlichen Aufgaben der geisteswissenschaftlichen Diziplinen. Im gegenwärtigen Medienwandel gewinnen die aufbereiteten Texte eine neue Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Mit der unmittelbaren Einbindung in die ebenfalls zunehmend online verfügbare inhaltliche Forschung steigt ihre Präsenz weiter an. Eine digitale Forschungslandschaft verändert aber auch die technischen und vor allem methodischen Rahmenbedingungen für die kritische Aufbereitung der Überlieferung. Der Überblick über die methodischen Implikationen des Medienwandels und solide Kenntnisse der grundlegenden Technologien sind wesentliche Voraussetzung für eine zeitgemäße Editorik.
Das dafür notwendige Handwerkszeug liegt abseits der etablierten Lehrinhalte der geisteswissenschaftlichen Fächer, eine Einbringung in die bestehenden Studienmodule ist deshalb nicht ohne weiteres möglich. Sowohl der transdisziplinäre Charakter der Editorik, als auch der hierfür notwendigen methodisch-technischen Grundfertigkeiten verlangt daher zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten, die hier in Form einer "Summer"-School unabhängig von fachlicher und institutioneller Anbindung angeboten werden.
Gemeinsam mit dem International Center for Archivali Research (ICARus) und der Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek richtet das Institut für Dokumentologie und Editorik eine School aus, welche Historiker, Philologen und Philosophen in die Lage zu versetzen, inhaltlich wie funktional hochwertige Editionen für die digitalen Medien (ggf. mit Spin-offs in den analogen Medien) zu konzipieren und sie zeitgemäßen methodischen und technischen Standards entsprechend durchzuführen, sowie Archivaren ein Bewußtsein dafür schafft, in welchen Umgebungen die von ihnen digital bereitgestellten Dokumente weiterverarbeitet werden. Die Unterrichtseinheiten werden von den Mitarbeitern des Instituts für Dokumentologie und Editorik (IDE) durchgeführt, einem Verbund von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die im Bereich der Digital Humanities an vielen einschlägigen Projekten beteiligt sind und über reiche Erfahrung in der Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen verfügen.
Im Zentrum der Veranstaltung stehen neben dem Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand digitaler Editionen vor allem die praktische Einübung der maßgeblichen Technologien aus dem Umfeld von XML (eXtensible Markup Language) und der Umgang mit dem international verbreiteten Standard der TEI (Text Encoding Initiative) oder der EAD (Encoded Archival Description) zur Kodierung digitaler Texte und Editionen. Ein eintägiges Propädeutikum zu den grundlegenden Anwendungen und Techniken des Internets und der digitalen Bildverarbeitung ist dem Kursprogramm vorgeschaltet. Die Teilnehmer sind gehalten, eigene Materialien und Projekte mitzubringen, an denen der Lehrstoff unmittelbar angewandt und erprobt werden kann. Der Kursablauf wird durch den Wechsel zwischen vormittäglichen Lehreinheiten und nachmittäglichen Übungseinheiten (mit betreuenden Tutoren) bestimmt.
Zielgruppe der Veranstaltung sind Archivare und aus den Universitäten vor allem Graduierte, Doktoranden, Postdoktoranden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum; auch fortgeschrittene Studenten können berücksichtigt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten melden sich mit einer ca. halbseitige Skizze eines digital zu verarbeitenden Editionsprojektes an bei SpringSchool2011@icar-us.eu.
Teilnahme
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessenten melden sich mit einer ca. halbseitige Skizze eines digital zu verarbeitenden Editionsprojektes an bei
ICARUS – International Centre for Archival Research
Erdberger Laende 6/7
A-1030 Vienna.
Vorläufiges Programm
Montag 14.3.2011: Einführung
14.00-18.00 Uhr:
(1.) Begrüßung; Zielstellungen: Digitale Editionen am Beispiel; Überblick: technische Standards und Architekturen [Georg Vogeler]
(2.) Kurzeinführung in XML; erste gemeinsame Übungen mit einer XML-verarbeitenden Software; Wege von der klassischen Textverarbeitung nach XML [Philipp Steinkrüger]
18.30 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
Dr. Thomas Aigner, Präsident des ICARus
18.45 Uhr: Abendvortrag: Gerhart Marckhgott (Direktor des oberösterreichischen Landesarchivs): Archive und Edition – Digitale Perspektiven
Anschließend Empfang
Dienstag 15.3.2011: Standards
09.00-13.00 Uhr:
(1.) eXtensible Markup Language (XML) und Text Encoding Initiative (TEI) [Oliver Duntze]
(2.) TEI für Editionen [Torsten Schaßan]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Besprechung einzelner Teilnehmerprojekte
(2.) Angeleitete Übungen zur Textauszeichnung
Mittwoch 16.3.2011: Methodische Hintergründe und technische Kontexte
09.00-13.00 Uhr:
(1.) Digitale Edition und ihr Grundlagenmaterial (Zum Verhältnis von Archiv und Edition in der Digitalen Welt) [Franz Fischer]
(2.) Vertiefung TEI-Richtlinien und ihre Anwendung [Torsten Schaßan]
14.00-17.00 Uhr:
Übungen in Textauszeichnung
Donnerstag 17.3.2011: Vertiefung
09.00-13.00 Uhr:
(1.) TEI für Register und Sacherschließung [Niels-Oliver-Walkowski]
(2.) Einführung in andere XML-Dialekte (CEI, EAD, METS) [Georg Vogeler]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Besprechung einzelner Teilnehmerprojekte
(2.) Übungen in XML-Verarbeitung
Freitag 18.3.2011: Ausblick
09.00-13.00 Uhr:
Wege zur Anzeige mit XSLT (eXtensible Stylesheet Language – Transformation) und SADE (Scalable Architecture for Digital Editions) [Christiane Fritze, Alexander Czmiel, Bernhard Assmann]
14.00-17.00 Uhr:
(1.) Erstellen von Präsentationsformen zu den Teilnehmermaterialien
(2.) Diskussion der Ergebnisse
Kontakt:
ICARus - International Centre for Archival Research
Erdberger Laende 6/7
A-1030 Vienna
SpringSchool2011@icar-us.eu
URL: http://www.i-d-e.de/spring-school-2011 "
Quelle: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=15397
Wolf Thomas - am Sonntag, 2. Januar 2011, 20:50 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 2. Januar 2011, 18:22 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"El capitán Wilkens llama a su despacho al sargento detective Benson (Ryan O'Neal) y al policía Fred Kerwin (John Hurt), que trabaja en los archivos de la policía y que trata de ocultar que es homosexual.
El capitán les encarga hacerse pasar por pareja para investigar un asesinato.
Kerwin responde: ¿un caso? ¿en la calle? pero si yo siempre he trabajado en una oficina, en archivos...
Película típica y tópica. Menos mal que el poli-archivero resuelve el caso, porque la película es "infumable"."
Quelle: http://archivistica.blogspot.com/2010/12/poli-de-archivo.html
"Um einen Mord im Schwulenmilieu aufzuklären, wird ein ungewöhnliches Polizisten-Team zusammengespannt: Detective Benson (Ryan O'Neal), ein Weiberheld mit knackigem Aussehen als Lockvogel, und der introvertierte Innendienstler und Schwule Kerwin (John Hurt) als Insider. Sie mimen ein schwules Pärchen. Was beiden sichtlich unangenehm ist :-) Besonders der an sich homophobe Benson tut sich damit schwer; und erst recht, als sich Kerwin in ihn verliebt. Doch die Ermittlungen kommen vorwärts.
Trotz der Klischees amüsant."
Quelle: http://www.gaystation.info/tv/?/tv/archiv/z/zwei_irre_typen_auf_heisser_spur.html
s. a. http://www.imdb.com/title/tt0084477/
El capitán les encarga hacerse pasar por pareja para investigar un asesinato.
Kerwin responde: ¿un caso? ¿en la calle? pero si yo siempre he trabajado en una oficina, en archivos...
Película típica y tópica. Menos mal que el poli-archivero resuelve el caso, porque la película es "infumable"."
Quelle: http://archivistica.blogspot.com/2010/12/poli-de-archivo.html
"Um einen Mord im Schwulenmilieu aufzuklären, wird ein ungewöhnliches Polizisten-Team zusammengespannt: Detective Benson (Ryan O'Neal), ein Weiberheld mit knackigem Aussehen als Lockvogel, und der introvertierte Innendienstler und Schwule Kerwin (John Hurt) als Insider. Sie mimen ein schwules Pärchen. Was beiden sichtlich unangenehm ist :-) Besonders der an sich homophobe Benson tut sich damit schwer; und erst recht, als sich Kerwin in ihn verliebt. Doch die Ermittlungen kommen vorwärts.
Trotz der Klischees amüsant."
Quelle: http://www.gaystation.info/tv/?/tv/archiv/z/zwei_irre_typen_auf_heisser_spur.html
s. a. http://www.imdb.com/title/tt0084477/
Wolf Thomas - am Sonntag, 2. Januar 2011, 10:32 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 2. Januar 2011, 10:14 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Paul Stänner bespricht das neue Buch von Wolfgang Wippermann
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/1353018/
Wippermann thematisiert zu Recht ein Unwohlsein angesichts immer neuer Denkmäler und Denkmaldiskussionen, er hat eine griffige und mitsamt ihrer Polemiken durchaus auch erhellende Geschichte der Denkmäler in Deutschland geschrieben. Die liest man gern. Aber es reicht nicht für eine Streitschrift, die eine Grundsatzdiskussion vom Zaum brechen könnte.
Siehe auch
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/denken-statt-denkmalen/
http://www.jungewelt.de/2010/11-20/013.php
Zur Geschichte des Denkmalkults siehe auch den Artikel Denkmal im RDK
http://goo.gl/V9WMr

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/1353018/
Wippermann thematisiert zu Recht ein Unwohlsein angesichts immer neuer Denkmäler und Denkmaldiskussionen, er hat eine griffige und mitsamt ihrer Polemiken durchaus auch erhellende Geschichte der Denkmäler in Deutschland geschrieben. Die liest man gern. Aber es reicht nicht für eine Streitschrift, die eine Grundsatzdiskussion vom Zaum brechen könnte.
Siehe auch
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/denken-statt-denkmalen/
http://www.jungewelt.de/2010/11-20/013.php
Zur Geschichte des Denkmalkults siehe auch den Artikel Denkmal im RDK
http://goo.gl/V9WMr

KlausGraf - am Sonntag, 2. Januar 2011, 02:14 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ProPublica is an independent, non-profit newsroom that produces investigative journalism in the public interest. Our work focuses exclusively on truly important stories, stories with “moral force.”
http://www.propublica.org
Die FR interviewte den Chefredakteur Paul Steiger:
http://www.fr-online.de/kultur/medien/-ich-muesste-sie-umbringen-/-/1473342/5048336/-/index.html
http://www.propublica.org
Die FR interviewte den Chefredakteur Paul Steiger:
http://www.fr-online.de/kultur/medien/-ich-muesste-sie-umbringen-/-/1473342/5048336/-/index.html
KlausGraf - am Sonntag, 2. Januar 2011, 02:11 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Englischsprachige Nachrufe auf den geneialen Perlentaucher verlinkt natürlich
http://www.aldaily.com/
Deutschsprachige Würdigungen:
http://blogs.taz.de/wienblog/2010/12/30/eine_rose_fuer_denis_dutton/
http://www.sueddeutsche.de/h5438E/3816363/Der-flotte-Step-der-Wissenschaften.html
http://derstandard.at/1293369693929/Denis-Dutton-1944-2010
http://www.aldaily.com/
Deutschsprachige Würdigungen:
http://blogs.taz.de/wienblog/2010/12/30/eine_rose_fuer_denis_dutton/
http://www.sueddeutsche.de/h5438E/3816363/Der-flotte-Step-der-Wissenschaften.html
http://derstandard.at/1293369693929/Denis-Dutton-1944-2010
KlausGraf - am Sonntag, 2. Januar 2011, 01:53 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Siehe etwa:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benjamin_Das_Leben_der_Studenten.djvu
http://de.wikisource.org/wiki/Das_Leben_der_Studenten
Und René Schickele und viele andere ...
http://de.wikisource.org/wiki/René_Schickele
Die neue Public Domain Review stellt englischsprachige PD-Werke in Rezension vor:
http://publicdomainreview.okfn.org/
 Paul Kee: Angelus Novus
Paul Kee: Angelus Novus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benjamin_Das_Leben_der_Studenten.djvu
http://de.wikisource.org/wiki/Das_Leben_der_Studenten
Und René Schickele und viele andere ...
http://de.wikisource.org/wiki/René_Schickele
Die neue Public Domain Review stellt englischsprachige PD-Werke in Rezension vor:
http://publicdomainreview.okfn.org/
 Paul Kee: Angelus Novus
Paul Kee: Angelus NovusKlausGraf - am Samstag, 1. Januar 2011, 23:20 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein gutes Neues Jahr für freie Inhalte wünscht Archivalia!

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Klee,_Insula_dulcamara.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Klee,_Insula_dulcamara.jpg
KlausGraf - am Samstag, 1. Januar 2011, 16:46 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.law.duke.edu/cspd/publicdomainday
Der erste Januar ist in Europa Public Domain Day, da die 1940 verstorbenen AutorInnen zum 1. Januar gemeinfrei wurden. Siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Gemeinfrei_2011
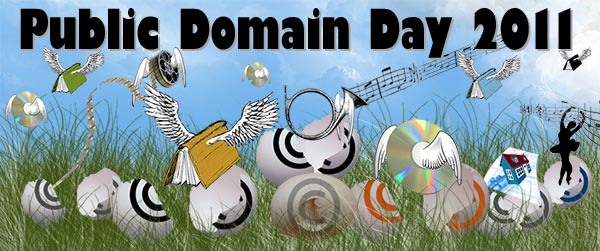
Der erste Januar ist in Europa Public Domain Day, da die 1940 verstorbenen AutorInnen zum 1. Januar gemeinfrei wurden. Siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Gemeinfrei_2011
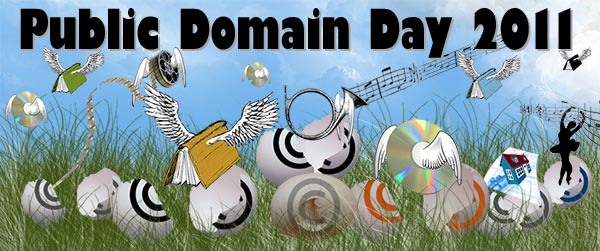
KlausGraf - am Samstag, 1. Januar 2011, 16:19 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 1. Januar 2011, 12:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
David Armitage ist ein Wissenschafts-Star:
http://history.fas.harvard.edu/people/faculty/armitage.php
In DASH gibt es 6 Dokumente von ihm, alle Open Access:
http://dash.harvard.edu/browse?authority=56ef3ad808bc314a169f09f2b67e5822&type=author
Auf seiner oben genannten Harvard-Homepage gibt es aber keinen Link auf DASH und auch nicht die genannten 6 Volltexte, wohl aber 4 andere Volltexte!
http://history.fas.harvard.edu/people/faculty/armitage.php
In DASH gibt es 6 Dokumente von ihm, alle Open Access:
http://dash.harvard.edu/browse?authority=56ef3ad808bc314a169f09f2b67e5822&type=author
Auf seiner oben genannten Harvard-Homepage gibt es aber keinen Link auf DASH und auch nicht die genannten 6 Volltexte, wohl aber 4 andere Volltexte!
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 17:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://history.fas.harvard.edu/people/faculty/timeperiod.php
McCormick, Michael. 2003. Rats, communications, and plague: Toward an ecological history. Journal of Interdisciplinary History 34, no. 1: 1-25.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3208221/McCormick_RatsPlague.pdf?sequence=2
In Worten: ein Beitrag
Roy Mottahedeh
Steven Ozment
nichts!
Smail, Daniel Lord. 1996. Common violence: Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille. Past and Present 151(1): 28-59.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3743539/smail_comviolence.pdf?sequence=2
Smail, Daniel. 2005. In the grip of sacred history. American Historical Review 110, no. 5: 1336-1361.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3207678/Smail_GripSacred.pdf?sequence=2
Smail, Daniel Lord. 1997. Telling tales in Angevin courts. French Historical Studies 20(2): 183-215.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3716639/smail_tales.pdf?sequence=2
Macht 3 Artikel
Alle 4 erwähnten Artikel sind in der Verlagsfassung eingestellt.
14.-16. Jahrhundert
Ann Blair 9 Artikel, alle Open Access (Fassung nicht überprüft, in mindestens 1 Fall Verlagsfassung)
Joyce Chaplin: nichts
James Hankins: Von den 14 Artikeln (viele Preprints) sind nur 2 nicht Open Access.
Cemal Kafadar: nichts
Mark Kishlansky: nichts
McCormick, Michael. 2003. Rats, communications, and plague: Toward an ecological history. Journal of Interdisciplinary History 34, no. 1: 1-25.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3208221/McCormick_RatsPlague.pdf?sequence=2
In Worten: ein Beitrag
Roy Mottahedeh
Steven Ozment
nichts!
Smail, Daniel Lord. 1996. Common violence: Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille. Past and Present 151(1): 28-59.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3743539/smail_comviolence.pdf?sequence=2
Smail, Daniel. 2005. In the grip of sacred history. American Historical Review 110, no. 5: 1336-1361.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3207678/Smail_GripSacred.pdf?sequence=2
Smail, Daniel Lord. 1997. Telling tales in Angevin courts. French Historical Studies 20(2): 183-215.
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3716639/smail_tales.pdf?sequence=2
Macht 3 Artikel
Alle 4 erwähnten Artikel sind in der Verlagsfassung eingestellt.
14.-16. Jahrhundert
Ann Blair 9 Artikel, alle Open Access (Fassung nicht überprüft, in mindestens 1 Fall Verlagsfassung)
Joyce Chaplin: nichts
James Hankins: Von den 14 Artikeln (viele Preprints) sind nur 2 nicht Open Access.
Cemal Kafadar: nichts
Mark Kishlansky: nichts
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 16:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenig Konkretes sagt dieses Interview:
http://fairuse.stanford.edu/blog/2010/12/open-access-to-scholarship-par.html
Wenn Harvards Regelung kein Mandat ist (weil man eine Ausnahme beantragen kann und diese auch bekommt), aber trotzdem funktioniert - wozu brauchen wir dann Mandate, wie sie Harnad gebetsmühlenhaft propagiert?
Im übrigen lügt sich die Open-Access-Community bei den Repositorien in die Tasche, weil man nicht die Zahlen herausgibt, die man für eine Beurteilung des Erfolgs braucht. Wenn man also der Engführung OA = Zeitschriftenartikel folgt, die den meisten Mandaten (abgesehen von Dissertations-Mandaten) zugrundeliegt, braucht man einfach den jährlichen Output der Universität/Institution an Zeitschriftenartikeln und könnte dann den Anteil der im IR vorhandenen Beiträge bestimmen.
Dass Mandate kein Selbstläufer sind ist allen klar. Also sollte auch allen klar sein, dass die Studien der Harnad-Jünger, die immer auf die gleichen Institutionen mit Mandaten Bezug nehmen, nichts beweisen, denn der höhere Anteil an IR-Ablieferungen hängt kausal eben nicht mit den Mandaten, sondern mit den sie begleitenden Anstrengungen und der Aufgeschlossenheit der jeweiligen Wissenschaftler zusammen.
http://fairuse.stanford.edu/blog/2010/12/open-access-to-scholarship-par.html
Wenn Harvards Regelung kein Mandat ist (weil man eine Ausnahme beantragen kann und diese auch bekommt), aber trotzdem funktioniert - wozu brauchen wir dann Mandate, wie sie Harnad gebetsmühlenhaft propagiert?
Im übrigen lügt sich die Open-Access-Community bei den Repositorien in die Tasche, weil man nicht die Zahlen herausgibt, die man für eine Beurteilung des Erfolgs braucht. Wenn man also der Engführung OA = Zeitschriftenartikel folgt, die den meisten Mandaten (abgesehen von Dissertations-Mandaten) zugrundeliegt, braucht man einfach den jährlichen Output der Universität/Institution an Zeitschriftenartikeln und könnte dann den Anteil der im IR vorhandenen Beiträge bestimmen.
Dass Mandate kein Selbstläufer sind ist allen klar. Also sollte auch allen klar sein, dass die Studien der Harnad-Jünger, die immer auf die gleichen Institutionen mit Mandaten Bezug nehmen, nichts beweisen, denn der höhere Anteil an IR-Ablieferungen hängt kausal eben nicht mit den Mandaten, sondern mit den sie begleitenden Anstrengungen und der Aufgeschlossenheit der jeweiligen Wissenschaftler zusammen.
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 16:02 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 31. Dezember 2010, 08:27 - Rubrik: Unterhaltung
"Ein großer Brand zerstörte gestern abend einen Teil der altehrwürdigen Abtei von Saint Remy bei Rochefort in der Wallonie. Bei dem Feuer kamen keine Menschen zu Schaden. Nach ersten Angaben brach der Brand gegen 18.30 Uhr aus, als sich die Trappistenmönche zum Abendessen versammelten. Die Ursache des Brandes ist vorläufig noch unbekannt, es wird jedoch ein Kurzschluß vermutet. Die Abtei von Saint Remy im Bistum Namür wurde im 13. Jahrhundert gegründet und ist als Wallfahrtsort bekannt, aber auch wegen ihres Bieres. In der Abtei wird das bekannte Trappistenbier Rochefort gebraut. Die wichtigsten Teile des Klosters konnten gerettet werden, so auch die alte Bibliothek. Auch die Klosterbrauerei wurde durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Ursprünglich um 1230 als Zisterzienserinnenkloster gegründet, wurde die Abtei im 15. Jahrhundert in ein Mönchskloster umgewandelt. Beim Einmarsch der französischen Revolutionstruppen wurde die Abtei geplündert, 1797 aufgehoben, die Klosterkirche abgerissen und aus den anderen Klostergebäuden ein Landwirtschaftsbetrieb gemacht.
Am 21. 1887 wurde das Kloster durch Trappisten aus den Niederlanden neu belebt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Klosterkirche im neugotischen Stil erbaut."
Quelle: Katholisch.info, 30.12.2010
Da sind wir aber beruhigt, dass die Brauerei nicht beschädigt wurde. Was ist mit dem Archiv der Mönche? Schreiben werden sie ja wohl dürfen.
Ursprünglich um 1230 als Zisterzienserinnenkloster gegründet, wurde die Abtei im 15. Jahrhundert in ein Mönchskloster umgewandelt. Beim Einmarsch der französischen Revolutionstruppen wurde die Abtei geplündert, 1797 aufgehoben, die Klosterkirche abgerissen und aus den anderen Klostergebäuden ein Landwirtschaftsbetrieb gemacht.
Am 21. 1887 wurde das Kloster durch Trappisten aus den Niederlanden neu belebt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Klosterkirche im neugotischen Stil erbaut."
Quelle: Katholisch.info, 30.12.2010
Da sind wir aber beruhigt, dass die Brauerei nicht beschädigt wurde. Was ist mit dem Archiv der Mönche? Schreiben werden sie ja wohl dürfen.
Wolf Thomas - am Freitag, 31. Dezember 2010, 08:05 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Werden besprochen von:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2010/12/29/a-preview-of-two-sites/
Es geht um:
http://www.rechtsgeschiedenis.org/
http://www.storiadeldiritto.org/index.html
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2010/12/29/a-preview-of-two-sites/
Es geht um:
http://www.rechtsgeschiedenis.org/
http://www.storiadeldiritto.org/index.html
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 03:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Liste in einem PDF gibt es bei:
http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/12/30/elenco-di-riviste-e-periodici-storici-digitalizzati/
http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/12/30/elenco-di-riviste-e-periodici-storici-digitalizzati/
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 03:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fonds_Trutat_-_Archives_municipales_de_Toulouse?uselang=fr
Diese wurden aufgrund der Partnerschaft von Toulouse mit Wikimedia France auf Commons eingestellt, leider in schlechter Auflösung.
 Mehr an Auflösung gibts nicht!
Mehr an Auflösung gibts nicht!
Diese wurden aufgrund der Partnerschaft von Toulouse mit Wikimedia France auf Commons eingestellt, leider in schlechter Auflösung.
 Mehr an Auflösung gibts nicht!
Mehr an Auflösung gibts nicht!KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 02:55 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liebe Verleger,
das tut jetzt vielleicht ein wenig weh, aber einer muss es mal deutlich sagen: Euch hat niemand gerufen! Niemand hat gesagt: “Mein Internet ist so leer, kann da nicht mal jemand Zeitungstexte oder so was reinkippen?“ Ihr seid freiwillig gekommen, und ihr habt eure Verlagstexte freiwillig ins Web gestellt. Zu Hauf. Und kostenlos. Ihr nehmt keinen Eintritt für die Besichtigung eurer Hyperlink-freien Wörterwüsten, weil ihr genau wisst, dass niemand dafür Geld ausgeben würde. Ihr habt seriöse und un- seriöse SEO-Fritzen mit Geld beworfen, damit Google eure Seiten besonders lieb hat. Ihr seid ohne Einladung auf diese Party gekommen. Das ist okay, ihr könnt gerne ein wenig mitfeiern. Prost! Aber wisst ihr, was gar nicht geht? Dass ihr jetzt von den anderen Gästen hier Geld kassieren wollt. Sogar per Gesetz. Verleger: geht’s noch?
Weiterlesen:
http://carta.info/36869/verlegerforderung-leistungsschutzrecht-ja-habt-ihr-denn-ueberhaupt-keinen-stolz/
Via
http://textundblog.de/?p=3912
das tut jetzt vielleicht ein wenig weh, aber einer muss es mal deutlich sagen: Euch hat niemand gerufen! Niemand hat gesagt: “Mein Internet ist so leer, kann da nicht mal jemand Zeitungstexte oder so was reinkippen?“ Ihr seid freiwillig gekommen, und ihr habt eure Verlagstexte freiwillig ins Web gestellt. Zu Hauf. Und kostenlos. Ihr nehmt keinen Eintritt für die Besichtigung eurer Hyperlink-freien Wörterwüsten, weil ihr genau wisst, dass niemand dafür Geld ausgeben würde. Ihr habt seriöse und un- seriöse SEO-Fritzen mit Geld beworfen, damit Google eure Seiten besonders lieb hat. Ihr seid ohne Einladung auf diese Party gekommen. Das ist okay, ihr könnt gerne ein wenig mitfeiern. Prost! Aber wisst ihr, was gar nicht geht? Dass ihr jetzt von den anderen Gästen hier Geld kassieren wollt. Sogar per Gesetz. Verleger: geht’s noch?
Weiterlesen:
http://carta.info/36869/verlegerforderung-leistungsschutzrecht-ja-habt-ihr-denn-ueberhaupt-keinen-stolz/
Via
http://textundblog.de/?p=3912
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 02:53 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die dreiteilige Beitragsserie verlinkt:
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2010/12/ngram-viewer-im-binder-blog.html
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2010/12/ngram-viewer-im-binder-blog.html
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 02:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diese wenig überraschende Erkenntnis steht am Anfang eines Beitrags
zur Geschichte der Zeitrechnung:
http://historikerkraus.de/blog/?p=673
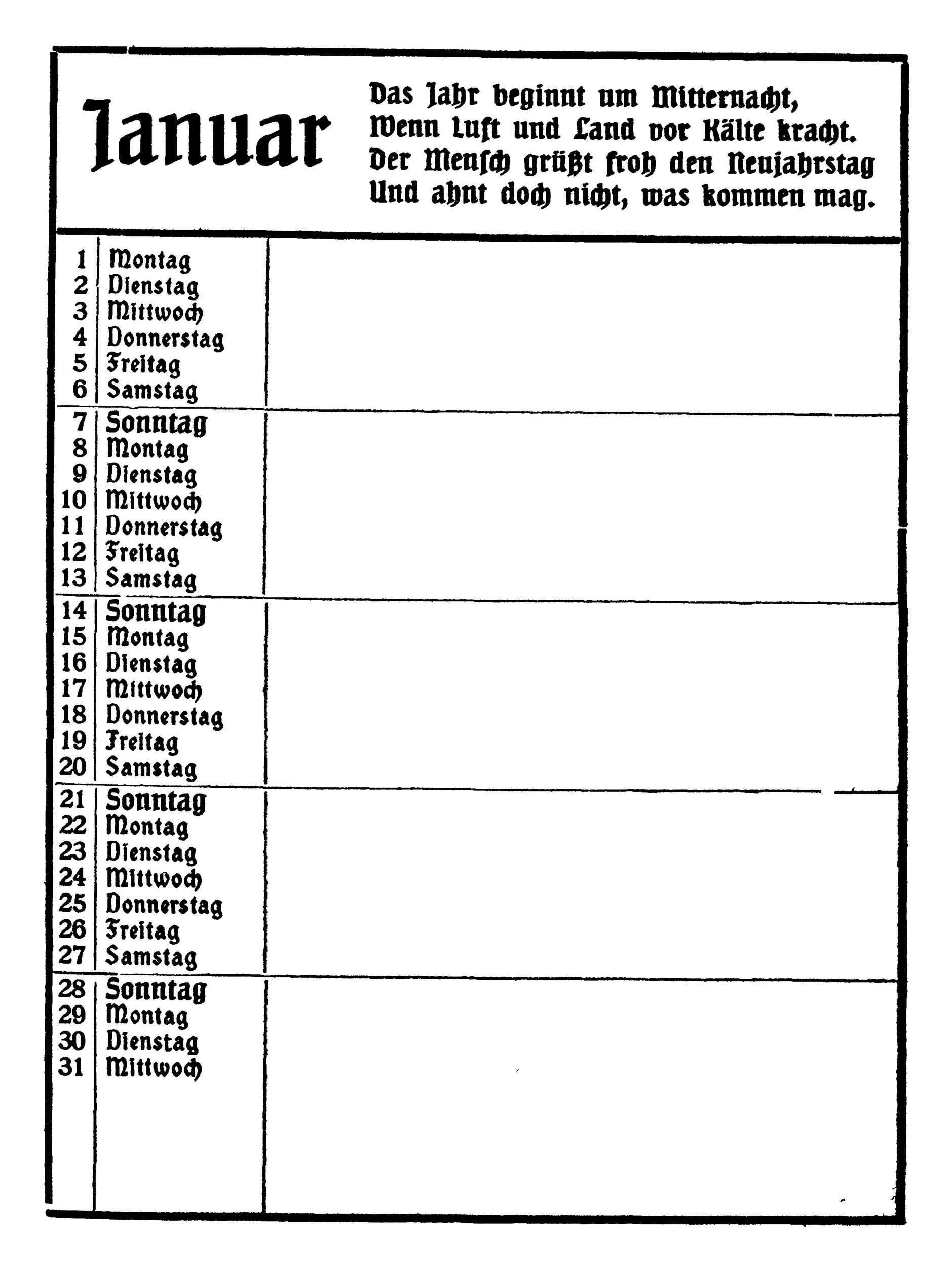
zur Geschichte der Zeitrechnung:
http://historikerkraus.de/blog/?p=673
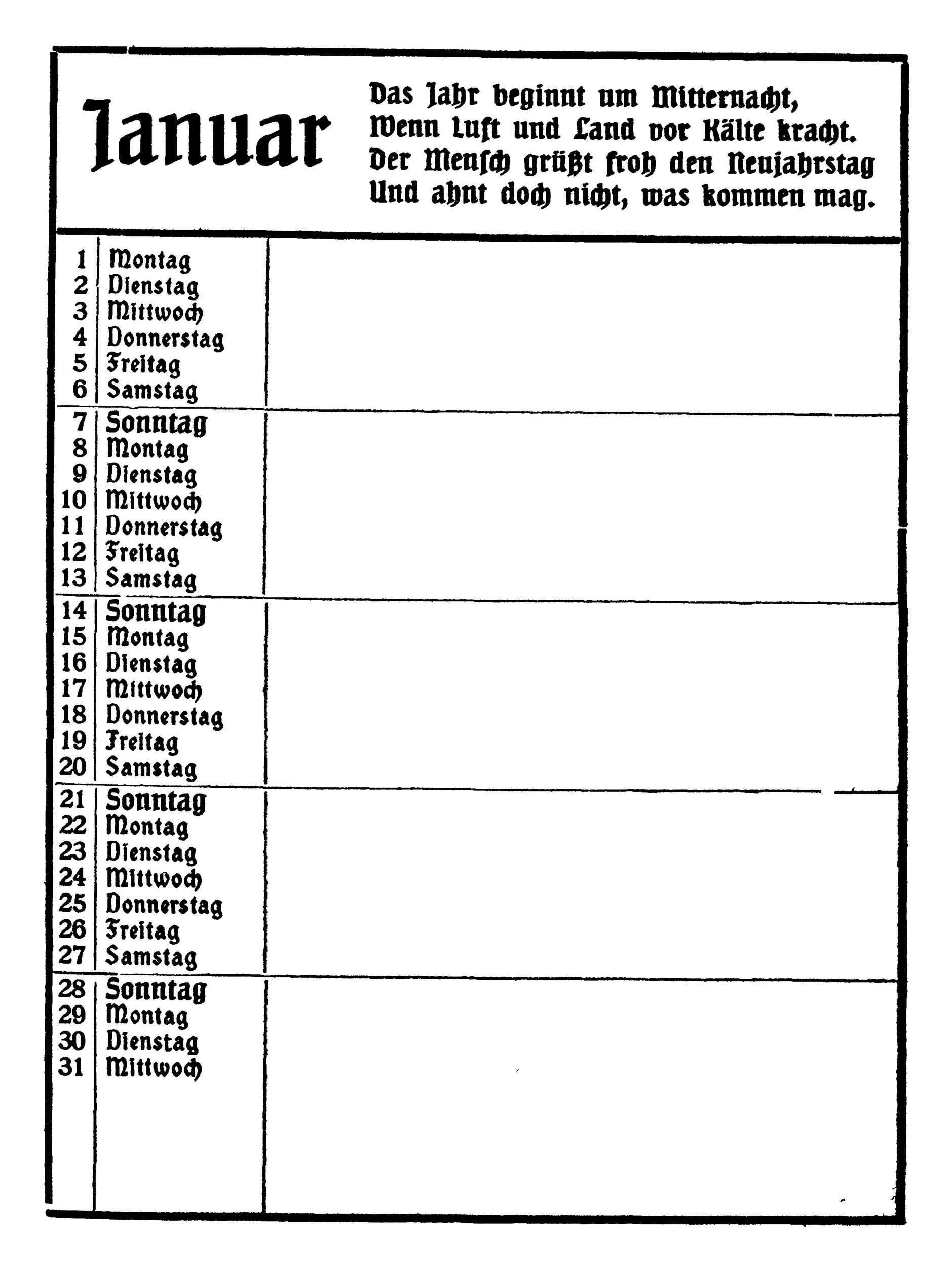
KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 02:48 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Ein Artikel im Tagesspiegel erinnert an sie:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/reise-nach-jerusalem/3680030.html
Die beste biographische Information zu Felix Fabri ist übrigens die Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri

http://www.tagesspiegel.de/kultur/reise-nach-jerusalem/3680030.html
Die beste biographische Information zu Felix Fabri ist übrigens die Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri

KlausGraf - am Freitag, 31. Dezember 2010, 02:44 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen




 1. Bild
1. Bild 2. Bild
2. Bild 3. Bild
3. Bild

