KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 17:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über Ausnahmen unterrichtet:
http://www.ihk-praktikumsportal.de/inhalte/Arbeitgeber/Praktikum/Rechtliche+Rahmenbedingungen/2957346/Mindestlohn.html#Praktikanten
http://personal-im-web.de/mindestlohn/mindestlohn-wann-bekommen-praktikanten-den-mindestlohn/
http://www.ihk-praktikumsportal.de/inhalte/Arbeitgeber/Praktikum/Rechtliche+Rahmenbedingungen/2957346/Mindestlohn.html#Praktikanten
http://personal-im-web.de/mindestlohn/mindestlohn-wann-bekommen-praktikanten-den-mindestlohn/
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 17:00 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.alexandria.admin.ch/bv00963319_Schaffhausen.pdf
Weitere Digitalisate der Bibliothek am Guisanplatz in Bern über
http://search.books2ebooks.eu
(Abfrage ausgehend von einem Einzeltreffer z.B. mit Schweiz nach: all items available for EOD from Library Am Guisanplatz, anschließend auf eBooks einschränken)
Weitere Digitalisate der Bibliothek am Guisanplatz in Bern über
http://search.books2ebooks.eu
(Abfrage ausgehend von einem Einzeltreffer z.B. mit Schweiz nach: all items available for EOD from Library Am Guisanplatz, anschließend auf eBooks einschränken)
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 13:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bibliotheque-diderot.fr/services/numerisation-a-la-demande-168859.kjsp
Via
http://francofil.hypotheses.org/3018
Weiteres:
http://archiv.twoday.net/stories/434207182/
Via
http://francofil.hypotheses.org/3018
Weiteres:
http://archiv.twoday.net/stories/434207182/
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Bundespatentgericht in München hat mit Beschluss vom 26. März 2014 eine Beschwerde der Wikimedia Foundation gegen das interdisziplinäre Projekt Wiki-Watch zurückgewiesen. Wikimedia hatte beantragt, die Marke von Wiki-Watch löschen zu lassen. Ohne Erfolg: Zwischen Wikipedias Puzzle-Kugel und dem Logo von Wiki-Watch bestehe keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr, so das eindeutige Urteil der Richter."
http://blog.wiki-watch.de/?p=3916

http://blog.wiki-watch.de/?p=3916

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:23 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Suber: "This is big, and not only because the the Gates Foundation is big. The policy applies to both texts and data, requires CC-BY licenses, and is the first OA policy anywhere to give publishers fair warning and cut the permissible embargo from 12 months to zero over the next two years."
https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/SNRPPLGCqPh
https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/SNRPPLGCqPh
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:07 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nkf
Das OA-Journal richtet sich an Nachwuchswissenschaftler; jede Ausgabe hat einen Themenschwerpunkt.
Das OA-Journal richtet sich an Nachwuchswissenschaftler; jede Ausgabe hat einen Themenschwerpunkt.
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:02 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2014, 12:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Welche brandneuen Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Neue_Seiten
finden Suchmaschinen und Metasuchmaschinen?
23 Uhr 49 wurde angelegt
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutnacht_von_Sneek
Suche nach:
blutnacht von sneek
Etwas Informatives bietet dazu nur Google und http://www.etools.ch/ (erste drei Treffer nach Google).
Um Mitternacht: Nichts Informatives bei Metager3, Yahoo=Bing, info.com.
Otfriedvers: Google und etools.ch auf Platz 1, nichts bei Yahoo, info.com (jeweils erste 10 Treffer). geprüft ca. 00:10.
Geprüft 00:13-00:17 Ambika (Mahabharata). Noch nichts bei Google und den anderen.
Rebeca Olvera: Google nur auf Platz 10. Bei den anderen noch Fehlanzeige.
Schon um 22:50 wurde Barbara Schöbi-Fink angelegt. Google: Platz 3. Fehlt bis auf etools.ch (Platz 10) bei den anderen.
22:06 wurde angelegt: Attilio Momigliano. Google Platz 2; fehlt bei den anderen unter den ersten 10.
Bei Metager3 werden (aber nicht durchgehend) oben rechts gesondert Suchergebnisse aus der Wikipedia angezeigt; diese wurden nicht ausgewertet, sondern nur die Treffer der regulären Trefferliste.
Das Fazit des Kurztests überrascht nicht: Google hat eindeutig die Nase vorn. Etools.ch hat dank Google in 3 von 6 Fällen einen Treffer. In keinem Fall hatte eine andere Suchmaschine den Treffer früher als Google.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Neue_Seiten
finden Suchmaschinen und Metasuchmaschinen?
23 Uhr 49 wurde angelegt
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutnacht_von_Sneek
Suche nach:
blutnacht von sneek
Etwas Informatives bietet dazu nur Google und http://www.etools.ch/ (erste drei Treffer nach Google).
Um Mitternacht: Nichts Informatives bei Metager3, Yahoo=Bing, info.com.
Otfriedvers: Google und etools.ch auf Platz 1, nichts bei Yahoo, info.com (jeweils erste 10 Treffer). geprüft ca. 00:10.
Geprüft 00:13-00:17 Ambika (Mahabharata). Noch nichts bei Google und den anderen.
Rebeca Olvera: Google nur auf Platz 10. Bei den anderen noch Fehlanzeige.
Schon um 22:50 wurde Barbara Schöbi-Fink angelegt. Google: Platz 3. Fehlt bis auf etools.ch (Platz 10) bei den anderen.
22:06 wurde angelegt: Attilio Momigliano. Google Platz 2; fehlt bei den anderen unter den ersten 10.
Bei Metager3 werden (aber nicht durchgehend) oben rechts gesondert Suchergebnisse aus der Wikipedia angezeigt; diese wurden nicht ausgewertet, sondern nur die Treffer der regulären Trefferliste.
Das Fazit des Kurztests überrascht nicht: Google hat eindeutig die Nase vorn. Etools.ch hat dank Google in 3 von 6 Fällen einen Treffer. In keinem Fall hatte eine andere Suchmaschine den Treffer früher als Google.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_14_68/index.html
"Um eine Nachnutzung nicht zu erschweren oder sie gar unmöglich zu machen, müssen dem Leser beziehungsweise Nutzer von Forschungsergebnissen aller Art (Texte, Abbildungen, Software, Forschungsdaten, Metadaten) seine diesbezüglichen Rechte und Pflichten klar und einfach kommuniziert werden. Dies umfasst eine eindeutige Aussage, welche Möglichkeiten der Urheber Dritten für die freie Nachnutzung, zum Beispiel die Verbreitung und die Auswertung von Forschungsergebnissen einräumt, und ob dies gegebenenfalls die Möglichkeit einschließt, automatisiert Text- und Datenanalysen durchzuführen. Deshalb ist die Vergabe einer Lizenz, in der die vom Urheber beziehungsweise Rechteinhaber eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten nachvollziehbar dargelegt werden, unerlässlich. Diese Lizenzen müssen in ihren Aussagen rechtssicher formuliert und international verständlich sein. Zudem sollten dem Urheber für die Verwendung der Lizenzen keine Kosten entstehen. Die Pflicht zum exakten wissenschaftlichen Zitieren bleibt von der Vergabe solcher Lizenzen selbstverständlich unberührt.
Offene Lizenzen sind daher ein elementarer Standard, der eine wissenschaftskonforme Nachnutzung wissenschaftlicher Produkte erleichtert. Mit der offenen Bereitstellung von Forschungsergebnissen werden deren Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit, schnelle Verbreitung und somit Innovation befördert. Offene Lizenzen erleichtern zudem die Umsetzung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis.
Die deutschen Wissenschaftsorganisationen halten daher standardisierte offene Lizenzen für ein ideales Werkzeug, um im Sinne der Berliner Erklärung von 2003 die möglichst umfassende Nutzung wissenschaftlicher Inhalte rechtsverbindlich abzusichern.
Creative Commons
Die offenen Creative-Commons-Lizenzen sind international verbreitet und anerkannt. Es gibt für wissenschaftliche Veröffentlichungen kein anderes in vergleichbarer Weise breit genutztes standardisiertes Lizenzsystem. "
"Um eine Nachnutzung nicht zu erschweren oder sie gar unmöglich zu machen, müssen dem Leser beziehungsweise Nutzer von Forschungsergebnissen aller Art (Texte, Abbildungen, Software, Forschungsdaten, Metadaten) seine diesbezüglichen Rechte und Pflichten klar und einfach kommuniziert werden. Dies umfasst eine eindeutige Aussage, welche Möglichkeiten der Urheber Dritten für die freie Nachnutzung, zum Beispiel die Verbreitung und die Auswertung von Forschungsergebnissen einräumt, und ob dies gegebenenfalls die Möglichkeit einschließt, automatisiert Text- und Datenanalysen durchzuführen. Deshalb ist die Vergabe einer Lizenz, in der die vom Urheber beziehungsweise Rechteinhaber eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten nachvollziehbar dargelegt werden, unerlässlich. Diese Lizenzen müssen in ihren Aussagen rechtssicher formuliert und international verständlich sein. Zudem sollten dem Urheber für die Verwendung der Lizenzen keine Kosten entstehen. Die Pflicht zum exakten wissenschaftlichen Zitieren bleibt von der Vergabe solcher Lizenzen selbstverständlich unberührt.
Offene Lizenzen sind daher ein elementarer Standard, der eine wissenschaftskonforme Nachnutzung wissenschaftlicher Produkte erleichtert. Mit der offenen Bereitstellung von Forschungsergebnissen werden deren Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit, schnelle Verbreitung und somit Innovation befördert. Offene Lizenzen erleichtern zudem die Umsetzung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis.
Die deutschen Wissenschaftsorganisationen halten daher standardisierte offene Lizenzen für ein ideales Werkzeug, um im Sinne der Berliner Erklärung von 2003 die möglichst umfassende Nutzung wissenschaftlicher Inhalte rechtsverbindlich abzusichern.
Creative Commons
Die offenen Creative-Commons-Lizenzen sind international verbreitet und anerkannt. Es gibt für wissenschaftliche Veröffentlichungen kein anderes in vergleichbarer Weise breit genutztes standardisiertes Lizenzsystem. "
KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2014, 23:22 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Beitrag von Manuel Hagemann steht auch online zur Verfügung:
http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/forschung/beitrag_hagemann_rhvjbll2014
http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/forschung/beitrag_hagemann_rhvjbll2014
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.netzwelt.de/news/150011-goodbye-google-yahoo-default-suchmaschine-firefox-browser.html
Gewiss keine gute Entscheidung, schaut man sich das Ergebnis von Bing (das hinter der Yahoo-Suche steht) bei meinem letzten Metasuchmaschinentest an:
http://archiv.twoday.net/stories/1022370760/
Die Suche nach
Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert
erbringt bei Google meinen aktuellen Archivalia-Beitrag (Platz 6), während Yahoo unter den ersten 10 Treffern nichts hat.
Gewiss keine gute Entscheidung, schaut man sich das Ergebnis von Bing (das hinter der Yahoo-Suche steht) bei meinem letzten Metasuchmaschinentest an:
http://archiv.twoday.net/stories/1022370760/
Die Suche nach
Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert
erbringt bei Google meinen aktuellen Archivalia-Beitrag (Platz 6), während Yahoo unter den ersten 10 Treffern nichts hat.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die folgende Rezension erschien in der Zeitschrift für Volkskunde, Jahrgang 110, Heft 2, 2014, S. 344-346.
Nils Grosch: Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert.
Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2013, 206 S., 56
Schwarzweißabb. (Populäre Kultur und Musik Bd. 6).
“Über das Alter der Populären Musik, die Erfindung des
‘Volkslieds’ und die Konstruktion von ‘Tenorliedern’”. Die
Überschrift des ersten Kapitels - eine Einleitung gibt es
nicht - zeigt die Richtung an, die diese Basler
musikwissenschaftliche Habilitationsschrift von 2009
einschlägt. Sie siedelt im Überschneidungsbereich von
Musikwissenschaft, Mediengeschichte, Volkskunde und
Literaturwissenschaft.
Während die Erforschung moderner Populärer Musik diese vor
allem als Industrieprodukt begreift, hat der - seit
längerem in Misskredit geratene - Volkslied-Begriff seinen
Gegenstand ahistorisch und ohne Bezug auf den
mediengeschichtlichen Kontext konstruiert. Herders
Volkslied war eine ästhetische Kategorie, die das gesamte
Volk als Kulturgemeinschaft meinte. Im 19. Jahrhundert
wurden die Volkslieder dann zu Liedern des einfachen Volks
umgewertet. Musikwissenschaftlich korrespondiert diesem
Prozess die Etablierung des sogenannten “Tenorlieds”, das
definiert wird als eine “umfassende Kategorie für die
überlieferten, mehrstimmigen Kompositionen über
deutschsprachige Texte von der Mitte des 15. bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts” (S. 23). Die Tenorstimme
mehrstimmiger Lieder hat man regelmäßig als Volksliedbeleg
gewertet (S. 27). Grosch lehnt die Tenorlied-Theorie (in
der NS-Zeit gern: “deutsches Tenorlied”) als “ideologisch
motiviertes Konstrukt” ab (S. 31) und betont die
industrielle Produktion und kommerzielle Distribution
populärer Musik.
Nach erfolgreicher Aufräumarbeit unternimmt es Grosch, im
zweiten Kapitel die Rolle des Lieds in der
‘Gutenberg-Galaxis’ (McLuhan) zu bestimmen. Da
Gattungsdifferenzierungen für das (weltliche) Lied wie
Volkslied, Gesellschaftslied, Kunstlied oder Hofweise die
Gefahr zirkulärer Argumentation mit sich bringen,
bezeichnet er die Gattung einfach als Lied. Er behandelt
Liederhandschriften, Liedflugschriften und überwiegend mit
Noten versehene gedruckte Liederbücher, die zunächst im
Mehrphasendruck vervielfältigt wurden. In den 1530er Jahren
setzte sich als technologische Innovation der
Einphasendruck mit beweglichen Lettern durch.
Um die Rezeption und den Gebrauch des Lieds geht es dem
dritten Kapitel, das auf die Erweiterung der Abnehmerkreise
ebenso aufmerksam macht wie auf den “Standortwechsel als
Medienwechsel” (vom Hof in die Stadt). Lieder spielten in
der Jugendkultur eine besondere Rolle und wurden als
Medienobjekte nicht nur als Vorlagen für das Singen
geschätzt.
In fünf detailreichen Fallstudien, allesamt
weitverbreiteten Liebesliedern gewidmet, wird jeweils nach
dem“konstruktiven Anteil der Medien an der Realität und
Praxis des Liedes” (S. 109) gefragt. Den Schlussabschnitt
(“Das Lied im intermedialen Transkriptionsprozess”) hätte
man wohl auch etwas weniger ambitioniert und wesentlich
konziser abfassen können.
Der ständige Verweis auf die mediengeschichtlichen
Rahmenbedingungen (prägend waren vor allem die Studien von
Michael Giesecke) ist vor dem Hintergrund ihrer
Vernachlässigung in der Forschungsgeschichte über lange
Zeit mehr als verständlich. Grosch ist davon überzeugt,
dass der “Medienapparat die kulturelle Kommunikation immens
prägte und dabei die Gattung Lied nicht nur selbst als
Medium nutzte, sondern sie auch in anderer Gestalt,
Erscheinungsform und Funktion entließ, als er sie
vorgefunden hatte” (S. 67). Eine bedeutende
Grundlagenarbeit für alle Beschäftigung mit dem weltlichen
Lied des 16. Jahrhunderts stellt die 1974/75 erschienene
zweibändige Monographie des Volkskundlers Rolf Wilhelm
Brednich zur Liedpublizistik dar, der im Jahrbuch für
Volksliedforschung 1974 “Das Lied als Ware” präsentierte.
Dass Grosch immer wieder die Einbindung in ein
“frühkapitalistischen Netzwerk” (S. 80) unterstreicht und
das Lied als kommerzielles Industrieprodukt bestimmt, wirkt
jedoch ein wenig einseitig.
Fundiertes über die Rolle der Mündlichkeit hat Grosch nicht
zu sagen, da er das Lied vor allem als Gegenstand medialer
Verbreitung in den Blick nimmt. Literaturwissenschaftliche
Studien wie die von ihm nicht rezipierten Arbeiten von
Harald Haferland haben sich aber durchaus zeitgemäß mit
mündlicher Varianz befasst.
Die Rolle des Performativen (also den Aufführungs-Aspekt
bzw. das gemeinschaftliche Singen) spielt Grosch herunter,
während er individuelle und private Nutzungen aufwertet.
Tabulaturdrucke sieht er als “Versuch interaktionsfreier
Kommunikation von Musik” (S. 71, vgl. auch S. 85), der das
Selbstlernen an die Stelle der persönlichen Unterweisung
durch einen Lehrer setzen wollte. Neben der Aufführung sind
auch “ganz andere Formen des Gebrauchs - Lesen, Kodieren,
Verschenken, Sammeln usw. - “ in Rechnung zu stellen (S.
103). Liederhandschriften dokumentierten die individuellen
Vorlieben der Besitzer. Angemerkt sei, dass sowohl das
Phänomen der “Liederstammbücher” (S. 47) als auch der
Erwerb von Lieder-Kleindrucken als Erinnerungsstücke, die
das “Habhaftwerden eines eigentlich flüchtigen
performativen Ereignisses und dessen Verlängerung in das
Privatleben hinein” ermöglichten (S. 51), eng mit der
Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts in Verbindung
stehen.
Offensichtlich sei, “dass der Zweck von Musikbüchern und
Flugschriften im Bereich der individuellen Adaption bis hin
zur Identifikation und Persönlichkeitsbildung liegt und
somit aufführungspraktische Zwecke im Sinne professioneller
Musikpraxis in den Hintergrund treten” (S. 91). In das
Gesamtbild des damaligen “populären” Musiklebens gehört
aber auch eine Erscheinung stadtbürgerlicher Provenienz,
die auf das Performative setzt und eben nicht von höfischen
Kreisen oder einem Patriziat getragen wird: der von
Handwerkern in Gesellschaften praktizierte Meistersang.
Für den Historiker spannend sind die Ausführungen zum “Sitz
im Leben” des Lieds. Im Rahmen einer “Geschichte der
Freizeit” ist der Befund zu beachten, dass Liedersingen als
hochwertige Alternative zu dem “grossen unfletigen
sewischem sauffen und zenckischem haderischen spilen” (so
Georg Forster 1549, zitiert S. 93) geschätzt wurde.
Mehrstimmige Liebeslieder hatten einen wichtigen Platz
schon in der damaligen Jugendkultur. Oberflächlich bleibt
Groschs Analyse hinsichtlich der “Propagierung einer neuen
Moral” (S. 96) - der Historiker war es lange gewohnt, an
dieser Stelle die (inzwischen doch recht umstrittene)
“Sozialdisziplinierung” als Trumpf-As aus dem Ärmel zu
ziehen. Überhaupt kommt die Reformation als
mediengeschichtlicher Faktor so gut wie nicht vor.
Wenn ich recht sehe, liegt die Erforschung der Sozial- und
Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Musikpraxis fast
ausnahmslos in den Händen der Musikwissenschaftler, während
literarische Praktiken nicht selten auch aus
geschichtswissenschaftlicher Perspektive untersucht werden.
Groschs anregende Hinweise auf Freizeitverhalten und
Jugendkultur könnten solche musikhistorischen Studien
inspirieren.
Die großen Linien herauszuarbeiten ist wichtig. Trotzdem
möchte ich einige formale Mängel nicht unter den Tisch
fallen lassen. Im Literaturverzeichnis sind manche Lücken
und eine sehr selektive Berücksichtigung der nach 2009
erschienenen Arbeiten zu konstatieren. Dies betrifft
insbesondere den 2010 erschienenen wichtigen Sammelband
NiveauNischeNimbus, aus dem Grosch nur zwei Beiträge von
Andrea Lindmayr-Brandl und Nicole Schwindt ins
Literaturverzeichnis aufgenommen hat, nicht aber seinen
eigenen Aufsatz oder die buchgeschichtliche Studie von
Hans-Jörg Künast.
Ergänzend zu musikwissenschaftlichen Referenzwerken hätte
unbedingt das VD 16 zitiert werden müssen. Wenn häufig eine
unveröffentlichte Datenbank von Eberhard Nehlsen 2003 als
einziger bibliographischer Verweis angegeben wird (obwohl
manchmal “Nehlsen 2008f.” am Platz gewesen wäre), stellt
sich die Frage: Cui bono? Im Einzelfall hätte Grosch
gründlicher recherchieren müssen, was bei Nutzung von
Internetressourcen auch ohne weiteres möglich gewesen wäre.
Beispielsweise ist der älteste Einblattdruck von “Entlaubet
ist der Walde” (S. 156) ganz bestimmt kein Produkt von
Konrad Dinckmut (nicht: Dinckmuth) 1496. Der beigegebene
Holzschnitt wird von Matthäus Elchinger in Augsburg ca.
1523/30 verwendet, was einen Anhaltspunkt für die Datierung
liefert (vgl.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GWXI346A.htm ).
Seit 2002 liegt eine moderne Edition (Chronik der Bischöfe
von Würzburg Bd. 4, S. 280) der S. 49 nach Brednich
zitierten Chronik des Lorenz Fries vor.
Die mediengeschichtlich revolutionäre Ausweitung der
Quellenbasis durch Digitalisate - zu nennen sind vor allem
die Projekte der Bayerischen Staatsbibliothek (Musikdrucke)
und der Staatsbibliothek Berlin (Lieddrucke) - kommt bei
Grosch nicht vor. Er hat noch nicht einmal für die
Drucklegung die paar Internetadressen, die er nennt,
aktualisiert. Ein “Zugriff vom 24.10.2005" in einer 2013
gedruckten Publikation ist nicht gerade vorbildlich zu
nennen. Die schon etwas angejahrte Internet-Anthologie
http://www.lyrik-und-lied.de/, an der Grosch selbst
mitgearbeitet hat (auch in Bezug auf die Lieder seiner
Fallstudien), erwähnt er S. 108 nicht einmal. Schon
mindestens seit Ende 2009 steht ein Digitalisat von Hans
Judenkönigs Tabulaturbuch (1523) im Netz, das Grosch hätte
dazu verwenden können, die ungenaue Wiedergabe eines Zitats
(S. 74 nach Brown 1965) zu korrigieren.
Gleichwohl: ein wertvoller, angenehm straff geschriebener
Diskussionsbeitrag, der auch außerhalb der
Musikwissenschaft gelesen werden sollte.
Nils Grosch: Lied und Medienwechsel im 16. Jahrhundert.
Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2013, 206 S., 56
Schwarzweißabb. (Populäre Kultur und Musik Bd. 6).
“Über das Alter der Populären Musik, die Erfindung des
‘Volkslieds’ und die Konstruktion von ‘Tenorliedern’”. Die
Überschrift des ersten Kapitels - eine Einleitung gibt es
nicht - zeigt die Richtung an, die diese Basler
musikwissenschaftliche Habilitationsschrift von 2009
einschlägt. Sie siedelt im Überschneidungsbereich von
Musikwissenschaft, Mediengeschichte, Volkskunde und
Literaturwissenschaft.
Während die Erforschung moderner Populärer Musik diese vor
allem als Industrieprodukt begreift, hat der - seit
längerem in Misskredit geratene - Volkslied-Begriff seinen
Gegenstand ahistorisch und ohne Bezug auf den
mediengeschichtlichen Kontext konstruiert. Herders
Volkslied war eine ästhetische Kategorie, die das gesamte
Volk als Kulturgemeinschaft meinte. Im 19. Jahrhundert
wurden die Volkslieder dann zu Liedern des einfachen Volks
umgewertet. Musikwissenschaftlich korrespondiert diesem
Prozess die Etablierung des sogenannten “Tenorlieds”, das
definiert wird als eine “umfassende Kategorie für die
überlieferten, mehrstimmigen Kompositionen über
deutschsprachige Texte von der Mitte des 15. bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts” (S. 23). Die Tenorstimme
mehrstimmiger Lieder hat man regelmäßig als Volksliedbeleg
gewertet (S. 27). Grosch lehnt die Tenorlied-Theorie (in
der NS-Zeit gern: “deutsches Tenorlied”) als “ideologisch
motiviertes Konstrukt” ab (S. 31) und betont die
industrielle Produktion und kommerzielle Distribution
populärer Musik.
Nach erfolgreicher Aufräumarbeit unternimmt es Grosch, im
zweiten Kapitel die Rolle des Lieds in der
‘Gutenberg-Galaxis’ (McLuhan) zu bestimmen. Da
Gattungsdifferenzierungen für das (weltliche) Lied wie
Volkslied, Gesellschaftslied, Kunstlied oder Hofweise die
Gefahr zirkulärer Argumentation mit sich bringen,
bezeichnet er die Gattung einfach als Lied. Er behandelt
Liederhandschriften, Liedflugschriften und überwiegend mit
Noten versehene gedruckte Liederbücher, die zunächst im
Mehrphasendruck vervielfältigt wurden. In den 1530er Jahren
setzte sich als technologische Innovation der
Einphasendruck mit beweglichen Lettern durch.
Um die Rezeption und den Gebrauch des Lieds geht es dem
dritten Kapitel, das auf die Erweiterung der Abnehmerkreise
ebenso aufmerksam macht wie auf den “Standortwechsel als
Medienwechsel” (vom Hof in die Stadt). Lieder spielten in
der Jugendkultur eine besondere Rolle und wurden als
Medienobjekte nicht nur als Vorlagen für das Singen
geschätzt.
In fünf detailreichen Fallstudien, allesamt
weitverbreiteten Liebesliedern gewidmet, wird jeweils nach
dem“konstruktiven Anteil der Medien an der Realität und
Praxis des Liedes” (S. 109) gefragt. Den Schlussabschnitt
(“Das Lied im intermedialen Transkriptionsprozess”) hätte
man wohl auch etwas weniger ambitioniert und wesentlich
konziser abfassen können.
Der ständige Verweis auf die mediengeschichtlichen
Rahmenbedingungen (prägend waren vor allem die Studien von
Michael Giesecke) ist vor dem Hintergrund ihrer
Vernachlässigung in der Forschungsgeschichte über lange
Zeit mehr als verständlich. Grosch ist davon überzeugt,
dass der “Medienapparat die kulturelle Kommunikation immens
prägte und dabei die Gattung Lied nicht nur selbst als
Medium nutzte, sondern sie auch in anderer Gestalt,
Erscheinungsform und Funktion entließ, als er sie
vorgefunden hatte” (S. 67). Eine bedeutende
Grundlagenarbeit für alle Beschäftigung mit dem weltlichen
Lied des 16. Jahrhunderts stellt die 1974/75 erschienene
zweibändige Monographie des Volkskundlers Rolf Wilhelm
Brednich zur Liedpublizistik dar, der im Jahrbuch für
Volksliedforschung 1974 “Das Lied als Ware” präsentierte.
Dass Grosch immer wieder die Einbindung in ein
“frühkapitalistischen Netzwerk” (S. 80) unterstreicht und
das Lied als kommerzielles Industrieprodukt bestimmt, wirkt
jedoch ein wenig einseitig.
Fundiertes über die Rolle der Mündlichkeit hat Grosch nicht
zu sagen, da er das Lied vor allem als Gegenstand medialer
Verbreitung in den Blick nimmt. Literaturwissenschaftliche
Studien wie die von ihm nicht rezipierten Arbeiten von
Harald Haferland haben sich aber durchaus zeitgemäß mit
mündlicher Varianz befasst.
Die Rolle des Performativen (also den Aufführungs-Aspekt
bzw. das gemeinschaftliche Singen) spielt Grosch herunter,
während er individuelle und private Nutzungen aufwertet.
Tabulaturdrucke sieht er als “Versuch interaktionsfreier
Kommunikation von Musik” (S. 71, vgl. auch S. 85), der das
Selbstlernen an die Stelle der persönlichen Unterweisung
durch einen Lehrer setzen wollte. Neben der Aufführung sind
auch “ganz andere Formen des Gebrauchs - Lesen, Kodieren,
Verschenken, Sammeln usw. - “ in Rechnung zu stellen (S.
103). Liederhandschriften dokumentierten die individuellen
Vorlieben der Besitzer. Angemerkt sei, dass sowohl das
Phänomen der “Liederstammbücher” (S. 47) als auch der
Erwerb von Lieder-Kleindrucken als Erinnerungsstücke, die
das “Habhaftwerden eines eigentlich flüchtigen
performativen Ereignisses und dessen Verlängerung in das
Privatleben hinein” ermöglichten (S. 51), eng mit der
Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts in Verbindung
stehen.
Offensichtlich sei, “dass der Zweck von Musikbüchern und
Flugschriften im Bereich der individuellen Adaption bis hin
zur Identifikation und Persönlichkeitsbildung liegt und
somit aufführungspraktische Zwecke im Sinne professioneller
Musikpraxis in den Hintergrund treten” (S. 91). In das
Gesamtbild des damaligen “populären” Musiklebens gehört
aber auch eine Erscheinung stadtbürgerlicher Provenienz,
die auf das Performative setzt und eben nicht von höfischen
Kreisen oder einem Patriziat getragen wird: der von
Handwerkern in Gesellschaften praktizierte Meistersang.
Für den Historiker spannend sind die Ausführungen zum “Sitz
im Leben” des Lieds. Im Rahmen einer “Geschichte der
Freizeit” ist der Befund zu beachten, dass Liedersingen als
hochwertige Alternative zu dem “grossen unfletigen
sewischem sauffen und zenckischem haderischen spilen” (so
Georg Forster 1549, zitiert S. 93) geschätzt wurde.
Mehrstimmige Liebeslieder hatten einen wichtigen Platz
schon in der damaligen Jugendkultur. Oberflächlich bleibt
Groschs Analyse hinsichtlich der “Propagierung einer neuen
Moral” (S. 96) - der Historiker war es lange gewohnt, an
dieser Stelle die (inzwischen doch recht umstrittene)
“Sozialdisziplinierung” als Trumpf-As aus dem Ärmel zu
ziehen. Überhaupt kommt die Reformation als
mediengeschichtlicher Faktor so gut wie nicht vor.
Wenn ich recht sehe, liegt die Erforschung der Sozial- und
Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Musikpraxis fast
ausnahmslos in den Händen der Musikwissenschaftler, während
literarische Praktiken nicht selten auch aus
geschichtswissenschaftlicher Perspektive untersucht werden.
Groschs anregende Hinweise auf Freizeitverhalten und
Jugendkultur könnten solche musikhistorischen Studien
inspirieren.
Die großen Linien herauszuarbeiten ist wichtig. Trotzdem
möchte ich einige formale Mängel nicht unter den Tisch
fallen lassen. Im Literaturverzeichnis sind manche Lücken
und eine sehr selektive Berücksichtigung der nach 2009
erschienenen Arbeiten zu konstatieren. Dies betrifft
insbesondere den 2010 erschienenen wichtigen Sammelband
NiveauNischeNimbus, aus dem Grosch nur zwei Beiträge von
Andrea Lindmayr-Brandl und Nicole Schwindt ins
Literaturverzeichnis aufgenommen hat, nicht aber seinen
eigenen Aufsatz oder die buchgeschichtliche Studie von
Hans-Jörg Künast.
Ergänzend zu musikwissenschaftlichen Referenzwerken hätte
unbedingt das VD 16 zitiert werden müssen. Wenn häufig eine
unveröffentlichte Datenbank von Eberhard Nehlsen 2003 als
einziger bibliographischer Verweis angegeben wird (obwohl
manchmal “Nehlsen 2008f.” am Platz gewesen wäre), stellt
sich die Frage: Cui bono? Im Einzelfall hätte Grosch
gründlicher recherchieren müssen, was bei Nutzung von
Internetressourcen auch ohne weiteres möglich gewesen wäre.
Beispielsweise ist der älteste Einblattdruck von “Entlaubet
ist der Walde” (S. 156) ganz bestimmt kein Produkt von
Konrad Dinckmut (nicht: Dinckmuth) 1496. Der beigegebene
Holzschnitt wird von Matthäus Elchinger in Augsburg ca.
1523/30 verwendet, was einen Anhaltspunkt für die Datierung
liefert (vgl.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GWXI346A.htm ).
Seit 2002 liegt eine moderne Edition (Chronik der Bischöfe
von Würzburg Bd. 4, S. 280) der S. 49 nach Brednich
zitierten Chronik des Lorenz Fries vor.
Die mediengeschichtlich revolutionäre Ausweitung der
Quellenbasis durch Digitalisate - zu nennen sind vor allem
die Projekte der Bayerischen Staatsbibliothek (Musikdrucke)
und der Staatsbibliothek Berlin (Lieddrucke) - kommt bei
Grosch nicht vor. Er hat noch nicht einmal für die
Drucklegung die paar Internetadressen, die er nennt,
aktualisiert. Ein “Zugriff vom 24.10.2005" in einer 2013
gedruckten Publikation ist nicht gerade vorbildlich zu
nennen. Die schon etwas angejahrte Internet-Anthologie
http://www.lyrik-und-lied.de/, an der Grosch selbst
mitgearbeitet hat (auch in Bezug auf die Lieder seiner
Fallstudien), erwähnt er S. 108 nicht einmal. Schon
mindestens seit Ende 2009 steht ein Digitalisat von Hans
Judenkönigs Tabulaturbuch (1523) im Netz, das Grosch hätte
dazu verwenden können, die ungenaue Wiedergabe eines Zitats
(S. 74 nach Brown 1965) zu korrigieren.
Gleichwohl: ein wertvoller, angenehm straff geschriebener
Diskussionsbeitrag, der auch außerhalb der
Musikwissenschaft gelesen werden sollte.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 22:31 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Noch bis zum 30. November in Schweinfurt zu sehen.
https://www.schweinfurt-evangelisch.de/inhalt/die-sakristei-gehoerig

https://www.schweinfurt-evangelisch.de/inhalt/die-sakristei-gehoerig

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 22:07 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das erste Bibliotheksgesetz in der Geschichte von Rheinland-Pfalz wurde heute mit den Stimmen aller Fraktionen im Landtag verabschiedet."
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 20:17 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.corpusvitrearum.de/forschung/bildarchiv/auswahl.html
3075 Bilder von Glasmalereien bis ca. zur Mitte des 16. Jahrhunderts, anscheinend ohne Wasserzeichen, aber auch ohne Public-Domain- oder CC-Freigabe. Die Metadaten sind teilweise veraltet, so ist der CVMA-Band Südhessen bereits vor einigen Jahren erschienen.
Bei ICONCLASS erweist sich das GND-Prinzip als überlegen: Bei GND führt die Kennziffer mittels BEACON zu den Objekten, die so klassifiziert sind.
Obwohl die das Projekt tragenden Akademien Open Access unterstützen, war es bisher ärmlich, was im CVMA-Kontext im Netz zu sehen war:
http://telota.bbaw.de/cvma/ (Bilder mit Wasserzeichen)
Die Newsletter des Projekts, die auch wissenschaftliche Fachbeiträge enthalten, sind als PDFs bis Nr. 46 online:
http://www.corpusvitrearum.org/
Dort gibt es auch Bibliographien kostenlos.
Das CVMA UK enthält auch ein öffentliches Bildarchiv:
http://www.cvma.ac.uk/jsp/index.jsp
Unverständlich ist, wieso die anklickbare Karte in Deutschland nicht ebenso realisiert wurde.
Italien bietet eine Bilddatenbank an:
http://www.icvbc.cnr.it/bivi/
 Scheibe aus Erbach
Scheibe aus Erbach
3075 Bilder von Glasmalereien bis ca. zur Mitte des 16. Jahrhunderts, anscheinend ohne Wasserzeichen, aber auch ohne Public-Domain- oder CC-Freigabe. Die Metadaten sind teilweise veraltet, so ist der CVMA-Band Südhessen bereits vor einigen Jahren erschienen.
Bei ICONCLASS erweist sich das GND-Prinzip als überlegen: Bei GND führt die Kennziffer mittels BEACON zu den Objekten, die so klassifiziert sind.
Obwohl die das Projekt tragenden Akademien Open Access unterstützen, war es bisher ärmlich, was im CVMA-Kontext im Netz zu sehen war:
http://telota.bbaw.de/cvma/ (Bilder mit Wasserzeichen)
Die Newsletter des Projekts, die auch wissenschaftliche Fachbeiträge enthalten, sind als PDFs bis Nr. 46 online:
http://www.corpusvitrearum.org/
Dort gibt es auch Bibliographien kostenlos.
Das CVMA UK enthält auch ein öffentliches Bildarchiv:
http://www.cvma.ac.uk/jsp/index.jsp
Unverständlich ist, wieso die anklickbare Karte in Deutschland nicht ebenso realisiert wurde.
Italien bietet eine Bilddatenbank an:
http://www.icvbc.cnr.it/bivi/
 Scheibe aus Erbach
Scheibe aus ErbachKlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 18:41 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/web/58105
Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, im Weihnachtsurlaub forschen zu wollen.
Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, im Weihnachtsurlaub forschen zu wollen.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:58 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/11/19/29-histofloxikon-vierte-lieferung/
Die 4. Lieferung thematisiert:
Von der Vergangenheit eingeholt werden
Die Vergangenheit begraben
Ende der Geschichte
Die 4. Lieferung thematisiert:
Von der Vergangenheit eingeholt werden
Die Vergangenheit begraben
Ende der Geschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es gab 743 Bewerbungen!
http://www.rhein-zeitung.de/region/panorama_artikel,-Jury-hat-entschieden-Burgenbloggerin-wird-%E2%80%9EWortwalz%E2%80%9C-Jessica-Schober-aus-Muenchen-.html
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/948993967/
http://archiv.twoday.net/stories/948993544/
http://www.rhein-zeitung.de/region/panorama_artikel,-Jury-hat-entschieden-Burgenbloggerin-wird-%E2%80%9EWortwalz%E2%80%9C-Jessica-Schober-aus-Muenchen-.html
Mit @wortwalz wird eine der tollsten Journalistinnen, die ich kenne, die Burgenbloggerin https://t.co/bcVMfG7asO
— Don Alphonso (@faz_donalphonso) 10. November 2014
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/948993967/
http://archiv.twoday.net/stories/948993544/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.tanjapraske.de/2014/11/19/14-gruende-warum-museen-kein-social-media-brauchen/
Gilt so ähnlich auch für Archive ...
Gilt so ähnlich auch für Archive ...
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:30 - Rubrik: Museumswesen
Das MDZ hat endlich eine Projektseite für die digitalisierten Handschriften spendiert.
http://goo.gl/VxdP6N
Bislang 21 Titel.

http://goo.gl/VxdP6N
Bislang 21 Titel.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 17:05 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.museumsofindia.gov.in/
"National Portal and Digital Repository for Indian Museums"
Zoombare Abbildungen mit Wasserzeichen, keine Freigabe als Public Domain.
"National Portal and Digital Repository for Indian Museums"
Zoombare Abbildungen mit Wasserzeichen, keine Freigabe als Public Domain.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:30 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nur ein Dokument aus dem im Stadtarchiv Reutlingen verwahrten Friedrich-List-Archiv, der durch ein Online-Findbuch erschlossen ist.
http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Friedrich-List-Archiv
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/friedrich-list-archiv-im-stadtarchiv.html

http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Friedrich-List-Archiv
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/friedrich-list-archiv-im-stadtarchiv.html
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2014, 16:22 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.youtube.com/watch?v=8A0CgS66iE0
Vom Ansatz her verdient das Video alle Zustimmung. Es ist gut gemacht und gibt die Rechtslage im wesentlichen korrekt wieder.
Ich selbst habe mich in diesem Blog sehr oft mit dem Thema der lizenzkonformen Nutzung befasst.
Mit
http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%BCbersichtsb
komme ich schnell zu
http://archiv.twoday.net/stories/49598992/
und von da zu
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/
Dort findet sich eine (sicher nicht lückenlose) Beitragsliste.
Ich bestreite, dass die Darstellung des Videos hinsichtlich der Angabe des Titels korrekt ist.
"Sechtens: Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen"
Dazu stelle ich fest:
Die jüngste Version der CC-Lizenzen, also Version 4, enthält diese Verpflichtung nicht mehr:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Via
https://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Detailed_attribution_comparison_chart
Am 13. Oktober 2012 habe ich mich mit der Auslegung der Lizenzforderung "title if supplied" mit Blick auf Bilder beschäftigt.
http://archiv.twoday.net/stories/165211461/
Auch die Praxis erweist meine Ansicht, dass ein Titel ausdrücklich spezifiziert werden muss, um die Forderung nach Titelnennung obligatorisch zu machen, als richtig, denn so wie das Video das interpretiert (Dateinamen als Titel) lizenziert meines Wissens niemand.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
ist zwar keine verpflichtende Richtlinie, gibt aber den entscheidenden Anhaltspunkt: Der Titel ist optional, er muss nur angegeben werden, wenn der Urheber ihn ausdrücklich bezeichnet.
Auf Wikimedia Commons gibt es keinen eindeutigen Titel, der beizubehalten ist, da der Dateiname geändert werden kann (und bei aussagelosen Namen wie dem im Video IMG_6462-6464 auch geändert werden SOLL) und auch die Beschreibung.
Ich wehre mich dagegen, einen Dateinamen als TITEL zu sehen. Eher ist die Beschreibung der Titel.
Gibt es keine eindeutige Entität, die unmissverständlich als Titel anzusprechen ist, kann eine Nennung nicht verlangt werden!
Nach der ganz und gar abzulehenden Rechtsansicht des Videos wäre jede Dateinamenänderung oder jede Änderung der ursprünglichen Beschreibung (je nach dem, was man als Titel ansieht) eine Urheberrechtsverletzung.
Die Checkliste formuliert differenzierter:
"Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen! Das gilt natürlich nur, wenn ein Titel angegeben ist, wobei strittig ist, ob z.B. „IMG_6464.jpg“ überhaupt ein Titel ist.
(Diese Auflage entfällt bei Werken, die nach der neuesten Lizenzversion 4.0 freigegeben werden.)"
http://open-educational-resources.de/bilder-unter-freier-lizenz-nutzen/
Gibt der Urheber aber etwa mittels der Vorlage Credit Line auf Commons oder auf andere eindeutige Weise (z.B. "Als Titel des Werks muss angegeben werden:") einen Titel an, so ist es nicht lizenzkonform, ihn wegzulassen. Eine Abmahnung ist denkbar (aber sehr unwahrscheinlich).
Bei Internettexten, die eine eindeutige Überschrift haben (Zeitschriftenartikel, Blogartikel), ist diese als Titel zu nennen, wenn der Beitrag abgeändert wird (und sei es auch nur in der Überschrift). Wird der Beitrag nicht abgeändert, ist die Überschrift als Bestandteil des Textes ja angegeben.
Soweit Zweifel bestehen, was denn nun der Titel ist, gehen diese Zweifel zu Lasten des Urhebers mit der Konsequenz, dass der Titel nicht zu nennen ist (folgend dem deutschen Rechtsprinzip, dass eine freie Lizenz eine AGB darstellt und Zweifel zu Lasten des Anbieters gehen).
Üblicherweise wird bei Bildern ein Titel nicht genannt und daher auch nicht angegeben. Es bleibt daher bei meinen zwei einfachen Faustregeln:
1. Urheber nennen
2. Lizenz verlinken
Wer sich an sie hält, sollte vor den meisten Abmahnungen gefeit sein.
Vom Ansatz her verdient das Video alle Zustimmung. Es ist gut gemacht und gibt die Rechtslage im wesentlichen korrekt wieder.
Ich selbst habe mich in diesem Blog sehr oft mit dem Thema der lizenzkonformen Nutzung befasst.
Mit
http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%BCbersichtsb
komme ich schnell zu
http://archiv.twoday.net/stories/49598992/
und von da zu
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/
Dort findet sich eine (sicher nicht lückenlose) Beitragsliste.
Ich bestreite, dass die Darstellung des Videos hinsichtlich der Angabe des Titels korrekt ist.
"Sechtens: Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen"
Dazu stelle ich fest:
Die jüngste Version der CC-Lizenzen, also Version 4, enthält diese Verpflichtung nicht mehr:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Via
https://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Detailed_attribution_comparison_chart
Am 13. Oktober 2012 habe ich mich mit der Auslegung der Lizenzforderung "title if supplied" mit Blick auf Bilder beschäftigt.
http://archiv.twoday.net/stories/165211461/
Auch die Praxis erweist meine Ansicht, dass ein Titel ausdrücklich spezifiziert werden muss, um die Forderung nach Titelnennung obligatorisch zu machen, als richtig, denn so wie das Video das interpretiert (Dateinamen als Titel) lizenziert meines Wissens niemand.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
ist zwar keine verpflichtende Richtlinie, gibt aber den entscheidenden Anhaltspunkt: Der Titel ist optional, er muss nur angegeben werden, wenn der Urheber ihn ausdrücklich bezeichnet.
Auf Wikimedia Commons gibt es keinen eindeutigen Titel, der beizubehalten ist, da der Dateiname geändert werden kann (und bei aussagelosen Namen wie dem im Video IMG_6462-6464 auch geändert werden SOLL) und auch die Beschreibung.
Ich wehre mich dagegen, einen Dateinamen als TITEL zu sehen. Eher ist die Beschreibung der Titel.
Gibt es keine eindeutige Entität, die unmissverständlich als Titel anzusprechen ist, kann eine Nennung nicht verlangt werden!
Nach der ganz und gar abzulehenden Rechtsansicht des Videos wäre jede Dateinamenänderung oder jede Änderung der ursprünglichen Beschreibung (je nach dem, was man als Titel ansieht) eine Urheberrechtsverletzung.
Die Checkliste formuliert differenzierter:
"Man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen! Das gilt natürlich nur, wenn ein Titel angegeben ist, wobei strittig ist, ob z.B. „IMG_6464.jpg“ überhaupt ein Titel ist.
(Diese Auflage entfällt bei Werken, die nach der neuesten Lizenzversion 4.0 freigegeben werden.)"
http://open-educational-resources.de/bilder-unter-freier-lizenz-nutzen/
Gibt der Urheber aber etwa mittels der Vorlage Credit Line auf Commons oder auf andere eindeutige Weise (z.B. "Als Titel des Werks muss angegeben werden:") einen Titel an, so ist es nicht lizenzkonform, ihn wegzulassen. Eine Abmahnung ist denkbar (aber sehr unwahrscheinlich).
Bei Internettexten, die eine eindeutige Überschrift haben (Zeitschriftenartikel, Blogartikel), ist diese als Titel zu nennen, wenn der Beitrag abgeändert wird (und sei es auch nur in der Überschrift). Wird der Beitrag nicht abgeändert, ist die Überschrift als Bestandteil des Textes ja angegeben.
Soweit Zweifel bestehen, was denn nun der Titel ist, gehen diese Zweifel zu Lasten des Urhebers mit der Konsequenz, dass der Titel nicht zu nennen ist (folgend dem deutschen Rechtsprinzip, dass eine freie Lizenz eine AGB darstellt und Zweifel zu Lasten des Anbieters gehen).
Üblicherweise wird bei Bildern ein Titel nicht genannt und daher auch nicht angegeben. Es bleibt daher bei meinen zwei einfachen Faustregeln:
1. Urheber nennen
2. Lizenz verlinken
Wer sich an sie hält, sollte vor den meisten Abmahnungen gefeit sein.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 20:19 - Rubrik: Archivrecht
Wie üblich ragen nur wenige Artikel aus der Journaille heraus. Die meisten Berichte zur umstrittenen Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan, siehe etwa
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-erdogan-besteht-auf-entdeckung-amerikas-durch-muslime-a-1003669.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogans-geschichtsverstaendnis-muslimische-seefahrer-sollen-amerika-entdeckt-haben-13269005.html
sehen keine Veranlassung, LeserInnen mit Links eine Überprüfung oder weiterführende Recherchen zu erleichtern. Eine Ausnahme fiel mir auf:
http://www.welt.de/geschichte/article134422444/Wieso-Erdogan-Kolumbus-Entdeckerruhm-abspricht.html
Die WELT wiederum verweist auf einen guten Artikel der Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?hpid=z5
 Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf
Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf
http://lostislamichistory.com/columbus-was-not-the-first-to-cross-the-atlantic/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-erdogan-besteht-auf-entdeckung-amerikas-durch-muslime-a-1003669.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogans-geschichtsverstaendnis-muslimische-seefahrer-sollen-amerika-entdeckt-haben-13269005.html
sehen keine Veranlassung, LeserInnen mit Links eine Überprüfung oder weiterführende Recherchen zu erleichtern. Eine Ausnahme fiel mir auf:
http://www.welt.de/geschichte/article134422444/Wieso-Erdogan-Kolumbus-Entdeckerruhm-abspricht.html
Die WELT wiederum verweist auf einen guten Artikel der Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?hpid=z5
 Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz auf
Karte von Piri Reis 1513, verwertet als Indiz aufhttp://lostislamichistory.com/columbus-was-not-the-first-to-cross-the-atlantic/
"Um Kraus’ Rolle und Wirkung als Vorleser wieder sichtbarer zu machen, stehen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums seiner ersten, berühmten Weltkriegsvorlesung, alle Vorlesungsprogramme in der digitalen Bibliothek zur Verfügung."
http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/1136528
http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/1136528
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 19:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[year]=2014&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[day]=14&tx_ttnews[tt_news]=191&cHash=e0ef8a64f54a2af19030c6946aa25d81
oder mit "Grafs Rasiermesser":
https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=191
oder mit "Grafs Rasiermesser":
https://www.propylaeum.de/altertumswissenschaften/newsbox/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=191
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:54 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:36 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:14 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wisspub.net/2014/11/18/schleswig-holstein-legt-open-access-strategie-vor/
Geplant ist unter anderem ein landesweites OA-Repositorium.
Geplant ist unter anderem ein landesweites OA-Repositorium.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 18:09 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ipetitions.com/petition/worries-about-belgian-hertitage
"Belgiens föderale Wissenschaftseinrichtungen sind mit starken Sparmaßnamen konfrontiert. Diese Institutionen, zu denen wichtige Bewahrer des belgischen kulturellen Erbes, u.a. die Königliche Bibliothek, das Reichsarchiv, die Königlichen Museen für die Schönen Künste von Belgien und das Königliche Institut für das kulturelle Erbe gehören, sind schon seit Jahren unterfinanziert. Die von der neuen Regierung auferlegten Haushaltskürzungen werden es diesen Einrichtungen noch stärker erschweren, ihren Auftrag adäquat zu erfüllen und ihre Sammlungen auf optimale Art und Weise zu betreuen."
Bitte unterschreiben!
Via
http://archiv.twoday.net/stories/1022370782/#1022371196
"Belgiens föderale Wissenschaftseinrichtungen sind mit starken Sparmaßnamen konfrontiert. Diese Institutionen, zu denen wichtige Bewahrer des belgischen kulturellen Erbes, u.a. die Königliche Bibliothek, das Reichsarchiv, die Königlichen Museen für die Schönen Künste von Belgien und das Königliche Institut für das kulturelle Erbe gehören, sind schon seit Jahren unterfinanziert. Die von der neuen Regierung auferlegten Haushaltskürzungen werden es diesen Einrichtungen noch stärker erschweren, ihren Auftrag adäquat zu erfüllen und ihre Sammlungen auf optimale Art und Weise zu betreuen."
Bitte unterschreiben!
Via
http://archiv.twoday.net/stories/1022370782/#1022371196
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt Nico Lumma:
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/kinderschutz/der-murks-mit-dem-jugendschutz-im-internet-38616152.bild.html
Fundierte Informationen von RA Stadler:
http://www.internet-law.de/2014/11/jugendmedienschutz-alter-wein-in-neuen-schlaeuchen.html
Siehe auch
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britischer-Pornofilter-wird-um-Terror-Propaganda-erweitert-2459058.html
"Die voreingestellten Jugendschutzsysteme der vier großen britischen Provider sollen künftig auch terroristisches und extremistisches Material aussortieren. "
Siehe auch
http://irights.info/artikel/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-im-internet/22725#teil3
http://archiv.twoday.net/search?q=jugendschutz
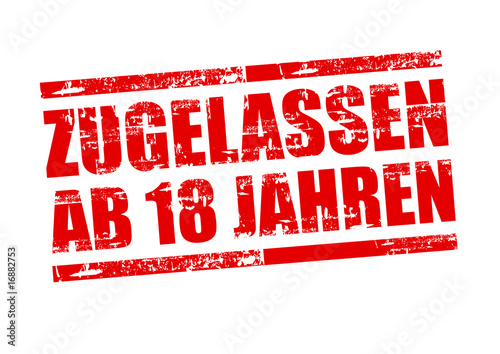
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/kinderschutz/der-murks-mit-dem-jugendschutz-im-internet-38616152.bild.html
Fundierte Informationen von RA Stadler:
http://www.internet-law.de/2014/11/jugendmedienschutz-alter-wein-in-neuen-schlaeuchen.html
Siehe auch
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britischer-Pornofilter-wird-um-Terror-Propaganda-erweitert-2459058.html
"Die voreingestellten Jugendschutzsysteme der vier großen britischen Provider sollen künftig auch terroristisches und extremistisches Material aussortieren. "
Siehe auch
http://irights.info/artikel/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-im-internet/22725#teil3
http://archiv.twoday.net/search?q=jugendschutz
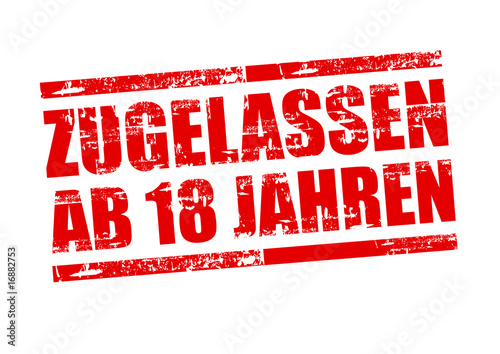
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 17:30 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.oapen.org/search?identifier=496214
Darin u.a.: E. Ketelaar: Prolegomena to a Social History of Dutch Archives
Via Tantner G+.
Darin u.a.: E. Ketelaar: Prolegomena to a Social History of Dutch Archives
Via Tantner G+.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:42 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:36 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zentrale Landesbibliothek hält Studie unter Verschluss. Der Streit um
Neubau und Standort für die Zentrale Landesbibliothek eskaliert. Ein
Studie zur Nutzung der insgesamt 70 Bibliotheksstandorte ist bisher
geheim. Abgeordnete fordern die Veröffentlichung
http://www.morgenpost.de/berlin/article134452098/Zentrale-Landesbibliothek-haelt-Studie-unter-Verschluss.html
Wortprotokoll der Sitzung des Kulturausschusses am 06.10.2014, TOP 2:
Projekt Nutzungsmonitoring für Öffentliche Bibliotheken (NuMoB) –
Ergebnisse der Bevölkerungs- und der Nutzerbefragungen 27.08.2014:
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Kult/protokoll/k17-043-wp.pdf
Via Ingrid Strauch.
Neubau und Standort für die Zentrale Landesbibliothek eskaliert. Ein
Studie zur Nutzung der insgesamt 70 Bibliotheksstandorte ist bisher
geheim. Abgeordnete fordern die Veröffentlichung
http://www.morgenpost.de/berlin/article134452098/Zentrale-Landesbibliothek-haelt-Studie-unter-Verschluss.html
Wortprotokoll der Sitzung des Kulturausschusses am 06.10.2014, TOP 2:
Projekt Nutzungsmonitoring für Öffentliche Bibliotheken (NuMoB) –
Ergebnisse der Bevölkerungs- und der Nutzerbefragungen 27.08.2014:
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Kult/protokoll/k17-043-wp.pdf
Via Ingrid Strauch.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2014, 16:14 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:38 - Rubrik: Museumswesen
DENICOLO, BARBARA: „Essen, Trinken und Kleidung am Hof Friedrichs IV. von Tirol 1413-1436". Geschichtswissenschaftliche Diplomarbeit, Innsbruck 2013. Die Innsbrucker Diplom-Arbeit ist online abrufbar unter
https://www.academia.edu/2487666/Essen_Trinken_und_Kleidung_am_Hof_Friedrich_IV._von_Tirol_1413-1436
https://www.academia.edu/2487666/Essen_Trinken_und_Kleidung_am_Hof_Friedrich_IV._von_Tirol_1413-1436
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Sehr geehrte Damen und Herren,
heute feiert das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv seinen zehnten Jahrestag und eine einzigartige Erfolgsstory: Was unerschrockenes bürgerschaftliches Engagement ohne einen Cent öffentlicher Unterstützung bewirken kann – das beweist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv, das 2014 als Wirtschaftsarchiv des Jahres ausgezeichnet wurde.
Mit hohem Engagement betreibt das Wirtschaftsarchiv seine Bildungsarbeit in Kooperation mit Universitäten, Fachhochschulen, Oberstufenzentren, freien Bildungsträgern und Schulen und erfüllt seinen Auftrag, notwendige Quellen der Wirtschaftsgeschichte als Teil der Gesellschafts- und Stadtgeschichte zu sichern. Das "Gedächtnis der Berliner und Brandenburger Wirtschaft" ist eines von zehn Regionalen Wirtschaftsarchiven in Deutschland.
Der Empfang findet heute, am 17.11.2014, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Wirtschaftsarchivs statt.
Wir würden uns über Ihre Berichterstattung freuen.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Björn Berghausen
Geschäftsführer
--
Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.
Eichborndamm 167
Haus 42
13403 Berlin
Telefon 030 411 90 698
Telefax 030 411 90 699
mail@bb-wa.de
www.bb-wa.de
Besuchen Sie unser Online-Magazin: www.archivspiegel.de "
Schön und gut, aber wieso steht auf der Startseite des Online-Magazins keine Silbe davon?
heute feiert das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv seinen zehnten Jahrestag und eine einzigartige Erfolgsstory: Was unerschrockenes bürgerschaftliches Engagement ohne einen Cent öffentlicher Unterstützung bewirken kann – das beweist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv, das 2014 als Wirtschaftsarchiv des Jahres ausgezeichnet wurde.
Mit hohem Engagement betreibt das Wirtschaftsarchiv seine Bildungsarbeit in Kooperation mit Universitäten, Fachhochschulen, Oberstufenzentren, freien Bildungsträgern und Schulen und erfüllt seinen Auftrag, notwendige Quellen der Wirtschaftsgeschichte als Teil der Gesellschafts- und Stadtgeschichte zu sichern. Das "Gedächtnis der Berliner und Brandenburger Wirtschaft" ist eines von zehn Regionalen Wirtschaftsarchiven in Deutschland.
Der Empfang findet heute, am 17.11.2014, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Wirtschaftsarchivs statt.
Wir würden uns über Ihre Berichterstattung freuen.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Björn Berghausen
Geschäftsführer
--
Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.
Eichborndamm 167
Haus 42
13403 Berlin
Telefon 030 411 90 698
Telefax 030 411 90 699
mail@bb-wa.de
www.bb-wa.de
Besuchen Sie unser Online-Magazin: www.archivspiegel.de "
Schön und gut, aber wieso steht auf der Startseite des Online-Magazins keine Silbe davon?
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:32 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
Wussten Sie schon, dass es in Schweden das Grab einer Staufer-Witwe gibt?
http://www.stauferstelen.net/texts/staufergraeber.htm
http://www.stauferstelen.net/texts/staufergraeber.htm
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://wiki.dnb.de/display/che
Siehe auch die Infoveranstaltung des Bundesarchivs dazu:
http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/informationstechnologie/digitalisiertesarchivgut/programm_24_11_internet.pdf
Siehe auch die Infoveranstaltung des Bundesarchivs dazu:
http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/informationstechnologie/digitalisiertesarchivgut/programm_24_11_internet.pdf
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:21 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ungleichbehandlung eines Nutzers ist im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz nicht vorgesehen (siehe § 11
http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html in Verbindung mit dem Schricker-Kommentar). Das Patentamt sollte daher der VG Media entschieden auf die Finger klopfen, die zwar Google eine Gratislizenz gewährt, nicht aber kleineren Anbietern.
http://schmalenstroer.net/blog/2014/11/keine-antwort/
http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html in Verbindung mit dem Schricker-Kommentar). Das Patentamt sollte daher der VG Media entschieden auf die Finger klopfen, die zwar Google eine Gratislizenz gewährt, nicht aber kleineren Anbietern.
http://schmalenstroer.net/blog/2014/11/keine-antwort/
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:15 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:12 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.politische-bildung.de/100_jahre_erster_weltkrieg.html
Hierher passt auch
Der Erste Weltkrieg in Westfalen - Ausgewählte Archivquellen
http://beruf.hypotheses.org/58
Hierher passt auch
Der Erste Weltkrieg in Westfalen - Ausgewählte Archivquellen
http://beruf.hypotheses.org/58
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:09 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Melchior ist mit der jüngsten Verschärfung des StGB gar nicht einverstanden:
http://ra-melchior.blog.de/2014/11/14/gesetzgeberischer-muell-19708785/
http://ra-melchior.blog.de/2014/11/14/gesetzgeberischer-muell-19708785/
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:05 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/raritaet-entdeckt-koranhandschrift-stammt-aus-der-fruehzeit-des-islam.html
Die dumme Journaille verlinkt natürlich nicht auf diese ausgezeichnete Pressemitteilung.
Die dumme Journaille verlinkt natürlich nicht auf diese ausgezeichnete Pressemitteilung.
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:03 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.antihus.eu/search.php
Zu den 250 Werken ist auch die handschriftliche Überlieferung angegeben.
Zu den 250 Werken ist auch die handschriftliche Überlieferung angegeben.
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 23:01 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. November 2014, 22:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nun ist lieferbar
Gudrun Fiedler / Susanne Rappe-Weber / Detlef Siegfried (Hg.)
Sammeln – erschließen – vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv
Mit 30 Abbildungen (V&R unipress ISBN 978-3-8471-0340-0, 39,90 EUR)
Das Buch ist der Tagungsband zur 2013er Tagung der Burg Ludwigstein (mehr dazu auf http://archiv.twoday.net/stories/581437145/), bzw. hier der Tagungsbericht auf HsozKult
Gudrun Fiedler / Susanne Rappe-Weber / Detlef Siegfried (Hg.)
Sammeln – erschließen – vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv
Mit 30 Abbildungen (V&R unipress ISBN 978-3-8471-0340-0, 39,90 EUR)
Das Buch ist der Tagungsband zur 2013er Tagung der Burg Ludwigstein (mehr dazu auf http://archiv.twoday.net/stories/581437145/), bzw. hier der Tagungsbericht auf HsozKult
Bernd Hüttner - am Montag, 17. November 2014, 21:49 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://log.netbib.de/archives/2014/11/14/ipl-internet-public-library-wird-ende-des-jahres-eingestellt/
Zum Thema siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/1016309007/
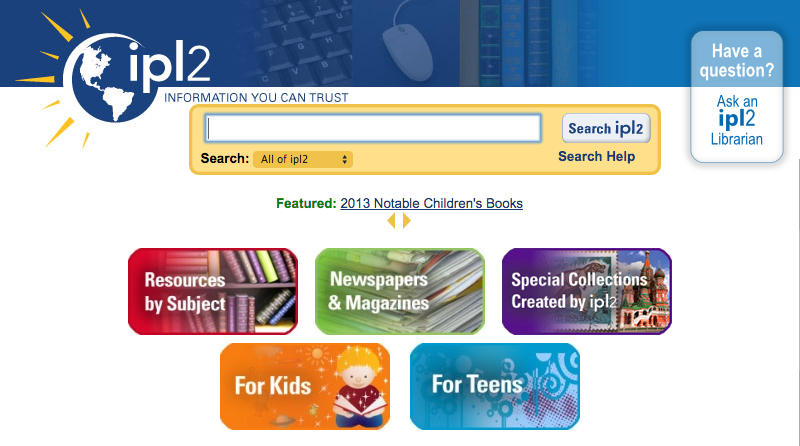
Zum Thema siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/1016309007/
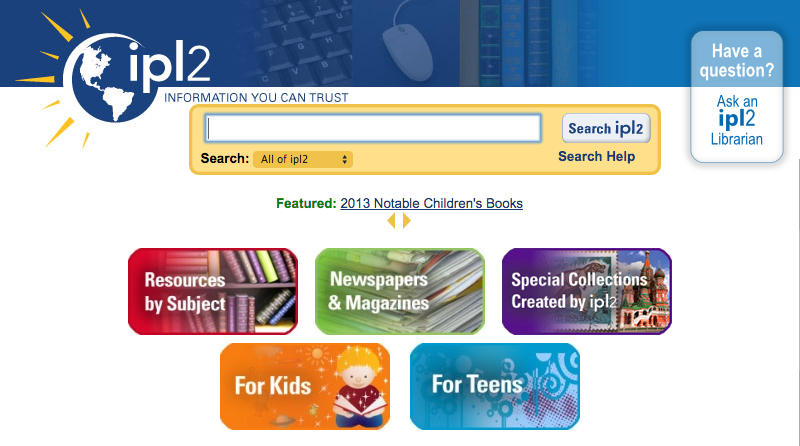
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:12 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2014/11/14/defending-belgiums-cultural-heritage/
"Last week many media published the news about a drastic cut in the budgets of major cultural institutions in Belgium. in particular federal institutions such as the Bibliothèque Royale Albert I in Brussels and the Archives de l’État en Belgique, also in Brussels, face next year a loss of 20 percent of their yearly budget. I use here the French name of both institutions, but in particular on the website of the Belgian National archives you can immediately gauge the multilingual character of Belgian society. Belgium can be roughly divided in three parts, Flanders, Wallonie and the central region in and around Brussels, Belgium’s capital. The German-speaking minority in the region along the German border has in principle the same rights as the Flemish and Wallon communities.
An online petition has been launched to give the protest against these plans a loud and clear voice, and I cordially invite you to share your concern about these proposals by signing this petition. "
PLEASE SIGN!
"Last week many media published the news about a drastic cut in the budgets of major cultural institutions in Belgium. in particular federal institutions such as the Bibliothèque Royale Albert I in Brussels and the Archives de l’État en Belgique, also in Brussels, face next year a loss of 20 percent of their yearly budget. I use here the French name of both institutions, but in particular on the website of the Belgian National archives you can immediately gauge the multilingual character of Belgian society. Belgium can be roughly divided in three parts, Flanders, Wallonie and the central region in and around Brussels, Belgium’s capital. The German-speaking minority in the region along the German border has in principle the same rights as the Flemish and Wallon communities.
An online petition has been launched to give the protest against these plans a loud and clear voice, and I cordially invite you to share your concern about these proposals by signing this petition. "
PLEASE SIGN!
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:06 - Rubrik: English Corner
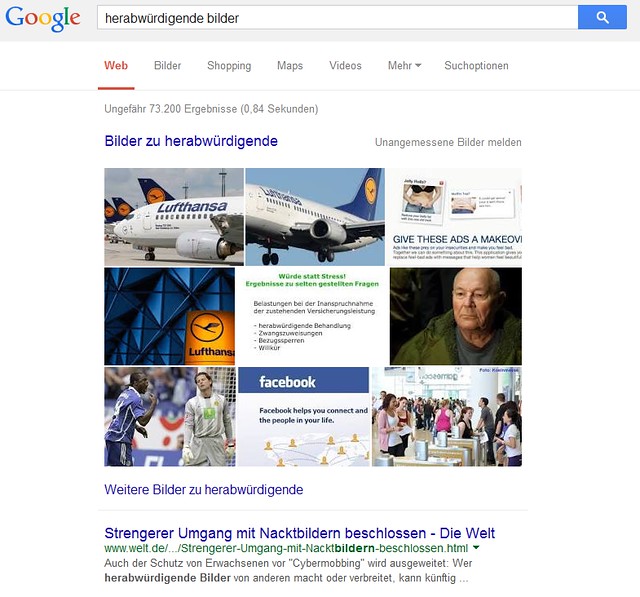
http://www.welt.de/newsticker/news1/article134328160/Bundestag-verabschiedet-schaerferes-Sexualstrafrecht.html
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 22:00 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://heise.de/-2445295
"Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich in einer jetzt veröffentlichten Begründung eines Urteils vom Juli (Az.: 2-03 S 2/14) näher mit der Funktionsweise des Share-Buttons von Facebook auseinandergesetzt. Wer als Webseitenbetreiber eine solche Schaltfläche zur Verfügung stellt, räumt Mitgliedern des Netzwerks damit eingeschränkte Nutzungsrechte an Inhalten des eigenen Angebots ein.
Die erteilte Lizenz umfasst demnach die Überschrift des verlinkten Artikels einschließlich der Quelle, den eigentlichen Verweis, einen "Kurztext" als Anreißer sowie gegebenenfalls ein Miniaturbild. Allein der Umstand, dass der Nutzer theoretisch den Ankündigungstext erweitern könne, führe hingegen nicht dazu, dass ihm automatisch Lizenzrechte erteilt würden.
Das Landgericht gab damit in letzter Instanz einer Klägerin Recht, die ein Facebook-Mitglied wegen Übernahme ihres gesamten Textes im Rahmen eines geteilten Links wegen Urheberrechtsverletzung abmahnen ließ."
Via
http://www.urheberrecht.org/news/5284/
"Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich in einer jetzt veröffentlichten Begründung eines Urteils vom Juli (Az.: 2-03 S 2/14) näher mit der Funktionsweise des Share-Buttons von Facebook auseinandergesetzt. Wer als Webseitenbetreiber eine solche Schaltfläche zur Verfügung stellt, räumt Mitgliedern des Netzwerks damit eingeschränkte Nutzungsrechte an Inhalten des eigenen Angebots ein.
Die erteilte Lizenz umfasst demnach die Überschrift des verlinkten Artikels einschließlich der Quelle, den eigentlichen Verweis, einen "Kurztext" als Anreißer sowie gegebenenfalls ein Miniaturbild. Allein der Umstand, dass der Nutzer theoretisch den Ankündigungstext erweitern könne, führe hingegen nicht dazu, dass ihm automatisch Lizenzrechte erteilt würden.
Das Landgericht gab damit in letzter Instanz einer Klägerin Recht, die ein Facebook-Mitglied wegen Übernahme ihres gesamten Textes im Rahmen eines geteilten Links wegen Urheberrechtsverletzung abmahnen ließ."
Via
http://www.urheberrecht.org/news/5284/
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:50 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Schlosskapelle Possenhofen
http://archiv.twoday.net/stories/615267997/
gibt es Neues:
http://jusatpublicum.wordpress.com/2014/11/14/in-aller-schlossherrenmanier-da-quietscht-das-scharnier-in-der-posse-um-ein-nutzungsrecht/
http://archiv.twoday.net/stories/615267997/
gibt es Neues:
http://jusatpublicum.wordpress.com/2014/11/14/in-aller-schlossherrenmanier-da-quietscht-das-scharnier-in-der-posse-um-ein-nutzungsrecht/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:41 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitale Werk-Auszüge für die Lehre bleiben erlaubt, meldet
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/digitale-werk-auszuge-fur-die-lehre.html
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/digitale-werk-auszuge-fur-die-lehre.html
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:39 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fu-berlin.de/sites/open_access/Veranstaltungen/oa_berlin/poster/OA-Empfehlung-SPK_Hanns-Peter-Frentz-Susanne-Maier_SPK.pdf
In der Sache falsch und absolut unverständlich.
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/empfehlung-der-stiftung-preuischer.html
In der Sache falsch und absolut unverständlich.
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/11/empfehlung-der-stiftung-preuischer.html
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 21:18 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
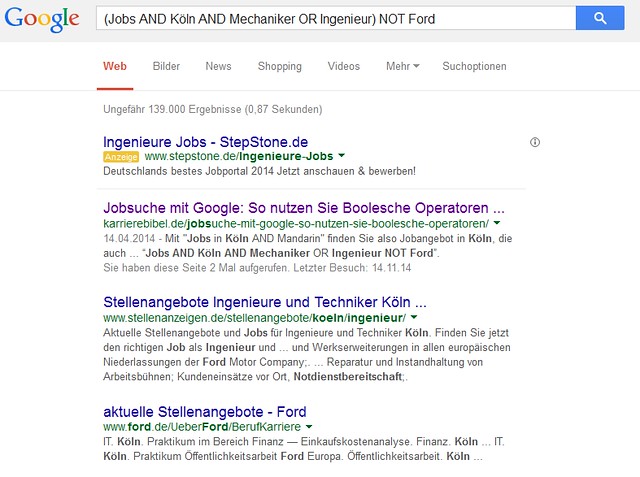
Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/1022370527/#1022370717
https://support.google.com/vault/answer/2474474?hl=en
jobs NOT ford erbringt Ergebnisse mit Ford unter den ersten Treffern!
"The query NOT secret returns all items that do not contain the word secret."
Kann jeder ausprobieren, dass das nicht stimmt ...
Es wird beteuert, dass keine unersetzlichen Handexemplare darunter sind.
https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1411/pm_141114_00
Die WELT hatte anderes gemeldet:
http://www.welt.de/vermischtes/article134296453/Unterm-Dach-da-wo-die-teuren-Buecher-schimmeln.html
In einer E-Mail heißt es, "es seien wertvolle und wertvollste Bücher dort oben, unter anderem Handexemplare mit Anmerkungen zum Beispiel von Philipp Heck und Liszt".
https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1411/pm_141114_00
Die WELT hatte anderes gemeldet:
http://www.welt.de/vermischtes/article134296453/Unterm-Dach-da-wo-die-teuren-Buecher-schimmeln.html
In einer E-Mail heißt es, "es seien wertvolle und wertvollste Bücher dort oben, unter anderem Handexemplare mit Anmerkungen zum Beispiel von Philipp Heck und Liszt".
Auf Twitter weist mich @FrueheNeuzeit hin auf:
http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/sued/spielbank-hohensyburg-zerstoert-max-bill-skulptur-wegen-umbau-id10038454.html
"Vor Jahren schuf der Schweizer Bildhauer Max Bill eine Edelstahl-Plastik eigens für das Foyer der Spielbank Hohensyburg. Jetzt wurde bekannt: Das Casino hat die riesige Skulptur vor einigen Jahren für den Brandschutz-Umbau zerlegt - und damit zerstört. Der Sohn des Künstlers ist entsetzt."
http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/sued/spielbank-hohensyburg-zerstoert-max-bill-skulptur-wegen-umbau-id10038454.html
"Vor Jahren schuf der Schweizer Bildhauer Max Bill eine Edelstahl-Plastik eigens für das Foyer der Spielbank Hohensyburg. Jetzt wurde bekannt: Das Casino hat die riesige Skulptur vor einigen Jahren für den Brandschutz-Umbau zerlegt - und damit zerstört. Der Sohn des Künstlers ist entsetzt."
Bevor ich mich ans Testen mache, möchte ich vor dem besonders inkompetenten Tutorium (2014!) des hochinnovativen eStudies-Angebots warnen:
http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-recherche/fakten-suchen/suchinstrumente/metasuchmaschinen/
Wie man sich bei metacrawler.de leicht überzeugen kann, ist Metacrawler nur noch Schrott. Metacrawler.de erhielt jeweils null Punkte, wobei es jedesmal nur Spam als Treffer produzierte (daher nicht gelistet). Metacrawler.com mag zwar die älteste Metasuchmaschine sein, heißt aber jetzt trotzdem zoo.com.
Frühere Tests - siehe zuletzt -
http://archiv.twoday.net/stories/714908537/
lieferten die Auswahl der Metasuchmaschinen. Erstmals getestet wurde metascroll.com.
Es sollte gemäß http://archiv.twoday.net/stories/1022370527 jeweils die Dissertation von Burckhardt gefunden werden. Unter den ersten 5: 5 Punkte, 6-10: 4. 1 Punkt gab es, wenn der Link auf den Konstanzer Server ins Leer führte, was bei Oneseek und Ixquick der Fall war. Diese hatten bei jeder der vier Aufgaben nur schlechte Chancen.
Aufgabe 1:
parigger hexe zeil dissertation
Aufgabe 2:
parigger hexe zeil vgl
Aufgabe 3:
hexe zeil parigger behringer
Aufgabe 4:
hexe zeil parigger pleticha
Ergebnisse:
Google 5-4-4-5=18
Bing 0-0-0-0=0
Metasuchmaschinen:
Metager3 5-5-0-5=15
etools.ch 5-5-0-5=15
info.com 5-5-0-5=15
metascroll.com 5-0-0-5=10
webcrawler.com 0-5-0-0=5
Oneseek.de 1-1-0-1=3
Ixquick 1-1-0-0=2
Metager schnitt diesmal recht gut ab, etools.ch schnitt schon bei früheren Tests gut ab. Außer Konkurrenz, aber unverzichtbar: Google an der Spitze.
Merkwürdig ist, dass die Zitatsuche der Aufgabe 3 nur von Google bewältigt wurde, während die identische Zitatsuche nach einem in der Arbeit erwähnten einflussreichen Jugendbuch-Forscher (Pleticha) meist gut bewältigt wurde.
http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-recherche/fakten-suchen/suchinstrumente/metasuchmaschinen/
Wie man sich bei metacrawler.de leicht überzeugen kann, ist Metacrawler nur noch Schrott. Metacrawler.de erhielt jeweils null Punkte, wobei es jedesmal nur Spam als Treffer produzierte (daher nicht gelistet). Metacrawler.com mag zwar die älteste Metasuchmaschine sein, heißt aber jetzt trotzdem zoo.com.
Frühere Tests - siehe zuletzt -
http://archiv.twoday.net/stories/714908537/
lieferten die Auswahl der Metasuchmaschinen. Erstmals getestet wurde metascroll.com.
Es sollte gemäß http://archiv.twoday.net/stories/1022370527 jeweils die Dissertation von Burckhardt gefunden werden. Unter den ersten 5: 5 Punkte, 6-10: 4. 1 Punkt gab es, wenn der Link auf den Konstanzer Server ins Leer führte, was bei Oneseek und Ixquick der Fall war. Diese hatten bei jeder der vier Aufgaben nur schlechte Chancen.
Aufgabe 1:
parigger hexe zeil dissertation
Aufgabe 2:
parigger hexe zeil vgl
Aufgabe 3:
hexe zeil parigger behringer
Aufgabe 4:
hexe zeil parigger pleticha
Ergebnisse:
Google 5-4-4-5=18
Bing 0-0-0-0=0
Metasuchmaschinen:
Metager3 5-5-0-5=15
etools.ch 5-5-0-5=15
info.com 5-5-0-5=15
metascroll.com 5-0-0-5=10
webcrawler.com 0-5-0-0=5
Oneseek.de 1-1-0-1=3
Ixquick 1-1-0-0=2
Metager schnitt diesmal recht gut ab, etools.ch schnitt schon bei früheren Tests gut ab. Außer Konkurrenz, aber unverzichtbar: Google an der Spitze.
Merkwürdig ist, dass die Zitatsuche der Aufgabe 3 nur von Google bewältigt wurde, während die identische Zitatsuche nach einem in der Arbeit erwähnten einflussreichen Jugendbuch-Forscher (Pleticha) meist gut bewältigt wurde.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu den Gerüchten über Personalabbau im Stadtarchiv Essen:
http://www.pressemeldung-nrw.de/essen-historisches-erbe-pflegen-kein-stellenabbau-im-stadtarchiv-99583/
http://www.pressemeldung-nrw.de/essen-historisches-erbe-pflegen-kein-stellenabbau-im-stadtarchiv-99583/
ingobobingo - am Freitag, 14. November 2014, 15:50 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Abseits der großen Namen - der "big five": Andreas von Regensburg, Ebran, Füetrer, Arnpeck und Aventin - gibt es auf dem Feld der Erforschung der spätmittelalterlichen bayerischen Geschichtsschreibung mitunter erhebliche Forschungslücken. Auch hat man manchmal den Eindruck, dass im 19. Jahrhundert eher Unwichtiges ediert wurde, während Wichtiges unbeachtet blieb. So verhält es sich im Fall des Wittelsbacher-Hausstifts Indersdorf, eines im 12. Jahrhundert gegründeten regulierten Chorherrenstifts, das nach dem Anschluss an die Raudnitzer Reform ( um1417?) zu einem Mittelpunkt der Ordensreform in Bayern wurde. [1]
Da es mir nicht möglich war, die Indersdorfer Amtsbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv einzusehen, kann ich nicht für mich in Anspruch zu nehmen, dass meine aus der mir online oder gedruckt zugänglichen Literatur erstellten Notizen ein zuverlässiges Bild der Indersdorfer Geschichtsschreibung präsentieren. Sie sollen dazu ermuntern, die historiographischen Primärquellen endlich einmal genauer zu untersuchen. Eine Anfrage bei dem wohl besten Kenner der Stiftsgeschichte, Professor Wilhelm Liebhart, blieb erfolglos. [2]
1. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 1
Eine moderne Beschreibung dieser wichtigen Handschrift existiert nicht. Wenig ergiebig ist der Eintrag in: Die Zeit der frühen Herzöge. Katalog (1980), S. 42 Nr. 49: Lit. 1, Pergamenths., im 15. Jh. angelegt: “Den Kern bilden Beiträge zu einer Stiftschronik, Verzeichnisse von Schenkungen und Nekrologe”. Dagegen datiert Müller [3]: 13.-15. Jh. Etwas ausführlicher charakterisierte den Band Graf Hundt [4].
Historiographische Notizen aus dem Band edierte Philipp Jaffé 1861 als "Annales et Notae Undersdorfenses" (MGH SS 17, S. 332f.) [5]. Von zwei Händen des 15. Jahrhunderts auf den Hinterdeckel geschrieben, betreffen die "Annales" die Jahre 1180-1322, 1472. Als "Notae" wurde eine Auswahl von lokalgeschichtlichen Notizen am Rand des Nekrologs abgedruckt: 1173, 1430-1483. Die "Geschichtsquellen" dekretieren (ohne dass dies ihre Aufgabe wäre): "inhaltlich wenig bedeutend" [6].
Interessanter erscheint jedenfalls die lateinische Fundatio ab Bl. 72v, die Moeglin 1985 im Kontext seiner Studien zur Wittelbacher- Genealogie analysierte und in die 1430er Jahre datierte [7]: "sciendum de fundatore nostri monasterii Undensdorff sicut quod in diversis principum cronicum legitur" (zitiert nach Moeglin S. 101).
Im Cgm 735, einer 1472/82 entstandenen Handschrift des Augsburger Berufsschreibers Konrad Bollstatter, fand Moeglin eine deutschsprachige Version der Indersdorfer Fundatio, eine "Tafel von Oberwittelsbach", die er als Quelle für Veit Arnpeck erweisen konnte. [8]
Erwähnt sei noch, dass nach Hundt die Reihe der Pröpste "cum eorum gestis" mit dem Tod Ulrichs IV. Schirm 1479 endet. Virgil Redlich hat die Indersdorfer Chronik in dieser Handschrift für die Vita des nach Tegernsee übergetrenen Bernhard Waging herangezogen (Bl. 62r und folgende) [9].
2. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 4
In dieser Handschrift befindet sich nach Fürbeth [10] um Blatt 10 eine auf drei Blättern eingetragene kurze lateinische Chronik über die Rolle Indersdorfs in den Klosterreformen Herzog Albrechts III.
Wilhelm Liebhart druckte aus KL 4 in der Heimatzeitschrift Amperland 1982 einen kurzen, von ihm um 1460 datierten deutschsprachigen Bericht über die Anfänge der Wallfahrtskapelle Rothschwaige ab [11].
3. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 7
Aus dieser Handschrift Bl. 18v-20r stammt der kostbare deutsche Bericht über den Reformer Johannes von Indersdorf (gestorben 1470 [12]), den Bernhard Haage 1969 edierte (Wiederabdruck danach bei Haberkern 1997, S. 214-217) [13]. Beide haben nicht im mindesten beachtet, was damals bereits als selbstverständlich gelten musste: Dass man eine Quelle, aus der man einen Auszug veröffentlicht, mit ihren Grunddaten präsentiert. Liebhart spricht in seinem bereits genannten Heimatzeitschriften-Aufsatz mit Blick auf KL 7 von einer 1516 vollendeten Klosterchronik (Anm. 14). Gern wüsste man Näheres über den Überlieferungszusammenhang des Berichts.
Die von einem Vertrauten Johanns verfasste Vita ist als deutschsprachiger literarischer Reflex der Ordensreform wertvoll, wurde aber bisher nur als Faktensteinbruch zum Leben Johanns genutzt. Ihre quasi-hagiographische Stilisierung wurde bislang nicht beachtet.
4. Weitere Klosterliteralien
1982 nannte Liebhart in einem Übersichtsartikel im Amperland [14] als Quellen zur Geschichtsschreibung des Klosters die Klosterliteralien 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 - ohne weitere Angaben. In seinem kaum aufgrund von Autopsie gearbeiteten, wenig erhellenden Artikel zu den lateinischen Indersdorfer Handschriften nennt Haberkern auch fünf Klosterliteralien als "Handschriften" (die römische Ziffer bezeichnet offenkundig die Datierung) [15]:
1 XIII/XVI
2 Kalendar XIV
4 Chronik XV
5 Kalendar XV
146 Statuta XV
5. Indersdorfer Kopialbuch, München, Staatsbibliothek, Cgm 1515
Die kurzen historischen Notizen aus dem in das zweite Viertel des 15. Jahrhundert zu datierenden Amtsbuch Bl. 6v-9ra hat Karin Schneider 1991 knapp charakterisiert. [16] Von ihr erfährt man, anders als bei den bisher genannten Autoren, tatsächlich, was es sich über die Handschrift zu wissen lohnt. Nicht anders ist eine Beschreibung der archivisch verwahrten Amtsbücher zu wünschen.
6. Sammelband, München, Staatsbibliothek, Cgm 5482
Eine umsichtige Beschreibung legte 2009 Elisabeth Wunderle vor [17]. Der Codex, der hinsichtlich des Indersdorfer Teils aus dem dritten Viertel des 15. Jahrhunderts stammt, ist online (Link verweist auf den Beginn des Indersdorfer Teils):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008862/image_54
Die Fundationes der Klöster stehen der Chronik Veit Arnpecks nahe [18]. Sie fehlen im Aufsatz zu den Fundationes monasteriorum Bavariae, den Alois Schmid 1987 vorlegte. Allerdings nicht ganz, denn der von Hundt 1862 erwähnte Sammelband im Reichsarchiv, den Schmid für "nicht auffindbar" hielt [19], ist kein anderer als der früher im Reichsarchiv befindliche Cgm 5482!
***
ANMERKUNGEN
[1] Siehe den geschichtlichen Überblick
http://www.hdbg.eu/kloster/web/index.php/detail?id=KS0153
und den Abriss der Klostergeschichte bei Ernst Haberkern: Funken aus alter Glut. Johannes von Indersdorf: Von dreierlei Wesen der Menschen (1997), S. 235-273.
Kritisch zum Datum 1417 siehe Horst Miekisch: Das Augustinerchorherrenstift Neunkirchen am Brand. Diss. Bamberg 2006, S. 165 Anm. 851.
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:473-opus-929
Online ist die barocke Darstellung der Stiftsgeschichte von Gelasius Morhart 1762:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11083252-5
[2] Mit Mail vom 7. August 2014 teilte Liebhart, dem ich meine kleine Sammlung übermittelt hatte, mit, seine Forschungen lägen auf Eis. Er machte nur auf die für die Geschichtsschreibung durchaus irrelevanten Titel von Brinkhus und Haberkern (Monographie 1997 und Auszug daraus im Katalog Das Augustinerchorherrenstift Indersdorf, 2000) aufmerksam. Vor allem die Empfehlung des von mir käuflich erworbenen Buchs von Haberkern hätte er sich sparen können. Haberkern trägt kaum etwas Substantielles zur Forschung über Johannes von Indersdorf bei und arbeitet zu gern aus zweiter Hand.
[3] Michael Müller: Die Annalen und Chroniken im Herzogtum Bayern 1250-1314 (1983), S. 244.
[4] Urkunden des Klosters Indersdorf 1 (1863), S. XXf.
http://books.google.de/books?id=qSA3AAAAYAAJ&pg=PR20
und etwas ausführlicher in der Schrift über das Kloster Scheyern 1862, S. 48f.
http://books.google.de/books?id=Vj9UAAAAcAAJ&pg=PA48
[5] http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_17_S._332
[6] http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00437.html
[7] Jean-Marie Moeglin: Les Ancêtres du Prince (1985), S. 101-105, 268
[8] Beschreibung Karin Schneiders:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a189_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/6357
[9] Virgil Redlich: Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert (1931), S. 113, 137.
[10] Frank Fürbeth: Johannes Hartlieb (1992), S. 17. Auszug:
http://books.google.de/books?id=X-AZmEqwvdoC&pg=PA17
Haberkern 1997, S. 255 Anm. 702 bezieht sich auf Bl. 10-11 (fälschlich als "Urkunde" bezeichnet) von KL 4. Meist zitiert er Primärquellen aus zweiter Hand, so wohl auch hier, aber an der angegebenen Stelle bei Riezler Bd. 3, S. 828 steht nichts, was Haberkerns Angaben zu KL 4 belegen könnte:
https://archive.org/stream/RiezlerGeschichteBaiernsBd3/Riezler%20Geschichte_Baierns_Bd_3#page/n823/mode/2up
[11] http://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=620
[12] GND:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119441721
[13] Bernhard Haage: Johannes von Indersdorf in der zeitgenössischen Chronik seines Klosters. In: Leuvense Bijdragen 58 (1969), S. 169-174. Der gemeinfreie Text S. 170-174 steht online zur Verfügung:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haage_indersdorf_gekuerzt.pdf
Miekisch S. 164 gibt ein längeres Zitat aus der Handschrift leicht abweichend wieder.
Bernhard Haage: Der Traktat 'Von dreierlei Wesen der Menschen', Diss. Heidelberg 1968, S. 101 erwähnte die Lebensbeschreibung unter Bezugnahme auf die mir gerade nicht zugängliche Freiburger Dissertation von Eugen Gehr (Die Fürstenlehren ... 1926, S. 49).
[14] http://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=595
[15] Ernst Haberkern: Die lateinischen Handschriften des Augustiner-Chorherrenstifts Indersdorf. Ein Gang durch eine mittelalterliche Bibliothek. In: Mittellateinisches Jahrbuch 38 (2003), S. 51-88, hier S. 66 Anm. 20.
[16] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0189_a193_JPG.htm
[17] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-BSB-cgm-pdfs/Cgm%205482.pdf
[18] Veit Arnpeck: Sämtliche Chroniken. Hrsg. von Georg Leidinger (1915), S. 195 zu Indersdorf:
https://archive.org/stream/VeitArnpeckSaemtlicheChroniken#page/n335/mode/2up
[19] In: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (1987), S. 591 mit Anm. 74.
Nachtrag von Herrn Liebhart (Mail 4.12.2014): "Nachtrag zur frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung mit Rückgriffen:
Peter Dorner: Indersdorfer Chronik (Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim 5). Paring 2003.
ISBN 3-936197-01-6 "
#forschung

Da es mir nicht möglich war, die Indersdorfer Amtsbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv einzusehen, kann ich nicht für mich in Anspruch zu nehmen, dass meine aus der mir online oder gedruckt zugänglichen Literatur erstellten Notizen ein zuverlässiges Bild der Indersdorfer Geschichtsschreibung präsentieren. Sie sollen dazu ermuntern, die historiographischen Primärquellen endlich einmal genauer zu untersuchen. Eine Anfrage bei dem wohl besten Kenner der Stiftsgeschichte, Professor Wilhelm Liebhart, blieb erfolglos. [2]
1. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 1
Eine moderne Beschreibung dieser wichtigen Handschrift existiert nicht. Wenig ergiebig ist der Eintrag in: Die Zeit der frühen Herzöge. Katalog (1980), S. 42 Nr. 49: Lit. 1, Pergamenths., im 15. Jh. angelegt: “Den Kern bilden Beiträge zu einer Stiftschronik, Verzeichnisse von Schenkungen und Nekrologe”. Dagegen datiert Müller [3]: 13.-15. Jh. Etwas ausführlicher charakterisierte den Band Graf Hundt [4].
Historiographische Notizen aus dem Band edierte Philipp Jaffé 1861 als "Annales et Notae Undersdorfenses" (MGH SS 17, S. 332f.) [5]. Von zwei Händen des 15. Jahrhunderts auf den Hinterdeckel geschrieben, betreffen die "Annales" die Jahre 1180-1322, 1472. Als "Notae" wurde eine Auswahl von lokalgeschichtlichen Notizen am Rand des Nekrologs abgedruckt: 1173, 1430-1483. Die "Geschichtsquellen" dekretieren (ohne dass dies ihre Aufgabe wäre): "inhaltlich wenig bedeutend" [6].
Interessanter erscheint jedenfalls die lateinische Fundatio ab Bl. 72v, die Moeglin 1985 im Kontext seiner Studien zur Wittelbacher- Genealogie analysierte und in die 1430er Jahre datierte [7]: "sciendum de fundatore nostri monasterii Undensdorff sicut quod in diversis principum cronicum legitur" (zitiert nach Moeglin S. 101).
Im Cgm 735, einer 1472/82 entstandenen Handschrift des Augsburger Berufsschreibers Konrad Bollstatter, fand Moeglin eine deutschsprachige Version der Indersdorfer Fundatio, eine "Tafel von Oberwittelsbach", die er als Quelle für Veit Arnpeck erweisen konnte. [8]
Erwähnt sei noch, dass nach Hundt die Reihe der Pröpste "cum eorum gestis" mit dem Tod Ulrichs IV. Schirm 1479 endet. Virgil Redlich hat die Indersdorfer Chronik in dieser Handschrift für die Vita des nach Tegernsee übergetrenen Bernhard Waging herangezogen (Bl. 62r und folgende) [9].
2. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 4
In dieser Handschrift befindet sich nach Fürbeth [10] um Blatt 10 eine auf drei Blättern eingetragene kurze lateinische Chronik über die Rolle Indersdorfs in den Klosterreformen Herzog Albrechts III.
Wilhelm Liebhart druckte aus KL 4 in der Heimatzeitschrift Amperland 1982 einen kurzen, von ihm um 1460 datierten deutschsprachigen Bericht über die Anfänge der Wallfahrtskapelle Rothschwaige ab [11].
3. München, Hauptstaatsarchiv, Klosterliteralien Indersdorf 7
Aus dieser Handschrift Bl. 18v-20r stammt der kostbare deutsche Bericht über den Reformer Johannes von Indersdorf (gestorben 1470 [12]), den Bernhard Haage 1969 edierte (Wiederabdruck danach bei Haberkern 1997, S. 214-217) [13]. Beide haben nicht im mindesten beachtet, was damals bereits als selbstverständlich gelten musste: Dass man eine Quelle, aus der man einen Auszug veröffentlicht, mit ihren Grunddaten präsentiert. Liebhart spricht in seinem bereits genannten Heimatzeitschriften-Aufsatz mit Blick auf KL 7 von einer 1516 vollendeten Klosterchronik (Anm. 14). Gern wüsste man Näheres über den Überlieferungszusammenhang des Berichts.
Die von einem Vertrauten Johanns verfasste Vita ist als deutschsprachiger literarischer Reflex der Ordensreform wertvoll, wurde aber bisher nur als Faktensteinbruch zum Leben Johanns genutzt. Ihre quasi-hagiographische Stilisierung wurde bislang nicht beachtet.
4. Weitere Klosterliteralien
1982 nannte Liebhart in einem Übersichtsartikel im Amperland [14] als Quellen zur Geschichtsschreibung des Klosters die Klosterliteralien 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 - ohne weitere Angaben. In seinem kaum aufgrund von Autopsie gearbeiteten, wenig erhellenden Artikel zu den lateinischen Indersdorfer Handschriften nennt Haberkern auch fünf Klosterliteralien als "Handschriften" (die römische Ziffer bezeichnet offenkundig die Datierung) [15]:
1 XIII/XVI
2 Kalendar XIV
4 Chronik XV
5 Kalendar XV
146 Statuta XV
5. Indersdorfer Kopialbuch, München, Staatsbibliothek, Cgm 1515
Die kurzen historischen Notizen aus dem in das zweite Viertel des 15. Jahrhundert zu datierenden Amtsbuch Bl. 6v-9ra hat Karin Schneider 1991 knapp charakterisiert. [16] Von ihr erfährt man, anders als bei den bisher genannten Autoren, tatsächlich, was es sich über die Handschrift zu wissen lohnt. Nicht anders ist eine Beschreibung der archivisch verwahrten Amtsbücher zu wünschen.
6. Sammelband, München, Staatsbibliothek, Cgm 5482
Eine umsichtige Beschreibung legte 2009 Elisabeth Wunderle vor [17]. Der Codex, der hinsichtlich des Indersdorfer Teils aus dem dritten Viertel des 15. Jahrhunderts stammt, ist online (Link verweist auf den Beginn des Indersdorfer Teils):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008862/image_54
Die Fundationes der Klöster stehen der Chronik Veit Arnpecks nahe [18]. Sie fehlen im Aufsatz zu den Fundationes monasteriorum Bavariae, den Alois Schmid 1987 vorlegte. Allerdings nicht ganz, denn der von Hundt 1862 erwähnte Sammelband im Reichsarchiv, den Schmid für "nicht auffindbar" hielt [19], ist kein anderer als der früher im Reichsarchiv befindliche Cgm 5482!
***
ANMERKUNGEN
[1] Siehe den geschichtlichen Überblick
http://www.hdbg.eu/kloster/web/index.php/detail?id=KS0153
und den Abriss der Klostergeschichte bei Ernst Haberkern: Funken aus alter Glut. Johannes von Indersdorf: Von dreierlei Wesen der Menschen (1997), S. 235-273.
Kritisch zum Datum 1417 siehe Horst Miekisch: Das Augustinerchorherrenstift Neunkirchen am Brand. Diss. Bamberg 2006, S. 165 Anm. 851.
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:473-opus-929
Online ist die barocke Darstellung der Stiftsgeschichte von Gelasius Morhart 1762:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11083252-5
[2] Mit Mail vom 7. August 2014 teilte Liebhart, dem ich meine kleine Sammlung übermittelt hatte, mit, seine Forschungen lägen auf Eis. Er machte nur auf die für die Geschichtsschreibung durchaus irrelevanten Titel von Brinkhus und Haberkern (Monographie 1997 und Auszug daraus im Katalog Das Augustinerchorherrenstift Indersdorf, 2000) aufmerksam. Vor allem die Empfehlung des von mir käuflich erworbenen Buchs von Haberkern hätte er sich sparen können. Haberkern trägt kaum etwas Substantielles zur Forschung über Johannes von Indersdorf bei und arbeitet zu gern aus zweiter Hand.
[3] Michael Müller: Die Annalen und Chroniken im Herzogtum Bayern 1250-1314 (1983), S. 244.
[4] Urkunden des Klosters Indersdorf 1 (1863), S. XXf.
http://books.google.de/books?id=qSA3AAAAYAAJ&pg=PR20
und etwas ausführlicher in der Schrift über das Kloster Scheyern 1862, S. 48f.
http://books.google.de/books?id=Vj9UAAAAcAAJ&pg=PA48
[5] http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_17_S._332
[6] http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00437.html
[7] Jean-Marie Moeglin: Les Ancêtres du Prince (1985), S. 101-105, 268
[8] Beschreibung Karin Schneiders:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a189_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/6357
[9] Virgil Redlich: Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert (1931), S. 113, 137.
[10] Frank Fürbeth: Johannes Hartlieb (1992), S. 17. Auszug:
http://books.google.de/books?id=X-AZmEqwvdoC&pg=PA17
Haberkern 1997, S. 255 Anm. 702 bezieht sich auf Bl. 10-11 (fälschlich als "Urkunde" bezeichnet) von KL 4. Meist zitiert er Primärquellen aus zweiter Hand, so wohl auch hier, aber an der angegebenen Stelle bei Riezler Bd. 3, S. 828 steht nichts, was Haberkerns Angaben zu KL 4 belegen könnte:
https://archive.org/stream/RiezlerGeschichteBaiernsBd3/Riezler%20Geschichte_Baierns_Bd_3#page/n823/mode/2up
[11] http://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=620
[12] GND:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119441721
[13] Bernhard Haage: Johannes von Indersdorf in der zeitgenössischen Chronik seines Klosters. In: Leuvense Bijdragen 58 (1969), S. 169-174. Der gemeinfreie Text S. 170-174 steht online zur Verfügung:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haage_indersdorf_gekuerzt.pdf
Miekisch S. 164 gibt ein längeres Zitat aus der Handschrift leicht abweichend wieder.
Bernhard Haage: Der Traktat 'Von dreierlei Wesen der Menschen', Diss. Heidelberg 1968, S. 101 erwähnte die Lebensbeschreibung unter Bezugnahme auf die mir gerade nicht zugängliche Freiburger Dissertation von Eugen Gehr (Die Fürstenlehren ... 1926, S. 49).
[14] http://www.zeitschrift-amperland.de/download_pdf.php?id=595
[15] Ernst Haberkern: Die lateinischen Handschriften des Augustiner-Chorherrenstifts Indersdorf. Ein Gang durch eine mittelalterliche Bibliothek. In: Mittellateinisches Jahrbuch 38 (2003), S. 51-88, hier S. 66 Anm. 20.
[16] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0189_a193_JPG.htm
[17] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-BSB-cgm-pdfs/Cgm%205482.pdf
[18] Veit Arnpeck: Sämtliche Chroniken. Hrsg. von Georg Leidinger (1915), S. 195 zu Indersdorf:
https://archive.org/stream/VeitArnpeckSaemtlicheChroniken#page/n335/mode/2up
[19] In: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (1987), S. 591 mit Anm. 74.
Nachtrag von Herrn Liebhart (Mail 4.12.2014): "Nachtrag zur frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung mit Rückgriffen:
Peter Dorner: Indersdorfer Chronik (Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim 5). Paring 2003.
ISBN 3-936197-01-6 "
#forschung

KlausGraf - am Freitag, 14. November 2014, 02:28 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 13. November 2014, 20:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gesucht wird eine Abfrage in der Google-Websuche, die eine wissenschaftliche Arbeit (unter anderem) über Parrigers Jugendbuch "Die Hexe von Zeil" unter die ersten zehn Treffer bringt. Die Abfrage muss naheliegend und verallgemeinerbar sein.


http://www.sueddeutsche.de/news/kultur/kunst-warhol-bilder-bringen-mehr-als-150-millionen-dollar-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-141113-99-01356
"Der Verkauf von Kunst aus öffentlichem Besitz, um Haushaltslöcher zu stopfen, gilt in der Kultur als größter Sündenfall. Die Landesregierung in Düsseldorf versichert nun, dass Kunst aus Museen des Landes und der Kommunen unantastbar sei. Bei den Warhol-Siebdrucken, die einst zur Ausstattung der Aachener Spielbank gekauft wurden, sei die Situation eine andere. Die Warhols seien schließlich im Besitz eines wirtschaftlich selbstständig agierenden Unternehmens.
In den landeseigenen Unternehmen schlummern noch weitere Hochkaräter. Die Blicke richten sich etwa auf Portigon, die Nachfolgegesellschaft der WestLB. Diese hortet den Rest des einstigen Kunstschatzes der Landesbank WestLB, dazu noch eine wertvolle Stradivari-Geige. Ein Max-Beckmann-Gemälde aus Besitz der WestLB wurde bereits 2006 heimlich verkauft."
"Der Verkauf von Kunst aus öffentlichem Besitz, um Haushaltslöcher zu stopfen, gilt in der Kultur als größter Sündenfall. Die Landesregierung in Düsseldorf versichert nun, dass Kunst aus Museen des Landes und der Kommunen unantastbar sei. Bei den Warhol-Siebdrucken, die einst zur Ausstattung der Aachener Spielbank gekauft wurden, sei die Situation eine andere. Die Warhols seien schließlich im Besitz eines wirtschaftlich selbstständig agierenden Unternehmens.
In den landeseigenen Unternehmen schlummern noch weitere Hochkaräter. Die Blicke richten sich etwa auf Portigon, die Nachfolgegesellschaft der WestLB. Diese hortet den Rest des einstigen Kunstschatzes der Landesbank WestLB, dazu noch eine wertvolle Stradivari-Geige. Ein Max-Beckmann-Gemälde aus Besitz der WestLB wurde bereits 2006 heimlich verkauft."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Ursula Huber:
http://www.htwchur.ch/uploads/media/CSI_70_Huber.pdf
Wie erbärmlich ist das denn, dass nach 10 Jahren OA die Churer Hochschule noch keinen institutionellen Schriftenserver hat? Also auch kein DOI, URN für die Publikation.
http://www.htwchur.ch/uploads/media/CSI_70_Huber.pdf
Wie erbärmlich ist das denn, dass nach 10 Jahren OA die Churer Hochschule noch keinen institutionellen Schriftenserver hat? Also auch kein DOI, URN für die Publikation.
KlausGraf - am Donnerstag, 13. November 2014, 18:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zwei Buchbesprechungen von mir, die jetzt in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins erschienen sind (mit Ergänzungen in Form von Links):
Elizabeth Harding und Michael Hecht (Hrsg.), Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion - Initiation - Repräsentation. Münster: Rhema 2011 (= Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496 Bd. 37). 434 S., zahlreiche Abb.
Der auf eine Tagung in Münster 2009 zurückgehende Sammelband enthält eine sehr umfangreiche und materialreiche “Einführung” durch die Herausgeber (S. 9-83), in der die drei Begriffe des Untertitels expliziert werden. Ahnenproben werden als Auswahlverfahren vorgestellt (“Selektion”), doch beschränkte sich ihre Rolle keineswegs darauf. Der Abschnitt “Initiation: Ahnenproben als Einsetzungsritual” (S. 37-44) thematisiert in innovativer Weise die rituellen Aspekte des Phänomens, indem er die öffentlichen Aufschwörungsakte würdigt. Ahnenproben dienten schließlich als “Repräsentation von Abstammung und Verwandtschaft” (S. 44) auf Bildzeugnissen und insbesondere in Funeralschriften.
Zu unpräzise wird die spätmittelalterliche Vorgeschichte der Ahnenprobe dargestellt. Die entsprechende Passage (S. 14-28) setzt mit dem Sachsenspiegel im 13. Jahrhundert ein, geht dann auf Belege aus dem Turnierwesen und den Rittergesellschaften des 15. Jahrhunderts ein und springt vom Hubertus-Orden zu einer Düsseldorfer Festlichkeit 1585. Eine ahistorische Betrachtungsweise, die Spätmittelalter und Frühe Neuzeit in einen Topf wirft, wird den Ahnenproben jedoch nicht gerecht.
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts dominierte eindeutig die Vierahnenprobe. Strengere Anforderungen gab es vereinzelt bei den Domstiften: Basel forderte 1466 acht Ahnen (S. 198), Köln für die hochadeligen “Domgrafen” 1474 sogar 16 (Adlige Lebenswelten im Rheinland, 2009, S. 183). Turnier- und Rittergesellschaften, aber auch die Friedberger Burgmannen (S. 209), begnügten sich im 15. Jahrhundert mit vier Ahnen. So auch der jülich-bergische Hubertus-Orden 1476 (S. 18), wenngleich in seinem Heroldsbuch auch höhere Ahnenproben vertreten sind. So betrifft der letzte datierte Eintrag (1492) die 16 Ahnen eines Grafen von Hohenlohe (Krakau, ehemals Staatsbibliothek Berlin mgq 1479). Quellenkritisch nicht zulässig ist der exemplarische Verweis auf das Eptinger Familienbuch, das Ludwig von Eptingen zugewiesen wird: “Anlässlich seiner Teilnahme an einem Turnier in Mainz 1480 hielt er seine vier Ahnenwappen fest, im folgenden Jahr malte er im Kontext eines Heidelberger Turniers bereits acht Wappen auf, zu den Turnieren in Regensburg und Worms führte er je 16 Ahnenwappen für sich und für seine Ehrefrau an” (S. 16). Ich habe schon in meiner Rezension (ZGO 143, 1995, S. 609f.) der Ausgabe von Dorothea Christ 1992 Zweifel an der Authentizität der Quelle als spätmittelalterliches Zeugnis angemeldet. Sie ist zuallererst als Dokument aus dem frühen 17. Jahrhundert zu lesen. Wenngleich der Redaktor Materialien zum Turnierwesen aus der Zeit der Vierlande-Turniere verwenden konnte, liegt gerade bei den Ahnenproben der Verdacht nahe, dass diese nachträglich fingiert wurden. Selbst wenn man meine Skepsis nicht vollständig teilt, geht es nicht an, ein nur in einer frühneuzeitlichen Überlieferung fassbares Hausbuch ohne jedes Fragezeichen als Beleg aus dem Ende des 15. Jahrhundert zu werten.
Die Staatsbibliothek Berlin verwahrt eine zeitgenössische Beschreibung des Vierlandeturniers in Ingolstadt 1484 mit Wappen (mgo 107). Aufgrund von einigen von Kurt Heydeck freundlicherweise zur Verfügung gestellten Aufnahmen vermag ich jedoch nicht zu sagen, ob darunter auch Ahnenproben sind. Steffen Krieb hat auf die Erwähnung eines Bildteppichs mit Turnier-Thematik in der Flersheimer Chronik (1547), auf dem je acht Ahnen der Eheleute Friedrich und Margarethe von Flersheim turnierend dargestellt gewesen sein sollen, aufmerksam gemacht (in: Geschichte schreiben, 2010, S. 355). Friedrich von Flersheim starb 1473. Seine Gemahlin Margarethe von Randeck (gestorben 1489) könnte die Tapisserie während seiner Lebenszeit Friedrichs in Auftrag gegeben haben, oder als Witwe, jedenfalls aber vor Einsetzen der Vierlandeturniere 1479, da sie ihren Kindern “zu einer gedechtnus” das Turnierwesen während einer Zeit der Nichtausübung in Erinnerung rufen wollte. Einen sicheren Beweis, dass es dieses Turniertuch tatsächlich gegeben hat, stellt aber der Abschnitt in der sehr viel späteren Familienchronik nicht dar.
Übergangen werden die bedeutsamen Erhebungen zu Ahnenproben vor allem auf Grabdenkmalen im Rahmen der Sammlung der “Deutschen Inschriften” (DI) - es gibt nur einen kurzen Hinweis in der Fußnote 119 auf S. 45. Vergleichsweise früh findet sich in Worms eine Vierahnenprobe 1364 vor: Es handelt sich, so eine Auskunft von Rüdiger Fuchs (Mainz), “um die des Reimbold Bayer von Boppard (+1364) (= DI 29, Worms, Nr. 145, Wormser Domstift). Die nächsten mir bekannten in unserem Raum sind die Platte des Neffen (?) Reimbolds Heinrich Bayer von Boppard (+1377 = DI 2, Mainz, Nr. 49, Mainzer Domstift) und die des Rorich von Sterrenberg (+1380 = DI 2, Mainz, Nr. 50 – zusammen mit Nr. 60 = Heinrich Bayer von Sterrenberg, +1394, jeweils Mainzer Domstift). Das Ganze hat wohl etwas mit der Familie zu tun” (vgl. auch DI 29, Worms, S. XXXVII). Andere Regionen kennen sehr viel spätere Erstbelege für Vierahnenproben. Um nur einige Beispiele aus jüngeren südwestdeutschen Inschriftenbänden zu nennen: 1412 Grabplatte einer Truchsessin von Baldersheim in Waldmannshofen (DI 54, Mergentheim, Nr. 39); 1442 Grabplatte Hartmanns III. Ulner von Dieburg in Dieburg (DI 49, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Nr. 34; nur durch den Inschriftensammler Helwich überliefert ist eine Vierahnenprobe aus der gleichen Familie ebenfalls in Dieburg 1395, ebenda Nr. 14); um 1470 Gernsbacher Sakramentshäuschen (DI 78, Baden-Baden/Rastatt, Nr. 88); 1567 Grabplatte der Margretha von Rüppur in Leonberg (DI 47, Böblingen, Nr. 211).
An die Einleitung schließen sich einige Beiträge allgemeiner Natur (zu Verwandtschaft in der Vormoderne, Ahnenproben an Grabdenkmälern des lutherischen Adels, gedruckten Ahnentafeln und zur Handwerkerehre) und ein bunter Strauß von Fallstudien an. Es geht um Dom- und Damenstifte, um die Reichsburg/Ganerbschaft Friedburg, die kursächsische, kurkölnisch-herzoglich-westfälische und die geldrische Ritterschaft und um den Wiener Hof und die habsburgischen Territorien (unter besonderer Berücksichtigung der heutigen südlichen Niederlande). Die letzten drei Aufsätze verlassen Mitteleuropa, wenn sie den Johanniterorden auf Malta, Frankreich sowie die Rolle der “Blutsreinheit” in der neu-spanischen Casta-Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in den Blick nehmen. Fast alle Beiträge sind gründlich auch aus archivalischen Quellen erarbeitet.
Für Südwestdeutschland ist vor allem die Studie von Kurt Andermann relevant, der sich anhand der größtenteils im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrten Überlieferung der Domkapitel von Speyer und Konstanz mit Gestalt und Inhalt der Ahnentafeln, den Zulassungsbedingungen und dem Probeverfahren befasst (S. 191-207).
Der Band, der die Forschung zum Thema Ahnenprobe ohne Zweifel auf eine neue Grundlage stellt, lässt den Wunsch nach einem im Internet zu realisierenden Verzeichnis der mitteleuropäischen Aufschwörungs-Quellen aufkommen.
Ein Lob verdienen die reiche Bebilderung, die Existenz englischer Zusammenfassungen und das abschließende Register der Personennamen. Man vermisst aber eine Bibliographie der in den Fußnoten aufgeführten, arg verstreuten Arbeiten zum Thema.
Druck: ZGO 162 (2014), S. 554-556
Zu Ahnenproben hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=ahnenprobe
Mein Lexikonartikel Ahnenprobe in der Enzyklopädie der Neuzeit:
http://archiv.twoday.net/stories/6186936/
***
Martin Wrede, Ohne Furcht und Tadel - für König und Vaterland. Frühneuzeitlicher Hochadel zwischen Familienehre, Ritterideal und Fürstendienst. Ostfildern: Thorbecke 2012 (= Beihefte der Francia 75). 484 S.
Die Gießener Habilitationsschrift hat sich außerordentlich viel vorgenommen: Es geht um die Familiengeschichtsschreibung und genealogische Kultur hochadeliger Familien in Frankreich und Deutschland, um höfische Ritterorden, das Turnier in der frühneuzeitlichen Hofkultur und den Adels-Diskurs des 18. Jahrhunderts. Sie stützt sich auf ein ausgedehntes Studium archivalischer Quellen.
Für die Fallstudien des ersten Teils (“Adelshäuser imaginieren sich selbst”) wurde das Archiv des 1933 im Mannesstamm ausgestorbenen französischen Hauses La Trémoïlle (Paris, Archives Nationales) ausgewählt, “die faktisch einzige intakte Familienüberlieferung des französischen Hochadels” (S. 34). Die Häuser Arenberg und Croÿ sollen für den “belgischen” Hochadel repäsentativ sein. Reich ist auch die in Den Haag und Wiesbaden vorhandene Überlieferung des Hauses Nassau. Bereits diese Quellenauswahl erweckt Bedenken, da auch das “deutsche” Haus Nassau enge Beziehungen zu den Niederlanden hatte. Es geht also im Kern um westeuropäische Adelskultur, nicht etwa um einen Vergleich zwischen dem Alten Reich und Frankreich.
Knapp die Hälfte des Buchs (bis S. 227) ist dem ersten Teil zu Familienerinnerung und Geschichtsschreibung gewidmet. Mir leuchtet nicht ein, wieso der zweite Teil zum Ritterideal hinzugepackt werden musste. “Von Wert, Wandlungen und Beständigkeiten höfischer Ritterorden” - im Mittelpunkt stehen hier der burgundische, später habsburgische Orden vom Goldenen Vlies, die Orden des Königs von Frankreich und der Kreuzzugsplan des Herzogs Charles de Nevers, den er mit einem 1618 gegründeten Orden “Militia Christiana” fördern wollte. Lars Adler hat sich 2008 den Hoforden der Markgrafen von Baden gewidmet (vgl. ZGO 160, 2012, S. 680f.), ohne dass Wrede sich veranlasst sah, diese für das höfische Ordenswesen auch allgemein wichtige Studie eingehender zu Vergleichszwecken heranzuziehen. “Formen, Funktionen und Konjunkturen des Turniers in der Hofkultur der Frühen Neuzeit” - behandelt werden vor allem französische “carrousels” und ein Wiener Turnier (1560) und Rossballett (1667) der Habsburger.
Im letzten Kapitel gibt es Streiflichter zum Adels-Diskurs aus dem deutschen und französischen 18. Jahrhundert. Statt der naheliegenden Orientierung am Konzept des Rittertums findet man ein buntes Allerlei von Themen vor.
Auch Studien auf so modischen Feldern wie dem der Erinnerungskultur bedürfen einer klaren und stringenten Fragestellung und sollten sich nicht darauf beschränken, weitgehend deskriptiv Material auszubreiten. Wredes Interpretationen, vorgetragen in einer hochtrabenden und fremdwortgeschwängerten Sprache, plätschern dahin, ohne dass versucht wird, das Thema mit Thesen zu strukturieren. Die Resümees sind alles andere als konzis.
Die Erscheinungsformen des Rittertums seit dem 13. Jahrhundert werden geprägt durch die ständige Verschränkung von Kontinuität und Revitalisierung, schrieb ich 2004 im Artikel “Rittertum” [recte: Ritter] der Enzyklopädie des Märchens (Bd. 11, Sp. 710). Die damit verbundene Frage nach den Ritter-Renaissancen bzw. der “Ritterromantik”, die ich für das 15. Jahrhundert in einem Aufsatz (in: Zwischen Deutschland und Frankreich, 2002, S. 517-532) erörtert habe, wurde in der ebenfalls aus dem Gießener Erinnerungskulturen-Sonderforschungsbereich hervorgegangenen Dissertation von Barbara Hammes (Ritterlicher Fürst und Ritterschaft, 2011) für das Jahrhundert 1350-1450 untersucht. Bei Wrede kann in dieser Beziehung von methodischer Disziplin keine Rede sein: Er reflektiert nicht zusammenfassend über das Rittertum als Relikt und das Problem des Anachronismus und der historischen Distanz (oder gar über retrospektive Tendenzen, wie sie sich etwa im Schlossbau manifestierten), sondern belässt es bei punktuellen Beobachtungen, die nicht zusammengeführt werden. Der Begriffsgebrauch ist fahrlässig vage, beispielsweise “Rittertumsnostalgie” (S. 50 Anm. 42), “Distinktionserwerb durch Ungleichzeitigkeit” (S. 329), “Archaismus”, “Traditionalität”, “Musealisierung”, Nostalgie”, “romantische Erinnerungskultur” (so im Schlusskapitel “Adel zwischen Erinnerung und Erneuerung” S. 411-413).
Im Literaturverzeichnis vermisst man etliche Titel, darunter auch adelsgeschichtliche Standardwerke (z.B. Otto Brunners “Adeliges Landleben und europäischer Geist”) oder etwa die in einer Studie zum Ritterideal unverzichtbare Monographie von Andreas Wang zum Miles Christianus im 16. und 17. Jahrhundert. Das abschließende Personenregister wurde nachlässig erstellt.
Wredes Buch ist weit davon entfernt, als Grundlagenstudie zum Ritterideal der Frühen Neuzeit gelten zu können, auch wenn in ihm mit großem Fleiß schätzenswerte Bausteine zu diesem Thema zusammengetragen wurden.
Druck: ZGO 162 (2014), S. 593f.
Wrede kommt sehr viel besser weg in:
http://www.hsozkult.de/hfn/publicationreview/id/rezbuecher-19271
http://www.sehepunkte.de/2013/05/21972.html
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/fruhneuzeit-info/24-2013/ReviewMonograph335006578/

Elizabeth Harding und Michael Hecht (Hrsg.), Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion - Initiation - Repräsentation. Münster: Rhema 2011 (= Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496 Bd. 37). 434 S., zahlreiche Abb.
Der auf eine Tagung in Münster 2009 zurückgehende Sammelband enthält eine sehr umfangreiche und materialreiche “Einführung” durch die Herausgeber (S. 9-83), in der die drei Begriffe des Untertitels expliziert werden. Ahnenproben werden als Auswahlverfahren vorgestellt (“Selektion”), doch beschränkte sich ihre Rolle keineswegs darauf. Der Abschnitt “Initiation: Ahnenproben als Einsetzungsritual” (S. 37-44) thematisiert in innovativer Weise die rituellen Aspekte des Phänomens, indem er die öffentlichen Aufschwörungsakte würdigt. Ahnenproben dienten schließlich als “Repräsentation von Abstammung und Verwandtschaft” (S. 44) auf Bildzeugnissen und insbesondere in Funeralschriften.
Zu unpräzise wird die spätmittelalterliche Vorgeschichte der Ahnenprobe dargestellt. Die entsprechende Passage (S. 14-28) setzt mit dem Sachsenspiegel im 13. Jahrhundert ein, geht dann auf Belege aus dem Turnierwesen und den Rittergesellschaften des 15. Jahrhunderts ein und springt vom Hubertus-Orden zu einer Düsseldorfer Festlichkeit 1585. Eine ahistorische Betrachtungsweise, die Spätmittelalter und Frühe Neuzeit in einen Topf wirft, wird den Ahnenproben jedoch nicht gerecht.
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts dominierte eindeutig die Vierahnenprobe. Strengere Anforderungen gab es vereinzelt bei den Domstiften: Basel forderte 1466 acht Ahnen (S. 198), Köln für die hochadeligen “Domgrafen” 1474 sogar 16 (Adlige Lebenswelten im Rheinland, 2009, S. 183). Turnier- und Rittergesellschaften, aber auch die Friedberger Burgmannen (S. 209), begnügten sich im 15. Jahrhundert mit vier Ahnen. So auch der jülich-bergische Hubertus-Orden 1476 (S. 18), wenngleich in seinem Heroldsbuch auch höhere Ahnenproben vertreten sind. So betrifft der letzte datierte Eintrag (1492) die 16 Ahnen eines Grafen von Hohenlohe (Krakau, ehemals Staatsbibliothek Berlin mgq 1479). Quellenkritisch nicht zulässig ist der exemplarische Verweis auf das Eptinger Familienbuch, das Ludwig von Eptingen zugewiesen wird: “Anlässlich seiner Teilnahme an einem Turnier in Mainz 1480 hielt er seine vier Ahnenwappen fest, im folgenden Jahr malte er im Kontext eines Heidelberger Turniers bereits acht Wappen auf, zu den Turnieren in Regensburg und Worms führte er je 16 Ahnenwappen für sich und für seine Ehrefrau an” (S. 16). Ich habe schon in meiner Rezension (ZGO 143, 1995, S. 609f.) der Ausgabe von Dorothea Christ 1992 Zweifel an der Authentizität der Quelle als spätmittelalterliches Zeugnis angemeldet. Sie ist zuallererst als Dokument aus dem frühen 17. Jahrhundert zu lesen. Wenngleich der Redaktor Materialien zum Turnierwesen aus der Zeit der Vierlande-Turniere verwenden konnte, liegt gerade bei den Ahnenproben der Verdacht nahe, dass diese nachträglich fingiert wurden. Selbst wenn man meine Skepsis nicht vollständig teilt, geht es nicht an, ein nur in einer frühneuzeitlichen Überlieferung fassbares Hausbuch ohne jedes Fragezeichen als Beleg aus dem Ende des 15. Jahrhundert zu werten.
Die Staatsbibliothek Berlin verwahrt eine zeitgenössische Beschreibung des Vierlandeturniers in Ingolstadt 1484 mit Wappen (mgo 107). Aufgrund von einigen von Kurt Heydeck freundlicherweise zur Verfügung gestellten Aufnahmen vermag ich jedoch nicht zu sagen, ob darunter auch Ahnenproben sind. Steffen Krieb hat auf die Erwähnung eines Bildteppichs mit Turnier-Thematik in der Flersheimer Chronik (1547), auf dem je acht Ahnen der Eheleute Friedrich und Margarethe von Flersheim turnierend dargestellt gewesen sein sollen, aufmerksam gemacht (in: Geschichte schreiben, 2010, S. 355). Friedrich von Flersheim starb 1473. Seine Gemahlin Margarethe von Randeck (gestorben 1489) könnte die Tapisserie während seiner Lebenszeit Friedrichs in Auftrag gegeben haben, oder als Witwe, jedenfalls aber vor Einsetzen der Vierlandeturniere 1479, da sie ihren Kindern “zu einer gedechtnus” das Turnierwesen während einer Zeit der Nichtausübung in Erinnerung rufen wollte. Einen sicheren Beweis, dass es dieses Turniertuch tatsächlich gegeben hat, stellt aber der Abschnitt in der sehr viel späteren Familienchronik nicht dar.
Übergangen werden die bedeutsamen Erhebungen zu Ahnenproben vor allem auf Grabdenkmalen im Rahmen der Sammlung der “Deutschen Inschriften” (DI) - es gibt nur einen kurzen Hinweis in der Fußnote 119 auf S. 45. Vergleichsweise früh findet sich in Worms eine Vierahnenprobe 1364 vor: Es handelt sich, so eine Auskunft von Rüdiger Fuchs (Mainz), “um die des Reimbold Bayer von Boppard (+1364) (= DI 29, Worms, Nr. 145, Wormser Domstift). Die nächsten mir bekannten in unserem Raum sind die Platte des Neffen (?) Reimbolds Heinrich Bayer von Boppard (+1377 = DI 2, Mainz, Nr. 49, Mainzer Domstift) und die des Rorich von Sterrenberg (+1380 = DI 2, Mainz, Nr. 50 – zusammen mit Nr. 60 = Heinrich Bayer von Sterrenberg, +1394, jeweils Mainzer Domstift). Das Ganze hat wohl etwas mit der Familie zu tun” (vgl. auch DI 29, Worms, S. XXXVII). Andere Regionen kennen sehr viel spätere Erstbelege für Vierahnenproben. Um nur einige Beispiele aus jüngeren südwestdeutschen Inschriftenbänden zu nennen: 1412 Grabplatte einer Truchsessin von Baldersheim in Waldmannshofen (DI 54, Mergentheim, Nr. 39); 1442 Grabplatte Hartmanns III. Ulner von Dieburg in Dieburg (DI 49, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Nr. 34; nur durch den Inschriftensammler Helwich überliefert ist eine Vierahnenprobe aus der gleichen Familie ebenfalls in Dieburg 1395, ebenda Nr. 14); um 1470 Gernsbacher Sakramentshäuschen (DI 78, Baden-Baden/Rastatt, Nr. 88); 1567 Grabplatte der Margretha von Rüppur in Leonberg (DI 47, Böblingen, Nr. 211).
An die Einleitung schließen sich einige Beiträge allgemeiner Natur (zu Verwandtschaft in der Vormoderne, Ahnenproben an Grabdenkmälern des lutherischen Adels, gedruckten Ahnentafeln und zur Handwerkerehre) und ein bunter Strauß von Fallstudien an. Es geht um Dom- und Damenstifte, um die Reichsburg/Ganerbschaft Friedburg, die kursächsische, kurkölnisch-herzoglich-westfälische und die geldrische Ritterschaft und um den Wiener Hof und die habsburgischen Territorien (unter besonderer Berücksichtigung der heutigen südlichen Niederlande). Die letzten drei Aufsätze verlassen Mitteleuropa, wenn sie den Johanniterorden auf Malta, Frankreich sowie die Rolle der “Blutsreinheit” in der neu-spanischen Casta-Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in den Blick nehmen. Fast alle Beiträge sind gründlich auch aus archivalischen Quellen erarbeitet.
Für Südwestdeutschland ist vor allem die Studie von Kurt Andermann relevant, der sich anhand der größtenteils im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrten Überlieferung der Domkapitel von Speyer und Konstanz mit Gestalt und Inhalt der Ahnentafeln, den Zulassungsbedingungen und dem Probeverfahren befasst (S. 191-207).
Der Band, der die Forschung zum Thema Ahnenprobe ohne Zweifel auf eine neue Grundlage stellt, lässt den Wunsch nach einem im Internet zu realisierenden Verzeichnis der mitteleuropäischen Aufschwörungs-Quellen aufkommen.
Ein Lob verdienen die reiche Bebilderung, die Existenz englischer Zusammenfassungen und das abschließende Register der Personennamen. Man vermisst aber eine Bibliographie der in den Fußnoten aufgeführten, arg verstreuten Arbeiten zum Thema.
Druck: ZGO 162 (2014), S. 554-556
Zu Ahnenproben hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=ahnenprobe
Mein Lexikonartikel Ahnenprobe in der Enzyklopädie der Neuzeit:
http://archiv.twoday.net/stories/6186936/
***
Martin Wrede, Ohne Furcht und Tadel - für König und Vaterland. Frühneuzeitlicher Hochadel zwischen Familienehre, Ritterideal und Fürstendienst. Ostfildern: Thorbecke 2012 (= Beihefte der Francia 75). 484 S.
Die Gießener Habilitationsschrift hat sich außerordentlich viel vorgenommen: Es geht um die Familiengeschichtsschreibung und genealogische Kultur hochadeliger Familien in Frankreich und Deutschland, um höfische Ritterorden, das Turnier in der frühneuzeitlichen Hofkultur und den Adels-Diskurs des 18. Jahrhunderts. Sie stützt sich auf ein ausgedehntes Studium archivalischer Quellen.
Für die Fallstudien des ersten Teils (“Adelshäuser imaginieren sich selbst”) wurde das Archiv des 1933 im Mannesstamm ausgestorbenen französischen Hauses La Trémoïlle (Paris, Archives Nationales) ausgewählt, “die faktisch einzige intakte Familienüberlieferung des französischen Hochadels” (S. 34). Die Häuser Arenberg und Croÿ sollen für den “belgischen” Hochadel repäsentativ sein. Reich ist auch die in Den Haag und Wiesbaden vorhandene Überlieferung des Hauses Nassau. Bereits diese Quellenauswahl erweckt Bedenken, da auch das “deutsche” Haus Nassau enge Beziehungen zu den Niederlanden hatte. Es geht also im Kern um westeuropäische Adelskultur, nicht etwa um einen Vergleich zwischen dem Alten Reich und Frankreich.
Knapp die Hälfte des Buchs (bis S. 227) ist dem ersten Teil zu Familienerinnerung und Geschichtsschreibung gewidmet. Mir leuchtet nicht ein, wieso der zweite Teil zum Ritterideal hinzugepackt werden musste. “Von Wert, Wandlungen und Beständigkeiten höfischer Ritterorden” - im Mittelpunkt stehen hier der burgundische, später habsburgische Orden vom Goldenen Vlies, die Orden des Königs von Frankreich und der Kreuzzugsplan des Herzogs Charles de Nevers, den er mit einem 1618 gegründeten Orden “Militia Christiana” fördern wollte. Lars Adler hat sich 2008 den Hoforden der Markgrafen von Baden gewidmet (vgl. ZGO 160, 2012, S. 680f.), ohne dass Wrede sich veranlasst sah, diese für das höfische Ordenswesen auch allgemein wichtige Studie eingehender zu Vergleichszwecken heranzuziehen. “Formen, Funktionen und Konjunkturen des Turniers in der Hofkultur der Frühen Neuzeit” - behandelt werden vor allem französische “carrousels” und ein Wiener Turnier (1560) und Rossballett (1667) der Habsburger.
Im letzten Kapitel gibt es Streiflichter zum Adels-Diskurs aus dem deutschen und französischen 18. Jahrhundert. Statt der naheliegenden Orientierung am Konzept des Rittertums findet man ein buntes Allerlei von Themen vor.
Auch Studien auf so modischen Feldern wie dem der Erinnerungskultur bedürfen einer klaren und stringenten Fragestellung und sollten sich nicht darauf beschränken, weitgehend deskriptiv Material auszubreiten. Wredes Interpretationen, vorgetragen in einer hochtrabenden und fremdwortgeschwängerten Sprache, plätschern dahin, ohne dass versucht wird, das Thema mit Thesen zu strukturieren. Die Resümees sind alles andere als konzis.
Die Erscheinungsformen des Rittertums seit dem 13. Jahrhundert werden geprägt durch die ständige Verschränkung von Kontinuität und Revitalisierung, schrieb ich 2004 im Artikel “Rittertum” [recte: Ritter] der Enzyklopädie des Märchens (Bd. 11, Sp. 710). Die damit verbundene Frage nach den Ritter-Renaissancen bzw. der “Ritterromantik”, die ich für das 15. Jahrhundert in einem Aufsatz (in: Zwischen Deutschland und Frankreich, 2002, S. 517-532) erörtert habe, wurde in der ebenfalls aus dem Gießener Erinnerungskulturen-Sonderforschungsbereich hervorgegangenen Dissertation von Barbara Hammes (Ritterlicher Fürst und Ritterschaft, 2011) für das Jahrhundert 1350-1450 untersucht. Bei Wrede kann in dieser Beziehung von methodischer Disziplin keine Rede sein: Er reflektiert nicht zusammenfassend über das Rittertum als Relikt und das Problem des Anachronismus und der historischen Distanz (oder gar über retrospektive Tendenzen, wie sie sich etwa im Schlossbau manifestierten), sondern belässt es bei punktuellen Beobachtungen, die nicht zusammengeführt werden. Der Begriffsgebrauch ist fahrlässig vage, beispielsweise “Rittertumsnostalgie” (S. 50 Anm. 42), “Distinktionserwerb durch Ungleichzeitigkeit” (S. 329), “Archaismus”, “Traditionalität”, “Musealisierung”, Nostalgie”, “romantische Erinnerungskultur” (so im Schlusskapitel “Adel zwischen Erinnerung und Erneuerung” S. 411-413).
Im Literaturverzeichnis vermisst man etliche Titel, darunter auch adelsgeschichtliche Standardwerke (z.B. Otto Brunners “Adeliges Landleben und europäischer Geist”) oder etwa die in einer Studie zum Ritterideal unverzichtbare Monographie von Andreas Wang zum Miles Christianus im 16. und 17. Jahrhundert. Das abschließende Personenregister wurde nachlässig erstellt.
Wredes Buch ist weit davon entfernt, als Grundlagenstudie zum Ritterideal der Frühen Neuzeit gelten zu können, auch wenn in ihm mit großem Fleiß schätzenswerte Bausteine zu diesem Thema zusammengetragen wurden.
Druck: ZGO 162 (2014), S. 593f.
Wrede kommt sehr viel besser weg in:
http://www.hsozkult.de/hfn/publicationreview/id/rezbuecher-19271
http://www.sehepunkte.de/2013/05/21972.html
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/fruhneuzeit-info/24-2013/ReviewMonograph335006578/

KlausGraf - am Donnerstag, 13. November 2014, 00:05 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


