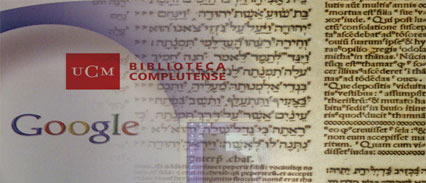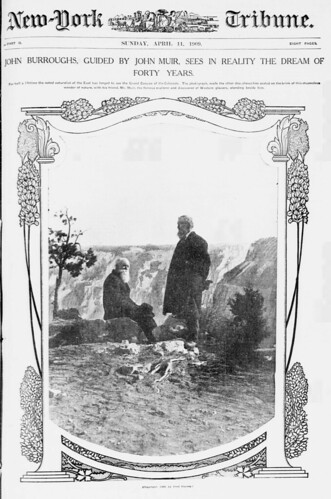Die seit Mitte der 1990er Jahre vorliegenden 10 Merksätze des VOI ( Branchenverband im Kontext DMS/VBS, Records Management, ECM) zur revisionssicheren Archivierung (Langzeitspeicherung) wurden liegen in überarbeiteter Form vor. Die Inhalte wurde präzisiert und fachlich der Entwicklung angepasst.
Als grundlegende Merksätze sind die 10 Punkte sicherlich gut, nur bleibt die Frage offen, worin der Mehrwert zu den vom VOI zumeist als "zu allgemein" kritisierten ISO-15489 besteht, die als internationale Norm jedoch deutlich verbindlicheren Charakter besitzen und zudem Verantwortlichkeiten und damit auch implizite Rechte und Pflichten der an einem ordnungsgemäßen Records Management Beteiligten definieren. Die Merksätze sind sehr allgemein und zudem in der Begrifflichkeit nicht branchenneutral, sondern vornehmlich auf die Privatwirtschaft ausgerichtet. So bezieht sich der Begriff "revisionssicher" zunächst auf die sichere Aufbewahrung im Hinblick auf die Prüfung bilanzrelevanter Unterlagen im Rahmen der Steuerprüfung gemäß den GdPDU und trifft insoweit Privatunternehmen (Vgl. § 147 AO ff.).
"Rechtssicher" im Sinne einer rechtskonformen Aufbewahrung wäre sicher der bessere Terminus.
Zudem meint der Terminus "Archivierung" bekanntermaßen die dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen mit bleibendem Wert im zuständigen Archiv.
Als erste Grundlage, Argumentationshilfe oder wie der Name anklingen lässt "Erinnerungshilfe" für eine rechtssichere und beweissichere Langzeitspeicherung sind die Merksätze durchaus zu empfehlen und auf das jeweilige Projekt lassen sie sich natürlich auch gut anpassen.
Vgl.: Merksätze des VOI
Als grundlegende Merksätze sind die 10 Punkte sicherlich gut, nur bleibt die Frage offen, worin der Mehrwert zu den vom VOI zumeist als "zu allgemein" kritisierten ISO-15489 besteht, die als internationale Norm jedoch deutlich verbindlicheren Charakter besitzen und zudem Verantwortlichkeiten und damit auch implizite Rechte und Pflichten der an einem ordnungsgemäßen Records Management Beteiligten definieren. Die Merksätze sind sehr allgemein und zudem in der Begrifflichkeit nicht branchenneutral, sondern vornehmlich auf die Privatwirtschaft ausgerichtet. So bezieht sich der Begriff "revisionssicher" zunächst auf die sichere Aufbewahrung im Hinblick auf die Prüfung bilanzrelevanter Unterlagen im Rahmen der Steuerprüfung gemäß den GdPDU und trifft insoweit Privatunternehmen (Vgl. § 147 AO ff.).
"Rechtssicher" im Sinne einer rechtskonformen Aufbewahrung wäre sicher der bessere Terminus.
Zudem meint der Terminus "Archivierung" bekanntermaßen die dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen mit bleibendem Wert im zuständigen Archiv.
Als erste Grundlage, Argumentationshilfe oder wie der Name anklingen lässt "Erinnerungshilfe" für eine rechtssichere und beweissichere Langzeitspeicherung sind die Merksätze durchaus zu empfehlen und auf das jeweilige Projekt lassen sie sich natürlich auch gut anpassen.
Vgl.: Merksätze des VOI
schwalm.potsdam - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 23:11 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie soeben zu lesen war
http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=947
hat Das digitale Historische Archiv Köln leider keinen Grimme Online Award verliehen bekommen.
Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch: aus Sicht des (insbesondere Kölner) Archivwesens ist das dHAK sicher ein extrem fortschrittlicher Ansatz, aus Sicht von Web x.0 eher konventionell.
Immerhin hat es das dHAK aus 1700 Vorschlägen in die Gruppe der 26 Nominierungen geschafft, Glückwunsch dafür an das Team und alle Unterstützer.
http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=947
hat Das digitale Historische Archiv Köln leider keinen Grimme Online Award verliehen bekommen.
Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch: aus Sicht des (insbesondere Kölner) Archivwesens ist das dHAK sicher ein extrem fortschrittlicher Ansatz, aus Sicht von Web x.0 eher konventionell.
Immerhin hat es das dHAK aus 1700 Vorschlägen in die Gruppe der 26 Nominierungen geschafft, Glückwunsch dafür an das Team und alle Unterstützer.
Wolfgang Lierz - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 22:36 - Rubrik: Kommunalarchive
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/content/below/index.xml
Ein Angebot der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena im Aufbau, aber Scans sind bereits sichtbar, wenngleich die Bereitstellungszeit der Bilder unzumutbar lang ist.
Ab Position 167 der Trefferliste sieht man Scans (es sind derzeit überwiegend lateinische Bücher aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts):
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=1f2yp848r70usfwcbjexl&page=167&numPerPage=10
Beispiel Tenglers Layenspiegel 1509:
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00004165
Update:
http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/W4RF/YaBB.pl?num=1245911992/0 mit technischen Details
Ein Angebot der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena im Aufbau, aber Scans sind bereits sichtbar, wenngleich die Bereitstellungszeit der Bilder unzumutbar lang ist.
Ab Position 167 der Trefferliste sieht man Scans (es sind derzeit überwiegend lateinische Bücher aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts):
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=1f2yp848r70usfwcbjexl&page=167&numPerPage=10
Beispiel Tenglers Layenspiegel 1509:
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00004165
Update:
http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/W4RF/YaBB.pl?num=1245911992/0 mit technischen Details
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=1310&pk=177363&opv=snd
Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.
Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“
Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.
Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“
Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.
http://archiv.twoday.net/search?q=rüxner
Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:
http://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

Parsberg ist keine 1000, sondern 800 Jahre alt: Dies ist bei einem Pressegespräch mit Burgmuseumsleiter Theo Döllinger und Fördervereinsvorsitzendem Helmut Jobst einmal mehr deutlich geworden. Das Museum besitzt seit kurzem eine Urkundenkopie aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, die angeblich aus den Jahren 1318 und 1340 stammen sollen. Darin wird bescheinigt, dass „die Parsberger Rechte schon seit 385 Jahren bestehen“.
Archivoberrat Reiprich schreibt an das Burgmuseum: „Die Rechnung, dass Parsberg schon im Jahre 933 bestand, geht von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von zwei gefälschten Urkunden, angeblich aus den Jahren 1318 und 1340. Die von 1340 des Kaisers Ludwig des Bayern, die von den damals seit 407 Jahren bestehenden Parsberger Rechten spricht, ist ebenso eine Fälschung, wie die von 1318, die in Amberg liegt.“
Nun bestehen die Parsberger seit Jahren auf der so genannten „Spitzner-Chronik“, die sich auf das Turnierbuch des Georg Rüxner (Rixner) stützt, das dieser 1532 verfasst hat. „Die Spitzner-Chronik ist eine saubere und diffizile Arbeit und soll auch erhalten werden, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Parsberg 933 noch nicht bestanden hat“, sagt Jobst. Dies habe auch Professor Dr. Alois Schmid in seinen Nachforschungen „Parsberg im Herzogtum der frühen Wittelsbacher“ bescheinigt.
Döllinger fügt hinzu, dass dies bereits der Historiker Manfred Jehle in seinem „Historischen Atlas Bayern“ festgestellt habe. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit der Genehmigung von Bertl Spitzner diese Chronik mit einem Anhang fortzuführen und Unwahrheiten zurechtrücken.“
Der damalige Vortrag von Dr. Schmid (7. Oktober 2005) in Parsberg hat aber weitere Hobby-Forscher auf den Plan gerufen. So hat Alois Dechant die Sache in die Hand genommen und Fragen an die Archive der Städte Magdeburg, Zürich und Nürnberg geschickt – wegen Ritterturnieren, an denen Parsberger genommen haben sollen.
http://archiv.twoday.net/search?q=rüxner
Von einer sauberen Arbeit kann hinsichtlich der Spitzner-Chronik zuallerletzt die Rede sein:
http://www.parsberg.de/fileadmin/downloads/chronik_parsberg.pdf

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Museumsblätter vom Juli 2009 mit Landesentwicklungskonzeption:
http://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Museumsblaetter_14.pdf
http://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Museumsblaetter_14.pdf
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Pampel erwähnt als gutes Beispiel die Beiträge von Archivalia zur OA week #oanetzwerk "
http://twitter.com/bckaemper/statuses/2308266438
Gemeint sind wohl die Beiträge zum OA-Tag 2008:
http://archiv.twoday.net/stories/5256322/
http://twitter.com/bckaemper/statuses/2308266438
Gemeint sind wohl die Beiträge zum OA-Tag 2008:
http://archiv.twoday.net/stories/5256322/
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 12:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das archivische Computerspiel, das die Siegener Firma outline development auf eine Idee des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit dem Siegener Stadtarchiv im Rahmen des NRW-Landeswettbewerbes entwickelthat, wurde mit vier weiteren Spielen für den LARA Education Award nominiert.
Gewonnen hat ein Mitkonkurrent, dem unser Glückwunsch gilt!
Quelle: Pressemitteilung
Link zum Award:
http://www.lara-award.de
s. a.:
http://archiv.twoday.net/stories/4381877/
http://archiv.twoday.net/stories/5250640/
http://archiv.twoday.net/stories/5261449/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Juni 2009, 08:00 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum Workshop der "Archive von unten" befindet sich im kg-Blog ein Kurzbericht von Lars Müller: http://kritischegeschichte.wordpress.com/2009/06/22/workshop-archive-von-unten-hat-stattgefunden/
Bernd Hüttner - am Dienstag, 23. Juni 2009, 23:03 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 19:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fortsetzung von: http://archiv.twoday.net/stories/5777050/
http://www.base-search.net
Die Bielefelder Suchmaschine ist ein ernsthafter Konkurrent für OAIster (mehr Quellen) . Als wissenschaftliche Volltextsuchmaschine ist sie aber unbrauchbar, da sie nach
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/about_sources_date_dn.php?menu=2
von den 1270 Quellen nur 38 volltextindiziert. Welche das sind erfährt man nicht, und man kann auch nicht gezielt zwischen Volltext- und Metadatensuche hin- und herschalten.
Bei bestimmten Suchbegriffen müllen das deutschsprachige Projekt Gutenberg oder andere Volltextquellen wie Bartleby die Trefferlisten zu. Wer Novalis eingibt, will wahrscheinlich etwas über den Dichter erfahren und nicht erst 20 englische Zitate von ihm lesen. Das Ranking ist unzulänglich.
Wie man etwa einer Suche nach Sudhoff entnehmen kann, hat OAIster 27 Bücher aus dem Internetarchiv, die in BASE fehlen (die Suche des Internetarchivs hat 28 Titel). Wer sich für die frei zugänglichen Schriften von Karl Sudhoff interessiert, wird dort, aber kaum in BASE fündig.
Wieso MDZ bei OAIster 16, bei BASE 19, die UB Breslau bei OAIster 138, bei BASE aber nur 115 Treffer hat, vermag ich nicht zu sagen.
Nachdem das Ranking von BASE nicht überzeugend ist, stellt sich die Frage, ob nicht ein OAI-Metadatenharvester, der ähnlich wie http://sbdsproto.nla.gov.au/ etwas aufgepeppt ist, nicht wesentlich billiger als BASE arbeiten könnte.
Wie meine Erfahrungen mit Google Booksearch gezeigt haben, ist es auch für geisteswissenschaftliche Zwecke unumgänglich, auf die Volltexte der Open-Access-Server zurückzugreifen. Da BASE dabei keine Hilfe ist, ist diese Suchmaschine kein brauchbares Werkzeug.
Das Scheitern von OpenDOAR und die gravierenden Lücken in der Google Websuche zeigen, wie wichtig es ist, dass alle im Netz vorhandenen wissenschaftlichen PDFs für eine gemeinsame Volltextsuche zur Verfügung stehen. Es ist grob fahrlässig, wenn sich Repositorien-Manager auf Google hinsichtlich der Volltextsuche verlassen.
Die Open-Access-Community braucht dringend eine übergreifende Volltextsuche für die Inhalte der OA-Schriftenserver und OA-Zeitschriftenartikel.
http://www.base-search.net
Die Bielefelder Suchmaschine ist ein ernsthafter Konkurrent für OAIster (mehr Quellen) . Als wissenschaftliche Volltextsuchmaschine ist sie aber unbrauchbar, da sie nach
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/about_sources_date_dn.php?menu=2
von den 1270 Quellen nur 38 volltextindiziert. Welche das sind erfährt man nicht, und man kann auch nicht gezielt zwischen Volltext- und Metadatensuche hin- und herschalten.
Bei bestimmten Suchbegriffen müllen das deutschsprachige Projekt Gutenberg oder andere Volltextquellen wie Bartleby die Trefferlisten zu. Wer Novalis eingibt, will wahrscheinlich etwas über den Dichter erfahren und nicht erst 20 englische Zitate von ihm lesen. Das Ranking ist unzulänglich.
Wie man etwa einer Suche nach Sudhoff entnehmen kann, hat OAIster 27 Bücher aus dem Internetarchiv, die in BASE fehlen (die Suche des Internetarchivs hat 28 Titel). Wer sich für die frei zugänglichen Schriften von Karl Sudhoff interessiert, wird dort, aber kaum in BASE fündig.
Wieso MDZ bei OAIster 16, bei BASE 19, die UB Breslau bei OAIster 138, bei BASE aber nur 115 Treffer hat, vermag ich nicht zu sagen.
Nachdem das Ranking von BASE nicht überzeugend ist, stellt sich die Frage, ob nicht ein OAI-Metadatenharvester, der ähnlich wie http://sbdsproto.nla.gov.au/ etwas aufgepeppt ist, nicht wesentlich billiger als BASE arbeiten könnte.
Wie meine Erfahrungen mit Google Booksearch gezeigt haben, ist es auch für geisteswissenschaftliche Zwecke unumgänglich, auf die Volltexte der Open-Access-Server zurückzugreifen. Da BASE dabei keine Hilfe ist, ist diese Suchmaschine kein brauchbares Werkzeug.
Das Scheitern von OpenDOAR und die gravierenden Lücken in der Google Websuche zeigen, wie wichtig es ist, dass alle im Netz vorhandenen wissenschaftlichen PDFs für eine gemeinsame Volltextsuche zur Verfügung stehen. Es ist grob fahrlässig, wenn sich Repositorien-Manager auf Google hinsichtlich der Volltextsuche verlassen.
Die Open-Access-Community braucht dringend eine übergreifende Volltextsuche für die Inhalte der OA-Schriftenserver und OA-Zeitschriftenartikel.
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 19:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 18:45 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Cornell University Library, as part of its mission to bring the library to its users where ever they may be, has put up on Flickr a selection of images from one of its prize collections, the AD White Architectural Photograph collection. All the photographs currently available are of buildings in Europe. Because Flickr Commons is not currently accepting new collections, this is in regular Flickr. They are licensed at the most general level Flickr allows (Attribution), and each image contains the following note:
There are no known U.S. copyright restrictions on this image. The digital file is owned by the Cornell Univeristy Library which is making it freely available with the request that, when possible, the Library be credited as its source.
Everybody if invited to visit Flickr and add tags, notes, and comments to these fine images.
Find us on Flickr: http://www.flickr.com/photos/cornelluniversitylibrary/
Thanks to Peter Hirtle.
 Cologne Rathaus
Cologne Rathaus
There are no known U.S. copyright restrictions on this image. The digital file is owned by the Cornell Univeristy Library which is making it freely available with the request that, when possible, the Library be credited as its source.
Everybody if invited to visit Flickr and add tags, notes, and comments to these fine images.
Find us on Flickr: http://www.flickr.com/photos/cornelluniversitylibrary/
Thanks to Peter Hirtle.
 Cologne Rathaus
Cologne RathausKlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 18:15 - Rubrik: English Corner
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 16:28 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Bergungsmaßnahmen gehen weiter. Seit Montag wird an der Unglücksstelle Severinstr. wieder geborgen. Aus diesem Grund brauchen wir diese und nächste Woche wieder Tatkräftige Unterstützung vor Ort. Gearbeitet wird in zwei Schichten: Montags bis Freitags von 7:00 bis 14:00 und 12:00 bis 19:00 Uhr
Wir brauchen noch dringend in der Nachmittagsschicht Unterstützung.
Wenn Sie also noch nicht im Einsatz sind und nochmals Lust und Zeit haben, uns zu unterstützen darf ich Sie bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen, damit wir mit Ihnen einen Einsatzplan absprechen können."
Kontakt:
Christian Bringe
Stadt Köln - Der Oberbürgermeister
Historisches Archiv
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Telefon: 0221/221-24617
Telefax: 0221/221-22480
E-Mail: HistorischesArchiv@Stadt-koeln.de
Internet: www.stadt-koeln.de
Wir brauchen noch dringend in der Nachmittagsschicht Unterstützung.
Wenn Sie also noch nicht im Einsatz sind und nochmals Lust und Zeit haben, uns zu unterstützen darf ich Sie bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen, damit wir mit Ihnen einen Einsatzplan absprechen können."
Kontakt:
Christian Bringe
Stadt Köln - Der Oberbürgermeister
Historisches Archiv
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Telefon: 0221/221-24617
Telefax: 0221/221-22480
E-Mail: HistorischesArchiv@Stadt-koeln.de
Internet: www.stadt-koeln.de
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Juni 2009, 14:51 - Rubrik: Kommunalarchive
http://edoc.hu-berlin.de/browsing/cms-journal/index.php
Das CMS-Journal enthält auch etliche Beiträge zu Open Access.
Das CMS-Journal enthält auch etliche Beiträge zu Open Access.
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 14:33 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vor allem Lambert Heller twittert:
http://search.twitter.com/search?q=oanetzwerk%20OR%20oanetzwerk09#
http://search.twitter.com/search?q=oanetzwerk%20OR%20oanetzwerk09#
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 13:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Institution: Deutsches Museum, München
Datum: 31.08.2009-25.09.2009
Bewerbungsschluss: 10.07.2009
Das Deutsche Museum – Anstalt des öffentlichen Rechts – sucht in der Zeit vom 31.8.2009 bis 25.9.2009 drei Praktikantinnen / Praktikanten (Vollzeit). Das Praktikum umfasst neben der Einführung in die Arbeit eines führenden Spezialarchivs zu Wissenschafts- und Technikgeschichte (Bestände, Archivsoftware, Verzeichnung etc.) auch jeweils konkrete Erfassungsprojekte.
Die Bewerberinnen / Bewerber sollen Studierende historischer Fächer sein.
Für das Praktikum kann keine Vergütung angeboten werden.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen mit Zeugnissen und Tätigkeitsnachweisen. Senden Sie diese bitte bis 10.7.2009 an: Deutsches Museum – Personalstelle - 80306 München.
Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Herr Dr. Wilhelm Füßl, Tel. 089/2179-220, E-Mail: archiv@deutsches-museum.de
Kontakt:
Personalstelle
Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München
089 / 2179-220
089 / 2179-265
archiv@deutsches-museum.de
URL: http://www.deutsches-museum.de/archiv/
URL zur Zitation dieses Beitrages
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=3936&type=stellen
Datum: 31.08.2009-25.09.2009
Bewerbungsschluss: 10.07.2009
Das Deutsche Museum – Anstalt des öffentlichen Rechts – sucht in der Zeit vom 31.8.2009 bis 25.9.2009 drei Praktikantinnen / Praktikanten (Vollzeit). Das Praktikum umfasst neben der Einführung in die Arbeit eines führenden Spezialarchivs zu Wissenschafts- und Technikgeschichte (Bestände, Archivsoftware, Verzeichnung etc.) auch jeweils konkrete Erfassungsprojekte.
Die Bewerberinnen / Bewerber sollen Studierende historischer Fächer sein.
Für das Praktikum kann keine Vergütung angeboten werden.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen mit Zeugnissen und Tätigkeitsnachweisen. Senden Sie diese bitte bis 10.7.2009 an: Deutsches Museum – Personalstelle - 80306 München.
Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Herr Dr. Wilhelm Füßl, Tel. 089/2179-220, E-Mail: archiv@deutsches-museum.de
Kontakt:
Personalstelle
Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München
089 / 2179-220
089 / 2179-265
archiv@deutsches-museum.de
URL: http://www.deutsches-museum.de/archiv/
URL zur Zitation dieses Beitrages
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=3936&type=stellen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 10:32 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nämlich der Universität Genf aus dem frankophonen Teil der Schweiz:
http://archive-ouverte.unige.ch/outils/Directive_Archive_ouverte_UNIGE.pdf

http://archive-ouverte.unige.ch/outils/Directive_Archive_ouverte_UNIGE.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 02:12 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=7181 samt unvermeidlichem Ulmer-Beitrag im Kommentar.
Rüdiger Wischenbart äußert sich treffend zum Heidelberger Appell:
http://www.perlentaucher.de/artikel/5522.html
Zitat:
Ich habe unlängst einen Artikel über Trends auf internationalen Buchmärkten in einer Zeitschrift veröffentlicht, die in einem der international führenden Wissenschaftsverlage erscheint. Wie dabei üblich bekam ich kein Autorenhonorar, aber eine Zuschrift des Verlages, ich könne gerne diesen Artikel auch auf meiner Homepage veröffentlichen, wenn ich dafür dem Verlag 3.000 US Dollar überweise. Noch einmal: Ich habe diesen Artikel ohne Honorar geschrieben. Eine im "Open Access" erscheinende Zeitschrift wäre da eine prima Alternative gewesen.
Warum Open Access "fehlgeleitet" sein soll, ist schwer nachvollziehbar. Tatsache ist, dass Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich unter wirtschaftlichen Druck gekommen sind, weil die Kosten aus Publikationstätigkeit und Abonnements der entsprechenden Publikationen dramatisch gestiegen sind, so dass diese Einrichtungen über alternative Modelle nachzudenken begannen und eben damit "unternehmerische Initiativen" gesetzt haben (was der Heidelberger Appell kritisiert).
Ergänzend sei noch daran erinnert, dass die Open-Access-Bewegung anfangs aus dem Wunsch entstanden ist, auch ärmeren Ländern den Anschluss an die Informationsgesellschaft zu erschwinglichen Kosten zu ermöglichen. Ist dies "fehlgeleitet"?
Rüdiger Wischenbart äußert sich treffend zum Heidelberger Appell:
http://www.perlentaucher.de/artikel/5522.html
Zitat:
Ich habe unlängst einen Artikel über Trends auf internationalen Buchmärkten in einer Zeitschrift veröffentlicht, die in einem der international führenden Wissenschaftsverlage erscheint. Wie dabei üblich bekam ich kein Autorenhonorar, aber eine Zuschrift des Verlages, ich könne gerne diesen Artikel auch auf meiner Homepage veröffentlichen, wenn ich dafür dem Verlag 3.000 US Dollar überweise. Noch einmal: Ich habe diesen Artikel ohne Honorar geschrieben. Eine im "Open Access" erscheinende Zeitschrift wäre da eine prima Alternative gewesen.
Warum Open Access "fehlgeleitet" sein soll, ist schwer nachvollziehbar. Tatsache ist, dass Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich unter wirtschaftlichen Druck gekommen sind, weil die Kosten aus Publikationstätigkeit und Abonnements der entsprechenden Publikationen dramatisch gestiegen sind, so dass diese Einrichtungen über alternative Modelle nachzudenken begannen und eben damit "unternehmerische Initiativen" gesetzt haben (was der Heidelberger Appell kritisiert).
Ergänzend sei noch daran erinnert, dass die Open-Access-Bewegung anfangs aus dem Wunsch entstanden ist, auch ärmeren Ländern den Anschluss an die Informationsgesellschaft zu erschwinglichen Kosten zu ermöglichen. Ist dies "fehlgeleitet"?
KlausGraf - am Dienstag, 23. Juni 2009, 00:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der rot-rote Senat in Berlin hat heute auf seiner Klausurtagung zum Haushalt den Bau einer neuen Landesbibliothek und einer Kunsthalle beschlossen. Die Landesbibliothek soll am Tempelhofer Damm entstehen. Der Etat 2010/11 sieht für den Neubau der Bibliothek 270 Millionen Euro vor. Baubeginn soll frühestens 2014 sein.
Literatur-blog - am Montag, 22. Juni 2009, 20:09 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige Funde, geordnet nach der Zahl der Follower (Stand: jetzt). Spamfollower z.B. beim Kindermuseum Wien wurden mitgezählt.
Mercedes-Benz-Museum 680
http://twitter.com/MB_Museum
Schuhmuseum Salzbergen (in Planung) 513
http://twitter.com/schuhmuseum
Städel Museum Frankfurt 387
http://m.twitter.com/staedelmuseum
Schirn Kunsthalle Frankfurt 263
http://twitter.com/SCHIRN
Museum Villa Stuck München 233
http://twitter.com/villastuck
Buchstabenmuseum eV 231
http://twitter.com/BMeV
Müritzeum (eher Zoo) 182
http://twitter.com/mueritzeum
Kunstverein Wiesbaden 121
https://twitter.com/kunstverein
Eishockeymuseum 90
http://twitter.com/eishockeymuseum
Liebighaus Frankfurt 83
http://twitter.com/Liebieghaus
THE KENNEDYS Berlin 63
http://twitter.com/THE_KENNEDYS
Haus der Musik Wien 48
http://twitter.com/hausdermusik
Kunstmuseum Stuttgart 47
http://twitter.com/kunstmuseum
Sisi-Museum Wien 33
http://twitter.com/hofburg_vienna
DDR-Museum Berlin 28
https://twitter.com/ddrmuseum
Kindermuseum Wien 21
http://twitter.com/kindermuseum
Hofmobiliendepot Wien 13
http://twitter.com/moebel_museum
Marta Herford 7
http://twitter.com/martamuseum
***
Verwandtes
Jörn Brunotte, Museumsberater 805
http://twitter.com/jbrunotte
Museumsportal Berlin 469
http://twitter.com/museumsportal
Museumsverband BRB 6
http://twitter.com/MV_BRB
Ergänzungen gern in den Kommentaren!
Update: 23.6.2009
Heimatmuseum Falkensee (Brandenburg)
http://twitter.com/museumfalkensee
Update 22.7.2009
Lehmbruck-Museum Duisburg
http://twitter.com/LehmbruckMuseum
Alamannenmuseum Ellwangen
http://twitter.com/alamannenmuseum
Nachtrag aus den Kommentaren
Update 2.9.2009
Museum Weltkulturen Frankfurt am Main
http://www.twitter.com/weltkulturenffm
Update:
Museums on Twitter July 09
http://www.museummarketing.co.uk/?p=171&cpage=1

Mercedes-Benz-Museum 680
http://twitter.com/MB_Museum
Schuhmuseum Salzbergen (in Planung) 513
http://twitter.com/schuhmuseum
Städel Museum Frankfurt 387
http://m.twitter.com/staedelmuseum
Schirn Kunsthalle Frankfurt 263
http://twitter.com/SCHIRN
Museum Villa Stuck München 233
http://twitter.com/villastuck
Buchstabenmuseum eV 231
http://twitter.com/BMeV
Müritzeum (eher Zoo) 182
http://twitter.com/mueritzeum
Kunstverein Wiesbaden 121
https://twitter.com/kunstverein
Eishockeymuseum 90
http://twitter.com/eishockeymuseum
Liebighaus Frankfurt 83
http://twitter.com/Liebieghaus
THE KENNEDYS Berlin 63
http://twitter.com/THE_KENNEDYS
Haus der Musik Wien 48
http://twitter.com/hausdermusik
Kunstmuseum Stuttgart 47
http://twitter.com/kunstmuseum
Sisi-Museum Wien 33
http://twitter.com/hofburg_vienna
DDR-Museum Berlin 28
https://twitter.com/ddrmuseum
Kindermuseum Wien 21
http://twitter.com/kindermuseum
Hofmobiliendepot Wien 13
http://twitter.com/moebel_museum
Marta Herford 7
http://twitter.com/martamuseum
***
Verwandtes
Jörn Brunotte, Museumsberater 805
http://twitter.com/jbrunotte
Museumsportal Berlin 469
http://twitter.com/museumsportal
Museumsverband BRB 6
http://twitter.com/MV_BRB
Ergänzungen gern in den Kommentaren!
Update: 23.6.2009
Heimatmuseum Falkensee (Brandenburg)
http://twitter.com/museumfalkensee
Update 22.7.2009
Lehmbruck-Museum Duisburg
http://twitter.com/LehmbruckMuseum
Alamannenmuseum Ellwangen
http://twitter.com/alamannenmuseum
Nachtrag aus den Kommentaren
Update 2.9.2009
Museum Weltkulturen Frankfurt am Main
http://www.twitter.com/weltkulturenffm
Update:
Museums on Twitter July 09
http://www.museummarketing.co.uk/?p=171&cpage=1

http://archiv.twoday.net/stories/5102167/ wurde aktualisiert.
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 18:26 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 18:08 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
For immediate release:
June 5, 2009
For more information, contact:
Julia Blixrud
Association of Research Libraries
202-296-2296
jblix@arl.org
ARL Encourages Members to Refrain from Signing Nondisclosure or Confidentiality Clauses
Members Also Encouraged to Share Agreement Content
Washington DC—The Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors voted in support of a resolution introduced by its Scholarly Communication Steering Committee to strongly encourage ARL member libraries to refrain from signing agreements with publishers or vendors, either individually or through consortia, that include nondisclosure or confidentiality clauses. In addition, the Board encourages ARL members to share upon request from other libraries information contained in these agreements (save for trade secrets or proprietary technical details) for licensing content, licensing software or other tools, and for digitization contracts with third-party vendors.
The Board adopted this position at the ARL Membership Meeting in Houston, Texas, on May 22. The resolution was prepared in response to the concerns of membership that, as the amount of licensed content has increased, especially through packages of publications, nondisclosure or confidentiality clauses have had a negative impact on effective negotiations. The Scholarly Communication Steering Committee took the position that an open market will result in better licensing terms. In their discussions, the committee also noted the value of encouraging research projects and other efforts to gather information about the current market and licensing terms, such as an initiative being undertaken by Ted Bergstrom, University of California, Santa Barbara, Paul Courant, University of Michigan, and Preston McAfee, Cal Tech, to acquire information on bundled site-license contracts. A panel session on collaboration held later in the Membership Meeting included informal polls of members and the results indicated high levels of agreement and a positive commitment for making this information public when possible.
“Openness, transparency, and collaborative action have been the hallmarks of the library profession and the scholarly community,” said Jim Neal, Columbia University, and Chair of the ARL Scholarly Communication Steering Committee. “It is incumbent upon us to share information about these major contracts we are signing on behalf of our library users.”
“While research libraries may have in the past tolerated these clauses in order to achieve a lower cost,” acknowledged Charles B. Lowry, ARL Executive Director, “the current economic crisis marks a fundamentally different circumstance in the relationship between libraries, publishers, and other vendors.” ARL will be establishing a mechanism by which its members can share information with one another about their agreements.
The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.
P.S.: Über die Mailingliste der ARL-Bibliotheksdirektoren ging am Freitag die Nachricht, dass der Whitman County Superior Court einen Antrag auf einstweilige Verfügung von Elsevier abgelehnt hat, mit dem der Verlag der Washington State University untersagen wollte, einem Public Records Request zu entsprechen, den Ted Bergstrom, Paul Courant und Preston McAfee zum Lizenzvertrag von Elsevier mit WSU gestellt hatten. Elsevier sah "confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae" verletzt, das Gericht hat "Full Disclosure" verfügt.
Update 24. Juni: Julia Blixrud hat mir soeben die offizielle Pressemitteilung geschickt:
Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision
Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State
For immediate release:
June 23, 2009
For more information, contact:
Julia C. Blixrud
Association of Research Libraries
202-296-2296
jblix@arl.org
Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision
Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State
Washington DC--An injunction filed by Elsevier to block release of information included in a licensing contract between the publisher and Washington State University (WSU) was denied by a court in the state of Washington last week. A public-records request for contract terms had been submitted to the university by researchers gathering data on the terms of large-publisher bundled contracts.
Whitman County Superior Court, State of Washington, ruled Friday, June 19, 2009, in favor of full disclosure for a public-records request submitted to Washington State University by Ted Bergstrom, Paul Courant, and Preston McAfee for license information regarding the WSU-Elsevier contract. On June 9, Elsevier had filed a Motion for Injunction against release of the data. According to court papers, the plaintiff argued that disclosure of the Elsevier-WSU contracts would "disclose aspects of Elsevier's pricing methods and formula so as to produce private gain and public loss. Such disclosure would violate Elsevier's rights under Washington statutes...to preserve the confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae."
"We could see no reason why the open-records request should not be fulfilled in this case," said Jay Starratt, Dean of Libraries, Washington State University. "As a member of ARL's Scholarly Communication Committee, I am interested in the results of the data analysis being conducted by the researchers."
Researchers Ted Bergstrom, Professor of Economics, University of California, Santa Barbara, and Paul Courant, University Librarian, Dean of Libraries, and Professor of Public Policy, Economics, and Information, University of Michigan, said, "We believe that state open-access laws serve the public interest by requiring full transparency of contracts that involve millions of taxpayer dollars. We will continue to collect and analyze the terms of 'Big Deal' contracts signed by a large number of universities and to share this information with the library community. We appreciate the efforts of university librarians who have helped us to collect contract information and we are grateful for ARL's support and encouragement."
It is not enough for institutions to assume that public-records requests will ensure that information about contracts and licenses can be made publicly accessible. Last month, the Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors supported a resolution to encourage its members to refrain from signing nondisclosure agreements with publishers and to share information about their agreements, insofar as possible, with each other. Tom Leonard, President of ARL and University Librarian, University of California, Berkeley, said, "By responding to an open-records case in this manner, Elsevier has only increased our resolve to push for both open contracts and public disclosure of terms in our negotiations. This case is a telling example of why we should not be signing these nondisclosure agreements."
The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.
Association of Research Libraries
21 Dupont Circle NW, Suite 800 | Washington DC 20036 | 202-296-2296
www.arl.org
June 5, 2009
For more information, contact:
Julia Blixrud
Association of Research Libraries
202-296-2296
jblix@arl.org
ARL Encourages Members to Refrain from Signing Nondisclosure or Confidentiality Clauses
Members Also Encouraged to Share Agreement Content
Washington DC—The Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors voted in support of a resolution introduced by its Scholarly Communication Steering Committee to strongly encourage ARL member libraries to refrain from signing agreements with publishers or vendors, either individually or through consortia, that include nondisclosure or confidentiality clauses. In addition, the Board encourages ARL members to share upon request from other libraries information contained in these agreements (save for trade secrets or proprietary technical details) for licensing content, licensing software or other tools, and for digitization contracts with third-party vendors.
The Board adopted this position at the ARL Membership Meeting in Houston, Texas, on May 22. The resolution was prepared in response to the concerns of membership that, as the amount of licensed content has increased, especially through packages of publications, nondisclosure or confidentiality clauses have had a negative impact on effective negotiations. The Scholarly Communication Steering Committee took the position that an open market will result in better licensing terms. In their discussions, the committee also noted the value of encouraging research projects and other efforts to gather information about the current market and licensing terms, such as an initiative being undertaken by Ted Bergstrom, University of California, Santa Barbara, Paul Courant, University of Michigan, and Preston McAfee, Cal Tech, to acquire information on bundled site-license contracts. A panel session on collaboration held later in the Membership Meeting included informal polls of members and the results indicated high levels of agreement and a positive commitment for making this information public when possible.
“Openness, transparency, and collaborative action have been the hallmarks of the library profession and the scholarly community,” said Jim Neal, Columbia University, and Chair of the ARL Scholarly Communication Steering Committee. “It is incumbent upon us to share information about these major contracts we are signing on behalf of our library users.”
“While research libraries may have in the past tolerated these clauses in order to achieve a lower cost,” acknowledged Charles B. Lowry, ARL Executive Director, “the current economic crisis marks a fundamentally different circumstance in the relationship between libraries, publishers, and other vendors.” ARL will be establishing a mechanism by which its members can share information with one another about their agreements.
The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.
P.S.: Über die Mailingliste der ARL-Bibliotheksdirektoren ging am Freitag die Nachricht, dass der Whitman County Superior Court einen Antrag auf einstweilige Verfügung von Elsevier abgelehnt hat, mit dem der Verlag der Washington State University untersagen wollte, einem Public Records Request zu entsprechen, den Ted Bergstrom, Paul Courant und Preston McAfee zum Lizenzvertrag von Elsevier mit WSU gestellt hatten. Elsevier sah "confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae" verletzt, das Gericht hat "Full Disclosure" verfügt.
Update 24. Juni: Julia Blixrud hat mir soeben die offizielle Pressemitteilung geschickt:
Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision
Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State
For immediate release:
June 23, 2009
For more information, contact:
Julia C. Blixrud
Association of Research Libraries
202-296-2296
jblix@arl.org
Elsevier Motion to Block License Release Denied in Open-Records Decision
Full Disclosure of Public Records Favored in Washington State
Washington DC--An injunction filed by Elsevier to block release of information included in a licensing contract between the publisher and Washington State University (WSU) was denied by a court in the state of Washington last week. A public-records request for contract terms had been submitted to the university by researchers gathering data on the terms of large-publisher bundled contracts.
Whitman County Superior Court, State of Washington, ruled Friday, June 19, 2009, in favor of full disclosure for a public-records request submitted to Washington State University by Ted Bergstrom, Paul Courant, and Preston McAfee for license information regarding the WSU-Elsevier contract. On June 9, Elsevier had filed a Motion for Injunction against release of the data. According to court papers, the plaintiff argued that disclosure of the Elsevier-WSU contracts would "disclose aspects of Elsevier's pricing methods and formula so as to produce private gain and public loss. Such disclosure would violate Elsevier's rights under Washington statutes...to preserve the confidentiality of its proprietary pricing methods and formulae."
"We could see no reason why the open-records request should not be fulfilled in this case," said Jay Starratt, Dean of Libraries, Washington State University. "As a member of ARL's Scholarly Communication Committee, I am interested in the results of the data analysis being conducted by the researchers."
Researchers Ted Bergstrom, Professor of Economics, University of California, Santa Barbara, and Paul Courant, University Librarian, Dean of Libraries, and Professor of Public Policy, Economics, and Information, University of Michigan, said, "We believe that state open-access laws serve the public interest by requiring full transparency of contracts that involve millions of taxpayer dollars. We will continue to collect and analyze the terms of 'Big Deal' contracts signed by a large number of universities and to share this information with the library community. We appreciate the efforts of university librarians who have helped us to collect contract information and we are grateful for ARL's support and encouragement."
It is not enough for institutions to assume that public-records requests will ensure that information about contracts and licenses can be made publicly accessible. Last month, the Association of Research Libraries (ARL) Board of Directors supported a resolution to encourage its members to refrain from signing nondisclosure agreements with publishers and to share information about their agreements, insofar as possible, with each other. Tom Leonard, President of ARL and University Librarian, University of California, Berkeley, said, "By responding to an open-records case in this manner, Elsevier has only increased our resolve to push for both open contracts and public disclosure of terms in our negotiations. This case is a telling example of why we should not be signing these nondisclosure agreements."
The Association of Research Libraries (ARL) is a nonprofit organization of 123 research libraries in North America. Its mission is to influence the changing environment of scholarly communication and the public policies that affect research libraries and the diverse communities they serve. ARL pursues this mission by advancing the goals of its member research libraries, providing leadership in public and information policy to the scholarly and higher education communities, fostering the exchange of ideas and expertise, and shaping a future environment that leverages its interests with those of allied organizations. ARL is on the Web at http://www.arl.org/.
Association of Research Libraries
21 Dupont Circle NW, Suite 800 | Washington DC 20036 | 202-296-2296
www.arl.org
BCK - am Montag, 22. Juni 2009, 18:02 - Rubrik: English Corner
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/codheidnf9
Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe
http://www.handschriftencensus.de/21636
Teilausgabe des überlieferten Textes:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862
Mein NDB-Artikel über den Autor:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424
Update:
Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599
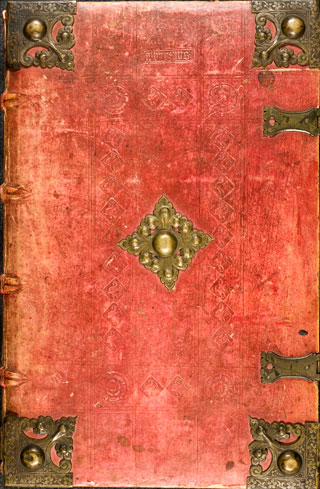
Zur 1997 von der Uni Heidelberg erworbenen Handschrift der Sammlung Ludwig (danach Malibu) siehe
http://www.handschriftencensus.de/21636
Teilausgabe des überlieferten Textes:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hofmann1862
Mein NDB-Artikel über den Autor:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424
Update:
Auch Heid. Hs. 3599 des gleichen Werks ist online
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3599
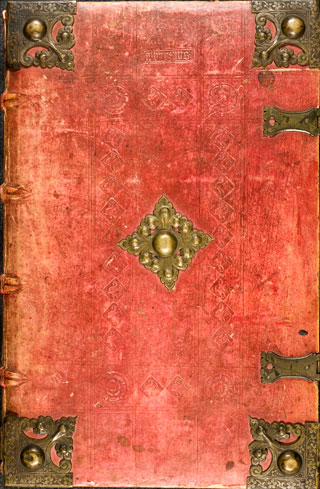
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:44 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rp-online.de/public/article/meerbusch/721660/Googles-Blick-in-die-Intimsphaere.html
Natürlich ist das eine Verletzung der Intimsphäre. Ich war selbst bass erstaunt, als ich den Kamerawagen in meinem Heimatort Jüchen gesehen habe.
Wer nicht weiß, dass im Vorüberfahren straßenseitig aufgenommene Hausansichten nicht das geringste mit Intimsphäre zu tun haben, hat sich offensichtlich bewusst entschlossen, die Öffentlichkeit irrezuführen.
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
 Axel Mauruszat CC-BY
Axel Mauruszat CC-BY
Natürlich ist das eine Verletzung der Intimsphäre. Ich war selbst bass erstaunt, als ich den Kamerawagen in meinem Heimatort Jüchen gesehen habe.
Wer nicht weiß, dass im Vorüberfahren straßenseitig aufgenommene Hausansichten nicht das geringste mit Intimsphäre zu tun haben, hat sich offensichtlich bewusst entschlossen, die Öffentlichkeit irrezuführen.
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
 Axel Mauruszat CC-BY
Axel Mauruszat CC-BYKlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:16 - Rubrik: Archivrecht
http://www.egms.de/de/journals/mbi/2009-9/mbi000139.shtml
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
Repositorien: Der grüne Weg zu Open Access Publishing aus der Perspektive einer Forschungsförderungsorganisation: 10 Fragen von Bruno Bauer an Falk Reckling, Mitarbeiter des FWF Der Wissenschaftsfonds
Zitat:
Wenn sich das bisherige Publikationssystem der Zeitschriftenabonnements und -lizenzen bewährt hätte, dann wäre es schwer verständlich, wie es zur „Zeitschriftenkrise“ und auch zur Open Access Bewegung gekommen ist. Die Open Access Bewegung ist ja keine Erfindung der Wissenschaftsbürokratie, sondern hat sich aus dem vitalen Bedürfnis der Scientific Community gespeist, auf Forschungsergebnisse, die von ihr produziert wurden, auch freien Zugang zu haben (Hierzu kann ich nur empfehlen, was der Medizinnobelpreisträger Harold Varmus als Wissenschaftler wie als NIH-Chef dazu geschrieben hat [1]).
Des weiteren sehe ich prinzipiell wie auch empirisch keine Anzeichen dafür, dass sich das bisherige System in Fragen der Qualität, des Impacts oder der Finanzierung von dem des Open Access unterscheidet:
Zunächst gibt auch im alten System in diesen Punkten eine erhebliche Varianz. Ein Aspekt der Zeitschriftenkrise war ja, dass es – wie die Gebrüder Bergstrom mit der Datenbank http://www.journalprices.com/ zeigen – bei vielen Zeitschriften kaum eine positive Korrelation zwischen Impactleistung und Preis gibt.
Open Access Publikationen unterliegen genau den gleichen „Gesetzen“ wie jede neue Zeitschrift im alten System: es braucht Zeit bis die entsprechende Reputation aufgebaut ist.
Wenn man bedenkt, dass Open Access (Green wie Gold Road) systematisch erst seit einigen Jahren betrieben wird, dann ist erstaunlich, in welchem Ausmaß Qualität und Impact sich bereits entwickelt haben. Damit meine ich nicht nur „Flaggschiffe“ wie die Zeitschriften von PLOS. Für viele Disziplinen gibt es mittlerweile einige empirische Evidenzen, dass Open Access signifikant den Impact der Publikationen erhöhen kann (siehe u.a. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).
Aber zurück zu den Beweggründen des FWF. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe: (1) Öffentlich finanzierte Forschung ist geradezu verpflichtet, die Produkte des öffentlichen Gutes „Wissenschaft“ so weit als möglich frei und kostengünstig zugänglich zu machen. (2) Weiterhin ist es im Interesse jeder Förderorganisation, dass die Ergebnisse ihrer Förderungen eine möglichst große Verbreitung finden. (3) Und schließlich gibt auch eine ökonomische Verantwortung. Derzeit konzentriert sich der STM-Markt auf drei bis vier marktbeherrschende „Big Player“, und das bei einem Markt, bei dem ein Großteil der Produktkosten und Abnahme von öffentlichen Mitteln getragen, die Gewinne aber privatisiert werden. Hier bietet Open Access die Möglichkeit, den Wettbewerb um Publikationsmodelle wieder zu vitalisieren, indem es profitorientierten wie auch nicht-profitorientierten Alternativmodellen Marktzugangschancen eröffnet.

GMS Medizin – Bibliothek – Information.
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
Repositorien: Der grüne Weg zu Open Access Publishing aus der Perspektive einer Forschungsförderungsorganisation: 10 Fragen von Bruno Bauer an Falk Reckling, Mitarbeiter des FWF Der Wissenschaftsfonds
Zitat:
Wenn sich das bisherige Publikationssystem der Zeitschriftenabonnements und -lizenzen bewährt hätte, dann wäre es schwer verständlich, wie es zur „Zeitschriftenkrise“ und auch zur Open Access Bewegung gekommen ist. Die Open Access Bewegung ist ja keine Erfindung der Wissenschaftsbürokratie, sondern hat sich aus dem vitalen Bedürfnis der Scientific Community gespeist, auf Forschungsergebnisse, die von ihr produziert wurden, auch freien Zugang zu haben (Hierzu kann ich nur empfehlen, was der Medizinnobelpreisträger Harold Varmus als Wissenschaftler wie als NIH-Chef dazu geschrieben hat [1]).
Des weiteren sehe ich prinzipiell wie auch empirisch keine Anzeichen dafür, dass sich das bisherige System in Fragen der Qualität, des Impacts oder der Finanzierung von dem des Open Access unterscheidet:
Zunächst gibt auch im alten System in diesen Punkten eine erhebliche Varianz. Ein Aspekt der Zeitschriftenkrise war ja, dass es – wie die Gebrüder Bergstrom mit der Datenbank http://www.journalprices.com/ zeigen – bei vielen Zeitschriften kaum eine positive Korrelation zwischen Impactleistung und Preis gibt.
Open Access Publikationen unterliegen genau den gleichen „Gesetzen“ wie jede neue Zeitschrift im alten System: es braucht Zeit bis die entsprechende Reputation aufgebaut ist.
Wenn man bedenkt, dass Open Access (Green wie Gold Road) systematisch erst seit einigen Jahren betrieben wird, dann ist erstaunlich, in welchem Ausmaß Qualität und Impact sich bereits entwickelt haben. Damit meine ich nicht nur „Flaggschiffe“ wie die Zeitschriften von PLOS. Für viele Disziplinen gibt es mittlerweile einige empirische Evidenzen, dass Open Access signifikant den Impact der Publikationen erhöhen kann (siehe u.a. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).
Aber zurück zu den Beweggründen des FWF. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe: (1) Öffentlich finanzierte Forschung ist geradezu verpflichtet, die Produkte des öffentlichen Gutes „Wissenschaft“ so weit als möglich frei und kostengünstig zugänglich zu machen. (2) Weiterhin ist es im Interesse jeder Förderorganisation, dass die Ergebnisse ihrer Förderungen eine möglichst große Verbreitung finden. (3) Und schließlich gibt auch eine ökonomische Verantwortung. Derzeit konzentriert sich der STM-Markt auf drei bis vier marktbeherrschende „Big Player“, und das bei einem Markt, bei dem ein Großteil der Produktkosten und Abnahme von öffentlichen Mitteln getragen, die Gewinne aber privatisiert werden. Hier bietet Open Access die Möglichkeit, den Wettbewerb um Publikationsmodelle wieder zu vitalisieren, indem es profitorientierten wie auch nicht-profitorientierten Alternativmodellen Marktzugangschancen eröffnet.

KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 17:09 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.freitag.de/kultur/0924-afghanistan-buechervernichtung (via http://log.netbib.de )
Vor 1.400 Jahren, als arabische Muslime zum ersten Mal in das von Persern bewohnte Gebiet einfielen, stießen sie auf eine eindrucksvolle Bibliothek, die unter dem Namen Jundi Shpur bekannt ist. Sie war die größte ihrer Art und befand sich in der größten Bibliothek jener Zeit. Der Kommandeur der arabischen Truppen, Sa’ad Ibn Abi Waqas, wandte sich in einem Brief an seinen Vorgesetzten und fragte ihn, was mit den Büchern geschehen solle. Die Antwort lautete, er möge überprüfen, ob der Inhalt der Bücher mit dem Koran übereinstimme. Stimme er überein, seien die Bücher überflüssig, denn der Koran sei ja bereits überall erhältlich und allgemein zugänglich. Hätten die Bücher nichts mit dem Koran zu tun, seien sie ohnehin nutzlos. Also ließ der Kommandeur die Bibliothek mitsamt den Büchern niederbrennen.
Vergangene Woche ließ die afghanische Regierung zehntausende von Büchern in einen Fluss werfen.
 G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg
G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg
Vor 1.400 Jahren, als arabische Muslime zum ersten Mal in das von Persern bewohnte Gebiet einfielen, stießen sie auf eine eindrucksvolle Bibliothek, die unter dem Namen Jundi Shpur bekannt ist. Sie war die größte ihrer Art und befand sich in der größten Bibliothek jener Zeit. Der Kommandeur der arabischen Truppen, Sa’ad Ibn Abi Waqas, wandte sich in einem Brief an seinen Vorgesetzten und fragte ihn, was mit den Büchern geschehen solle. Die Antwort lautete, er möge überprüfen, ob der Inhalt der Bücher mit dem Koran übereinstimme. Stimme er überein, seien die Bücher überflüssig, denn der Koran sei ja bereits überall erhältlich und allgemein zugänglich. Hätten die Bücher nichts mit dem Koran zu tun, seien sie ohnehin nutzlos. Also ließ der Kommandeur die Bibliothek mitsamt den Büchern niederbrennen.
Vergangene Woche ließ die afghanische Regierung zehntausende von Büchern in einen Fluss werfen.
 G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpg
G. Doré http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Paulus_Bücherverbrennung.jpgnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Donnelly, M.; Jones, S.: Data Management Plan Content Checklist. Draft Template for Public Consultation. 2009. Online.
http://www.dcc.ac.uk/docs/templates/DMP_checklist.pdf
Green, A. et al.: Policy-making for Research Data in Repositories: A Guide. Version 1.2. 2009. Online.
http://www.disc-uk.org/docs/guide.pdf
Green, T.: We Need Publishing Standards for Data sets and Data Tables. OECD Publishing White Paper. 2009. Online.
http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/publishing-standards-data-2009.pdf
Klump, J.: Digitale Forschungsdaten. In: Neuroth, H. et al.: Nestor Handbuch. Version 2.0. 2009. Online.
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel.php?id=72
Sietmann, R.: Rip. Mix. Publish. Der Wissenschaft steht ein radikaler Wandel im Umgang mit Forschungsdaten bevor. In: c't 14/09, S. 154-161.
UK Data Archive: Managing and sharing data. A best practice guide for researchers. 2009. Online.
http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/managingsharing.pdf
Quelle: Helmholtz-Open-Access-Newsletter
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=252#c1339
http://www.dcc.ac.uk/docs/templates/DMP_checklist.pdf
Green, A. et al.: Policy-making for Research Data in Repositories: A Guide. Version 1.2. 2009. Online.
http://www.disc-uk.org/docs/guide.pdf
Green, T.: We Need Publishing Standards for Data sets and Data Tables. OECD Publishing White Paper. 2009. Online.
http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/publishing-standards-data-2009.pdf
Klump, J.: Digitale Forschungsdaten. In: Neuroth, H. et al.: Nestor Handbuch. Version 2.0. 2009. Online.
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel.php?id=72
Sietmann, R.: Rip. Mix. Publish. Der Wissenschaft steht ein radikaler Wandel im Umgang mit Forschungsdaten bevor. In: c't 14/09, S. 154-161.
UK Data Archive: Managing and sharing data. A best practice guide for researchers. 2009. Online.
http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/managingsharing.pdf
Quelle: Helmholtz-Open-Access-Newsletter
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=252#c1339
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 13:43 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Juni 2009, 03:43 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
".... Vor 210 Jahren: Die Geburtsstunde des Meters. Im Stadtarchiv von Paris wird der aus Platin gefertigte Ur-Meter hinterlegt. ..."
Quelle:
http://www.presseportal.de/pm/60159/1425477/showprep_de
Quelle:
http://www.presseportal.de/pm/60159/1425477/showprep_de
Wolf Thomas - am Montag, 22. Juni 2009, 00:01 - Rubrik: Archivgeschichte
Fortsetzung von: http://archiv.twoday.net/stories/5776766/
Mein PDF (mit unterlegtem Volltext)
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/pdf/Graf_Vener.pdf
wird offenkundig von Google nicht erfasst, sonst würde die Suche nach
axel nuber turmburg
diese Quelle finden. (Ebenso die Suche: utinkofen walter lorch.)
Weder Bing noch Yahoo haben den Volltext, und auch wenn man bei
http://www.metager.de
alle einschlägigen Suchen anklickt, wird nichts gefunden.
Das gleiche gilt für:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5717/pdf/Graf_Debler.pdf
Suchen:
Conrad büschler jung
Philipp von Mossenheim
Auch die Suche bei der Metasuchmaschine
http://www.zuula.com/
nach philipp mossenheim buck ergibt bei den einzelnen Suchmaschinen keinen Treffer für das gesuchte PDF.
Dasselbe Bild bei
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/pdf/Graf_geschichtsschreibung.pdf
Keine Suchmaschine findet das PDF!
Wer der Ansicht ist, dass diese Negativbefunde ja wirklich kein Verlust sind (da Open-Access-Anhänger wie ich eh nur qualitativ Minderwertiges produzieren), wird sich auch dadurch nicht umstimmen lassen, dass der meines Erachtens durchaus wichtige Aufsatz zur Ordensreform ebenfalls fehlt:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/pdf/Graf_ordensreform.pdf
(Suche nach armagnaken horbruck)
Google Scholar gibt kein zutreffendes Bild von den tatsächlichen Zitaten dieses Beitrags, eher schon:
http://books.google.de/books?lr=&q=graf+%22ordensreform+und+literatur%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
Natürlich gilt das nicht nur für mich. Während die Arbeiten von Dieter Mertens auf Freidok überwiegend als Faksimile vorliegen, weisen die Studien von Felix Heinzer ebenfalls E-Texte unter den PDFs auf. Das PDF
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4953/pdf/Heinzer_Die_Koelner_Membra_disiecta_der_Stuttgarter_Schachzabel_Handschrift.pdf
ist nicht im Google-Index. Auch bei den anderen Suchmaschinen wird man nach Ausweis von Metager und Zuula nicht fündig.
Zurück zu mir. Den Volltext meines Beitrags zu Prüfungsunterlagen (PDF) in der DB Thüringen hat von Google, Bing und Yahoo nur Yahoo. Metager findet ihn zusätzlich auch noch via HSS-Suche und Abacho.de.
Glaubt man dieser Suche, so ist von meinen PDFs auf Freidok nur ein einziges (Schwabensagen) im Index von Yahoo. Wenn ich mich nicht verzählt habe, finde ich bei Bing (kein mir bekannter PDF-Filter!) nur sieben PDFs von mir auf Freidok als Volltext (alle auch bei Google, das ja 28 meiner 38 Volltexte auf Freidok hat).
Daraus ergibt sich: Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Volltexte auf den Schriftservern ist von keiner Suchmaschine erfasst, selbst nicht von Google, das am meisten PDFs erfasst.
Mein PDF (mit unterlegtem Volltext)
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/pdf/Graf_Vener.pdf
wird offenkundig von Google nicht erfasst, sonst würde die Suche nach
axel nuber turmburg
diese Quelle finden. (Ebenso die Suche: utinkofen walter lorch.)
Weder Bing noch Yahoo haben den Volltext, und auch wenn man bei
http://www.metager.de
alle einschlägigen Suchen anklickt, wird nichts gefunden.
Das gleiche gilt für:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5717/pdf/Graf_Debler.pdf
Suchen:
Conrad büschler jung
Philipp von Mossenheim
Auch die Suche bei der Metasuchmaschine
http://www.zuula.com/
nach philipp mossenheim buck ergibt bei den einzelnen Suchmaschinen keinen Treffer für das gesuchte PDF.
Dasselbe Bild bei
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/pdf/Graf_geschichtsschreibung.pdf
Keine Suchmaschine findet das PDF!
Wer der Ansicht ist, dass diese Negativbefunde ja wirklich kein Verlust sind (da Open-Access-Anhänger wie ich eh nur qualitativ Minderwertiges produzieren), wird sich auch dadurch nicht umstimmen lassen, dass der meines Erachtens durchaus wichtige Aufsatz zur Ordensreform ebenfalls fehlt:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/pdf/Graf_ordensreform.pdf
(Suche nach armagnaken horbruck)
Google Scholar gibt kein zutreffendes Bild von den tatsächlichen Zitaten dieses Beitrags, eher schon:
http://books.google.de/books?lr=&q=graf+%22ordensreform+und+literatur%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
Natürlich gilt das nicht nur für mich. Während die Arbeiten von Dieter Mertens auf Freidok überwiegend als Faksimile vorliegen, weisen die Studien von Felix Heinzer ebenfalls E-Texte unter den PDFs auf. Das PDF
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4953/pdf/Heinzer_Die_Koelner_Membra_disiecta_der_Stuttgarter_Schachzabel_Handschrift.pdf
ist nicht im Google-Index. Auch bei den anderen Suchmaschinen wird man nach Ausweis von Metager und Zuula nicht fündig.
Zurück zu mir. Den Volltext meines Beitrags zu Prüfungsunterlagen (PDF) in der DB Thüringen hat von Google, Bing und Yahoo nur Yahoo. Metager findet ihn zusätzlich auch noch via HSS-Suche und Abacho.de.
Glaubt man dieser Suche, so ist von meinen PDFs auf Freidok nur ein einziges (Schwabensagen) im Index von Yahoo. Wenn ich mich nicht verzählt habe, finde ich bei Bing (kein mir bekannter PDF-Filter!) nur sieben PDFs von mir auf Freidok als Volltext (alle auch bei Google, das ja 28 meiner 38 Volltexte auf Freidok hat).
Daraus ergibt sich: Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Volltexte auf den Schriftservern ist von keiner Suchmaschine erfasst, selbst nicht von Google, das am meisten PDFs erfasst.
KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 22:59 - Rubrik: Open Access
http://www.opendoar.org/search.php
Zur Kritik aus der Sicht des Dataminers Murray-Rust:
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2127
OpenDOAR bietet eine Google Custom Search Engine an, die Inhalte definierter Repositorien durchsuchen soll. Eine solche Suche ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn alle Treffer von ihr gefunden werden, die die Google Websuche auch findet.
Das ist offenkundig nicht der Fall!
Die Custom Search erlaubt keine Sucheingrenzung mittels erweiterter Suche.
Google hat 28 von meinen 38 in Freidok vorhandenen PDFs:
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2123#comments
Bei der Suche nach klaus graf freidok in OpenDOAR wird kein einziges PDF und kein einziger Volltexteingang gefunden, lediglich einige Freidok-Trefferlisten. Selbstverständlich ist Freidok unter den von OpenDOAR erfassten Repositorien!
Google-Websuche hat allein für die Freidok-Domain 374 Treffer zu klaus graf freidok.
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGGL_de___DE215&q=+site:www.freidok.uni-freiburg.de+klaus+graf+freidok
Nun könnte man der Ansicht sein, klaus graf freidok sei keine realistische Suche. Aber wenn man nach klaus graf gmünd sucht, so sollte man eigentlich eine Menge Treffer in Freidok finden.
Gefunden werden von OpenDOAR aber nur 5 (4 PDF, 1 Volltexteingang)!
Google-Websuche hat - eingegrenzt auf Freidok - dagegen 107 Treffer!
Die Suche nach
"graf klaus" geschichtsschreibung
findet in OpenDOAR nur 1 Volltext-Eingang in Freidok. Die gleiche Suche - wieder eingeschränkt auf site:www.freidok.uni-freiburg.de - erbringt 25 Treffer. (In der Trefferliste erscheinen 26, aber es sind nur 25. Die Volltextsuche von Freidok ist eine Google-Suche beschränkt auf die Freidok-Domain, sie hat ebenfalls die 25 Treffer.)
Google Scholar hat nur einen kleinen Teil der Freidok-Dokumente.
"graf klaus" freidok 3 PDF, 2 Volltexteingänge (aber nicht mit grünem Dreieck als Volltexte gekennzeichnet!)
freidok author:graf hat die gleichen 5 (Trefferliste)
"graf klaus" geschichtsschreibung: 2 Freidok-Volltexte
Daraus ergibt sich: Aufgrund beliebig ausgelassener Suchresultate der Google-Websuche ist die auf Repositorien beschränkte Custom-Search OpenDOAR für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar.
Zur Kritik aus der Sicht des Dataminers Murray-Rust:
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2127
OpenDOAR bietet eine Google Custom Search Engine an, die Inhalte definierter Repositorien durchsuchen soll. Eine solche Suche ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn alle Treffer von ihr gefunden werden, die die Google Websuche auch findet.
Das ist offenkundig nicht der Fall!
Die Custom Search erlaubt keine Sucheingrenzung mittels erweiterter Suche.
Google hat 28 von meinen 38 in Freidok vorhandenen PDFs:
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2123#comments
Bei der Suche nach klaus graf freidok in OpenDOAR wird kein einziges PDF und kein einziger Volltexteingang gefunden, lediglich einige Freidok-Trefferlisten. Selbstverständlich ist Freidok unter den von OpenDOAR erfassten Repositorien!
Google-Websuche hat allein für die Freidok-Domain 374 Treffer zu klaus graf freidok.
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGGL_de___DE215&q=+site:www.freidok.uni-freiburg.de+klaus+graf+freidok
Nun könnte man der Ansicht sein, klaus graf freidok sei keine realistische Suche. Aber wenn man nach klaus graf gmünd sucht, so sollte man eigentlich eine Menge Treffer in Freidok finden.
Gefunden werden von OpenDOAR aber nur 5 (4 PDF, 1 Volltexteingang)!
Google-Websuche hat - eingegrenzt auf Freidok - dagegen 107 Treffer!
Die Suche nach
"graf klaus" geschichtsschreibung
findet in OpenDOAR nur 1 Volltext-Eingang in Freidok. Die gleiche Suche - wieder eingeschränkt auf site:www.freidok.uni-freiburg.de - erbringt 25 Treffer. (In der Trefferliste erscheinen 26, aber es sind nur 25. Die Volltextsuche von Freidok ist eine Google-Suche beschränkt auf die Freidok-Domain, sie hat ebenfalls die 25 Treffer.)
Google Scholar hat nur einen kleinen Teil der Freidok-Dokumente.
"graf klaus" freidok 3 PDF, 2 Volltexteingänge (aber nicht mit grünem Dreieck als Volltexte gekennzeichnet!)
freidok author:graf hat die gleichen 5 (Trefferliste)
"graf klaus" geschichtsschreibung: 2 Freidok-Volltexte
Daraus ergibt sich: Aufgrund beliebig ausgelassener Suchresultate der Google-Websuche ist die auf Repositorien beschränkte Custom-Search OpenDOAR für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar.
KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 21:46 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christine Gräfin von Brühl hat mit "Noblesse oblige. Die Kunst, ein adliges Leben zu führen" (Eichborn Verlag, Frankfurt/M. 2009, 253 S., 17,95 Euro) einen amüsanten Führer durch eine erstaunliche Parallelwelt geschrieben, die nicht weniger bizarr anmutet als die Rituale von Anhängern schwarzer Messen.
ISBN-Suche:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783821856957
Besprechungen:
http://www.buecher.de/shop/Buecher/Noblesse-oblige/Bruehl-Christine-Graefin-von/products_products/detail/prod_id/25643492/#perl
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=1704554&em_loc=92
http://www.welt.de/welt_print/article3416374/Kurz-und-knapp.html
http://mediathek.ard.de/ard/servlet/content/1866728 (Audio)
http://www.podcast.at/episoden/christine-gräfin-von-brühl-noblesse-oblige-5063794.html (Audio)
http://news.google.de/archivesearch?q=brühl+noblesse+oblige&btnG=Archiv-Suche&ned=de&hl=de&scoring=a (weitere Nachweise sehr kurzer Besprechungen)
http://derstandard.at/fs/1244460710060/Kiesgeraeusch-Kiesgeraeusch (keine Besprechung, eine Notiz zum Adelsjargon anhand des Buchs)

ISBN-Suche:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783821856957
Besprechungen:
http://www.buecher.de/shop/Buecher/Noblesse-oblige/Bruehl-Christine-Graefin-von/products_products/detail/prod_id/25643492/#perl
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=1704554&em_loc=92
http://www.welt.de/welt_print/article3416374/Kurz-und-knapp.html
http://mediathek.ard.de/ard/servlet/content/1866728 (Audio)
http://www.podcast.at/episoden/christine-gräfin-von-brühl-noblesse-oblige-5063794.html (Audio)
http://news.google.de/archivesearch?q=brühl+noblesse+oblige&btnG=Archiv-Suche&ned=de&hl=de&scoring=a (weitere Nachweise sehr kurzer Besprechungen)
http://derstandard.at/fs/1244460710060/Kiesgeraeusch-Kiesgeraeusch (keine Besprechung, eine Notiz zum Adelsjargon anhand des Buchs)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt das OVG Schleswig in einer Entscheidung zur Veröffentlichung der Namen von Agrarsubventionsempfängern.
http://www.dr-bahr.com/news/daten-der-empfaenger-von-agrarsubventionen-duerfen-im-internet-veroeffentlicht-werden.html
Dem stimme ich zu.
http://www.dr-bahr.com/news/daten-der-empfaenger-von-agrarsubventionen-duerfen-im-internet-veroeffentlicht-werden.html
Dem stimme ich zu.
KlausGraf - am Sonntag, 21. Juni 2009, 14:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bereits mehrfach hat Archivalia sich in einzelnen Beiträgen (Linkliste s. u.) mit dem Thema "Geräuscharchive/Soundscape/Field Recording" beschäftigt. Twitter-Hinweise (Dank an die twitternden Philharmoniker aus Duisburg) und eine heute morgen gesendete Wiederholung der letzten vivo-Sendung (3sat) über Yukio Van Maren King (s. u.) lassen eine Fundzusammenstellung angezeigt erscheinen, damit eine archivische Diskussion um diese nicht uninteressante Quellengattungen geführt werden kann.
Daher gilt: Meinungen Anregungen, Ergänzungen, Fehlerhinweise etc.sind als Kommentare ausdrücklich erwünscht.
Begriffsbestimmungen
Ein Geräuscharchiv (englisch: sound library) ist eine Sammlung von gespeicherten Geräuschen und Klängen, die für die Weiterverarbeitung in Filmen, Hörspielen, Computerspielen und Klanginstallationen, ferner auch in Musik verwendet werden können. Beispielsweise verfügen alle ARD -Anstalten seit den 1950er-Jahren über eigene Geräuscharchive.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4uscharchiv
Der Begriff Soundscape bezeichnet die Gesamtheit einer „klingenden“ Umgebung und wird vor allem in der modernen Musik verwendet. Die geläufigste deutsche Übersetzung lautet „Klanglandschaft“. Dabei wird zwar die plastische Analogie zur visuellen Landschaft verdeutlicht, jedoch lässt der Begriff die notwendige Unschärfe des englischen Begriffes "sound". In Film, Theater und Hörspiel sind die Begriffe Geräuschkulisse bzw. Atmo gebräuchlich.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Soundscape
Als Field Recording bezeichnet man in erster Linie Aufnahmen von Natur- beziehungsweise Umgebungsgeräuschen fernab eines Tonstudios, die unter Zuhilfenahme portabler Aufnahmegeräte entstehen, wie zum Beispiel einem digitalen Voice-Recorder (früher DAT -Rekorder) oder einem Laptop mit externem Interface und geeigneter Aufnahme-Software.
Historisch betrachtet diente diese Technik der Dokumentation und Archivierung kultureller, musikalischer Gegebenheiten und Zusammenhänge. Heutzutage wird sie jedoch häufig im Bereich des Musikgenres Ambient (siehe zum Beispiel lowercase) und der experimentellen Musik angewandt, mit dem Anspruch, den Hörer auf einer klangvollen Reise hin zu unbestimmten Orten zu „transportieren“. Die Steigerung des Field Recording in Sachen Authentizität ist das Field Streaming. Hier werden Töne und Geräusche aus der Natur ohne klangliche Nachbearbeitung im Studio direkt (live) beispielsweise über das Internet (Stream Audio) zum Hörenden übertragen.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Field_recording
Soundscape/Field recordings deutscher Kommunen
Berlin:
"Berlincast.com wurde im Juni 2005 von Yukio Van Maren King gestartet, um unterschiedliche Aufnahmen verschiedener oeffentlichen Orte in Berlin aufzulisten.
Yukio van Maren King lebt in Berlin."
Link
http://www.berlincast.com/
Köln:
"Die Soundmap of Cologne beinhaltet Klangaufnahmen aus dem Kölner Stadtgebiet oder mit direktem Bezug zur Stadt. Kein Viertel wird bevorzugt behandelt oder vernachlässigt. Jedes Veedel wird irgendwann einmal als kurzer Ohrenblick auf der Klangkarte-Köln zu hören sein.
Kölner Klangarchiv für Ortskundige und Fremde
Die ehrenamtlichen Klängesammler, die die Soundmap mit Stadtteilgeräuschen füllen, bauen Schritt für Schritt ein Archiv auf, das nicht nur Kölner Bürgern, sondern auch Ortsunkundigen zur Verfügung steht, um den Klangcharakter der Stadt zu erforschen.
Heute und zukünftig kann man mit den vorhandenen Aufnahmen der Soundmap of Cologne feststellen, inwieweit sich der Klang der Stadt verändern wird. Steigt der Verkehrslärm in bestimmten Ortsteilen an, sprechen die Menschen auf einmal andere Sprachen in ihren Veedeln oder singen vielleicht mehr oder weniger Vögel in Zukunft? Solche Vergleiche macht das Klangarchiv Soundmap of Cologne möglich.
Mitmach-Projekt Soundmap of Cologne
Die Soundmap of Cologne ist ein Partizipationsprojekt: Wenn sie selbst Lust am Sammeln von Kölner Geräuschen und Klängen haben oder den Machern der Klangkarte einen besonderen Klangort in Köln vorstellen möchten, dann nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf. Jedes Jahr veranstaltet die Soundmap of Cologne rmxCGN, ein Remix-Projekt, das Musiker auffordert die Klänge der Soundmap für ihre Kompositionen zu nutzen. Im Anschluss erscheinen die eingereichten Remix-Stücke auf einem Album.
Copyright und Nutzung der Klangschnippsel auf Soundmap of Cologne
Alle Aufnahmen der Soundmap of Cologne stehen kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung und dürfen ausdrücklich für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden. Das Audiomaterial ist unter Creative Commons, dem schöpferischen Allgemeingut und Eigentum, erschienen. Sie müssen lediglich Soundmap of Cologne als Urheber nennen, ihr neues Werk unter den selben Bedingungen wieder veröffentlichen und dürfen mit den benutzten Aufnahmen kein Geld verdienen. Mehr muss man nicht beachten. Erfahren sie mehr über die geltende Creative Commons Lizenz der Soundmap of Cologne."
Link
http://soundmap-cologne.de/
Geislingen:
"Man sei ganz Ohr für die Seite, die fortan im Internet aufgeschlagen wird.
heima®t enthält zahlreiche ausgewählte Field Recordings, die in und um Geislingen an der Steige aufgenommen wurden. Unter Field Recordings versteht man Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen fernab von Tonstudios unter Zuhilfenahme portabler Aufnahmegeräte. Bei den Aufnahmen wurde und wird versucht, kein bestimmtes Gebiet zu bevorzugen, sondern die gesamte Bandbreite der vorhandenen Klangeindrücke zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Nach und nach wird damit die Klangwelt der Fünftälerstadt auch in der digitalen Welt des Internets verfügbar sein. So kann man hier im Zuge einer akustischen Sammlung beispielsweise das Geräuschpensum einer bestimmten Lokalität zu ihren verschiedenen Zeiten anhören, womit die auditive Dynamik der Stadt nachvollzogen wird. Bilder und kurze Texte sollen nur unterstützend wirken und vor allem denen, die die Stadt nicht kennen, einen visuellen Eindruck der gehörten Örtlichkeiten liefern.
Im Laufe der Zeit wird heima®t sich zu einem Klangarchiv der Stadt entwickeln. In diesem Sinne kann jeder, der gern genauer hinhorcht, seine eigene Note dazu beisteuern. Es ist der ausdrückliche Wunsch, dass viele Menschen sich daran beteiligen, sei es mit Hinweisen auf interessante Plätze oder eigenen Tonaufnahmen. Passen diese in das Konzept von heima®t, so finden sie dankbare Aufnahme in das Geräuschgremium.
Markus Bernath und Peter Schubert haben sich zum Ziel gesetzt, ein heima®t-Auditorium für die Stadt Geislingen zu entwickeln und somit den Klangeindrücken eine Heimstätte zu geben. Einerseits wird hiermit dem Hörsinn in einer visuell dominierten Welt bewusst ein höherer Stellenwert eingeräumt, auf der anderen Seite wird Geschichte zum Hören auditiv notiert."
Link:
http://www.heimart.de.vu
Duisburg:
""Duisburg klingt" ist eine Plattform, die es ermöglicht Geräusche aus Duisburg mit anderen Menschen zu teilen. Überall hört man Geräusche, sei es die Straßenbahn, seien es hupende Autos, Menschenmengen oder zwitschernde Vögel im Stadtpark.
Es gibt eine Reihe von Alltagsgeräuschen, die wir gewohnheitshalber nicht mehr bewusst wahrnehmen. Eben diese Geräusche sollen auf "Duisburg klingt" hochgeladen, gesammelt und mit anderen Menschen geteilt werden. Es ist unser Ziel auf diesem Wege den Duisburger Bürgern die Ohren für ihre Stadt zu öffnen und Ihnen zu einer intensiveren Wahrnehmung der Stadt Duisburg zu verhelfen."
Link:
http://www.stefan-borchert.de/duisburg/index.php?section=wassolldas
Geräuscharchiv Naturtöne:Wild Sanctuary Audio Archive
"The Wild Sanctuary Audio Archive is the largest private collection of its kind. The premiere source and center for the creation, study, and archiving of natural sound and wild soundscape recordings, this rare collection is the foundation of a world of new possibilities: fresh territory to access and realize the benefits and insights that the voice of the natural world provides about ourselves, our increasingly fragile natural world, and all the living things
with whom we share it.
The archive, mostly recorded in M-S digital formats with carefully noted metadata, is utilized in a variety of ways including commercial, educational, public outreach, and research components.
The Wild Sanctuary archives features recordings from all over the world, including the research sites of Jane Goodall (Gombe, Tanzania), Dian Fossey (Karisoke, Rwanda), and Biruté Galdikas (Camp Leakey, Borneo); from Alaska and the Arctic, to the Antarctic, and more. We work to preserve these rare recordings and the habitats from which they come.
Approximately 40% of the original unaltered natural soundscapes contained in the collection are from sites that have since been materially degraded or eliminated entirely, either by habitat damage, destruction from deforestation, or climate change, rendering a significant portion of the collection priceless. As a resource for science and the arts, the Wild Sanctuary Audio Archive is a natural treasure.
The Archive features over 1,500 discrete geographic location recordings from sites around the world including: Africa (Kenya, Madagascar, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zimbabwe), North America and Alaskan southeast, west-central tundra and North Slope, Amazonia (Amazon River, tributaries, and inland jungle from Ecuador, Peru, and Brazil), Antarctic, Australia (marine and terrestrial), Azores, Borneo, Brazil (Mata Atlantica), Fiji (marine and terrestrial), Galapagos, Hawaii, New Zealand (marine and terrestrial), and numerous other locations throughout the world.
Species-specific (creature) and habitat ambient (place) location recordings, the material are based on the inclusion of sound representing entire biomes, rather than the abstracted, single-species sound signatures often found in traditional, older collections. Often recorded at significant personal risk and hardship, each selection resonates with authenticity and quality.
All creatures have a place in the choir. The symphony of creature voices, in concert, creates a biophony; music of the most natural sort. We invite you to explore with us a new expression in the realm of audio performance.
BIOPHONIES™ (Whole habitats):
muskegs, coastal coniferous, marshes, lakes, bays (inner tidal zones), riparian zones (fast and slow water), inland coniferous forest, open marine environments (w/ whales, seals, birds and airborne vox), submarine environments (same as above only marine vox w/ birds replaced by fish, whales, crustaceans), tide pools, shoreline & more. Our library contains over 15,000 individual voices ranging from Aardvarks to Zorillas.
GEOPHONIES (Non-creature sounds):
rain, wind (not recordable, per se., only its effect across broken reeds, through trees, etc.), fast and slow streams, different types of lake, ocean, and inland waterway wave action, glacier masses moving over land, glaciers crackling (as ice melts), glaciers calving & more.
ANTHROPHONY (Historical & Cultural):
Traditional music, songs, stories, and spoken word sound sculptures (including Native American and indigenous cultures, and historical recreations) are part of the rare and endangered audio we acquire, record, and produce by commission. "
Link:
http://www.wildsanctuary.com
Personen: Yukio van Maren King
"Dem Städteplaner Yukio van Maren King entgeht auch nicht der kleinste Laut
Geräusche gehören zu unserem täglichen Leben und sofern sie uns nicht stören, schenken wir ihnen keine große Beachtung. Völlig zu Unrecht, finden viele Soziologen, Städteplaner und Ethnologen daher haben die Soundscape-Bewegung gegründet. Mit Mikrofonen fangen sie die Alltagsgeräusche unserer Städte ein und erstellen Soundkarten von Stadtbezirken. Was sich daran analysieren lässt und welche Bedeutung das für die Städteplanung hat zeigt Yukio van Maren King in Berlin.
Der Klang unserer Schritte, das Rascheln von Einkaufstüten, das Quietschen von Kinderwagen - der Städteplaner Yukio van Maren King spürt jedes noch so kleine Geräusch auf. Aufgewachsen ist er in einer ruhigen amerikanischen Kleinstadt, umgeben vom monotonen Geräusch der Mähdrescher.
Zur Zeit arbeitet King an einem Projekt, bei dem er öffentlichen Plätzen und Gebäuden einen spezifischen Klang verpassen möchte, um sie für die Bewohner attraktiver zu gestalten.
Geräusche haben eine ästhetische Qualität, noch extremer als Bilder werden Geräusche von unserem Unterbewusstsein wahrgenommen. Sie lösen starke Stimmungen und Gefühle aus. Beispielsweise Heimatgefühle, wenn bekannte, tief im Inneren gespeicherte Geräusche wiedererkannt werden. Der Mensch beurteilt die Attraktivität von Umgebungen anhand der Geräusche, fühlt sich wohl und identifiziert sich mit der Umgebung oder lehnt sie ab. So lassen sich durch die Klanggestaltung auch soziale Strukturen verändern.
Yukio van Maren King:
"In der Architektur und in der Stadtplanung wird das Thema des Klanges zweitrangig behandelt. Man beschäftigt sich eher mit visuellen Merkmalen."
Das möchte King mit seinem Konzept ändern. Denn: über den Klang eines Stadtviertels beurteilt man auch unbewusst seine soziale Struktur.
Yukio van Maren King: "Der Helmholtzplatz auf dem Prenzlauer Berg in Berlin ist ein tolles Beispiel für die Veränderung des Stadtklanges mit der Stadtentwicklung. Früher hätte man vielleicht eine ganz andere Klangkulisse gehört - eher Bierflaschen oder Hundegebell. In den letzten Jahren gab es eine starke Aufwertung des Platzes und eine Grundsanierung. Es ist toll, wie der Stadtklang solche städtischen Entwicklungen widerspiegelt."
Der städteplanerische Ansatz, Autos umzuleiten und Ruhezonen zu schaffen, hilft zwar, aber am effektivsten findet es King, die Atmosphäre mit Menschengeräuschen zu verbessern: Freiluftcafés und Märkte aber auch Brunnen und Wasserstellen schaffen akustische Räume, die Menschen angenehm beeinflussen und anziehen.
Entscheidend für Yukio van Maren Kings Planungen ist die genaue Analyse der Umgebung. Der Städteplaner arbeitet mit Originalkopfmikrofonen. Die sind winzig klein und sitzen an den Ohrstöpseln seiner Kopfhörer. So läuft er unauffällig durch die Stadt und niemand fühlt sich beobachtet - das Ergebnis ist unverfälscht.
Einfache Mittel - große Wirkung Wenn man seine eigenen Schritte nicht mehr hört, ist eine Stadt zu laut, dann ist die Kommunikation erschwert. Man erhebt die Stimme und reagiert unbewusst mit steigender Aggressivität auf die akustische Überforderung. Die Straßen und Häuserfluchten wirken dabei wie ein Resonanzboden für die Geräusche. Um Harmonie zu schaffen reicht es oft schon den Straßenbelag auszutauschen. Die Geräuschkulisse wirkt dadurch positiv.
Dank der Arbeit von Geräuschesammlern wie Yukio van Maren King werden Stadtgeräusche nicht mehr nur in den Kategorien laut und leise wahrgenommen. Stadtklang ist etwas Interessantes, Unverwechselbares, Identitätsstiftendes und sollte in der Stadtplanung viel häufiger als gestalterisches Element genutzt werden."
Quelle: 3sat vivo
Sonstiges:
Das kleine Field recording Festival
"News about the 4th edition of the Festival that will take place in Berlin all through the year 2008. The information about the former editions that were held on 22-26 november 2006, 13-22 february 2007 and 1-29 august, 2007 are still to be found somewhere in the jungle of this blop."
Quelle:
http://daskleinefieldrecordingsfestival.org
"das frankfurter label für field recording und hörkunst veröffentlicht seit 2003 übergreifende projekte im bereicht der akustischen feldaufnahmen. ..... in form von tonträgern, druck, online-medien, vorträgen, festivals und konzerten."
Link:
http://www.gruenrekorder.de
"In summer 2008 the crew from Soundmap of Cologne invited musicians, remixers and homerecordists all over the place to use any fieldrecordings we once put on the soundmap; to compose, mash-up and produce individual soundscapes from Cologne.
The product is called rmxCGN and contains five different sonic journeys through Cologne by Mark Tamea, ANTON MOBIN, Tam Burger, Grammophon and Vera Vermon. All songs from rmxCGN are licenced under Creative Commons Share-alike (by-nc-sa de 3.0).
Marcus Kuerten and Marco Medkour from konkretourist would like to thank all artists that took part in this “remix competition”! 25 minutes of greater ambient & concrete music "
Link:
http://konkretourist.de/?p=104
Linkliste Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5733663/ Hans Cybinski, Geräuscharchivar bei DLR Kultur
http://archiv.twoday.net/stories/5226930/ akustisches Archiv Geislingen
http://archiv.twoday.net/stories/5018802/ Bernie Krause Geräuscharchivar und Musiker
http://archiv.twoday.net/stories/5167038/ Archive und Klangkunst: Satoshi Morita
http://archiv.twoday.net/stories/5182685/ "OhrErinnerungen" in Lippstadt
http://archiv.twoday.net/stories/5206181/#5211317 Soundeffect-Specialist Ben Burtt (Wall-E)
http://archiv.twoday.net/stories/4630749/ "Archiv der verklingenden Geräusche"
http://archiv.twoday.net/stories/4366380/ Klangarchivar und Musiker Richard Ortmann
http://archiv.twoday.net/stories/4271965/ Archivierung von Klanglandschaften
Daher gilt: Meinungen Anregungen, Ergänzungen, Fehlerhinweise etc.sind als Kommentare ausdrücklich erwünscht.
Begriffsbestimmungen
Ein Geräuscharchiv (englisch: sound library) ist eine Sammlung von gespeicherten Geräuschen und Klängen, die für die Weiterverarbeitung in Filmen, Hörspielen, Computerspielen und Klanginstallationen, ferner auch in Musik verwendet werden können. Beispielsweise verfügen alle ARD -Anstalten seit den 1950er-Jahren über eigene Geräuscharchive.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4uscharchiv
Der Begriff Soundscape bezeichnet die Gesamtheit einer „klingenden“ Umgebung und wird vor allem in der modernen Musik verwendet. Die geläufigste deutsche Übersetzung lautet „Klanglandschaft“. Dabei wird zwar die plastische Analogie zur visuellen Landschaft verdeutlicht, jedoch lässt der Begriff die notwendige Unschärfe des englischen Begriffes "sound". In Film, Theater und Hörspiel sind die Begriffe Geräuschkulisse bzw. Atmo gebräuchlich.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Soundscape
Als Field Recording bezeichnet man in erster Linie Aufnahmen von Natur- beziehungsweise Umgebungsgeräuschen fernab eines Tonstudios, die unter Zuhilfenahme portabler Aufnahmegeräte entstehen, wie zum Beispiel einem digitalen Voice-Recorder (früher DAT -Rekorder) oder einem Laptop mit externem Interface und geeigneter Aufnahme-Software.
Historisch betrachtet diente diese Technik der Dokumentation und Archivierung kultureller, musikalischer Gegebenheiten und Zusammenhänge. Heutzutage wird sie jedoch häufig im Bereich des Musikgenres Ambient (siehe zum Beispiel lowercase) und der experimentellen Musik angewandt, mit dem Anspruch, den Hörer auf einer klangvollen Reise hin zu unbestimmten Orten zu „transportieren“. Die Steigerung des Field Recording in Sachen Authentizität ist das Field Streaming. Hier werden Töne und Geräusche aus der Natur ohne klangliche Nachbearbeitung im Studio direkt (live) beispielsweise über das Internet (Stream Audio) zum Hörenden übertragen.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Field_recording
Soundscape/Field recordings deutscher Kommunen
Berlin:
"Berlincast.com wurde im Juni 2005 von Yukio Van Maren King gestartet, um unterschiedliche Aufnahmen verschiedener oeffentlichen Orte in Berlin aufzulisten.
Yukio van Maren King lebt in Berlin."
Link
http://www.berlincast.com/
Köln:
"Die Soundmap of Cologne beinhaltet Klangaufnahmen aus dem Kölner Stadtgebiet oder mit direktem Bezug zur Stadt. Kein Viertel wird bevorzugt behandelt oder vernachlässigt. Jedes Veedel wird irgendwann einmal als kurzer Ohrenblick auf der Klangkarte-Köln zu hören sein.
Kölner Klangarchiv für Ortskundige und Fremde
Die ehrenamtlichen Klängesammler, die die Soundmap mit Stadtteilgeräuschen füllen, bauen Schritt für Schritt ein Archiv auf, das nicht nur Kölner Bürgern, sondern auch Ortsunkundigen zur Verfügung steht, um den Klangcharakter der Stadt zu erforschen.
Heute und zukünftig kann man mit den vorhandenen Aufnahmen der Soundmap of Cologne feststellen, inwieweit sich der Klang der Stadt verändern wird. Steigt der Verkehrslärm in bestimmten Ortsteilen an, sprechen die Menschen auf einmal andere Sprachen in ihren Veedeln oder singen vielleicht mehr oder weniger Vögel in Zukunft? Solche Vergleiche macht das Klangarchiv Soundmap of Cologne möglich.
Mitmach-Projekt Soundmap of Cologne
Die Soundmap of Cologne ist ein Partizipationsprojekt: Wenn sie selbst Lust am Sammeln von Kölner Geräuschen und Klängen haben oder den Machern der Klangkarte einen besonderen Klangort in Köln vorstellen möchten, dann nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf. Jedes Jahr veranstaltet die Soundmap of Cologne rmxCGN, ein Remix-Projekt, das Musiker auffordert die Klänge der Soundmap für ihre Kompositionen zu nutzen. Im Anschluss erscheinen die eingereichten Remix-Stücke auf einem Album.
Copyright und Nutzung der Klangschnippsel auf Soundmap of Cologne
Alle Aufnahmen der Soundmap of Cologne stehen kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung und dürfen ausdrücklich für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden. Das Audiomaterial ist unter Creative Commons, dem schöpferischen Allgemeingut und Eigentum, erschienen. Sie müssen lediglich Soundmap of Cologne als Urheber nennen, ihr neues Werk unter den selben Bedingungen wieder veröffentlichen und dürfen mit den benutzten Aufnahmen kein Geld verdienen. Mehr muss man nicht beachten. Erfahren sie mehr über die geltende Creative Commons Lizenz der Soundmap of Cologne."
Link
http://soundmap-cologne.de/
Geislingen:
"Man sei ganz Ohr für die Seite, die fortan im Internet aufgeschlagen wird.
heima®t enthält zahlreiche ausgewählte Field Recordings, die in und um Geislingen an der Steige aufgenommen wurden. Unter Field Recordings versteht man Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen fernab von Tonstudios unter Zuhilfenahme portabler Aufnahmegeräte. Bei den Aufnahmen wurde und wird versucht, kein bestimmtes Gebiet zu bevorzugen, sondern die gesamte Bandbreite der vorhandenen Klangeindrücke zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Nach und nach wird damit die Klangwelt der Fünftälerstadt auch in der digitalen Welt des Internets verfügbar sein. So kann man hier im Zuge einer akustischen Sammlung beispielsweise das Geräuschpensum einer bestimmten Lokalität zu ihren verschiedenen Zeiten anhören, womit die auditive Dynamik der Stadt nachvollzogen wird. Bilder und kurze Texte sollen nur unterstützend wirken und vor allem denen, die die Stadt nicht kennen, einen visuellen Eindruck der gehörten Örtlichkeiten liefern.
Im Laufe der Zeit wird heima®t sich zu einem Klangarchiv der Stadt entwickeln. In diesem Sinne kann jeder, der gern genauer hinhorcht, seine eigene Note dazu beisteuern. Es ist der ausdrückliche Wunsch, dass viele Menschen sich daran beteiligen, sei es mit Hinweisen auf interessante Plätze oder eigenen Tonaufnahmen. Passen diese in das Konzept von heima®t, so finden sie dankbare Aufnahme in das Geräuschgremium.
Markus Bernath und Peter Schubert haben sich zum Ziel gesetzt, ein heima®t-Auditorium für die Stadt Geislingen zu entwickeln und somit den Klangeindrücken eine Heimstätte zu geben. Einerseits wird hiermit dem Hörsinn in einer visuell dominierten Welt bewusst ein höherer Stellenwert eingeräumt, auf der anderen Seite wird Geschichte zum Hören auditiv notiert."
Link:
http://www.heimart.de.vu
Duisburg:
""Duisburg klingt" ist eine Plattform, die es ermöglicht Geräusche aus Duisburg mit anderen Menschen zu teilen. Überall hört man Geräusche, sei es die Straßenbahn, seien es hupende Autos, Menschenmengen oder zwitschernde Vögel im Stadtpark.
Es gibt eine Reihe von Alltagsgeräuschen, die wir gewohnheitshalber nicht mehr bewusst wahrnehmen. Eben diese Geräusche sollen auf "Duisburg klingt" hochgeladen, gesammelt und mit anderen Menschen geteilt werden. Es ist unser Ziel auf diesem Wege den Duisburger Bürgern die Ohren für ihre Stadt zu öffnen und Ihnen zu einer intensiveren Wahrnehmung der Stadt Duisburg zu verhelfen."
Link:
http://www.stefan-borchert.de/duisburg/index.php?section=wassolldas
Geräuscharchiv Naturtöne:Wild Sanctuary Audio Archive
"The Wild Sanctuary Audio Archive is the largest private collection of its kind. The premiere source and center for the creation, study, and archiving of natural sound and wild soundscape recordings, this rare collection is the foundation of a world of new possibilities: fresh territory to access and realize the benefits and insights that the voice of the natural world provides about ourselves, our increasingly fragile natural world, and all the living things
with whom we share it.
The archive, mostly recorded in M-S digital formats with carefully noted metadata, is utilized in a variety of ways including commercial, educational, public outreach, and research components.
The Wild Sanctuary archives features recordings from all over the world, including the research sites of Jane Goodall (Gombe, Tanzania), Dian Fossey (Karisoke, Rwanda), and Biruté Galdikas (Camp Leakey, Borneo); from Alaska and the Arctic, to the Antarctic, and more. We work to preserve these rare recordings and the habitats from which they come.
Approximately 40% of the original unaltered natural soundscapes contained in the collection are from sites that have since been materially degraded or eliminated entirely, either by habitat damage, destruction from deforestation, or climate change, rendering a significant portion of the collection priceless. As a resource for science and the arts, the Wild Sanctuary Audio Archive is a natural treasure.
The Archive features over 1,500 discrete geographic location recordings from sites around the world including: Africa (Kenya, Madagascar, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zimbabwe), North America and Alaskan southeast, west-central tundra and North Slope, Amazonia (Amazon River, tributaries, and inland jungle from Ecuador, Peru, and Brazil), Antarctic, Australia (marine and terrestrial), Azores, Borneo, Brazil (Mata Atlantica), Fiji (marine and terrestrial), Galapagos, Hawaii, New Zealand (marine and terrestrial), and numerous other locations throughout the world.
Species-specific (creature) and habitat ambient (place) location recordings, the material are based on the inclusion of sound representing entire biomes, rather than the abstracted, single-species sound signatures often found in traditional, older collections. Often recorded at significant personal risk and hardship, each selection resonates with authenticity and quality.
All creatures have a place in the choir. The symphony of creature voices, in concert, creates a biophony; music of the most natural sort. We invite you to explore with us a new expression in the realm of audio performance.
BIOPHONIES™ (Whole habitats):
muskegs, coastal coniferous, marshes, lakes, bays (inner tidal zones), riparian zones (fast and slow water), inland coniferous forest, open marine environments (w/ whales, seals, birds and airborne vox), submarine environments (same as above only marine vox w/ birds replaced by fish, whales, crustaceans), tide pools, shoreline & more. Our library contains over 15,000 individual voices ranging from Aardvarks to Zorillas.
GEOPHONIES (Non-creature sounds):
rain, wind (not recordable, per se., only its effect across broken reeds, through trees, etc.), fast and slow streams, different types of lake, ocean, and inland waterway wave action, glacier masses moving over land, glaciers crackling (as ice melts), glaciers calving & more.
ANTHROPHONY (Historical & Cultural):
Traditional music, songs, stories, and spoken word sound sculptures (including Native American and indigenous cultures, and historical recreations) are part of the rare and endangered audio we acquire, record, and produce by commission. "
Link:
http://www.wildsanctuary.com
Personen: Yukio van Maren King
"Dem Städteplaner Yukio van Maren King entgeht auch nicht der kleinste Laut
Geräusche gehören zu unserem täglichen Leben und sofern sie uns nicht stören, schenken wir ihnen keine große Beachtung. Völlig zu Unrecht, finden viele Soziologen, Städteplaner und Ethnologen daher haben die Soundscape-Bewegung gegründet. Mit Mikrofonen fangen sie die Alltagsgeräusche unserer Städte ein und erstellen Soundkarten von Stadtbezirken. Was sich daran analysieren lässt und welche Bedeutung das für die Städteplanung hat zeigt Yukio van Maren King in Berlin.
Der Klang unserer Schritte, das Rascheln von Einkaufstüten, das Quietschen von Kinderwagen - der Städteplaner Yukio van Maren King spürt jedes noch so kleine Geräusch auf. Aufgewachsen ist er in einer ruhigen amerikanischen Kleinstadt, umgeben vom monotonen Geräusch der Mähdrescher.
Zur Zeit arbeitet King an einem Projekt, bei dem er öffentlichen Plätzen und Gebäuden einen spezifischen Klang verpassen möchte, um sie für die Bewohner attraktiver zu gestalten.
Geräusche haben eine ästhetische Qualität, noch extremer als Bilder werden Geräusche von unserem Unterbewusstsein wahrgenommen. Sie lösen starke Stimmungen und Gefühle aus. Beispielsweise Heimatgefühle, wenn bekannte, tief im Inneren gespeicherte Geräusche wiedererkannt werden. Der Mensch beurteilt die Attraktivität von Umgebungen anhand der Geräusche, fühlt sich wohl und identifiziert sich mit der Umgebung oder lehnt sie ab. So lassen sich durch die Klanggestaltung auch soziale Strukturen verändern.
Yukio van Maren King:
"In der Architektur und in der Stadtplanung wird das Thema des Klanges zweitrangig behandelt. Man beschäftigt sich eher mit visuellen Merkmalen."
Das möchte King mit seinem Konzept ändern. Denn: über den Klang eines Stadtviertels beurteilt man auch unbewusst seine soziale Struktur.
Yukio van Maren King: "Der Helmholtzplatz auf dem Prenzlauer Berg in Berlin ist ein tolles Beispiel für die Veränderung des Stadtklanges mit der Stadtentwicklung. Früher hätte man vielleicht eine ganz andere Klangkulisse gehört - eher Bierflaschen oder Hundegebell. In den letzten Jahren gab es eine starke Aufwertung des Platzes und eine Grundsanierung. Es ist toll, wie der Stadtklang solche städtischen Entwicklungen widerspiegelt."
Der städteplanerische Ansatz, Autos umzuleiten und Ruhezonen zu schaffen, hilft zwar, aber am effektivsten findet es King, die Atmosphäre mit Menschengeräuschen zu verbessern: Freiluftcafés und Märkte aber auch Brunnen und Wasserstellen schaffen akustische Räume, die Menschen angenehm beeinflussen und anziehen.
Entscheidend für Yukio van Maren Kings Planungen ist die genaue Analyse der Umgebung. Der Städteplaner arbeitet mit Originalkopfmikrofonen. Die sind winzig klein und sitzen an den Ohrstöpseln seiner Kopfhörer. So läuft er unauffällig durch die Stadt und niemand fühlt sich beobachtet - das Ergebnis ist unverfälscht.
Einfache Mittel - große Wirkung Wenn man seine eigenen Schritte nicht mehr hört, ist eine Stadt zu laut, dann ist die Kommunikation erschwert. Man erhebt die Stimme und reagiert unbewusst mit steigender Aggressivität auf die akustische Überforderung. Die Straßen und Häuserfluchten wirken dabei wie ein Resonanzboden für die Geräusche. Um Harmonie zu schaffen reicht es oft schon den Straßenbelag auszutauschen. Die Geräuschkulisse wirkt dadurch positiv.
Dank der Arbeit von Geräuschesammlern wie Yukio van Maren King werden Stadtgeräusche nicht mehr nur in den Kategorien laut und leise wahrgenommen. Stadtklang ist etwas Interessantes, Unverwechselbares, Identitätsstiftendes und sollte in der Stadtplanung viel häufiger als gestalterisches Element genutzt werden."
Quelle: 3sat vivo
Sonstiges:
Das kleine Field recording Festival
"News about the 4th edition of the Festival that will take place in Berlin all through the year 2008. The information about the former editions that were held on 22-26 november 2006, 13-22 february 2007 and 1-29 august, 2007 are still to be found somewhere in the jungle of this blop."
Quelle:
http://daskleinefieldrecordingsfestival.org
"das frankfurter label für field recording und hörkunst veröffentlicht seit 2003 übergreifende projekte im bereicht der akustischen feldaufnahmen. ..... in form von tonträgern, druck, online-medien, vorträgen, festivals und konzerten."
Link:
http://www.gruenrekorder.de
"In summer 2008 the crew from Soundmap of Cologne invited musicians, remixers and homerecordists all over the place to use any fieldrecordings we once put on the soundmap; to compose, mash-up and produce individual soundscapes from Cologne.
The product is called rmxCGN and contains five different sonic journeys through Cologne by Mark Tamea, ANTON MOBIN, Tam Burger, Grammophon and Vera Vermon. All songs from rmxCGN are licenced under Creative Commons Share-alike (by-nc-sa de 3.0).
Marcus Kuerten and Marco Medkour from konkretourist would like to thank all artists that took part in this “remix competition”! 25 minutes of greater ambient & concrete music "
Link:
http://konkretourist.de/?p=104
Linkliste Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5733663/ Hans Cybinski, Geräuscharchivar bei DLR Kultur
http://archiv.twoday.net/stories/5226930/ akustisches Archiv Geislingen
http://archiv.twoday.net/stories/5018802/ Bernie Krause Geräuscharchivar und Musiker
http://archiv.twoday.net/stories/5167038/ Archive und Klangkunst: Satoshi Morita
http://archiv.twoday.net/stories/5182685/ "OhrErinnerungen" in Lippstadt
http://archiv.twoday.net/stories/5206181/#5211317 Soundeffect-Specialist Ben Burtt (Wall-E)
http://archiv.twoday.net/stories/4630749/ "Archiv der verklingenden Geräusche"
http://archiv.twoday.net/stories/4366380/ Klangarchivar und Musiker Richard Ortmann
http://archiv.twoday.net/stories/4271965/ Archivierung von Klanglandschaften
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Juni 2009, 10:09 - Rubrik: Musikarchive
Hier zu sehen, ein neuer Blog kritischer HistorikerInnen: http://kritischegeschichte.wordpress.com.
Bernd Hüttner - am Samstag, 20. Juni 2009, 23:06 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Arbeiterwohlfahrt Frankfurt hat gestern ihrem historischen Archiv offiziell den Namen "Meta-und-Max-Quarck-Haus" gegeben. Er hätte sich keinen besseren Namen denken können, sagte Geschäftsführer Jürgen Richter. Das Ehepaar Quarck war 1916 in das Anwesen am Röderbergweg im Ostend gezogen. Beide waren Politiker und setzten sich für das Frauenwahlrecht und die Armenpflege ein.
Heute archiviert der Wohlfahrtsverband Publikationen, die sein Wirken in Frankfurt dokumentieren, in der damaligen Bibliothek der Quarcks. Seit zehn Jahren treffen sich dort die Mitglieder der Geschichtswerkstatt des Verbandes, recherchieren und führen Zeitzeugengespräche.
F.A.Z., 20.06.2009, Nr. 140 / Seite 44 (Rhein-Main-Zeitung)
Heute archiviert der Wohlfahrtsverband Publikationen, die sein Wirken in Frankfurt dokumentieren, in der damaligen Bibliothek der Quarcks. Seit zehn Jahren treffen sich dort die Mitglieder der Geschichtswerkstatt des Verbandes, recherchieren und führen Zeitzeugengespräche.
F.A.Z., 20.06.2009, Nr. 140 / Seite 44 (Rhein-Main-Zeitung)
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 20:27 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Freilich, Heinrich Heines ausgefeiltestes Gedicht ist es nicht, die west-östliche Sehnsuchtsphantasie des schneeumhüllten Fichtenbaums im Norden: "Er träumt von einer Palme, / Die, fern im Morgenland, / Einsam und schweigend trauert / Auf brennender Felsenwand." Als Student bereits hatte er die acht Zeilen voll forstbotanischen Unsinns ersonnen, die fünf Jahre später im "Lyrischen Intermezzo" des "Buchs der Lieder" (1827) ihren Niederschlag fanden. Doch erschien ihm gerade der heißkalte Baumtraum besonders geeignet, wenn es galt, sich in einem Stammbuch, einer Art hochkulturellem Poesiealbum, zu verewigen. Auch in das um 1840 entstandene, siebenundachtzig Kartonblätter umfassende Stamm- oder Gästebuch der Madame Beaumarié trug er das Gedicht ein.
Heine befand sich hier in illustrer Gesellschaft: Die Besitzerin des 2007 auf einer Münchener Auktion aufgetauchten Stammbuchs, über die erstaunlicherweise so gut wie nichts bekannt ist, scheint mit den bedeutendsten Künstlern des neunzehnten Jahrhunderts vertraut gewesen zu sein. Vierzig der Beiträge stammen von bildenden Künstlern, darunter der Maler Paul Delaroche oder der Bildhauer Bertel Thorwaldsen. Den bedeutendsten Part des Büchleins machen allerdings die neunundzwanzig Einträge - teils kleine Kompositionen - berühmter Musiker und Komponisten aus. Frédéric Chopin steuerte einundzwanzig Takte einer 1840 komponierten Etüde bei. Ähnliche Widmungen hinterließen Felix Mendelssohn Bartholdy, Hector Berlioz, Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer und Cesar Franck, ebenso der Geiger Niccolò Paganini oder der Pianist Sigismund Thalberg. Der von Heine geschätzte Geiger Heinrich Wilhelm Ernst ("vielleicht der größte Violinspieler unserer Tage") ist gleich mit zwei Einträgen vertreten, was einige Fachleute vermuten lässt, er könnte der Vertraute von Madame Beaumarié gewesen sein.
Mehr in der FAZ 0.06.2009, Nr. 140 / Seite 33

Heine befand sich hier in illustrer Gesellschaft: Die Besitzerin des 2007 auf einer Münchener Auktion aufgetauchten Stammbuchs, über die erstaunlicherweise so gut wie nichts bekannt ist, scheint mit den bedeutendsten Künstlern des neunzehnten Jahrhunderts vertraut gewesen zu sein. Vierzig der Beiträge stammen von bildenden Künstlern, darunter der Maler Paul Delaroche oder der Bildhauer Bertel Thorwaldsen. Den bedeutendsten Part des Büchleins machen allerdings die neunundzwanzig Einträge - teils kleine Kompositionen - berühmter Musiker und Komponisten aus. Frédéric Chopin steuerte einundzwanzig Takte einer 1840 komponierten Etüde bei. Ähnliche Widmungen hinterließen Felix Mendelssohn Bartholdy, Hector Berlioz, Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer und Cesar Franck, ebenso der Geiger Niccolò Paganini oder der Pianist Sigismund Thalberg. Der von Heine geschätzte Geiger Heinrich Wilhelm Ernst ("vielleicht der größte Violinspieler unserer Tage") ist gleich mit zwei Einträgen vertreten, was einige Fachleute vermuten lässt, er könnte der Vertraute von Madame Beaumarié gewesen sein.
Mehr in der FAZ 0.06.2009, Nr. 140 / Seite 33

KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 20:09 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Wenn Journalisten sich durch historische Akten wühlen, ist das üblicherweise kein Fall für die Landespolitik. Anders beim Kreisarchiv Kamenz. Als sich der Mitarbeiter einer Tageszeitung dort für Details einer Ende 1989 im Rat des Kreises behandelten Hausenteignung interessierte, ging eine Information an Sachsens Staatskanzlei. Es gebe eine »innerbehördliche Anweisung«, wird der Landrat zitiert. ...."
Quelle:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150847.die-axt-im-blockfloeten-orchester.html
Quelle:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150847.die-axt-im-blockfloeten-orchester.html
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Juni 2009, 18:26 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 18:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"1934 wurde das Reichsfilmarchiv gegründet. Als Institution existierte es lediglich elf Jahre, viele seiner Filme aber sind in Nachfolgearchiven erhalten. 1945 wurden die bis dahin gesammelten, gestohlenen und gelagerten Archivfilme in alle Winde verstreut. Die Alliierten nahmen sich, was sie bekommen konnten - und haben es seither zu weiten Teilen zurückgegeben. .... " - von Rolf Aurich Lektor an der Deutschen Kinemathek in Berlin, am 20. Juni 2009 in der Neuen Zürcher Zeitung
.
.
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Juni 2009, 18:23 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 18:03 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Juni 2009, 17:27 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Rund 500.000 Zeichnungen und Pläne von Architekten aus den letzten 500 Jahren bewahrt das Architekturmuseum der TU München auf. Diese Sammlung soll künftig auch im Internet abrufbar sein. In diesem Monat wird mit der Digitalisierung der Werke begonnen. Vertreten sind in dem Archiv so illustre Baumeister wie Balthasar Neumann, Le Corbusier und Peter Zumthor. Was zur Sammlung gehört, kann man schon jetzt unter architekturmuseum.de erfahren. "
Quelle:
DLR Kultur Kulturnachrichten 20.06
Quelle:
DLR Kultur Kulturnachrichten 20.06
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Juni 2009, 17:20 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/wikisource-as-repository.html
Mein Kommentar unter:
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=Wikisource:Skriptorium&oldid=704342#Wikisource_als_Open-Access-Repositorium.3F
Für das deutschsprachige Wikisource sehe ich dazu derzeit keine Perspektive. Die Probleme wissenschaftlichen Open-Access-Publizierens sollten in anderen Wikis erprobt werden.
Mein Kommentar unter:
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=Wikisource:Skriptorium&oldid=704342#Wikisource_als_Open-Access-Repositorium.3F
Für das deutschsprachige Wikisource sehe ich dazu derzeit keine Perspektive. Die Probleme wissenschaftlichen Open-Access-Publizierens sollten in anderen Wikis erprobt werden.
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 15:09 - Rubrik: Open Access
http://www.heise.de/newsticker/Wissenschaftsorganisationen-wollen-Forschungsdaten-fuer-die-Nachnutzung-sichern--/meldung/140816
Die deutschen Wissenschaftsorganisationen sehen "einen dringenden Handlungsbedarf" hinsichtlich der systematischen Sicherung, Archivierung und Bereitstellung der in der Forschung erhobenen Daten zum Re-Use, der Nachnutzung durch Dritte. Der Aufwand für die Gewinnung in so unterschiedlichen Disziplinen wie der Soziologie, Medizin, Fernerkundung oder Hochenergiephysik liege allein in Deutschland in der Größenordnung von mehreren Milliarden Euro, doch es sei "unbestreitbar, dass viele dieser Daten nach einer relativ kurzen Phase der Auswertung durch Einzelne oder kleine Gruppen dem Vergessen oder gar dem Verfall ausgesetzt sind".
Die deutschen Wissenschaftsorganisationen sehen "einen dringenden Handlungsbedarf" hinsichtlich der systematischen Sicherung, Archivierung und Bereitstellung der in der Forschung erhobenen Daten zum Re-Use, der Nachnutzung durch Dritte. Der Aufwand für die Gewinnung in so unterschiedlichen Disziplinen wie der Soziologie, Medizin, Fernerkundung oder Hochenergiephysik liege allein in Deutschland in der Größenordnung von mehreren Milliarden Euro, doch es sei "unbestreitbar, dass viele dieser Daten nach einer relativ kurzen Phase der Auswertung durch Einzelne oder kleine Gruppen dem Vergessen oder gar dem Verfall ausgesetzt sind".
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 14:33 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2009/06/18/dont-ask-dont-tell-rights-retention-for-scholarly-articles/
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/581-Definitive-Answer-II.html
Open Access kann dadurch am meisten gefördert werden, dass Autoren schlicht und einfach darauf vertrauen, dass ihnen nichts Schlimmes passiert, wenn sie entgegen den Verleger-Wünschen ihre Artikel im Internet frei zugänglich machen. Wer für Open Access ist und "unerlaubt" selbstarchiviert, braucht diesen Rat nicht, aber für die Ängstlichen oder Unentschlossenen mag er hilfreich sein. Nur sehr hartnäckige Personen sind in der Lage Einzelverhandlungen mit Verlagen durchzustehen, wenn diese nicht von vornherein grünes Licht geben. Verlage fragen bei Retrodigitalisierungen den Autor ja auch nicht, obwohl die Rechte bei ihm liegen. Wieso sollte der Autor dann den Verlag fragen, wenn er selbstarchivieren möchte? Er muss allerdings auf einen Repositoriums-Manager stoßen, der nicht kleinlich auf einer Erlaubnis oder einem Embargo beharrt.
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/581-Definitive-Answer-II.html
Open Access kann dadurch am meisten gefördert werden, dass Autoren schlicht und einfach darauf vertrauen, dass ihnen nichts Schlimmes passiert, wenn sie entgegen den Verleger-Wünschen ihre Artikel im Internet frei zugänglich machen. Wer für Open Access ist und "unerlaubt" selbstarchiviert, braucht diesen Rat nicht, aber für die Ängstlichen oder Unentschlossenen mag er hilfreich sein. Nur sehr hartnäckige Personen sind in der Lage Einzelverhandlungen mit Verlagen durchzustehen, wenn diese nicht von vornherein grünes Licht geben. Verlage fragen bei Retrodigitalisierungen den Autor ja auch nicht, obwohl die Rechte bei ihm liegen. Wieso sollte der Autor dann den Verlag fragen, wenn er selbstarchivieren möchte? Er muss allerdings auf einen Repositoriums-Manager stoßen, der nicht kleinlich auf einer Erlaubnis oder einem Embargo beharrt.
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 01:02 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibts bei den Nationallizenzen, aber nur für Institutionen. Scans von gemeinfreien Werken aus zwei niederländischen wissenschaftlichen Bibliotheken und das mit einer absolut unbrauchbaren Suchoberfläche, die jeweils nur ein Suchkriterium zulässt. Sucht man etwa nach der Sprache German kann man endlose Trefferlisten durchsehen, da auch noch die Bestände anderer Bibliotheken gefunden werden (ohne dass Scans zugänglich sind). Man kann sich also nicht einfach die deutschsprachigen Drucke aus der UB Groningen zeigen lassen. Qualitätskontrolle bei schweineteuren Datenbanken: Fehlanzeige. Vogel friß kauf oder stirb!
KlausGraf - am Samstag, 20. Juni 2009, 00:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mgh-bibliothek.de/bibliothek/wuerttembergischevierteljahrshefte.html
Spiegel der Google-Digitalisate (1883 fehlt leider)
Spiegel der Google-Digitalisate (1883 fehlt leider)
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 22:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://diglib.hab.de/edoc/ed000012/start.htm
Eine Bibliographie zur Geschichte der Archäologie 1500-1806. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, 2009.
Bearbeitet von Dietrich Hakelberg und Ingo Wiwjorra
In den Einträgen zu den Ausgaben sind Provenienzen angegeben!

Eine Bibliographie zur Geschichte der Archäologie 1500-1806. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, 2009.
Bearbeitet von Dietrich Hakelberg und Ingo Wiwjorra
In den Einträgen zu den Ausgaben sind Provenienzen angegeben!

KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 22:41 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek zusammengestellt.
http://www.schopfheim.de/bib/virtbib/e-geschichte/Eb.html

http://www.schopfheim.de/bib/virtbib/e-geschichte/Eb.html

KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 22:31 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jochum hat in der FAZ (nicht online) seine in die Irre führenden Ansichten zu den Kosten von Open Access erneut veröffentlichen dürfen, und Joachim Losehand hat sich in seinem Freitag-Blog die Mühe gemacht, nachzurechnen und Jochum schlüssig zu widerlegen:
http://www.freitag.de/community/blogs/joachim-losehand/dichtung-und-wahrheit
Siehe dazu hier:
http://archiv.twoday.net/stories/5646283 Dämliche Rechenkünste [Folge I]
http://archiv.twoday.net/stories/5707980/
Siehe auch:
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/index.php?/archives/83-Die-Kosten-von-Open-Access.html
Update:
Seriöses Rechenmodell zu Open Access
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/realistic-futures-in-which-universities.html
http://www.freitag.de/community/blogs/joachim-losehand/dichtung-und-wahrheit
Siehe dazu hier:
http://archiv.twoday.net/stories/5646283 Dämliche Rechenkünste [Folge I]
http://archiv.twoday.net/stories/5707980/
Siehe auch:
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/index.php?/archives/83-Die-Kosten-von-Open-Access.html
Update:
Seriöses Rechenmodell zu Open Access
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/realistic-futures-in-which-universities.html
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:43 - Rubrik: Open Access
"Die fossilen Schalen der Ostrakoden [aquatische Muschelkrebse] sind damit so etwas wie ein Archiv der Erdgeschichte, das Information zum Klima, der Ökologie und Geologie vor Tausenden und Millionen von Jahren speichert."
LMU-Paläontologin Dr. Renate Matzke-Karasz
Quelle:
http://idw-online.de/pages/de/news320920
Zur Muschel-Archivstik s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/5743441/
http://archiv.twoday.net/stories/5029810/
LMU-Paläontologin Dr. Renate Matzke-Karasz
Quelle:
http://idw-online.de/pages/de/news320920
Zur Muschel-Archivstik s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/5743441/
http://archiv.twoday.net/stories/5029810/
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:32 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://gabi-reinmann.de/?p=1150
An sich sollte man dergleichen Open Educational Resources nennen:
Siehe etwa
http://archiv.twoday.net/stories/5412409/
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
An sich sollte man dergleichen Open Educational Resources nennen:
Siehe etwa
http://archiv.twoday.net/stories/5412409/
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:29 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Reden halten, Vorträge halten, im Archiv recherchieren - immer unterwegs als alte Legende."
Regisseur Rolf von Sydow
Quelle:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/2017526/index.do
Regisseur Rolf von Sydow
Quelle:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/2017526/index.do
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:22 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Einen vielleicht etwas zu breiten Raum nahmen die Darlegungen von Stade zu genealogischen Querverbindungen sowie unterschiedlichen historischen Maßen und Gewichten ein. Solche Archiv-Grabungen mögen für den danach forschenden Geist durchaus von Interesse sein, überfordern den weniger informierten Zuhörer aber doch in ihrer grenzenlosen Fülle. ....."
Quelle: Landes-Zeitung
Quelle: Landes-Zeitung
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:21 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ulrich Weinzierl über den diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels in der Welt (Link): " .... Der Erzähler bewährt sich darin als Meister des sprechenden, meist übersehenen Details, seine Fundstücke – seien’s Theaterzettel, seien’s Todesanzeigen – sind oft wahre Trouvaillen. Der penible Archivar des Vergangenen trägt die Maske des Flaneurs, ja, des Causeurs. Er unterhält sein Publikum so trefflich, dass wir gar nicht bemerken, wie gründlich wir von ihm belehrt und aufgeklärt werden. ...."
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:18 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Rund 100 Archivare aus dem Südwesten beraten seit Freitag darüber, wie sie die Öffentlichkeit wieder stärker für historische Dokumente interessieren können. Beim Südwestdeutschen Archivtag in Münsingen (Kreis Reutlingen) geht es vor allem um Chancen, die Internet-Lexika wie Wikipedia oder die Zusammenarbeit mit Journalisten für die Archive bieten. In einer zunehmend unübersichtlichen Welt steige das Interesse an fundierten Informationen, sagte der Leiter des Staatsarchivs Ludwigsburg, Peter Müller. Die Archive mit ihren großen Beständen an zeitgeschichtlichen Dokumenten hätten dabei viel zu bieten."
Was ist daran bild-würdig ? Da steigen ja Verschwörungstheorien in einem hoch ......
Quelle: Bild, Ausgabe Stuttgart
Was ist daran bild-würdig ? Da steigen ja Verschwörungstheorien in einem hoch ......
Quelle: Bild, Ausgabe Stuttgart
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:16 - Rubrik: Veranstaltungen
"Vor über drei Monaten stürzte in Köln das Historische Stadtarchiv in der Severinstraße ein - die Aufräumarbeiten und die Suche nach der endgültigen Ursache dauern bis heute an. center.tv Köln spricht im Stadtgespräch mit prominenten Gästen über ihre persönlichen Erlebnisse nach dem Einsturz, schwierige Entscheidungen sowie die teils heftig kritisierte Informationspolitik von Stadt Köln und KVB. Erster Gast bei center.tv-Moderator Brian Schneider in dieser Reihe ist Stadtdirektor Guido Kahlen.
Sendetermine:
Samstag, 20. Juni 2009, ab 21.15 Uhr
Sonntag, 21. Juni 2009, ab 20.15 Uhr (Wdh.)
center.tv hat auch in den nächsten Wochen Gäste im Stadtgespräch, die im Zusammenhang mit der Einsturzkatastrophe in verantwortlichen Positionen Entscheidungen treffen mussten. Auch die KVB-Vorstände Walter Reinarz und Jürgen Fenske sind zu Gast.
Sendetermin:
Samstag, 4. Juli 2009, ab 21.15 Uhr"
Quelle: Link
Sendetermine:
Samstag, 20. Juni 2009, ab 21.15 Uhr
Sonntag, 21. Juni 2009, ab 20.15 Uhr (Wdh.)
center.tv hat auch in den nächsten Wochen Gäste im Stadtgespräch, die im Zusammenhang mit der Einsturzkatastrophe in verantwortlichen Positionen Entscheidungen treffen mussten. Auch die KVB-Vorstände Walter Reinarz und Jürgen Fenske sind zu Gast.
Sendetermin:
Samstag, 4. Juli 2009, ab 21.15 Uhr"
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:14 - Rubrik: Kommunalarchive
"Am 19. Juni 1932 starb in Nitra der Archivar, Sprachwissenschaftler und Pädagoge Ján Damborský. 1918 war er einer der Autoren der Deklaration des slowakischen Volkes. Damborský wurde am 12. August 1880 geboren."
Quelle:
http://www.rozhlas.sk/inetportal/rsi/core.php?page=showSprava&id=18255&lang=3
Quelle:
http://www.rozhlas.sk/inetportal/rsi/core.php?page=showSprava&id=18255&lang=3
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 21:12 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.knastblog.de/index.php/2009/06/18/gefangenpost-in-sutterlin-darf-nicht-gestoppt-werden/
Die Justizvollzugsanstalt Celle (JVA) darf Briefe eines Gefangenen nicht anhalten, nur weil diese in Sütterlinschrift – auch Deutsche Schreibschrift genannt - geschrieben sind.
Dies hat der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle mit Beschluss vom 19. Mai 2009 entschieden (Aktenzeichen: 1 Ws 248/09 (StrVollz).
Der Strafsenat stellt fest, dass in Deutschland keine verbindlichen Vorschriften existieren, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden sei. Die Sütterlinschrift könne, auch wenn sie nicht mehr in den Schulen gelehrt wird, nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden.

Die Justizvollzugsanstalt Celle (JVA) darf Briefe eines Gefangenen nicht anhalten, nur weil diese in Sütterlinschrift – auch Deutsche Schreibschrift genannt - geschrieben sind.
Dies hat der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle mit Beschluss vom 19. Mai 2009 entschieden (Aktenzeichen: 1 Ws 248/09 (StrVollz).
Der Strafsenat stellt fest, dass in Deutschland keine verbindlichen Vorschriften existieren, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden sei. Die Sütterlinschrift könne, auch wenn sie nicht mehr in den Schulen gelehrt wird, nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden.

KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 20:32 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://booksearch.blogspot.com/2009/06/new-features-on-google-books.html
Eine Reihe von Verbesserungen! Insbesondere bei Verwendung eines Proxys, der keinen PDF-Download erlaubt, kann die Möglichkeit, sich eine Übersicht aller Thumbnails ausgeben zu lassen, nützlich sein, wenn es um die Analyse der Seitenzählungen geht. Geht nicht!
 "Bookclip"
"Bookclip"
Wenn man Proxyking.com als Proxy benutzt, muss man auf der Overview/Übersicht-Seite ganz unten nach dem HTML-Mode suchen, sonst sieht man keine Seiten.
Eine Reihe von Verbesserungen!
Wenn man Proxyking.com als Proxy benutzt, muss man auf der Overview/Übersicht-Seite ganz unten nach dem HTML-Mode suchen, sonst sieht man keine Seiten.
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 20:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:41 - Rubrik: English Corner
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.boersenblatt.net/325954/
Aus der Fachgruppensitzung der Verleger auf den Buchtagen Berlin:
Die Verleger stimmten schließlich mit großer Mehrheit dafür, dass der Börsenverein Objections geltend machen soll, auch auf die Gefahr hin, dass der Vergleich, also das Settlement, kippt.
Man kann wirklich nur hoffen, dass der Bär diese Ameisen zertritt.
http://archiv.twoday.net/search?q=settlement
Aus der Fachgruppensitzung der Verleger auf den Buchtagen Berlin:
Die Verleger stimmten schließlich mit großer Mehrheit dafür, dass der Börsenverein Objections geltend machen soll, auch auf die Gefahr hin, dass der Vergleich, also das Settlement, kippt.
Man kann wirklich nur hoffen, dass der Bär diese Ameisen zertritt.
http://archiv.twoday.net/search?q=settlement
KlausGraf - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach drei Immobilien sucht das Stadtarchiv zurzeit für sein Übergangsquartier: „Für einen Lesesaal mit 20 bis 30 Arbeitsplätzen und die Verwaltung benötigen wir idealerweise eine Büroimmobilie in der Innenstadt“, sagte Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia.
„Etwa 5000 Quadratmeter brauchen wir für die Restaurierungsabteilung, die für den Übergang irgendwo anders in der Stadt angesiedelt werden könnte, und ein großes Magazin, in das etwa 18 Regalkilometer passen“, fügte ihr Stellvertreter Ulrich Fischer hinzu.
Ein Neubau kann frühestens in fünf Jahren bezugsfertig sein. „Nach ursprünglichen Schätzungen waren da auch zwei Jahre für das Trocknen der Räume einkalkuliert“, sagte Fischer. Schmidt-Czaia fürchtet die Dauer der politischen Entscheidungsfindung. „Ich hoffe, dass die Beschlüsse für das Übergangsarchiv bis Monatsende gefasst sind, um im Oktober anfangen zu können. Wir müssen endlich in die Pötte kommen.“
Quelle:
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1238775234555.shtml
„Etwa 5000 Quadratmeter brauchen wir für die Restaurierungsabteilung, die für den Übergang irgendwo anders in der Stadt angesiedelt werden könnte, und ein großes Magazin, in das etwa 18 Regalkilometer passen“, fügte ihr Stellvertreter Ulrich Fischer hinzu.
Ein Neubau kann frühestens in fünf Jahren bezugsfertig sein. „Nach ursprünglichen Schätzungen waren da auch zwei Jahre für das Trocknen der Räume einkalkuliert“, sagte Fischer. Schmidt-Czaia fürchtet die Dauer der politischen Entscheidungsfindung. „Ich hoffe, dass die Beschlüsse für das Übergangsarchiv bis Monatsende gefasst sind, um im Oktober anfangen zu können. Wir müssen endlich in die Pötte kommen.“
Quelle:
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1238775234555.shtml
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:21 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivaris Rienk Jonker van de gemeente Leeuwarden en het Historisch Centrum Leeuwarden heeft deze week de Hendrik van Wijnpenning ontvangen voor zijn archiefwerk. Het is de achtste keer dat deze in 1987 ingestelde prijs werd uitgereikt door de Vereniging voor Archivarissen. Jonker kreeg de penning vooral omdat hij al heel lang op internet de digitale ontwikkelingen in de archiefwereld in kaart brengt. Veel collega's maken hier dankbaar gebruik van.
Het webadres luidt: http://www.labyrinth.rienkjonker.nl/
Quelle: Leeuwarder Courant
Het webadres luidt: http://www.labyrinth.rienkjonker.nl/
Quelle: Leeuwarder Courant
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:18 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
was Alabama's first woman lawyer and a pioneering political activist and archivist. ..... She joined women's historical, genealogical, and cultural societies. An ardent suffragist, Kelly joined the Birmingham Equal Suffrage Association and participated in its campaign to give women the right to vote, serving on the executive council and the policy-making board.
In 1943 Kelly accepted Alabama Department of Archives and History (ADAH) director Marie Bankhead Owen' s offer of the combined post of acquisitions agent, editor of the Alabama Historical Quarterly, and inspector of county records. In addition, Kelly authored legislation that gave ADAH authority over public records. Retiring in 1956, she continued to care for ailing family members and took up genealogy. Kelly died on April 2, 1973, and was buried in Birmingham's Hillside Cemetery. A devout Baptist, she donated her personal collection of genealogies, local histories, maps and other items to the Special Collections Department of the Samford University Library. "
Link:
http://encyclopediaofalabama.org/face/Article.jsp?id=h-1106
In 1943 Kelly accepted Alabama Department of Archives and History (ADAH) director Marie Bankhead Owen' s offer of the combined post of acquisitions agent, editor of the Alabama Historical Quarterly, and inspector of county records. In addition, Kelly authored legislation that gave ADAH authority over public records. Retiring in 1956, she continued to care for ailing family members and took up genealogy. Kelly died on April 2, 1973, and was buried in Birmingham's Hillside Cemetery. A devout Baptist, she donated her personal collection of genealogies, local histories, maps and other items to the Special Collections Department of the Samford University Library. "
Link:
http://encyclopediaofalabama.org/face/Article.jsp?id=h-1106
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 19:17 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Schüler des Berufskollegs Technik haben verschiedene Anzeigenkampagnen konzipiert. Mit den Anzeigen soll in Schülerzeitungen für das Kreisarchiv geworben werden. Landrat Paul Breuer hat jetzt die besten Entwürfe ausgezeichnet. Die Projektidee hatte Kreisarchivar Thomas Wolf beim Landeswettbewerb „Archiv und Jugend" eingereicht. Die Jury war vom Konzept „Faszination Archiv! - Schüler werben für Schüler" so überzeugt, dass sie das Projekt mit 2.000 Euro fördert. Das Kreisarchiv investiert weitere 1.000 Euro in die Entwicklung und Durchführung der Anzeigenkampagne.
Umgesetzt wurde das Projekt von angehenden Gestaltungstechnischen Assistenten, die in einer dreijährigen Ausbildung am Berufskolleg Technik einen Berufsabschluss und zugleich die allgemeine Fachhochschulreife erwerben. Die Schüler erarbeiteten in kleinen Teams eigene Gestaltungskonzepte. Zunächst wurden konkrete Ideen für die Anzeigenkampagne gesammelt, Skizzen erstellt und zielgruppengerechte Slogans getextet. In weiteren Schritten erfolgte die Umsetzung: Aufnahme der Bildmotive, Bildbearbeitung, Satz- und Textlayout. Unterstützt wurden sie von den beiden Lehrern Martin Diehl und Michael Böcking. „Inhaltlich war das Projekt für die Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung", sagt Martin Diehl: „Der Blick junger Menschen ist normalerweise nach vorne gerichtet. Hier mussten sich die Schüler darauf einlassen, zurück zu schauen."
Von den Ergebnissen der Schüler sind Landrat Paul Breuer und Schulleiter Roland Geldsetzer sehr beeindruckt: „Hier sieht man, dass junge Menschen mit frischen und unverbrauchten Ideen am Werke waren", lobt Breuer die Arbeiten der Schüler.
Ein Konzept stellt auf zwei hintereinander geschalteten Anzeigenseiten die Begriffe „Gegenwart erleben" und „Vergangenheit entdecken" anschaulich dar. So ist z.B. auf der ersten Seite ein Apfel zu sehen, auf der zweiten Seite ein Kern. Oder die erste Seite zeigt eine Flasche Zitronensaft, die zweite eine Zitrone. Die Bildpaare unter den beiden Überschriften sind beliebig austauschbar, je nach den Interessen der Zielgruppen, erläuterten die Schüler.
Ein anderes Konzept setzt darauf, Jugendliche zu motivieren, die eigene Familiengeschichte zu erforschen. Die Anzeigen zeigen jeweils kleine Kinder, verbunden mit Texten wie „Mein Ururur-Opa war Kolumbus! Wer waren deine Verwandten? Finde es heraus im Archiv in Deiner Nähe".
Das dritte von der Jury ausgewählte Konzept greift das Stilmittel der Collage auf. Wiederkehrendes Merkmal ist ein Taucher, der in Schätze wie Bücher oder alte Landkarten eintaucht, wie sie in Archiven zu finden sind. Unterstrichen wird dies mit der textlichen Aussage „Tauche ein in die Vergangenheit - Vergangenheit entdecken in einem Archiv in Deiner Nähe".
Landrat Paul Breuer dankte den Schülern für ihre kreativen Ideen. Die Arbeit der Archive gerade jungen Menschen nahe zu bringen, sei eine lohnende Aufgabe, so der Landrat. „Unsere Archive sind die Gedächtnisse der Region. In einer globalisierten Welt ist es zunehmend wichtig zu wissen, woher man kommt und wo die eigenen Wurzeln liegen, um selbstbewusst im Wettbewerb mit Menschen aus anderen Regionen bestehen zu können", so Breuer.
Nach den Sommerferien werden die ausgewählten Anzeigenkampagnen in verschiedenen Schülerzeitungen im Kreisgebiet erscheinen."
Quelle: Pressemitteilung Kreis Siegen-Wittgenstein
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 10:23 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Pressemitteilung des Landesarchivs NRW:

Von links nach rechts: Dr. Arie Nabrings (Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums), Prof. Dr. Karel Velle (Generalarchivar des Königsreichs Belgien), Josée Kirps (Direktorin Archives nationales, Luxemburg), Prof. Dr. Wilfried Reininghaus (Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen),
Zum Internationalen Archivsymposion haben sich in Münster am 15. und 16. Juni Politiker und Archivare aus Deutschland, den
Niederlanden, Belgien und Luxemburg zusammengefunden, um über das wechselseitige Verhältnis von Archiven und Politik zu beraten.
In einer Podiums- und Plenumsdiskussion, an der u. a. der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Karl-Heinz Lambertz, der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Wilfried Reininghaus und der Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums Dr. Arie Nabrings teilnahmen, wurde am ersten Tag des Symposions das Verhältnis von Archiven und Politik anhand von drei Leitfragen erörtert:
1) Was erwartet die Politik von den Archiven?
2) Was erwarten umgekehrt die Archive von der Politik?
3) Wo liegen die Schnittmengen dieser Erwartungen?
Die Diskussion führte zu folgenden Ergebnissen:
1) Aus Sicht der Politik ist es die Aufgabe der Archive, als unabhängige Instanzen jenseits tagesaktueller Interessen eine offene Überlieferung zu bilden. Archive sollten durch die Auswahl ihrer Unterlagen keine Geschichtsdeutung vornehmen; sie sollten
auch selbst keine eigene historische Forschung betreiben. Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag Sternberg forderte, dass Archive verstärkt mit anderen Kultureinrichtungen kooperieren sollten; sie
sollten auf ihre Bestände hinweisen und dadurch zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Geschichte anregen. Der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Lambertz äußerte die Hoffnung, dass die Archive auf diese Wiese einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Identitätsstiftung
leisten könnten. Durch den Hinweis auf langfristige historische Entwicklungen seien Archive in der Lage, die Nachhaltigkeit politischen Handelns zu unterstützen. Mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in Gestalt von Publikationen und
Veranstaltungen hätten die Archive eine gute Chance auf eine bessere gesellschaftliche Wahrnehmung und könnten so dazu beitragen, das oft noch immer angestaubte Image des Berufstandes aufzubessern.
2) Archive erwarten von der Politik vor allem Verständnis und Unterstützung bei der langfristigen Sicherung und Bereitstellung elektronischer Unterlagen. Diese Aufgabe könne nicht durch die IT-Stellen in den Verwaltungen, sondern nur auf der Grundlage fachlich gesicherter Standards durch die Archive geleistet werden. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Reininghaus betonte, dass mit der digitalen Revolution völlig neue Aufgaben auf die Archive zugekommen seien. Für die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben müsse die Politik die Archiven entsprechend ausstatten. Dies sei eine langfristige Notwendigkeit, der eine politische Planung im Zeithorizont von Legislaturperioden nicht immer gerecht werden könne. Insbesondere mit Blick auf die veränderten Herausforderungen für die Archive im digitalen Zeitalter sprach sich der belgische Generalarchivar Professor Karel Velle für einen kontinuierlichen und fest institutionalisierten Austausch zwischen Archiven und Politik aus.
3) Die Forderung der Politik nach einer Konzentration der Archive auf die Erschließung und Bereitstellung historischer Unterlagen stieß in der Diskussion bei den Archiven vielfach auf Zustimmung. Einige Archivvertreter äußerten allerdings die Auffassung, dass Archive zur Steigerung ihrer öffentlichen Wahrnehmung und zur
Intensivierung ihrer identitätsstiftenden Funktion auf eine Teilnahme an der Forschung nicht gänzlich verzichten könnten. Bei der Archivierung elektronischer Unterlagen erkannten die Vertreter der Politik die Notwendigkeit einer Bereitstellung ausreichender Ressourcen grundsätzlich an. Wichtig sei jedoch, dass die Archive
sich – auch im internationalen Kontext – auf verbindliche Standards der elektronischen Langzeitarchivierung verständigten.
Am zweiten Tag des Symposions gaben staatliche und kommunale Archivvertreter aus den beteiligten Ländern anhand von Fallstudien Einblicke in ihre konkreten Auseinandersetzungen mit der Politik. Im Zentrum standen dabei Fragen im
Zusammenhang der Novellierung von Archivgesetzen und der Realisierung von Bauprojekten. In beiden Fällen erwies sich die Abstimmung mit der Politik nicht immer als reibungslos. Die Bereitschaft zum „Bohren dicker Bretter“ ist eine Grundvoraussetzung in der Kooperation mit politischen Akteuren, die in vielen Fällen allerdings am Ende aus Sicht der Archive von Erfolg gekrönt ist.
Dr. Urs Diederichs schilderte am anschaulichen Beispiel der Standortverlagerung des Historischen Zentrums der Stadt Remscheid die langwierigen und nicht immer von sachlichen Erwägungen getragenen Diskussionen mit den Vertretern der
Kommunalpolitik. Nur durch eine Vernetzung der Archive mit gesellschaftlichen Partnern (Presse, Geschichtsvereinen usw.) und durch die Hilfe des LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrums als externe Fachstelle sei es möglich gewesen, dem Anliegen des Archivs den nötigen Rückhalt zu geben und die festgefahrenen parteipolitischen Fronten im Interesse einer archivfachlich begründeten Lösung der Standortfrage aufzubrechen. Von ähnlichen Erfahrungen berichtete auch die Direktorin des Luxemburger Nationalarchivs Josée Kirps. Infolge des Regierungswechsels 2004 in Luxemburg trat bei dem 2002 beschlossenen und im Entwurf bereits fertig vorliegenden
Neubauprojekt eine erhebliche Verzögerung ein. Hierfür war in erster Linie eine politische Neubewertung des Projekts unter fiskalischen Gesichtspunkten verantwortlich. Plänen der Politik, das ursprünglich bewusst repräsentativ gestaltete und in seiner Kapazität auf 90 Jahre angelegte Magazingebäude zwischenzeitlich zur Aufnahme der Universitätsbibliothek zu nutzen, trat das Archiv aus fachlichen Gründen entschieden entgegen. Als Kompromiss wurde – nach einer Phase des Stillstandes – schließlich eine Lösung gefunden, die es ermöglichte, den Magazinbau chrittweise mit zunächst nur der halben Kapazität des ursprünglichen Entwurfs zu
errichten und so den Kostenaufwand zu reduzieren.
Der belgische Generalarchivar Prof. Dr. Karel Velle berichtete in seinem Beitrag von den erfolgreichen Novellierungen der belgischen Archivgesetze, die auf föderaler wie regionaler Ebene zum Teil bereits abgeschlossen sind, zum Teil noch im Laufe
dieses Jahres zum Abschluss gelangen werden. Kernpunkt der Novellierungen ist eine Reduzierung der Sperrfristen auf die in Europa gängige Frist von 30 Jahren. Für diese Sperrfristenreduzierung hat die zeitgeschichtliche Forschung in Belgien einen wesentlichen Anstoß gegeben, der sich mit den archivfachlichen Interessen und Forderungen deckte und diese gegenüber der Politik unterstützte.
Der Beitrag von Prof. Dr. Alfred Minke über das Staatsarchiv Eupen machte deutlich, dass auch eine intensive und gezielte Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit – gelegentlich durchaus in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den archivischen
Kernaufgaben – geeignet sein kann, um als Archiv den Interessen und Anforderungen der Politik entgegenzukommen. Die Gründung eines Staatsarchivs Eupen sei nur möglich gewesen durch den starken und anhaltenden Einsatz der deutschsprachigen Politiker, die das Archiv mit seinen Möglichkeiten der Bildungsarbeit als einen Meilenstein auf dem Weg zur kulturpolitischen Autonomie
der deutschsprachigen Belgier ansahen. Wie wichtigen es ist, neben der historisch-wissenschaftlich ausgerichteten
Öffentlichkeitsarbeit auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die Verwaltungen und die Politik zu betreiben zeigte Dr. Beate Dorfey vom Landeshauptarchiv Koblenz, die in ihrem Beitrag u. a. die Ansätze des rheinland-pfälzischen Staatsarchive zur Neuorganisation der Behördeninformation erläuterte. Eine ausführliche Darstellung archivischer Artbeitsprozesse für den Kundenkreis der Behörden – in Form von Online-Angeboten oder auch Behördentagen – steigere die Akzeptanz des Archivs
auch in der Politik. Das Wissen der Politik um die Arbeit der Archive sei eine wesentliche Voraussetzung für eine stärkere Aufmerksamkeit und ein besseres Eintreten der Politik für archivische Belange.
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus betonte in seinem Schlußwort, daß „Archive und Politik“ ein bleibendes Thema sein werden. Die Archive rief er zu eigenen strategischen Überlegungen auf, um so auf „Archivpolitik“ Einfluss zu nehmen. Dieses Politikfeld mit den Akteuren Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Technik und
Archive müsse aber erst noch konstituiert werden. Es decke sich nicht nahtlos mit Kulturpolitik.
Link zum PDF

Von links nach rechts: Dr. Arie Nabrings (Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums), Prof. Dr. Karel Velle (Generalarchivar des Königsreichs Belgien), Josée Kirps (Direktorin Archives nationales, Luxemburg), Prof. Dr. Wilfried Reininghaus (Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen),
Zum Internationalen Archivsymposion haben sich in Münster am 15. und 16. Juni Politiker und Archivare aus Deutschland, den
Niederlanden, Belgien und Luxemburg zusammengefunden, um über das wechselseitige Verhältnis von Archiven und Politik zu beraten.
In einer Podiums- und Plenumsdiskussion, an der u. a. der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Karl-Heinz Lambertz, der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Wilfried Reininghaus und der Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums Dr. Arie Nabrings teilnahmen, wurde am ersten Tag des Symposions das Verhältnis von Archiven und Politik anhand von drei Leitfragen erörtert:
1) Was erwartet die Politik von den Archiven?
2) Was erwarten umgekehrt die Archive von der Politik?
3) Wo liegen die Schnittmengen dieser Erwartungen?
Die Diskussion führte zu folgenden Ergebnissen:
1) Aus Sicht der Politik ist es die Aufgabe der Archive, als unabhängige Instanzen jenseits tagesaktueller Interessen eine offene Überlieferung zu bilden. Archive sollten durch die Auswahl ihrer Unterlagen keine Geschichtsdeutung vornehmen; sie sollten
auch selbst keine eigene historische Forschung betreiben. Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag Sternberg forderte, dass Archive verstärkt mit anderen Kultureinrichtungen kooperieren sollten; sie
sollten auf ihre Bestände hinweisen und dadurch zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Geschichte anregen. Der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Lambertz äußerte die Hoffnung, dass die Archive auf diese Wiese einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Identitätsstiftung
leisten könnten. Durch den Hinweis auf langfristige historische Entwicklungen seien Archive in der Lage, die Nachhaltigkeit politischen Handelns zu unterstützen. Mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in Gestalt von Publikationen und
Veranstaltungen hätten die Archive eine gute Chance auf eine bessere gesellschaftliche Wahrnehmung und könnten so dazu beitragen, das oft noch immer angestaubte Image des Berufstandes aufzubessern.
2) Archive erwarten von der Politik vor allem Verständnis und Unterstützung bei der langfristigen Sicherung und Bereitstellung elektronischer Unterlagen. Diese Aufgabe könne nicht durch die IT-Stellen in den Verwaltungen, sondern nur auf der Grundlage fachlich gesicherter Standards durch die Archive geleistet werden. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Reininghaus betonte, dass mit der digitalen Revolution völlig neue Aufgaben auf die Archive zugekommen seien. Für die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben müsse die Politik die Archiven entsprechend ausstatten. Dies sei eine langfristige Notwendigkeit, der eine politische Planung im Zeithorizont von Legislaturperioden nicht immer gerecht werden könne. Insbesondere mit Blick auf die veränderten Herausforderungen für die Archive im digitalen Zeitalter sprach sich der belgische Generalarchivar Professor Karel Velle für einen kontinuierlichen und fest institutionalisierten Austausch zwischen Archiven und Politik aus.
3) Die Forderung der Politik nach einer Konzentration der Archive auf die Erschließung und Bereitstellung historischer Unterlagen stieß in der Diskussion bei den Archiven vielfach auf Zustimmung. Einige Archivvertreter äußerten allerdings die Auffassung, dass Archive zur Steigerung ihrer öffentlichen Wahrnehmung und zur
Intensivierung ihrer identitätsstiftenden Funktion auf eine Teilnahme an der Forschung nicht gänzlich verzichten könnten. Bei der Archivierung elektronischer Unterlagen erkannten die Vertreter der Politik die Notwendigkeit einer Bereitstellung ausreichender Ressourcen grundsätzlich an. Wichtig sei jedoch, dass die Archive
sich – auch im internationalen Kontext – auf verbindliche Standards der elektronischen Langzeitarchivierung verständigten.
Am zweiten Tag des Symposions gaben staatliche und kommunale Archivvertreter aus den beteiligten Ländern anhand von Fallstudien Einblicke in ihre konkreten Auseinandersetzungen mit der Politik. Im Zentrum standen dabei Fragen im
Zusammenhang der Novellierung von Archivgesetzen und der Realisierung von Bauprojekten. In beiden Fällen erwies sich die Abstimmung mit der Politik nicht immer als reibungslos. Die Bereitschaft zum „Bohren dicker Bretter“ ist eine Grundvoraussetzung in der Kooperation mit politischen Akteuren, die in vielen Fällen allerdings am Ende aus Sicht der Archive von Erfolg gekrönt ist.
Dr. Urs Diederichs schilderte am anschaulichen Beispiel der Standortverlagerung des Historischen Zentrums der Stadt Remscheid die langwierigen und nicht immer von sachlichen Erwägungen getragenen Diskussionen mit den Vertretern der
Kommunalpolitik. Nur durch eine Vernetzung der Archive mit gesellschaftlichen Partnern (Presse, Geschichtsvereinen usw.) und durch die Hilfe des LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrums als externe Fachstelle sei es möglich gewesen, dem Anliegen des Archivs den nötigen Rückhalt zu geben und die festgefahrenen parteipolitischen Fronten im Interesse einer archivfachlich begründeten Lösung der Standortfrage aufzubrechen. Von ähnlichen Erfahrungen berichtete auch die Direktorin des Luxemburger Nationalarchivs Josée Kirps. Infolge des Regierungswechsels 2004 in Luxemburg trat bei dem 2002 beschlossenen und im Entwurf bereits fertig vorliegenden
Neubauprojekt eine erhebliche Verzögerung ein. Hierfür war in erster Linie eine politische Neubewertung des Projekts unter fiskalischen Gesichtspunkten verantwortlich. Plänen der Politik, das ursprünglich bewusst repräsentativ gestaltete und in seiner Kapazität auf 90 Jahre angelegte Magazingebäude zwischenzeitlich zur Aufnahme der Universitätsbibliothek zu nutzen, trat das Archiv aus fachlichen Gründen entschieden entgegen. Als Kompromiss wurde – nach einer Phase des Stillstandes – schließlich eine Lösung gefunden, die es ermöglichte, den Magazinbau chrittweise mit zunächst nur der halben Kapazität des ursprünglichen Entwurfs zu
errichten und so den Kostenaufwand zu reduzieren.
Der belgische Generalarchivar Prof. Dr. Karel Velle berichtete in seinem Beitrag von den erfolgreichen Novellierungen der belgischen Archivgesetze, die auf föderaler wie regionaler Ebene zum Teil bereits abgeschlossen sind, zum Teil noch im Laufe
dieses Jahres zum Abschluss gelangen werden. Kernpunkt der Novellierungen ist eine Reduzierung der Sperrfristen auf die in Europa gängige Frist von 30 Jahren. Für diese Sperrfristenreduzierung hat die zeitgeschichtliche Forschung in Belgien einen wesentlichen Anstoß gegeben, der sich mit den archivfachlichen Interessen und Forderungen deckte und diese gegenüber der Politik unterstützte.
Der Beitrag von Prof. Dr. Alfred Minke über das Staatsarchiv Eupen machte deutlich, dass auch eine intensive und gezielte Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit – gelegentlich durchaus in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den archivischen
Kernaufgaben – geeignet sein kann, um als Archiv den Interessen und Anforderungen der Politik entgegenzukommen. Die Gründung eines Staatsarchivs Eupen sei nur möglich gewesen durch den starken und anhaltenden Einsatz der deutschsprachigen Politiker, die das Archiv mit seinen Möglichkeiten der Bildungsarbeit als einen Meilenstein auf dem Weg zur kulturpolitischen Autonomie
der deutschsprachigen Belgier ansahen. Wie wichtigen es ist, neben der historisch-wissenschaftlich ausgerichteten
Öffentlichkeitsarbeit auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die Verwaltungen und die Politik zu betreiben zeigte Dr. Beate Dorfey vom Landeshauptarchiv Koblenz, die in ihrem Beitrag u. a. die Ansätze des rheinland-pfälzischen Staatsarchive zur Neuorganisation der Behördeninformation erläuterte. Eine ausführliche Darstellung archivischer Artbeitsprozesse für den Kundenkreis der Behörden – in Form von Online-Angeboten oder auch Behördentagen – steigere die Akzeptanz des Archivs
auch in der Politik. Das Wissen der Politik um die Arbeit der Archive sei eine wesentliche Voraussetzung für eine stärkere Aufmerksamkeit und ein besseres Eintreten der Politik für archivische Belange.
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus betonte in seinem Schlußwort, daß „Archive und Politik“ ein bleibendes Thema sein werden. Die Archive rief er zu eigenen strategischen Überlegungen auf, um so auf „Archivpolitik“ Einfluss zu nehmen. Dieses Politikfeld mit den Akteuren Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Technik und
Archive müsse aber erst noch konstituiert werden. Es decke sich nicht nahtlos mit Kulturpolitik.
Link zum PDF
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Juni 2009, 10:02 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/hzbg/hzbg_hss_webbilder/index_hzbg_startseite.html
Kurzinventar der illuminierten Handschriften bis 1600 und der Inkunabeln
in der Bibliothek des
Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg in Niederösterreich
Version 1 (März 2009)

Kurzinventar der illuminierten Handschriften bis 1600 und der Inkunabeln
in der Bibliothek des
Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg in Niederösterreich
Version 1 (März 2009)
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 23:29 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 23:15 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/
17.06.2009
Freisinger Handschriften: Die Regesten zum Cozroh-Codex sind online. - Das Bayerische Brauer-Journal wurde heute freigeschaltet.
15.06.2009
Die Datenbank zum literarischen Bayern umfasst jetzt 250 AutorInnen.
4.6.2009
8 neu gescannte Bände von Preys Genealogie des altbayerischen Adels sind online.
17.06.2009
Freisinger Handschriften: Die Regesten zum Cozroh-Codex sind online. - Das Bayerische Brauer-Journal wurde heute freigeschaltet.
15.06.2009
Die Datenbank zum literarischen Bayern umfasst jetzt 250 AutorInnen.
4.6.2009
8 neu gescannte Bände von Preys Genealogie des altbayerischen Adels sind online.
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 22:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Gut hundert Tage nach Einsturz des Historischen Stadtarchivs in Köln haben Restauratoren nun begonnen, die ersten zerrissenen Papierstücke für ein Pilot-Projekt des Berliner Fraunhofer-Instituts vorzubereiten. Vor allem mit Tinte beschriebene Dokumente müssen dabei im Kölnischen Museum an der Zeughausstraße sorgfältig präpariert werden. Im Fraunhofer Institut sollen die Papierschnipsel mit einem aufwendigen Scan-Verfahren automatisch wieder zu ganzen Seiten zusammengefügt werden. Dieses Verfahren wird auch erfolgreich bei Stasi-Akten angewandt, die nach dem Mauerfall zerhäckselt wurden."
Quelle:
http://www.wdr.de/studio/koeln/nachrichten/index.html
Quelle:
http://www.wdr.de/studio/koeln/nachrichten/index.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 18:37 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 09:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 09:50 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Steinhauer bespricht den Band:
Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz … - Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. – 146 S. (Buchwissenschaftliche Forschungen ; 8)
ISBN 978-3-447-05799-8
27,- €
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/06/17/rezension-probleme-neuen-urheberrechts-6323381/
Auszug:
Dieser Satz verdient Beachtung: „Wird geltend gemacht, die Verbreitung einer Grafikdatei durch eine Bibliothek sei bereits eine Bedrohung der weiteren normalen Verwertung aufgrund der leichten Verbreitungsmöglichkeit im Internet, ist nicht erklärlich, warum Verlage in ihren kommerziellen Pay-per-view-Angeboten selbst Kopien im digitalen Format an Endkunden verbreiten. Würde eine digitale Kopie im Umlauf bereits die normale Verwertung beinträchtigen, würden Verlage diese Verbreitungsmethode nicht wählen.“ S. 72 f.
Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz … - Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. – 146 S. (Buchwissenschaftliche Forschungen ; 8)
ISBN 978-3-447-05799-8
27,- €
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/06/17/rezension-probleme-neuen-urheberrechts-6323381/
Auszug:
Dieser Satz verdient Beachtung: „Wird geltend gemacht, die Verbreitung einer Grafikdatei durch eine Bibliothek sei bereits eine Bedrohung der weiteren normalen Verwertung aufgrund der leichten Verbreitungsmöglichkeit im Internet, ist nicht erklärlich, warum Verlage in ihren kommerziellen Pay-per-view-Angeboten selbst Kopien im digitalen Format an Endkunden verbreiten. Würde eine digitale Kopie im Umlauf bereits die normale Verwertung beinträchtigen, würden Verlage diese Verbreitungsmethode nicht wählen.“ S. 72 f.
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 09:31 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Unterlagen der NESTOR-Informationsveranstaltung "Film digital" - Aspekte langfristiger Informationssicherung vom 27.05.2009 sind online verfügbar: Unterlagen "Film digital"
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 08:58 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
I found this fascinating quote today:
The percentage of articles found for each journal in their studied varied greatly. While fields such as elementary particle physics and astrophysics reported nearly 100% overlap, this finding was not generalized over other sub-disciplines in physics. Many fields showed much less coverage, many under 5%. Philip Davis under, The Scholarly Kitchen, Jun 2009
You should read the whole article.
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Juni 2009, 00:36 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

 Oxensepp CC-BY-SA
Oxensepp CC-BY-SA