Hans Sachs besaß eine Ausgabe von Georg Rüxners Turnierbuch, das bereits in Simmern ab 1530 mehrere Auflagen erlebte. Er fasste den Stoff, nämlich den Ursprung und die Reihenfolge der (angeblichen) Turniere ab 938, in einem Spruchgedicht zusammen, das auf den 21. Mai 1541 datiert ist.
Ein Einzeldruck erschien schon 1541 bei Hans Guldenmund in Nürnberg (VD 16 S 573, z.B. auch in Nürnberg GNM und UB Salzburg; Varianten in der Sachs-Werkausgabe von Keller und Goetze Bd. 21, S. 365
http://www.archive.org/stream/hanssachs06sachgoog#page/n377/mode/2up
Bibliographisch erfasst von Emil Weller: Der Volksdichter Hans Sachs und seine Dichtungen. Nürnberg 1868, S. 86 Nr. 204
http://books.google.com/books?id=7TkuAAAAYAAJ&pg=PA86 )
[Digitalisat:
http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ156765309 ]
Der Turnierspruch erscheint dann in der ersten Folioausgabe von 1558, die im 16. Jahrhundert mehrere Nachdrucke erlebte. Hiernach druckte es Adelbert von Keller (Hrsg.): Hans Sachs Bd. 2, Stuttgart 1870, S. 342-352
http://www.archive.org/stream/hanssachs10sachgoog#page/n347/mode/2up
Ein späterer Einzeldruck in Nürnberg um 1570 ist nach dem VD 16 S 575 in Wolfenbüttel nachgewiesen. Handschriftlich überliefert ist das Gedicht in der Zwickauer Spruchgedichte-Handschrift SG 4, Bl. 180v-186.
Weitere Nachweise in Bd. 25 der Ausgabe S. 123
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:BLV_225_Hans_Sachs_Band_25.pdf&page=127
Zur Quellenbearbeitung äußerte sich Carl Drescher: Studien zu Hans Sachs. Neue Folge, Marburg 1891, S. 18-21:
http://www.archive.org/stream/studienzuhanssa00dresgoog#page/n31/mode/2up
Ergänzungen dazu in einer Besprechung von A. L. Stiefel in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte NF 6 (1893), S. 146
http://books.google.com/books?id=aNYNAAAAYAAJ&pg=PA146 (US-Proxy)
Auf die Rezeption des Spruchgedichts weist hin: Ferdinand Eichler: Das Nachleben des Hans Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Leipzig 1904, S. 123:
http://www.archive.org/stream/dasnachlebendes00eichgoog#page/n141/mode/2up
Aufgrund von Rüxners Erfindung des ersten Turniers (Magdeburg 938) stieß auch das Spruchgedicht des Nürnberger Handwerkerdichters in Magdeburg auf ein besonderes Interesse. Zwei (bislang nicht weiter beachtete) frühneuzeitliche Handschriften des 17. Jahrhunderts, die die hochdeutsche Fassung der Magdeburger Schöppenchronik enthalten (fortgesetzt bis 1566) sowie die Liste der Bürgermeister und Kämmerer (bis 1601), überliefern auch das Spruchgedicht von Sachs.
- Leipzig, UB (Leihgabe der Stadtbibliothek) Rep. II 75
http://books.google.de/books?id=MAAVAAAAQAAJ&pg=PA169
- Kopenhagen, KB Cod. Thott. 633, 2°
http://books.google.de/books?id=Ro0kAQAAIAAJ&pg=RA2-PA357
Sicher handelt es sich um eine Druckabschrift. Schon Weller a.a.O. bemerkte, dass das Gedicht in Magdeburger Chronik-Drucken von 1587 und 1589 (Pomarius/Baumgartens d. J. Bearbeitung der Sassen-Chronik) abgedruckt wurde.
Die gleichen drei Texte (Schöppenchronik, Bürgermeisterkatalog, Turniere), aber wohl in anderer Reihenfolge, bot die verschollene Handschrift des Haller Universitätskanzlers Ludewig:
http://digital.slub-dresden.de/ppn33724149X/370
#forschung
#fnzhss
 Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)
Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)
Ein Einzeldruck erschien schon 1541 bei Hans Guldenmund in Nürnberg (VD 16 S 573, z.B. auch in Nürnberg GNM und UB Salzburg; Varianten in der Sachs-Werkausgabe von Keller und Goetze Bd. 21, S. 365
http://www.archive.org/stream/hanssachs06sachgoog#page/n377/mode/2up
Bibliographisch erfasst von Emil Weller: Der Volksdichter Hans Sachs und seine Dichtungen. Nürnberg 1868, S. 86 Nr. 204
http://books.google.com/books?id=7TkuAAAAYAAJ&pg=PA86 )
[Digitalisat:
http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ156765309 ]
Der Turnierspruch erscheint dann in der ersten Folioausgabe von 1558, die im 16. Jahrhundert mehrere Nachdrucke erlebte. Hiernach druckte es Adelbert von Keller (Hrsg.): Hans Sachs Bd. 2, Stuttgart 1870, S. 342-352
http://www.archive.org/stream/hanssachs10sachgoog#page/n347/mode/2up
Ein späterer Einzeldruck in Nürnberg um 1570 ist nach dem VD 16 S 575 in Wolfenbüttel nachgewiesen. Handschriftlich überliefert ist das Gedicht in der Zwickauer Spruchgedichte-Handschrift SG 4, Bl. 180v-186.
Weitere Nachweise in Bd. 25 der Ausgabe S. 123
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:BLV_225_Hans_Sachs_Band_25.pdf&page=127
Zur Quellenbearbeitung äußerte sich Carl Drescher: Studien zu Hans Sachs. Neue Folge, Marburg 1891, S. 18-21:
http://www.archive.org/stream/studienzuhanssa00dresgoog#page/n31/mode/2up
Ergänzungen dazu in einer Besprechung von A. L. Stiefel in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte NF 6 (1893), S. 146
http://books.google.com/books?id=aNYNAAAAYAAJ&pg=PA146 (US-Proxy)
Auf die Rezeption des Spruchgedichts weist hin: Ferdinand Eichler: Das Nachleben des Hans Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Leipzig 1904, S. 123:
http://www.archive.org/stream/dasnachlebendes00eichgoog#page/n141/mode/2up
Aufgrund von Rüxners Erfindung des ersten Turniers (Magdeburg 938) stieß auch das Spruchgedicht des Nürnberger Handwerkerdichters in Magdeburg auf ein besonderes Interesse. Zwei (bislang nicht weiter beachtete) frühneuzeitliche Handschriften des 17. Jahrhunderts, die die hochdeutsche Fassung der Magdeburger Schöppenchronik enthalten (fortgesetzt bis 1566) sowie die Liste der Bürgermeister und Kämmerer (bis 1601), überliefern auch das Spruchgedicht von Sachs.
- Leipzig, UB (Leihgabe der Stadtbibliothek) Rep. II 75
http://books.google.de/books?id=MAAVAAAAQAAJ&pg=PA169
- Kopenhagen, KB Cod. Thott. 633, 2°
http://books.google.de/books?id=Ro0kAQAAIAAJ&pg=RA2-PA357
Sicher handelt es sich um eine Druckabschrift. Schon Weller a.a.O. bemerkte, dass das Gedicht in Magdeburger Chronik-Drucken von 1587 und 1589 (Pomarius/Baumgartens d. J. Bearbeitung der Sassen-Chronik) abgedruckt wurde.
Die gleichen drei Texte (Schöppenchronik, Bürgermeisterkatalog, Turniere), aber wohl in anderer Reihenfolge, bot die verschollene Handschrift des Haller Universitätskanzlers Ludewig:
http://digital.slub-dresden.de/ppn33724149X/370
#forschung
#fnzhss
 Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)
Einzeldruck von Guldenmund 1541 (Wikimedia Commons)KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 23:49 - Rubrik: Landesgeschichte
als Suchwort googeln:
vier prinzen zu schaumburg lippe und das parallele Unrechtssystem
und auf Bilder drücken
Voila
ein overlook
vier prinzen zu schaumburg lippe und das parallele Unrechtssystem
und auf Bilder drücken
Voila
ein overlook
vom hofe - am Freitag, 17. Juni 2011, 23:29 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Kosten für den Wiederaufbau des Kölner Historischen Archivs steigen. So mussten laut Stadt im vergangenen Jahr 4,5 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben werden. Bis zum Jahr 2015 würden sich allein die Sachkosten auf mehr als 120 Millionen Euro belaufen. Bereits jetzt sei abzusehen, dass die Restaurierung der beschädigten Archivalien bis zum Jahr 2040 dauern und weitere Kosten in Millionenhöhe verursachen werde, so die Stadt."
Quelle: WDR.de, Lokalzeit Köln, Nachrichten v. 17.6.2011
Quelle: WDR.de, Lokalzeit Köln, Nachrichten v. 17.6.2011
Wolf Thomas - am Freitag, 17. Juni 2011, 21:47 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://womblog.de/2011/06/17/brasilien-geheim-soll-geheim-bleiben/
Aufarbeitung der Militärdiktatur in Brasilien.
Die Verbrechen der Militärdiktatur stehen wieder auf der Tagesordnung.
Doch Präsidentin Dilma Rousseff ist der Koalitionsfrieden wichtiger.
Auch unter Präsidentin Dilma Rousseff müssen sich Brasiliens
Menschenrechtler in Geduld üben. Bislang konnten sie hoffen, dass
"ultrageheime" Regierungsdokumente immerhin nach 50 Jahren öffentlich
gemacht werden – so hatte es das Abgeordneten- haus letztes Jahr
beschlossen.
Doch im Senat will Rousseff, selbst ein Folteropfer der
Militärdiktatur (1964-85), nun ihren konservativen Koalitionspartnern
nachgeben, allen voran den Expräsidenten José Sarney (1985-90) und
Fernando Collor (1990-92). "Wir dürfen doch aus der brasilianischen
Geschichte kein Wikileaks machen", sagte Sarney.
Aufarbeitung der Militärdiktatur in Brasilien.
Die Verbrechen der Militärdiktatur stehen wieder auf der Tagesordnung.
Doch Präsidentin Dilma Rousseff ist der Koalitionsfrieden wichtiger.
Auch unter Präsidentin Dilma Rousseff müssen sich Brasiliens
Menschenrechtler in Geduld üben. Bislang konnten sie hoffen, dass
"ultrageheime" Regierungsdokumente immerhin nach 50 Jahren öffentlich
gemacht werden – so hatte es das Abgeordneten- haus letztes Jahr
beschlossen.
Doch im Senat will Rousseff, selbst ein Folteropfer der
Militärdiktatur (1964-85), nun ihren konservativen Koalitionspartnern
nachgeben, allen voran den Expräsidenten José Sarney (1985-90) und
Fernando Collor (1990-92). "Wir dürfen doch aus der brasilianischen
Geschichte kein Wikileaks machen", sagte Sarney.
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 20:46 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"vielen Dank für Ihre Hinweise. Wir haben in Abstimmung mit der Autorin des Beitrags nun einige Ergänzungen vorgenommen" teilt die Bayerische Staatsbibliothek mir mit. Dass man bei substantiellen Hinweisen den Hinweisgeber oder die Quelle nennen muss, gilt nicht nur für den Universitätsbereich oder den Handschriftencensus.
Es geht um:
Sonja Kerth, Bernhard von Uissigheim: Vom Würzburger Städtekrieg, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45645 (17.06.2011)
Meine Hinweise wurden veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/19456421/
In den Kommentaren Hinweise auf auch jetzt nicht berücksichtigte Arbeiten von Klaus Arnold, wo bereits der Druck von 1527 genannt ist.
Die Existenz des Drucks und der Link wurde vermerkt, weitere Links wurden gesetzt (ärgerlicherweise aber nicht die zu den beiden JfL-Aufsätzen Schuberts, von der BSB digitalisiert, und weitere von mir genannte Links). Es fehlen aber die Arbeiten von Klaus Arnold.
Es geht um:
Sonja Kerth, Bernhard von Uissigheim: Vom Würzburger Städtekrieg, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45645 (17.06.2011)
Meine Hinweise wurden veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/19456421/
In den Kommentaren Hinweise auf auch jetzt nicht berücksichtigte Arbeiten von Klaus Arnold, wo bereits der Druck von 1527 genannt ist.
Die Existenz des Drucks und der Link wurde vermerkt, weitere Links wurden gesetzt (ärgerlicherweise aber nicht die zu den beiden JfL-Aufsätzen Schuberts, von der BSB digitalisiert, und weitere von mir genannte Links). Es fehlen aber die Arbeiten von Klaus Arnold.
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 18:20 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Ordensarchiven gibt es viel zu entdecken
Linz, 17.06.2011 (KAP) Ordensarchive sind «Gedächtnis und Hilfestellung für das Gewissen einer Gemeinschaft». Das erklärte Abt Maximilian Neulinger vom Benediktinerstift Lambach im «Kathpress»-Gespräch im Zuge der Jahrestagung der Ordensarchive und -bibliotheken im Seminarhaus St. Klara der Franziskanerinnen in Vöcklabruck. Hier trafen sich Ordensarchivare und -bibliothekare diese Woche zum Erfahrungsaustausch und besuchten abschließend das Stift Lambach als gelungenes Beispiel dafür, wie man Räumlichkeiten zu Archivzwecken umbauen kann.
«Viele Menschen suchen in Archiven Stammbäume, Ahnen, Identitäten. Sie erzählen von unserer Geschichte als Gemeinschaft», sagte Abt Neulinger, der zusammen mit einem Angestellten selbst das Lambacher Stiftsarchiv führt. «Archive geben Zeugnis für geschichtliche Fakten und Daten. Und sie regen an, Vergangenes zu bewerten und Gegenwärtiges in Beziehung zu stellen - auch mit den Überzeugungen, die letztlich unsere wahre Identität sind, nämlich das Leben nach dem Evangelium.»
Ein wichtiger Dienst eines Archivs sei es heutzutage auch, «offen zu sein», betonte der Abt. «Kirche steht oft unter dem Generalverdacht des Bunkerns, Mauerns und des Verbergens. Wir haben bewusst ein offenes Archiv, mit dem wir Zugang auch für die Aufarbeitung von unbequemen Fragestellungen schaffen wollen.»
«Ein Archiv birgt vieles: Geordnetes und Ungeordnetes, hier ist immer wieder etwas zu entdecken», so Abt Maximilian. Das Archiv im Stift Lambach umfasst tausend Archivkartons, «noch einmal eine solche Zahl archivarische Handschriften und speziell abgesondert Handschriften des Mittelalters, Papier, Pergament, auch erste Wiegendrucke». «Aber es gibt auch Unikate, Kanonenkugeln, übriggebliebene Kreuzrippen, Uhren aus dem Fundus verstorbener Mitbrüder - alles, was sich sammelt und was die Geschichte hinterlässt», berichtete Neulinger. Zu seinen liebsten Stücken zähle eine Stiftungsurkunde für ein Waisenhaus in Pergament, das mit dem Jahr 1723 datiert ist.
Im Archiv des Stiftes finden auch viele Heimatforscher - vor allem auch aufgrund des hohen Datenbestands an Bildmaterial - sowie Diplomanten und Dissertanten ihre Quellen. Es sei großartig, einen solchen Fundus an «Textzeugen» zu haben und auf diese Weise in Dialog mit einem Schreiber oder einem Illustrator zu treten. Faszinierend sei es, Pergamenthandschriften in der Hand zu halten: «Durch Tausend Jahre verwahren wir eine Information, die auch heute noch lesbar ist, auch wenn Sprache und Schrift speziell sind», hob der Abt hervor und erinnerte daran, dass neue Tonträger wie eine CD oder DVD vielleicht nicht so lange haltbar sein werden.
Kulturelles Erbe auch in Frauenorden
In den meisten Gemeinschaften betreuen Ordensleute die Archive und Bibliotheken. Vor allem in größeren Stiften und Klöstern gibt es zunehmend aber auch mehr Fachangestellte in diesem Bereich, «denn die fachlichen Anforderungen haben sich im Archiv- und Bibliothekswesen in den vergangenen Jahren vor allem durch die Einführung des Computers verändert», erklärte Helga Penz vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» der «Kathpress».
Dabei ist die Bewahrung der Archive und Bibliotheken von besonderer Wichtigkeit. «Nicht nur Männerorden, auch die vielen Frauenkongregationen haben ein reichhaltiges kulturelles Erbe zu bewahren», betonte Penz. «Es ist ein spannendes, für die Sozialgeschichte Österreichs auch höchst wichtiges historisches Erbe, das es zu bewahren und vermitteln gilt. Es ist auch wichtig, bewusst zu machen, dass diese Aufgabe nicht nur eine Angelegenheit der alten Stifte ist.»
Ordensbibliotheken: Spiegel der Zeit
«Ordensbibliotheken teilen die Geschichte des Ordens, sie haben die guten Zeiten mitgemacht, haben sich vermehrt besonders in Zeiten, als die philosophisch-theologische Bildung angesetzt hat. Aber sie haben auch die Zeiten der Ordensaufhebungen mitgemacht», erläuterte Manfred Massani, Provinzbibliothekar der Kapuziner in Innsbruck, gegenüber «Kathpress». Unterm Strich sehe man, «was die Ordensgeschichte ausgemacht hat, vor allem das spirituelle Wirken des Ordens ist hier eins zu eins vertreten».
In seinem Vortrag gab Massani eine Einführung, was eine moderne Bibliothek leisten soll. Denn war früher die Klosterbibliothek der einzige Ort im Kloster, an dem Ordensfrauen und -männer ihre Fachlektüre, Nachschlagewerke, aber auch Erbauungs- und Unterhaltungsliteratur benutzten, hat heute jeder seine eigene kleine Handbibliothek.
Die Provinzbibliothek der Kapuziner wurde 1994 gebaut im Zuge der Generalsanierung des Klosters in Innsbruck. Ziel sei gewesen, der Bibliothek des Kapuzinerklosters Innsbruck genug Platz zu bieten und auch Aufbewahrungsort für Bibliotheken aufgelassener Niederlassungen zu sein, berichtete Massani. Durch die Aufhebung von Kapuzinerklöstern der ehemaligen Nordtiroler Kapuzinerprovinz seien ganze Teile von Bibliotheken nach Innsbruck gekommen. Massani sprach damit ein generelles Problem von Orden an, denn durch Klosteraufhebungen und damit verbundenen Bibliothekszusammenführungen entstünden immer wieder Platzprobleme. Diese versuchen die Kapuziner damit zu lösen, dass sie sich Kooperationspartner suchen.
Überlegungen gebe es auch für eine stärkere Zentralisierung, erläuterte Massani. So wäre die Zentralbibliothek der Kapuziner in Rom interessiert daran, vor allem Kapuziner-Dubletten aus dem Altbestand zu erwerben. «Aber es gibt denkmalschutzrechtliche Bedenken, wenn man Kulturgut ins Ausland bringt.» Dabei müsse man aber auch bedenken, dass die Kapuziner ein weltweit tätiger Orden seien und Regionalgeschichte des Ordens immer auch Teil der gesamten Ordensgeschichte sei, merkte Massani an.
Heute umfasst die Bibliothek des Innsbrucker Klosters rund 80.000 Medien, samt eingelagerter Bestände der anderen Kapuzinerklöster komme man auf rund 120.000 Medien, die in der Provinzbibliothek verwahrt sind, so der Bibliothekar. Darunter finden sich u. a. Fragmente des Werkes «Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo» aus dem Jahr 1477 und ein deutschsprachiges Herbarium «Gart der Gesundheit» von Johann Wonnecke von Kaub aus dem Jahr 1485.
Unter den theologischen Werken seien für die Forschung die Predigtwerke von Kapuzinern der Barockzeit interessant, z. B. «Göttlicher Cetechistische Catholische Lehr» von Aemilianus von Grätz aus dem Jahr 1712. In den Werken seien immer wieder für die damalige Zeit fortschrittliche Gedanken wie etwa die Forderungen nach «gerechter» Entlohnung zu finden, sagte Massani. 2001 begann man mit der elektronischen Erschließung der Bestände - diese ist zu rund 75 Prozent erledigt.
«Parzival» bei den Franziskanern
Über die Klosterbibliothek der Franziskaner in Graz, die den historischen Buchbestand der gesamten Provinz enthält, sprachen Gert Janusch und Wolfgang Lang, die ehrenamtlich in der Bibliothek mitarbeiten. Sie umfasst rund 45.000 Bände, davon 13.000 aus der Zeit vor 1700, weiters mehr als 800 Inkunabeln und 440 mittelalterliche Handschriften. Zu den ältesten Stücken zählen Fragmente einzelner Pergamenthandschriften aus dem 9. bis 13. Jahrhundert, die zur Verkleidung hölzerner Buchdeckel dienten und nun nach behutsamer Ablösung als sogenannte Makulaturen existieren, berichtete Janusch. Auch ein vierseitiges «Parzival»-Fragment Wolfram von Eschenbachs aus dem 13. Jahrhundert, ein zweitseitiges Bruchstück von «Willehalm», ebenfalls von Wolfram von Eschenbach aus dem 13. Jahrhundert, sowie ein vierseitiges Fragment der «Christherre-Chronik» finden sich unter den Werken. Die Bibliothek betreibt einen Online-Katalog (http://opac.obvsg.at/fpa).
Redemptoristen: Verschollene Chronik
Der langjährige Provinzarchivar und kundige Ordenshistoriker der Redemptoristen, Pater Ferdinand Zahlner, berichtete über seine Tätigkeit im Provinzarchiv im Provinzhaus in Maria am Gestade in Wien. Leider seien in den Wirren der Revolution von 1848 viele Archivalien verloren gegangen, «darunter auch die wertvolle alte Chronik», so P. Zahlner. «Ebenso sind die Provinzchroniken verschollen. Sie wurden wahrscheinlich während der gefährlichen Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendwo versteckt.» Der Umfang des Archivs beläuft sich laut P. Zahlner auf rund 150 Laufmeter.
Weiterer Referenten der Tagung waren Severin Matiasovits - er hat im Rahmen eines vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» betreuten Projekts im Jahr 2009 das Archiv der Passionisten an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering geordnet und betreut - Monika Würthinger vom Diözesanarchiv Linz und Michaela Follner vom Österreichischen Staatsarchiv. Erwin Rotter von der Rechtsanwaltskanzlei Kuhn informierte über «Datenschutzfragen im Archivwesen».
Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs wurde im Jahr 2004 als Plattform zum Erfahrungsaustausch von Archivaren in Orden und Klöstern gegründet. Seit der Gründung des «Referats für die Kulturgüter der Orden» im Jahr 2010 ist die ARGE Ordensarchive eine Abteilung des Referats, die sich besonders um Weiterbildung und fachliche Beratung in Angelegenheiten des klösterlichen Archivwesens bemüht. (Infos: www.superiorenkonferenz.at)
Quelle: http://www.kathpress.co.at/
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14939
Linz, 17.06.2011 (KAP) Ordensarchive sind «Gedächtnis und Hilfestellung für das Gewissen einer Gemeinschaft». Das erklärte Abt Maximilian Neulinger vom Benediktinerstift Lambach im «Kathpress»-Gespräch im Zuge der Jahrestagung der Ordensarchive und -bibliotheken im Seminarhaus St. Klara der Franziskanerinnen in Vöcklabruck. Hier trafen sich Ordensarchivare und -bibliothekare diese Woche zum Erfahrungsaustausch und besuchten abschließend das Stift Lambach als gelungenes Beispiel dafür, wie man Räumlichkeiten zu Archivzwecken umbauen kann.
«Viele Menschen suchen in Archiven Stammbäume, Ahnen, Identitäten. Sie erzählen von unserer Geschichte als Gemeinschaft», sagte Abt Neulinger, der zusammen mit einem Angestellten selbst das Lambacher Stiftsarchiv führt. «Archive geben Zeugnis für geschichtliche Fakten und Daten. Und sie regen an, Vergangenes zu bewerten und Gegenwärtiges in Beziehung zu stellen - auch mit den Überzeugungen, die letztlich unsere wahre Identität sind, nämlich das Leben nach dem Evangelium.»
Ein wichtiger Dienst eines Archivs sei es heutzutage auch, «offen zu sein», betonte der Abt. «Kirche steht oft unter dem Generalverdacht des Bunkerns, Mauerns und des Verbergens. Wir haben bewusst ein offenes Archiv, mit dem wir Zugang auch für die Aufarbeitung von unbequemen Fragestellungen schaffen wollen.»
«Ein Archiv birgt vieles: Geordnetes und Ungeordnetes, hier ist immer wieder etwas zu entdecken», so Abt Maximilian. Das Archiv im Stift Lambach umfasst tausend Archivkartons, «noch einmal eine solche Zahl archivarische Handschriften und speziell abgesondert Handschriften des Mittelalters, Papier, Pergament, auch erste Wiegendrucke». «Aber es gibt auch Unikate, Kanonenkugeln, übriggebliebene Kreuzrippen, Uhren aus dem Fundus verstorbener Mitbrüder - alles, was sich sammelt und was die Geschichte hinterlässt», berichtete Neulinger. Zu seinen liebsten Stücken zähle eine Stiftungsurkunde für ein Waisenhaus in Pergament, das mit dem Jahr 1723 datiert ist.
Im Archiv des Stiftes finden auch viele Heimatforscher - vor allem auch aufgrund des hohen Datenbestands an Bildmaterial - sowie Diplomanten und Dissertanten ihre Quellen. Es sei großartig, einen solchen Fundus an «Textzeugen» zu haben und auf diese Weise in Dialog mit einem Schreiber oder einem Illustrator zu treten. Faszinierend sei es, Pergamenthandschriften in der Hand zu halten: «Durch Tausend Jahre verwahren wir eine Information, die auch heute noch lesbar ist, auch wenn Sprache und Schrift speziell sind», hob der Abt hervor und erinnerte daran, dass neue Tonträger wie eine CD oder DVD vielleicht nicht so lange haltbar sein werden.
Kulturelles Erbe auch in Frauenorden
In den meisten Gemeinschaften betreuen Ordensleute die Archive und Bibliotheken. Vor allem in größeren Stiften und Klöstern gibt es zunehmend aber auch mehr Fachangestellte in diesem Bereich, «denn die fachlichen Anforderungen haben sich im Archiv- und Bibliothekswesen in den vergangenen Jahren vor allem durch die Einführung des Computers verändert», erklärte Helga Penz vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» der «Kathpress».
Dabei ist die Bewahrung der Archive und Bibliotheken von besonderer Wichtigkeit. «Nicht nur Männerorden, auch die vielen Frauenkongregationen haben ein reichhaltiges kulturelles Erbe zu bewahren», betonte Penz. «Es ist ein spannendes, für die Sozialgeschichte Österreichs auch höchst wichtiges historisches Erbe, das es zu bewahren und vermitteln gilt. Es ist auch wichtig, bewusst zu machen, dass diese Aufgabe nicht nur eine Angelegenheit der alten Stifte ist.»
Ordensbibliotheken: Spiegel der Zeit
«Ordensbibliotheken teilen die Geschichte des Ordens, sie haben die guten Zeiten mitgemacht, haben sich vermehrt besonders in Zeiten, als die philosophisch-theologische Bildung angesetzt hat. Aber sie haben auch die Zeiten der Ordensaufhebungen mitgemacht», erläuterte Manfred Massani, Provinzbibliothekar der Kapuziner in Innsbruck, gegenüber «Kathpress». Unterm Strich sehe man, «was die Ordensgeschichte ausgemacht hat, vor allem das spirituelle Wirken des Ordens ist hier eins zu eins vertreten».
In seinem Vortrag gab Massani eine Einführung, was eine moderne Bibliothek leisten soll. Denn war früher die Klosterbibliothek der einzige Ort im Kloster, an dem Ordensfrauen und -männer ihre Fachlektüre, Nachschlagewerke, aber auch Erbauungs- und Unterhaltungsliteratur benutzten, hat heute jeder seine eigene kleine Handbibliothek.
Die Provinzbibliothek der Kapuziner wurde 1994 gebaut im Zuge der Generalsanierung des Klosters in Innsbruck. Ziel sei gewesen, der Bibliothek des Kapuzinerklosters Innsbruck genug Platz zu bieten und auch Aufbewahrungsort für Bibliotheken aufgelassener Niederlassungen zu sein, berichtete Massani. Durch die Aufhebung von Kapuzinerklöstern der ehemaligen Nordtiroler Kapuzinerprovinz seien ganze Teile von Bibliotheken nach Innsbruck gekommen. Massani sprach damit ein generelles Problem von Orden an, denn durch Klosteraufhebungen und damit verbundenen Bibliothekszusammenführungen entstünden immer wieder Platzprobleme. Diese versuchen die Kapuziner damit zu lösen, dass sie sich Kooperationspartner suchen.
Überlegungen gebe es auch für eine stärkere Zentralisierung, erläuterte Massani. So wäre die Zentralbibliothek der Kapuziner in Rom interessiert daran, vor allem Kapuziner-Dubletten aus dem Altbestand zu erwerben. «Aber es gibt denkmalschutzrechtliche Bedenken, wenn man Kulturgut ins Ausland bringt.» Dabei müsse man aber auch bedenken, dass die Kapuziner ein weltweit tätiger Orden seien und Regionalgeschichte des Ordens immer auch Teil der gesamten Ordensgeschichte sei, merkte Massani an.
Heute umfasst die Bibliothek des Innsbrucker Klosters rund 80.000 Medien, samt eingelagerter Bestände der anderen Kapuzinerklöster komme man auf rund 120.000 Medien, die in der Provinzbibliothek verwahrt sind, so der Bibliothekar. Darunter finden sich u. a. Fragmente des Werkes «Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo» aus dem Jahr 1477 und ein deutschsprachiges Herbarium «Gart der Gesundheit» von Johann Wonnecke von Kaub aus dem Jahr 1485.
Unter den theologischen Werken seien für die Forschung die Predigtwerke von Kapuzinern der Barockzeit interessant, z. B. «Göttlicher Cetechistische Catholische Lehr» von Aemilianus von Grätz aus dem Jahr 1712. In den Werken seien immer wieder für die damalige Zeit fortschrittliche Gedanken wie etwa die Forderungen nach «gerechter» Entlohnung zu finden, sagte Massani. 2001 begann man mit der elektronischen Erschließung der Bestände - diese ist zu rund 75 Prozent erledigt.
«Parzival» bei den Franziskanern
Über die Klosterbibliothek der Franziskaner in Graz, die den historischen Buchbestand der gesamten Provinz enthält, sprachen Gert Janusch und Wolfgang Lang, die ehrenamtlich in der Bibliothek mitarbeiten. Sie umfasst rund 45.000 Bände, davon 13.000 aus der Zeit vor 1700, weiters mehr als 800 Inkunabeln und 440 mittelalterliche Handschriften. Zu den ältesten Stücken zählen Fragmente einzelner Pergamenthandschriften aus dem 9. bis 13. Jahrhundert, die zur Verkleidung hölzerner Buchdeckel dienten und nun nach behutsamer Ablösung als sogenannte Makulaturen existieren, berichtete Janusch. Auch ein vierseitiges «Parzival»-Fragment Wolfram von Eschenbachs aus dem 13. Jahrhundert, ein zweitseitiges Bruchstück von «Willehalm», ebenfalls von Wolfram von Eschenbach aus dem 13. Jahrhundert, sowie ein vierseitiges Fragment der «Christherre-Chronik» finden sich unter den Werken. Die Bibliothek betreibt einen Online-Katalog (http://opac.obvsg.at/fpa).
Redemptoristen: Verschollene Chronik
Der langjährige Provinzarchivar und kundige Ordenshistoriker der Redemptoristen, Pater Ferdinand Zahlner, berichtete über seine Tätigkeit im Provinzarchiv im Provinzhaus in Maria am Gestade in Wien. Leider seien in den Wirren der Revolution von 1848 viele Archivalien verloren gegangen, «darunter auch die wertvolle alte Chronik», so P. Zahlner. «Ebenso sind die Provinzchroniken verschollen. Sie wurden wahrscheinlich während der gefährlichen Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendwo versteckt.» Der Umfang des Archivs beläuft sich laut P. Zahlner auf rund 150 Laufmeter.
Weiterer Referenten der Tagung waren Severin Matiasovits - er hat im Rahmen eines vom «Referat für die Kulturgüter der Orden» betreuten Projekts im Jahr 2009 das Archiv der Passionisten an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering geordnet und betreut - Monika Würthinger vom Diözesanarchiv Linz und Michaela Follner vom Österreichischen Staatsarchiv. Erwin Rotter von der Rechtsanwaltskanzlei Kuhn informierte über «Datenschutzfragen im Archivwesen».
Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs wurde im Jahr 2004 als Plattform zum Erfahrungsaustausch von Archivaren in Orden und Klöstern gegründet. Seit der Gründung des «Referats für die Kulturgüter der Orden» im Jahr 2010 ist die ARGE Ordensarchive eine Abteilung des Referats, die sich besonders um Weiterbildung und fachliche Beratung in Angelegenheiten des klösterlichen Archivwesens bemüht. (Infos: www.superiorenkonferenz.at)
Quelle: http://www.kathpress.co.at/
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14939
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 18:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus einer Zuschrift:
Seiten aus den Urbaren, die man vor 20 Jahren pro Kopie für wenige Pfennige erhielt, werden nun vorher angeblich gescannt. Pro Seite sind dann 5 € für die Scannung fällig, 0,50 € für die Kopie zuzüglich Porto. Für 1 DIN A4 Seite waren sage und schreibe 6,50 € fällig.
Seiten aus den Urbaren, die man vor 20 Jahren pro Kopie für wenige Pfennige erhielt, werden nun vorher angeblich gescannt. Pro Seite sind dann 5 € für die Scannung fällig, 0,50 € für die Kopie zuzüglich Porto. Für 1 DIN A4 Seite waren sage und schreibe 6,50 € fällig.
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 17:00 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Enhancing Open Access to Grey Literature: On the Launch of the OpenGrey Repository
http://www.opengrey.eu/
Today marks the launch of the OpenGrey Repository. OpenGrey succeeds
OpenSIGLE, which was an initiative by INIST-CNRS to transfer the contents of
a commercial database into an open access environment - including the
results of 25 years of collecting and referencing grey literature by
European partners. Since 2008, GreyNet's conference preprints complement the
offer on grey literature in OpenGrey by providing full-text access to
research output in this field of information science,
http://www.opengrey.eu/search/request?q=greynet
http://www.opengrey.eu/
Today marks the launch of the OpenGrey Repository. OpenGrey succeeds
OpenSIGLE, which was an initiative by INIST-CNRS to transfer the contents of
a commercial database into an open access environment - including the
results of 25 years of collecting and referencing grey literature by
European partners. Since 2008, GreyNet's conference preprints complement the
offer on grey literature in OpenGrey by providing full-text access to
research output in this field of information science,
http://www.opengrey.eu/search/request?q=greynet
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:49 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:31 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A new blog created by the Rare Books Collections of the Department of Special Collections of the University of St Andrews: http://standrewsrarebooks.wordpress.com/
"Echoes from the Vault explores discoveries made through current retro-cataloguing efforts, announces any news or events from the Special Collections and will highlight some of the treasures from our long history of collecting. It has also been published in part to fill the need to reach out to our current and potential users as the department has been relocated to a temporary, smaller facility during a phase of refurbishment." (Archives-L)
"Echoes from the Vault explores discoveries made through current retro-cataloguing efforts, announces any news or events from the Special Collections and will highlight some of the treasures from our long history of collecting. It has also been published in part to fill the need to reach out to our current and potential users as the department has been relocated to a temporary, smaller facility during a phase of refurbishment." (Archives-L)
KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 16:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,768816,00.html
Die Deutschland-Chefs von Sony Music und Universal Music attackieren die Gema. Die Verwertungsgesellschaft verhindert hartnäckig die Sendung zahlreicher Songs auf YouTube. Der Verdacht der Platten-Manager: Die Gema sei noch nicht im Digitalzeitalter angekommen.
Siehe auch
http://www.tagseoblog.de/das-elend-mit-der-gema-wen-vertritt-sie-eigentlich
Zur GEMA siehe hier
http://archiv.twoday.net/stories/19464659/
http://archiv.twoday.net/search?q=verwertungsges+gema
#gema

Die Deutschland-Chefs von Sony Music und Universal Music attackieren die Gema. Die Verwertungsgesellschaft verhindert hartnäckig die Sendung zahlreicher Songs auf YouTube. Der Verdacht der Platten-Manager: Die Gema sei noch nicht im Digitalzeitalter angekommen.
Siehe auch
http://www.tagseoblog.de/das-elend-mit-der-gema-wen-vertritt-sie-eigentlich
Zur GEMA siehe hier
http://archiv.twoday.net/stories/19464659/
http://archiv.twoday.net/search?q=verwertungsges+gema
#gema

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 15:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Joseph Schnitzer (1859-1939) war ein katholischer Theologe und Kirchenhistoriker, der zum Opfer der sogenannten Modernisten-Verfolgung wurde. Der greise Vorsitzende des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e.V., Manfred Weitlauff, gab dem kürzlich erschienenen Jahrbuch des Vereins 2010 einen mit separater Seitenzählung versehenen zweiten Teil bei, eine Monographie über Schnitzer, die durchaus spannend zu lesen ist. Einige Publikationen Schnitzers sind jetzt in Düsseldorf online, darunter die nach wie vor wichtige Savonarola-Biographie von 1924:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2698871

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2698871

KlausGraf - am Freitag, 17. Juni 2011, 12:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Damit befasste sich eine Arbeit schon 2008:
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33525
Archivalia ist in den Belegen zitiert.
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33525
Archivalia ist in den Belegen zitiert.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/stream/urkundenbuchder05sachgoog#page/n347/mode/2up
(auch Die Magdeburger Schöppensprüche, 1901, S. 6f. Nr. 2 http://books.google.de/books?id=-5QwAAAAYAAJ US-Proxy = http://www.archive.org/details/DieMagdeburgerSchoeppensprueche)
Hertel datiert im UB der Stadt Magdeburg I, n. 508 um 1370. Die Ausfertigung lag im Stadtarchiv Groß-Salze Nr. 39. Die Schöffen befragten ihren Schreiber - das war aber wohl der üblicherweise mit Heinrich von Lammespringe identifizierte Verfasser der Magdeburger Schöppenchronik. Er dürfte dann auch die Urkunde geschrieben haben. Zumindest ist das nicht unwahrscheinlicher als die Identifizierung des Autors mit dem Kleriker Heinrich von Lammespringe. Dieser erscheint 1386 und 1396 in Groß-Salze als Altarist von St. Peter in Magdeburg und ehemaliger Stadtschreiber von Magdeburg. Der Verfasser der Urfassung der Schöppenchronik ca. 1360/72 war nach eigenen Angaben Altarist von St. Petri und Stadtschreiber sowie Schöffenschreiber. Er muss 1350 noch recht jung gewesen sein. Die von den Schöffen zu Lehen gehende Heiligkreuzpfründe war für einen "armen scholere edder papen" vorgesehen (ed. Janicke S. 220). Auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Schöffen und der Stadt konnte der Schreiber diese Pfründe behalten. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:
a) Heinrich von Lammesspringe ist vielleicht um 1330 geboren und wurde 1350 Schöffenschreiber. Nach dem wohl ca. 1372 anzusetzenden Ende seiner Tätigkeit begab er sich unter Beibehaltung der Pfründe an St. Petri nach Groß-Salze. Er dürfte hochbetagt nicht vor 1396 gestorben sein. So die auf Janicke zurückgehende bisherige Forschung.
b) Der Chronist starb kurz nach 1372 (wohl in seinen 40ern) - oder er zog aus Magdeburg weg. Sein Nachfolger als Stadtschreiber bzw. Schöffenschreiber und Inhaber der Peterspfründe wurde Heinrich von Lammesspringe, der später nach Groß-Salze ging (unter Beibehaltung seiner Pfründe).
In chronologischer Hinsicht kann man die Variante b) nicht als erheblich weniger plausibel ansehen als a). Die Lücke zwischen 1372 und 1386 ist groß genug für einen langjährig amtierenden Nachfolger. Daher kann die übliche Gleichsetzung des Chronisten mit Heinrich von Lammesspringe nicht als gesichert angesehen werden.
Auf Schriftvergleiche ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung und der Problematik der Händezuweisung nicht zu hoffen. Man könnte allenfalls UB Magdeburg 1 Nr. 525 von 1373 (Magdeburg an Lübeck) im Stadtarchiv Lüneburg mit der oben zitierten Urkunde vergleichen. Aber selbst wenn es die gleiche Hand wäre, was wäre damit gewonnen?
Bei Janicke nicht berücksichtigt ist die Urkunde vom 24.2.1386, in der "her Hinric unn her Curt von Lammespring" als Zeugen auftreten (UB 1 n. 614 bzw. Volltext UB ULF) und zwar in Magdeburg. Ebenso wenig die von 1387 Sept. 4 ebd., Nr. 629 (S. 400), zu letzterer auch UB Halle http://goo.gl/DQDar http://goo.gl/Hn95D = GBS.
[Update: Aber war es der Schreiber der Magdeburger Schöffen oder nicht eher der der von Groß-Salze?]
#forschung
(auch Die Magdeburger Schöppensprüche, 1901, S. 6f. Nr. 2 http://books.google.de/books?id=-5QwAAAAYAAJ US-Proxy = http://www.archive.org/details/DieMagdeburgerSchoeppensprueche)
Hertel datiert im UB der Stadt Magdeburg I, n. 508 um 1370. Die Ausfertigung lag im Stadtarchiv Groß-Salze Nr. 39. Die Schöffen befragten ihren Schreiber - das war aber wohl der üblicherweise mit Heinrich von Lammespringe identifizierte Verfasser der Magdeburger Schöppenchronik. Er dürfte dann auch die Urkunde geschrieben haben. Zumindest ist das nicht unwahrscheinlicher als die Identifizierung des Autors mit dem Kleriker Heinrich von Lammespringe. Dieser erscheint 1386 und 1396 in Groß-Salze als Altarist von St. Peter in Magdeburg und ehemaliger Stadtschreiber von Magdeburg. Der Verfasser der Urfassung der Schöppenchronik ca. 1360/72 war nach eigenen Angaben Altarist von St. Petri und Stadtschreiber sowie Schöffenschreiber. Er muss 1350 noch recht jung gewesen sein. Die von den Schöffen zu Lehen gehende Heiligkreuzpfründe war für einen "armen scholere edder papen" vorgesehen (ed. Janicke S. 220). Auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Schöffen und der Stadt konnte der Schreiber diese Pfründe behalten. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:
a) Heinrich von Lammesspringe ist vielleicht um 1330 geboren und wurde 1350 Schöffenschreiber. Nach dem wohl ca. 1372 anzusetzenden Ende seiner Tätigkeit begab er sich unter Beibehaltung der Pfründe an St. Petri nach Groß-Salze. Er dürfte hochbetagt nicht vor 1396 gestorben sein. So die auf Janicke zurückgehende bisherige Forschung.
b) Der Chronist starb kurz nach 1372 (wohl in seinen 40ern) - oder er zog aus Magdeburg weg. Sein Nachfolger als Stadtschreiber bzw. Schöffenschreiber und Inhaber der Peterspfründe wurde Heinrich von Lammesspringe, der später nach Groß-Salze ging (unter Beibehaltung seiner Pfründe).
In chronologischer Hinsicht kann man die Variante b) nicht als erheblich weniger plausibel ansehen als a). Die Lücke zwischen 1372 und 1386 ist groß genug für einen langjährig amtierenden Nachfolger. Daher kann die übliche Gleichsetzung des Chronisten mit Heinrich von Lammesspringe nicht als gesichert angesehen werden.
Auf Schriftvergleiche ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung und der Problematik der Händezuweisung nicht zu hoffen. Man könnte allenfalls UB Magdeburg 1 Nr. 525 von 1373 (Magdeburg an Lübeck) im Stadtarchiv Lüneburg mit der oben zitierten Urkunde vergleichen. Aber selbst wenn es die gleiche Hand wäre, was wäre damit gewonnen?
Bei Janicke nicht berücksichtigt ist die Urkunde vom 24.2.1386, in der "her Hinric unn her Curt von Lammespring" als Zeugen auftreten (UB 1 n. 614 bzw. Volltext UB ULF) und zwar in Magdeburg. Ebenso wenig die von 1387 Sept. 4 ebd., Nr. 629 (S. 400), zu letzterer auch UB Halle http://goo.gl/DQDar http://goo.gl/Hn95D = GBS.
[Update: Aber war es der Schreiber der Magdeburger Schöffen oder nicht eher der der von Groß-Salze?]
#forschung
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 21:13 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
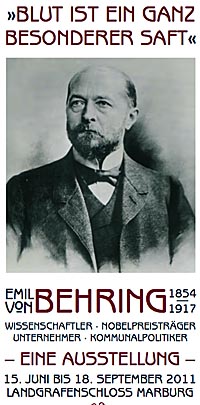
"Im Rahmen eines Festaktes zur Vertragsunterzeichnung der Übergabe des Behring-Archivs von Sanofi-Aventis Deutschland an die Philipps-Universität Marburg veranstalten die Philipps-Universität, Sanofi-Aventis und die Universitätsstadt Marburg einen Festakt im Landgrafenschloss. Anschließend findet sie Eröffnung der Ausstellung Blut ist ein ganz besonderer Saft’ – Emil von Behring (1854-1917) statt.
Im Mai des Jahres 1895 wurde Emil von Behring zum ordentlichen Professor für Hygiene ernannt und mit der Leitung des Hygienischen Instituts der Marburger Universität betraut. Seine Forschungen und Erfolge auf dem Gebiet der Serumforschung und der Serumproduktion führten im November 1904 zur Gründung der Behring-Werke. Damit wurde die Grundlage für den heutigen internationalen Pharmastandort Marburg geschaffen. Als erster Medizin-Nobelpreisträger und Ehrenbürger der Universitätsstadt Marburg ist der Name Behrings weltweit bekannt und mit Marburg verbunden.
Die Ausstellung beleuchtet den Mediziner als Persönlichkeit, sein wissenschaftliches Werk, seine Laufbahn als Hochschullehrer sowie seine unternehmerischen Fähigkeiten. Ebenso wird ein Einblick in seine weniger bekannte Tätigkeit als Kommunalpolitiker gewährt und kann ab 15. Juni besucht werden. Der Festakt am Dienstagabend findet mit geladenen Gästen statt."
Quelle: dasmarburger.de, Juni 2011
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 21:05 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Historians come and go. The archives last forever"
Eric Hobsbawm, APPG on Archives 15.6.2011
Eric Hobsbawm, APPG on Archives 15.6.2011
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:58 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Wikimedia
Wikimedia"Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger wird rund eine Million Dokumente und Gegenstände, die er im Lauf seines Lebens als Diplomat, Lehrer und Privatmann angehäuft hat, der amerikanischen Elite-Universität Yale vermachen.
Auch Regierungspapiere Kissingers, die in der Bücherei des US-Kongresses lagern, werden nach Angaben der Universität in die Archive Yales Eingang finden. Kissinger slbst habe durch eine Spende die Digitalisierung dieser Dokumente vorangetrieben und sie so für Yale zugänglich gemacht. Kissinger war unter Präsident Richard Nixon nationaler Sicherheitsberater und Außenminister, unter Gerald Ford war er weiter als Chefdiplomat tätig."
Quelle: 3sat.de, Kulturnews v. 16.6.11
Wikipedia-Artikel zu Henry Kissinger
s.a. San Francisco Chronicle, 15.6.11
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:47 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/details/DieGeschichtsquellenDerProvinzSachsenImMittelalterUndInDer
Eine Bibliographie von Walther Schultze, keine Quellenkunde, aber vorbildlich.
Eine Bibliographie von Walther Schultze, keine Quellenkunde, aber vorbildlich.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:37 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dr. Babicka, Dr. Ryantová, die stellv. Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen Richter-Laugwitz beim Grußwort, Dr. Poloncarz (v.l.n.r.). Foto: Stephan Luther, Chemnitz
"Bericht von Grit Richter-Laugwitz, stellv. Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im VdA
„Quellen zur Geschichte Böhmens und Sachsens in den Archiven beider Länder“ lautete der Titel des ersten offiziellen Tschechisch-Sächsischen Archivarstreffens in Děčỉn/Tschechien. Veranstaltet wurde es von der Tschechischen Archivgesellschaft und den staatlichen Archiven in Děčỉn in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Sachsen im VdA.
Die Initialzündung für das Treffen ging von der Vorsitzenden der Tschechischen Archivgesellschaft, Frau Dr. Marie Ryantová aus, die die sächsischen Kollegen nach drei bislang vom Landesverband Sachsen organisierten Sächsisch-Böhmischen Archivarstreffen (im Rahmen des Sächsischen Archivtages) nach Tschechien eingeladen hatte. Die sächsischen Archivarinnen und Archivare wurden durch Kolleginnen und Kollegen aus dem Sächsischen Staatsarchiv, dem Stadtarchiv Leipzig, dem Archivverbund Bautzen sowie dem Universitätsarchiv Chemnitz vertreten. Sie erlebten mit einem Stadtrundgang in Děčỉn, dem Blick in das Staatliche Gebietsarchiv Leitmeritz, Zweigstelle Děčỉn und in das Staatliche Kreisarchiv Děčỉn sowie den Vorträgen am Samstag ein sehr abwechslungsreiches Programm. Dabei wurden die sächsischen Archivarinnen und Archivare von überaus herzlichen Gastgebern umsorgt, die die Fragen der Gäste zu den Strukturen des tschechischen Archivwesens sowie den Aufgaben und Problemen der Kollegen vor Ort geduldig beantworteten. Dabei erfuhren die sächsischen Gäste viel Wissenswertes und es kam sehr schnell ein kollegialer Austausch zu Stande.
Die Vorträge am Samstag, dank der finanziellen Unterstützung durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond alle simultan gedolmetscht, behandelten vor allem die Quellen zur Geschichte Böhmens in deutschen und tschechischen Archiven. Eingeleitet wurde die Tagung durch Grußworte von Frau Ryantová und Frau Richter-Laugwitz als Vertreterinnen der Archivverbände sowie vom Direktor der Archivverwaltung in Prag, Dr. Babicka, und vom Direktor des Staatlichen Gebietsarchivs Leitmeritz, Dr. Poloncarz. Von deutscher Seite steuerte Dr. Peter Wiegand, Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, eines sehr interessanten Vortrag zur kartographischen Überlieferung Nordböhmens im Hauptstaatsarchiv Dresden bei. Inhaltlich waren die Oberlausitz und das Erzgebirge - als geographisch unmittelbar an Tschechien angrenzende Gebiete - Schwerpunkte der Ausführungen.
Alle Teilnehmer bewerteten das Treffen als überaus gelungen. Es hat wesentlich dazu beigetragen, die Kontakte zwischen den Archivarinnen und Archivaren beider Länder und insbesondere zwischen der Tschechischen Archivarsgesellschaft und dem Landesverband Sachsen im VdA weiter zu intensivieren. Die nach langer grauer Regenzeit endlich herausgekommene Sonne trug ihr übriges zur guten Stimmung bei. Viele der sächsischen Kolleginnen und Kollegen waren sich einig, dass das nicht ihr letzter Besuch speziell in Děčỉn war. "
Quelle: VdA-Landesverband Sachsen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:34 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.iuwis.de/blog/presse_lsr_kuhlen_2011
Überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig – das Leistungsschutzrecht für Presseverleger
(Anmerkung: Dieser Beitrag steht unter der Lizenz Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).)
Von Rainer Kuhlen
Zusammenfassung: Ein Leistungsschutz für Presseverlage trägt kaum dazu bei, dem Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung mehr Substanz zu verleihen. Ganz im Gegenteil: ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage griffe entsprechend den bislang bekannt gewordenen Erwartungen der Verleger unbillig stark in den freien Informationsfluss und in bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts ein. Es ist zudem ökonomisch unsinnig, indem es den zukünftigen, in elektronischen Umgebungen zu erzielenden Geschäftserfolg der Presseunternehmen eher behindert als begünstigt. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotener Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Eine substantielle Urheberrechtsreform zu Zeiten des Internet sollte nicht immer weitere Schutzräume und Verknappungsformen schaffen, sondern mehr Freiräume, nicht zuletzt auch für die Urheber der Werke selber, nicht alleine für die Verwerter.
Vorbemerkung Die Realisierung eines Leistungsschutzrechts war nach allen bisherigen Informationen aus dem Bundesjustizministerium im Rahmen des Dritten Korbs der Urheberrechtsanpassung vorgesehen. Offenbar tut man sich im Ministerium aber weiterhin schwer, einen Entwurf für den Dritten Korb vorzulegen. Als Grund dafür kann nur mangelnde Substanz bei den bisherigen Vorschlägen vermutet werden. Mangelnde Substanz wird dann sicherlich massiv beklagt werden, wenn, anders als es die ursprüngliche Anlage des Dritten Korbs nahegelegt hatte, den Belangen von Bildung und Wissenschaft nach weitgehend freiem Informationsfluss erneut nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Mangelnde Substanz kann aber auch bedeuten, dass nicht zeitgemäße und lediglich Lobby-/Partikularinteressen dienende Regelungen neu aufgenommen wurden. Über den folgenden Beitrag soll die Politik dringend davor gewarnt werden, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, auch wenn dieses Ziel Eingang in den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung zwischen CDU/CSU und FDP gefunden hat, nun umzusetzen, obgleich es nach Einschätzung so gut wie aller Betroffenen (mit Ausnahme der dadurch Begünstigten natürlich) überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig ist (vgl. die Literatur vor allem in Anm. 5).
Die Formulierung im Koalitionsvertrag lautet:
„Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sein als andere Werkvermittler. Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an.“[1]
Aber es steht auch in diesem Vertrag: „… wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistungen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent ermäßigen.“ (ibid. 14/132). All das sind ja keine Naturgesetze. Wie schnell sind solche Zielvorstellungen der Schnee von gestern. Das drastischste Beispiel dafür ist sicher: „In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung [für deutsche Kernkraftwerke –RK] nähere Regelungen getroffen“ (ibid. 29/132).
Dass Fehler korrigiert werden müssen, kommt vor, und mit der entsprechenden Häme muss man leben. Aber muss immer erst der Weg über die Fehler gehen, um dann aufwändig diese wieder zu beseitigen? Könnte man nicht vorher auf die dagegen sprechenden Argumente hören? Ob heute das Hotelprivileg wieder verabschiedet werden würde, ist höchst zweifelhaft. Klientelpolitik zahlt sich nicht aus, und für eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Urheberrecht kann diese ohnehin nicht herhalten. Das Urheberrecht begründet sich in erster Linie dadurch, dass die getroffenen Regelungen der Beförderung der Produktion und Nutzung von Wissen und Information allen und in allen Bereichen der Gesellschaft dienen, und nicht dem Schutz der ökonomischen Interessen von speziellen Gruppen.
Sollte also der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums für den Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung vorsehen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Leistungsschutzrecht für Presseverlage tatsächlich rechtlich zu verankern, dann würde das kein Beitrag zur Substanz des Dritten Korbs werden, sondern nur ein weiteres Beispiel für eine höchst überflüssige Klientelpolitik und eine Fehlinterpretation des staatlichen Regulierungsauftrags für den Umgang mit Wissen und Information. Aber vor allem wäre das schlichtweg ökonomischer Unsinn, weil es die Presseverlage davon freistellte, kreativ und innovativ Mehrwertleistungen und neue Modelle für die Vermarktung von Medieninformationen zu entwickeln.
Natürlich macht ein Ministerium mit einem Gesetzentwurf noch keine verbindliche Politik. Vielleicht werden die Gremien der Legislative so etwas nicht durchgehen lassen. Schließlich baute der Vorsitzende des Rechtsauschusses des Bundestages, Siegfried Kauder, schon einmal eine Bremse gegen ein neues Presse-Leistungsschutzrecht ein: „Ich versichere Ihnen, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der gewinnt, der den besseren Lobbyismus betreibt.“[2] Es sollten in der Tat die besseren Argumente entscheiden.
Zunächst: was ist ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage und was soll es bewirken?[3] So ganz klar ist es nicht, was die Verlege eigentlich geregelt haben wollen. Druck wird gemacht mit Hinweisen auf die bedrohte Pressefreiheit oder zumindest die Bedrohung des Qualitätsjournalismus. Der Zusammenhang mit einem Leistungsschutzrecht ist dabei nicht klar ersichtlich. Allein man kann politische Zustimmung dadurch erwirken. In erster Linie geht es natürlich darum, mehr Einnahmen zu generieren, ohne zwangsläufig weitere Leistungen als bislang schon zu erbringen.
So könnten Links auf ansonsten frei zugängliche Presseartikel dann kostenpflichtig werden, wenn sie (die Links) in einem gewerblichen Umfeld auf elektronischem Weg bekannt gemacht werden[4]. Aber der Hauptgrund dürfte wohl der Ärger der Verleger sein, dass Internetakteure wie Google Werbeeinnahmen nicht zuletzt dadurch erzielen, dass bei den Ergebnissen von Suchmaschinenanfragen kurze Textauszüge (Snippets) von Presseerzeugnissen angezeigt werden, die dann als Links auf die Volltexte verweisen. Die Anzeige dieser Snippets über das bisherige Urheberrecht entgeltpflichtig zu machen, ist ziemlich aussichtslos – darüber ist sich die Fachwelt weitgehend einig. Also soll die Erweiterung über das Leistungsschutzrecht her.
Im Prinzip könnten damit Ansprüche gegen einen jeglichen Informationsdienst erhoben werden, der wie z.B. Abstractdienste, Pressespiegel, aber auch Kopienversanddienste oder Rechercheleistungen von Informationsvermittlern, Mehrwertleistungen erbringt (vgl. Nolte in Anm. 2). Die Nutzung selbst kleinster Teile aus Artikeln der Presse könnte im Prinzip abgabepflichtig werden, da das für das Urheberrecht verbindliche (wenn auch schwierig zu definierende) Kriterium der ausreichenden Schöpfungshöhe bei einem Leistungsschutzrecht überhaupt nicht zur Anwendung kommen würde. Die Inpflichtnahme für private individuelle Nutzung sei bislang nicht vorgesehen, so versichern das Ministerium und die Verleger. Nur die Nutzung für kommerzielle Zwecke sei anvisiert. Aber das hatte die Musik- und Filmindustrie auch zunächst erklärt, und dann kamen die vielen Abmahnungen an die privaten Adressen.
Natürlich könnten sich die Verlage vor allem gegen die Suchmaschinenanzeige wehren. Schließlich könnte den Robotern der Suchmaschinen sehr einfach und mit Erfolg untersagt werden, auf die Artikel aus den Presseerzeugnissen zum Zwecke der Indexierung und der Ableitung der Snippets zuzugreifen. Das will man aber nicht, weil die Suchmaschinenanzeige natürlich auch für die Verleger einen Marketingwert hat. Man will also beides: den Marketingeffekt und an den Werbeeinnahmen der Googles bzw. den (gewerblichen) Informationszuwächsen der Nutzer der Googles teilhaben. Im Übrigen ist keine Rede davon, dass sich ein neues Leistungsschutzrecht daran messen solle, inwieweit die Presseerzeugnisse neue Leistungen, neue informationelle Mehrwerte, erbringen bzw. inwieweit die Verlage neue, den elektronischen Umgebungen angemessene Organisationsmodelle entwickeln.
Nach wie vor wird in der Politik der politische Wille der Repräsentanten der Politik, sprich der Parteien, durchgesetzt, zumal wenn diese die Regierung tragen. Die von der Politik Betroffenen werden zwar heute i.d.R. nicht zuletzt über den Weg der Anhörung bei anstehenden Gesetzesvorhaben gehört, aber das bleibt oft genug folgenlos – so wie vermutlich die Aussagen bei der Anhörung zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger, die das Bundesjustizministerium zur Vorbereitung des Dritten Korbs im August 2010 durchgeführt hatte. Jeder, der dabei war, und die verschiedenen Berichte zur Anhörung und Dokumente dazu belegen das, wird bestätigen, dass die überwiegende Mehrheit der Gehörten sich entschieden gegen ein neues Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat. Die Argumente liegen auf der Hand[5]:
Die Ansprüche (von geistigem Eigentum sollte man nicht sprechen[6]) der Verleger (oft genug erst als Nutzungsrechte erworben durch Übertragung der Verwertungsrechte von den journalistischen Urhebern) sind schon jetzt durch das Urheberrecht bzw. das Urhebervertragsrecht gesichert. Insbesondere sind die Online-Produkte der Presseverleger über die in § 87a UrhG verankerte Datenbanknorm weitgehend geschützt (allerdings, so hatte es der Gesetzgeber gewollt, nicht vor der Nutzung kleinerer Teile aus der betreffenden Datenbank).
Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, über das Urheberrecht einem Teilbereich der Informationswirtschaft neue Geschäftsbereiche und neue Einnahmen zu ermöglichen bzw. zu garantieren.
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein Leistungsschutzrecht jetzt nur den Presseverlagen zugebilligt werden soll – warum z.B. nicht den professionellen Bloggern oder anderen Betreibern von sozialen Diensten, die zweifellos heute ebenfalls für Medienöffentlichkeit sorgen?
Die Informations-/Kommunikationsfreiheit im Internet würde durch Verknappung bislang frei zugänglicher Pressematerialien unbillig eingeschränkt. Das Zitatrecht könnte ausgehöhlt werden.
Die zur Orientierung in den Internetdiensten unverzichtbaren Metainformationssysteme (Suchmaschinen) würden in ihrer Leistungsbreite erheblich behindert.
Innovative (Meta-)Dienste der Informationswirtschaft würden verhindert, ohne dass die Presseverleger selber Ersatz dafür schafften.
Die Entwicklung der Dienste in sozialen Netzwerken würde behindert.
Es liegen keine allgemein akzeptierten Modelle vor, wie die Abrechnung der Nutzung dann abgabepflichtiger Teile von Pressematerialien organisiert werden soll.
Die Wahrnehmung von Zweitverwertungsrechten von (freien) Journalisten könnte behindert werden, z.B. durch pauschales Aussetzung der Regelungen von § 38 UrhG.
Die durch § 53 garantierte Privatkopierregelung könnte durch Leistungsschutzregelungen außer Kraft gesetzt werden.
Die Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts für Presseverleger würde Tür und Tor öffnen für weitere Ansprüche an einen solchen Schutz (wie es z.B. die Schulbuchverlage schon einfordern, wohingegen die Buchverlage bislang eher skeptisch gegenüber einem Leistungsschutzrecht für ihre Produkte sind[7]).
Bildung und Wissenschaft würden in der Nutzung (für Ausbildung und Forschung) von Pressematerialien behindert, zumal die Gefahr besteht, dass Leistungsschutzregelungen Urheberrechtsschranken (wie z.B. § 52a UrhG) teilweise oder ganz außer Kraft setzen.
Natürlich sehen das die Presseverleger ganz anders (vgl. die Positionen des BDZV, s. Anm. 9) und im Gefolge auch die Schulbuchverlage, die unvorhergesehener Weise, wenn auch nicht überraschend, ebenfalls ein eigenes Leistungsschutz forderten[8]. Nun könnte man ja sagen, diese Probleme gingen nur die betroffenen Verlage und Verleger an, also solle die Politik deren Forderungen entsprechen[9]. Die Zielvorstellung im Koalitionsvertrag folgte dem.
Aber Regelungen im Urheberrecht und für verwandte Schutzrechte allgemein (also auch für Leistungsschutzrechte) dürfen, darauf wies sehr deutlich Till Kreutzer hin[10], keineswegs nur Partikularinteressen dienen: „Vielmehr sind sie mit gesamtgesellschaftlichen Belangen wie Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit oder der möglichst ungehinderten Nutzung von Informationen abzuwägen.“ Keinesfalls ist das Urheberrecht dazu da, darauf wies Till Barleben, für den Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. tätig, hin, Verlegern über ein Leistungsschutzrecht „ohne eigene Anstrengung eine neue Einnahmequelle [zu] schaffen“ [11]. Auch Bitkom[12] weist darauf hin, dass „grundlegende Änderungen des Urheberrechts … nur bei Vorliegen einer Rechtsschutzlücke oder aufgrund belegbaren Marktversagens gerechtfertigt“ seien. „Beides liegt in Bezug auf die Situation der Verlagsbranche nicht vor.“ Vielleicht sollte sich der FDP-Wirtschaftsminister gegenüber der FDP-Justizministerin durchsetzen.
Aber das wird nicht einfach sein. Die verführerischen Argumente zugunsten des Leistungsschutzrechts laufen nach demselben Schema wie die Argumente der Verlage insgesamt für den Schutz des von ihnen reklamierten geistigen Eigentums (also auch der wissenschaftlichen Buch- und Zeitschriftenverlage): Hohe Ziele und grundgesetzlich geschützte Werte, Rechte und Freiheiten, Pressefreiheit und Meinungsvielfalt, geistiges Eigentum, die Unabhängigkeit der Autoren/Journalisten, der Qualitätsjournalismus und die Medienvielfalt seien bedroht und damit die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Wer wollte Widerspruch anmelden, wenn es diese Bedrohung tatsächlich gäbe und wenn die wirtschaftliche Grundlage der Verlage durch die Entwicklungen im Internet tatsächlich nicht mehr gegeben wäre! Aber ist diese nicht eigentlich dadurch bedroht, dass die Potenziale des Internet nicht oder nur zögerlich ausgeschöpft werden?
Der Argumentation des Bedrohungsszenarios haben sich auch Gewerkschaften wie ver.di angeschlossen[13]. Gäbe es keine Presseverlage mehr, so gäbe es auch keine Journalisten mehr, die von der Gewerkschaft vertreten werden könnten. Aber kann die ökonomische Lage der z.B. von ver.di vertretenen Journalisten wirklich dadurch verbessert werden, dass die Verleger nun rechtlich garantierte Wege für Zusatzeinnahmen suchen (über Teilhabe an Werbeeinnahmen oder durch Nutzungsgebühren für ansonsten frei ins Netz gestellte Materialien)? Wäre nicht eine ebenfalls gesetzlich geregelte Verfügungssicherheit der (freien) Journalisten über ihre Werke, anstelle der häufig verlangten Buy-out-Verträge, der bessere Weg? Ist es mit den Zielen von Gewerkschaften vereinbar, den freien Zugang zu Wissen und Information durch Wahrung von Partikularinteressen einschränken zu lassen?
Die wesentlichen Argumente gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger sind oben zusammengestellt. So mag es vielleicht überraschen, dass Juristen wie Thomas Hoeren[14] oder auch Reto Hilty, die in ihren Beiträgen sicherlich nicht als Lobbyisten der Informationswirtschaft tätig werden, durchaus auch Argumente für ein spezielles Leistungsschutzrecht finden.
Allerdings sind das die Reichweite eines umfassenden Leistungsschutzrechts einschränkende Argumente, die den bislang verfolgten Interessen und Zielen der Verlagsvertreter insgesamt nicht gerade entgegenkommen. Dazu gehört Hoerens Vorschlag, den Schutz der Verlagswerke nicht länger auf ihr vermeintliches geistiges Eigentum zu gründen, das ihnen durch die Übertragung der Verwertungsrechte der Urheber selber entstanden sei. Ein Leistungsschutzrecht könnte die Veröffentlichungsleistung der Verlage weitgehend von dem ideologischen Ballast des Urheberrechts befreien, z.B. dadurch dass dieser Schutz nach 5 oder 10 Jahren gänzlich wieder an die Autoren zurückgegeben werde. Und nur die „originär verlegerische Leistung als solche“ sollte anerkannt werden. Verlage „könnten dann stolz sein auf ihr Lektorat, ihre Pressearbeit, ihre Programmgestaltung und ihre Autorenbetreuung." (vgl. Hoeren Anm. 7).
Ohnehin sollten m.E. Anbieter der Informationswirtschaft exklusive Rechte an Leistungen mit Schutzanspruch nur dann reklamieren dürfen, wenn sie über die von den Urhebern erstellten Ausgangsprodukte hinaus informationelle Mehrwerte oder neue Mehrwertprodukte (wie Metainformationsformen) produzieren. Den Urhebern selber sollten die Rechte an der weiteren Verwertung ihrer Ausgangswerke in jedem Fall erhalten bleiben.
Leistungsschutzregelungen dürften auf keinen Fall vom Gesetzgeber beschlossen werden, wenn diese nur den Rechteinhabern neue Einkommensmöglichkeiten erschließen würden. Das Urheberrecht dient nicht dem direkten Eingriff des Gesetzgebers in das Marktgeschehen durch Begünstigung von Partikularinteressen. Schon gar nicht dürfen Urheberrechts- oder Leistungsschutzregelungen innovative Entwicklungen bei den Leistungen und Geschäftsmodellen dadurch behindern, dass Schutzansprüche geltend gemacht werden, die in früheren technologischen und medialen Umgebungen vielleicht sinnvoll waren, aber im elektronischen Umfeld eher Schaden anrichten. Die Musik(und Film)-Industrie hat lange gebraucht, um diese Lektion zu lernen, nachdem sie zu lange an klassischen Produkten festgehalten und den Geschäftserfolg an der Anzahl der verkauften Alben (über CD oder DVD) gebunden hat.
Der Gesetzgeber wäre gut beraten, die Presseverlage vor deren eigenen Ansprüchen zu schützen und die Entwicklung von Diensten, die auf Presseinformationen aufsetzen, nicht zu behindern. So paradox es sich nach wie vor in den Ohren der klassischen Verleger anhören mag – es ist dennoch richtig und wird jeden Tag im Internet bestätigt: je freier der Umgang mit Informations- und Wissensprodukten im elektronischen Umfeld gemacht wird, desto größer ist die Chance, dass auch wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmodelle für Wissen und Information entwickelt werden. Verknappung ist kein Mittel für wirtschaftlichen Erfolg im Internet. Kreative Phantasie und Innovationsfähigkeit sind in offenen Informationswelten gefragt.
Man würde es vorderhand vielleicht nicht erwarten, aber die passendste Zusammenfassung der Argumente gegen ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger findet sich in einem Kommentar auf der Website der Deutschen Bank/DB Research unter dem Titel „Leistungsschutzrecht – mehr Schutz als Leistung“: „In einem marktwirtschaftlichen System werden Geschäftsmodelle an den Wandel angepasst und nicht umgekehrt. Das eingeforderte Leistungsschutzrecht würde zwar temporäre Mehreinnahmen der Verlage garantieren. Das Schutzrecht hat aber weitreichende negative Folgen sowohl für die Wirtschaft, als auch für Gesellschaft und Kultur. Es schränkt die Informations- und Kommunikationskanäle ein, behindert den wachstums- und innovationsstimulierenden Wissenstransfer und manövriert die Urheber in eine ungünstige Position.“[15]
Fazit:
Neue Leistungsschutzrechte für Presseverlage im Urheberrecht zu verankern ist überflüssig und sogar kontraproduktiv. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotenen Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Vielleicht wäre ein solches Leistungsschutzrecht dann sogar ein Substanzgewinn für den Dritten Korb.
[1] http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (104/132)
[2] Zitiert nach: Georg Nolte: Zur Forderung der Presseverleger nach Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts. Eine kritische Auseinandersetzung - http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Mohr_ZGE_02_2_165-195.pdf
[3] Ausführliche, juristisch solide Informationen zum Hintergrund eines Leistungsschutzrechtes bei Timo Ehmann und Emese Szilagyi: Erforderlichkeit eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger. In: Kommunikation & Recht, Beilage 2/2009 - http://www.kommunikationundrecht.de/archiv/pages/show.php?timer=1260795904&deph=0&id=68501&currPage=1
[4] Details, wie die Erhebung einer dann kostenpflichtigen Nutzung organisiert werden kann, sind bislang aus der Verlegersicht kaum bekannt geworden. Vielleicht wird an eine pauschale Abgabe gedacht, die allen in der Wirtschaft zum Einsatz kommenden Geräten auferlegt und über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet würden, die für die Nutzung von Pressematerialien geeignet sind.
[5] Arnd Haller: Zehn Gründe gegen ein Presse-Leistungsschutzrecht. Gastbeitrag in Telemedicus vom 4.8.2010 - http://www.telemedicus.info/article/1824-Zehn-Gruende-gegen-ein-Presse-Leistungsschutzrecht.html; Timo Ehmann in Jus Meum - http://www.jusmeum.de/blog/internet-und-recht-2/die-anhoerung-des-bmj-zum-37; ebenso Ehmann in einem offenen Brief an die Bundesjustizministerin - http://carta.info/29093/offener-brief-an-die-bundesjustizministerin-6-fragen-zum-leistungsschutzrecht/; vgl. auch die weitgehend ablehnenden Beiträge, die bei IGEL (Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht - http://leistungsschutzrecht.info/) zusammengestellt sind; vgl. auch GRUR in einem Brief an das Bundesjustizministerium vom 5.7.2010 (http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2010/2010-07-05_GRUR_Stn_Anhrung_BMJ_Leistungsschutzrecht_Verleger.pdf); Bitkom (vgl. Anm. 10); vgl. die umfassende Kritik von Nolte (vgl. Anm. 2); Kreutzer (Anm. 8); Matthias Spielkamp: Leistungsschutzrechte schaden - auch den Verlagen. In: perlentaucher.de 30.3.2011- http://www.perlentaucher.de/artikel/6832.html.
[6] Ohne die Leistungen der Verlage auch im Medienbereich klein reden zu wollen – aber was haben die redaktionelle Aufbereitung, das Marketing, die Versand- und Abrechnungsformen, …. mit geistigem Eigentum zu tun?
[7] So hat sich die Vertretung der Buchverlage insgesamt nicht der Forderung der Pressenverleger nach einem Leistungsschutzrecht angeschlossen; nach Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins, habe sich dieser „immer gegen ein Leistungsschutzrecht der Verlage ausgesprochen, weil es die Situation der Verlage verschlechtere. Das Leistungsschutzrecht sei ohnehin schwächer als das Urheberrecht.“ Vgl. die Argumente von Thomas Hoeren in WeltOnline vom 17.7.2009 (Zeitungsverleger fordern ein eigenes Leistungsschutzrecht, um wirksamer gegen Piraterie vorgehen zu können. Wäre das auch etwas für Buchverlage?) - http://www.welt.de/die-welt/article4135872/Wer-den-Weg-zum-Leser-ebnet.html, http://www.boersenblatt.net/330550/.
[8] Vgl. Ehmann in Jus Meum, vgl. Anm.5.
[9] Z.B. vertreten von Christoph Keese, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG: Mit Kreativität Publikum im Internet gewinnen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf; umfängliche Informationen zum Leistungsschutzrecht für Verlage auf der Website des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) - http://www.bdzv.de/leistungsschutzrecht_aktuelles.html
[10] Till Kreutzer: Leistungsschutzrecht für Verlage: Mehr Schaden als Nutzen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf
[11] http://irights.de/?q=node/2049
[12] Bitkom: Stellungnahme zu Überlegungen der Einführung urheberrechtlichen Leistungsschutzrechts für Presseverleger (25.6.2010) - http://www.bitkom.org/files/documents/100624_Stellungnahme_BITKOM_Verleger_LSR_final.pdf. Bemerkenswert das Argument zugunsten der Leistung der Suchmaschinen: „Insbesondere bilden Links auf frei verfügbar gemachte Presseartikel durch Suchmaschinen oder Social-Networks kein Ausnutzen fremder Leistungen, sondern eine eigenständige Infrastrukturleistung der Aggregatoren, die auch der Anknüpfungspunkt für entsprechende Einnahmen, etwa durch Werbung, ist.“
[13] Position der Gewerkschaften DJV und ver.di zu einem Leistungsschutzrecht der periodischen Presse - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/05/Leistungsschutzrecht-Gewerkschaftssynopse.pdf; Kritik daran in Charta von Till Kreutzer, Matthias Spielkamp und Philipp Otto - http://carta.info/27043/entwurf-fuer-das-leistungsschutzrecht-fuer-presseverleger-nie-da-gewesene-rechtsverwirrung/; die Ver-di-Politik erläuternd vgl. das Interview mit dem Justiziar von Ver.di, Wolfgang Schimmel - http://carta.info/31813/ver-di-zum-leistungsschutzrecht-freie-journalisten-sind-nur-bedingt-freigestellt/; zur (umstrittenen) Internetpolitik von Ver.di allgemein vgl. Bundesvorstand: Positionspapier. Internet und Digitalisierung – Herausforderungen für die Zukunft des Urheberrechts - http://www.netzpolitik.org/wp-upload/verdi_Urheberrecht_Position.pdf.
[14] Vgl. Anm. 6
[15] http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwdspl=0&rwsite=DBR_INTERNET_DE-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000262717
Überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig – das Leistungsschutzrecht für Presseverleger
(Anmerkung: Dieser Beitrag steht unter der Lizenz Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).)
Von Rainer Kuhlen
Zusammenfassung: Ein Leistungsschutz für Presseverlage trägt kaum dazu bei, dem Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung mehr Substanz zu verleihen. Ganz im Gegenteil: ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage griffe entsprechend den bislang bekannt gewordenen Erwartungen der Verleger unbillig stark in den freien Informationsfluss und in bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts ein. Es ist zudem ökonomisch unsinnig, indem es den zukünftigen, in elektronischen Umgebungen zu erzielenden Geschäftserfolg der Presseunternehmen eher behindert als begünstigt. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotener Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Eine substantielle Urheberrechtsreform zu Zeiten des Internet sollte nicht immer weitere Schutzräume und Verknappungsformen schaffen, sondern mehr Freiräume, nicht zuletzt auch für die Urheber der Werke selber, nicht alleine für die Verwerter.
Vorbemerkung Die Realisierung eines Leistungsschutzrechts war nach allen bisherigen Informationen aus dem Bundesjustizministerium im Rahmen des Dritten Korbs der Urheberrechtsanpassung vorgesehen. Offenbar tut man sich im Ministerium aber weiterhin schwer, einen Entwurf für den Dritten Korb vorzulegen. Als Grund dafür kann nur mangelnde Substanz bei den bisherigen Vorschlägen vermutet werden. Mangelnde Substanz wird dann sicherlich massiv beklagt werden, wenn, anders als es die ursprüngliche Anlage des Dritten Korbs nahegelegt hatte, den Belangen von Bildung und Wissenschaft nach weitgehend freiem Informationsfluss erneut nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Mangelnde Substanz kann aber auch bedeuten, dass nicht zeitgemäße und lediglich Lobby-/Partikularinteressen dienende Regelungen neu aufgenommen wurden. Über den folgenden Beitrag soll die Politik dringend davor gewarnt werden, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, auch wenn dieses Ziel Eingang in den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung zwischen CDU/CSU und FDP gefunden hat, nun umzusetzen, obgleich es nach Einschätzung so gut wie aller Betroffenen (mit Ausnahme der dadurch Begünstigten natürlich) überflüssig, schädlich und ökonomisch unsinnig ist (vgl. die Literatur vor allem in Anm. 5).
Die Formulierung im Koalitionsvertrag lautet:
„Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sein als andere Werkvermittler. Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an.“[1]
Aber es steht auch in diesem Vertrag: „… wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistungen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent ermäßigen.“ (ibid. 14/132). All das sind ja keine Naturgesetze. Wie schnell sind solche Zielvorstellungen der Schnee von gestern. Das drastischste Beispiel dafür ist sicher: „In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung [für deutsche Kernkraftwerke –RK] nähere Regelungen getroffen“ (ibid. 29/132).
Dass Fehler korrigiert werden müssen, kommt vor, und mit der entsprechenden Häme muss man leben. Aber muss immer erst der Weg über die Fehler gehen, um dann aufwändig diese wieder zu beseitigen? Könnte man nicht vorher auf die dagegen sprechenden Argumente hören? Ob heute das Hotelprivileg wieder verabschiedet werden würde, ist höchst zweifelhaft. Klientelpolitik zahlt sich nicht aus, und für eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Urheberrecht kann diese ohnehin nicht herhalten. Das Urheberrecht begründet sich in erster Linie dadurch, dass die getroffenen Regelungen der Beförderung der Produktion und Nutzung von Wissen und Information allen und in allen Bereichen der Gesellschaft dienen, und nicht dem Schutz der ökonomischen Interessen von speziellen Gruppen.
Sollte also der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums für den Dritten Korb der Urheberrechtsanpassung vorsehen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Leistungsschutzrecht für Presseverlage tatsächlich rechtlich zu verankern, dann würde das kein Beitrag zur Substanz des Dritten Korbs werden, sondern nur ein weiteres Beispiel für eine höchst überflüssige Klientelpolitik und eine Fehlinterpretation des staatlichen Regulierungsauftrags für den Umgang mit Wissen und Information. Aber vor allem wäre das schlichtweg ökonomischer Unsinn, weil es die Presseverlage davon freistellte, kreativ und innovativ Mehrwertleistungen und neue Modelle für die Vermarktung von Medieninformationen zu entwickeln.
Natürlich macht ein Ministerium mit einem Gesetzentwurf noch keine verbindliche Politik. Vielleicht werden die Gremien der Legislative so etwas nicht durchgehen lassen. Schließlich baute der Vorsitzende des Rechtsauschusses des Bundestages, Siegfried Kauder, schon einmal eine Bremse gegen ein neues Presse-Leistungsschutzrecht ein: „Ich versichere Ihnen, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der gewinnt, der den besseren Lobbyismus betreibt.“[2] Es sollten in der Tat die besseren Argumente entscheiden.
Zunächst: was ist ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage und was soll es bewirken?[3] So ganz klar ist es nicht, was die Verlege eigentlich geregelt haben wollen. Druck wird gemacht mit Hinweisen auf die bedrohte Pressefreiheit oder zumindest die Bedrohung des Qualitätsjournalismus. Der Zusammenhang mit einem Leistungsschutzrecht ist dabei nicht klar ersichtlich. Allein man kann politische Zustimmung dadurch erwirken. In erster Linie geht es natürlich darum, mehr Einnahmen zu generieren, ohne zwangsläufig weitere Leistungen als bislang schon zu erbringen.
So könnten Links auf ansonsten frei zugängliche Presseartikel dann kostenpflichtig werden, wenn sie (die Links) in einem gewerblichen Umfeld auf elektronischem Weg bekannt gemacht werden[4]. Aber der Hauptgrund dürfte wohl der Ärger der Verleger sein, dass Internetakteure wie Google Werbeeinnahmen nicht zuletzt dadurch erzielen, dass bei den Ergebnissen von Suchmaschinenanfragen kurze Textauszüge (Snippets) von Presseerzeugnissen angezeigt werden, die dann als Links auf die Volltexte verweisen. Die Anzeige dieser Snippets über das bisherige Urheberrecht entgeltpflichtig zu machen, ist ziemlich aussichtslos – darüber ist sich die Fachwelt weitgehend einig. Also soll die Erweiterung über das Leistungsschutzrecht her.
Im Prinzip könnten damit Ansprüche gegen einen jeglichen Informationsdienst erhoben werden, der wie z.B. Abstractdienste, Pressespiegel, aber auch Kopienversanddienste oder Rechercheleistungen von Informationsvermittlern, Mehrwertleistungen erbringt (vgl. Nolte in Anm. 2). Die Nutzung selbst kleinster Teile aus Artikeln der Presse könnte im Prinzip abgabepflichtig werden, da das für das Urheberrecht verbindliche (wenn auch schwierig zu definierende) Kriterium der ausreichenden Schöpfungshöhe bei einem Leistungsschutzrecht überhaupt nicht zur Anwendung kommen würde. Die Inpflichtnahme für private individuelle Nutzung sei bislang nicht vorgesehen, so versichern das Ministerium und die Verleger. Nur die Nutzung für kommerzielle Zwecke sei anvisiert. Aber das hatte die Musik- und Filmindustrie auch zunächst erklärt, und dann kamen die vielen Abmahnungen an die privaten Adressen.
Natürlich könnten sich die Verlage vor allem gegen die Suchmaschinenanzeige wehren. Schließlich könnte den Robotern der Suchmaschinen sehr einfach und mit Erfolg untersagt werden, auf die Artikel aus den Presseerzeugnissen zum Zwecke der Indexierung und der Ableitung der Snippets zuzugreifen. Das will man aber nicht, weil die Suchmaschinenanzeige natürlich auch für die Verleger einen Marketingwert hat. Man will also beides: den Marketingeffekt und an den Werbeeinnahmen der Googles bzw. den (gewerblichen) Informationszuwächsen der Nutzer der Googles teilhaben. Im Übrigen ist keine Rede davon, dass sich ein neues Leistungsschutzrecht daran messen solle, inwieweit die Presseerzeugnisse neue Leistungen, neue informationelle Mehrwerte, erbringen bzw. inwieweit die Verlage neue, den elektronischen Umgebungen angemessene Organisationsmodelle entwickeln.
Nach wie vor wird in der Politik der politische Wille der Repräsentanten der Politik, sprich der Parteien, durchgesetzt, zumal wenn diese die Regierung tragen. Die von der Politik Betroffenen werden zwar heute i.d.R. nicht zuletzt über den Weg der Anhörung bei anstehenden Gesetzesvorhaben gehört, aber das bleibt oft genug folgenlos – so wie vermutlich die Aussagen bei der Anhörung zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger, die das Bundesjustizministerium zur Vorbereitung des Dritten Korbs im August 2010 durchgeführt hatte. Jeder, der dabei war, und die verschiedenen Berichte zur Anhörung und Dokumente dazu belegen das, wird bestätigen, dass die überwiegende Mehrheit der Gehörten sich entschieden gegen ein neues Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat. Die Argumente liegen auf der Hand[5]:
Die Ansprüche (von geistigem Eigentum sollte man nicht sprechen[6]) der Verleger (oft genug erst als Nutzungsrechte erworben durch Übertragung der Verwertungsrechte von den journalistischen Urhebern) sind schon jetzt durch das Urheberrecht bzw. das Urhebervertragsrecht gesichert. Insbesondere sind die Online-Produkte der Presseverleger über die in § 87a UrhG verankerte Datenbanknorm weitgehend geschützt (allerdings, so hatte es der Gesetzgeber gewollt, nicht vor der Nutzung kleinerer Teile aus der betreffenden Datenbank).
Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, über das Urheberrecht einem Teilbereich der Informationswirtschaft neue Geschäftsbereiche und neue Einnahmen zu ermöglichen bzw. zu garantieren.
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein Leistungsschutzrecht jetzt nur den Presseverlagen zugebilligt werden soll – warum z.B. nicht den professionellen Bloggern oder anderen Betreibern von sozialen Diensten, die zweifellos heute ebenfalls für Medienöffentlichkeit sorgen?
Die Informations-/Kommunikationsfreiheit im Internet würde durch Verknappung bislang frei zugänglicher Pressematerialien unbillig eingeschränkt. Das Zitatrecht könnte ausgehöhlt werden.
Die zur Orientierung in den Internetdiensten unverzichtbaren Metainformationssysteme (Suchmaschinen) würden in ihrer Leistungsbreite erheblich behindert.
Innovative (Meta-)Dienste der Informationswirtschaft würden verhindert, ohne dass die Presseverleger selber Ersatz dafür schafften.
Die Entwicklung der Dienste in sozialen Netzwerken würde behindert.
Es liegen keine allgemein akzeptierten Modelle vor, wie die Abrechnung der Nutzung dann abgabepflichtiger Teile von Pressematerialien organisiert werden soll.
Die Wahrnehmung von Zweitverwertungsrechten von (freien) Journalisten könnte behindert werden, z.B. durch pauschales Aussetzung der Regelungen von § 38 UrhG.
Die durch § 53 garantierte Privatkopierregelung könnte durch Leistungsschutzregelungen außer Kraft gesetzt werden.
Die Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts für Presseverleger würde Tür und Tor öffnen für weitere Ansprüche an einen solchen Schutz (wie es z.B. die Schulbuchverlage schon einfordern, wohingegen die Buchverlage bislang eher skeptisch gegenüber einem Leistungsschutzrecht für ihre Produkte sind[7]).
Bildung und Wissenschaft würden in der Nutzung (für Ausbildung und Forschung) von Pressematerialien behindert, zumal die Gefahr besteht, dass Leistungsschutzregelungen Urheberrechtsschranken (wie z.B. § 52a UrhG) teilweise oder ganz außer Kraft setzen.
Natürlich sehen das die Presseverleger ganz anders (vgl. die Positionen des BDZV, s. Anm. 9) und im Gefolge auch die Schulbuchverlage, die unvorhergesehener Weise, wenn auch nicht überraschend, ebenfalls ein eigenes Leistungsschutz forderten[8]. Nun könnte man ja sagen, diese Probleme gingen nur die betroffenen Verlage und Verleger an, also solle die Politik deren Forderungen entsprechen[9]. Die Zielvorstellung im Koalitionsvertrag folgte dem.
Aber Regelungen im Urheberrecht und für verwandte Schutzrechte allgemein (also auch für Leistungsschutzrechte) dürfen, darauf wies sehr deutlich Till Kreutzer hin[10], keineswegs nur Partikularinteressen dienen: „Vielmehr sind sie mit gesamtgesellschaftlichen Belangen wie Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit oder der möglichst ungehinderten Nutzung von Informationen abzuwägen.“ Keinesfalls ist das Urheberrecht dazu da, darauf wies Till Barleben, für den Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. tätig, hin, Verlegern über ein Leistungsschutzrecht „ohne eigene Anstrengung eine neue Einnahmequelle [zu] schaffen“ [11]. Auch Bitkom[12] weist darauf hin, dass „grundlegende Änderungen des Urheberrechts … nur bei Vorliegen einer Rechtsschutzlücke oder aufgrund belegbaren Marktversagens gerechtfertigt“ seien. „Beides liegt in Bezug auf die Situation der Verlagsbranche nicht vor.“ Vielleicht sollte sich der FDP-Wirtschaftsminister gegenüber der FDP-Justizministerin durchsetzen.
Aber das wird nicht einfach sein. Die verführerischen Argumente zugunsten des Leistungsschutzrechts laufen nach demselben Schema wie die Argumente der Verlage insgesamt für den Schutz des von ihnen reklamierten geistigen Eigentums (also auch der wissenschaftlichen Buch- und Zeitschriftenverlage): Hohe Ziele und grundgesetzlich geschützte Werte, Rechte und Freiheiten, Pressefreiheit und Meinungsvielfalt, geistiges Eigentum, die Unabhängigkeit der Autoren/Journalisten, der Qualitätsjournalismus und die Medienvielfalt seien bedroht und damit die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Wer wollte Widerspruch anmelden, wenn es diese Bedrohung tatsächlich gäbe und wenn die wirtschaftliche Grundlage der Verlage durch die Entwicklungen im Internet tatsächlich nicht mehr gegeben wäre! Aber ist diese nicht eigentlich dadurch bedroht, dass die Potenziale des Internet nicht oder nur zögerlich ausgeschöpft werden?
Der Argumentation des Bedrohungsszenarios haben sich auch Gewerkschaften wie ver.di angeschlossen[13]. Gäbe es keine Presseverlage mehr, so gäbe es auch keine Journalisten mehr, die von der Gewerkschaft vertreten werden könnten. Aber kann die ökonomische Lage der z.B. von ver.di vertretenen Journalisten wirklich dadurch verbessert werden, dass die Verleger nun rechtlich garantierte Wege für Zusatzeinnahmen suchen (über Teilhabe an Werbeeinnahmen oder durch Nutzungsgebühren für ansonsten frei ins Netz gestellte Materialien)? Wäre nicht eine ebenfalls gesetzlich geregelte Verfügungssicherheit der (freien) Journalisten über ihre Werke, anstelle der häufig verlangten Buy-out-Verträge, der bessere Weg? Ist es mit den Zielen von Gewerkschaften vereinbar, den freien Zugang zu Wissen und Information durch Wahrung von Partikularinteressen einschränken zu lassen?
Die wesentlichen Argumente gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger sind oben zusammengestellt. So mag es vielleicht überraschen, dass Juristen wie Thomas Hoeren[14] oder auch Reto Hilty, die in ihren Beiträgen sicherlich nicht als Lobbyisten der Informationswirtschaft tätig werden, durchaus auch Argumente für ein spezielles Leistungsschutzrecht finden.
Allerdings sind das die Reichweite eines umfassenden Leistungsschutzrechts einschränkende Argumente, die den bislang verfolgten Interessen und Zielen der Verlagsvertreter insgesamt nicht gerade entgegenkommen. Dazu gehört Hoerens Vorschlag, den Schutz der Verlagswerke nicht länger auf ihr vermeintliches geistiges Eigentum zu gründen, das ihnen durch die Übertragung der Verwertungsrechte der Urheber selber entstanden sei. Ein Leistungsschutzrecht könnte die Veröffentlichungsleistung der Verlage weitgehend von dem ideologischen Ballast des Urheberrechts befreien, z.B. dadurch dass dieser Schutz nach 5 oder 10 Jahren gänzlich wieder an die Autoren zurückgegeben werde. Und nur die „originär verlegerische Leistung als solche“ sollte anerkannt werden. Verlage „könnten dann stolz sein auf ihr Lektorat, ihre Pressearbeit, ihre Programmgestaltung und ihre Autorenbetreuung." (vgl. Hoeren Anm. 7).
Ohnehin sollten m.E. Anbieter der Informationswirtschaft exklusive Rechte an Leistungen mit Schutzanspruch nur dann reklamieren dürfen, wenn sie über die von den Urhebern erstellten Ausgangsprodukte hinaus informationelle Mehrwerte oder neue Mehrwertprodukte (wie Metainformationsformen) produzieren. Den Urhebern selber sollten die Rechte an der weiteren Verwertung ihrer Ausgangswerke in jedem Fall erhalten bleiben.
Leistungsschutzregelungen dürften auf keinen Fall vom Gesetzgeber beschlossen werden, wenn diese nur den Rechteinhabern neue Einkommensmöglichkeiten erschließen würden. Das Urheberrecht dient nicht dem direkten Eingriff des Gesetzgebers in das Marktgeschehen durch Begünstigung von Partikularinteressen. Schon gar nicht dürfen Urheberrechts- oder Leistungsschutzregelungen innovative Entwicklungen bei den Leistungen und Geschäftsmodellen dadurch behindern, dass Schutzansprüche geltend gemacht werden, die in früheren technologischen und medialen Umgebungen vielleicht sinnvoll waren, aber im elektronischen Umfeld eher Schaden anrichten. Die Musik(und Film)-Industrie hat lange gebraucht, um diese Lektion zu lernen, nachdem sie zu lange an klassischen Produkten festgehalten und den Geschäftserfolg an der Anzahl der verkauften Alben (über CD oder DVD) gebunden hat.
Der Gesetzgeber wäre gut beraten, die Presseverlage vor deren eigenen Ansprüchen zu schützen und die Entwicklung von Diensten, die auf Presseinformationen aufsetzen, nicht zu behindern. So paradox es sich nach wie vor in den Ohren der klassischen Verleger anhören mag – es ist dennoch richtig und wird jeden Tag im Internet bestätigt: je freier der Umgang mit Informations- und Wissensprodukten im elektronischen Umfeld gemacht wird, desto größer ist die Chance, dass auch wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmodelle für Wissen und Information entwickelt werden. Verknappung ist kein Mittel für wirtschaftlichen Erfolg im Internet. Kreative Phantasie und Innovationsfähigkeit sind in offenen Informationswelten gefragt.
Man würde es vorderhand vielleicht nicht erwarten, aber die passendste Zusammenfassung der Argumente gegen ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger findet sich in einem Kommentar auf der Website der Deutschen Bank/DB Research unter dem Titel „Leistungsschutzrecht – mehr Schutz als Leistung“: „In einem marktwirtschaftlichen System werden Geschäftsmodelle an den Wandel angepasst und nicht umgekehrt. Das eingeforderte Leistungsschutzrecht würde zwar temporäre Mehreinnahmen der Verlage garantieren. Das Schutzrecht hat aber weitreichende negative Folgen sowohl für die Wirtschaft, als auch für Gesellschaft und Kultur. Es schränkt die Informations- und Kommunikationskanäle ein, behindert den wachstums- und innovationsstimulierenden Wissenstransfer und manövriert die Urheber in eine ungünstige Position.“[15]
Fazit:
Neue Leistungsschutzrechte für Presseverlage im Urheberrecht zu verankern ist überflüssig und sogar kontraproduktiv. Leistungsschutzregelungen für Presseverlage könnten allenfalls dann sinnvoll sein, wenn a) sie lediglich auf von den Anbietern neu angebotenen Leistungen (informationelle Mehrwertprodukte und Metainformationsdienste) angewendet; b) durch das Leistungsschutzrecht bestehende Schrankenregelungen des Urheberrechts nicht ausgehebelt; c) die Rechte der produzierenden Urheber (hier in erster Linie der freien Journalisten) nicht beeinträchtigt und d) der freie Informationsfluss und die Orientierung der NutzerInnen im Internet nicht behindert würden. Vielleicht wäre ein solches Leistungsschutzrecht dann sogar ein Substanzgewinn für den Dritten Korb.
[1] http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (104/132)
[2] Zitiert nach: Georg Nolte: Zur Forderung der Presseverleger nach Einführung eines speziellen Leistungsschutzrechts. Eine kritische Auseinandersetzung - http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Mohr_ZGE_02_2_165-195.pdf
[3] Ausführliche, juristisch solide Informationen zum Hintergrund eines Leistungsschutzrechtes bei Timo Ehmann und Emese Szilagyi: Erforderlichkeit eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger. In: Kommunikation & Recht, Beilage 2/2009 - http://www.kommunikationundrecht.de/archiv/pages/show.php?timer=1260795904&deph=0&id=68501&currPage=1
[4] Details, wie die Erhebung einer dann kostenpflichtigen Nutzung organisiert werden kann, sind bislang aus der Verlegersicht kaum bekannt geworden. Vielleicht wird an eine pauschale Abgabe gedacht, die allen in der Wirtschaft zum Einsatz kommenden Geräten auferlegt und über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet würden, die für die Nutzung von Pressematerialien geeignet sind.
[5] Arnd Haller: Zehn Gründe gegen ein Presse-Leistungsschutzrecht. Gastbeitrag in Telemedicus vom 4.8.2010 - http://www.telemedicus.info/article/1824-Zehn-Gruende-gegen-ein-Presse-Leistungsschutzrecht.html; Timo Ehmann in Jus Meum - http://www.jusmeum.de/blog/internet-und-recht-2/die-anhoerung-des-bmj-zum-37; ebenso Ehmann in einem offenen Brief an die Bundesjustizministerin - http://carta.info/29093/offener-brief-an-die-bundesjustizministerin-6-fragen-zum-leistungsschutzrecht/; vgl. auch die weitgehend ablehnenden Beiträge, die bei IGEL (Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht - http://leistungsschutzrecht.info/) zusammengestellt sind; vgl. auch GRUR in einem Brief an das Bundesjustizministerium vom 5.7.2010 (http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2010/2010-07-05_GRUR_Stn_Anhrung_BMJ_Leistungsschutzrecht_Verleger.pdf); Bitkom (vgl. Anm. 10); vgl. die umfassende Kritik von Nolte (vgl. Anm. 2); Kreutzer (Anm. 8); Matthias Spielkamp: Leistungsschutzrechte schaden - auch den Verlagen. In: perlentaucher.de 30.3.2011- http://www.perlentaucher.de/artikel/6832.html.
[6] Ohne die Leistungen der Verlage auch im Medienbereich klein reden zu wollen – aber was haben die redaktionelle Aufbereitung, das Marketing, die Versand- und Abrechnungsformen, …. mit geistigem Eigentum zu tun?
[7] So hat sich die Vertretung der Buchverlage insgesamt nicht der Forderung der Pressenverleger nach einem Leistungsschutzrecht angeschlossen; nach Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins, habe sich dieser „immer gegen ein Leistungsschutzrecht der Verlage ausgesprochen, weil es die Situation der Verlage verschlechtere. Das Leistungsschutzrecht sei ohnehin schwächer als das Urheberrecht.“ Vgl. die Argumente von Thomas Hoeren in WeltOnline vom 17.7.2009 (Zeitungsverleger fordern ein eigenes Leistungsschutzrecht, um wirksamer gegen Piraterie vorgehen zu können. Wäre das auch etwas für Buchverlage?) - http://www.welt.de/die-welt/article4135872/Wer-den-Weg-zum-Leser-ebnet.html, http://www.boersenblatt.net/330550/.
[8] Vgl. Ehmann in Jus Meum, vgl. Anm.5.
[9] Z.B. vertreten von Christoph Keese, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG: Mit Kreativität Publikum im Internet gewinnen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf; umfängliche Informationen zum Leistungsschutzrecht für Verlage auf der Website des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) - http://www.bdzv.de/leistungsschutzrecht_aktuelles.html
[10] Till Kreutzer: Leistungsschutzrecht für Verlage: Mehr Schaden als Nutzen. In: MedienWirtschaft 1/2010, Standpunkte - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/04/Medienwirtschaft-Leistungsschutzrecht.pdf
[11] http://irights.de/?q=node/2049
[12] Bitkom: Stellungnahme zu Überlegungen der Einführung urheberrechtlichen Leistungsschutzrechts für Presseverleger (25.6.2010) - http://www.bitkom.org/files/documents/100624_Stellungnahme_BITKOM_Verleger_LSR_final.pdf. Bemerkenswert das Argument zugunsten der Leistung der Suchmaschinen: „Insbesondere bilden Links auf frei verfügbar gemachte Presseartikel durch Suchmaschinen oder Social-Networks kein Ausnutzen fremder Leistungen, sondern eine eigenständige Infrastrukturleistung der Aggregatoren, die auch der Anknüpfungspunkt für entsprechende Einnahmen, etwa durch Werbung, ist.“
[13] Position der Gewerkschaften DJV und ver.di zu einem Leistungsschutzrecht der periodischen Presse - http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2010/05/Leistungsschutzrecht-Gewerkschaftssynopse.pdf; Kritik daran in Charta von Till Kreutzer, Matthias Spielkamp und Philipp Otto - http://carta.info/27043/entwurf-fuer-das-leistungsschutzrecht-fuer-presseverleger-nie-da-gewesene-rechtsverwirrung/; die Ver-di-Politik erläuternd vgl. das Interview mit dem Justiziar von Ver.di, Wolfgang Schimmel - http://carta.info/31813/ver-di-zum-leistungsschutzrecht-freie-journalisten-sind-nur-bedingt-freigestellt/; zur (umstrittenen) Internetpolitik von Ver.di allgemein vgl. Bundesvorstand: Positionspapier. Internet und Digitalisierung – Herausforderungen für die Zukunft des Urheberrechts - http://www.netzpolitik.org/wp-upload/verdi_Urheberrecht_Position.pdf.
[14] Vgl. Anm. 6
[15] http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwdspl=0&rwsite=DBR_INTERNET_DE-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000262717
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:30 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aytaç Eryilmaz Foto: IB
Objekte, Fotos, Plakate, Schriftstücke, Film- und Tondokumente – das alles hat das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland (DOMiD) in den 20 Jahren seines Bestehens zusammengetragen. Zum 50. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens plant die Kölner Institution eine groß angelegte Ausstellung.
Pünktlich zum 31. Oktober soll die Dokumentation im Rahmen eines Festakts in Berlin zu sehen sein. Im November werden zwei weitere Ausstellungen in Düsseldorf und Köln präsentiert. Anfang nächsten Jahres soll die Ausstellung in der Türkei gezeigt werden. Mit den gezeigten Objekten und Tondokumenten "möchte DOMiD eine umfassende Bilanz ziehen", sagt der Geschäftsführer des Vereins, Aytaç Eryilmaz. "Es soll die Geschichte, aber auch die vielschichtige Gegenwart der Migranten aus der Türkei dargestellt werden." Dabei ist die "geteilte Erinnerung" für Türken und Deutsche bisher nur eine kleine Schnittmenge, die aber auf jeden Fall größer werden soll.
Portrait des Geschäftsführers des Vereins DOMiD, Aytaç EryilmazFoto: IB Vergrößerung Aytaç EryilmazUnter der Überschrift "50 Jahre Migration aus der Türkei" sollen auch viele wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen stehen, an denen DOMiD, in Zusammenarbeit mit dem KulturForum TürkeiDeutschland, der TGD-Türkischen Gemeinde in Deutschland und dem Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, mitwirkt. Die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Maria Böhmer, ist für diese Ausstellung Kooperationspartnerin des Vereins, aber auch das Bundesministerium des Innern, das Auswärtige Amt, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Landesregierung NRW, die Städte Köln und Istanbul, Deutscher Gewerkschaftsbund und Arbeiterwohlfahrt und viele andere.
Ausstellungen für alle Sinne
Schon in den vergangenen Jahren hat DOMiD mit Ausstellungen, die alle Sinne ansprechen und sowohl die Geschichte als auch die aktuelle Situation von Migranten verdeutlichen, auf sich aufmerksam gemacht: Fremde Heimat (1998 in Essen), 40 Jahre Fremde Heimat (2001 in Köln) und Projekt Migration (2005 in Köln).
Vor gut einem Jahr hat der Verein neue Räume in Köln-Ehrenfeld bezogen, eine Etage im Bezirksrathaus, die für die Sammlung und Archivierung optimale Bedingungen bietet. 70.000 Dokumente und Exponate hat DOMiD in den 20 Jahren seines Bestehens schon gesammelt. Aber erst ein Drittel ist inventarisiert. "Viele stellen uns Dinge zur Verfügung, die an die Zeit der Migration in den 60er Jahren oder auch später erinnern. Das können Fotos, Schriftstücke, Plakate oder auch persönliche Gegenstände sein", erklärt Aytaç Eryilmaz. "Dennoch suchen wir weiter, um unsere Sammlung zu erweitern und möglichst vielen Menschen einen Eindruck davon zu geben, was Migration bedeutet, um das erfahrbar zu machen." Ob es sich dabei um Schenkungen oder Dauerleihgaben handelt, ist zweitrangig. In den DOMiD-Archiven sind die Exponate gut aufgehoben, jedes Depot enthält nur bestimmte Materialien, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind exakt auf sie abgestimmt. Und es gibt noch jede Menge Platz.
Bundesweit einzigartiges Archiv
Während sich DOMiD ursprünglich nur mit der Migrationsgeschichte aus der Türkei befasst hat, sind in den Jahren 2002 bis 2006 auch die anderen Migrantencommunities hinzugekommen: Durch das Projekt Migration, in dem der Verein mit einigen anderen Institutionen eine große sozialgeschichtliche und künstlerische Ausstellung auf die Beine gestellt hat, enthält die Sammlung nun auch Objekte zur Migration aus Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, Ex-Jugoslawien, Südkorea, Vietnam, Mosambik und Angola. Diese Sammlung ist bundesweit einmalig. Und auch der Verein selbst ist internationaler geworden. Hatte er anfänglich fast nur türkische Mitglieder, sind mittlerweile auch viele andere Nationen vertreten, natürlich auch Deutschland. Je mehr Perspektiven, desto interessanter das Projekt.
Diese Vielfalt soll auch weiter gepflegt werden. "Wir wollen in Zukunft auch andere Formen der Migration darstellen und Exponate dazu sammeln: Asyl und Flucht zum Beispiel", sagt Aytaç Eryilmaz. "Es ist so wichtig, dass die Menschen soweit es eben möglich ist, einmal einen anderen, ganz persönlichen Blick auf solche Lebensläufe bekommen können." Sein größter Wunsch für die nähere Zukunft ist aber ein Zentrum für Geschichte, Kunst und Kultur der Migration: "Ein Migrationsmuseum wäre in etwa zwei Jahren fertig, aber bisher sind uns für so ein Projekt keine Gelder bewilligt worden." Darüber allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesproche
Quelle: Bundesregierung, Artikel v. 1.6.11
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:27 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bd. 1 der Ausgabe von 1755
http://www.archive.org/details/PagusNeleticiEtNudzici1
Bd. 2:
http://www.archive.org/details/PagusNeleticiEtNudzici2
Ausgabe 1772/73:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pagus_Neletici_et_Nuvdzici_oder_Diplomatisch-historische_Beschreibung_des_Saal-Creyses_1.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pagus_Neletici_et_Nuvdzici_oder_Diplomatisch-historische_Beschreibung_des_Saal-Creyses_2.pdf
In Halle sind leider nur die Beilagen der Erstausgabe 1749-50 online (die SB München ist im Rahmen von VD 18 für die Digitalisierung des Gesamtwerks zuständig):
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/1692979
http://www.archive.org/details/PagusNeleticiEtNudzici1
Bd. 2:
http://www.archive.org/details/PagusNeleticiEtNudzici2
Ausgabe 1772/73:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pagus_Neletici_et_Nuvdzici_oder_Diplomatisch-historische_Beschreibung_des_Saal-Creyses_1.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pagus_Neletici_et_Nuvdzici_oder_Diplomatisch-historische_Beschreibung_des_Saal-Creyses_2.pdf
In Halle sind leider nur die Beilagen der Erstausgabe 1749-50 online (die SB München ist im Rahmen von VD 18 für die Digitalisierung des Gesamtwerks zuständig):
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/1692979
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:02 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.its-arolsen.org/de/startseite/aktuelles/index.html?expand=5190&cHash=5ff8f53227
Zum ITS Arolsen beachte man:
http://archiv.twoday.net/stories/25481910/
http://archiv.twoday.net/stories/19441887/
Zum ITS Arolsen beachte man:
http://archiv.twoday.net/stories/25481910/
http://archiv.twoday.net/stories/19441887/
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 19:29 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die spinnen, die Österreicher:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,768614,00.html
 Foto: Pedroserafin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Pedroserafin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,768614,00.html
 Foto: Pedroserafin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Pedroserafin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 17:50 - Rubrik: Archivrecht
Die in zwei Teilen erschienene Darstellung von Schmidt 1878 und 1881 ist online:
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2011/0323/
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2011/0324/
Zu den heutigen russischen Standorten der Handschriften siehe die Nachweise bei den Beschreibungen
http://www.handschriftencensus.de/hss/Halberstadt
Siehe auch
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/halberstadta.html
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2011/0323/
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2011/0324/
Zu den heutigen russischen Standorten der Handschriften siehe die Nachweise bei den Beschreibungen
http://www.handschriftencensus.de/hss/Halberstadt
Siehe auch
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/halberstadta.html
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 17:33 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
siehe Archäologik
R.Schreg - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 17:09 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/wd/wolfdietrich.htm
Anlässlich der Präsentation der soeben erschienenen Publikation «Strategien der Macht. Hof und Residenz in Salzburg um 1600″ veröffentlichte die Universitätsbibliothek Salzburg ein online-Portal zur Büchersammlung des Salzburger Erzbischofs Wolf Dietrich von Raitenau:
Eines Fürsten Bibliothek
Zu finden sind eine Auflistung der an der UB Salzburg vorhandenen Bücher, Abbildungen der Einbände mit einer Tabelle der Stempel und Rollen, ein Beitrag zur Bibliothek des Franziskanerklosters in Salzburg sowie zu den Streubeständen in anderen Einrichtungen.
Text aus
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14865

Anlässlich der Präsentation der soeben erschienenen Publikation «Strategien der Macht. Hof und Residenz in Salzburg um 1600″ veröffentlichte die Universitätsbibliothek Salzburg ein online-Portal zur Büchersammlung des Salzburger Erzbischofs Wolf Dietrich von Raitenau:
Eines Fürsten Bibliothek
Zu finden sind eine Auflistung der an der UB Salzburg vorhandenen Bücher, Abbildungen der Einbände mit einer Tabelle der Stempel und Rollen, ein Beitrag zur Bibliothek des Franziskanerklosters in Salzburg sowie zu den Streubeständen in anderen Einrichtungen.
Text aus
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14865

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus Mainz. Anscheinend in Wordpress realisiert. Die Beiträge stehen unter CC-BY-ND.
http://www.skriptum-geschichte.de/
Inhalt der ersten Ausgabe:
Essay
Epigraphik im digitalen Umfeld von Torsten Schrade
Seminararbeit
Italien unter den Karolingern: Reichsteil oder Teilreich? von Ulrich Hausmann
Seminararbeit
Drei Fragen zum Staats- und Verfassungssystem der Vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert von Thorsten Holzhauser
Unterrichtsentwurf
Die Eroberung des Aztekenreichs von Mareike Schenk
Rezension
Mainz: Menschen – Bauten – Ereignisse von Kevin Hecken
Nicht glücklich bin ich mit den Zitierhinweisen:
http://www.skriptum-geschichte.de/?page_id=28
Wie unter http://archiv.twoday.net/stories/16539613/ ausgeführt, sollte man URNs immer mit einem Resolver unterlegen. Außerdem sollte man den Zitierhinweis unter jedem Artikel plazieren, wenn die Ausgabe Nr. 2 erschienen ist, wird man nicht mehr wissen, dass ein Beitrag in Nr. 1 erschienen ist, denn das lässt sich der Seite des Artikels nicht entnehmen! Daß man auch das PDF zitieren kann, lässt Studierende ratlos: Sollen Sie nun HTML, URN oder PDF zitieren? Der URN führt auf die HMTL-Version, also ist diese die "Version of Record".
http://www.skriptum-geschichte.de/
Inhalt der ersten Ausgabe:
Essay
Epigraphik im digitalen Umfeld von Torsten Schrade
Seminararbeit
Italien unter den Karolingern: Reichsteil oder Teilreich? von Ulrich Hausmann
Seminararbeit
Drei Fragen zum Staats- und Verfassungssystem der Vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert von Thorsten Holzhauser
Unterrichtsentwurf
Die Eroberung des Aztekenreichs von Mareike Schenk
Rezension
Mainz: Menschen – Bauten – Ereignisse von Kevin Hecken
Nicht glücklich bin ich mit den Zitierhinweisen:
http://www.skriptum-geschichte.de/?page_id=28
Wie unter http://archiv.twoday.net/stories/16539613/ ausgeführt, sollte man URNs immer mit einem Resolver unterlegen. Außerdem sollte man den Zitierhinweis unter jedem Artikel plazieren, wenn die Ausgabe Nr. 2 erschienen ist, wird man nicht mehr wissen, dass ein Beitrag in Nr. 1 erschienen ist, denn das lässt sich der Seite des Artikels nicht entnehmen! Daß man auch das PDF zitieren kann, lässt Studierende ratlos: Sollen Sie nun HTML, URN oder PDF zitieren? Der URN führt auf die HMTL-Version, also ist diese die "Version of Record".
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 16:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2662347
Darin in Bd. 2 Johann Birks Tractatus über die Klostergeschichte Kemptens
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2711468
Darin in Bd. 2 Johann Birks Tractatus über die Klostergeschichte Kemptens
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2711468
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 15:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ibiblio.org/pomerantz/blog/2011/06/my-copyfight/
Am Ende eine charmante Idee: Man kann ja absichtlich einen Artikel das Peer-Review durchlaufen lassen und ihn dann zurückziehen. Wieso der Autor den Artikel nur als Google-Doc, aber nicht in einem Repositorium wie E-LIS veröffentlichte, bleibt zu fragen.
Am Ende eine charmante Idee: Man kann ja absichtlich einen Artikel das Peer-Review durchlaufen lassen und ihn dann zurückziehen. Wieso der Autor den Artikel nur als Google-Doc, aber nicht in einem Repositorium wie E-LIS veröffentlichte, bleibt zu fragen.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 15:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110616_OTS0165/karlheinz-toechterle-plattform-der-zeithistorischen-politischen-archive-gegruendet
"Mit der Plattform der zeithistorischen politischen
Archive sichern wir die wertvollen Forschungsinfrastrukturen im
Bereich der politischen Zeitgeschichte des gesamten 20. Jahrhunderts,
bündeln ihre Stärken und erhöhen gerade auch international die
Sichtbarkeit", begrüßt Wissenschafts- und Forschungsminister Dr.
Karlheinz Töchterle die heutige Konstituierung der Plattform in der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Damit wird die Säule
drei des Drei-Säulen-Modells umgesetzt, das im Herbst des Vorjahres
die Basissubventionen im Bereich der außeruniversitären
Forschungseinrichtungen abgelöst hat. Die in dieser Plattform
zusammengefassten wissenschaftlichen Institute (Bruno Kreisky Archiv,
Dr. Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Karl von Vogelsang-Institut, Verein
für die Geschichte der Arbeiterbewegung) knüpfen an ihre bisherigen
Tätigkeiten unter Nutzung ihrer über Jahrzehnte erworbenen
Kompetenzen, ihrer internationalen Netzwerke und ihrer
wissenschaftlichen Ressourcen an.
Dass eine solche Plattform auch eine Website braucht, scheint man im verschlafenen Alpenland nicht zu wissen.
Danke an M. Bargmann via Twitter.
"Mit der Plattform der zeithistorischen politischen
Archive sichern wir die wertvollen Forschungsinfrastrukturen im
Bereich der politischen Zeitgeschichte des gesamten 20. Jahrhunderts,
bündeln ihre Stärken und erhöhen gerade auch international die
Sichtbarkeit", begrüßt Wissenschafts- und Forschungsminister Dr.
Karlheinz Töchterle die heutige Konstituierung der Plattform in der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Damit wird die Säule
drei des Drei-Säulen-Modells umgesetzt, das im Herbst des Vorjahres
die Basissubventionen im Bereich der außeruniversitären
Forschungseinrichtungen abgelöst hat. Die in dieser Plattform
zusammengefassten wissenschaftlichen Institute (Bruno Kreisky Archiv,
Dr. Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Karl von Vogelsang-Institut, Verein
für die Geschichte der Arbeiterbewegung) knüpfen an ihre bisherigen
Tätigkeiten unter Nutzung ihrer über Jahrzehnte erworbenen
Kompetenzen, ihrer internationalen Netzwerke und ihrer
wissenschaftlichen Ressourcen an.
Dass eine solche Plattform auch eine Website braucht, scheint man im verschlafenen Alpenland nicht zu wissen.
Danke an M. Bargmann via Twitter.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 15:02 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
PNV (Nationalistische Baskische Partei) erhält die Archive zurück die Franco beschlagnahmen liess.
El Pais hier:
http://goo.gl/Bqqzg
http://vierprinzen.blogspot.com/
El Pais hier:
http://goo.gl/Bqqzg
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 09:39 - Rubrik: Parteiarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Confessions of an impatient historian
View more presentations from Tim Sherratt
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. Juni 2011, 09:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit Januar 2011 wird die Forschung zu Zwangsarbeit, Holocaust und Widerstand in Berlin-Neukölln durch den Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen blockiert. In willkürlicher Auslegung der Benutzerordnung verweigert der Suchdienst die Anfertigung und Herausgabe von Kopien, die für eine Auswertung notwendig sind.
Der Suchdienst hatte vergangenes Jahr in Archivalia (https://archiv.twoday.net/stories/11430012/) geschrieben, der ITS sei eine "Institution nach internationalem Recht" und es bliebe "jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das 'Governing Body' (den Internationalen Ausschuss) oder an das 'Managing Body' (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren."
Also habe ich mich an den Internationalen Ausschuss gewandt. Dies sind Regierungsvertreter aus 11 Nationen (Belgien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Großbritannien, USA). Ich bat die Ausschussmitglieder - soweit ich sie ausfindig machen konnte - sowie den Ausschussvorsitzenden, Herrn Servais aus dem Brüsseler Außenministerium, dafür zu sorgen,
"dass sich auch der ITS an die in der Benutzerregelung bzw. Gebührenordnung vorgegebenen Regeln hält. Nur so kann dem Eindruck entgegen gearbeitet werden, dass der ITS unter Missachtung der selbst aufgestellten Regeln und unter willkürlicher Umdefinierung von Fachbegriffen die Forschung zu Zwangsarbeit und anderen Verbrechen im Nationalsozialismus behindert."
Der Ausschuss tagte Ende Mai in Brüssel. Ich wurde darüber informiert:
"Auf der Sitzung ... wurde Ihr Anliegen (keine Beschränkung bei der
Anfertigung von Ablichtungen aus den Dokumenten) erörtert. ... Im Ergebnis wurde beschlossen, die Frage im Rahmen einer Arbeitsgruppe von Archivexperten einer vertieften Betrachtung zu unterziehen. Dies soll möglichst bis Ende 2011 geschehen. In der Zwischenzeit wird es bei der bisherigen Regelung in der Benutzerordnung verbleiben."
Hier haben die versammelten Diplomaten durch ein gezieltes Missverständnis mein Anliegen abgebügelt, denn es ging mir nicht um eine Neuregelung der Benutzerordnung, sondern einfach nur um deren Einhaltung durch den Suchdienst.
Der Internationale Ausschuss hat es also abgelehnt, sich für die Einhaltung der eigenen Regeln durch den ITS einzusetzen und sieht offensichtlich auch keine Veranlassung, sich darum zu kümmern. Es ist zu vermuten, dass der ITS dort zumindest seine Bestandsdefinition (https://archiv.twoday.net/stories/25481910/) zur Sprache gebracht haben muss, die nichts anderes besagt als "Wir pfeifen darauf, was der allgemeine Sprachgebrauch, die Wissenschaft und Archivterminologie darunter versteht, wir basteln uns unsere eigene Definition nach Gusto zurecht." Diese Definition erlaubt dem ITS generell die beliebige Verweigerung von Kopien und damit die Blockade der Forschung, die mit Kopien arbeitet.
Wenn ich beides zusammenführe: Einerseits die Definitionshoheit des ITS über das, was man in Kopien herausgeben möchte, andererseits die Beschlusslage des Internationalen Ausschusses, so bedeutet dies:
Der Internationale Ausschuss hat in Brüssel dem ITS die Vollmacht gegeben, nach Belieben die Auswertung von Archivalien des Suchdienstes zu verhindern. Damit hat er einen Schlussstrich unter die vom ITS ohnehin nicht gewünschte Öffnung für die Forschung gezogen.
Wenn man einige Jahre lang hoffen durfte, die Forschung zu den Verbrechen des Dritten Reiches werde durch die Öffnung des Suchdienstes voranschreiten, so macht der Brüsseler Schlussstrich viele dieser Hoffnungen zunichte.
Der Suchdienst hatte vergangenes Jahr in Archivalia (https://archiv.twoday.net/stories/11430012/) geschrieben, der ITS sei eine "Institution nach internationalem Recht" und es bliebe "jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das 'Governing Body' (den Internationalen Ausschuss) oder an das 'Managing Body' (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren."
Also habe ich mich an den Internationalen Ausschuss gewandt. Dies sind Regierungsvertreter aus 11 Nationen (Belgien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Großbritannien, USA). Ich bat die Ausschussmitglieder - soweit ich sie ausfindig machen konnte - sowie den Ausschussvorsitzenden, Herrn Servais aus dem Brüsseler Außenministerium, dafür zu sorgen,
"dass sich auch der ITS an die in der Benutzerregelung bzw. Gebührenordnung vorgegebenen Regeln hält. Nur so kann dem Eindruck entgegen gearbeitet werden, dass der ITS unter Missachtung der selbst aufgestellten Regeln und unter willkürlicher Umdefinierung von Fachbegriffen die Forschung zu Zwangsarbeit und anderen Verbrechen im Nationalsozialismus behindert."
Der Ausschuss tagte Ende Mai in Brüssel. Ich wurde darüber informiert:
"Auf der Sitzung ... wurde Ihr Anliegen (keine Beschränkung bei der
Anfertigung von Ablichtungen aus den Dokumenten) erörtert. ... Im Ergebnis wurde beschlossen, die Frage im Rahmen einer Arbeitsgruppe von Archivexperten einer vertieften Betrachtung zu unterziehen. Dies soll möglichst bis Ende 2011 geschehen. In der Zwischenzeit wird es bei der bisherigen Regelung in der Benutzerordnung verbleiben."
Hier haben die versammelten Diplomaten durch ein gezieltes Missverständnis mein Anliegen abgebügelt, denn es ging mir nicht um eine Neuregelung der Benutzerordnung, sondern einfach nur um deren Einhaltung durch den Suchdienst.
Der Internationale Ausschuss hat es also abgelehnt, sich für die Einhaltung der eigenen Regeln durch den ITS einzusetzen und sieht offensichtlich auch keine Veranlassung, sich darum zu kümmern. Es ist zu vermuten, dass der ITS dort zumindest seine Bestandsdefinition (https://archiv.twoday.net/stories/25481910/) zur Sprache gebracht haben muss, die nichts anderes besagt als "Wir pfeifen darauf, was der allgemeine Sprachgebrauch, die Wissenschaft und Archivterminologie darunter versteht, wir basteln uns unsere eigene Definition nach Gusto zurecht." Diese Definition erlaubt dem ITS generell die beliebige Verweigerung von Kopien und damit die Blockade der Forschung, die mit Kopien arbeitet.
Wenn ich beides zusammenführe: Einerseits die Definitionshoheit des ITS über das, was man in Kopien herausgeben möchte, andererseits die Beschlusslage des Internationalen Ausschusses, so bedeutet dies:
Der Internationale Ausschuss hat in Brüssel dem ITS die Vollmacht gegeben, nach Belieben die Auswertung von Archivalien des Suchdienstes zu verhindern. Damit hat er einen Schlussstrich unter die vom ITS ohnehin nicht gewünschte Öffnung für die Forschung gezogen.
Wenn man einige Jahre lang hoffen durfte, die Forschung zu den Verbrechen des Dritten Reiches werde durch die Öffnung des Suchdienstes voranschreiten, so macht der Brüsseler Schlussstrich viele dieser Hoffnungen zunichte.
Bremberger - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 22:21
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Er recherchiere über eine gigantische Verschwörung. Mehr wollte der Leipziger Historiker Heinz Rehmer seinem Ex-Kollegen Stachelmann beim Abendessen nicht erzählen.
Am nächsten Morgen liegt seine Leiche im Berliner Bundesarchiv. Stachelmann lässt Rehmers Andeutung keine Ruhe: Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Akribisch prüft Stachelmann zusammen mit seinem Helfer Georgie die Akten, die Rehmer bestellt hatte. Doch die Mühe ist umsonst. Als Stachelmann schon aufgeben will, bedroht ihn ein Unbekannter mit einer Pistole. Dann verschwindet Georgie spurlos. Und die Polizei stößt in Leipzig auf einen Institutschef, der Rehmer so bald wie möglich loswerden wollte. Ein Verwirrspiel, in dem nichts zusammenpasst.
Am Ende bleibt Stachelmann nur eine Chance: Rehmers Mörder zu finden, bevor er selbst dessen nächstes Opfer wird.
Der sympathischste Versager unter den Detektiven wieder auf den Spuren deutscher Vergangenheit – für Krimifans, die sich auch für Politik und Geschichte interessieren."
ISBN: 978-3-462-04296-2
448 Seiten, Paperback
Euro (D) 9,95 |
Quelle: Verlagswerbung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 22:19 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Am kommenden Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni 2011, tagt das Preisgericht für den Neubau des Historischen Archivs und der Kunst- und Museumsbibliothek. Als Standort steht ein Grundstück am Eifelwall, Ecke Luxemburger Straße, im Stadtteil Neustadt-Süd zur Verfügung. Vom Preisgericht zu bewerten sind 40 Entwürfe von nationalen und internationalen Architektenteams, die sich an dem Realisierungswettbewerb beteiligt haben. Der Wettbewerb wurde von dem Darmstädter Architekturbüro reischlad + Holz begleitet.
Von den Wettbewerbsteilnehmern wurden städtebaulich, architektonisch und funktionell anspruchsvolle Entwürfe erwartet. Die Planung eines Gebäudes für diese beiden bedeutenden wissenschaftlichen Einrichtungen verlangte von allen Beteiligten eine intensive Auseineinadersetzung mit den verschiedenen Aufgabenbereichen, Inhalten und Zielen der künftigen Nutzer. Entstehen soll ein einladendes, offenes und gleichzeitig hochfunktionales Haus, das sowohl Fachwissenschaftler als auch Studenten und interessierte Kölner Bürger anspricht. Die Planung sollte außerdem unter dem Aspekt des energieoptimierten Bauens im Sinne des so genannten Passivhausstandards erfolgen. Neben dem Siegerentwurf, dem ein Preisgeld von 62.500 Euro winkt, wird es vier weitere preisgekrönte Entwürfe geben.
Über die Ergebnisse der Preisgerichtssitzungen informieren bei einer Pressekonferenz
am Sonntag, 19. Juni 2011, im Rathaus, Spanischer Bau:
- Oberbürgermeister Jürgen Roters
- Bernd Streitberger, Beigeordneter für Planen und Bauen,
- Professor Georg Quander, Beigeordneter für Kunst und Kultur,
- N.N., Vorsitzender des Preisgerichts.
- Brigitte Holz, Architekturbüro Freischlad + Holz, Darmstadt.
Dort werden auch die Siegermodelle sowie die dazugehörigen Planunterlagen und Ansichten zu sehen sein.
Alle für den Wettbewerb eingereichten Arbeiten (Modelle, Visualisierungen, Pläne, Erläuterungen) werden vom 21. Juni bis 5. Juli im Lichthof des Spanischen Baus des Rathauses ausgestellt und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein.
Den außergewöhnlichen Termin für die Pressekonferenz am Sonntag bitten wir zu entschuldigen. Wegen der möglicherweise bis in die Samstagnacht andauernden Sitzung des Preisgerichts und nicht aufschiebbarer Verpflichtungen vieler Beteiligter in der darauffolgenden Woche war kein andere zeitnaher Termin möglich."
Quelle: Stadt Köln, Presseinfo v. 15.6.2011
Bin ich zu kleinkariert, wenn ich bemängele, dass weder Archivierende noch die zukünftig Nutzenden eine Stimme im Preisgericht haben?
Von den Wettbewerbsteilnehmern wurden städtebaulich, architektonisch und funktionell anspruchsvolle Entwürfe erwartet. Die Planung eines Gebäudes für diese beiden bedeutenden wissenschaftlichen Einrichtungen verlangte von allen Beteiligten eine intensive Auseineinadersetzung mit den verschiedenen Aufgabenbereichen, Inhalten und Zielen der künftigen Nutzer. Entstehen soll ein einladendes, offenes und gleichzeitig hochfunktionales Haus, das sowohl Fachwissenschaftler als auch Studenten und interessierte Kölner Bürger anspricht. Die Planung sollte außerdem unter dem Aspekt des energieoptimierten Bauens im Sinne des so genannten Passivhausstandards erfolgen. Neben dem Siegerentwurf, dem ein Preisgeld von 62.500 Euro winkt, wird es vier weitere preisgekrönte Entwürfe geben.
Über die Ergebnisse der Preisgerichtssitzungen informieren bei einer Pressekonferenz
am Sonntag, 19. Juni 2011, im Rathaus, Spanischer Bau:
- Oberbürgermeister Jürgen Roters
- Bernd Streitberger, Beigeordneter für Planen und Bauen,
- Professor Georg Quander, Beigeordneter für Kunst und Kultur,
- N.N., Vorsitzender des Preisgerichts.
- Brigitte Holz, Architekturbüro Freischlad + Holz, Darmstadt.
Dort werden auch die Siegermodelle sowie die dazugehörigen Planunterlagen und Ansichten zu sehen sein.
Alle für den Wettbewerb eingereichten Arbeiten (Modelle, Visualisierungen, Pläne, Erläuterungen) werden vom 21. Juni bis 5. Juli im Lichthof des Spanischen Baus des Rathauses ausgestellt und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein.
Den außergewöhnlichen Termin für die Pressekonferenz am Sonntag bitten wir zu entschuldigen. Wegen der möglicherweise bis in die Samstagnacht andauernden Sitzung des Preisgerichts und nicht aufschiebbarer Verpflichtungen vieler Beteiligter in der darauffolgenden Woche war kein andere zeitnaher Termin möglich."
Quelle: Stadt Köln, Presseinfo v. 15.6.2011
Bin ich zu kleinkariert, wenn ich bemängele, dass weder Archivierende noch die zukünftig Nutzenden eine Stimme im Preisgericht haben?
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:31 - Rubrik: Kommunalarchive

"Das Historische Archiv freut sich über Ihre Mitarbeit in den verschiedenen Archiven außerhalb von Köln, in denen zur Zeit ca. 20 Regalkilometer der geborgenen Archivalien des eingestürzten Stadtarchivs Asyl gewährt wird und wo sie auf ihre weitere Bearbeitung warten. Sie werden die einmalige Chance haben, sehr viel und unterschiedlichstes Archivgut aus nächster Nähe betrachten zu können. Sie bekommen einen übergeordneten Einblick in die archivarische Arbeit.
Was Sie wissen sollten:
Es handelt sich explizit um Mitarbeit in den sogenannten „Asyl“-archiven außerhalb von Köln; es geht zur Zeit nicht um Arbeit in Köln selbst;
Ihre Arbeit sollte bitte mindestens einen ganzen Tag am Stück betragen, da es sich ansonsten nicht lohnt, die Reise anzutreten. Sehr gern im wöchentlichen oder im zweiwöchentlichen Rhythmus;
Wenn es Ihre Zeit zulässt, sind Sie herzlich willkommen, mehrere Tage am Stück in einem der Archive zu arbeiten;
Fahrt- und Übernachtungskosten mit Frühstück werden erstattet.
"

"Was Sie mitbringen sollten:
Eine Affinität zu Computerarbeit;
Die Fähigkeit, sich mehrere Stunden am Stück zu konzentrieren;
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten.
Wen Sie kontaktieren können:
Nehmen Sie bei Interesse bitte Kontakt auf mit Frau Karoline Meyntz (0173-8874364 / karoline.meyntz@stadt-koeln.de), die Ihnen außerdem weitere Fragen zur Mitarbeit beantworten kann."
Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, 14.6.2011
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:21 - Rubrik: Kommunalarchive

"An
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
SPD-Bundestagsfraktion
FDP-Bundestagsfraktion
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Berlin
Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus. Berlin
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus. Berlin
Fraktion der CDU im Abgeordnetenhaus. Berlin
Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus. Berlin
Fraktion DIE LINKE in der BVV Lichtenberg
SPD-Fraktion in der BVV Lichtenberg
Fraktion der CDU in der BVV Lichtenberg
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der BVV Lichtenberg
Berlin, 14. 06. 2011
Offener Brief:
Soll ein würdiger Gedenk-, Lern-und Forschungsort an und zu „Asozialen“ weiter verhindert werden? Setzen Sie sich gegen das Vergessen und Verschweigen ein!
Sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages sowie des Berliner Abgeordnetenhauses, Sehr geehrte Bezirksverordnete des Bezirkes Lichtenberg,
Am gestrigen 13. Juni vor 73 Jahren fand die „Aktion Arbeitsscheu Reich“ statt, die einen weiteren Beitrag zur Radikalisierung der „Erhaltung und Reinigung des deutschen Volkskörpers“ leisten sollte und einen Wendepunkt im Umgang mit den „Gemeinschaftsfremden“ einleitete.
„Massiv griff zunächst einmal die Gestapo, dann nachhaltig die Kriminalpolizei ein, letztere im Rahmen der 'vorbeugenden Verbrechensbekämpfung'.
Etwa zehntausend männliche „Asoziale“ wurden im Sommer 1938 binnen weniger Wochen in die Konzentrationslager verschleppt. …
Bereits wenige Wochen nach den Massenverhaftungen vom Sommer 1938 war die Verhängung von Vorbeugungshaft gegen „Asoziale“ in das normale, routinemäßige Verwaltungshandeln vieler Kommunen integriert. Wohlfahrtsämter drängten die Polizeibehörden geradezu zur Verhaftung von „Asozialen“1.
Begleitet war dieser Prozess von Gesetzesverschärfungen, -änderungen bzw. Neufassungen sowie wechselnden Zuständigkeiten und Deportationen in Konzentrationslager bzw. andere sogenannte Anstalten.
Die „Aktion Arbeitsscheu Reich“ steht somit symptomatisch für die Legalisierung und verstärkte Radikalisierung einer Politik der Ausgrenzung von sogenannten sozialen Randgruppen durch Stigmatisierung und Kriminalisierung. Betroffene waren zum Beispiel Obdachlose, Bettler_innen, Prostituierte, Homosexuelle, Sinti und Roma, die u. a. als „Unangepasste“, „Unwerte“ bzw. Wolfgang Ayaß, „Gemeinschaftsfremde“, Materialien aus dem Bundesarchiv, Koblenz 1998, Einleitung „Minderwertige“, „Unnütze“, „Arbeitsunwillige“ oder „Volks-bzw. Gemeinschaftsfremde“ gebrandmarkt wurden.
Unter den Nazis bedeutete dies für Zehntausende der als „Asoziale“ stigmatisierten Menschen Verfolgung, Sterilisation, Ingewahrsamnahme bis hin zur Zwangsarbeit und Ermordung in Konzentrationslagern.
Die Nichtanerkennung als Opfer des Nazi-Regimes sowie die bis heute fehlende Rehabilitierung und Entschädigung aber auch die Nichtaufarbeitung dieses Unrechts stellt für uns eine nachträgliche Erniedrigung der Betroffenen dar. Zu dem wird so in skandalöser Art und Weise eine nachträgliche Legitimierung der Verfolgung und Ermordung sogenannter Asozialer suggeriert.
Das Areal der ehemaligen Rummelsburger Arbeitshäuser steht symptomatisch für eine ganze Reihe authentischer Orte von Naziverbrechen, an denen die Erinnerung in den letzten Jahren durch Privatisierung und Kommerzialisierung entsorgt wurde. Nicht nur die frischen Fassaden täuschen über ihre Geschichte hinweg. Während z.B. das "ANDERE HAUS VIII" an der Rummelsburger Bucht aus der Nutzung des Areals als Gefängnis in der DDR-Zeit Kapital zu schlagen versucht, erinnert nichts an den Naziterror an diesem Ort. So z.B. auch nicht: an die sowjetischen Zwangsarbeiter_innen. Mädchen und jungen Frauen die nachts eingepfercht und tagsüber in die anliegenden Fabriken der IG Farben oder nach Oberschöneweide getrieben wurden.
Dieses Parallelgedenken stellt einen Versuch dar, die Singularität der Verbrechen des Naziregimes zu leugnen, zu relativieren und zu bagatellisieren Eine Gleichsetzung des Naziregimes mit der DDR lehnen wir aber an jedem Ort und zu jeder Zeit ab! Sowohl Völkermord als auch der Vernichtungskrieg der Nazis waren ein einmaliger Zivilisationsbruch, und jeder Versuch der Relativierung und Verharmlosung ist ein geschichtsrevisionistischer Vorstoß, dem wir uns entgegenstellen.
Sonst übertönt das Schweigen über Unrecht und Mord der Nazis auch weiterhin das Schreien der Gefolterten im „Raum der Stille“ des etwas anderen Hauses VIII. (s. Anhang, Historiker Thomas Irmer zu den Arbeitshäusern)
Ihrem Raum der Stille, des Verschweigens und Vergessens wollen wir unser vernehmliches Gedenken entgegensetzen und fordern gerade an diesem authentischen Ort darüber hinaus eine Erinnerungs-und Lernstätte zu Kontinuitäten und Brüchen sozialer Ausgrenzung mit Schwerpunkt zur "Verfolgung und Ermordung sogenannter Asozialer durch das Nazi-Regime“.
In Form eines Dokumentations-, Studien-und Forschungszentrum sowie einer Begegnungsstätte wäre dies möglich. Bitte unterstützen Sie uns dabei!
„Danksagung“ oder „Wem nutzt die Verhinderung des Gedenkens und der Aufarbeitung?“
Wir wollen heute alljenen unseren „Dank“ aussprechen, die so unermüdlich die Anerkennung der als „Asoziale“ durch die Nazis Verfolgten und Ermordeten als „spezifische“ Opfer des Nazi-Regimes blockiert, eine Aufarbeitung als Unrecht und somit eine Rehabilitierung und Entschädigung verhindert haben bzw. noch verhindern. Immerhin ist es u.a. auch dadurch gelungen systemisch bedingte Ausgrenzungsmechanismen beizubehalten bzw. zu modifizieren ohne, dass die kapitalistische Verwertungslogik in Frage gestellt oder Rassismus in der Mitte der Gesellschaft thematisiert werden musste.
Und wer keinen ökonomischen Wert (Mehrwert) für die „weiße Mehrheitsgesellschaft“ darstellt, hat sowieso weder eine Lobby noch viel Solidarität zu erwarten. Die Beibehaltung des Stigmas „asozial“ bzw. synonym dazu die Zuschreibung als „unwert“, „unnütz“ „minderwertig“ und „gemeinschaftsfremd“ oder heute verstärkt als „integrationsunwillig“ bzw., „Integrationsunfähig“ fördert außerdem die Selbststigmatisierung und Entsolidarisierung der Betroffenen auch untereinander. Ein geschlossener Widerstand ist also größtenteils auch hier nicht zu erwarten. Schließlich will verständlicherweise ja niemand dazu gehören oder als Letzter das Licht ausmachen.
Sollte da, wo bereits vorhandenes Unrecht den Nährboden für Naziverbrechen vorbereitete, der Zusatz „spezifische“ vor Nazi-Verbrechen deren Anerkennung als Opfer sowie eine Rehabilitierung und Entschädigung unmöglich machen? Und … Veränderungen in der Gesetzgebung des Nazi-Regimes sowie eine damit einhergehende Radikalisierung der Politik bis hin zur Ermordung so genannter Asozialer bewusst ignoriert werden?
Aus dieser Perspektive erscheint es ja möglich und scheinbar notwenig, auch weiterhin einen Gedenk-, Lern-und Forschungsort sowie eine Rehabilitierung und Entschädigung zu verhindern, um das Unrecht nicht als solches in der Öffentlichkeit zu enttarnen sowie mögliche Rückschlüsse auf Kontinuitäten und Brüche nicht zuzulassen.
Immerhin haben damals sowohl Kommunen wie auch Wohlfahrtsverbände etc. ebenfalls von den Gesetzen und Verordnungen sowie dem geringen Entgelt für die geleistete Zwangsarbeit durch Arbeitshausinsass_innen profitiert und daran entscheidend mitgewirkt. Nun sollte man zwar nicht behaupten, dass wir uns auf dem Weg zurück in die braune Vergangenheit befinden -und damit die Verbrechen der Nazis verharmlosen. Das ganz sicher nicht. Aber auch der Möglichkeit, Kontinuitäten sozialer bzw. rassistisch motivierter Ausgrenzung aufzuzeigen bzw. zu analysieren, soll wohl scheinbar rechtzeitig der Boden entzogen und das Stigma „asozial“ historisch entkontextualisiert werden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Zeit ist günstig! In kaum einer Krise seit 1945 ist es Teilen der Politik, Gesellschaft und Medien erfolgreicher gelungen, die Ursachen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen auf die Betroffenen selbst abzulenken sowie soziale Probleme zu individualisieren und Rassismus geschickt kultur-religiös oder ethnisch zu ummanteln bzw. zu verschleiern. Feindbilder scheinen wieder mehrheitsfähig, Sanktionen und Zwangsmaßnahmen öffentlich legitimierbar. Es ist wieder möglich geworden, die Zuschreibung von negativen Eigenschaften auf ganze Teile von Bevölkerungsgruppen vorzunehmen, ohne dass mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen ist. Endlich können wir aussprechen, was wir schon lange wussten.
Das verdanken wir denjenigen, die u.a. Thilo Sarrazin so geschickt in Stellung gebracht und des „deutschen Volkes Meinungsfreiheit“ wiederhergestellt haben. Unter diesem Deckmantel lässt sich Rassismus gut verstecken oder gar den Kritiker_innen in die Schuhe schieben. Sarrazin dabei als Opfer einer schon Jahrzehnte lang währenden „Meinungsdiktatur“ zu inszenieren und seine Kritiker_innen als -wie im rechten Sprachgebrauch üblich -„Gutmenschen“ zu diskreditieren, war nicht nur ein cleverer Schachzug, sondern bot vielen auch die Möglichkeit, sich zu solidarisieren und ihren eigenen Vorurteilen und Ängsten zu frönen.
Auch die „Integrationsdebatte“ hat einmal mehr deutlich gemacht, wer sich hier wem unterzuordnen hat, um Deutschland vor dem Untergang durch „Geburtenrückgang und gleichzeitige „Überfremdung durch Migration und Zuwanderung“ zu bewahren. Gut, dabei zu wissen, dass dem Glücksversprechen „Integration“ nicht gleich die Zugehörigkeit zu uns „Deutschen“ folgen wird. Sonst würde sich Deutschland womöglich doch noch abschaffen, dann aber durch erfolgreiche „Integration“ von „Nützlichen“ und „Angepassten“. Das dabei allein das Versprechen für Ausgegrenzte ausreicht, um sich gegenüber anderen Ausgegrenzten zu entsolidarisieren, ist dabei ein scheinbar glücklicher Umstand des Prinzips „Teile und Herrsche“. Zu groß ist offensichtlich die Verlockung auf die Aussicht, dazugehören zu dürfen.
Dies nutzen verstärkt in jüngster Zeit insbesondere Rechtspopulist_innen und Rassist_innen nicht nur neuer menschenfeindlicher Kleinstparteien, sondern auch aus den etablierten Parteien. Getroffen wird sich unter dem Deckmantel von „Islamkritik“, der Abwehr einer „Islamisierung“ sowie der „Überfremdung“ durch Zuwanderung und „unnütze Flüchtlinge“ in unsere Sozialsysteme. Als hilfreich erweisen sich dabei aber auch die Konstruktion eines „Kampfes der Kulturen“, einer Bedrohung des christlichen Abendlandes oder das Wiederauflebenlassen des Diskurses um eine angebliche deutsche Leitkultur, geschmückt mit sogenannten christlichen Werten.
Die Konstruktion von „Sozialschmarotzer_innen“ und „Sozialhilfebetrüger_innen“ mal mit und mal ohne Bezug auf die Herkunft und/ oder Religion hat dagegen schon länger eine unrühmliche Tradition. Und das auch nicht erst seit Sarrazins rassistischen Ausfällen mit Versatzstücken aus der Rassenhygiene und Eugenik der Nazis, die durch seinen mehrmaligen Nichtausschluss aus der SPD eine nachträgliche öffentliche Legitimation erhielten.
Es ist nicht notwendig, Äußerungen von heutigen Vertreter_innen aus Politik, Medien oder Gesellschaft oder von Thilo Sarrazin unter der Berücksichtigung jeweils herrschender gesellschaftspolitisch veränderter Rahmenbedingungen und Entwicklungen mit denen u.a. des NS-Reichsinnenministers Frick von 1933 zu vergleichen (s. Anlage). Kontinuitäten dürften Ihnen auch so auffallen. Die Bedrohungskulisse zur Polarisierung der Gesellschaft und zum Schüren von Ängsten vor der Abschaffung des „deutschen Volkes“ im Allgemeinen, die Konstruktion der Notwendigkeit eines „Wir Nützlichen“ gegen die „Anderen Unnützen“ und die Gefahr eines sozialen Abstieg des Einzelnen im Speziellen ähneln sich nicht zufällig.
Wohin dies führt, bleibt ebenso offen wie die Frage, ob sich Geschichte wiederholen kann. Nicht offen dagegen ist für uns die Tatsache, dass die Ursachen sozialer Probleme niemals durch eine „Law and Order“-Politik, einen ständig ausgebauten Sicherheits-und Überwachungsstaat, verbunden mit den fortgesetzten und sich verschärfenden Einschränkungen von Bürger_innenrechten durch Sanktions-und Zwangsmaßnahmen, behoben werden können. Dies dient lediglich der Verschleierung der Ursachen und der Tarnung der Profiteur_innen, die die bestehenden Macht-und Herrschaftsverhältnisse mit der der weiteren Profitmaximierung von einigen Wenigen sichern wollen. Reichtum benötigt immer Armut und die kapitalistische Verwertungslogik immer Ausgrenzung und Sündenböcke. Dies lehrt uns die Geschichte aber auch die Ergebnisse der sich verschärfenden Verteilungskämpfe.
Auch deshalb bitten wir Sie, die Forderung nach der längst überfälligen Anerkennung der Verfolgung und Ermordung sogenannter Asozialer als Verbrechen des Naziregimes sowie nach Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer zu unterstützen. Viele der Überlebenden sind schon gestorben. Geben sie ihnen nachträglich sowie den noch Lebenden jetzt ihre Würde und ihr Gesicht zurück! Darüber hinaus kann nur ein würdiger Gedenk-, Lern-und Forschungsort die Aufarbeitung der Geschichte sozialer Ausgrenzung bis heute leisten und das Schicksal der Opfer umfassend aufarbeiten. Auf authentische Orte der Nazi-Verbrechen kann dabei nicht verzichtet werden, und die Rummelsburger Arbeitshäuser bieten sich dafür an. Deshalb muss eine Privatisierung der restlichen zwei noch nicht verkauften Teile der Arbeitshäuser so lange gestoppt werden, bis eine Einigung dazu erzielt sowie alle nachvollziehbaren Spuren der Verbrechen gesichert wurden. Der Arbeitskreis „Marginalisierte gestern und heute“ wird sich mit aller zur Verfügung stehenden Kraft für diesen Ort einsetzen.
Es wird Zeit, dass auch die Bundesregierung und der Berliner Senat selbstständig ihre historische Verantwortung erkennen und ihr gerecht werden! Wir begrüßen das bisherige Engagement der BVV in Lichtenberg für eine Gedenktafel. Darüber hinaus wird das Bezirksamt Berlin-Lichtenberg ersucht, über eine Gedenktafel hinaus, die der differenzierten und wechselhaften Geschichte dieses Ortes nicht umfassend gerecht werden kann, alle Bemühungen für eine Gedenk-, Lern-und Forschungsort auf dem Gelände der Rummelsburger Arbeitshäuser zu unterstützen und die Privatisierung zu stoppen.
Sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages sowie des Berliner Abgeordnetenhauses, Sehr geehrte Bezirksverordnete des Bezirkes Lichtenberg, Sehr geehrte Leser_innen dieses Offenen Briefes,
es bleibt uns nicht mehr viel Zeit, bis die letzten Erinnerungen an die Verbrechen an den sogenannten Asozialen ökonomisch verwertet und aus der Geschichte von Nazi-Verbrechen getilgt sind.
Bisher gibt es keinerlei Gedenkzeichen in ganz Deutschland und kaum Bemühungen aus der Politik zur Aufarbeitung dieses Unrechts. Der Arbeitskreis „Marginalisierte -gestern und heute“ wird deshalb am 22. Juni, einen Tag vor der nächsten Lichtenberger BVV-Sitzung, eine thematische „antifaschistische Open-End-Filmnacht“ ab 20.00 Uhr auf dem zum Verkauf stehenden ehemaligen Friedhof der Rummelsburger Arbeitshäuser durchführen. Am darauf folgenden Tag werden wir versuchen, unser Anliegen in der Einwohner_innenfragestunde der BVV-Sitzung vorzutragen.
Wir bitten Sie daher, unser Anliegen, die Anerkennung als Opfer des Nazi-Regimes, ihre Rehabilitierung und Entschädigung sowie die Schaffung eines würdigen Gedenk-, Lern-und Forschungsortes mit Ihrer Unterschrift zu unterstützen und gleichzeitig Gesicht gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung zu zeigen. Ihre Unterschrift senden Sie bitte bis zum 22. Juni 2011 an marginalisierte@yahoo.de
Niemand ist „asozial“!
Mit freundlichen Grüßen AK „Marginalisierte-gestern und heute“ c/o Dirk Stegemann
Historisches:
I. Gesetze/Dienstvorschriften
Reichsinnenminister Dr. Wilhelm Frick betonte in seiner Rede am 28. Juni 1933 auf der ersten Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs-und Rassenpolitik in Berlin2:
„Nach den Berechnungen des Statistischen Reichsamtes ist das deutsche Volk bei seiner heutigen Geburtenziffer nicht mehr imstande, sich aus eigener Kraft zu erhalten, … . Unser Volk geht unweigerlich einer starken Überalterung und Vergreisung entgegen. … Es kommt hinzu, dass gerade oft schwachsinnige und minderwertige Personen eine überdurchschnittlich große Fortpflanzung aufweisen. … Das bedeutet aber, dass die begabtere wertvolle Schicht von Generation zu Generation abnimmt und in wenigen Generationen nahezu völlig ausgestorben sein wird, damit aber auch Leistung und deutsche Kultur. … trotz der vorhandenen Arbeitslosigkeit die Gefahr der Zuwanderung von Fremdstämmigen im Osten besteht. … In Berlin allein sind im Jahre 1930 etwa 4000 Zugewanderte aus dem Osten eingebürgert, von denen die meisten fremdstämmig, zum großen Teil Ostjuden waren. Neben der bedrohlich zunehmenden erbbiologischen Minderwertigkeit müssen wir in gleichem Maße die fortschreitende Rassenmischung und Rassenentartung unseres Volkes mit Sorge verfolgen …, wir müssen es als eine Verletzung der christlichen und sozialen Nächstenliebe ansehen, wenn wir trotz der gewonnenen Erkenntnisse es weiter zulassen, dass Erbkranke einen Nachwuchs hervorbringen, der unendliches Leid für sie selbst und die Angehörigen in dieser und den kommenden Generationen bedeutet. … Ausmerze und Auslese … .“
Fünf Jahre später hieß es in einer Dienstvorschrift des Berliner Oberbürgermeisters Dr. Julius Lippert an die Bezirksbürgermeister (Berlin, 29. März 1938)3:
㤠8 Allgemeine Rechtsgrundlage
Solange ein Bewahrungsgesetz nicht erlassen ist, sind alle Handhaben der geltenden Gesetze, die zur Verwirklichung der Bewahrungsaufgabe dienen können, rechtsschöpferisch anzuwenden. Zu diesem Zweck ist mit allen in Betracht kommenden Stellen, insbesondere mit dem Polizei-und Justizbehörden, zielbewusst und eng zusammenzuarbeiten. …
§ 13 Polizeiliche Bewahrung
Asoziale können nach § 14 des preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes mit Zustimmung der Polizei zwangsweise bewahrt werden, wenn nicht ihre gesicherte Unterbringung in polizeilichen Einrichtungen oder anderen Anstalten erforderlich ist.
§ 14 Strafrechtliche Bewahrung
Asoziale, die sich durch Landstreichen, gewerbs-oder gewohnheitsmäßiges Betteln, Trunk, Spiel, Müßiggang, Unzucht, Arbeitsscheu oder Obdachlosigkeit nach § 361 Ziffer 3 bis 8 StGB strafbar machen, sind bei der Polizei oder bei der Amtanwaltschaft anzuzeigen. In der Anzeige ist die Anordnung der Arbeitshausunterbringung nach § 42 d StGB anzuregen und aufgrund der für die Asozialenmeldung nach § 2 ermittelten Umstände zu begründen.
§ 15 Bewahrungsvollzug
Die Bewahrung wird im Städtischen Arbeits-und Bewahrungshaus Berlin-Rummelsburg, Hauptstraße 8, und seinen Zweigabteilungen sowie in den vom Landeswohlfahrts-und Jugendamt zugelassenen Bewahrungseinrichtungen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege vollzogen, die Wolfgang Ayaß, „Gemeinschaftsfremde“, Materialien aus dem Bundesarchiv, Koblenz 1998, S. 6 ff. 3 Wolfgang Ayaß, „Gemeinschaftsfremde“, Materialien aus dem Bundesarchiv, Koblenz 1998, S. 120 ff. zwangsweise Bewahrung nach §§ 11, 12, 13, 14 Absatz 1 und 2 ausschließlich im Städtischen Arbeitsund Bewahrungshaus und seinen Zweigabteilungen. … Nach der Entlassung ist mindestens für die Dauer eines Jahres die vorbeugende Überwachung nach § 6 auszuüben. Soweit die Bewahrung im Städtischen Arbeits-und Bewahrungshaus oder einer seiner Zweiganstalten erfolgt. Sind die Unterstützungsvorgänge an den Bezirksbürgermeister des Verwaltungsbezirks Lichtenberg … abzugeben, der die Sachbearbeitung übernimmt.“
Weitere knapp drei Jahre danach finden sich im Erlass des Berliner Oberbürgermeisters Ludwig Steeg an die Bezirksbürgermeister (Berlin, 13. Januar 1941) die „Regelung der Bewahrung „Asozialer“ in Berlin unter Einbeziehung der Einweisung in Konzentrationslager und Jugendschutzlager“4 sowie die Zuständigkeiten von Bezirksbürgermeistern, Wohlfahrtsämter und der Kriminalpolizei.
II. Der Historiker Thomas Irmer betonte in seiner Rede am Gedenktag für die Opfer der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ am 13. Juni 2010 zu den Arbeitshäusern Rummelsburg sinngemäß:
Die Nationalsozialisten konnten zwar auf einen bestehenden Diskurs der Ausgrenzung zurückgreifen, dieser wurde aber unvergleichlich radikalisiert und im weiteren Verlauf auch spezifisch rassistisch aufgeladen. Neu war in der Zeit des Nazi-Regimes, in welchem Umfang und Radikalität die Nazis unmittelbar nach der Machtübernahme gegen Menschen vorgingen, die nicht „integriert“ waren, nicht „integriert“ werden sollten oder sich nicht „integrieren“ wollten. Neu war auch, das Anfang 1934 die gesetzlichen Bestimmungen, die zu einer Einweisung in Arbeitshäuser führen konnten, grundlegend geändert wurden: Seit dem 1. Januar 1934 konnten Gerichte und nicht mehr die Landespolizeibehörden, eine Einweisung in Arbeitshäuser anordnen, und zwar auf unbestimmte Zeit. In der Folgezeit stieg die Zahl der Insassen in den Arbeitshäusern umfangreich an. In Rummelsburg stieg die Zahl der Insassen von Mitte 1934 bis Mitte 135 von 932 auf 1.191 Personen an. Ende 1939 waren hier bis zu 2.000 Menschen inhaftiert. 1937 war in anderer Hinsicht ein entscheidendes Jahr in der Geschichte des Arbeitshauses während der NS-Zeit: So wurden in dem Jahr auch alle jüdischen Insassen von den anderen isoliert. Außerdem wurden Sonderabteilungen für Homosexuelle und sogenannte ‚psychisch Abwegige’ eingerichtet.
Rummelsburg wurde dann in den Folgejahren immer mehr zu einer Verwahranstalt für ältere Obdachlose, Bettler und Prostituierte. Von den nachweisbar über 1.000 Insassen, die zwischen 1933 und 1945 hier in Rummelsburg starben und anschließend auf dem damaligen städtischen Armenfriedhof in Marzahn bestattet wurden, war die Mehrzahl über 50 Jahre alt. Bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob bzw. welchen Zusammenhang es zwischen ihrem Tod und den Lebensbedingungen hier in Rummelsburg gab. Bekannt ist aber, dass viele von ihnen zeitweise im Fadenkreuz von Gutachtern des NS-Euthanasieprogramms standen: Anfang 1942 wählte eine Gutachter-Kommission mehr als dreihundert Rummelsburger Insassen nach Aktenlage zur Tötung aus, bei weiteren 700 sprach sich mindestens ein Gutachter ebenfalls für deren Tötung aus. Diese Pläne wurden jedoch nicht vollstreckt.
Während des Krieges war der „Alltag“ der Insassen von Rummelsburg zunehmend durch Zwangsarbeit bestimmt. Sie wurden in innerbetrieblichen Werkstätten wie z.B. in einer Großwäscherei oder in 20 sogenannten Stadtkommandos außerhalb des Arbeitshauses u.a. zur Straßenreinigung oder auf den Rieselfeldern eingesetzt. Hervorzuheben ist hier, dass kommunale Arbeitgeber hier ein großer Nutznießer der Zwangsarbeit der Insassen des Arbeitshauses Rummelsburg waren.
4 Wolfgang Ayaß, „Gemeinschaftsfremde“, Materialien aus dem Bundesarchiv, Koblenz 1998, S. 111 "
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:18 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
chris cottrell : nine square from chris cottrell on Vimeo.
"Mixed media/digital video.2min 50"
shown in Viewfinder, Auckland Public Library/New Zealand Film Archive.
April - May 2006
now in the collection of the New Zealand Film Archive.
This video piece documents an architectural project concerned with repetition, subtle variation, memory and the body as a measure of space. Plans and sections are moved across, giving a partial experience of the space. The multiple screens act to highlight similarities and underscore differences. Materiality and inhabitation is suggested through the use of sound. "
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:12 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In den vergangenen Wochen kam hier mehrfach die Behinderung der Forschung zu Zwangsarbeit und Holocaust durch den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Arolsen (ITS) zur Sprache. Diese wurde damit begründet, die zur Auswertung benötigten Listen seien "Bestände" und dürften nach der Benutzer- bzw. Gebührenordnung als solche nicht für Benutzer abgelichtet werden. (https://archiv.twoday.net/stories/16556128/ Dubioses Vorgehen des ITS Arolsen).
Dabei wurde beispielsweise im Februar 2011 eine Liste von holländischen Zwangsarbeitern (Ordner 135, Seite 89 bis 101) als "Bestand" definiert, im April schrieb der Suchdienst, dies sei "selbstverständlich" kein "Bestand".
Um nachzuvollziehen, was der ITS nun tatsächlich meint, bat ich um eine Definition des Begriffs "Bestand". Der ITS erklärte auch Journalisten auf Nachfrage, er werde "diese archivarischen Grundbegriffe noch einmal transparent für alle Forscher definieren".
Mit Schreiben vom 9. Juni 2011 erläuterte Suchdienst-Direktor Blondel die "beim ITS übliche Definition eines 'Bestandes'", die ich hiermit der interessierten Fachwelt mitteile:
Dieser Begriff entspricht im ITS traditionell einem Akzessionsbestand in der Bedeutung der Zugangseinheit, d.h. er richtet sich auf die einzelnen nach dem Erwerb der Dokumente bei der Inventarisierung gelisteten Einheiten. Die Inventarisierung ist die Eintragung in ein Eingangsverzeichnis. Die mit ihr verbundene Beschreibung ist der Eintrag im Inventarbuch, also dem Eingangsverzeichnis. Diese Einträge werden für den Nutzer in unserer Recherchesoftware unter der Rubrik 'Archivbeschreibungen' bereitgestellt.
Es zeigt sich somit, dass der Bestandsbegriff in der bisherigen Geschichte des ITS nicht als Terminus aus dem Archivwesen verwendet wurde.
Die weitere Differenzierung des so bezeichneten 'Bestands' (identisch: Sammlung) in eine oder mehrere 'Aktenbestände' entspricht der Abgrenzung der einzelnen Schriftguteinheiten bei der oben dargelegten Inventarisierung. Diese Abgrenzung wird im Inventareintrag verdeutlicht und führt nicht zu jeweils eigenen Inventardatensätzen für die so definierten Schriftguteinheiten.
Der in der Gebührenordnung verwendete Begriff des Aktenbestands meint somit die innerhalb der einzelnen Inventareinträge als selbständig erkennbare Schriftguteinheit.
Wie Sie sehen, beziehen sich diese Begrifflichkeiten auf ein
vorarchivarisches Bearbeitungsstadium der Unterlagen. Im Zuge der fortschreitenden archivischen Erschließung wird auch eine Überarbeitung derTerminologie nochmals zur Sprache kommen. Da aber bis auf Weiteres beim größten Teil der Unterlagen primär noch über das jetzige Tektonikmodell recherchiert werden muss, bleibt die Terminologie im erläuterten Sinne bis auf Weiteres anwendbar.
Nun zweifle ich daran, dass es "transparent für alle Forscher" ist, ich verstehe es jedenfalls noch nicht ganz. Klar wird jedenfalls, dass die in der Benutzerordnung des ITS gebrauchten Begriffe des Webspaces nicht wert sind, den sie einnehmen.
Der ITS möchte zwar - wie er mehrfach schreibt - ein bedeutendes Archiv werden, gibt aber andererseits zu, dass Archivterminologie bei ihm nicht gilt. Vielmehr können beim ITS nach Belieben "als selbständig erkennbare Schriftguteinheiten" [ist das schon ein einzelnes Dokument?] als Bestand interpretiert und der auswertung durch Forscher vorenthalten werden.
Bernhard Bremberger
Dabei wurde beispielsweise im Februar 2011 eine Liste von holländischen Zwangsarbeitern (Ordner 135, Seite 89 bis 101) als "Bestand" definiert, im April schrieb der Suchdienst, dies sei "selbstverständlich" kein "Bestand".
Um nachzuvollziehen, was der ITS nun tatsächlich meint, bat ich um eine Definition des Begriffs "Bestand". Der ITS erklärte auch Journalisten auf Nachfrage, er werde "diese archivarischen Grundbegriffe noch einmal transparent für alle Forscher definieren".
Mit Schreiben vom 9. Juni 2011 erläuterte Suchdienst-Direktor Blondel die "beim ITS übliche Definition eines 'Bestandes'", die ich hiermit der interessierten Fachwelt mitteile:
Dieser Begriff entspricht im ITS traditionell einem Akzessionsbestand in der Bedeutung der Zugangseinheit, d.h. er richtet sich auf die einzelnen nach dem Erwerb der Dokumente bei der Inventarisierung gelisteten Einheiten. Die Inventarisierung ist die Eintragung in ein Eingangsverzeichnis. Die mit ihr verbundene Beschreibung ist der Eintrag im Inventarbuch, also dem Eingangsverzeichnis. Diese Einträge werden für den Nutzer in unserer Recherchesoftware unter der Rubrik 'Archivbeschreibungen' bereitgestellt.
Es zeigt sich somit, dass der Bestandsbegriff in der bisherigen Geschichte des ITS nicht als Terminus aus dem Archivwesen verwendet wurde.
Die weitere Differenzierung des so bezeichneten 'Bestands' (identisch: Sammlung) in eine oder mehrere 'Aktenbestände' entspricht der Abgrenzung der einzelnen Schriftguteinheiten bei der oben dargelegten Inventarisierung. Diese Abgrenzung wird im Inventareintrag verdeutlicht und führt nicht zu jeweils eigenen Inventardatensätzen für die so definierten Schriftguteinheiten.
Der in der Gebührenordnung verwendete Begriff des Aktenbestands meint somit die innerhalb der einzelnen Inventareinträge als selbständig erkennbare Schriftguteinheit.
Wie Sie sehen, beziehen sich diese Begrifflichkeiten auf ein
vorarchivarisches Bearbeitungsstadium der Unterlagen. Im Zuge der fortschreitenden archivischen Erschließung wird auch eine Überarbeitung derTerminologie nochmals zur Sprache kommen. Da aber bis auf Weiteres beim größten Teil der Unterlagen primär noch über das jetzige Tektonikmodell recherchiert werden muss, bleibt die Terminologie im erläuterten Sinne bis auf Weiteres anwendbar.
Nun zweifle ich daran, dass es "transparent für alle Forscher" ist, ich verstehe es jedenfalls noch nicht ganz. Klar wird jedenfalls, dass die in der Benutzerordnung des ITS gebrauchten Begriffe des Webspaces nicht wert sind, den sie einnehmen.
Der ITS möchte zwar - wie er mehrfach schreibt - ein bedeutendes Archiv werden, gibt aber andererseits zu, dass Archivterminologie bei ihm nicht gilt. Vielmehr können beim ITS nach Belieben "als selbständig erkennbare Schriftguteinheiten" [ist das schon ein einzelnes Dokument?] als Bestand interpretiert und der auswertung durch Forscher vorenthalten werden.
Bernhard Bremberger
Bremberger - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:11 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://idw-online.de/pages/de/news428166
Siehe auch
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170055253054610
Update: Sammlung kann dank des Entgegenkommens der JCC in Leipzig bleiben.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,770180,00.html
Siehe auch
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170055253054610
Update: Sammlung kann dank des Entgegenkommens der JCC in Leipzig bleiben.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,770180,00.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Universität Heidelberg hat Silvana Koch-Mehrin (FDP) den Doktortitel entzogen.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,768607,00.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13431631/Koch-Mehrins-bizarre-Verteidigung-des-Doktortitels.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2011/pm20110615_koch_mehrin.html
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/stories/18099050/
http://archiv.twoday.net/stories/16571975/
http://archiv.twoday.net/stories/16566594/
[Update zu K-M:
http://www.heise.de/tp/blogs/10/150009 ]
Hier geht die Plagiatsforschung weiter:
http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/VroniPlag_Wiki
Zum Fall Uwe Brinkmann:
http://erbloggtes.wordpress.com/2011/06/07/plagiator-nummer-7-kein-abgeordneter-aber-dicht-dran/

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,768607,00.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13431631/Koch-Mehrins-bizarre-Verteidigung-des-Doktortitels.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2011/pm20110615_koch_mehrin.html
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/stories/18099050/
http://archiv.twoday.net/stories/16571975/
http://archiv.twoday.net/stories/16566594/
[Update zu K-M:
http://www.heise.de/tp/blogs/10/150009 ]
Hier geht die Plagiatsforschung weiter:
http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/VroniPlag_Wiki
Zum Fall Uwe Brinkmann:
http://erbloggtes.wordpress.com/2011/06/07/plagiator-nummer-7-kein-abgeordneter-aber-dicht-dran/

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 20:15 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ulrike Spree
Records Management (k)ein Thema für Information
Professionals!?
Ulrich Kampffmeyer
Records Management und Schriftgutverwaltung
Ulrike Spree
Wissensorganisation und Records Management:
Was ist der State of the Art?
Ulrich Kampffmeyer
MoReq und MoReq2
Interview von Ulrike Spree mit Joachim Haessler
Entwicklung von Records Management Software:
„Weg von einzelnen Projektlösungen, hin zum
Softwarehersteller“
Irmgard Mummenthey, Jenny Kotte und Julia Brüdegam
Schriftgutverwaltung, Records Management und
Records Preservation. Selbstverständnis des
Staatsarchivs Hamburg in einer modernen Verwaltung
Beate Graner, Maike Fresenborg, Anneke Lühr, Joachim
Seifert und Sebastian Sünkler
Schriftgutverwaltung an der Hochschule –
Entwicklung eines aufgabenorientierten Aktenplans
für die Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg
Martin Gennis
Schriftgutverwaltung und Langzeitarchivierung.
Records Management (k)ein Thema an
informationswissenschaftlichen Ausbildungsstätten
in Deutschland?
Die Beiträge sind kostenfrei online unter
http://www.agi-imc.de/isearch/dgi_publications.nsf/
Records Management (k)ein Thema für Information
Professionals!?
Ulrich Kampffmeyer
Records Management und Schriftgutverwaltung
Ulrike Spree
Wissensorganisation und Records Management:
Was ist der State of the Art?
Ulrich Kampffmeyer
MoReq und MoReq2
Interview von Ulrike Spree mit Joachim Haessler
Entwicklung von Records Management Software:
„Weg von einzelnen Projektlösungen, hin zum
Softwarehersteller“
Irmgard Mummenthey, Jenny Kotte und Julia Brüdegam
Schriftgutverwaltung, Records Management und
Records Preservation. Selbstverständnis des
Staatsarchivs Hamburg in einer modernen Verwaltung
Beate Graner, Maike Fresenborg, Anneke Lühr, Joachim
Seifert und Sebastian Sünkler
Schriftgutverwaltung an der Hochschule –
Entwicklung eines aufgabenorientierten Aktenplans
für die Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg
Martin Gennis
Schriftgutverwaltung und Langzeitarchivierung.
Records Management (k)ein Thema an
informationswissenschaftlichen Ausbildungsstätten
in Deutschland?
Die Beiträge sind kostenfrei online unter
http://www.agi-imc.de/isearch/dgi_publications.nsf/
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 18:26 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Zeitschrift "Information. Wissenschaft und Praxis" (IWP), früher Nachrichten für Dokumentation (NfD), wird getragen von der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI) und gilt als das führende Fachorgan der deutschsprachigen Informationswissenschaft und der deutschsprachigen Dokumentare.
2011 stieß der Wechsel der Zeitschrift zum großen kommerziellen Wissenschaftsverlag de Gruyter (statt eines möglichen Übergangs zu Open Access) auf Kritik:
http://archiv.twoday.net/stories/25480595/
Analog zu der 2010 für die ZfBB durchgeführten Studie
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
schien es mir sinnvoll, auch für IWP zu überprüfen, welcher Anteil der Aufsätze des vorletzten Jahrs von den AutorInnen selbstarchiviert wurde und Open Access zur Verfügung steht. Das gesamte Heft 5 mit dem Schwerpunktthema Open Access musste natürlich ausgeklammert werden, da es vom Verlag Open Access bereitgestellt wurde:
http://www.b-i-t-online.de/pdf/IWP2009-5.pdf
Berücksichtigt wurden keine Editorials, Nachrichten, Interviews, Leserfora, Tagungsberichte, Informationen und Buchbesprechungen.
Es wurde beispielsweise ermittelt:
Stock: Begriffe und semantische Relationen in der Wissensrepräsentation
http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/admin/public_dateien/files/1/1260277157iwp2009-8_.pdf
Verlags-PDF
Nachdem ich bei der Suche mit Google auf einen Treffer auf http://www.agi-imc.de stieß, dem ein PDF-Volltext beigegeben war, musste ich die Studie abbrechen, da die Aufsätze von 2009 anscheinend komplett unter
http://www.agi-imc.de/isearch/dgi_publications.nsf/ (Archiv)
einsehbar sind. Auch wenn nicht wenige davon im "Deep Web" unauffindbar für Interessenten, die von diesem eher klandestinen Angebot nichts wissen, lagern, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass Autoren, die davon wussten, von einer Selbstarchivierung abgesehen haben. Der Nutzen des Angebots ist aber eher gering, da keine zitierbaren Links für die einzelnen Aufsätze und PDFs vorliegen und die Suchfunktion nicht zu funktionieren scheint - zumindest ergab die Suche nach dem Titelwort Informationsvermittlung keinen Treffer. Einsehbar sind die Jahrgänge 2001, 2005-2011 bis hin zu 2011/4! Ein Eintrag dazu in der EZB existiert nicht, auch Herb scheint von diesem DGI-Angebot nichts zu wissen:
http://www.scinoptica.com/pages/posts/information-wissenschaft-praxis-iwp-ab-2012-bei-de-gruyter-die-open-access-flaute-haelt-an-22.php
So erfreulich der Befund ist, dass der Jahrgang 2009 - noch dazu in der Version of Record, also der Verlagsfassung - Open Access im Netz ist - wem nützt das, wenn so gut wie niemand davon etwas weiß?
2011 stieß der Wechsel der Zeitschrift zum großen kommerziellen Wissenschaftsverlag de Gruyter (statt eines möglichen Übergangs zu Open Access) auf Kritik:
http://archiv.twoday.net/stories/25480595/
Analog zu der 2010 für die ZfBB durchgeführten Studie
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
schien es mir sinnvoll, auch für IWP zu überprüfen, welcher Anteil der Aufsätze des vorletzten Jahrs von den AutorInnen selbstarchiviert wurde und Open Access zur Verfügung steht. Das gesamte Heft 5 mit dem Schwerpunktthema Open Access musste natürlich ausgeklammert werden, da es vom Verlag Open Access bereitgestellt wurde:
http://www.b-i-t-online.de/pdf/IWP2009-5.pdf
Berücksichtigt wurden keine Editorials, Nachrichten, Interviews, Leserfora, Tagungsberichte, Informationen und Buchbesprechungen.
Es wurde beispielsweise ermittelt:
Stock: Begriffe und semantische Relationen in der Wissensrepräsentation
http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/admin/public_dateien/files/1/1260277157iwp2009-8_.pdf
Verlags-PDF
Nachdem ich bei der Suche mit Google auf einen Treffer auf http://www.agi-imc.de stieß, dem ein PDF-Volltext beigegeben war, musste ich die Studie abbrechen, da die Aufsätze von 2009 anscheinend komplett unter
http://www.agi-imc.de/isearch/dgi_publications.nsf/ (Archiv)
einsehbar sind. Auch wenn nicht wenige davon im "Deep Web" unauffindbar für Interessenten, die von diesem eher klandestinen Angebot nichts wissen, lagern, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass Autoren, die davon wussten, von einer Selbstarchivierung abgesehen haben. Der Nutzen des Angebots ist aber eher gering, da keine zitierbaren Links für die einzelnen Aufsätze und PDFs vorliegen und die Suchfunktion nicht zu funktionieren scheint - zumindest ergab die Suche nach dem Titelwort Informationsvermittlung keinen Treffer. Einsehbar sind die Jahrgänge 2001, 2005-2011 bis hin zu 2011/4! Ein Eintrag dazu in der EZB existiert nicht, auch Herb scheint von diesem DGI-Angebot nichts zu wissen:
http://www.scinoptica.com/pages/posts/information-wissenschaft-praxis-iwp-ab-2012-bei-de-gruyter-die-open-access-flaute-haelt-an-22.php
So erfreulich der Befund ist, dass der Jahrgang 2009 - noch dazu in der Version of Record, also der Verlagsfassung - Open Access im Netz ist - wem nützt das, wenn so gut wie niemand davon etwas weiß?
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 17:14 - Rubrik: Open Access
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 15:44 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bernd Reiher vom Onlinemagazin "Radioszene", interviewt Heiko Hilker:
" ...... Heiko Hilker ist ein Mann, der sich mit den Medien im Osten bestens auskennt. Er hat für die Rettung von DT64 demonstriert, war viele Jahre Abgeordneter mit Schwerpunkt Medien im sächsischen Landtag und baut nach seinem Ausstieg aus der Parlamentsarbeit an seinem „Dresdner Institut für Medien, Bildung und Beratung“. Weil das Deutsche Rundfunkarchiv sich derzeit in Sachen eigene Zukunft in Zurückhaltung übt, haben wir ihn gebeten, uns in einigen Sätzen zu erklären, was das Deutsche Rundfunkarchiv ist und worum es bei der Schließungs-Debatte geht. ....
RADIOSZENE: Welche Bedeutung hat das Deutsche Rundfunkarchiv aus Ihrer Sicht für die gesamtdeutsche Medienlandschaft?
Hilker: Das Deutsche Rundfunkarchiv ist in der deutschen Medienlandschaft einmalig. Es gibt keine weitere Einrichtung, die in diesem Umfang Ton- und Bildträger aller Art erfasst hat, die von geschichtlichem, künstlerischem oder wissenschaftlichen Wert sind und in Kunst, Wissenschaft, Forschung und Unterricht genutzt werden können. Das DRA restauriert und sichert audiovisuelle Medien. Zur Langzeitsicherung werden die schriftlichen, audiophonen und audiovisuellen Dokumente auch verfilmt bzw. digitalisiert. Zudem gibt es eine umfangreiche Dokumentation rundfunkgeschichtlich bedeutsamer Tatsachen und Dokumente.
RADIOSZENE: Könnte jemand anderes die zum Teil kostbaren Unikate betreuen, die das DRA pflegt? Das Bundesarchiv?
Hilker: Das hat andere Aufgaben.
RADIOSZENE: Die ARD-Anstalten selbst?
Hilker: Denen mangelt es an Kapazitäten und Fachpersonal. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: „Ein Hörfunkredakteur benötigt Musik aus Lortzings unbekannter Oper „Zum Großadmiral“. Die einzige Aufnahme ist ein Radio-Schellack-Mitschnitt von 1937. Das Original, abermals ein Unikat, liegt in Frankfurt; …. Wer hören will, wie die Stimme Giacomo Puccinis geklungen hat: Per Recherche-Anfrage beim DRA erfährt er es in 30 Sekunden.“ (RP Online, 8.6.2011).
RADIOSZENE: Über dem DRA scheinen derzeit dunkle Kürzungs- oder Privatisierungswolken zu schweben. Aus dem Hause selber war bisher nicht viel zu erfahren. Was wissen Sie über die aktuelle Lage der Einrichtung zu berichten?
Hilker: Seit etwa sieben Jahren ist das Budget des DRA nicht gestiegen. Die ARD möchte jedoch innerhalb ihrer Gemeinschaftseinrichtungen, zu denen das DRA gehört, 15 Prozent sparen. Begründet wird dies mit sinkenden Gebühreneinnahmen. (Allerdings sind die Einnahmen aus der Rundfunkgebühr in den letzten zehn Jahren nur einmal gesunken). Im Jahre 2009 hatte man über 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und so werden verschiedene Varianten bis hin zur Privatisierung geprüft. Demnächst wollen die Intendanten hierzu eine Entscheidung treffen. Der Etat des DRA liegt bei zirka 12 Millionen Euro. Die Gebühreneinnahmen lagen 2009 bei 7,6 Millionen Euro. Die „degeto“ erhält für ihre Spielfilme über 370 Millionen Euro, die „SportA“ hatte 2010 einen Etat von über 300 Millionen Euro. Drei Fußballspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft kosten in etwa so viel wie der Etat des DRA. Es ist fraglich, ob eine Privatisierung des DRA der ARD Kosten spart. Schließlich erstellt das DRA nicht nur für die ARD deren Jahrbuch. Das DRA würde dann seine Leistungen den ARD-Anstalten voll in Rechnung stellen. Dies könnte für die ARD teurer als bisher werden oder dazu führen, dass weniger historisches Material genutzt wird.
RADIOSZENE: Wie sollte es aus Ihrer Sicht mit dem DRA weitergehen – was wünschen Sie sich für die Zukunft des Hauses? Was wünschen Sie sich von den Verantwortlichen, die derzeit laut über die Zukunft des DRA nachdenken?
Hilker: Die Intendanten haben im Zusammenhang mit den Dreistufentests ihrer Online-Angebote immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig möglichst lange Verweildauern im Internet wären, da das Internet zum medialen Gedächtnis werde. Das DRA ist auch ein mediales Gedächtnis, ja, es ist die Grundlage jeden medialen Gedächtnisses. Es wäre falsch, diesen Speicher auszulagern. Das Geld ist da. Dazu nur ein aktuelles Beispiel. Der SWR hatte für das Jahr 2010 mit Einnahmen von 1,16 Millionen Euro geplant, laut Jahresabschluss hat man 1,21 Millionen Euro eingenommen. Die Ausgaben sind im Plan geblieben. Bisher finanziert der SWR zirka 2 Millionen Euro vom Etat des DRA.
RADIOSZENE: Der Wunsch?
Hilker: Die Intendanten sollten alles so belassen, wie es ist. Das DRA bleibt eine Gemeinschaftseinrichtung. Der Etat wird nicht reduziert, sondern entsprechend den Aufgaben angepasst. Nur so kann man das „mediale Gedächtnis“ erhalten, haben Journalisten, Künstler und Wissenschaftler die Chance, auch in Zukunft zu erfahren, was einer genau gesagt hat, welches Gesicht er dazu gemacht hat und wie seine Stimme dabei geklungen hat. Nur so kann man Legendenbildung verhindern."
Radioszene, 15.6.2011
Zur möglichen Schließung s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/19472003/
Diskussion: Radioforen.de, Thema: "DRA (Deutsches Rundfunkarchiv) vor der Zerschlagung? "
" ...... Heiko Hilker ist ein Mann, der sich mit den Medien im Osten bestens auskennt. Er hat für die Rettung von DT64 demonstriert, war viele Jahre Abgeordneter mit Schwerpunkt Medien im sächsischen Landtag und baut nach seinem Ausstieg aus der Parlamentsarbeit an seinem „Dresdner Institut für Medien, Bildung und Beratung“. Weil das Deutsche Rundfunkarchiv sich derzeit in Sachen eigene Zukunft in Zurückhaltung übt, haben wir ihn gebeten, uns in einigen Sätzen zu erklären, was das Deutsche Rundfunkarchiv ist und worum es bei der Schließungs-Debatte geht. ....
RADIOSZENE: Welche Bedeutung hat das Deutsche Rundfunkarchiv aus Ihrer Sicht für die gesamtdeutsche Medienlandschaft?
Hilker: Das Deutsche Rundfunkarchiv ist in der deutschen Medienlandschaft einmalig. Es gibt keine weitere Einrichtung, die in diesem Umfang Ton- und Bildträger aller Art erfasst hat, die von geschichtlichem, künstlerischem oder wissenschaftlichen Wert sind und in Kunst, Wissenschaft, Forschung und Unterricht genutzt werden können. Das DRA restauriert und sichert audiovisuelle Medien. Zur Langzeitsicherung werden die schriftlichen, audiophonen und audiovisuellen Dokumente auch verfilmt bzw. digitalisiert. Zudem gibt es eine umfangreiche Dokumentation rundfunkgeschichtlich bedeutsamer Tatsachen und Dokumente.
RADIOSZENE: Könnte jemand anderes die zum Teil kostbaren Unikate betreuen, die das DRA pflegt? Das Bundesarchiv?
Hilker: Das hat andere Aufgaben.
RADIOSZENE: Die ARD-Anstalten selbst?
Hilker: Denen mangelt es an Kapazitäten und Fachpersonal. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: „Ein Hörfunkredakteur benötigt Musik aus Lortzings unbekannter Oper „Zum Großadmiral“. Die einzige Aufnahme ist ein Radio-Schellack-Mitschnitt von 1937. Das Original, abermals ein Unikat, liegt in Frankfurt; …. Wer hören will, wie die Stimme Giacomo Puccinis geklungen hat: Per Recherche-Anfrage beim DRA erfährt er es in 30 Sekunden.“ (RP Online, 8.6.2011).
RADIOSZENE: Über dem DRA scheinen derzeit dunkle Kürzungs- oder Privatisierungswolken zu schweben. Aus dem Hause selber war bisher nicht viel zu erfahren. Was wissen Sie über die aktuelle Lage der Einrichtung zu berichten?
Hilker: Seit etwa sieben Jahren ist das Budget des DRA nicht gestiegen. Die ARD möchte jedoch innerhalb ihrer Gemeinschaftseinrichtungen, zu denen das DRA gehört, 15 Prozent sparen. Begründet wird dies mit sinkenden Gebühreneinnahmen. (Allerdings sind die Einnahmen aus der Rundfunkgebühr in den letzten zehn Jahren nur einmal gesunken). Im Jahre 2009 hatte man über 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und so werden verschiedene Varianten bis hin zur Privatisierung geprüft. Demnächst wollen die Intendanten hierzu eine Entscheidung treffen. Der Etat des DRA liegt bei zirka 12 Millionen Euro. Die Gebühreneinnahmen lagen 2009 bei 7,6 Millionen Euro. Die „degeto“ erhält für ihre Spielfilme über 370 Millionen Euro, die „SportA“ hatte 2010 einen Etat von über 300 Millionen Euro. Drei Fußballspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft kosten in etwa so viel wie der Etat des DRA. Es ist fraglich, ob eine Privatisierung des DRA der ARD Kosten spart. Schließlich erstellt das DRA nicht nur für die ARD deren Jahrbuch. Das DRA würde dann seine Leistungen den ARD-Anstalten voll in Rechnung stellen. Dies könnte für die ARD teurer als bisher werden oder dazu führen, dass weniger historisches Material genutzt wird.
RADIOSZENE: Wie sollte es aus Ihrer Sicht mit dem DRA weitergehen – was wünschen Sie sich für die Zukunft des Hauses? Was wünschen Sie sich von den Verantwortlichen, die derzeit laut über die Zukunft des DRA nachdenken?
Hilker: Die Intendanten haben im Zusammenhang mit den Dreistufentests ihrer Online-Angebote immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig möglichst lange Verweildauern im Internet wären, da das Internet zum medialen Gedächtnis werde. Das DRA ist auch ein mediales Gedächtnis, ja, es ist die Grundlage jeden medialen Gedächtnisses. Es wäre falsch, diesen Speicher auszulagern. Das Geld ist da. Dazu nur ein aktuelles Beispiel. Der SWR hatte für das Jahr 2010 mit Einnahmen von 1,16 Millionen Euro geplant, laut Jahresabschluss hat man 1,21 Millionen Euro eingenommen. Die Ausgaben sind im Plan geblieben. Bisher finanziert der SWR zirka 2 Millionen Euro vom Etat des DRA.
RADIOSZENE: Der Wunsch?
Hilker: Die Intendanten sollten alles so belassen, wie es ist. Das DRA bleibt eine Gemeinschaftseinrichtung. Der Etat wird nicht reduziert, sondern entsprechend den Aufgaben angepasst. Nur so kann man das „mediale Gedächtnis“ erhalten, haben Journalisten, Künstler und Wissenschaftler die Chance, auch in Zukunft zu erfahren, was einer genau gesagt hat, welches Gesicht er dazu gemacht hat und wie seine Stimme dabei geklungen hat. Nur so kann man Legendenbildung verhindern."
Radioszene, 15.6.2011
Zur möglichen Schließung s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/19472003/
Diskussion: Radioforen.de, Thema: "DRA (Deutsches Rundfunkarchiv) vor der Zerschlagung? "
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 08:44 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieder einmal verärgert Ben Kaden durch einen schein-nachdenklichen Sermon, der Open Access in Frage stellt:
http://libreas.wordpress.com/2011/06/14/1659/
Die richtigen Worte findet dagegen Ulrich Herb:
http://www.scinoptica.com/pages/posts/information-wissenschaft-praxis-iwp-ab-2012-bei-de-gruyter-die-open-access-flaute-haelt-an-22.php
Traurig ist, und das wird mir nun wieder klar, dass es für den Bereich Informationswissenschaft/ E-Publishing/ Digital Library in Deutschland weder eine wirklich gute Zeitschrift überhaupt und erst recht kein echtes Open Access Journal gibt, zumindest fällt mir aus dem Stand keines ein.
Wenn Bibliothekare und Informationswissenschaftler Open Access unterstützen, aber eine der führenden Fachzeitschriften in den Rachen eines großen kommerziellen Verlags werfen, dann handelt es sich einmal mehr um einen Akt der Heuchelei!
Update:
http://infobib.de/blog/2011/06/15/kommentare-zu-iwpde-gruyter/
http://infobib.de/blog/2011/06/15/iwp-auch-in-zukunft-hinter-schloss-und-riegel/
http://libreas.wordpress.com/2011/06/14/1659/
Die richtigen Worte findet dagegen Ulrich Herb:
http://www.scinoptica.com/pages/posts/information-wissenschaft-praxis-iwp-ab-2012-bei-de-gruyter-die-open-access-flaute-haelt-an-22.php
Traurig ist, und das wird mir nun wieder klar, dass es für den Bereich Informationswissenschaft/ E-Publishing/ Digital Library in Deutschland weder eine wirklich gute Zeitschrift überhaupt und erst recht kein echtes Open Access Journal gibt, zumindest fällt mir aus dem Stand keines ein.
Wenn Bibliothekare und Informationswissenschaftler Open Access unterstützen, aber eine der führenden Fachzeitschriften in den Rachen eines großen kommerziellen Verlags werfen, dann handelt es sich einmal mehr um einen Akt der Heuchelei!
Update:
http://infobib.de/blog/2011/06/15/kommentare-zu-iwpde-gruyter/
http://infobib.de/blog/2011/06/15/iwp-auch-in-zukunft-hinter-schloss-und-riegel/
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Juni 2011, 00:54 - Rubrik: Open Access
"Kein Scherz: Dem EN-Kreis fehlt sozusagen das Gedächtnis. Er ist der einzige Kreis in NRW, der kein eigenes Archiv hat.
Das muss sich jetzt ändern – so wollen es die Vorschriften. „Ein paar Kisten“ mit Zeugen aus der Vergangenheit unserer Heimat liegen im Landesarchiv in Münster, erklärte Fachbereichsleiter Andreas Roters bei der letzte Sitzung des Kreisausschusses für Sport, Freizeit und Kultur.
Welche Schätze sich dort verbergen, weiß eigentlich niemand so genau. Es seien, so versicherte Roters, einige „spannende Sachen dabei“. Zum Beispiel Urkunden und Dokumente aus dem 19. Jahrhundert sollen sich in den Kisten verbergen. Wie viele es sind? Auch das weiß niemand im Schwelmer Kreishaus so genau.
Nun hat sich der Ennepe-Ruhr-Kreis im wahrsten Sinne des Wortes bisher ein Archiv gespart. Das Aufbewahren der Zeitzeugen kostet nämlich das Geld des Steuerzahlers und die kommunalen Kassen sind bekanntlich leer. Und ein Vermögen möchte die Verwaltung auf keinen Fall auf den Tisch legen, um die Geschichte des EN-Kreises zu dokumentieren. Deshalb wurden alle Städte zwischen Breckerfeld und Witten angeschrieben, ob es dort in den Archiven noch ein Plätzchen gebe, wo sich der Kreis mit seinen Papieren niederlassen könne.
„Ennepetal, Hattingen und Wetter haben positiv geantwortet. Mit den drei möglichen Partnern sind wir in Verhandlungen“, sagte Roters. Bis Ende des Jahres will man nun in der Kreisverwaltung eine Entscheidung vorbereiten.
Die Kreispolitiker im Ausschuss mahnten, nicht allzu großzügig zu planen. Schließlich würden in Zukunft keine dicken Aktenordner in die Archive wandern, sondern eher Computer-CDs mit darauf gespeicherten Daten. Und schon war die Diskussion auf den technischen Fortschritt gelenkt worden. Schließlich wisse heute niemand so genau mehr, was auf einer Diskette abgespeichert sei, da das Medium und die entsprechenden Lesegeräte inzwischen der Vergangenheit angehören würden und damit museumsreif sind.
So spannend kann ein Gang ins Archiv sein – auch wenn man eigentlich gar keins besitzt."
Quelle: derwesten.de, 14.6.2011
22 Jahre nach dem Erlass des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes wagen es die Kreispolitiker ernsthaft Sparsamkeit anzumahen, anstelle verschämt zu schweigen. Das fördert archivi(ar)ische Polik(er)verdrossenheit!
Das muss sich jetzt ändern – so wollen es die Vorschriften. „Ein paar Kisten“ mit Zeugen aus der Vergangenheit unserer Heimat liegen im Landesarchiv in Münster, erklärte Fachbereichsleiter Andreas Roters bei der letzte Sitzung des Kreisausschusses für Sport, Freizeit und Kultur.
Welche Schätze sich dort verbergen, weiß eigentlich niemand so genau. Es seien, so versicherte Roters, einige „spannende Sachen dabei“. Zum Beispiel Urkunden und Dokumente aus dem 19. Jahrhundert sollen sich in den Kisten verbergen. Wie viele es sind? Auch das weiß niemand im Schwelmer Kreishaus so genau.
Nun hat sich der Ennepe-Ruhr-Kreis im wahrsten Sinne des Wortes bisher ein Archiv gespart. Das Aufbewahren der Zeitzeugen kostet nämlich das Geld des Steuerzahlers und die kommunalen Kassen sind bekanntlich leer. Und ein Vermögen möchte die Verwaltung auf keinen Fall auf den Tisch legen, um die Geschichte des EN-Kreises zu dokumentieren. Deshalb wurden alle Städte zwischen Breckerfeld und Witten angeschrieben, ob es dort in den Archiven noch ein Plätzchen gebe, wo sich der Kreis mit seinen Papieren niederlassen könne.
„Ennepetal, Hattingen und Wetter haben positiv geantwortet. Mit den drei möglichen Partnern sind wir in Verhandlungen“, sagte Roters. Bis Ende des Jahres will man nun in der Kreisverwaltung eine Entscheidung vorbereiten.
Die Kreispolitiker im Ausschuss mahnten, nicht allzu großzügig zu planen. Schließlich würden in Zukunft keine dicken Aktenordner in die Archive wandern, sondern eher Computer-CDs mit darauf gespeicherten Daten. Und schon war die Diskussion auf den technischen Fortschritt gelenkt worden. Schließlich wisse heute niemand so genau mehr, was auf einer Diskette abgespeichert sei, da das Medium und die entsprechenden Lesegeräte inzwischen der Vergangenheit angehören würden und damit museumsreif sind.
So spannend kann ein Gang ins Archiv sein – auch wenn man eigentlich gar keins besitzt."
Quelle: derwesten.de, 14.6.2011
22 Jahre nach dem Erlass des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes wagen es die Kreispolitiker ernsthaft Sparsamkeit anzumahen, anstelle verschämt zu schweigen. Das fördert archivi(ar)ische Polik(er)verdrossenheit!
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. Juni 2011, 22:08 - Rubrik: Kommunalarchive
"Die UN-Vollversammlung hat den 20. Juni eines jeden Jahres zum zentralen Gedenktag für Flüchtlinge ausgerufen. Einen Tag später wird an der Hochschule Fulda das Archiv der Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration (FFM) eröffnet.
Bei den Dokumenten im FFM-Archiv handelt es sich überwiegend um “graue” Literatur, die in den etablierten Bibliotheken und Instituten nicht zu finden ist, und um Schlüssel- und Hintergrundtexte zur internationalen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Der Bestand umfasst den Zeitraum von den 1980er Jahren bis 2004. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren 1996 bis 2001.
Die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM) gründete sich 1994. Sie recherchierte und veröffentlichte zur Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen sowie zur Abschottungs- und Lagerpolitik an den EU-Außengrenzen. Bezugspunkt für das Archiv der FFM sind die Interessen und Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen und damit einhergehend die kritische Auseinandersetzung mit staatlicher Migrations- und Flüchtlingspolitik. Dabei werden Gründe für Flucht und Migration grundsätzlich respektiert.
Veranstalter:
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
Veranstaltungsort:
Hochschule Fulda, Geb. P, Raum 022
Anfang:
Di, Jun 21, 2011 um 18:00 Uhr
Programm
Eröffnung durch Prof. Dr. Gudrun Hentges,
Prodekanin des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda
Grußworte Berthold Weiß, Stellvertretender Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Hochschule Fulda
Helmut Dietrich, Mitbegründer und Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM)
Lesung Sabrina Freyer, Eine kleine Lesung von Texten aus dem Archiv zur „Kostprobe“
Besichtigung der Räumlichkeiten des Archivs, Gebäude P, Raum -113
...."
Quelle: Hochschule Fulda, Termine
Bei den Dokumenten im FFM-Archiv handelt es sich überwiegend um “graue” Literatur, die in den etablierten Bibliotheken und Instituten nicht zu finden ist, und um Schlüssel- und Hintergrundtexte zur internationalen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Der Bestand umfasst den Zeitraum von den 1980er Jahren bis 2004. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren 1996 bis 2001.
Die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM) gründete sich 1994. Sie recherchierte und veröffentlichte zur Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen sowie zur Abschottungs- und Lagerpolitik an den EU-Außengrenzen. Bezugspunkt für das Archiv der FFM sind die Interessen und Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen und damit einhergehend die kritische Auseinandersetzung mit staatlicher Migrations- und Flüchtlingspolitik. Dabei werden Gründe für Flucht und Migration grundsätzlich respektiert.
Veranstalter:
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
Veranstaltungsort:
Hochschule Fulda, Geb. P, Raum 022
Anfang:
Di, Jun 21, 2011 um 18:00 Uhr
Programm
Eröffnung durch Prof. Dr. Gudrun Hentges,
Prodekanin des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda
Grußworte Berthold Weiß, Stellvertretender Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Hochschule Fulda
Helmut Dietrich, Mitbegründer und Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM)
Lesung Sabrina Freyer, Eine kleine Lesung von Texten aus dem Archiv zur „Kostprobe“
Besichtigung der Räumlichkeiten des Archivs, Gebäude P, Raum -113
...."
Quelle: Hochschule Fulda, Termine
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. Juni 2011, 22:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. Juni 2011, 21:46 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.staatsarchive.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=24802&article_id=85965&_psmand=187
"Die Historische Kommission stellt Ihnen online die Bände des Jahrbuchs ab 2004 zur Verfügung. Die Digitalisierung der früheren Bände der Zeitschrift ist in Angriff genommen. Langfristig sollen alle Bände des Niedersächsischen Jahrbuchs online verfügbar sein. Ausgenommen von der Online-Präsentation muß aus rechtlichen Gründen lediglich der jeweils jüngste im Druck erschienene Band bleiben."
"Die Historische Kommission stellt Ihnen online die Bände des Jahrbuchs ab 2004 zur Verfügung. Die Digitalisierung der früheren Bände der Zeitschrift ist in Angriff genommen. Langfristig sollen alle Bände des Niedersächsischen Jahrbuchs online verfügbar sein. Ausgenommen von der Online-Präsentation muß aus rechtlichen Gründen lediglich der jeweils jüngste im Druck erschienene Band bleiben."
KlausGraf - am Dienstag, 14. Juni 2011, 16:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 14. Juni 2011, 12:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die wichtige Quellenausgabe ist online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-71465
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-71465
KlausGraf - am Dienstag, 14. Juni 2011, 12:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Statistik: Geister-Videos
5 Videos mit insgesamt 683 Aufrufen
Link zu den Videos: http://archiv.twoday.net/search?q=ghost+archives
Einzelstatistik:
Ghost in the archives?: 292 Aufrufe, Dauer: 0:04 min
Ghost in the archives? II : 164 Aufrufe, Dauer: 0:06
Ghost in the archives III: 73 Aufrufe, Dauer: 0:09
Ghost in the archives IV: My little ghost with a file trolley : 83 Aufrufe, Dauer: 0:08
Ghost in the archives V: 71 Aufrufe, Dauer: 0:22
9 Gleitregalanlage mit insgesamt 503 Aufrufen
Link zu den Videos:https://archiv.twoday.net/search?q=gleitregalanlage
Gleitregalanlage I: 86 Aufrufe, 0:32
Gleitregalanlage II: 43 Aufrufe, 0:31
Gleitregalanlage III: 59 Aufrufe, 0:40
Gleitregalanlage IV: 111 Aufrufe, 0:34
Gleitregalanlage V: 53 Aufrufe, 0:37
Gleitregalanlage VI:41 Aufrufe,0:21
Gleitregalanlage VII: 38 Aufrufe, 0:46
Gleitregalanlage VIII: 33 Aufrufe, 0:34
Gleitregalanlage IX: 39 Aufrufe, 0:34
Die Geister haben gewonnen. Warum? Vermutlich, weil:
1) Die Videos waren nicht länger als 22 sec. Je kürzer das Video, desto mehr Klicks.
2) Die Verschlagwortung mit dem Begriff "ghost" dürfte archivferne Internetnutzer zum Klick verleitet haben. Verschlagwortung nutzen!
3) Die Geister-Videos wurden auf Facebook, Twitter und Archivist 2.0 verbreitet. Nutzen diverser Netzwerke!
4) Beschränkung der Serie auf weniger Fortsetzungen (optimaler dürften 3 Fortsetzungen genügen).
5 Videos mit insgesamt 683 Aufrufen
Link zu den Videos: http://archiv.twoday.net/search?q=ghost+archives
Einzelstatistik:
Ghost in the archives?: 292 Aufrufe, Dauer: 0:04 min
Ghost in the archives? II : 164 Aufrufe, Dauer: 0:06
Ghost in the archives III: 73 Aufrufe, Dauer: 0:09
Ghost in the archives IV: My little ghost with a file trolley : 83 Aufrufe, Dauer: 0:08
Ghost in the archives V: 71 Aufrufe, Dauer: 0:22
9 Gleitregalanlage mit insgesamt 503 Aufrufen
Link zu den Videos:https://archiv.twoday.net/search?q=gleitregalanlage
Gleitregalanlage I: 86 Aufrufe, 0:32
Gleitregalanlage II: 43 Aufrufe, 0:31
Gleitregalanlage III: 59 Aufrufe, 0:40
Gleitregalanlage IV: 111 Aufrufe, 0:34
Gleitregalanlage V: 53 Aufrufe, 0:37
Gleitregalanlage VI:41 Aufrufe,0:21
Gleitregalanlage VII: 38 Aufrufe, 0:46
Gleitregalanlage VIII: 33 Aufrufe, 0:34
Gleitregalanlage IX: 39 Aufrufe, 0:34
Die Geister haben gewonnen. Warum? Vermutlich, weil:
1) Die Videos waren nicht länger als 22 sec. Je kürzer das Video, desto mehr Klicks.
2) Die Verschlagwortung mit dem Begriff "ghost" dürfte archivferne Internetnutzer zum Klick verleitet haben. Verschlagwortung nutzen!
3) Die Geister-Videos wurden auf Facebook, Twitter und Archivist 2.0 verbreitet. Nutzen diverser Netzwerke!
4) Beschränkung der Serie auf weniger Fortsetzungen (optimaler dürften 3 Fortsetzungen genügen).
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. Juni 2011, 12:42 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Colin Steele in liblicense-l:
ANU E Press publishes between 50-60 titles
a year, all of its eBooks are available free through its website
and the reader may choose to purchase a Print-On-Demand version
of the book. ANU has over 3 million eBook downloads a year. The
ANU E Press website is at: http://epress.anu.edu.au'
The current top ten is, in terms of downloading. It's been
interesting for the E Press to note the varied geographical
spread of downloads for each title.
ANU E Press Top 10 most popular eBooks in 2010
1.Ethics and Auditing - 93, 627
2.The Islamic Traditions of Cirebon - 77, 400
3.Aboriginal Placenames - 64, 964
4.Aboriginal History 33 - 59, 322
5.Myanmar-the state, community and the environment - 54, 769
6.China: Next Twenty Years of Reform and Development - 49, 105
7.Islamising Indonesia - 43, 502
8.TA 28 - New Directions in Archaeological Science - 41, 676
9.Anomie and Violence - 40, 245
10.Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar - 39, 044
This is not the time to re-engage with Stevan Harnad on OA
monographs, but there is a growing OA monograph trend which the
Australian E Presses continue to promulgate. Given the limited
distribution globally of a print academic monograph, often quoted
sales of 200-300 copies with 200 remainder, then e-OA versions
have an ability (with POD as required) to disseminate scholarly
knowledge much more widely than is currently the case,
particularly where trade "university publishers" increasingly
have to eschew academic content.
ANU E Press publishes between 50-60 titles
a year, all of its eBooks are available free through its website
and the reader may choose to purchase a Print-On-Demand version
of the book. ANU has over 3 million eBook downloads a year. The
ANU E Press website is at: http://epress.anu.edu.au'
The current top ten is, in terms of downloading. It's been
interesting for the E Press to note the varied geographical
spread of downloads for each title.
ANU E Press Top 10 most popular eBooks in 2010
1.Ethics and Auditing - 93, 627
2.The Islamic Traditions of Cirebon - 77, 400
3.Aboriginal Placenames - 64, 964
4.Aboriginal History 33 - 59, 322
5.Myanmar-the state, community and the environment - 54, 769
6.China: Next Twenty Years of Reform and Development - 49, 105
7.Islamising Indonesia - 43, 502
8.TA 28 - New Directions in Archaeological Science - 41, 676
9.Anomie and Violence - 40, 245
10.Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar - 39, 044
This is not the time to re-engage with Stevan Harnad on OA
monographs, but there is a growing OA monograph trend which the
Australian E Presses continue to promulgate. Given the limited
distribution globally of a print academic monograph, often quoted
sales of 200-300 copies with 200 remainder, then e-OA versions
have an ability (with POD as required) to disseminate scholarly
knowledge much more widely than is currently the case,
particularly where trade "university publishers" increasingly
have to eschew academic content.
KlausGraf - am Dienstag, 14. Juni 2011, 00:22 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Verfolgung der Juden während der NS-Zeit. Stand und Perspektiven der Dokumentation, der Vermittlung und der Erinnerung. Hrsg. von Andreas Hedwig / Reinhard Neebe / Annegret Wenz-Haubfleisch (= Schriften des hessischen Staatsarchivs Marburg; Bd. 24), Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2011, 311 S., ISBN 978-3-88964-205-9, EUR 28,00
Der Sammelband widmet sich der Judenverfolgung vornehmlich aus hessischer Perspektive. Er ist der Begleitband der "Programnacht"-Ausstellung des Staatsarchivs Marburg aus dem Jahr 2008 und dokumentiert zugleich das Kolloquium vom 23./24. April 2009. Wer den vom einleitenden Beitrag von Peter Steinbach eine Einführung in den Forschungsstand erwartet, wird enttäuscht. Er hat vielmehr ein sehr spezielles Thema, denn es geht ihm um einen 1930 in den nationalsozialistischen Monatsheften 1930 erschienenen Artikel von Gerhard Ludwig Binz (Scan), dem der Autor große programmatische Bedeutung beimisst. Es folgt ein bunter Strauß von Projektvorstellungen, organisiert in den Sektionen "Zeugnisse jüdischen Lebens" (z.B. Friedhofs-Dokumentation, Unterlagen des ITS Arolsen), "Perspektiven in der schulischen und ausserschulischen Bildung" (vor allem Schulprojekte), "Niemals vergessen - Gedenken und Erinnern" (z.B. Stolperstein-Projekt, Holocaust-Denkmal). Etwas aus dem Rahmen fallen die subjektiven Reflexionen von Eveline Goodman Thau: Vom Archiv zur Arche - Zur Frage des eigenen Erinnerns zum 70. jahrestag der "Reichskristallnacht" und dem 60-jährigen Bestehen des Staates Israel. Am Schluss des Bandes werden die Exponate der Archivausstellung fotografisch vorgestellt.
Dass der Band nicht zugleich auch online vorliegt, ist bedauerlich, zumal er in der Flut der Veröffentlichungen zum Thema eigenes Profil vermissen lässt und er daher nicht guten Gewissens zur Anschaffung empfohlen werden kann. Inzwischen sollte klar sein, dass nicht mehr alles an archivischer Öffentlichkeitsarbeit zwischen zwei Buchdeckeln untergebracht werden muss.
Die sehenswerte Online-Version der Ausstellung:
http://pdf.digam.net/?str=246
Inhaltsverzeichnis des Bandes (PDF)
http://d-nb.info/1009818767/04

Der Sammelband widmet sich der Judenverfolgung vornehmlich aus hessischer Perspektive. Er ist der Begleitband der "Programnacht"-Ausstellung des Staatsarchivs Marburg aus dem Jahr 2008 und dokumentiert zugleich das Kolloquium vom 23./24. April 2009. Wer den vom einleitenden Beitrag von Peter Steinbach eine Einführung in den Forschungsstand erwartet, wird enttäuscht. Er hat vielmehr ein sehr spezielles Thema, denn es geht ihm um einen 1930 in den nationalsozialistischen Monatsheften 1930 erschienenen Artikel von Gerhard Ludwig Binz (Scan), dem der Autor große programmatische Bedeutung beimisst. Es folgt ein bunter Strauß von Projektvorstellungen, organisiert in den Sektionen "Zeugnisse jüdischen Lebens" (z.B. Friedhofs-Dokumentation, Unterlagen des ITS Arolsen), "Perspektiven in der schulischen und ausserschulischen Bildung" (vor allem Schulprojekte), "Niemals vergessen - Gedenken und Erinnern" (z.B. Stolperstein-Projekt, Holocaust-Denkmal). Etwas aus dem Rahmen fallen die subjektiven Reflexionen von Eveline Goodman Thau: Vom Archiv zur Arche - Zur Frage des eigenen Erinnerns zum 70. jahrestag der "Reichskristallnacht" und dem 60-jährigen Bestehen des Staates Israel. Am Schluss des Bandes werden die Exponate der Archivausstellung fotografisch vorgestellt.
Dass der Band nicht zugleich auch online vorliegt, ist bedauerlich, zumal er in der Flut der Veröffentlichungen zum Thema eigenes Profil vermissen lässt und er daher nicht guten Gewissens zur Anschaffung empfohlen werden kann. Inzwischen sollte klar sein, dass nicht mehr alles an archivischer Öffentlichkeitsarbeit zwischen zwei Buchdeckeln untergebracht werden muss.
Die sehenswerte Online-Version der Ausstellung:
http://pdf.digam.net/?str=246
Inhaltsverzeichnis des Bandes (PDF)
http://d-nb.info/1009818767/04

KlausGraf - am Montag, 13. Juni 2011, 23:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Villerscollege
En zijn bestanden
Lezers en hun topstukken
En zijn bestanden
Lezers en hun topstukken
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 21:46 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam denkt nach erfolgreicher Akkreditierung seiner Bachelor- und Master-Studiengänge bereits jetzt über die langfristige inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung und die weitere berufsfeldorientierte Profilierung seines Studienangebotes nach. ...."
Link zum Volltext auf der Newsseite des Potsdamer Fachbereichs
Link zum Volltext auf der Newsseite des Potsdamer Fachbereichs
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 19:07 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Anlässlich des Einführungsseminars für den 46. Wissenschaftlichen Kurs an der Archivschule Marburg hat der seit Mai 2011 amtierende Präsident des Bundes-archivs, Dr. Michael Hollmann, am 6. Juni einen Vortrag über ‚Die digitale Herausforderung der Archive‘ gehalten. Er zeigte am Beispiel des Bundesarchivs in welchen Fachbereichen digitale Medien die archivischen Aufgaben strukturell verändern. Die Präsentation von Informationen im Internet sowie die Übernahme digitaler Unterlagen hat er als die beiden wichtigsten Aufgabenkomplexe herausgearbeitet. Ersteres bedeutet unter anderem Online-Findmittel zu erarbeiten und bereitzustellen. Hollmann wies darauf hin, dass Datenbanken grundsätzlich den Vorrang vor XML-files haben sollten, weil in sie leichter Veränderungen eingearbeitet werden können. Er präsentierte des Weiteren die Online-Edition der Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, die durch die Darstellung in einer html-Struktur und die Verlinkung von Fußnoten Möglichkeiten der Einarbeitung von neuen Erkenntnissen bieten, die eine gedruckte Edition nicht leisten kann.
Im zweiten Teil seines Referats ging Hollmann auf die Realisierung eines digitalen Archivs im Bundesarchiv ein. Ausgelöst wurde die Diskussion schon vor zwanzig Jahren durch die Übernahme von digitalen Daten aus der DDR, die wieder lesbar gemacht und dann digital archiviert wurden. Das Bundearchiv arbeitet neben dem Aufbau eines digitalen Archivs an einem digitalen Zwischenarchiv als Service für die obersten Bundesbehörden und kann eine verstärkte Nachfrage nach seinen Beratungsangeboten in der Bundesverwaltung als positiven Effekt verbuchen.
Insgesamt bot Hollmann einen weitgreifenden und interessanten Einblick in den Umgang des Bundesarchivs mit der digitalen Herausforderung. Er machte aber auch deutlich, dass die Vertretung archivischer Belange in diesem neuen Aufgabengebiet der Verwaltung einen langen Atem und viel Überzeugungskraft erfordert."
Quelle: Archivschule Marburg
Im zweiten Teil seines Referats ging Hollmann auf die Realisierung eines digitalen Archivs im Bundesarchiv ein. Ausgelöst wurde die Diskussion schon vor zwanzig Jahren durch die Übernahme von digitalen Daten aus der DDR, die wieder lesbar gemacht und dann digital archiviert wurden. Das Bundearchiv arbeitet neben dem Aufbau eines digitalen Archivs an einem digitalen Zwischenarchiv als Service für die obersten Bundesbehörden und kann eine verstärkte Nachfrage nach seinen Beratungsangeboten in der Bundesverwaltung als positiven Effekt verbuchen.
Insgesamt bot Hollmann einen weitgreifenden und interessanten Einblick in den Umgang des Bundesarchivs mit der digitalen Herausforderung. Er machte aber auch deutlich, dass die Vertretung archivischer Belange in diesem neuen Aufgabengebiet der Verwaltung einen langen Atem und viel Überzeugungskraft erfordert."
Quelle: Archivschule Marburg
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 19:01 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Asia Art Archive Fundraiser Video 2010- AAA Turns 10 from asiaartarchive on Vimeo.
"Asia Art Archive (AAA) is a young and dynamic organization initiated in 2000 as a direct response to the increasing number of Asian contemporary art exhibitions and events worldwide. A non-profit organisation and registered charity, AAA is dedicated to documenting the recent history of visual art from the region within an international context. The first art education centre and library of its kind, AAA boasts one of the most comprehensive collections of primary and secondary source material on contemporary Asian art in the world. More than a static collection of material, AAA also actively organizes exciting programmes. "Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 15:01 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 14:44 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2011/06/book-review-wilkin-on-orphan-works.html
Eine unbedingt lesenswerte Besprechung der Studie von Wilkin anhand von HathiTrust durch Peter Hirtle. " It is pretty clear to me that Hathi has started building the Digital Public Library of America that others are talking about."
PDF der Studie:
http://www.clir.org/pubs/ruminations/01wilkin/wilkin.pdf
Eine unbedingt lesenswerte Besprechung der Studie von Wilkin anhand von HathiTrust durch Peter Hirtle. " It is pretty clear to me that Hathi has started building the Digital Public Library of America that others are talking about."
PDF der Studie:
http://www.clir.org/pubs/ruminations/01wilkin/wilkin.pdf
KlausGraf - am Montag, 13. Juni 2011, 13:55 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Anleitung (bei der leider das Produkt sowohl richtig Tesseract als auch falsch Tessaract heißt):
http://www.finanzer.org/blog/index.php/2011/06/12/fraktur-ocr-mit-tessaract/
http://www.finanzer.org/blog/index.php/2011/06/12/fraktur-ocr-mit-tessaract/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Theatermuseum Düsseldorf sammelt, archiviert und vermittelt deutsche Theatergeschichte am Beispiel der Stadt und der Region (hier: Nordrhein-Westfalen). Ein essentieller Punkt ist in diesem Zusammenhang die Kooperation: die Bibliothek weist ihre Bestände im Gesamtkatalogs der Düsseldorfer Kulturinstitute (GDK) nach sowie im Bereich des Sammlungsmanagements. D:kult ist ein Gemeinschaftsprojekt, das auf Initiative der Düsseldorfer Kulturinstitute ins Leben gerufen wurde, und die gemeinsame Inventarisierung und Verwaltung der Objekte zum Ziel hat, die sich in der Obhut dieser Einrichtungen befinden. Für den Bereich Theater werden Inszenierungen dokumentiert sowie die sich inhaltlich darauf beziehenden Dokumente und Materialien (Theaterzettel, Theaterprogramme, Plakate, Kostüme, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Bühnenbildmodelle, Fotos, Textbücher usw.) sowie weitere Materialien und Objekte, die einen Theaterbezug haben, und Veranstaltungen (wie z.B. Ausstellungen). Standards und Normen aus dem Bibliotheks- und Museumsbereich werden bei der Erfassung berücksichtigt und machen es möglich, einen Teil der Informationen nicht nur lokal über eine Webpräsentation (d:kult online) zu präsentieren sondern darüber hinaus an Portale, wie z.B. BAM, Athena, Europeana, weiterzugeben.
Ziel der Initiative und der Teilnahme ist es, die Qualität und Effizienz der Arbeit in den beteiligten Museen im Bereich des Sammlungsmanagements zu erhöhen und transparenter zu machen: Es besteht die Möglichkeit, auch Arbeitsbereiche und -ergebnisse sichtbar zu machen, die normalerweise eher im Verborgenen bleiben (z.B. Erschließungsprojekte) und damit auch hier einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. "
Quelle: BIB-OPUS
Link zum Vortrag auf dem diesjährigen Biblthekarstag (PDF)
Ziel der Initiative und der Teilnahme ist es, die Qualität und Effizienz der Arbeit in den beteiligten Museen im Bereich des Sammlungsmanagements zu erhöhen und transparenter zu machen: Es besteht die Möglichkeit, auch Arbeitsbereiche und -ergebnisse sichtbar zu machen, die normalerweise eher im Verborgenen bleiben (z.B. Erschließungsprojekte) und damit auch hier einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. "
Quelle: BIB-OPUS
Link zum Vortrag auf dem diesjährigen Biblthekarstag (PDF)
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 13:48 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 13:41 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die von den Klägern vorgeschlagene Anordnung im Fall der Klage gegen die Georgia State University wegen E-Reserves wird überwiegend kritisch kommentiert:
http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2011/06/12/recent-commentary-about-the-georgia-state-e-reserves-copyright-case-cambridge-university-press-et-al-v-patton-et-al/
http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2011/06/12/recent-commentary-about-the-georgia-state-e-reserves-copyright-case-cambridge-university-press-et-al-v-patton-et-al/
KlausGraf - am Montag, 13. Juni 2011, 13:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zur Diaschau mit engl. Untertiteln
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 13:26 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Bad Kreuznacher Stadtarchiv ist ein unscheinbares, zweistöckiges Haus, das unglaublich viele Informationen bereithält
schreibt Jenny Hoffmann, Schülerin der Jahrgangsstufe 12 des Lina-Hilger-Gymnasiums in ihrem Erfahrungsbericht.
Gemeinsam mit 17 Mitschülerinnen und Mitschülern recherchierte sie im Stadtarchiv über die Geschichte des Bad Kreuznacher Jahrmarktes.
Ihr Fazit:
Meine Meinung nach sollte eine Führung durch das Stadtarchiv im Geschichtsunterricht eingeplant werden, da die Schüler durch das eigenständige Arbeiten mit alten Materialien nicht nur einen besseren Einblick bekommen, sondern auch persönliche Erfahrungen sammeln können.
Für sie ist es außerdem:
spannend, sich mit der Geschichte der Heimatstadt zu beschäftigen, vor allem weil man den direkten Bezug zu dem Geschehen hat, da man sich selbst mit der Geschichte identifizieren kann.
Viel Lob gab es auch für die »herzliche Begrüßung und kompetente Führung« durch die Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann
Da freut sich natürlich die Stadtarchivarin:
Die jungen Leute haben über Stunden sehr interessiert und konzentriert gearbeitet. Unsere Schautafeln zur Geschichte des Bad Kreuznacher Jahrmarkt eignen sich idealerweise für den Unterricht.
Sie verweist darauf, dass das Archiv für alle Schulen offen ist für Forschungszwecke bzw. Unterrichtsprojektet.
Das sehen wir auch als eine unserer wesentlichen Aufgaben an.
Bei diesem Schulprojekt werden die Jugendlichen von Eike-Frederic Zern, seit zwei Jahren Referendar am Lina-Hilger-Gymnasium, betreut. Für einen Besuch im Stadtarchiv konnte er die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema »Reichsgründung 1871″ gewinnen, als es um die Rolle von Reichskanzler Bismarck ging.
Zern stellte dabei den Bezug zu Bad Kreuznach her, da Bismark der erste Ehrenbürger unserer Stadt ist.
Zum Beleg brachte ich eine Farbkopie der entsprechenden Akte mit, deren Alter und Aussehen die Schüler sichtlich begeisterte.
Mit dem Besuch im Stadtarchiv verfolgte Zern zwei Ziele: Neben der grundsätzlichen Einführung in Arbeit und Funktion eines Archivs, sollte Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass sich die große Geschichte nicht nur über unseren Köpfen abspielt, sondern dass wir ihre Spuren in unserer unmittelbaren Lebenswirklichkeit vorfinden können.
Gerade Bad Kreuznach halte hier einige Entdeckungen bereit, denen es sich nachzugehen lohne
so Zern weiter.
So wurde den Schülern anhand der Entwicklung des Jahrmarktes plastisch die historische Gewachsenheit solcher in der Regel als selbstverständlich hingenommenen Institutionen vor Augen geführt.
Die Schülerinnen und Schüler fanden heraus, dass der einstige Viehmarkt ein gutes Beispiel für den Messecharakter ist und der Jahrmarkt sich im Laufe der der Zeit »zu einem reinen Vergnügungsort entwickelte«. Dazu gehörten bis in die 60er-Jahre auch die Liliputaner-Schauen, was:
Befremdlich für unser heutiges Verständnis von Unterhaltung sind sicherlich die Kuriositätenkabinette, in denen körperliche Anomalien von Menschen zum Zwecke der Volksbelustigung ausgestellt wurden
stellt die Schülerin in ihrem Erfahrungsbericht fest.
Essen und Trinken, die Entwicklung der Pfingstwiese, Attraktionen und Fahrgeschäfte und der Jahrmarkt als Wirtschaftsfaktor waren die Themenschwerpunkte. Nach dieser Erarbeitung wurden die Ergebnisse auf Plakaten festgehalten und den anderen Gruppen präsentiert."
Quelle: Infotext & Foto von Stadtverwaltung Bad Kreuznach via kreuznach-blog.de, 9.6.11
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 13:20 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zum Artikel
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 13:16 - Rubrik: Wikis
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 12:57 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: Kanton Bern, Medienmitteilung
"Die Historikerin Barbara Studer Immenhauser ist vom bernischen Regierungsrat zur neuen Staatsarchivarin des Kantons Bern ernannt worden. Damit wird erstmals in der Geschichte des Kantons eine Frau das Staatsarchiv leiten.
Korrektur-Hinweis
Die 1972 geborene Studer Immenhauser wird laut einer Mitteilung des Regierungsrats die Nachfolge von Peter Martig antreten, der Ende April 2012 in Pension geht. Die neue Staatsarchivarin, die in Wohlen lebt und derzeit im Jobsharing als Stellvertreterin des Staatsarchivars arbeitet, wird ein Team von rund 20 Personen führen."
Quelle: Der Bund, 9.6.2011
".... Barbara Studer arbeitet seit 2005 im Jobsharing als Stellvertreterin des Staatsarchivars im Staatsarchiv des Kantons Bern. Im gleichen Jahr wurde sie von der Universität Bern mit einer Dissertation zum Thema «Verwaltung zwischen Innovation und Tradition. Die Stadt Bern und ihr Untertanengebiet 1250 - 1550» promoviert. Sie ist als Präsidentin des Bildungsausschusses des Vereins Schweizer Archivar/innen national breit vernetzt. Barbara Studer Immenhauser ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern ...."
Quelle: Kanton Bern, Kurzinformation aus dem Regierungsrat (09.06.2011)
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 12:05 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 13. Juni 2011, 11:04 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heimatliebe gebeut den folgenden Link:
http://www.panoblog.de/krpanos/?p=Muenster_001
Siehe auch
http://panoblog.de/?p=222
http://www.panoblog.de/krpanos/?p=Muenster_001
Siehe auch
http://panoblog.de/?p=222
KlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 19:12 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html
Unter anderem von Carl Curman
http://commons.wikimedia.org/wiki/Carl_Curman
 Bad Harzburg
Bad Harzburg
Unter anderem von Carl Curman
http://commons.wikimedia.org/wiki/Carl_Curman
 Bad Harzburg
Bad HarzburgKlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 18:41 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ist meine Meinung.
http://taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/jugendlicher-als-wissenswaechter/ (Bartz)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Adminkandidaturen/Umweltsch%C3%BCtzen
http://taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/jugendlicher-als-wissenswaechter/ (Bartz)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Adminkandidaturen/Umweltsch%C3%BCtzen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Seit in Schweden 1991 das Antikengesetz verschärft wurde, wurde nun erstmals eine Gefängnisstrafe verhängt. Drei Raubgräber, die 2009 auf einem Feld bei Gandarve auf Gotland (Schweden) einen wikingerzeitlichen Silberschatz ausgegraben hatten, wurden zu einem Jahr Haft verurteilt."
Ein drakonisches, völlig überzogenes Urteil, bedenkt man, wie milde Buchdiebe in Bibliotheken in der Regel davonkommen. Archäologische Funde sind nicht wertvoller als hochrangige Buchensembles, die überall auf der Welt m.W. strafffrei zerstückelt werden dürfen! Das Strafrecht ist nicht das geeignete Mittel, Konflikte zwischen Denkmalpflege und Raubgräbern zu lösen.
http://archaeologik.blogspot.com/2011/06/erstmals-in-schweden-raubgraber-zu.html
Ein drakonisches, völlig überzogenes Urteil, bedenkt man, wie milde Buchdiebe in Bibliotheken in der Regel davonkommen. Archäologische Funde sind nicht wertvoller als hochrangige Buchensembles, die überall auf der Welt m.W. strafffrei zerstückelt werden dürfen! Das Strafrecht ist nicht das geeignete Mittel, Konflikte zwischen Denkmalpflege und Raubgräbern zu lösen.
http://archaeologik.blogspot.com/2011/06/erstmals-in-schweden-raubgraber-zu.html
Durch die Ehec-Fälle ist das vom Bund getragene Robert-Koch-Institut wieder einmal in den Focus der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten. Das Institut unterstützt Open Access und hat die Berliner Erklärung unterzeichnet. Es unterhält als einzige Bundeseinrichtung einen Open-Access-Schriftenserver.
Im Januar 2011 wurde eine Vereinbarung mit Elsevier bekannt gegeben: "they have entered into a two-year trial agreement enabling researchers at Robert Koch Institute to systematically post their manuscripts in the institutional repository." Dies ist einigermaßen rätselhaft, denn Wissenschaftler dürfen in der Regel ihre Arbeiten gemäß Elseviers Policy in Repositorien unterbringen. Eine Suche in http://edoc.rki.de fördert zu elsevier keinen einzigen Treffer zutage, die Wissenschaftler des Instituts publizieren in PLoS One oder Zeitschriften von BioMedCentral.
Wenn es heißt "Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Robert Koch-Institutes untersagt." ist das ganz und gar unbeachtlich, da die CC-BY-Lizenz, die eine kommerzielle Nutzung einschließt, die Nutzung des Dokuments abschließend umschreibt - einschränkende Nebenbedingungen sind vom Wortlaut der CC-Lizenz nicht erlaubt. Ob die Formulierung abmahnfähig ist, ist zweifelhaft, da der Geltungsbereich des UWG wohl nicht eröffnet ist. Als AGB wäre die Klausel nicht wirksam einbezogen.
Wer Open Access unterstützt, sollte die von der Berliner Erklärung vorgesehene kommerzielle Nutzung nicht verbieten- gerade auch in der medizinischen Forschung, die ja auch von kommerziellen Unternehmen getragen wird. Alles andere ist Doppelmoral.
Im Januar 2011 wurde eine Vereinbarung mit Elsevier bekannt gegeben: "they have entered into a two-year trial agreement enabling researchers at Robert Koch Institute to systematically post their manuscripts in the institutional repository." Dies ist einigermaßen rätselhaft, denn Wissenschaftler dürfen in der Regel ihre Arbeiten gemäß Elseviers Policy in Repositorien unterbringen. Eine Suche in http://edoc.rki.de fördert zu elsevier keinen einzigen Treffer zutage, die Wissenschaftler des Instituts publizieren in PLoS One oder Zeitschriften von BioMedCentral.
Wenn es heißt "Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Robert Koch-Institutes untersagt." ist das ganz und gar unbeachtlich, da die CC-BY-Lizenz, die eine kommerzielle Nutzung einschließt, die Nutzung des Dokuments abschließend umschreibt - einschränkende Nebenbedingungen sind vom Wortlaut der CC-Lizenz nicht erlaubt. Ob die Formulierung abmahnfähig ist, ist zweifelhaft, da der Geltungsbereich des UWG wohl nicht eröffnet ist. Als AGB wäre die Klausel nicht wirksam einbezogen.
Wer Open Access unterstützt, sollte die von der Berliner Erklärung vorgesehene kommerzielle Nutzung nicht verbieten- gerade auch in der medizinischen Forschung, die ja auch von kommerziellen Unternehmen getragen wird. Alles andere ist Doppelmoral.
KlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 17:29 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die maßgebliche Zusammenstellung zu Open-Access-Links
http://www.connotea.org/tag/oa.elsevier
gibt leider keinen hinreichenden Überblick über die Debatte zu Elseviers Open-Access-Policy. Zuletzt empörte sich ein schwedisches Open-Access-Kommitee:
http://www.kb.se/OpenAccess_english/OA-News/Statement-about-Elseviers--new-policy-concerning-authors-rights-to-self-archive-articles/
Nicht berücksichtigt bei oa.elsevier auf Connotea ist die Stellungnahme der niederländischen Bibliotheken vom Mai 2011:
http://www.ukb.nl/English/028_2011_UKBStatementElsevier.pdf
Im Januar 2011 gab es die Stellungnahme Harnads:
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/786-guid.html
Dass Elsevier keine Einstellung des Verlags-Pdf erlaubt, beklagte (zu Recht) ebenfalls im Januar 2011
http://openbiomed.info/2011/01/elsevier-is-pale-green/
Mit dem Kommentar: "There is no need for the publisher’s proprietry version-of0record to be openly accessible." erwies sich Harnad einmal mehr als Open-Access-Schädling.
Zur Elsevier-Policy von 2004:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/07-02-04.htm#elsevier
Elsevier ist der größte Verleger wissenschaftlicher Zeitschriften. Elseviers Policy ist für deutsche Autoren nur dann relevant, wenn es eine eindeutige, § 38 UrhG aushebelnde vertragliche Vereinbarung gibt. Ist das nicht der Fall, kann auch Elseviers PDF verwendet werden.
http://www.connotea.org/tag/oa.elsevier
gibt leider keinen hinreichenden Überblick über die Debatte zu Elseviers Open-Access-Policy. Zuletzt empörte sich ein schwedisches Open-Access-Kommitee:
http://www.kb.se/OpenAccess_english/OA-News/Statement-about-Elseviers--new-policy-concerning-authors-rights-to-self-archive-articles/
Nicht berücksichtigt bei oa.elsevier auf Connotea ist die Stellungnahme der niederländischen Bibliotheken vom Mai 2011:
http://www.ukb.nl/English/028_2011_UKBStatementElsevier.pdf
Im Januar 2011 gab es die Stellungnahme Harnads:
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/786-guid.html
Dass Elsevier keine Einstellung des Verlags-Pdf erlaubt, beklagte (zu Recht) ebenfalls im Januar 2011
http://openbiomed.info/2011/01/elsevier-is-pale-green/
Mit dem Kommentar: "There is no need for the publisher’s proprietry version-of0record to be openly accessible." erwies sich Harnad einmal mehr als Open-Access-Schädling.
Zur Elsevier-Policy von 2004:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/07-02-04.htm#elsevier
Elsevier ist der größte Verleger wissenschaftlicher Zeitschriften. Elseviers Policy ist für deutsche Autoren nur dann relevant, wenn es eine eindeutige, § 38 UrhG aushebelnde vertragliche Vereinbarung gibt. Ist das nicht der Fall, kann auch Elseviers PDF verwendet werden.
KlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 16:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Egler, Louis: Aus der Vorzeit Hohenzollerns (1861)
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10018441-1
sieht man keine Einzelseiten, lädt man das PDF stellt man fest, dass ab S. 150 nur eine Auswahl von Seiten gescannt wurde. Im übrigen wurde der Fehler der Seitenanzeige am 23. April 2011 der BSB gemeldet, die am 3. Mai den Eingang bestätigte. Getan hat sich nichts.
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10018441-1
sieht man keine Einzelseiten, lädt man das PDF stellt man fest, dass ab S. 150 nur eine Auswahl von Seiten gescannt wurde. Im übrigen wurde der Fehler der Seitenanzeige am 23. April 2011 der BSB gemeldet, die am 3. Mai den Eingang bestätigte. Getan hat sich nichts.
KlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 14:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egler_Fuehrer_durch_Hechingen_und_die_Burg_Hohenzollern.pdf
Zu Egler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Egler
http://de.wikisource.org/wiki/Ludwig_Egler
Schöne Pfingsten!

Zu Egler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Egler
http://de.wikisource.org/wiki/Ludwig_Egler
Schöne Pfingsten!

KlausGraf - am Sonntag, 12. Juni 2011, 14:33 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Stadtarchiv Braunschweig hat seine Findbuchdatenbank - denkbar benutzerunfreundlich - bei AUGIAS ins Netz gestellt. Die Navigation in den Listen ist eher gewohnungsbedürftig.
http://www.stadtarchiv-braunschweig.findbuch.net
Unter den neueren Handschriften finden sich auch zahlreiche Abschriften des Erforschers des Niederdeutschen Karl F. A. Scheller (1743-1843)
Zu ihm
http://nds.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Arend_Scheller
Im Handschriftencensus fehlt:
Signatur: H VI 10: 7
Laufzeit im Findbuch: 14./15. Jahrhundert
Titel: Rezepte, in niederdeutscher Mundart, Handschrift aus dem 14./15. Jahrhundert
Alt-Signatur: I 434
http://www.stadtarchiv-braunschweig.findbuch.net
Unter den neueren Handschriften finden sich auch zahlreiche Abschriften des Erforschers des Niederdeutschen Karl F. A. Scheller (1743-1843)
Zu ihm
http://nds.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Arend_Scheller
Im Handschriftencensus fehlt:
Signatur: H VI 10: 7
Laufzeit im Findbuch: 14./15. Jahrhundert
Titel: Rezepte, in niederdeutscher Mundart, Handschrift aus dem 14./15. Jahrhundert
Alt-Signatur: I 434
KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 15:34 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem ich lange zeit vergeblich nach den Inhalten des Katalogs der illustrierten Handschriften gesucht und nur E-Texte ohne Abbildungen (z.B. http://www.manuscripta-mediaevalia.de/obj32321840.html ) gefunden hatte, brachte nun ein Link im Handschriftencensus die gewünschten Aufschlüsse:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0620c.html
Verlinkbar sind die einzelnen Beschreibungen nicht, da anders als sonst kein Permalink für die einzelnen Seiten/Handschriften zur Verfügung steht, sondern nur der obige für den gesamten Band!
Die Abbildungen sind unvollständig gescannt, es fehlt z.B. Abbildung 117, die nach
http://www.handschriftencensus.de/8822
existiert! Da die Handschriftensignaturen bei den Abbildungen nicht angegeben sind, muss man erst einmal herausfinden, wo welche Abbildung steht.
Ob jeder, der mit dem alten supermiesen alten ManuMed gearbeitet hat, sich dieses zurückwünscht, weiß ich nicht. Das neue ManuMed ist nicht nur langsamer, es ist auch noch viel mieser, da es Inhalte versteckt.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0620c.html
Verlinkbar sind die einzelnen Beschreibungen nicht, da anders als sonst kein Permalink für die einzelnen Seiten/Handschriften zur Verfügung steht, sondern nur der obige für den gesamten Band!
Die Abbildungen sind unvollständig gescannt, es fehlt z.B. Abbildung 117, die nach
http://www.handschriftencensus.de/8822
existiert! Da die Handschriftensignaturen bei den Abbildungen nicht angegeben sind, muss man erst einmal herausfinden, wo welche Abbildung steht.
Ob jeder, der mit dem alten supermiesen alten ManuMed gearbeitet hat, sich dieses zurückwünscht, weiß ich nicht. Das neue ManuMed ist nicht nur langsamer, es ist auch noch viel mieser, da es Inhalte versteckt.
KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 15:12 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ak-zensur.de/download/Stellungnahme-AK-Zensur--15-RAeStV.pdf
Via
http://www.internet-law.de/2011/06/ak-zensur-nimmt-zum-depublizieren-stellung.html
Via
http://www.internet-law.de/2011/06/ak-zensur-nimmt-zum-depublizieren-stellung.html
KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 14:15 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.faz.net/-01x4xg
Der Bundesstaat Alaska hat 24.000 E-Mails veröffentlicht, die Sarah Palin in ihrer Zeit als Gouverneurin geschrieben hat. Die Freigabe der Mails wurde 2008 von mehreren Medien beantragt. Im Internet sind die überwiegend banalen Dokumente einsehbar. [...] MSNBC bietet auf seiner Internetseite die Möglichkeit, die Mails nach Schlagworten zu durchsuchen. Der Bundesstaat Alaska hatte am Freitag 24.000 E-Mails aus ihrer Zeit als Gouverneurin veröffentlicht - allerdings in gedruckter Form. Wie MSNBC berichtete, wurden für die Online-Suche deshalb Tausende Seiten binnen weniger Stunden eingescannt.
http://palinemail.msnbc.msn.com/palinAll/search.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,768044,00.html
Der Bundesstaat Alaska hat 24.000 E-Mails veröffentlicht, die Sarah Palin in ihrer Zeit als Gouverneurin geschrieben hat. Die Freigabe der Mails wurde 2008 von mehreren Medien beantragt. Im Internet sind die überwiegend banalen Dokumente einsehbar. [...] MSNBC bietet auf seiner Internetseite die Möglichkeit, die Mails nach Schlagworten zu durchsuchen. Der Bundesstaat Alaska hatte am Freitag 24.000 E-Mails aus ihrer Zeit als Gouverneurin veröffentlicht - allerdings in gedruckter Form. Wie MSNBC berichtete, wurden für die Online-Suche deshalb Tausende Seiten binnen weniger Stunden eingescannt.
http://palinemail.msnbc.msn.com/palinAll/search.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,768044,00.html
KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 14:01 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 01:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://newspapermap.com/
Via
http://schmalenstroer.net/blog/2011/06/zeitungen-weltweit-mit-newspapermap-com-anschauen/

Via
http://schmalenstroer.net/blog/2011/06/zeitungen-weltweit-mit-newspapermap-com-anschauen/

KlausGraf - am Samstag, 11. Juni 2011, 01:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken


