Der Handwerkerliterat Hans Wertmann (auch Wortmann, Frank, Glaser) lebte als Glaser in Schwäbisch Hall, wo er von 1508 bis zu seinem Tod 1527/28 bezeugt ist. Er verfasste drei Reimpaarsprüche: einen Spruch auf den Feldzug Herzog Ulrichs von Württemberg im Landshuter Erbfolgekrieg 1504, den ältesten bekannten Pritschenmeisterspruch auf das Augsburger Schießen 1509 und einen Spruch auf den Bauernkrieg 1525.
1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].
2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.
Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.
"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.
Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.
3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504
Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].
Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.
A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176
Digitalisat des Münchner Exemplars:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5
B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174
Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.
[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]
Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].
[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175
C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)
D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]
Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.
Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.
Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.
Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.
Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.
4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509
Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .
Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]
Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von
Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die
schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb
dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain
wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen
nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain
klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden
daran gemalet, und ain pritschen." [16]
5. Bauernkrieg reimenweis, 1525
Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]
In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".
Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.
Hinweis:
http://d-nb.info/gnd/100489362
http://d-nb.info/gnd/1012266486
beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.
ANMERKUNGEN
[1] http://www.libreka.de/9783110087789/35
[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12
[3] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/
[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347
[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]
[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg
[6] http://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31
[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72
[8] http://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522
[9] http://www.handschriftencensus.de/5499
[10] http://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)
[11] http://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93
[12] Zu dem Feldzug siehe etwa
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf
[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62
http://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up
[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563
http://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]
Zum Amt des Pritschenmeisters: http://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister
[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm
[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]
[August 2014: Die Handschrift ist online:
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]
[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104
http://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)
[ http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]
[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3
http://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up
Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:
http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15
[17] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg
[18] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/
[Wertmanns GND:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]
#forschung
#fnzhss
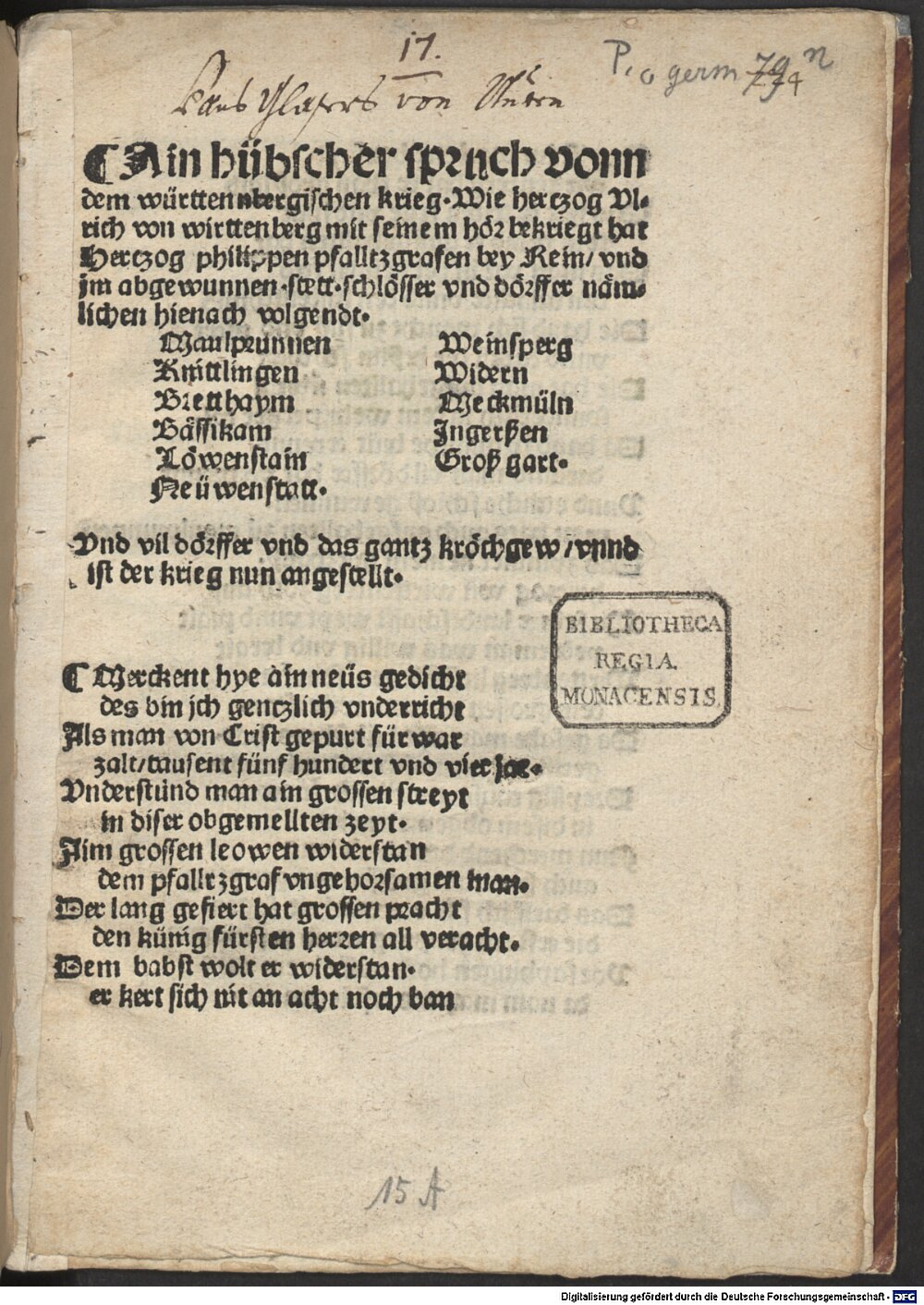
1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].
2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.
Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.
"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.
Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.
3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504
Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].
Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.
A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176
Digitalisat des Münchner Exemplars:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5
B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174
Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.
[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]
Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].
[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175
C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)
D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]
Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.
Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.
Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.
Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.
Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.
4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509
Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .
Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]
Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von
Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die
schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb
dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain
wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen
nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain
klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden
daran gemalet, und ain pritschen." [16]
5. Bauernkrieg reimenweis, 1525
Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]
In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".
Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.
Hinweis:
http://d-nb.info/gnd/100489362
http://d-nb.info/gnd/1012266486
beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.
ANMERKUNGEN
[1] http://www.libreka.de/9783110087789/35
[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12
[3] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/
[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347
[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]
[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg
[6] http://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31
[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72
[8] http://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522
[9] http://www.handschriftencensus.de/5499
[10] http://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)
[11] http://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93
[12] Zu dem Feldzug siehe etwa
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf
[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62
http://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up
[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563
http://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]
Zum Amt des Pritschenmeisters: http://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister
[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm
[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]
[August 2014: Die Handschrift ist online:
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]
[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104
http://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)
[ http://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]
[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3
http://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up
Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:
http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15
[17] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg
[18] http://archiv.twoday.net/stories/97052702/
[Wertmanns GND:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]
#forschung
#fnzhss
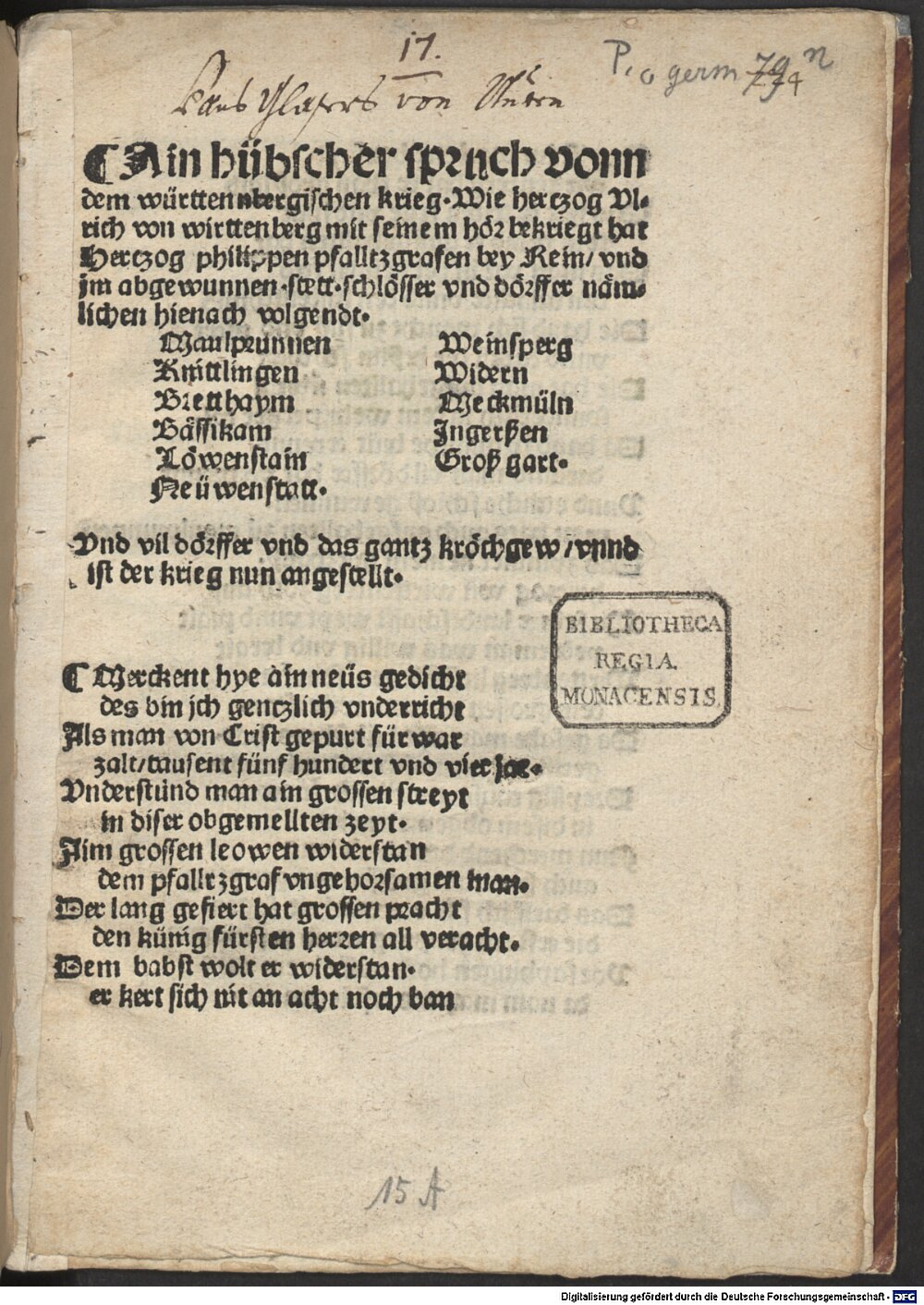
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 23:05 - Rubrik: Kodikologie
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 22:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Stadler findet wie fast immer die richtigen Worte über das neueste Schandurteil:
http://www.internet-law.de/2012/06/landgericht-berlin-filmen-verboten.html
"Was falsche BGH-Entscheidungen anrichten, wenn sie dann auch noch von Instanzgerichten exzessiv ausgelegt werden, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Berlin (Urteil vom 10.05.2012, Az.: 16 O 199/11), durch die das Filmen in Berliner U-Bahnhöfen untersagt wird, mit der Begründung, dass dadurch das Eigentumsrecht der Berliner Verkehrsbetriebe verletzt würde."
Update: KG hob auf http://archiv.twoday.net/stories/326201826/
http://www.internet-law.de/2012/06/landgericht-berlin-filmen-verboten.html
"Was falsche BGH-Entscheidungen anrichten, wenn sie dann auch noch von Instanzgerichten exzessiv ausgelegt werden, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Berlin (Urteil vom 10.05.2012, Az.: 16 O 199/11), durch die das Filmen in Berliner U-Bahnhöfen untersagt wird, mit der Begründung, dass dadurch das Eigentumsrecht der Berliner Verkehrsbetriebe verletzt würde."
Update: KG hob auf http://archiv.twoday.net/stories/326201826/
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 21:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://carta.info/44862/von-plagiaten-und-dem-fortschritt-der-erkenntnis/
Wenn sich gleich acht angesehene und höchst verdiente Wissenschaftler zusammentun, um sich mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung in die aktuelle Plagiatsdiskussion einzuschalten, wenn sie das gar unter dem Titel „Unwürdiges Spektakel“ tun, dann erwartet man, dass Klartext geredet wird.
Zum Beispiel die unmissverständliche Forderung, enttarnten Plagiator/innen keine wissenschaftspolitischen Ämter anzuvertrauen (wie sie eine Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen im Fall Koch-Mehrin stellte). Oder vielleicht endlich einmal lange überfällige Worte des Dankes an die Mitwirkenden der Plagiatsdokumentationen von GuttenPlag, VroniPlag und Co. Oder wenigstens ein viel zu seltenes selbstkritisches Eingeständnis, dass die Wissenschaft erst durch diese Plagiatsdokumentationen zu einer Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Betrug gezwungen wurde, der in Teilen von Politik und Wirtschaft selbstverständlicher Karrierebaustein zu sein scheint.
Nichts davon findet sich in dem Gastbeitrag der Germanisten Wolfgang Frühwald und Gerhart von Graevenitz, des Philosophen Ludger Honnefelder, des Physikers Reimar Lüst, des Theologen Christoph Markschies, der Chemiker Ernst Theodor Rietschel und Ernst-Ludwig Winnacker und des Juristen Rüdiger Wolfrum.
Eine Koryphäe hackt der anderen kein Auge aus ...
Update: http://www.spektrum.de/alias/plagiate/betrug-schadet-der-wissenschaft-nicht-seine-aufdeckung/1154911
Wenn sich gleich acht angesehene und höchst verdiente Wissenschaftler zusammentun, um sich mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung in die aktuelle Plagiatsdiskussion einzuschalten, wenn sie das gar unter dem Titel „Unwürdiges Spektakel“ tun, dann erwartet man, dass Klartext geredet wird.
Zum Beispiel die unmissverständliche Forderung, enttarnten Plagiator/innen keine wissenschaftspolitischen Ämter anzuvertrauen (wie sie eine Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen im Fall Koch-Mehrin stellte). Oder vielleicht endlich einmal lange überfällige Worte des Dankes an die Mitwirkenden der Plagiatsdokumentationen von GuttenPlag, VroniPlag und Co. Oder wenigstens ein viel zu seltenes selbstkritisches Eingeständnis, dass die Wissenschaft erst durch diese Plagiatsdokumentationen zu einer Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Betrug gezwungen wurde, der in Teilen von Politik und Wirtschaft selbstverständlicher Karrierebaustein zu sein scheint.
Nichts davon findet sich in dem Gastbeitrag der Germanisten Wolfgang Frühwald und Gerhart von Graevenitz, des Philosophen Ludger Honnefelder, des Physikers Reimar Lüst, des Theologen Christoph Markschies, der Chemiker Ernst Theodor Rietschel und Ernst-Ludwig Winnacker und des Juristen Rüdiger Wolfrum.
Eine Koryphäe hackt der anderen kein Auge aus ...
Update: http://www.spektrum.de/alias/plagiate/betrug-schadet-der-wissenschaft-nicht-seine-aufdeckung/1154911
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 19:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Es war eine groteskes Szene, die sich am vergangenen Mittwoch vor dem Institut für Erziehungswissenschaften in der Franz-Mehring Straße 47 ereignete: Ein LKW fuhr vor und setzte einen Müllcontainer ab. Das ist zunächst noch nichts ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist jedoch, dass anschließend der Müllcontainer mit Büchern gefüllt wurde. Es handelt sich hierbei um Bestände der Bibliothek für Erziehungswissenschaften und Psychologie. “Was wollt ihr denn mit den Büchern machen? Wollt ihr sie euch unters Kopfkissen legen?”, spöttelte das die Entsorgung vollziehende Fachpersonal, als sich zahlreiche Studierende um den Container scharten, um die Bücher zu bergen und vor der Vernichtung zu bewahren.
Unter den Büchern befinden sich zum Teil über einhundert Jahre alte Exemplare, darunter beispielsweise Schriften zur Reformpädagogik der 1920iger Jahre sowie zahlreiche Publikationen jüngeren Datums, die sich mit Kindererziehung, Entwicklungspsychologie, aber auch mit Fragen der Fach- und Hochschuldidaktik befassen. Ebenfalls vernichtet wurden bei dieser Aktion zahlreiche Dissertations- und Habilitationsschriften, die zum Teil an der Universität Greifswald verfasst worden sind. Es handelt sich um zirka 1.000 Bücher, die im Keller der Franz-Mehring Straße gelagert wurden. Nicht wenige von ihnen trugen bereits eine neue Signatur, einige waren bereits mit einem Scancode versehen.
INSTITUT, FAKULTÄT, REKTORAT – ALLE WUSSTEN NICHTS
"Neue" Signatur und beinahe auf dem Müll gelandet: Dissertationen und Habilitationen
Auf Nachfrage des Autors erklärte Professor Dr. Andreas Pehnke, Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaft, dass er nicht über die Entsorgung der Bücher informiert wurde. Auch die übrigen Mitarbeiterinnen des Instituts wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Neben dem Institut tappten auch das Dekanat und Rektorat bezüglich dieser Angelegenheit im Dunkeln. “Dann kann ich gleich aufhören, Dekan zu sein, wenn ich nicht einmal erfahre, was der Bibliotheksdirektor mit unseren Institutsbibliotheken macht”, reagierte Professor Dr. Alexander Wöll verärgert, als er während der Vollversammlung Lehrerbildung von dem Vorfall erfuhr. In diesem Zusammenhang sprach er erneut seinen Unmut darüber aus, dass er ebenso wenig in die Frage der geplanten, inzwischen in Vollzug befindlichen, Auflösung der Institutsbibliothek in der Franz-Mehring Straße mit einbezogen worden ist.
DIGITALISIERUNG VOR VERNICHTUNG NICHT VORGENOMMEN
Inzwischen ist bekannt geworden, dass ein Großteil der Bücherbestände derart mit Schimmel befallen gewesen sein soll, dass keine andere Wahl als deren Vernichtung geblieben wäre. Diesbezüglich gäbe es ein entsprechendes Gutachten, das dem webMoritz bislang jedoch noch nicht vorliegt. Sollte tatsächlich dem so gewesen sein, dass kein einziges Buch mehr brauchbar gewesen wäre, bleibt immer noch die Frage offen, weshalb weder Institut, noch Fakultät und Rektorat über den Verfall der Bücher informiert wurden, um gegebenenfalls ein Fenster zu öffnen, einen Teil der Bestände digital erhalten zu können.
Anmerkung: Der Verfasser war Zeuge des Vorfalls und hat in seiner Funktion als studentisches Mitglied der Zentralen Koordinierungsgruppe für Lehrerbildung das Thema auf der im Text erwähnten Vollversammlung Lehrerbildung angesprochen.
http://webmoritz.de/2012/06/08/universitatsbibliothek-greifswald-vernichtet-hunderte-bucher/
Unter den Büchern befinden sich zum Teil über einhundert Jahre alte Exemplare, darunter beispielsweise Schriften zur Reformpädagogik der 1920iger Jahre sowie zahlreiche Publikationen jüngeren Datums, die sich mit Kindererziehung, Entwicklungspsychologie, aber auch mit Fragen der Fach- und Hochschuldidaktik befassen. Ebenfalls vernichtet wurden bei dieser Aktion zahlreiche Dissertations- und Habilitationsschriften, die zum Teil an der Universität Greifswald verfasst worden sind. Es handelt sich um zirka 1.000 Bücher, die im Keller der Franz-Mehring Straße gelagert wurden. Nicht wenige von ihnen trugen bereits eine neue Signatur, einige waren bereits mit einem Scancode versehen.
INSTITUT, FAKULTÄT, REKTORAT – ALLE WUSSTEN NICHTS
"Neue" Signatur und beinahe auf dem Müll gelandet: Dissertationen und Habilitationen
Auf Nachfrage des Autors erklärte Professor Dr. Andreas Pehnke, Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaft, dass er nicht über die Entsorgung der Bücher informiert wurde. Auch die übrigen Mitarbeiterinnen des Instituts wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Neben dem Institut tappten auch das Dekanat und Rektorat bezüglich dieser Angelegenheit im Dunkeln. “Dann kann ich gleich aufhören, Dekan zu sein, wenn ich nicht einmal erfahre, was der Bibliotheksdirektor mit unseren Institutsbibliotheken macht”, reagierte Professor Dr. Alexander Wöll verärgert, als er während der Vollversammlung Lehrerbildung von dem Vorfall erfuhr. In diesem Zusammenhang sprach er erneut seinen Unmut darüber aus, dass er ebenso wenig in die Frage der geplanten, inzwischen in Vollzug befindlichen, Auflösung der Institutsbibliothek in der Franz-Mehring Straße mit einbezogen worden ist.
DIGITALISIERUNG VOR VERNICHTUNG NICHT VORGENOMMEN
Inzwischen ist bekannt geworden, dass ein Großteil der Bücherbestände derart mit Schimmel befallen gewesen sein soll, dass keine andere Wahl als deren Vernichtung geblieben wäre. Diesbezüglich gäbe es ein entsprechendes Gutachten, das dem webMoritz bislang jedoch noch nicht vorliegt. Sollte tatsächlich dem so gewesen sein, dass kein einziges Buch mehr brauchbar gewesen wäre, bleibt immer noch die Frage offen, weshalb weder Institut, noch Fakultät und Rektorat über den Verfall der Bücher informiert wurden, um gegebenenfalls ein Fenster zu öffnen, einen Teil der Bestände digital erhalten zu können.
Anmerkung: Der Verfasser war Zeuge des Vorfalls und hat in seiner Funktion als studentisches Mitglied der Zentralen Koordinierungsgruppe für Lehrerbildung das Thema auf der im Text erwähnten Vollversammlung Lehrerbildung angesprochen.
http://webmoritz.de/2012/06/08/universitatsbibliothek-greifswald-vernichtet-hunderte-bucher/
Diese findet auf Twitter #newLIS und im Piratenpad statt:
http://piratenpad.de/p/newlis
http://archiv.twoday.net/stories/97065874/
http://archiv.twoday.net/stories/97065874/
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 15:17 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich erinnere mich sehr deutlich, dass die detaillierte Erschließung (mit Provenienzen) des gedruckten Produkts ÖNB-Ink (Inkunabelkatalog der Österreichischen Nationalbibliothek Wien) Eingang gefunden hatte in eine Wiener Inkunabelkatalog-Datenbank. Diese Daten sind offenkundig nicht mehr online. Merke: Die Wiener Stümper stehen den Münchnern nur wenig nach.
http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%B6nb-ink
Update:
https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/6Jmde5d7Zmk
http://archiv.twoday.net/search?q=%C3%B6nb-ink
Update:
https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/6Jmde5d7Zmk
KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 12:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://epub.ub.uni-muenchen.de/ludovico.html
"Bei der Plattform Ludovico-Maximilianea handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsbibliothek, des Universitätsarchivs und des Herzoglichen Georgianums München, das Dokumente von zentraler Bedeutung für die Universitätsgeschichte versammelt."
Archivalien des Universitätsarchivs (39)
Akademischer Senat (2)
Juristische Fakultät (9)
Katholisch-Theologische Fakultät (13)
Medizinische Fakultät (3)
Philosophische Fakultät (12)

"Bei der Plattform Ludovico-Maximilianea handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsbibliothek, des Universitätsarchivs und des Herzoglichen Georgianums München, das Dokumente von zentraler Bedeutung für die Universitätsgeschichte versammelt."
Archivalien des Universitätsarchivs (39)
Akademischer Senat (2)
Juristische Fakultät (9)
Katholisch-Theologische Fakultät (13)
Medizinische Fakultät (3)
Philosophische Fakultät (12)

KlausGraf - am Freitag, 15. Juni 2012, 15:15 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rosenland-lippe.de/Rosenland-13.pdf (2012)
Jürgen Hartmann hat den ergiebigen Quellenbestand für die lippische Regionalgeschichte ausgewertet.
Jürgen Hartmann hat den ergiebigen Quellenbestand für die lippische Regionalgeschichte ausgewertet.
KlausGraf - am Freitag, 15. Juni 2012, 01:04 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Durch rückwirkende Zuordnung von Beiträgen stieg der Zähler der Suche
#forschung
soeben auf 100. (Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/75221743/ muss abgezogen werden und künftig natürlich auch dieser Eintrag.)
Der älteste Beitrag stammt von 2005:
http://archiv.twoday.net/stories/914849/ (Ergänzungen zum ²VL)
Die meisten wurden jedoch in den letzten beiden Jahren veröffentlicht.
Das Gros der Beiträge betrifft Handschriftenfunde.
Ganz einheitlich ist meine Zuordnungspraxis sicher nicht. Ich habe aber generell eher zurückhaltend etikettiert. Bei Themen, die auf mehrere Beiträge verteilt sind (z.B. Rüxner) habe ich nur die wichtigsten berücksichtigt.
Es bieten noch viele andere Archivalia-Beiträge wissenschaftliche Erkenntnisse.
Oft enthalten die Rezensionen weiterführende Hinweise:
http://archiv.twoday.net/stories/4941756/ (nicht berücksichtigt)
Nicht aufgenommen wurden die kulturpolitisch ausgerichteten Beiträge (zum Kulturgutschutz), vor allem zum Karlsruher Handschriftenstreit. Hier wurden teilweise auch Archivalien ausgewertet und Erkenntnisse gewonnen, die nicht alle vom Laufs-Gutachten überholt sind.
Ausgeklammert wurden auch die juristischen Erörterungen und Kommentare, die mitunter Neuland beschritten, sowie die vielen kleinen "Studien" und Beobachtungen zum Thema "Open Access".
Wer sich bei diesen Erkenntnissen bedient, ist gehalten, Archivalia auch zitieren - gern auch unter Zuhilfenahme von WebCite:
http://archiv.twoday.net/stories/97039151/
#forschung
soeben auf 100. (Der Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/75221743/ muss abgezogen werden und künftig natürlich auch dieser Eintrag.)
Der älteste Beitrag stammt von 2005:
http://archiv.twoday.net/stories/914849/ (Ergänzungen zum ²VL)
Die meisten wurden jedoch in den letzten beiden Jahren veröffentlicht.
Das Gros der Beiträge betrifft Handschriftenfunde.
Ganz einheitlich ist meine Zuordnungspraxis sicher nicht. Ich habe aber generell eher zurückhaltend etikettiert. Bei Themen, die auf mehrere Beiträge verteilt sind (z.B. Rüxner) habe ich nur die wichtigsten berücksichtigt.
Es bieten noch viele andere Archivalia-Beiträge wissenschaftliche Erkenntnisse.
Oft enthalten die Rezensionen weiterführende Hinweise:
http://archiv.twoday.net/stories/4941756/ (nicht berücksichtigt)
Nicht aufgenommen wurden die kulturpolitisch ausgerichteten Beiträge (zum Kulturgutschutz), vor allem zum Karlsruher Handschriftenstreit. Hier wurden teilweise auch Archivalien ausgewertet und Erkenntnisse gewonnen, die nicht alle vom Laufs-Gutachten überholt sind.
Ausgeklammert wurden auch die juristischen Erörterungen und Kommentare, die mitunter Neuland beschritten, sowie die vielen kleinen "Studien" und Beobachtungen zum Thema "Open Access".
Wer sich bei diesen Erkenntnissen bedient, ist gehalten, Archivalia auch zitieren - gern auch unter Zuhilfenahme von WebCite:
http://archiv.twoday.net/stories/97039151/
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 23:52 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dank dem Hohenzollerischen Geschichtsverein!
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html
Update: http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/97059939/
#histverein
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html
Update: http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/97059939/
#histverein
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 22:41 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/
Sauber, wenn die Suchworte Teil des Permalinks sind:
http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10586926&db=107&View=dig&q=porn+liebe&showFulltextPage=19
http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10620521&db=107&View=dig&q=klaus+graf&showFulltextPage=37
Die Fraktur-OCR, die man sich anschauen kann, ist teilweise sehr schlecht. Die Personen- und Ortserkennung noch fast unbrauchbar.
Weitere Volltexte des MDZ:
http://archiv.twoday.net/stories/64968906/
Sauber, wenn die Suchworte Teil des Permalinks sind:
http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10586926&db=107&View=dig&q=porn+liebe&showFulltextPage=19
http://opac-plus-volltext.bsb-muenchen.de/search?q=bsb10620521&db=107&View=dig&q=klaus+graf&showFulltextPage=37
Die Fraktur-OCR, die man sich anschauen kann, ist teilweise sehr schlecht. Die Personen- und Ortserkennung noch fast unbrauchbar.
Weitere Volltexte des MDZ:
http://archiv.twoday.net/stories/64968906/
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 21:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern
Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen
Referat im Rahmen des 75. VdW-Lehrgangs am 12.6.2012 in Frankfurt am Main
Liebe chinesische Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren,
 Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.
Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.
Ich möchte nicht über Social Media als Teil der Unternehmenskommunikation und die Einbeziehung der Archive und des Archivguts in diesem Kontext sprechen, obwohl dies bei einer Konferenz von Wirtschaftsarchivaren naheliegen könnte. Ich leugne nicht, dass meine Position sehr stark vom Selbstverständnis der sogenannten öffentlichen Archive bestimmt wird.
Social Media sind für moderne Demokratien unverzichtbar. Indem sie auf den freien Austausch von Meinungen und Ideen im offenen Internet, das in seinem Ursprung nicht-kommerziell und staatlich nicht reguliert ist, abzielen, helfen sie beim Aufbau demokratischer Strukturen und ihrer Festigung. Social Media setzen nicht auf die Propaganda oder die einseitige Öffentlichkeitsarbeit, sondern den Dialog, die Interaktion. Sie bieten große Chancen für bürgerschaftliche Teilhabe, ermöglichen gesellschaftliche Diskussionen ohne Zensur und obrigkeitliche Unterdrückung unliebsamer Positionen. Auch im archivfachlichen Kontext ist die öffentliche kritische Diskussion dann am wirksamsten, wenn sie eine möglichst breite Öffentlichkeit erzielt, was am besten mit dem frei zugänglichen Internet zu realisieren ist.
Das sogenannte “archivische Menschenrecht”, das erstmals im französischen Gesetz vom 25. Mai 1794 formuliert wurde, bezog sich auf den Informationszugang zu amtlichen Unterlagen und ist daher ebenso wie die schwedische Regelung von 1766 ein Vorläufer der heutigen Informationsfreiheitsgesetze im Bund und den meisten Ländern. Archivare sollten sich weit mehr für Informationsfreiheit und Verwaltungstransparenz einsetzen, da diese Werte für die demokratische Kultur wesentlich sind. Auch hier ist das Mittel der Wahl das Internet: es ermöglicht die Information und den Dialog mit dem Bürger.
Während die Open-Access-Bewegung aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, wird der Open-Data-Gedanke im Kontext der Überlegungen zum E-Government diskutiert und dort immer wichtiger. Öffentliche Daten sollen frei, auch für kommerzielle Zwecke nachnutzbar sein. Dies muss auch für digitale Reproduktionen von Archivgut gelten, das etwa über Social Media unter das Volk gebracht wird. Wer etwa als Archiv ein Tumblr-Blog nutzt, dem muss klar sein, dass dort gepostete Fotos ohne Ansehen eines möglichen Urheberrechts geteilt und damit weiterverbreitet werden. Zweckmäßigerweise stellt man sie daher von vornherein unter eine passende freie Lizenz - am besten Creative Commons Attribution - oder etikettiert sie, wenn die Vorlage gemeinfreie “Flachware” ist, als Public Domain.
Social Media stehen daher im Kern einer modernen, offenen und demokratischen Gesellschaft, zu der auch die Archive ihren Beitrag leisten können und sollen.
Ein Lamento, wie wenig die deutschsprachigen Archive, im Web 2.0 angekommen sind, könnte Stunden dauern. Die meisten Archive kommen ja noch nicht einmal mit dem Web 1.0 zurecht. Es gibt nur gute eine Handvoll Archive, die im Web 2.0 aktiv sind, vor allem auf Facebook und Twitter, darunter, wenn ich nichts übersehen habe, kein einziges Wirtschaftsarchiv. Während das US-Nationalarchiv mehrere Blogs unterhält, sind Blogs im deutschsprachigen Archivwesen nach wie vor eine Außenseiter-Beschäftigung, auch wenn in letzter Zeit gewisse Fortschritte gemacht wurden. Hoffnungsfroh stimmt immerhin der Erfolg des Gemeinschaftsblogs der Archive des Landkreises Siegen-Wittgenstein, begründet von Thomas Wolf, nach mir dem wichtigsten Beiträger auf Archivalia. Im jüngsten Heft des “Archivars” äußern sich 5 deutsche Stadtarchive und das Österreichische Staatsarchiv sehr positiv über ihre Erfahrungen mit ihren Web 2.0-Aktivitäten. Social Media entwickeln eine eigene Dynamik, sie erschließen neue Zielgruppen und bereiten den Archivaren auch eine Menge Spaß.
Andere Kulturinstitutionen, vor allem die ebenfalls mit der Verwahrung von Kulturgut befassten Bibliotheken und Museen, sind uns im deutschsprachigen Raum meilenweit voraus.
Social Media sind virtuelle Schaufenster der Archive, sie helfen dabei, eine Bringschuld der Archive zu erfüllen: die demokratische Gesellschaft mit der Materialität ihres Gedächtnisses (oder besser: ihrer Gedächtnisse) zu konfrontieren, oder weniger hochtrabend ausgedrückt: Sie sind das aus meiner Sicht wichtigste Mittel der historischen Bildungsarbeit der Archive. Nur wenn wir die junge, netzaffine Generation erreichen, werden wir nicht überaltern.
Social Media können, wenn die Sprachbarriere überwunden wird, auch internationale Kontakte schaffen und dem fachlichen Austausch über die Kulturen hinweg dienen. Daher hatte Archivalia von Anfang an eine English Corner für englischsprachige Beiträge, und seit letztem Jahr betreibe ich einen englischsprachigen Ableger Archivalia_EN auf Tumblr, auf dem ich neben Bildern unter anderem auch archivische Links poste.
Wer aber das Internet und die interaktiv angelegten Angebote des Web 2.0 nur als weiteren Kanal für die obrigkeitliche Öffentlichkeitsarbeit betrachtet, verkennt das Potential der Social Media. Archive, die sich als Bürgerarchive verstehen, müssen sich dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern öffnen, sie müssen zu Lernprozessen bereit sein und zum kritischen Hinterfragen der eigenen Praxis.
Hier vermisse ich so gut wie jeglichen Ansatz im deutschsprachigen Archivwesen, selbst wenn es sich schon dem Web 2.0 geöffnet hat.. Natürlich kann man auf Facebook liken und auf Twitter kurze Gespräche führen, aber das hat mit dem interaktiven Potential des Web 2.0 kaum etwas zu tun.
Weltweit sind - auch archivische - Crowdsourcing-Unternehmen erfolgreich - im deutschsprachigen Bereich experimentiert kein einziges Archiv damit. Wieso eröffnet man kein Transkriptionsprojekt, bei dem Freiwillige wichtige historische Quellen, die aus Ressourcen-Gründen nicht ediert werden konnten, gemeinsam abschreiben oder mit einem Index erschließen? Wieso setzt man kein Findbuch-Wiki auf, das von Benutzern ergänzt und verbessert werden kann?
Nicht nur bei der Erschließung, auch im archivischen Kernbereich, der Bewertung, sollte Bürgerbeteiligung kein Tabu sein. Wir brauchen endlich eine gesellschaftliche Debatte über die Überlieferungsbildung - und zwar in allen Archivsparten.
Die internationale Kooperation habe ich ja bereits erwähnt. Hier steht mit Blick auf China das Überwinden der Sprachbarriere an erster Stelle. Wieso setzen nicht deutsche und chinesische Wirtschaftsarchivare ein gemeinsames Weblog auf, das die wichtigsten Entwicklungen im fachlichen Bereich in nicht zu langen Beiträgen dokumentiert, die dann von Freiwilligen in die jeweils andere Sprache bzw. das Englische als Lingua franca übersetzt werden? Wir können nur dann voneinander lernen und einen Dialog auf Augenhöhe führen, wenn wir die durch das Internet gebotene Chance wahrnehmen, uns übereinander zu informieren.
Wir müssen als Archivare entschieden mutiger sein und mehr experimentieren, viel mehr Ideen wagen. Dazu gehört auch, Misserfolge und Rückschläge in Kauf zu nehmen. Wer neue Wege gehen will, geht auch manchmal in die Irre. Das Internet ist ein digitales Laboratorium, in dem man nicht zuletzt lernen kann, wie man mit eigenen Fehlern angemessen umgeht.
Dies Alles und noch viel mehr kann ein Archivar in einem öffentlichen Archiv viel offensiver vertreten als ein Unternehmensarchivar, der gelernt hat, bei der Freigabe von Informationen mit äußerster Vorsicht zu agieren. Aber Transparenz ist nicht nur ein Grundwert der demokratischen politischen Kultur, sondern auch einer Unternehmenskultur, die gesellschaftliche Verantwortung ernstnimmt. Hier gilt es für den Archivar, strategische Verbündete im Unternehmen im Bereich Social Media zu suchen. Vielleicht geht es in einem Unternehmen sogar mitunter unkomplizierter zu als etwa im deutschen staatlichen Archivwesen, das ja bisher ziemlich strikt an einer Social-Media-Abstinenz festhält. Das Bundesarchiv hat ja noch nicht einmal einen RSS-Feed, und das Staatsarchiv München durfte nur wenige Tage auf Facebook aktiv sein. Und was das Niedersächsische Landesarchiv dort abliefert, ist wenig überzeugend.
Die deutschsprachige Archivlandschaft ist hinsichtlich der Social Media ein bitterarmes Entwicklungsland, noch nicht einmal ein Schwellenland, und ich befürchte, dass die behäbige Beharrlichkeit der “Generation Fax”, die Innovationen blockiert, dem Ansehen unseres Berufs mittelfristig schweren Schaden zufügen kann. Um so mehr würde mich interessieren, welche Erfahrungen in China mit Social Media im Archivbereich vorliegen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332286/
Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen
Referat im Rahmen des 75. VdW-Lehrgangs am 12.6.2012 in Frankfurt am Main
Liebe chinesische Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren,
 Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.
Warum ist mein Twitter-Avatar grün? Meinen Twitter-Account Archivalia-kg habe ich seit dem Frühjahr 2009, als der Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht nur die deutsche Archivwelt erschütterte. Damals wurde mir klar, wie wichtig Twitter bei der raschen Verbreitung von fachlichen Informationen sein kann. Der Twittername bezieht sich auf das von mir 2003 begründete Gemeinschaftsweblog rund um das Archivwesen Archivalia, und der Avatar, eine mittelalterliche Kampfszene, nimmt auf die streitbare Grundhaltung meiner Archivalia-Beiträge Bezug. Der Avatar wurde noch im Jahr 2009 grün aus Solidarität zu der gescheiterten Volkserhebung im Iran und er wird es bleiben, bis Iran eine Demokratie ist. Nicht nur bei diesem tragischen Ereignis, auch bei dem sogenannten “arabischen Frühling” 2011 spielten Twitter und andere Social Media eine herausragende Rolle.Ich möchte nicht über Social Media als Teil der Unternehmenskommunikation und die Einbeziehung der Archive und des Archivguts in diesem Kontext sprechen, obwohl dies bei einer Konferenz von Wirtschaftsarchivaren naheliegen könnte. Ich leugne nicht, dass meine Position sehr stark vom Selbstverständnis der sogenannten öffentlichen Archive bestimmt wird.
Social Media sind für moderne Demokratien unverzichtbar. Indem sie auf den freien Austausch von Meinungen und Ideen im offenen Internet, das in seinem Ursprung nicht-kommerziell und staatlich nicht reguliert ist, abzielen, helfen sie beim Aufbau demokratischer Strukturen und ihrer Festigung. Social Media setzen nicht auf die Propaganda oder die einseitige Öffentlichkeitsarbeit, sondern den Dialog, die Interaktion. Sie bieten große Chancen für bürgerschaftliche Teilhabe, ermöglichen gesellschaftliche Diskussionen ohne Zensur und obrigkeitliche Unterdrückung unliebsamer Positionen. Auch im archivfachlichen Kontext ist die öffentliche kritische Diskussion dann am wirksamsten, wenn sie eine möglichst breite Öffentlichkeit erzielt, was am besten mit dem frei zugänglichen Internet zu realisieren ist.
Das sogenannte “archivische Menschenrecht”, das erstmals im französischen Gesetz vom 25. Mai 1794 formuliert wurde, bezog sich auf den Informationszugang zu amtlichen Unterlagen und ist daher ebenso wie die schwedische Regelung von 1766 ein Vorläufer der heutigen Informationsfreiheitsgesetze im Bund und den meisten Ländern. Archivare sollten sich weit mehr für Informationsfreiheit und Verwaltungstransparenz einsetzen, da diese Werte für die demokratische Kultur wesentlich sind. Auch hier ist das Mittel der Wahl das Internet: es ermöglicht die Information und den Dialog mit dem Bürger.
Während die Open-Access-Bewegung aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, wird der Open-Data-Gedanke im Kontext der Überlegungen zum E-Government diskutiert und dort immer wichtiger. Öffentliche Daten sollen frei, auch für kommerzielle Zwecke nachnutzbar sein. Dies muss auch für digitale Reproduktionen von Archivgut gelten, das etwa über Social Media unter das Volk gebracht wird. Wer etwa als Archiv ein Tumblr-Blog nutzt, dem muss klar sein, dass dort gepostete Fotos ohne Ansehen eines möglichen Urheberrechts geteilt und damit weiterverbreitet werden. Zweckmäßigerweise stellt man sie daher von vornherein unter eine passende freie Lizenz - am besten Creative Commons Attribution - oder etikettiert sie, wenn die Vorlage gemeinfreie “Flachware” ist, als Public Domain.
Social Media stehen daher im Kern einer modernen, offenen und demokratischen Gesellschaft, zu der auch die Archive ihren Beitrag leisten können und sollen.
Ein Lamento, wie wenig die deutschsprachigen Archive, im Web 2.0 angekommen sind, könnte Stunden dauern. Die meisten Archive kommen ja noch nicht einmal mit dem Web 1.0 zurecht. Es gibt nur gute eine Handvoll Archive, die im Web 2.0 aktiv sind, vor allem auf Facebook und Twitter, darunter, wenn ich nichts übersehen habe, kein einziges Wirtschaftsarchiv. Während das US-Nationalarchiv mehrere Blogs unterhält, sind Blogs im deutschsprachigen Archivwesen nach wie vor eine Außenseiter-Beschäftigung, auch wenn in letzter Zeit gewisse Fortschritte gemacht wurden. Hoffnungsfroh stimmt immerhin der Erfolg des Gemeinschaftsblogs der Archive des Landkreises Siegen-Wittgenstein, begründet von Thomas Wolf, nach mir dem wichtigsten Beiträger auf Archivalia. Im jüngsten Heft des “Archivars” äußern sich 5 deutsche Stadtarchive und das Österreichische Staatsarchiv sehr positiv über ihre Erfahrungen mit ihren Web 2.0-Aktivitäten. Social Media entwickeln eine eigene Dynamik, sie erschließen neue Zielgruppen und bereiten den Archivaren auch eine Menge Spaß.
Andere Kulturinstitutionen, vor allem die ebenfalls mit der Verwahrung von Kulturgut befassten Bibliotheken und Museen, sind uns im deutschsprachigen Raum meilenweit voraus.
Social Media sind virtuelle Schaufenster der Archive, sie helfen dabei, eine Bringschuld der Archive zu erfüllen: die demokratische Gesellschaft mit der Materialität ihres Gedächtnisses (oder besser: ihrer Gedächtnisse) zu konfrontieren, oder weniger hochtrabend ausgedrückt: Sie sind das aus meiner Sicht wichtigste Mittel der historischen Bildungsarbeit der Archive. Nur wenn wir die junge, netzaffine Generation erreichen, werden wir nicht überaltern.
Social Media können, wenn die Sprachbarriere überwunden wird, auch internationale Kontakte schaffen und dem fachlichen Austausch über die Kulturen hinweg dienen. Daher hatte Archivalia von Anfang an eine English Corner für englischsprachige Beiträge, und seit letztem Jahr betreibe ich einen englischsprachigen Ableger Archivalia_EN auf Tumblr, auf dem ich neben Bildern unter anderem auch archivische Links poste.
Wer aber das Internet und die interaktiv angelegten Angebote des Web 2.0 nur als weiteren Kanal für die obrigkeitliche Öffentlichkeitsarbeit betrachtet, verkennt das Potential der Social Media. Archive, die sich als Bürgerarchive verstehen, müssen sich dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern öffnen, sie müssen zu Lernprozessen bereit sein und zum kritischen Hinterfragen der eigenen Praxis.
Hier vermisse ich so gut wie jeglichen Ansatz im deutschsprachigen Archivwesen, selbst wenn es sich schon dem Web 2.0 geöffnet hat.. Natürlich kann man auf Facebook liken und auf Twitter kurze Gespräche führen, aber das hat mit dem interaktiven Potential des Web 2.0 kaum etwas zu tun.
Weltweit sind - auch archivische - Crowdsourcing-Unternehmen erfolgreich - im deutschsprachigen Bereich experimentiert kein einziges Archiv damit. Wieso eröffnet man kein Transkriptionsprojekt, bei dem Freiwillige wichtige historische Quellen, die aus Ressourcen-Gründen nicht ediert werden konnten, gemeinsam abschreiben oder mit einem Index erschließen? Wieso setzt man kein Findbuch-Wiki auf, das von Benutzern ergänzt und verbessert werden kann?
Nicht nur bei der Erschließung, auch im archivischen Kernbereich, der Bewertung, sollte Bürgerbeteiligung kein Tabu sein. Wir brauchen endlich eine gesellschaftliche Debatte über die Überlieferungsbildung - und zwar in allen Archivsparten.
Die internationale Kooperation habe ich ja bereits erwähnt. Hier steht mit Blick auf China das Überwinden der Sprachbarriere an erster Stelle. Wieso setzen nicht deutsche und chinesische Wirtschaftsarchivare ein gemeinsames Weblog auf, das die wichtigsten Entwicklungen im fachlichen Bereich in nicht zu langen Beiträgen dokumentiert, die dann von Freiwilligen in die jeweils andere Sprache bzw. das Englische als Lingua franca übersetzt werden? Wir können nur dann voneinander lernen und einen Dialog auf Augenhöhe führen, wenn wir die durch das Internet gebotene Chance wahrnehmen, uns übereinander zu informieren.
Wir müssen als Archivare entschieden mutiger sein und mehr experimentieren, viel mehr Ideen wagen. Dazu gehört auch, Misserfolge und Rückschläge in Kauf zu nehmen. Wer neue Wege gehen will, geht auch manchmal in die Irre. Das Internet ist ein digitales Laboratorium, in dem man nicht zuletzt lernen kann, wie man mit eigenen Fehlern angemessen umgeht.
Dies Alles und noch viel mehr kann ein Archivar in einem öffentlichen Archiv viel offensiver vertreten als ein Unternehmensarchivar, der gelernt hat, bei der Freigabe von Informationen mit äußerster Vorsicht zu agieren. Aber Transparenz ist nicht nur ein Grundwert der demokratischen politischen Kultur, sondern auch einer Unternehmenskultur, die gesellschaftliche Verantwortung ernstnimmt. Hier gilt es für den Archivar, strategische Verbündete im Unternehmen im Bereich Social Media zu suchen. Vielleicht geht es in einem Unternehmen sogar mitunter unkomplizierter zu als etwa im deutschen staatlichen Archivwesen, das ja bisher ziemlich strikt an einer Social-Media-Abstinenz festhält. Das Bundesarchiv hat ja noch nicht einmal einen RSS-Feed, und das Staatsarchiv München durfte nur wenige Tage auf Facebook aktiv sein. Und was das Niedersächsische Landesarchiv dort abliefert, ist wenig überzeugend.
Die deutschsprachige Archivlandschaft ist hinsichtlich der Social Media ein bitterarmes Entwicklungsland, noch nicht einmal ein Schwellenland, und ich befürchte, dass die behäbige Beharrlichkeit der “Generation Fax”, die Innovationen blockiert, dem Ansehen unseres Berufs mittelfristig schweren Schaden zufügen kann. Um so mehr würde mich interessieren, welche Erfahrungen in China mit Social Media im Archivbereich vorliegen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332286/
Das Bozner Stadtarchiv hat für seine Aufarbeitung von Faschismus und Nationalsozialismus in der Region die Auszeichnung überreicht bekommen. Der Wanderpreis ehrt friedensstiftendes Engagement, das mit den Mitteln der historischen Forschung und durch Öffentlichkeitsarbeit zu einer neuen Erinnerungskultur in Südtirol beigetragen hat.
http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=20565&COL0008=36
Zum Thema "Bozen - Stadt von 2 Diktaturen":
http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=976&page=5&area=48&id_context=14987
http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=20565&COL0008=36
Zum Thema "Bozen - Stadt von 2 Diktaturen":
http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=976&page=5&area=48&id_context=14987
ho - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 17:15
Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
http://historyblogosphere.org/call-for-papers
http://historyblogosphere.org/call-for-papers
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die ULB Düsseldorf digitalisiert gerade in großem Stil Schulprogramme, darunter auch drei Abhandlungen des Humanismusforschers Gustav Bauch:
Langer Link
Gut 500 Schulprogramme sind online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp
Wieso verdammtnochmal werden die Digitalisate nicht endlich in die Gießener Datenbank der Schulprogramme eingespeist?
Weitere Werke Bauchs online:
http://de.wikisource.org/wiki/Gustav_Bauch
Langer Link
Gut 500 Schulprogramme sind online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp
Wieso verdammtnochmal werden die Digitalisate nicht endlich in die Gießener Datenbank der Schulprogramme eingespeist?
Weitere Werke Bauchs online:
http://de.wikisource.org/wiki/Gustav_Bauch
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hundreds of original wartime art works are going online following a partnership between The National Archives and Wikimedia UK.
Photographed with a digitisation grant from Wikimedia UK, the collection is now freely available on Wikimedia Commons and includes oil paintings, drawings, posters, caricatures and portraits produced as propaganda for the Ministry of Information during the Second World War. There are currently over 350 pieces available to view online, but there are plans to digitise the entire collection of almost 2,000 art works.
The collection includes portraits of Allied commanders, members of the Royal Family and leading figures such as Stalin, Churchill and Eisenhower. Also showcased are some of the original works behind famous campaigns such as 'Dig for Victory' and 'Careless talk costs lives', as well as works by artists such as Terence Cuneo and Laura Knight.
http://nationalarchives.gov.uk/news/724.htm

Photographed with a digitisation grant from Wikimedia UK, the collection is now freely available on Wikimedia Commons and includes oil paintings, drawings, posters, caricatures and portraits produced as propaganda for the Ministry of Information during the Second World War. There are currently over 350 pieces available to view online, but there are plans to digitise the entire collection of almost 2,000 art works.
The collection includes portraits of Allied commanders, members of the Royal Family and leading figures such as Stalin, Churchill and Eisenhower. Also showcased are some of the original works behind famous campaigns such as 'Dig for Victory' and 'Careless talk costs lives', as well as works by artists such as Terence Cuneo and Laura Knight.
http://nationalarchives.gov.uk/news/724.htm

Der Blaubeurer Benediktiner Thomas Finck schrieb die Abhandlung 1493 im Kloster Lorch:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533
Zur Handschrift:
http://www.handschriftencensus.de/16356
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/
Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):
http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck
Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf
Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533
Zur Handschrift:
http://www.handschriftencensus.de/16356
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/
Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):
http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck
Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf
Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:50 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitalisierte Dokumente, u.a. gedruckte Reisebeschreibungen in Italienisch, Französisch usw., zur frühneuzeitlichen Adelsreise nach Italien:
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2012/06/14/grand-tour/
Zur Sache:
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf/babel-paravicini_grand-tour

http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2012/06/14/grand-tour/
Zur Sache:
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf/babel-paravicini_grand-tour

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mareike König hat den intellektuellen Titan Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford!) zum Bloggen befragt und nur sehr lapidare Antworten erhalten, die keineswegs Lust machen, sich das Interview anzuhören:
http://dhdhi.hypotheses.org/967
“Wenn die Förderungskriterien – die informellen – in Deutschland so sind, dann kann, bevor sie sich nicht verändern, man nicht jungen Leuten empfehlen zu bloggen.“
Die FAZ-Kolumne:
http://faz-community.faz.net/blogs/digital/default.aspx
Selbstverständlich gibts da keine Links und son Schnickschnack, sondern nur GEISTREICHES.
http://dhdhi.hypotheses.org/967
“Wenn die Förderungskriterien – die informellen – in Deutschland so sind, dann kann, bevor sie sich nicht verändern, man nicht jungen Leuten empfehlen zu bloggen.“
Die FAZ-Kolumne:
http://faz-community.faz.net/blogs/digital/default.aspx
Selbstverständlich gibts da keine Links und son Schnickschnack, sondern nur GEISTREICHES.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Abmahnwesen treibt sonderbare Blüten: Nun hat es den Filmemacher Rudolf Thome getroffen, der auf seiner Website zwei Kritiken aus dem Tagesspiegel zu seinen Filmen dokumentiert hatte und deshalb von einer Hamburger Kanzlei aufgefordert wird, knapp 950 Euro zu zahlen. Thome war selbst jahrelang Autor für das Blatt, wie er schreibt: "Wie kann dem Tagesspiegel ein Schaden durch die Wiedergabe zweier uralter Kritiken entstanden sein, frage ich mich. Und dann kriege ich so was ausgerechnet vom Tagesspiegel, für den ich selbst 15 Jahre lang Filmkritiken geschrieben habe." Im Tagesspiegel selbst fand man im März 2012 im übrigen noch recht deutliche Worte über die Abmahnindustrie: "Wenn das aktuelle Abmahnwesen in Deutschland eine Farbe hätte, wäre es schmutzig-grau. Mit allerlei Tricks versuchen Geschäftemacher, über Abmahnungen Geld zu verdienen. Privatleute, die sich als Anwälte ausgeben und betrügerische Massenabmahnungen per E-Mail verschicken, Anwälte, die das Internet nach Verstößen durchforsten und bei einem Fund die Rechteinhaber fragen, ob die Kanzlei ihre verletzten Rechte vertreten soll - das Geld könne man sich teilen."
http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2012-06-13.html
http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2012-06-13.html
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:45 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Bundesjustizministerium hat den bereits im Koalitionsvertrag geplanten und mehrfach angekündigten Referentenentwurf zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage vorgelegt. Der Entwurf für ein "Siebentes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes" wurde an die anderen Ministerien und Lobbykreise verschickt. Laut dem heise online vorliegenden, mittlerweile im Internet kursierenden Papier (PDF-Datei) sollen nur Herausgeber von Zeitungen und Zeitschriften Presseerzeugnisse zu gewerblichen Zwecken im Internet veröffentlichen dürfen. Die Verlage sollen auch verlangen können, dass ihre Erzeugnisse weiter nicht unerlaubt genutzt werden. "Gewerbliche Nutzer" müssten Lizenzen erwerben. Dies gelte nicht "für die reine Verlinkung" und Zitate.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerium-legt-Entwurf-fuer-neues-Leistungsschutzrecht-vor-1617614.html
http://www.irights.info/userfiles/RefE%20LSR.pdf
Dazu gibts nur 1 Kommentar: Schwachsinn!
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerium-legt-Entwurf-fuer-neues-Leistungsschutzrecht-vor-1617614.html
http://www.irights.info/userfiles/RefE%20LSR.pdf
Dazu gibts nur 1 Kommentar: Schwachsinn!
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:35 - Rubrik: Archivrecht
Zu
http://archiv.twoday.net/topics/Frauenarchive/
passt ein aktuelles Stellenangebot aus INETBIB:
Der FrauenMediaTurm in Köln stellt ein:
Wissenschaftliche Bibliothekarin mit politischem Interesse
Wir bieten: Einen Traumarbeitsplatz mit passionierenden Inhalten und ausbaubarem Profil.
Aufgaben: Erschließung und Erweiterung von Literatur und Dokumenten; Verstärkung der bibliothekarischen wie politischen Vernetzung; Freude an der Kommunikation mit NutzerInnen; Beitrag zu einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. Gehalt: angemessen.
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, fundierte Berufserfahrung, Vertrautheit mit neuen Medien, IT-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit Datenbanken. Kreativität, Teamgeist und Verantwortungssinn willkommen.
Die gemeinnützige Stiftung FrauenMediaTurm (FMT) wurde 1984 von Alice Schwarzer initiiert und wird heute von Land und Bund gefördert. Sie hat ihren Sitz in dem modern ausgebauten, mittelalterlichen Bayenturm am Rhein.
Bewerbungen an:
Vorstand des FrauenMediaTurm
Bayenturm
50678 Köln.
www.frauenmediaturm.de
--------------------------
Kontakt: Margitta Hösel
FrauenMediaTurm
Bayenturm, 50678 Köln
T 0221/931881-30, Fax -18
http://archiv.twoday.net/topics/Frauenarchive/
passt ein aktuelles Stellenangebot aus INETBIB:
Der FrauenMediaTurm in Köln stellt ein:
Wissenschaftliche Bibliothekarin mit politischem Interesse
Wir bieten: Einen Traumarbeitsplatz mit passionierenden Inhalten und ausbaubarem Profil.
Aufgaben: Erschließung und Erweiterung von Literatur und Dokumenten; Verstärkung der bibliothekarischen wie politischen Vernetzung; Freude an der Kommunikation mit NutzerInnen; Beitrag zu einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. Gehalt: angemessen.
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, fundierte Berufserfahrung, Vertrautheit mit neuen Medien, IT-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit Datenbanken. Kreativität, Teamgeist und Verantwortungssinn willkommen.
Die gemeinnützige Stiftung FrauenMediaTurm (FMT) wurde 1984 von Alice Schwarzer initiiert und wird heute von Land und Bund gefördert. Sie hat ihren Sitz in dem modern ausgebauten, mittelalterlichen Bayenturm am Rhein.
Bewerbungen an:
Vorstand des FrauenMediaTurm
Bayenturm
50678 Köln.
www.frauenmediaturm.de
--------------------------
Kontakt: Margitta Hösel
FrauenMediaTurm
Bayenturm, 50678 Köln
T 0221/931881-30, Fax -18
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 14:04 - Rubrik: Frauenarchive
"Kulturelles Erbe erhalten. Nordrhein-Westfalen ist reich an materiellen und immateriellen Kulturgütern. Wir wollen die Anstrengungen, sie zu erhalten, zu sichern und ihre Institutionen zu vernetzen, weiter verstärken. Denkmalpflege, Archäologie und konsequenter Erhalt und Ausbau der Archive bleiben deshalb wichtige Aufgaben."(NRW-Koalitionsvertrag S. 163, Zeilen 7486-7491) - wichtige Aufgaben ohne Geld?
Link: http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
Link: http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:55 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
seit gestern ist die Seite "Hexenprozesse in Kurmainz" freigeschaltet und unter
http://www.hexenprozesse-kurmainz.de/
zu finden.
Sie wird als Internetpräsenz auf „regionalgeschichte.net“ geführt.
Die Seite beinhaltet am Beispiel von Mainz unter Heranziehung von digitalisierten Archivalien einen Überblick zu Kurmainz mit dem Schwerpunkt auf Dieburg. Diese war besonders von der Verfolgung betroffen. Die Akten dieser Verfolgung sind im Stadtarchiv Mainz zugänglich.
Mit dem Gedanken, die Akten und deren Hintergründe einem größeren Publikum zugänglich zu machen, arbeitete 1999 bis 2004 eine Gruppe von Studierenden im Rahmen des Arbeitskreises „Hexenprozesse in Kurmainz“ unter der Leitung von Ludolf Pelizaeus (Historisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) an der Erstellung einer CD-Rom. Diese enthält digitalisierte Archivalien, gesprochene und geschriebene Texte, Hintergrundinformationen, zeitgenössische Musik und Listen der Opfer. Unterstützt wurden wir durch Beiträge von Herbert Pohl, Rita Voltmer und Walter Rummel. Hinzu kam zwischen 2005 und 2010 die Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung des Sujets „Hexenverfolgung“ durch Studierende der JGU.
Um diese Inhalte allgemein zugänglich zu machen, wurde 2011 begonnen, sie auf eine Seite auf dem von Institut für Geschichtliche Landeskunde betriebenen Portal „regionalgeschichte.net“ online zu stellen.
Ich hoffe, das Resultat dieses studentischen Projekts findet Interesse. Weitere Beiträge in dem regionalen Rahmen können aufgenommen werden und sind damit eine Ergänzung zu regionalgeschichte.net. Die Verknüpfung mit Historicum.net. soll ebenfalls bald erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ludolf Pelizaeus (Via ML Hexenforschung)
http://www.hexenprozesse-kurmainz.de/
zu finden.
Sie wird als Internetpräsenz auf „regionalgeschichte.net“ geführt.
Die Seite beinhaltet am Beispiel von Mainz unter Heranziehung von digitalisierten Archivalien einen Überblick zu Kurmainz mit dem Schwerpunkt auf Dieburg. Diese war besonders von der Verfolgung betroffen. Die Akten dieser Verfolgung sind im Stadtarchiv Mainz zugänglich.
Mit dem Gedanken, die Akten und deren Hintergründe einem größeren Publikum zugänglich zu machen, arbeitete 1999 bis 2004 eine Gruppe von Studierenden im Rahmen des Arbeitskreises „Hexenprozesse in Kurmainz“ unter der Leitung von Ludolf Pelizaeus (Historisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) an der Erstellung einer CD-Rom. Diese enthält digitalisierte Archivalien, gesprochene und geschriebene Texte, Hintergrundinformationen, zeitgenössische Musik und Listen der Opfer. Unterstützt wurden wir durch Beiträge von Herbert Pohl, Rita Voltmer und Walter Rummel. Hinzu kam zwischen 2005 und 2010 die Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung des Sujets „Hexenverfolgung“ durch Studierende der JGU.
Um diese Inhalte allgemein zugänglich zu machen, wurde 2011 begonnen, sie auf eine Seite auf dem von Institut für Geschichtliche Landeskunde betriebenen Portal „regionalgeschichte.net“ online zu stellen.
Ich hoffe, das Resultat dieses studentischen Projekts findet Interesse. Weitere Beiträge in dem regionalen Rahmen können aufgenommen werden und sind damit eine Ergänzung zu regionalgeschichte.net. Die Verknüpfung mit Historicum.net. soll ebenfalls bald erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ludolf Pelizaeus (Via ML Hexenforschung)
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:54 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei der Katalogisierung der griechischen Handschriften aus der Büchersammlung Johann Jakob Fuggers wurde kürzlich in der Bayerischen Staatsbibliothek eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Die Philologin Marina Molin Pradel identifizierte bei der Katalogisierung einer Handschrift zahlreiche Texte der bislang nicht im Original bekannten griechischen Predigten zu den Psalmen von Origenes von Alexandria (185 - 253/54 n. Chr.), dem bedeutendsten Theologen der frühen christlichen Kirche vor Augustinus. Dieser Fund ist für die Forschung von nicht hoch genug einzuschätzender Bedeutung. Die Zuordnung zu Origenes wurde vom international anerkannten Origenes-Experten Lorenzo Perrone von der Universität Bologna mit höchster Wahrscheinlichkeit bestätigt.
Origenes gilt als Begründer der allegorischen Bibelauslegung. Seine zahlreichen, oft allerdings nicht mehr oder nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werke sind Grundfundament christlichen Denkens. Als Philosoph, Theologe, Philologe und Prediger hat Origenes die Geistesgeschichte von der Spätantike bis heute tief geprägt. Seine Predigten und Auslegungen zu den Psalmen waren bisher nur bruchstückhaft und lediglich in lateinischer Übersetzung überliefert. Die nun in ihrem wahren Inhalt identifizierte, unauffällig aussehende, umfangreiche griechische Handschrift stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Der Fund ist überaus bedeutend, sowohl was Alter wie auch Umfang der Texte angeht. Er wird in Wissenschafts- und Forscherkreisen lebhafte Diskussionen auslösen und sogar neue Erkenntnisse für den Text der griechischen Bibelfassung erlauben. Alle Kirchenväter haben Origenes gelesen und intensiv rezipiert. Die Entdeckung erlaubt es nun, sich mit bislang unbekannten Originaltexten zu befassen, so Generaldirektor Rolf Griebel.
Die Handschrift wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek bereits digitalisiert und ist für jedermann im Internet abrufbar:
www.digitale-sammlungen.de > Eingabe Homiliae in psalmos
Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt mehr als 650 griechische Handschriften und damit den größten Bestand in Deutschland. Er wurde und wird von der Wissenschaft intensiv genutzt. Die wissenschaftliche Erschließung erfolgt im hauseigenen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten, Handschriftenerschließungszentrum. Der Fund macht die Notwendigkeit und den Erkenntnisgewinn dieser detaillierten und aufwendigen Analysen augenfällig. Die Katalogisierung der griechischen Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, mindestens fünfzehn weitere Jahre wird es dauern, bis alle griechischen Handschriften neu beschrieben sind. (Via u.a. DISKUS)
Wozu macht denn die BSB persistente Links und verwendet URN, wenn die eigene Presseabteilung damit offenbar noch nicht umgehen kann?
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00050972/image_1
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00050972-0
Origenes gilt als Begründer der allegorischen Bibelauslegung. Seine zahlreichen, oft allerdings nicht mehr oder nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werke sind Grundfundament christlichen Denkens. Als Philosoph, Theologe, Philologe und Prediger hat Origenes die Geistesgeschichte von der Spätantike bis heute tief geprägt. Seine Predigten und Auslegungen zu den Psalmen waren bisher nur bruchstückhaft und lediglich in lateinischer Übersetzung überliefert. Die nun in ihrem wahren Inhalt identifizierte, unauffällig aussehende, umfangreiche griechische Handschrift stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Der Fund ist überaus bedeutend, sowohl was Alter wie auch Umfang der Texte angeht. Er wird in Wissenschafts- und Forscherkreisen lebhafte Diskussionen auslösen und sogar neue Erkenntnisse für den Text der griechischen Bibelfassung erlauben. Alle Kirchenväter haben Origenes gelesen und intensiv rezipiert. Die Entdeckung erlaubt es nun, sich mit bislang unbekannten Originaltexten zu befassen, so Generaldirektor Rolf Griebel.
Die Handschrift wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek bereits digitalisiert und ist für jedermann im Internet abrufbar:
www.digitale-sammlungen.de > Eingabe Homiliae in psalmos
Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt mehr als 650 griechische Handschriften und damit den größten Bestand in Deutschland. Er wurde und wird von der Wissenschaft intensiv genutzt. Die wissenschaftliche Erschließung erfolgt im hauseigenen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten, Handschriftenerschließungszentrum. Der Fund macht die Notwendigkeit und den Erkenntnisgewinn dieser detaillierten und aufwendigen Analysen augenfällig. Die Katalogisierung der griechischen Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, mindestens fünfzehn weitere Jahre wird es dauern, bis alle griechischen Handschriften neu beschrieben sind. (Via u.a. DISKUS)
Wozu macht denn die BSB persistente Links und verwendet URN, wenn die eigene Presseabteilung damit offenbar noch nicht umgehen kann?
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00050972/image_1
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00050972-0
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:45 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus Inetbib:
> Die von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
> herausgegebene Zeitschrift BIBLIOTHEKSDIENST erscheint ab
> 2013 bei De Gruyter
> Die Einzelausgaben werden
> zwölf Monate nach ihrem Erscheinen Open Access gestellt.
>
> "Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist sicher, mit
> De Gruyter einen hervorragenden Kooperationspartner
> gewählt zu haben, um die erforderliche gestalterische und
> technische Neuausrichtung des BIBLIOTHEKSDIENST
> umzusetzen", sagt Hans Joachim Rieseberg,
> Interim-Managementdirektor der Zentral- und
> Landesbibliothek Berlin. "Damit uns diese bestmöglich
> gelingt, werden wir einen Beirat einberufen, der den
> Prozess beratend begleiten wird."
Wieder ein erbaermliches Beispiel fuer die Open-Access-Heuchelei der deutschen Bibliothekare und eine eklatante Verschlechterung fuer Open Access, da sich das Embargo vervierfacht. Derzeit gilt naemlich:
"Die Beiträge der Rubrik "Themen" der einzelnen Hefte werden drei Monate nach Erscheinen der Druckausgabe online im PDF-Format veröffentlicht, die Stellenanzeigen ca. 14 Tage nach Erscheinen der Druckausgabe."
Klaus Graf
http://archiv.twoday.net/stories/38788072/
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=22056
http://archiv.twoday.net/stories/97070594/

> Die von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
> herausgegebene Zeitschrift BIBLIOTHEKSDIENST erscheint ab
> 2013 bei De Gruyter
> Die Einzelausgaben werden
> zwölf Monate nach ihrem Erscheinen Open Access gestellt.
>
> "Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist sicher, mit
> De Gruyter einen hervorragenden Kooperationspartner
> gewählt zu haben, um die erforderliche gestalterische und
> technische Neuausrichtung des BIBLIOTHEKSDIENST
> umzusetzen", sagt Hans Joachim Rieseberg,
> Interim-Managementdirektor der Zentral- und
> Landesbibliothek Berlin. "Damit uns diese bestmöglich
> gelingt, werden wir einen Beirat einberufen, der den
> Prozess beratend begleiten wird."
Wieder ein erbaermliches Beispiel fuer die Open-Access-Heuchelei der deutschen Bibliothekare und eine eklatante Verschlechterung fuer Open Access, da sich das Embargo vervierfacht. Derzeit gilt naemlich:
"Die Beiträge der Rubrik "Themen" der einzelnen Hefte werden drei Monate nach Erscheinen der Druckausgabe online im PDF-Format veröffentlicht, die Stellenanzeigen ca. 14 Tage nach Erscheinen der Druckausgabe."
Klaus Graf
http://archiv.twoday.net/stories/38788072/
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=22056
http://archiv.twoday.net/stories/97070594/

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:36 - Rubrik: Open Access
Pappelallee-Grundschüler erleben Stadtgeschichte hautnah
Was ist eigentlich ein Archiv und wozu braucht man das? Welche Aufgaben hat ein Archivar und wer bestimmt, was im Archiv aufbewahrt wird? Fragen über Fragen, die sich unter anderem auch die Schüler der Grundschule An der Pappelallee gestellt haben. Daraus entstanden ist der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. Diese wurde mit der Unterzeichnung einer "Bildungspartnerschaft Archiv und Schule" jetzt offiziell besiegelt. Dazu waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3d mit ihrer Lehrerin Gabriele Niemeier-Illies und Schulleiterin Bettina Pichmann ins Archiv gekommen.
"Für die Kinder ist es bereits der zweite Besuch im Archiv", erzählt Gabriele Niemeier-Illies. Beim ersten Mal hatten die Schüler gemeinsam mit Stadtarchivarin Dr. Claudia Becker das Archiv erforscht und dabei nicht nur etwas über die Lippstädter Stadtgeschichte erfahren, sondern auch alte Urkunden gesehen und gelernt, wie ein Archivar entscheidet, welche Dinge aufbewahrt werden und welche nicht. "Das Spannendste war für die Kinder sicherlich, als sie selbst sortieren mussten", so Dr. Claudia Becker über die ersten Praxiserfahrungen der Schüler im Archiv. Und genau dieser Praxisbezug soll die Bildungspartnerschaft, der eine Initiative des Landes zugrunde liegt, ausmachen. "In der dritten Klasse nehmen die Schüler im Sachunterricht die Lippstädter Stadtgeschichte durch", erklärt Bettina Pichmann. Durch den Besuch und die praktische Arbeit im Stadtarchiv werde das theoretische Wissen noch mehr vertieft und die Schüler würden früh an die Arbeit und die Möglichkeiten im Archiv herangeführt.
Praktisch ging es dann auch beim aktuellen Besuch der Schüler zu. Mit Feder und Tinte lernten die rund 20 Schüler unter der Anleitung von Dr. Claudia Becker die alte "Deutsche Schrift". Die Stadtarchivarin war beeindruckt von ihren gelehrigen Schreibschülern, die in dem neu erlernten Sütterlin auch schnell einen unschlagbaren Vorteil erkannten: "Das ist eine richtig coole Geheimschrift", waren sich alle einig. Wie lange sich dieser Vorteil hält, bleibt jedoch abzuwarten, denn die neue Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Archiv sieht vor, dass in Zukunft alle dritten Klassen für zwei praktische Unterrichtseinheiten das Archiv besuchen. Bis es soweit ist, können die Schüler der 3d allerdings noch getrost in ihrer neuen Geheimsprache kommunizieren.
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Was ist eigentlich ein Archiv und wozu braucht man das? Welche Aufgaben hat ein Archivar und wer bestimmt, was im Archiv aufbewahrt wird? Fragen über Fragen, die sich unter anderem auch die Schüler der Grundschule An der Pappelallee gestellt haben. Daraus entstanden ist der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. Diese wurde mit der Unterzeichnung einer "Bildungspartnerschaft Archiv und Schule" jetzt offiziell besiegelt. Dazu waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3d mit ihrer Lehrerin Gabriele Niemeier-Illies und Schulleiterin Bettina Pichmann ins Archiv gekommen.
"Für die Kinder ist es bereits der zweite Besuch im Archiv", erzählt Gabriele Niemeier-Illies. Beim ersten Mal hatten die Schüler gemeinsam mit Stadtarchivarin Dr. Claudia Becker das Archiv erforscht und dabei nicht nur etwas über die Lippstädter Stadtgeschichte erfahren, sondern auch alte Urkunden gesehen und gelernt, wie ein Archivar entscheidet, welche Dinge aufbewahrt werden und welche nicht. "Das Spannendste war für die Kinder sicherlich, als sie selbst sortieren mussten", so Dr. Claudia Becker über die ersten Praxiserfahrungen der Schüler im Archiv. Und genau dieser Praxisbezug soll die Bildungspartnerschaft, der eine Initiative des Landes zugrunde liegt, ausmachen. "In der dritten Klasse nehmen die Schüler im Sachunterricht die Lippstädter Stadtgeschichte durch", erklärt Bettina Pichmann. Durch den Besuch und die praktische Arbeit im Stadtarchiv werde das theoretische Wissen noch mehr vertieft und die Schüler würden früh an die Arbeit und die Möglichkeiten im Archiv herangeführt.
Praktisch ging es dann auch beim aktuellen Besuch der Schüler zu. Mit Feder und Tinte lernten die rund 20 Schüler unter der Anleitung von Dr. Claudia Becker die alte "Deutsche Schrift". Die Stadtarchivarin war beeindruckt von ihren gelehrigen Schreibschülern, die in dem neu erlernten Sütterlin auch schnell einen unschlagbaren Vorteil erkannten: "Das ist eine richtig coole Geheimschrift", waren sich alle einig. Wie lange sich dieser Vorteil hält, bleibt jedoch abzuwarten, denn die neue Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Archiv sieht vor, dass in Zukunft alle dritten Klassen für zwei praktische Unterrichtseinheiten das Archiv besuchen. Bis es soweit ist, können die Schüler der 3d allerdings noch getrost in ihrer neuen Geheimsprache kommunizieren.
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:07 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Zahlreiche Open Access Verlage und NGOs stellen auf PaperC ihre Titel kostenfrei zur Verfügung. Danke dafür an die: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Hamburg University Press, Internet & Gesellschaft Co:llaboratory, KIT Scientific Publishing, Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Universitätsverlag der TU Berlin und Universitätsverlag Göttingen. Von Chemie über Social Science bis hin zu Medienwissenschaften ist für viele etwas dabei!"
http://paperc.de
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=paperc
http://paperc.de
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=paperc
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:06 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die ULB Düsseldorf hat digitalisiert
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/3888158
10 Jahre Archiv für Alternatives Schrifttum (AFAS), 30 Jahre Druck von unten : Reader zur Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 7. Dezember 1995 - 17. Februar 1996
Archiv für Alternatives Schrifttum in NRW ; Universitäts- und Landesbibliothek
Düsseldorf, 1995
Online-Ausg. Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2012
185 S. : zahlr. Ill.
Materialien des Archivs für Alternatives Schrifttum ; 4
Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 23
Gruß
J. Paul
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/3888158
10 Jahre Archiv für Alternatives Schrifttum (AFAS), 30 Jahre Druck von unten : Reader zur Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 7. Dezember 1995 - 17. Februar 1996
Archiv für Alternatives Schrifttum in NRW ; Universitäts- und Landesbibliothek
Düsseldorf, 1995
Online-Ausg. Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2012
185 S. : zahlr. Ill.
Materialien des Archivs für Alternatives Schrifttum ; 4
Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 23
Gruß
J. Paul
J. Paul - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 09:45 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
... des Hamburger Christianeums mit einem nicht weniger bemerkenswerten digitalen Angebot, beispielsweise zu den Direktoren der Anstalt:
http://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=172&limitstart=6
http://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=172&limitstart=6
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 23:24 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://the1709blog.blogspot.it/2012/06/some-french-fresh-air-to-google-books.html
Zum offenbar illusorischen US-Settlement:
http://archiv.twoday.net/search?q=settlement
Zum offenbar illusorischen US-Settlement:
http://archiv.twoday.net/search?q=settlement
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 23:22 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Kurzbeitrag in ARBIDO, dankenswerterweise Open Access selbstarchiviert unter:
http://weblog.hist.net/wp-content/uploads/2012/06/arbido2012-1.pdf
Am Ende wird Archivalia als "beste Informationsquelle" für laufende Entwicklungen im Archivbereich hervorgehoben.
http://weblog.hist.net/wp-content/uploads/2012/06/arbido2012-1.pdf
Am Ende wird Archivalia als "beste Informationsquelle" für laufende Entwicklungen im Archivbereich hervorgehoben.
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 22:00 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5394
"Kernstück des Entwurfs ist das öffentliche Informationsregister, in das die Verwaltung zukünftig eine Vielzahl von Daten, Dokumenten, Statistiken, Verträgen und Vorschriften einstellt. Das Gesetz gibt konkret vor, welche Daten im Informationsregister zu veröffentlichen sind. In Zukunft können dann Bürgerinnen und Bürger ohne individuellen Antrag dort Einsicht nehmen und sich über das Verwaltungshandeln informieren. Auch die Grundlagen, die zu den Entscheidungen geführt haben, erfahren Bürgerinnen und Bürger so aus erster Hand. Für Interessierte ohne Internetzugang soll ein Zugang über öffentliche Terminals, zum Beispiel in den Bücherhallen, ermöglicht werden. Das Informationsregister bietet nicht zuletzt auch der Presse ganz neue Recherchemöglichkeiten. Weiter wird durch das Transparenzgesetz der antragsgebundene Informationszugang, der bisher durch das Hamburgische Informationsfreiheitsgesetz geregelt war, noch einmal ausgeweitet, indem die Ablehnungsgründe reduziert werden."
Siehe auch
http://de.hamburgertransparenzgesetz.wikia.com/wiki/Hamburger_Transparenzgesetz_Wiki
https://twitter.com/#!/transparenz_hh
http://www.transparenzgesetz.de/41/?tx_ttnews[tt_news]=141&cHash=65d6352607c0961116c5cf1bc4b25119
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ (aktuelle Dokumente oder nach Transparenzgesetz suchen)
http://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article2305598/Hamburg-wird-transparent.html
"Kernstück des Entwurfs ist das öffentliche Informationsregister, in das die Verwaltung zukünftig eine Vielzahl von Daten, Dokumenten, Statistiken, Verträgen und Vorschriften einstellt. Das Gesetz gibt konkret vor, welche Daten im Informationsregister zu veröffentlichen sind. In Zukunft können dann Bürgerinnen und Bürger ohne individuellen Antrag dort Einsicht nehmen und sich über das Verwaltungshandeln informieren. Auch die Grundlagen, die zu den Entscheidungen geführt haben, erfahren Bürgerinnen und Bürger so aus erster Hand. Für Interessierte ohne Internetzugang soll ein Zugang über öffentliche Terminals, zum Beispiel in den Bücherhallen, ermöglicht werden. Das Informationsregister bietet nicht zuletzt auch der Presse ganz neue Recherchemöglichkeiten. Weiter wird durch das Transparenzgesetz der antragsgebundene Informationszugang, der bisher durch das Hamburgische Informationsfreiheitsgesetz geregelt war, noch einmal ausgeweitet, indem die Ablehnungsgründe reduziert werden."
Siehe auch
http://de.hamburgertransparenzgesetz.wikia.com/wiki/Hamburger_Transparenzgesetz_Wiki
https://twitter.com/#!/transparenz_hh
http://www.transparenzgesetz.de/41/?tx_ttnews[tt_news]=141&cHash=65d6352607c0961116c5cf1bc4b25119
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ (aktuelle Dokumente oder nach Transparenzgesetz suchen)
http://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article2305598/Hamburg-wird-transparent.html
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 21:35 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein [sog.] Mainzer Karmeliter-Einband
ehemals in der Öffentlichen Bibliothek Meiningen:
Langer Link
Zur Meininger Bibliothek:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg20556.html
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2001/0417.html
Update zur Werkstatt von Annelen Ottermann:
"Die durch den Hilfsnamen "Mainz Karmeliter-Meister" nahegelegte Verbindung mit einer Einbandwerkstatt des Mainzer Karmeliterklosters ist so sicher nicht ohne weiteres aufrecht zu erhalten. Insofern empfehle ich Zurückhaltung bei der Zuschreibung "a binding by the Carmelite Convent of Mainz, ca. 1478", auch wenn inzwischen ca. ein Dutzend Inkunabeln aus Mainzer Karmeliterprovenienz aus der Werkstatt "M mit Krone" nachgewiesen werden konnten. (Näheres in Speyer bei der AEB-Tagung)"
Update von Paul Needham:
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2012-June/000526.html
ehemals in der Öffentlichen Bibliothek Meiningen:
Langer Link
Zur Meininger Bibliothek:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg20556.html
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2001/0417.html
Update zur Werkstatt von Annelen Ottermann:
"Die durch den Hilfsnamen "Mainz Karmeliter-Meister" nahegelegte Verbindung mit einer Einbandwerkstatt des Mainzer Karmeliterklosters ist so sicher nicht ohne weiteres aufrecht zu erhalten. Insofern empfehle ich Zurückhaltung bei der Zuschreibung "a binding by the Carmelite Convent of Mainz, ca. 1478", auch wenn inzwischen ca. ein Dutzend Inkunabeln aus Mainzer Karmeliterprovenienz aus der Werkstatt "M mit Krone" nachgewiesen werden konnten. (Näheres in Speyer bei der AEB-Tagung)"
Update von Paul Needham:
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/pipermail/provenienz/2012-June/000526.html
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 21:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Steinhauer hat auf Twitter eine Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Trier von 2011 ausgegraben, die das Lesen von Weblogs an den Internetarbeitsplätzen verbietet:
http://cms.trier.de/stadt-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=10300&Media.Object.ObjectType=full
Ist mit Blick auf Art. 5 GG aus meiner Sicht eindeutig rechtswidrig.
http://cms.trier.de/stadt-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=10300&Media.Object.ObjectType=full
Ist mit Blick auf Art. 5 GG aus meiner Sicht eindeutig rechtswidrig.
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 21:15 - Rubrik: Archivrecht
http://filosofiastoria.wordpress.com/2012/06/11/repertori-archivistici-non-editi-degli-archivi-di-stato-e-delle-soprintendenze-archivistiche/
"Una sezione specifica della Biblioteca Digitale del sito dell’ICAR – Istituto centrale per gli archivi offre un accesso unificato e integrato al patrimonio degli strumenti di ricerca non editi prodotti dagli istituti archivistici italiani.
A tal fine è stata effettuata una ricognizione degli inventari realizzati da ciascuno istituto archivistico e già disponibili online su SIAS e sui siti dei singoli Archivi e delle Soprintendenze archivistiche.
Si tratta di circa 2.600 repertori tra inventari (sommari ed analitici), guide, elenchi e base dati realizzati dagli istituti archivistici e disponibili in passato solo in formato cartaceo nelle sale di studio.
>> consulta i Repertori archivistici non editi degli Archivi di Stato
>> consulta i Repertori archivistici non editi a cura delle Soprintendenze archivistiche"
Bei einem solchen Angebot sich auf eine Google Custom-Search zu verlassen, ist abwegig. Zum 100. Mal: Diese Suche erfasst nur das, was Google erfasst und das ist in der Regel nicht alles. Und die Suche bietet in nicht-nachvollziehbarer Weise Treffer.
"Una sezione specifica della Biblioteca Digitale del sito dell’ICAR – Istituto centrale per gli archivi offre un accesso unificato e integrato al patrimonio degli strumenti di ricerca non editi prodotti dagli istituti archivistici italiani.
A tal fine è stata effettuata una ricognizione degli inventari realizzati da ciascuno istituto archivistico e già disponibili online su SIAS e sui siti dei singoli Archivi e delle Soprintendenze archivistiche.
Si tratta di circa 2.600 repertori tra inventari (sommari ed analitici), guide, elenchi e base dati realizzati dagli istituti archivistici e disponibili in passato solo in formato cartaceo nelle sale di studio.
>> consulta i Repertori archivistici non editi degli Archivi di Stato
>> consulta i Repertori archivistici non editi a cura delle Soprintendenze archivistiche"
Bei einem solchen Angebot sich auf eine Google Custom-Search zu verlassen, ist abwegig. Zum 100. Mal: Diese Suche erfasst nur das, was Google erfasst und das ist in der Regel nicht alles. Und die Suche bietet in nicht-nachvollziehbarer Weise Treffer.
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 21:11 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu den Handschriften des Historischen Vereins für Mittelfranken zählt auch eine Hexenprozessakte aus Oberschwaben:
"Kriminalprozess ("Hexenprozess") über die zu Buchau am Federsee inhaftierte, 63jährige Elisabeth
Kolbin von Rupertshofen, welche wegen Magie und Umgang mit dem Teufel mit der Feuerstrafe am
3. Sept. 1746 hingerichtet wurde. Enthält v.a.: Protokolle über ereignete Wetterschäden 1743, 1745
(Abschrift); Verhör der Kolbin; Urteil d.d. Biberach den 28. Aug. 1746; Urgich. Enthält auch: Klage
der Sabina Müllerin von Ogelspeyren (wohl Oggelsbeuren) wegen Bezichtigung als Hexe und
darauf folgendes Verhör 1747. Umfang: ca. 0,08 lfm. Provenienz: Stift Buchau.
Der Weg dieses Stücks in die Sammlung des HV Mittelfranken kann durch eine Notiz im Akt in
etwa nachgezeichnet werden: Der Akt gelangte mittels Schenkung der Witwe des
Oberlandesgerichtspräsidenten v. Enderlein (gest. 1906, Mitglied des HV Mittelfranken) am 1.
Januar 1907 an den HV Mittelfranken. Ihr Vater, der fürstl. Thurn und Taxis'sche Rentamtmann
Sartorius in Obermarchthal, hatte den Akt (wohl nach der Säkularisation) aus dem Archiv des
Reichsstifts Buchau erhalten." (Freundliche Mitteilung von AOR Dr. Daniel Burger, Staatsarchiv Nürnberg, wo die Handschriften als Depositum lagern: http://archiv.twoday.net/stories/97052702/ )
Zu den Prozessen in Buchau wenige Hinweise in:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?S1=hexenforschung
Die Kolbin wird erwähnt auf der Website der Buchauer "Feuerhexen":
http://www.feuerhexen-badbuchau.de/Feuerhexe.htm
#fnzhss
"Kriminalprozess ("Hexenprozess") über die zu Buchau am Federsee inhaftierte, 63jährige Elisabeth
Kolbin von Rupertshofen, welche wegen Magie und Umgang mit dem Teufel mit der Feuerstrafe am
3. Sept. 1746 hingerichtet wurde. Enthält v.a.: Protokolle über ereignete Wetterschäden 1743, 1745
(Abschrift); Verhör der Kolbin; Urteil d.d. Biberach den 28. Aug. 1746; Urgich. Enthält auch: Klage
der Sabina Müllerin von Ogelspeyren (wohl Oggelsbeuren) wegen Bezichtigung als Hexe und
darauf folgendes Verhör 1747. Umfang: ca. 0,08 lfm. Provenienz: Stift Buchau.
Der Weg dieses Stücks in die Sammlung des HV Mittelfranken kann durch eine Notiz im Akt in
etwa nachgezeichnet werden: Der Akt gelangte mittels Schenkung der Witwe des
Oberlandesgerichtspräsidenten v. Enderlein (gest. 1906, Mitglied des HV Mittelfranken) am 1.
Januar 1907 an den HV Mittelfranken. Ihr Vater, der fürstl. Thurn und Taxis'sche Rentamtmann
Sartorius in Obermarchthal, hatte den Akt (wohl nach der Säkularisation) aus dem Archiv des
Reichsstifts Buchau erhalten." (Freundliche Mitteilung von AOR Dr. Daniel Burger, Staatsarchiv Nürnberg, wo die Handschriften als Depositum lagern: http://archiv.twoday.net/stories/97052702/ )
Zu den Prozessen in Buchau wenige Hinweise in:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?S1=hexenforschung
Die Kolbin wird erwähnt auf der Website der Buchauer "Feuerhexen":
http://www.feuerhexen-badbuchau.de/Feuerhexe.htm
#fnzhss
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 20:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.scilogs.de/blogs/blog/quantensprung/2012-06-12/das-neue-open-acces-journal-peerj-jetzt-offen-f-r-erste-mitglieder
Das neue OA-Portal PeerJ verspricht gegen eine einmalige Zahlung von derzeit 99 USD ein lebenslängliches Recht auf eine Publikation pro Jahr auf dem hauptsächlich auf Biologie und Medizin ausgerichteten Portal. Für 169 USD sind lebenslänglich zwei Publikationen pro Jahr möglich. Mit zunächst 259 USD sogar eine unlimitierte Anzahl! Allerdings müssen Co-Autoren ebenfalls Mitglieder sein. Ein Paper mit fünf Co-Autoren könnte also für weniger als 500 USD veröffentlicht werden.
Selbstverständlich sollen die Fachartikel einen ordentlichen Peer-Review-Prozess durchlaufen. Als Reviewer werden auch Mitglieder herangezogen werden. Jedes Mitglied soll mindestens einmal im Jahr ein PeerJPrePrint oder PeerJ Paper reviewen. Wer dies nicht tut, riskiert seine Mitgliedschaft. Angelehnt an das EMBO-Journal wollen Binfield und Hoyt erreichen, dass die Autoren erfahren können, wer ihre Reviewer sind und dass sie den gesamten Reviewprozess öffentlich machen (können). Das alles soll auch noch schneller ablaufen, als herkömmlich.
Leider bezieht sich PeerJ wieder nur auf die biomedizinische Forschung. Ein OA-Journal auch für die Geisteswissenschaften und alle Sprachen bleibt ein Desiderat.
Links:
http://scienceblogs.com/confessions/2012/06/13/around-the-web-peerj-orama-why-twitter-matters-using-twitter-in-university-research-teaching-and-impact-activities-and-more/
http://scienceblogs.com/confessions/2012/06/12/peerj-formally-announced-innovative-new-business-model-for-open-access/
Das neue OA-Portal PeerJ verspricht gegen eine einmalige Zahlung von derzeit 99 USD ein lebenslängliches Recht auf eine Publikation pro Jahr auf dem hauptsächlich auf Biologie und Medizin ausgerichteten Portal. Für 169 USD sind lebenslänglich zwei Publikationen pro Jahr möglich. Mit zunächst 259 USD sogar eine unlimitierte Anzahl! Allerdings müssen Co-Autoren ebenfalls Mitglieder sein. Ein Paper mit fünf Co-Autoren könnte also für weniger als 500 USD veröffentlicht werden.
Selbstverständlich sollen die Fachartikel einen ordentlichen Peer-Review-Prozess durchlaufen. Als Reviewer werden auch Mitglieder herangezogen werden. Jedes Mitglied soll mindestens einmal im Jahr ein PeerJPrePrint oder PeerJ Paper reviewen. Wer dies nicht tut, riskiert seine Mitgliedschaft. Angelehnt an das EMBO-Journal wollen Binfield und Hoyt erreichen, dass die Autoren erfahren können, wer ihre Reviewer sind und dass sie den gesamten Reviewprozess öffentlich machen (können). Das alles soll auch noch schneller ablaufen, als herkömmlich.
Leider bezieht sich PeerJ wieder nur auf die biomedizinische Forschung. Ein OA-Journal auch für die Geisteswissenschaften und alle Sprachen bleibt ein Desiderat.
Links:
http://scienceblogs.com/confessions/2012/06/13/around-the-web-peerj-orama-why-twitter-matters-using-twitter-in-university-research-teaching-and-impact-activities-and-more/
http://scienceblogs.com/confessions/2012/06/12/peerj-formally-announced-innovative-new-business-model-for-open-access/
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 20:43 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Falk Eisermann weist mich freundlicherweise hin auf:
http://www.pbagalleries.com/search/item.php?anr=226838
http://www.pbagalleries.com/search/item.php?anr=226838
KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 20:24 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_1_2012.pdf
U.a. mit einem Bericht über den aktuellen Stand des Projekts "Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung (LeA)"
U.a. mit einem Bericht über den aktuellen Stand des Projekts "Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung (LeA)"
ingobobingo - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 16:19 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit dem 03.02.2012 ist Andrea Wettmann als Nachfolgerin von Jürgen Rainer Wolf Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs. Die feierliche Amtseinführung erfolgte am 04.06.2012. Hier ein Bericht auf der Internetpräsenz der sächsischen Staatskanzlei:
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/169776
Und hier eine PM des Sächsischen Staatsarchivs:
http://www.archiv.sachsen.de/download/Amtseinfuehrung_Wettmann_1.pdf
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/169776
Und hier eine PM des Sächsischen Staatsarchivs:
http://www.archiv.sachsen.de/download/Amtseinfuehrung_Wettmann_1.pdf
ingobobingo - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 15:51 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Spurensuche im Archiv
Dieser Artikel ist ab dem 27.06.2012 lieferbar
Hauptfilm (6 Episoden, 30. Min.) und 6 vertiefende Episoden, zusammen 60 Min.
DVD mit Begleitheft, 2012 (D 147)
Archiv – schon das Wort klingt für manchen Schüler nach staubigen Kellern und muffigen Akten. Dass Archive spannende Lernorte sein können, die zu vielfältigen Entdeckungsreisen in die Vergangenheit einladen, zeigt diese DVD. In kurzen Spielfilmsequenzen vermitteln der Hauptfilm und sechs vertiefende Episoden die spannenden Seiten der vermeintlich staubtrockenen Archivarbeit.
Wie geht man vor, wenn man für ein Unterrichtsprojekt die Geschichte einer örtlichen Textilfabrik und ihrer Arbeiter aufbereiten soll? Vor dieser Frage stehen die vier Schüler Nele, Tom, Janina und Andy, die sich in Kai Schuberts Film auf Spurensuche in ihrem eigenen Stadtarchiv, einem Wirtschafts- und einem Staatsarchiv sowie einem Museum begeben. Auch ein Zeitzeuge wird als Quelle der Geschichte befragt. Begleitet werden die vier von dem Arbeiter Bas, der ihre akribische Suche anfangs mit Skepsis, dann mit zunehmendem Enthusiasmus verfolgt. Vertiefende Episoden machen mit unterschiedlichen Quellen- und Archivtypen sowie mit Recherche- und Dokumentationstechniken vertraut.
Als öffentliche Einrichtungen bieten Archive vielfältige Möglichkeiten für historisch-entdeckendes Forschen und Lernen. Lehrerinnen und Lehrer finden dort ideale Partner: Archivarinnen und Archivare sind Spezialisten für die Geschichte des Heimatortes und der Heimatregion und die Arbeit mit Originalquellen. Bei der Arbeit mit Archivalien erfahren Schülerinnen und Schüler einen neuen, unverstellten Blick auf Vergangenes und sind zur eigenen Reflexion aufgefordert. Durch die Ortsbezogenheit der Archivalien entsteht auch ein Bezug zur eigenen Lebenswelt. Historische Geschehnisse können lebendig und an konkreten Beispielen vermittelt werden. Zugleich schult die Archivarbeit die Recherche- und Informationskompetenz der Schülerinnen und Schüler und damit eine Schlüssel-kompetenz unserer Wissensgesellschaft. (vgl. http://www.archiv.schulministerium.nrw.de)
Neben der Vermittlung von Arbeitstechniken bietet die DVD einen Blick hinter die Kulissen. Sie zeigt, was Archive sind, welche Funktion und Bedeutung sie für die Rekonstruktion von Geschichte besitzen, wie Archivarinnen und Archivare arbeiten, welche Aufgaben sie haben und wie sie Dokumente bewerten, erschließen und magazinieren."
PDF-Version des Begleithefts
Produktseite im LWL-Medienzentrum-Shop
Filmpremiere
"Vergangenheit, wir kommen! Spurensuche im Archiv"
26.06.2012, 16:00 Uhr
Citykino Rheine, Kardinal-Galen-Ring 42
Wolf Thomas - am Montag, 11. Juni 2012, 20:02 - Rubrik: Archivpaedagogik
Der Archivar-Beitrag "Archivische Spätzünder? Sechs Web 2.0-Praxisberichte" ist online:
http://archive20.hypotheses.org/149
http://archive20.hypotheses.org/149
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archives.meuse.fr/?id=recherche_simple_detail&doc=accounts%2Fmnesys_ad55%2Fdatas%2Fir%2FManuscrits%20anciens%2FFRAD055000002.xml
Darunter auch die wichtige Glossenhandschrift 25:
Langer Link
Darunter auch die wichtige Glossenhandschrift 25:
Langer Link
KlausGraf - am Montag, 11. Juni 2012, 13:46 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine neue Zeitschrift - online, open access, peer reviewed: Forum Kritische Archäologie
Forum Kritische Archäologie
ISSN 2194-346X
http://www.kritischearchaeologie.de/
Die Beiträge stehen unter CC BY-NC-ND 3.0 Lizenz, das ist leider keine gute Wahl, CC-BY wäre angebracht.
Via
http://archaeologik.blogspot.de/2012/06/kritische-archaologie.html
Forum Kritische Archäologie
ISSN 2194-346X
http://www.kritischearchaeologie.de/
Die Beiträge stehen unter CC BY-NC-ND 3.0 Lizenz, das ist leider keine gute Wahl, CC-BY wäre angebracht.
Via
http://archaeologik.blogspot.de/2012/06/kritische-archaologie.html
KlausGraf - am Montag, 11. Juni 2012, 13:01 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Karl Kraus ist in Europa gemeinfrei, aber mit seinen nach 1922 erschienen Werken nach einem Schandurteil des dortigen Obersten Gerüchtshofs nicht. (Dass da auch alte unfähige Männer sitzen, können regelmäßige Gucker von Boston Legal ahnen ...)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/Files_in_Category:De_Die_Un%C3%BCberwindlichen_(Kraus)
Update zu:
http://archiv.twoday.net/search?q=uraa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/Files_in_Category:De_Die_Un%C3%BCberwindlichen_(Kraus)
Update zu:
http://archiv.twoday.net/search?q=uraa
KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 23:02 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die meisten Bände der landesgeschichtlichen Reihe sind digitalisiert und ohne Proxy einsehbar. Nachweise:
http://de.wikisource.org/wiki/Neujahrsbl%C3%A4tter_%28Badische_Historische_Kommission%29
Ich greife heraus: Panzers Heldensage im Breisgau:
http://archive.org/details/DeutscheHeldensageInBreisgau
http://de.wikisource.org/wiki/Neujahrsbl%C3%A4tter_%28Badische_Historische_Kommission%29
Ich greife heraus: Panzers Heldensage im Breisgau:
http://archive.org/details/DeutscheHeldensageInBreisgau
KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 22:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nur 2 Stellenangebote im neuen Heft (noch nicht online):
Archivgemeinschaft Schwarzenbek - 10 TVöD
Landeskirchliches Archiv Nürnberg - A 14 KBG
Archivgemeinschaft Schwarzenbek - 10 TVöD
Landeskirchliches Archiv Nürnberg - A 14 KBG
KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 16:00 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://fm4.orf.at/stories/1699834/
Ein instruktiver Artikel zum Problem.
"Ein großer Wurf? Das ist nicht einmal ein Würfchen, sondern eine verpasste Chance, in den Archiven verschollene Filme, Fotografie und Literatur seit der Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts wieder zugänglich zu machen", sagte die Abgeordnete zum EU-Parlament Eva Lichtenberger (Grüne) auf Anfrage von ORF.at. Gemeint ist der Richtlinienentwurf zur Nutzung sogenannter "verwaister Werke", der seit Monaten auf dem Weg durch die Parlamentsausschüsse ist.
Am Mittwoch hatte eine "Trilog"-Runde zu diesem Thema getagt, am Abend wurde dann überraschend ein "Kompromiss" verkündet. Laut dem neuesten Entwurf, der ORF.at vorliegt, sind erst wieder so viele Einschränkungen in den Text eingeflossen, dass es mehr als fraglich ist, ob die Richtlinie auch in der Praxis dazu führt, Verlorenes wieder zugänglich zu machen.
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
 Potsdamer Militärwaisen 1931, Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 102-11921 / CC-BY-SA
Potsdamer Militärwaisen 1931, Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 102-11921 / CC-BY-SA
Ein instruktiver Artikel zum Problem.
"Ein großer Wurf? Das ist nicht einmal ein Würfchen, sondern eine verpasste Chance, in den Archiven verschollene Filme, Fotografie und Literatur seit der Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts wieder zugänglich zu machen", sagte die Abgeordnete zum EU-Parlament Eva Lichtenberger (Grüne) auf Anfrage von ORF.at. Gemeint ist der Richtlinienentwurf zur Nutzung sogenannter "verwaister Werke", der seit Monaten auf dem Weg durch die Parlamentsausschüsse ist.
Am Mittwoch hatte eine "Trilog"-Runde zu diesem Thema getagt, am Abend wurde dann überraschend ein "Kompromiss" verkündet. Laut dem neuesten Entwurf, der ORF.at vorliegt, sind erst wieder so viele Einschränkungen in den Text eingeflossen, dass es mehr als fraglich ist, ob die Richtlinie auch in der Praxis dazu führt, Verlorenes wieder zugänglich zu machen.
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
 Potsdamer Militärwaisen 1931, Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 102-11921 / CC-BY-SA
Potsdamer Militärwaisen 1931, Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 102-11921 / CC-BY-SAKlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 12:45 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Papst Benedikt XVI. hat am Samstag das Rücktrittsgesuch des italienischen Kurienkardinals Raffaele Farina (78) angenommen. Der Leiter des vatikanischen Geheimarchivs und der vatikanischen Bibliothek habe dem Papst seinen Amtsverzicht aus Altersgründen angeboten"
http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/47411.html
Ein Zusammenhang mit "Vatileaks" scheint prima facie nicht ersichtlich, aber wer weiß?

http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/47411.html
Ein Zusammenhang mit "Vatileaks" scheint prima facie nicht ersichtlich, aber wer weiß?

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 12:40 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach wie vor nicht im Handschriftencensus, obwohl ich am 1. März 2009 an Klaus Klein mailte:
lieber herr klein,
schon laenger online, aber sicher eine anzeige unter den neuigkeiten wert:
Saint Louis (Missouri), Concordia Seminary Library
http://www.atla.com/digitalresources/browsecoll.asp
Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466
Manuscript: Medizinisch-Astrologisches Hausbuch [...]
Zum Kalender wird als Beschreibung angeboten:
Title: Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466
Subtitle: Medical-astrological housebook
Imprint: Concordia Seminary Library, 2003
Description: Würzburg(?), 1466-ca. 1500. Genre: text based on the “ioatromathematische Hausbücher” (medical-mathematical house-book) tradition, which links and systematizes medical and astrological knowledge to create a kind of everyday handbook for medical treatments, especially bloodletting, to be administered by laymen at home. It is based on the medieval idea of the influence of planets on the health and character of human beings. This specimen would be considered a “poor man’s” version, including, e.g., re-used woodcuts rather than hand-colored paintings. Physical description: paper, 26 leaves, 8 in. x 11 ½ in.; bound in worn (1930s?) black buckram boards. Script: written in 3 hands, one of which is Johann Dolcart (or Dohart), identified on 10 verso. Dating evidence: 1466 on “title page”; polemical poem (13 verso) on the Schwaebischer Bund (not founded until 1488); Golden Numbers and Sunday Letters (8 verso) range from 1500-1536. Thus, the manuscript is reasonably dated 1466-1500. Illustrations: small woodcuts (initial D) with names of months pasted into text on calendar pages, executed some time after 1483. Their date corresponds well to text additions by second scribe (active after 1488). Their appearance is similar to others published in the “teutsch kalender” March 1483 by Heinrich Knoblochtzer in Strassburg. Cf., e.g., Das ist der teutsch kalender mit den figure(n), gedruckt zu Ulm in Jahre 1498 von Johannes Schaeffler (Faksimile-Edition, kommentiert von Peter Amelung. Zurich, 1978). Condition: fair; marks and traces of continued use; trimming along borders cuts off some text; insect damage; some evidence of restoration.
Der priamelartige Spruch 13v, auf den ich zurückkommen möchte, setzt die Erhebung Württembergs zum Herzogtum 1495 voraus und stammt von einer Hand aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, trägt also nichts zur Datierung bei. Man wird das Stück wohl ins Jahr 1466 setzen dürfen.
Die Schreibernennung 10v lese ich nicht Dolcart oder Dohart, sondern "p(er) me Joh(ann)em Doleat(oris)". Ob ein Zusammenhang mit dem in Erlanger Handschriften auftregenden Heilsbronner Zisterzienser besteht? Der Name war ja nun wirklich nicht selten.
Zum Priamelmuster http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/werkansicht/cache.off?tx_dlf[id]=14343&tx_dlf[page]=362 = Steiff-Mehring Nr. 18 - Euling 1887 Nr. 48 - Kiepe 1984, S. 413 - http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00053
https://www2.atla.com/CDRIImages/KALENDER/00000020.JPG

lieber herr klein,
schon laenger online, aber sicher eine anzeige unter den neuigkeiten wert:
Saint Louis (Missouri), Concordia Seminary Library
http://www.atla.com/digitalresources/browsecoll.asp
Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466
Manuscript: Medizinisch-Astrologisches Hausbuch [...]
Zum Kalender wird als Beschreibung angeboten:
Title: Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466
Subtitle: Medical-astrological housebook
Imprint: Concordia Seminary Library, 2003
Description: Würzburg(?), 1466-ca. 1500. Genre: text based on the “ioatromathematische Hausbücher” (medical-mathematical house-book) tradition, which links and systematizes medical and astrological knowledge to create a kind of everyday handbook for medical treatments, especially bloodletting, to be administered by laymen at home. It is based on the medieval idea of the influence of planets on the health and character of human beings. This specimen would be considered a “poor man’s” version, including, e.g., re-used woodcuts rather than hand-colored paintings. Physical description: paper, 26 leaves, 8 in. x 11 ½ in.; bound in worn (1930s?) black buckram boards. Script: written in 3 hands, one of which is Johann Dolcart (or Dohart), identified on 10 verso. Dating evidence: 1466 on “title page”; polemical poem (13 verso) on the Schwaebischer Bund (not founded until 1488); Golden Numbers and Sunday Letters (8 verso) range from 1500-1536. Thus, the manuscript is reasonably dated 1466-1500. Illustrations: small woodcuts (initial D) with names of months pasted into text on calendar pages, executed some time after 1483. Their date corresponds well to text additions by second scribe (active after 1488). Their appearance is similar to others published in the “teutsch kalender” March 1483 by Heinrich Knoblochtzer in Strassburg. Cf., e.g., Das ist der teutsch kalender mit den figure(n), gedruckt zu Ulm in Jahre 1498 von Johannes Schaeffler (Faksimile-Edition, kommentiert von Peter Amelung. Zurich, 1978). Condition: fair; marks and traces of continued use; trimming along borders cuts off some text; insect damage; some evidence of restoration.
Der priamelartige Spruch 13v, auf den ich zurückkommen möchte, setzt die Erhebung Württembergs zum Herzogtum 1495 voraus und stammt von einer Hand aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, trägt also nichts zur Datierung bei. Man wird das Stück wohl ins Jahr 1466 setzen dürfen.
Die Schreibernennung 10v lese ich nicht Dolcart oder Dohart, sondern "p(er) me Joh(ann)em Doleat(oris)". Ob ein Zusammenhang mit dem in Erlanger Handschriften auftregenden Heilsbronner Zisterzienser besteht? Der Name war ja nun wirklich nicht selten.
Zum Priamelmuster http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/werkansicht/cache.off?tx_dlf[id]=14343&tx_dlf[page]=362 = Steiff-Mehring Nr. 18 - Euling 1887 Nr. 48 - Kiepe 1984, S. 413 - http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00053
https://www2.atla.com/CDRIImages/KALENDER/00000020.JPG
KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 01:07 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Inkunabel der Marciana (Gesamtpdf ist übrigens fehlerfrei)
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Update:
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm
verlinkt wenig originell:
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Update:
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm
verlinkt wenig originell:
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es ist erbärmlich, wie wenig sich seit 2004 zum Guten gewendet hat ...
Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?
Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"
http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf
Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.
Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:
Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen
Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die
Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei
erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende
Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und
hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene
Information über die Resultate, betrieben wird.
Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung
ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.
Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht
einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,
zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,
immer noch in einer Experimentierphase.
Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren
konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder
Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen
grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und
durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In
einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes
Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem
Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der
1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna
Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die
Hexenforschung.
Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere
zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert
wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte
verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die
Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es
sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt
werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand
(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)
realisieren könnte.
Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft
sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.
Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die
eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren
offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur
Sprache kommen, leidet.
Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,
obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die
Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,
Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,
aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden
ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen
übertragen.
Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und
unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits
jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken
weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt
werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des
digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter
sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser
verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht
des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine
einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich
einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man
weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst
einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte
überhaupt zur Kenntnis genommen wird.
Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte
Information der Wissenschaft.
Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare
Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren
Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf
suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.
Die Datenbank sollte als reine Datenbank von
Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert
und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die
GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen
Volltextkatalog, der nun OASE heißt.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html
Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die
Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC
vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.
Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die
für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner
Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt
und sich international geschickt vernetzt, könnte eine
solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell
realisiert werden.
Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß
Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen
Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk
auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich
sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog
recherchierbar sein.
Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die
Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über
entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -
genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.
http://oaister.umdl.umich.edu/
Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen
von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant
verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500
Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren
Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben
dürften.
http://miami.uni-muenster.de/
Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?
Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun
einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn
sie etwas im Internet finden wollen.
Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit
einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der
Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt
Sacherschließung aufgelistet sind.
Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von
Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht
geschafft hat, die digitalen Angebote der
Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als
bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz
einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die
Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.
http://forschungsportal.net/
Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den
offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen
beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.
Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen
Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die
wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das
Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie
"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit
an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch
unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.
http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/
Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen
Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.
Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und
mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von
ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte
das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei
Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen
Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im
Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres
ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile
digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der
großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und
Augsburg, also des Streuguts, angelegt.
http://archiv.twoday.net/stories/113113/
Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken
für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB
Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer
Website geschickt zu verstecken.
http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html
Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels
willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den
Scheffel!
Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch
Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt
eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"
herausstellen, das ausführlich erläutert wird?
Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den
neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,
aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die
man neu anzubieten hat?
Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu
digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und
natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur
ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für
seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf
gern an einen Mail-Newsletter denken.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern
auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat
die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im
Internet" eingerichtet.
http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html
Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche
Sacherschließung betreffend.
Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als
Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts
digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer
anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten
wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der
neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die
Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich
unfaßbar.
Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die
Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu
weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel
sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet
worden.
Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,
die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen
sich der Forscher einen Überblick über vertretenen
Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein
fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.
Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider
nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett
als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen
Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn
man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die
Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit
Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also
unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen
dürfen.
In der Digital Library of India, die auch einige
englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts
enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.
http://www.dli.gov.in/home.htm
Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich
versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,
wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen
erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche
Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja
auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen
Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger
ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett
ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.
Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem
Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse
Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -
verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen
Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.
Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die
Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht
werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.
Druckillustrationen sind wichtige Quellen der
Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -
erschließen sollte.
http://www.prometheus-bildarchiv.de/
Der dritte Punkt betrifft die fehlende
Benutzerfreundlichkeit.
Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie
barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige
Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht
ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt
wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die
Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion
zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,
betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der
Benennungskonvention der Dateinamen oder einer
entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit
haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,
der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat
seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv
eingängig sind die allerwenigsten.
Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines
brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das
unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,
vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape
7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
http://www.obrasraras.usp.br/
Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch
alternative Formen der Ansicht realisieren.
Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So
ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable
Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.
Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung
verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in
Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines
Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von
Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese
Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch
befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu
unten beim Punkt "Open Access".
http://gallica.bnf.fr/
Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die
man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,
am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).
Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die
einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:
http://purl.pt/360/
Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks
bequem verlinkbar sein.
Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon
einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des
Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der
Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch
nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten
gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton
außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke
dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als
Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.
http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html
Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten
angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die
innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.
Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte
alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten
werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen
Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier
sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken
könnte.
Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An
den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die
Auswahl der Werke.
Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos
Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,
oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger
Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius
anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des
16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in
Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als
Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens
nirgends einsehbar.
Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man
digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei
der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am
größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer
Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -
und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen
wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,
handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie
wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.
Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande
völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja
sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter
auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte
sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot
Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der
UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen
Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer
baskischen Bibliothek abgedeckt.
Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,
verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online
gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche
Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und
Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen
Allerweltsinkunabeln startete.
http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm
Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern
arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige
hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die
blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken
selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum
individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,
von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs
gefördert werden.
Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.
Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher
Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und
wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu
zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen
Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem
Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli
in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,
brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen
zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem
Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden
arbeiten.
http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html
Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun
wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch
wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger
Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht
auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des
Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei
Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen
Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es
moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch
für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne
Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den
Werken arbeiten möchten.
Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären
Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den
entsprechenden Text der elektronischen Edition der
Patrologia Latina legt, die ja von größeren
Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt
wird.
Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu
erschließen - vielleicht sogar den interessierten
Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer
illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell
blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die
vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken
haben.
Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner
ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus
darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den
Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte
Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es
das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik
zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht
die anderen Exemplare verlinken wie es bei der
Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine
bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die
von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten
Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische
Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen
Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur
durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html
Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das
anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer
eigenen Linkliste nachweist.
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm
Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.
Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende
Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit
geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden
fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto
"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja
wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter
den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.
Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen
Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche
Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es
auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der
Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen
Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht
geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur
bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen
Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den
digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate
könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung
werben.
Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich
an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,
die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der
wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht
irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar
nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele
Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten
- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als
vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran
könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener
Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus
wird.
Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die
Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand
beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk
digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl
eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.
Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen
Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre
wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für
Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,
über alte Drucke zu forschen.
Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde
Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein
Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.
Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke
und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß
man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder
meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man
vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.
Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur
an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten
Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,
und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen
sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in
der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide
Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter
ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige
sind.
Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle
Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen
Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert
sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein
Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige
Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,
man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,
ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit
handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens
in einem Fall so ist). Dabei hat die
Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der
Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.
http://archiv.twoday.net/stories/32777/
Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der
virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich
selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt
"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene
Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen
virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige
Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite
mehr als bescheiden.
http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm
Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!
Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke
des Open Access Movements, das sich den freien - also
sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.
lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur
auf die Fahnen geschrieben hat, auf die
kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)
ausgeweitet worden - zu Recht!
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus
urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren
sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle
Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit
und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als
Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig
bewachen und möglichst gewinnbringend via
Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in
einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen
Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und
eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten
duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften
außerhalb des eigenen Servers.
Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt
Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke
digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf
Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten
westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus
begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu
erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit
unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form
vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen
haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek
kollegiale Proteste zukommen zu lassen.
Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des
Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur
Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf
einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei
es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate
sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit
größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche
Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich
um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist
daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.
Quelle:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3
Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?
Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"
http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf
Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.
Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:
Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen
Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die
Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei
erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende
Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und
hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene
Information über die Resultate, betrieben wird.
Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung
ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.
Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht
einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,
zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,
immer noch in einer Experimentierphase.
Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren
konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder
Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen
grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und
durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In
einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes
Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem
Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der
1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna
Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die
Hexenforschung.
Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere
zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert
wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte
verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die
Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es
sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt
werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand
(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)
realisieren könnte.
Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft
sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.
Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die
eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren
offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur
Sprache kommen, leidet.
Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,
obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die
Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,
Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,
aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden
ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen
übertragen.
Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und
unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits
jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken
weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt
werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des
digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter
sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser
verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht
des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine
einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich
einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man
weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst
einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte
überhaupt zur Kenntnis genommen wird.
Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte
Information der Wissenschaft.
Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare
Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren
Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf
suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.
Die Datenbank sollte als reine Datenbank von
Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert
und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die
GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen
Volltextkatalog, der nun OASE heißt.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html
Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die
Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC
vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.
Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die
für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner
Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt
und sich international geschickt vernetzt, könnte eine
solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell
realisiert werden.
Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß
Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen
Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk
auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich
sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog
recherchierbar sein.
Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die
Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über
entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -
genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.
http://oaister.umdl.umich.edu/
Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen
von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant
verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500
Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren
Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben
dürften.
http://miami.uni-muenster.de/
Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?
Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun
einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn
sie etwas im Internet finden wollen.
Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit
einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der
Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt
Sacherschließung aufgelistet sind.
Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von
Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht
geschafft hat, die digitalen Angebote der
Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als
bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz
einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die
Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.
http://forschungsportal.net/
Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den
offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen
beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.
Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen
Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die
wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das
Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie
"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit
an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch
unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.
http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/
Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen
Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.
Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und
mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von
ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte
das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei
Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen
Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im
Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres
ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile
digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der
großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und
Augsburg, also des Streuguts, angelegt.
http://archiv.twoday.net/stories/113113/
Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken
für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB
Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer
Website geschickt zu verstecken.
http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html
Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels
willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den
Scheffel!
Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch
Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt
eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"
herausstellen, das ausführlich erläutert wird?
Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den
neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,
aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die
man neu anzubieten hat?
Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu
digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und
natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur
ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für
seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf
gern an einen Mail-Newsletter denken.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern
auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat
die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im
Internet" eingerichtet.
http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html
Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche
Sacherschließung betreffend.
Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als
Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts
digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer
anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten
wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der
neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die
Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich
unfaßbar.
Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die
Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu
weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel
sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet
worden.
Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,
die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen
sich der Forscher einen Überblick über vertretenen
Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein
fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.
Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider
nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett
als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen
Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn
man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die
Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit
Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also
unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen
dürfen.
In der Digital Library of India, die auch einige
englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts
enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.
http://www.dli.gov.in/home.htm
Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich
versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,
wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen
erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche
Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja
auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen
Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger
ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett
ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.
Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem
Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse
Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -
verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen
Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.
Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die
Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht
werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.
Druckillustrationen sind wichtige Quellen der
Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -
erschließen sollte.
http://www.prometheus-bildarchiv.de/
Der dritte Punkt betrifft die fehlende
Benutzerfreundlichkeit.
Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie
barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige
Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht
ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt
wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die
Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion
zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,
betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der
Benennungskonvention der Dateinamen oder einer
entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit
haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,
der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat
seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv
eingängig sind die allerwenigsten.
Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines
brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das
unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,
vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape
7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
http://www.obrasraras.usp.br/
Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch
alternative Formen der Ansicht realisieren.
Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So
ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable
Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.
Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung
verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in
Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines
Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von
Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese
Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch
befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu
unten beim Punkt "Open Access".
http://gallica.bnf.fr/
Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die
man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,
am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).
Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die
einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:
http://purl.pt/360/
Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks
bequem verlinkbar sein.
Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon
einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des
Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der
Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch
nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten
gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton
außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke
dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als
Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.
http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html
Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten
angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die
innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.
Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte
alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten
werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen
Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier
sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken
könnte.
Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An
den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die
Auswahl der Werke.
Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos
Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,
oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger
Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius
anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des
16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in
Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als
Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens
nirgends einsehbar.
Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man
digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei
der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am
größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer
Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -
und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen
wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,
handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie
wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.
Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande
völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja
sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter
auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte
sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot
Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der
UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen
Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer
baskischen Bibliothek abgedeckt.
Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,
verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online
gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche
Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und
Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen
Allerweltsinkunabeln startete.
http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm
Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern
arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige
hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die
blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken
selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum
individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,
von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs
gefördert werden.
Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.
Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher
Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und
wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu
zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen
Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem
Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli
in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,
brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen
zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem
Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden
arbeiten.
http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html
Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun
wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch
wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger
Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht
auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des
Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei
Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen
Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es
moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch
für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne
Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den
Werken arbeiten möchten.
Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären
Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den
entsprechenden Text der elektronischen Edition der
Patrologia Latina legt, die ja von größeren
Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt
wird.
Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu
erschließen - vielleicht sogar den interessierten
Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer
illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell
blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die
vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken
haben.
Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner
ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus
darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den
Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte
Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es
das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik
zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht
die anderen Exemplare verlinken wie es bei der
Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine
bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die
von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten
Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische
Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen
Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur
durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html
Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das
anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer
eigenen Linkliste nachweist.
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm
Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.
Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende
Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit
geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden
fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto
"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja
wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter
den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.
Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen
Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche
Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es
auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der
Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen
Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht
geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur
bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen
Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den
digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate
könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung
werben.
Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich
an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,
die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der
wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht
irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar
nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele
Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten
- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als
vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran
könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener
Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus
wird.
Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die
Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand
beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk
digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl
eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.
Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen
Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre
wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für
Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,
über alte Drucke zu forschen.
Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde
Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein
Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.
Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke
und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß
man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder
meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man
vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.
Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur
an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten
Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,
und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen
sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in
der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide
Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter
ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige
sind.
Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle
Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen
Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert
sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein
Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige
Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,
man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,
ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit
handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens
in einem Fall so ist). Dabei hat die
Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der
Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.
http://archiv.twoday.net/stories/32777/
Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der
virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich
selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt
"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene
Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen
virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige
Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite
mehr als bescheiden.
http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm
Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!
Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke
des Open Access Movements, das sich den freien - also
sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.
lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur
auf die Fahnen geschrieben hat, auf die
kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)
ausgeweitet worden - zu Recht!
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus
urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren
sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle
Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit
und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als
Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig
bewachen und möglichst gewinnbringend via
Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in
einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen
Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und
eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten
duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften
außerhalb des eigenen Servers.
Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt
Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke
digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf
Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten
westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus
begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu
erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit
unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form
vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen
haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek
kollegiale Proteste zukommen zu lassen.
Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des
Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur
Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf
einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei
es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate
sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit
größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche
Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich
um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist
daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.
Quelle:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3
KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 19. Mai 2013, am Pfingstsonntag des nächsten Jahres, wird in Wesel Geschichte geschrieben. Da sind sich die Kirchenvorstände der rechtsrheinischen katholischen Kirchengemeinden einig. Denn an diesem Tag fusionieren die vier Pfarrgemeinden St. Martini, St. Mariä Himmelfahrt, St. Antonius und St. Johannes zu einer Großpfarrei. "Das Datum ist etwa gleichzustellen mit Ostern 1540. Damals führte der Rat der Stadt die Reformation ein. Mehr als 470 Jahre später führen wir den neuen Stadtpatron ein", sagt Stefan Sühling, leitender Pfarrer der künftigen Seelsorgeeinheit. Wie er heißen soll, das entscheiden nun die rund 23 000 Katholiken.
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473
Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:
http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).
Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473
Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:
http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).
Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).
KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 15:14 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen