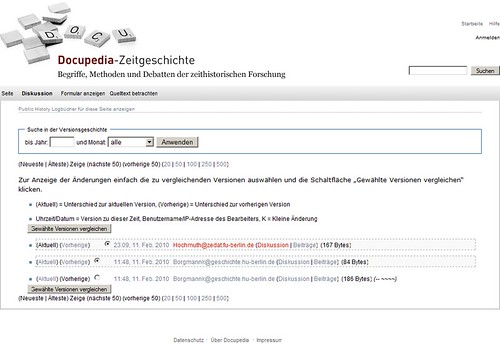Falsche Protokolle, abgebrochene Schaufeln, womöglich fehlender Beton und eine vermutete Lücke in der Außenwand: Die Schlitzwand-Lamelle 11 der U-Bahngrube Waidmarkt ist nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zu einem zentralen Punkt bei der Aufklärung des Kölner Archiveinsturzes geworden. Falls sich die Vorwürfe bestätigen, könnten Pfusch, Schlamperei und womöglich sogar bewusst in Kauf genommene Missstände zur Katastrophe zumindest beigetragen haben.
http://www.ksta.de/html/artikel/1265965864356.shtml
http://www.ksta.de/html/artikel/1265965864356.shtml
KlausGraf - am Dienstag, 16. Februar 2010, 19:34 - Rubrik: Kommunalarchive
Wolf Thomas - am Dienstag, 16. Februar 2010, 19:18 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Andreas Freitäger (Hg.): "1933" - Hochschularchive und die Erforschung des Nationalsozialismus. Beiträge des Kolloquiums aus Anlaß des 40jährigen Bestehens des Universitätsarchivs Köln am 8. April 2008. Köln: Universitätsarchiv 2010.
Kostenloser Download unter
http://www.uniarchiv.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uak/PDF/Publikationen/forum%20Heft1_1933.pdf
Andreas Freitäger: „1933“ – eine Einführung – 7
Max Plaßmann: Spartenübergreifende Überlieferungsbildung am
Beispiel der Medizinischen Akademie Düsseldorf im Nationalsozialismus
– 14
Thomas P. Becker: Mut zur Lücke. Die Erforschung des Nationalsozialismus
an Universitäten bei Überlieferungslücken am Beispiel der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – 43
Barbara Hoen: Im Widerstreit der Interessen. Möglichkeiten und
Grenzen des Zugangs zu Archivgut – 57
Christiane Hoffrath: Der Bücherraub der Nationalsozialisten. Strukturen
der NS-Provenienzforschung – 75
Franz Rudolf Menne: Das „Akademische Auskunftsamt für Studienund
Berufsfragen“ an der Universität Köln von 1923 bis zur Gleichschaltung
1938 – 87
Andreas Freitäger: Gleichschaltung durch das Disziplinarrecht:
Universitätsrat und Disziplinargericht 1928-1936 – 109
Andreas Freitäger: Innenansichten aus der Emigration. Der Nachlaß
von Hans Ludwig Hamburger – 137
Andreas Freitäger: Zwangsarbeit an der Universität Köln – 151
Kostenloser Download unter
http://www.uniarchiv.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uak/PDF/Publikationen/forum%20Heft1_1933.pdf
Andreas Freitäger: „1933“ – eine Einführung – 7
Max Plaßmann: Spartenübergreifende Überlieferungsbildung am
Beispiel der Medizinischen Akademie Düsseldorf im Nationalsozialismus
– 14
Thomas P. Becker: Mut zur Lücke. Die Erforschung des Nationalsozialismus
an Universitäten bei Überlieferungslücken am Beispiel der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – 43
Barbara Hoen: Im Widerstreit der Interessen. Möglichkeiten und
Grenzen des Zugangs zu Archivgut – 57
Christiane Hoffrath: Der Bücherraub der Nationalsozialisten. Strukturen
der NS-Provenienzforschung – 75
Franz Rudolf Menne: Das „Akademische Auskunftsamt für Studienund
Berufsfragen“ an der Universität Köln von 1923 bis zur Gleichschaltung
1938 – 87
Andreas Freitäger: Gleichschaltung durch das Disziplinarrecht:
Universitätsrat und Disziplinargericht 1928-1936 – 109
Andreas Freitäger: Innenansichten aus der Emigration. Der Nachlaß
von Hans Ludwig Hamburger – 137
Andreas Freitäger: Zwangsarbeit an der Universität Köln – 151
KlausGraf - am Dienstag, 16. Februar 2010, 16:29 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hilfreich bei der Ermittlung von mittelalterlichen und Renaissance-Handschriften die Archivierung der Projektseiten:
http://web.archive.org/web/20041022080424/members.aol.com/dericci/umcc/
http://web.archive.org/web/20041022080424/members.aol.com/dericci/umcc/
KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 21:37 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 18:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 15. Februar 2010, 14:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2007 konnte man die gescannten deutschen Bücher noch nach kostenloser Registrierung einsehen: http://archiv.twoday.net/stories/4008449/
Letztes Jahr erwarb ich eine Basis Mitgliedschaft, Jahresabonnement für knapp 10 Euro (heute ist sie doppelt so teuer) und konnte damals alle damals vorhandenen Bücher einsehen. Für die neu gescannten Bücher brauche ich aber eine Premium-Mitgliedschaft (knapp 30 Euro für ein halbes Jahr), ohne dass dies in irgendeiner Weise mitgeteilt wurde. Man hat zwar eine kurze Kündigungsfrist, aber es erfolgt keine Rückerstattung. Der Leistungsumfang wurde bei Vertragsabschluss nirgends zugesichert und lässt sich auch den AGB nicht entnehmen.
Gemäß http://www.ancestry.de/subscribe/signup.aspx?o_iid=36983&o_lid=36983
sollte der Zugriff auf die "Orts- und Familiengeschichten" (also die gescannten Bücher) im Rahmen der Basismitgliedschaft frei sein. Das ist falsch, ich kann nur einen Teil der Bücher einsehen.
Das ist eindeutig unlauter. Wenn ich 2009 davon ausgehen konnte, ich kann alle deutschen Aufzeichnungen mit meiner Basisjahres-Mitgliedschaft einsehen und dies ist nun nicht mehr der Fall, ist das eine unzulässige Vertragsänderung.
Letztes Jahr erwarb ich eine Basis Mitgliedschaft, Jahresabonnement für knapp 10 Euro (heute ist sie doppelt so teuer) und konnte damals alle damals vorhandenen Bücher einsehen. Für die neu gescannten Bücher brauche ich aber eine Premium-Mitgliedschaft (knapp 30 Euro für ein halbes Jahr), ohne dass dies in irgendeiner Weise mitgeteilt wurde. Man hat zwar eine kurze Kündigungsfrist, aber es erfolgt keine Rückerstattung. Der Leistungsumfang wurde bei Vertragsabschluss nirgends zugesichert und lässt sich auch den AGB nicht entnehmen.
Gemäß http://www.ancestry.de/subscribe/signup.aspx?o_iid=36983&o_lid=36983
sollte der Zugriff auf die "Orts- und Familiengeschichten" (also die gescannten Bücher) im Rahmen der Basismitgliedschaft frei sein. Das ist falsch, ich kann nur einen Teil der Bücher einsehen.
Das ist eindeutig unlauter. Wenn ich 2009 davon ausgehen konnte, ich kann alle deutschen Aufzeichnungen mit meiner Basisjahres-Mitgliedschaft einsehen und dies ist nun nicht mehr der Fall, ist das eine unzulässige Vertragsänderung.
KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 17:32 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:53 - Rubrik: Genealogie
KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:52 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hans Vaut und seine Ehefrau Elisabeth treten in zahllosen Ahnentafeln und Ahnenlisten auf. Das Paar gehört zu den schwaebischen "Massenahnen". Der Familienforscher freut sich, hier eine Bruecke zu einer adeligen Ahnengruppe gefunden zu haben. Er stützt sich dabei auf Publikationen und Berichte renomierter Historiker und Genealogen, so z.B. auf einen Aufsatz von Gerd Wunder über "Schillers adelige Ahnen" von 1958/59 , auf dessen Vortragsbericht von 1959 zum gleichen Thema oder auf dessen Zusammenstellung der entsprechenden "Ahnenlinie Schillers" in der Familiengeschichte "Die Schenken von Stauffenberg" von 1972. Gerd Wunder geht aus von den Befunden Richard Lauxmanns zur Familie Vaut (1930) und vor allem von einem Bericht von Hansmartin Decker-Hauff über "Vorfahren und Nachkommen von Hans Vaut und Elisabeth von Plieningen" (1958). [...] "Dieser Hans von Plieningen muß jeden und allem ansehenn nach ohne kinder verschiden sein". Auch aus diesem Grunde kann die "Elisabeth Plieningerin von Wangen" nicht als Tochter dieses Ehepaares angesehen werden. Von den adeligen Vorfahren Schillers (und vieler anderer) dürfen wir uns also gertrost verabschieden. Auch wenn das vielen schwer fallen wird, ist dieser adelige Ahnenkreis hier und in vielen anderen Ahnenlisten rigoros zu streichen, und zwar ohne Wenn und Aber.
http://www.gemeinschaft-wappenfuehrender-familien.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3962
http://www.gemeinschaft-wappenfuehrender-familien.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3962
KlausGraf - am Sonntag, 14. Februar 2010, 16:42 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kracke.org/blog/?p=772
Archivalia ist mit seinen beiden Rubriken Genealogie und Hilfswissenschaften nicht zutreffend bei den Kommerziellen Blogs eingeordnet.
Archivalia ist mit seinen beiden Rubriken Genealogie und Hilfswissenschaften nicht zutreffend bei den Kommerziellen Blogs eingeordnet.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
am Sonnabend, den 6. März bietet sich in der Zeit von 10-17 Uhr eine
gute Möglichkeit, einmal das Hamburger Staatsarchiv kennenzulernen.
Wer schon immer mal einen Blick hinter die Türen des Magazins und
der Werkstätten werfen wollte, kann an diesem Tag an diversen Führungen teilnehmen.
Auch der Hamburger Verein für Familienforscher, die Genealogische
Gesellschaft Hamburg e.V., wird sich im Lesesaal des Staatsarchivs
vorstellen und Tipps und Hinweise zur Erforschung der Ahnen geben.
Das Programm für diesen Tag der offenen Tür:
http://www.aufmkampe.de/temp/staatsarchiv.pdf
gute Möglichkeit, einmal das Hamburger Staatsarchiv kennenzulernen.
Wer schon immer mal einen Blick hinter die Türen des Magazins und
der Werkstätten werfen wollte, kann an diesem Tag an diversen Führungen teilnehmen.
Auch der Hamburger Verein für Familienforscher, die Genealogische
Gesellschaft Hamburg e.V., wird sich im Lesesaal des Staatsarchivs
vorstellen und Tipps und Hinweise zur Erforschung der Ahnen geben.
Das Programm für diesen Tag der offenen Tür:
http://www.aufmkampe.de/temp/staatsarchiv.pdf
Fieten - am Sonntag, 14. Februar 2010, 13:03 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Aufsatz gibt Provenienzen an:
http://verbum.btk.ppke.hu/pdf/1-1-03.pdf
Alle Jahrgänge von Verbum Analecta Neolatina sind kostenfrei einsehbar:
http://verbum.btk.ppke.hu/search_en/search.php
http://verbum.btk.ppke.hu/pdf/1-1-03.pdf
Alle Jahrgänge von Verbum Analecta Neolatina sind kostenfrei einsehbar:
http://verbum.btk.ppke.hu/search_en/search.php
KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 17:51 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 15:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Treffend diagnostiziert:
http://netzwertig.com/2010/02/09/der-fall-axolotl-roadkill-doppelmoral-in-grossem-stil/
Nun ist das Verwenden des Materials anderer, wie es in den Reaktionen in FAZ und anderen Publikationen beschrieben wird, nicht so ungewöhnlich. Was allerdings in den Texten nicht erwähnt wird (neben etwa Verbindungen von verteidigenden SPON-Autoren und betroffenem Verlag (via)), ist die diametral andere Sichtweise, die sonst bei Urheberrechtsfragen an der gleichen Stelle an den Tag gelegt wird. Immer wieder wird in FAZ, SZ, Welt, ZEIT und anderen Publikationen gefordert, dass das Urheberrecht stärker geschützt werden müsse.
Tatsächlich findet seit jeher gegenseitige Befruchtung in der Kunst statt. Viele Musiker fangen damit an, Songs von anderen Künstlern zu spielen. Selbst Shakespeare hat sich freimütig bei anderen bedient. Mehr noch: Shakespeares König Lear wäre unter aktuellem us-amerikanischen Copyright so nie erschienen und wahrscheinlich ebenso unter aktuellem deutschen Urheberrecht nicht. Ist das nicht bemerkenswert?
Mindestens ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieser Zusammenhang bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte in den Medien praktisch immer unterschlagen wird. Jetzt aber trifft es eine Autorin und ein Werk, dass man mag und schon dreht sich die Haltung in vielen Medien um 180 Grad. Das offenbart vor allem eins: Bei der Urheberrechtsdebatte in den Medien geht es selten um die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen oder darum, wofür dieses Recht überhaupt eingeführt wurde. Es geht um Partikularinteressen
Zum Fall
http://archiv.twoday.net/stories/6179643/
Zum Ganzen auch die Einleitung zu meiner Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

http://netzwertig.com/2010/02/09/der-fall-axolotl-roadkill-doppelmoral-in-grossem-stil/
Nun ist das Verwenden des Materials anderer, wie es in den Reaktionen in FAZ und anderen Publikationen beschrieben wird, nicht so ungewöhnlich. Was allerdings in den Texten nicht erwähnt wird (neben etwa Verbindungen von verteidigenden SPON-Autoren und betroffenem Verlag (via)), ist die diametral andere Sichtweise, die sonst bei Urheberrechtsfragen an der gleichen Stelle an den Tag gelegt wird. Immer wieder wird in FAZ, SZ, Welt, ZEIT und anderen Publikationen gefordert, dass das Urheberrecht stärker geschützt werden müsse.
Tatsächlich findet seit jeher gegenseitige Befruchtung in der Kunst statt. Viele Musiker fangen damit an, Songs von anderen Künstlern zu spielen. Selbst Shakespeare hat sich freimütig bei anderen bedient. Mehr noch: Shakespeares König Lear wäre unter aktuellem us-amerikanischen Copyright so nie erschienen und wahrscheinlich ebenso unter aktuellem deutschen Urheberrecht nicht. Ist das nicht bemerkenswert?
Mindestens ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieser Zusammenhang bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte in den Medien praktisch immer unterschlagen wird. Jetzt aber trifft es eine Autorin und ein Werk, dass man mag und schon dreht sich die Haltung in vielen Medien um 180 Grad. Das offenbart vor allem eins: Bei der Urheberrechtsdebatte in den Medien geht es selten um die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen oder darum, wofür dieses Recht überhaupt eingeführt wurde. Es geht um Partikularinteressen
Zum Fall
http://archiv.twoday.net/stories/6179643/
Zum Ganzen auch die Einleitung zu meiner Urheberrechtsfibel http://www.contumax.de

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 03:28 - Rubrik: Archivrecht
Im Historischen Lexikon Bayerns schrieb Elizabeth Harding jüngst über die "Adelsprobe" (mit stark bayern-lastiger Literaturauswahl und ohne Kennzeichnung online vorliegender Quellen, noch nicht einmal des eigenen Beitrags (PDF)):
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45028
Zum Vergleich dazu eine Preprint-Fassung meines Artikels
Klaus Graf, Ahnenprobe, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von Friedrich Jäger, Bd. 1, Stuttgart 2005, Sp. 146-148
Ahnenprobe
Die Ahnenprobe war der Nachweis oder die Darstellung der
Herkunft von vier, acht, sechzehn usw. adeligen Ahnen
(Adelsprobe). Die vor allem im deutschsprachigen Raum
bedeutsame Ahnenprobe war ein normatives Instrument der
Exklusion, das einen institutionellen oder
genossenschaftlichen Binnenraum gegen unerwünschte
Eindringlinge abschotten sollte. Bei der Ahnenprobe in Form
der "Aufschwörung" mussten die Probanden und Zeugen eidlich
die Herkunft (Adel und eheliche Geburt der Ahnen, oft
kombiniert mit weiteren Eigenschaften wie Stiftsmäßigkeit,
Angehörigkeit zur Reichsritterschaft oder zur deutschen
Nation) bekräftigen. So wehrten sich adelige Institutionen
wie Domstifte oder Korporationen wie Ritterorden gegen
Aufsteiger aus dem Bürgertum, insbesondere gegen den
Briefadel, gegen die Angehörigen städtischer Patriziate,
die als Stadtadelige Ebenbürtigkeit mit dem Landadel
anstrebten, oder gegen landfremde Adelige. Durch die
negative Sanktionierung von Mesalliancen (eine nicht
standesgemäße Heirat schadete den Nachkommen als Probanden
einer Ahnenprobe) diente sie zugleich der Wahrung
ständischer Homogenität.
Die von landsmannschaftlichen, ständischen oder familiären
Adelscliquen dominierten geistlichen Institutionen waren
mit ihren Pfründen "Spitäler des Adels" und somit als
Versorgungsressourcen in die aristokratische
Familienordnung eingebunden. Besonders rigide war die
ständische Abschließung der Domstifte Köln und Straßburg,
die dem Hochadel vorbehalten waren. Erasmus von Rotterdam
habe, so die Zimmerische Chronik, dazu bemerkt, Christus
selbst wäre in Straßburg nur mit Dispens aufgenommen
worden. Ritterschaftliche Familien beherrschten als
"Stiftsadel" die Domkapitel der "Pfaffengasse" an Rhein und
Main und die Domkapitel der westfälischen Hochstifte
Münster und Osnabrück. Trotz aller sozialen Abgrenzung gab
es aber noch in der frühen Neuzeit etwa in den bayerischen
Bistümern einen nennenswerten Anteil bürgerlicher Kanoniker
(so wie im Spätmittelalter in nord- und mitteldeutschen
Bistümern). Ahnenproben regelten nicht nur die
Zugehörigkeit zu den geistlichen Institutionen (Domkapitel,
Klöster und Stifte, Damenstifte, Deutscher Orden und
Johanniterorden usw.), die natürlich nach der Reformation
überwiegend katholisch waren, sie wurden auch zur
Abgrenzung landständischer Ritterschaften eingesetzt. So
wurden 1648 für die Aufnahme in die märkische Ritterschaft
acht adelige Ahnen verlangt. Ganerbschaften und
vergleichbare adelige Genossenschaften wie die
Burgmannenschaft der Reichsburg Friedberg bestanden
ebenfalls auf dem Nachweis adeliger Vorfahren. Ahnenproben
wahrten aber auch die Exklusivität adeliger Vereinigungen
ohne Versorgungsaspekt wie Turniergesellschaften,
Bruderschaften und höfischer Orden (z.B. des burgundischen
Ordens vom Goldenen Vlies). Begnügte man sich im 15.
Jahrhundert fast immer mit der Vierahnenprobe, so wurden in
der Frühen Neuzeit häufig acht oder gar 16 Ahnen gefordert
(z.B. im Deutschen Orden: 1606 acht, 1671 16 Ahnen).
Aufklärerische Adelskritik wandte sich vehement gegen die
von den geburtsadeligen Eliten durch die Ahnenprobe
bewirkte Verknöcherung der von ihnen kontrollierten
sozialen Systeme.
Wenig untersucht sind die nicht-adeligen Ahnenproben in
bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen, mit der die
Abstammung von freien Vorfahren oder die ehrliche und
eheliche Herkunft nachgewiesen wurde. Handwerksmeister und
Gesellen legten gelegentlich auf eine genealogisch geprüfte
"Ehre" Wert.
Im erhaltenen Denkmalbestand sind vor allem die unzähligen
umfangreichen heraldischen Ahnenproben auf
ritterschaftlichen Grabmälern eindrucksvoll (für die
Anordnung der Wappen gab es eigene Konventionen). Auch hier
setzten sich erst im 16. Jahrhundert höhere Ahnenzahlen – acht,
16, 32 usw. - durch. Gelegentlich kam es auf solchen
Darstellungen zu verfälschenden "Ahnenkorrekturen". Nicht
weniger als 124 Ahnenwappen zählte eine Tapisserie, die
1619/20 von der niederösterreichischen Adeligen Katharina
von Volkensdorf und ihren Töchtern gewirkt wurde. Wie
Ahnenproben in das höfische Fest integriert wurden, illustrieren
einige der den Turnierrittern auf der jülichschen
Fürstenhochzeit 1585 vorangetragene Tafeln mit ihren
Ahnenproben (zu acht Ahnen) aus dem Stadtmuseum Düsseldorf.
Die Praxis der Ahnenprobe führte zu einer entsprechenden
Schriftlichkeit: Wappengeschmückte Urkunden und
Aufschwörbücher dokumentierten den Adelsnachweis in
repräsentativer Weise. Die Ahnenprobe erforderte mit der
Erstellung einer Ahnentafel genealogische Recherchen, und
dies sowie die Beweisproblematik inspirierte häufig
gelehrte "hilfswissenschaftliche" Studien. Genealogische
Forschungen profitierten von den in voluminösen Tafelwerken
abgedruckten Ahnenproben, etwa der Kompilation des
Benediktiners Gabriel Bucelin "Germania
topo-chronostemmato-graphica sacra et profana" (1655-1678).
Als Handbuch galt in der Spätzeit des Alten Reiches die
Schrift von Georg Estor "Praktische Anleitung zur Anenprobe" (Marburg 1750).
Auch in anderen europäischen Ländern gab es Ahnenproben (meist zu vier Ahnen), so im Frankreich des Ancien Régime, in dem es im 18. Jahrhundert unter dem Eindruck einer „réaction aristocratique“ zu einer starken Revitalisierung alter Adelswerte kam. Komparatistisch zu untersuchen wäre, wie
sich Ahnenprobenpraxis und andere Formen des
Adelsnachweises zueinander verhalten haben.
F.v.Klocke, Westdeutsche Ahnenproben feierlichster Form im
16., 17. und 18. Jahrhundert, 1940
W. Kundert, Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich
in Schwaben 1555-1803, in: F. Quarthal (Hrsg.), Zwischen
Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 1984, S. 303-327
H. Lönnecker, Die Ahnenprobe und ihre
heraldisch-genealogischen Voraussetzungen, in: P. Rück
(Hrsg.), Mabillons Spur, 1992, S. 367-387
J. Schneider, Spätmittelalterlicher deutscher Niederadel,
2003
Update: http://www.rambow.de/deutsche-adelsproben.html

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45028
Zum Vergleich dazu eine Preprint-Fassung meines Artikels
Klaus Graf, Ahnenprobe, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von Friedrich Jäger, Bd. 1, Stuttgart 2005, Sp. 146-148
Ahnenprobe
Die Ahnenprobe war der Nachweis oder die Darstellung der
Herkunft von vier, acht, sechzehn usw. adeligen Ahnen
(Adelsprobe). Die vor allem im deutschsprachigen Raum
bedeutsame Ahnenprobe war ein normatives Instrument der
Exklusion, das einen institutionellen oder
genossenschaftlichen Binnenraum gegen unerwünschte
Eindringlinge abschotten sollte. Bei der Ahnenprobe in Form
der "Aufschwörung" mussten die Probanden und Zeugen eidlich
die Herkunft (Adel und eheliche Geburt der Ahnen, oft
kombiniert mit weiteren Eigenschaften wie Stiftsmäßigkeit,
Angehörigkeit zur Reichsritterschaft oder zur deutschen
Nation) bekräftigen. So wehrten sich adelige Institutionen
wie Domstifte oder Korporationen wie Ritterorden gegen
Aufsteiger aus dem Bürgertum, insbesondere gegen den
Briefadel, gegen die Angehörigen städtischer Patriziate,
die als Stadtadelige Ebenbürtigkeit mit dem Landadel
anstrebten, oder gegen landfremde Adelige. Durch die
negative Sanktionierung von Mesalliancen (eine nicht
standesgemäße Heirat schadete den Nachkommen als Probanden
einer Ahnenprobe) diente sie zugleich der Wahrung
ständischer Homogenität.
Die von landsmannschaftlichen, ständischen oder familiären
Adelscliquen dominierten geistlichen Institutionen waren
mit ihren Pfründen "Spitäler des Adels" und somit als
Versorgungsressourcen in die aristokratische
Familienordnung eingebunden. Besonders rigide war die
ständische Abschließung der Domstifte Köln und Straßburg,
die dem Hochadel vorbehalten waren. Erasmus von Rotterdam
habe, so die Zimmerische Chronik, dazu bemerkt, Christus
selbst wäre in Straßburg nur mit Dispens aufgenommen
worden. Ritterschaftliche Familien beherrschten als
"Stiftsadel" die Domkapitel der "Pfaffengasse" an Rhein und
Main und die Domkapitel der westfälischen Hochstifte
Münster und Osnabrück. Trotz aller sozialen Abgrenzung gab
es aber noch in der frühen Neuzeit etwa in den bayerischen
Bistümern einen nennenswerten Anteil bürgerlicher Kanoniker
(so wie im Spätmittelalter in nord- und mitteldeutschen
Bistümern). Ahnenproben regelten nicht nur die
Zugehörigkeit zu den geistlichen Institutionen (Domkapitel,
Klöster und Stifte, Damenstifte, Deutscher Orden und
Johanniterorden usw.), die natürlich nach der Reformation
überwiegend katholisch waren, sie wurden auch zur
Abgrenzung landständischer Ritterschaften eingesetzt. So
wurden 1648 für die Aufnahme in die märkische Ritterschaft
acht adelige Ahnen verlangt. Ganerbschaften und
vergleichbare adelige Genossenschaften wie die
Burgmannenschaft der Reichsburg Friedberg bestanden
ebenfalls auf dem Nachweis adeliger Vorfahren. Ahnenproben
wahrten aber auch die Exklusivität adeliger Vereinigungen
ohne Versorgungsaspekt wie Turniergesellschaften,
Bruderschaften und höfischer Orden (z.B. des burgundischen
Ordens vom Goldenen Vlies). Begnügte man sich im 15.
Jahrhundert fast immer mit der Vierahnenprobe, so wurden in
der Frühen Neuzeit häufig acht oder gar 16 Ahnen gefordert
(z.B. im Deutschen Orden: 1606 acht, 1671 16 Ahnen).
Aufklärerische Adelskritik wandte sich vehement gegen die
von den geburtsadeligen Eliten durch die Ahnenprobe
bewirkte Verknöcherung der von ihnen kontrollierten
sozialen Systeme.
Wenig untersucht sind die nicht-adeligen Ahnenproben in
bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen, mit der die
Abstammung von freien Vorfahren oder die ehrliche und
eheliche Herkunft nachgewiesen wurde. Handwerksmeister und
Gesellen legten gelegentlich auf eine genealogisch geprüfte
"Ehre" Wert.
Im erhaltenen Denkmalbestand sind vor allem die unzähligen
umfangreichen heraldischen Ahnenproben auf
ritterschaftlichen Grabmälern eindrucksvoll (für die
Anordnung der Wappen gab es eigene Konventionen). Auch hier
setzten sich erst im 16. Jahrhundert höhere Ahnenzahlen – acht,
16, 32 usw. - durch. Gelegentlich kam es auf solchen
Darstellungen zu verfälschenden "Ahnenkorrekturen". Nicht
weniger als 124 Ahnenwappen zählte eine Tapisserie, die
1619/20 von der niederösterreichischen Adeligen Katharina
von Volkensdorf und ihren Töchtern gewirkt wurde. Wie
Ahnenproben in das höfische Fest integriert wurden, illustrieren
einige der den Turnierrittern auf der jülichschen
Fürstenhochzeit 1585 vorangetragene Tafeln mit ihren
Ahnenproben (zu acht Ahnen) aus dem Stadtmuseum Düsseldorf.
Die Praxis der Ahnenprobe führte zu einer entsprechenden
Schriftlichkeit: Wappengeschmückte Urkunden und
Aufschwörbücher dokumentierten den Adelsnachweis in
repräsentativer Weise. Die Ahnenprobe erforderte mit der
Erstellung einer Ahnentafel genealogische Recherchen, und
dies sowie die Beweisproblematik inspirierte häufig
gelehrte "hilfswissenschaftliche" Studien. Genealogische
Forschungen profitierten von den in voluminösen Tafelwerken
abgedruckten Ahnenproben, etwa der Kompilation des
Benediktiners Gabriel Bucelin "Germania
topo-chronostemmato-graphica sacra et profana" (1655-1678).
Als Handbuch galt in der Spätzeit des Alten Reiches die
Schrift von Georg Estor "Praktische Anleitung zur Anenprobe" (Marburg 1750).
Auch in anderen europäischen Ländern gab es Ahnenproben (meist zu vier Ahnen), so im Frankreich des Ancien Régime, in dem es im 18. Jahrhundert unter dem Eindruck einer „réaction aristocratique“ zu einer starken Revitalisierung alter Adelswerte kam. Komparatistisch zu untersuchen wäre, wie
sich Ahnenprobenpraxis und andere Formen des
Adelsnachweises zueinander verhalten haben.
F.v.Klocke, Westdeutsche Ahnenproben feierlichster Form im
16., 17. und 18. Jahrhundert, 1940
W. Kundert, Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich
in Schwaben 1555-1803, in: F. Quarthal (Hrsg.), Zwischen
Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 1984, S. 303-327
H. Lönnecker, Die Ahnenprobe und ihre
heraldisch-genealogischen Voraussetzungen, in: P. Rück
(Hrsg.), Mabillons Spur, 1992, S. 367-387
J. Schneider, Spätmittelalterlicher deutscher Niederadel,
2003
Update: http://www.rambow.de/deutsche-adelsproben.html

KlausGraf - am Samstag, 13. Februar 2010, 01:21 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 23:46 - Rubrik: Datenschutz
Update zu meiner Docupedia-Kritik:
http://archiv.twoday.net/stories/6186445/
1. Urheberrechtsverletzung
Dank auskunftsfreudiger Wikipedianer konnte bestätigt werden, dass das Baku-Bild von Commons (ursprünglich von Flickr) stammt und tatsächlich allem Anschein nach illegal genutzt wird, da weder der Fotograf teuchterlad noch die Lizenz angegeben wird.
Es ist schlicht und einfach unerträglich, dass ein Wiki, das keine Nachnutzung gestattet, sich bei der freien Wikipedia bzw. Wikimedia Commons bedient, ohne die Spielregeln einzuhalten.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
2. Mediawiki
Dank eines Hinweises auf WP:FZW ist klar, dass es ein normales Mediawiki ist und die von mir vermissten (weil nicht mit Links versehenen) Feature funktionieren, wenn man die URL-Syntax kennt:
http://docupedia.de/zg/Spezial:Linkliste/Literatur:Frei_Broszat_2007
[Zum DICKEN DATENSCHUTZHUND siehe Kommentare]
3. Erstes Twitter-Feedback
http://twitter.com/Amartholion/status/9024935444
"Großer Anspruch, schlechte Umsetzung. Wie so oft bei der weitenteils immernoch weltfremden Historikerzunft."
http://twitter.com/porlock_person/status/9024708624
"Docupedia = schrecklich, arrogant, nutzlos und ein Design zum abgewöhnen..."
4. Darstellungsmängel
Die von mir beklagten Mängel (fehlende Fußnotennummerierung, Abgeschnittenes) hängen vom Gebrauch des richtigen Browsers aus. Während sie in Firefox und dem Internetexplorer nicht auftreten, sieht Docupedia in Chrome und in Opera schlecht aus.
5. Fotos
Fotos sind wohl nur am Kopf der Seite vorgesehen. Fehlt es, ergibt sich eine unschöne Leerfläche mit Hinweis. Dass bei der Darstellung des Historikerstreit kein Foto (und sei es ein Unfreies) aufzutreiben war, ist schon merkwürdig.
http://docupedia.de/zg/Werkstatt:Historikerstreit
Selbst die Wikipedia hat ein Foto von Jürgen Habermas:
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
Dass man ein Foto von 1989 ohne jede Quellenangabe veröffentlicht, geht gar nicht.
7. Keine ausreichenden Webnachweise
Da es Zeitgeschichte Online nicht geschafft hat, die ja nun schon geraume Zeit auf dem Server des IfZ bereitstehenden PDFs der Vierteljahreshefte
http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html?&L=11
zu verlinken, wundert es nicht, dass z.B. in Anm. 31 von
http://docupedia.de/zg/Historikerstreit
kein Link vorhanden ist. Die wenigsten Leser werden wissen, dass der Artikel online ist, und Google sagt es ihnen natürlich nicht.
8. Keine Einladung zum Mitmachen
Mit Web 2.0 hat dieses Portal so viel zu tun wie die Kuh mit dem Drachenfliegen. Wer den Hilfelink rechts oben anklickt, wird darauf verwiesen, dass er der Redaktion mailen kann. Es gibt auch keine Seite, wo man über Pros und Cons des Projekts diskutieren könnte oder wo das Mitmachen organisiert würde.
"Hinweise zu den Texten werden durch die Redaktion gesichtet. Grundlegende inhaltliche Kommentare werden als Co-Artikel dauerhaft gespeichert."
9. Quellen sind unwichtig
http://docupedia.de/zg/Kategorie:Quellen
Die Seite ist leer!
10. Vergleich der Artikel Umweltgeschichte in Wikipedia und Docupedia
Dass die inhaltliche Qualität in Docupedia um Längen besser ist, braucht man nicht lang zu begründen. In der Wikipedia ist das eher ein Stummel, aber mit viel Literatur und einigen Weblinks.
Da der Artikel eher den Charkter eines Forschungsberichts hat, kann man vielleicht verstehen, dass die Sektion "Empfohlene Literatur" zum Thema leer ist. Man muss sich die Angaben halt aus den 90 Anmerkungen zusammensuchen, man hat ja sonst nix zu tun.
Bei den Weblinks liegt es bei der Docupedia wirklich im argen. Die CLIO-Leute haben es unterlassen, für den Artikel (wohlgemerkt einer von ca. 20) ihre Links aufzurüsten und zu aktualisieren. Beide Links wurden 2005 eingetragen. Während der Link zu Academic Info noch begrenzten Nutzen stiften mag, ist der andere zu Umweltgeschichte.de schlicht und einfach defekt.
Nun sage aber keiner, es gebe keine hochwertigen Internetquellen zur Umweltgeschichte. Selbst für den deutschsprachigen Bereich ist das krass unzutreffend. Dem Wikipedia-Artikel entnimmt man, dass das Sonderheft HSR 29/3 von 2004 online ist:
http://www.hsr-retro.de/
Und es wird ein von der Autorin des Artikels übergangener Sammelband des Göttinger Graduiertenkollegs Interdisziplinäre Umweltgeschichte von 2009 verlinkt:
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/umweltgeschichte_umweltzukunft.pdf
Die Autorin scheint nicht gut recherchieren zu können, ein Blick in den KVK hätte sie sofort zu weiteren Online-Quellen der gleichen Provenienz geführt:
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/schauplaetze3.pdf
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/zwingelberg.pdf
Dass diese neueren Göttinger Publikationen, denen man noch eine Dissertation anfügen könnte
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2205
nicht rezipiert wurden, befremdet.
Dass man vorrangig mit der gedruckten Literatur arbeitet, ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn man den Leser mit zwei veralteten (davon einem nicht-funktionierenden) Links aus dem Clio-Webverzeichnis abspeist, wenn er weiterführende Materialien zur Umweltgeschichte im Internet sucht.
http://archiv.twoday.net/stories/6186445/
1. Urheberrechtsverletzung
Dank auskunftsfreudiger Wikipedianer konnte bestätigt werden, dass das Baku-Bild von Commons (ursprünglich von Flickr) stammt und tatsächlich allem Anschein nach illegal genutzt wird, da weder der Fotograf teuchterlad noch die Lizenz angegeben wird.
Es ist schlicht und einfach unerträglich, dass ein Wiki, das keine Nachnutzung gestattet, sich bei der freien Wikipedia bzw. Wikimedia Commons bedient, ohne die Spielregeln einzuhalten.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
2. Mediawiki
Dank eines Hinweises auf WP:FZW ist klar, dass es ein normales Mediawiki ist und die von mir vermissten (weil nicht mit Links versehenen) Feature funktionieren, wenn man die URL-Syntax kennt:
http://docupedia.de/zg/Spezial:Linkliste/Literatur:Frei_Broszat_2007
[Zum DICKEN DATENSCHUTZHUND siehe Kommentare]
3. Erstes Twitter-Feedback
http://twitter.com/Amartholion/status/9024935444
"Großer Anspruch, schlechte Umsetzung. Wie so oft bei der weitenteils immernoch weltfremden Historikerzunft."
http://twitter.com/porlock_person/status/9024708624
"Docupedia = schrecklich, arrogant, nutzlos und ein Design zum abgewöhnen..."
4. Darstellungsmängel
Die von mir beklagten Mängel (fehlende Fußnotennummerierung, Abgeschnittenes) hängen vom Gebrauch des richtigen Browsers aus. Während sie in Firefox und dem Internetexplorer nicht auftreten, sieht Docupedia in Chrome und in Opera schlecht aus.
5. Fotos
Fotos sind wohl nur am Kopf der Seite vorgesehen. Fehlt es, ergibt sich eine unschöne Leerfläche mit Hinweis. Dass bei der Darstellung des Historikerstreit kein Foto (und sei es ein Unfreies) aufzutreiben war, ist schon merkwürdig.
http://docupedia.de/zg/Werkstatt:Historikerstreit
Selbst die Wikipedia hat ein Foto von Jürgen Habermas:
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
Dass man ein Foto von 1989 ohne jede Quellenangabe veröffentlicht, geht gar nicht.
7. Keine ausreichenden Webnachweise
Da es Zeitgeschichte Online nicht geschafft hat, die ja nun schon geraume Zeit auf dem Server des IfZ bereitstehenden PDFs der Vierteljahreshefte
http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html?&L=11
zu verlinken, wundert es nicht, dass z.B. in Anm. 31 von
http://docupedia.de/zg/Historikerstreit
kein Link vorhanden ist. Die wenigsten Leser werden wissen, dass der Artikel online ist, und Google sagt es ihnen natürlich nicht.
8. Keine Einladung zum Mitmachen
Mit Web 2.0 hat dieses Portal so viel zu tun wie die Kuh mit dem Drachenfliegen. Wer den Hilfelink rechts oben anklickt, wird darauf verwiesen, dass er der Redaktion mailen kann. Es gibt auch keine Seite, wo man über Pros und Cons des Projekts diskutieren könnte oder wo das Mitmachen organisiert würde.
"Hinweise zu den Texten werden durch die Redaktion gesichtet. Grundlegende inhaltliche Kommentare werden als Co-Artikel dauerhaft gespeichert."
9. Quellen sind unwichtig
http://docupedia.de/zg/Kategorie:Quellen
Die Seite ist leer!
10. Vergleich der Artikel Umweltgeschichte in Wikipedia und Docupedia
Dass die inhaltliche Qualität in Docupedia um Längen besser ist, braucht man nicht lang zu begründen. In der Wikipedia ist das eher ein Stummel, aber mit viel Literatur und einigen Weblinks.
Da der Artikel eher den Charkter eines Forschungsberichts hat, kann man vielleicht verstehen, dass die Sektion "Empfohlene Literatur" zum Thema leer ist. Man muss sich die Angaben halt aus den 90 Anmerkungen zusammensuchen, man hat ja sonst nix zu tun.
Bei den Weblinks liegt es bei der Docupedia wirklich im argen. Die CLIO-Leute haben es unterlassen, für den Artikel (wohlgemerkt einer von ca. 20) ihre Links aufzurüsten und zu aktualisieren. Beide Links wurden 2005 eingetragen. Während der Link zu Academic Info noch begrenzten Nutzen stiften mag, ist der andere zu Umweltgeschichte.de schlicht und einfach defekt.
Nun sage aber keiner, es gebe keine hochwertigen Internetquellen zur Umweltgeschichte. Selbst für den deutschsprachigen Bereich ist das krass unzutreffend. Dem Wikipedia-Artikel entnimmt man, dass das Sonderheft HSR 29/3 von 2004 online ist:
http://www.hsr-retro.de/
Und es wird ein von der Autorin des Artikels übergangener Sammelband des Göttinger Graduiertenkollegs Interdisziplinäre Umweltgeschichte von 2009 verlinkt:
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/umweltgeschichte_umweltzukunft.pdf
Die Autorin scheint nicht gut recherchieren zu können, ein Blick in den KVK hätte sie sofort zu weiteren Online-Quellen der gleichen Provenienz geführt:
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/schauplaetze3.pdf
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/zwingelberg.pdf
Dass diese neueren Göttinger Publikationen, denen man noch eine Dissertation anfügen könnte
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2205
nicht rezipiert wurden, befremdet.
Dass man vorrangig mit der gedruckten Literatur arbeitet, ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn man den Leser mit zwei veralteten (davon einem nicht-funktionierenden) Links aus dem Clio-Webverzeichnis abspeist, wenn er weiterführende Materialien zur Umweltgeschichte im Internet sucht.
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/25-09-2009-lg-hamburg-az-324-o-84-09.html
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenberg
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenberg
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
[Update: http://archiv.twoday.net/stories/6186800/ ]
Beispiel:
Annette Vowinckel, Mediengeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2. 2009, URL: http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Mediengeschichte&oldid=68720
Clio Online kreißte ...
Ein einziges, noch dazu wenig geeignetes unfreies Bild (Zitat: "Klärung der Nutzungsrechte wäre schön (karsten)") bei dem Artikel Mediengeschichte. Gerade bei diesem Thema hätte man zeigen müssen, dass eine belanglose Illustration nicht genügt, sondern dass Medien Geschichtsquellen sind, mit denen der Zeithistoriker professionell und intelligent umgehen muss.
Rein illustrativ auch die schlechte Farbabbildung zum Artikel Vetorecht der Quellen:
http://docupedia.de/zg/Vetorecht
Ohne brauchbare Quellenangabe und von schlechtester Qualität:
http://docupedia.de/zg/Herrschaft
Es steht immer nur eine Abbildung am Kopf des Beitrags, gleichsam als "multimediale Pflichtübung".
Schon allein das öde Docupedia-Logo treibt einigermaßen intelligente Netzbürger schnell wieder weg.
Auf der Seite
http://docupedia.de/zg/Generation
ist bei mir links die Bildunterschrift abgeschnitten. Bei
http://docupedia.de/zg/1989 rechts die Überschrift. Das sind keine Einzelfälle, sondern nur die ersten Beispiele, die mir auffielen! Hinweis: Die Kritik beruht auf einem Besuch mit dem Browser Chrome!
Das Bild zu "Generation" ist anders als Wikipedia-Bilder nicht nachnutzbar, sondern nur in der Docupedia nutzbar:
"Susanne Pötzsch hat das Bild zufällig im Netz gefunden und dann die Bäckersfamilie kontaktiert. Die Schwiegertochter des heutigen Inhabers (damals der kleine Junge mit der Pfeife) hat ihr Einverständnis zur Nutzung des Fotos für den Artikel "Generation" von Ulrike Jureit gegeben. Frau Jureit ist mit dem Bildvorschlag einverstanden."
Auf eine Urheberrechtsverletzung könnte die Nutzung des Bildes auf
http://docupedia.de/zg/Global_History
hindeuten. Im Artikel steht als Bildunterschrift: Baku, Aserbaidschan, 2009, Quelle: WikimediaCommons. Auf der Bildbeschreibungsseite ist davon aber nichts zu lesen, und ohne einen Link habe ich das Bild auf Commons nicht gefunden. Es fehlt Autor und Lizenz, das ist abmahnfähig.
Zum Artikel Mediengeschichte gibt es sogar schon einen Kommentar:
http://docupedia.de/zg/Mediengeschichte/Kommentar:Zum_Artikel_Mediengeschichte_(Frank_B%C3%B6sch_2010/01/09)
Die bloße Ansicht des Quelltextes ist gesperrt, was absolut albern ist. Es genügt, wenn man ihn nicht bearbeiten kann.
Völliger Unsinn ist die Nicht-Nummerierung der Anmerkungen im Anmerkungsteil, da das Sprungziel von Browsern vielfach nicht exakt getroffen wird. Wenn ich den Link bei Fn. 39 klicke, komme ich bei Fn. 32 heraus. Natürlich findet man in diesem Beispiel die passende Fußnote schnell, wenn man bemerkt, dass Fn. 39 die allerletzte ist. Wie eine funktionierende Fußnotenverwaltung aussieht, zeigt die Wikipedia. Oder irgendein Textverarbeitungsprogramm. So etwas ist ein absolutes No-Go.
Eine Docupedia als wissenschaftliche Alternative zur Wikipedia müsste auch technisch besser als die Mediawiki-Software sein, nicht schlechter!
Und wo bitteschön ist der Link, der vom Kommentar zum kommentierten Artikel führt?
Wieso gibt es keine internen Links, die Artikel vernetzen wie in der Wikipedia (was eine von deren großen Stärken ist)?
Wieso ist das Instrument "Kategorie" nicht genutzt worden?
Eher zu Amazon als zu einem seriösen wissenschaftlichen Portal passt, dass man bei einem Klick auf einen Literaturtitel zu einer Liste weiterer Titel aus dem gleichen Verlag kommt:
http://docupedia.de/zg/Literatur:Frei_Broszat_2007
In der Wikipedia könnte man bei dieser Seite sofort feststellen, welche Seiten auf sie verlinken, also das Werk zitieren. Docupedia: Pustekuchen!
Der rechte Bereich "Material" wird von lästiger H-SOZ-U-KULT-Werbung eingenommen, als ob sich das Internet auf H-SOZ-U-KULT reduzieren lasse. Selbstverständlich kein Link zur Wikipedia, zur Erfassung der Artikel hat die Clio-Online-Redaktion (die sich ja weißgott nicht überarbeitet) wie zu so vielem anderen wohl noch keine Zeit gefunden ...
Gewöhnungsbedürftig ist auch die Anordnung der Literaturtitel:
http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Generation/Feed&feed=lit
Offenbar gilt bei mehreren Autoren der letzte. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eine rigide Vereinheitlichung der Formalia bei den Literaturtiteln nicht stattgefunden hat. Da sind viele exzellente Artikel der Wikipedia formal besser aufgestellt.
An dieser Stelle müssen wir, bereits hinreichend verärgert von dem neuen Millionengrab, zurückblenden ins Jahr 2008, als vollmundig Ankündigungsprosa zu lesen war:
http://archiv.twoday.net/stories/5208922/ bzw.
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=292
"Alle Artikel der Docupedia-Zeitgeschichte werden im Open Access unter einer freien Lizenz zur Weiterverwendung zur Verfügung stehen."
Ist wohl auf der Strecke geblieben. Es heißt nunmehr in den Nutzungsbedingungen: "Für alle Verwendungen der Beiträge durch Dritte ist die schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber einzuholen". Ob Autoren eine CC-Lizenz wählen, was ihnen freigestellt ist, ist ihnen überlassen. Ich habe keinen einzelnen nachnutzbaren Artikel gefunden! Mit Open Access hat die Docupedia also allenfalls im Sinne von gratis Open Access zu tun.
Für eine URN-Vergabe war in der Projektlaufzeit wohl keine Zeit (die ersten Inhalte sollten eigentlich schon im Herbst 2009 online sein).
"Es soll erprobt werden, inwieweit mit der weitverbreiteten Software MediaWiki die thematische Vernetzung der Forschung gefördert und zugleich ein attraktiver Bereitstellungsort für Open Access-Publikationen wissenschaftlicher Autoren/innen aufgebaut werden kann."
Sieht nicht nach Mediawiki aus, fühlt sich auch nicht danach an. "In technischer Hinsicht erprobt Docupedia-Zeitgeschichte die weitverbreitete Software-Plattform MediaWiki, um damit ein Redaktionssystem zu schaffen, das durch andere wissenschaftliche Projekte mit vergleichbarer inhaltlicher Zielsetzung nachgenutzt werden kann. Die MediaWiki-Basisinstallation wurde durch zahlreiche Extensions ergänzt und die Standardoberfläche angepasst. " http://docupedia.de/zg/Docupedia:%C3%9Cber_Docupedia
Merkwürdigerweise ähnelt eine Vorversion, die noch im Google-Cache betrachtbar ist, wenn man Text only wählt und die Passworteingabe ignoriert eher der vertrauten Mediawiki-Oberfläche:
http://tinyurl.com/ygltelj
Hat man alles das, was Mediawiki nützlich macht, weggelassen, damit man die Docupedia nicht mit der Wikipedia verwechselt?
Dass die Docupedia technisch in den Sand gesetzt wurde - geschenkt! Geradezu lächerlich ist aber die Gesamtzahl der in den zwei Jahren zustandegebrachten Artikel:
http://docupedia.de/zg/Docupedia:Artikel
Es sind keine 20! Qualität statt Quantität? Schon, aber in zwei Jahren sollte man mehr als 20 Artikel organisieren können. Jedes kommerzielle Fachlexikon arbeitet da besser.
Zu den Planungen 2009 PDF.
Und dann mitunter der Stil! "Als „Vetorecht der Quellen" bezeichnet man eine geschichtstheoretische Denkfigur, nach der der quellenkritischen Deutung historischer Überreste die Funktion zukommt, historisch unwahre Aussagen als solche kenntlich werden zu lassen." Ich muss das mehrmals lesen, bevor ich das kapiere. Bin wohl zu sehr Wikipedia-geschädigt und kein Zeisthistoriker.
Wissenschaftlich hochkarätige Autoren haben gehaltvolle Darstellungen abgeliefert, aber das hätten sie auch in einem Druckwerk tun können. Die Wikipedia hat Standards gesetzt - nicht unbedingt auf dem Gebiet der zeitgeschichtlichen Forschung, das sei zugegeben - und Docupedia zeigt überzeugend, dass Murks herauskommt, wenn Internetausdrucker die Wikipedia kopieren und sich mit dem Begriff "Open Access" schmücken möchten.
 Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Beispiel:
Annette Vowinckel, Mediengeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2. 2009, URL: http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Mediengeschichte&oldid=68720
Clio Online kreißte ...
Ein einziges, noch dazu wenig geeignetes unfreies Bild (Zitat: "Klärung der Nutzungsrechte wäre schön (karsten)") bei dem Artikel Mediengeschichte. Gerade bei diesem Thema hätte man zeigen müssen, dass eine belanglose Illustration nicht genügt, sondern dass Medien Geschichtsquellen sind, mit denen der Zeithistoriker professionell und intelligent umgehen muss.
Rein illustrativ auch die schlechte Farbabbildung zum Artikel Vetorecht der Quellen:
http://docupedia.de/zg/Vetorecht
Ohne brauchbare Quellenangabe und von schlechtester Qualität:
http://docupedia.de/zg/Herrschaft
Es steht immer nur eine Abbildung am Kopf des Beitrags, gleichsam als "multimediale Pflichtübung".
Schon allein das öde Docupedia-Logo treibt einigermaßen intelligente Netzbürger schnell wieder weg.
Auf der Seite
http://docupedia.de/zg/Generation
ist bei mir links die Bildunterschrift abgeschnitten. Bei
http://docupedia.de/zg/1989 rechts die Überschrift. Das sind keine Einzelfälle, sondern nur die ersten Beispiele, die mir auffielen! Hinweis: Die Kritik beruht auf einem Besuch mit dem Browser Chrome!
Das Bild zu "Generation" ist anders als Wikipedia-Bilder nicht nachnutzbar, sondern nur in der Docupedia nutzbar:
"Susanne Pötzsch hat das Bild zufällig im Netz gefunden und dann die Bäckersfamilie kontaktiert. Die Schwiegertochter des heutigen Inhabers (damals der kleine Junge mit der Pfeife) hat ihr Einverständnis zur Nutzung des Fotos für den Artikel "Generation" von Ulrike Jureit gegeben. Frau Jureit ist mit dem Bildvorschlag einverstanden."
Auf eine Urheberrechtsverletzung könnte die Nutzung des Bildes auf
http://docupedia.de/zg/Global_History
hindeuten. Im Artikel steht als Bildunterschrift: Baku, Aserbaidschan, 2009, Quelle: WikimediaCommons. Auf der Bildbeschreibungsseite ist davon aber nichts zu lesen, und ohne einen Link habe ich das Bild auf Commons nicht gefunden. Es fehlt Autor und Lizenz, das ist abmahnfähig.
Zum Artikel Mediengeschichte gibt es sogar schon einen Kommentar:
http://docupedia.de/zg/Mediengeschichte/Kommentar:Zum_Artikel_Mediengeschichte_(Frank_B%C3%B6sch_2010/01/09)
Die bloße Ansicht des Quelltextes ist gesperrt, was absolut albern ist. Es genügt, wenn man ihn nicht bearbeiten kann.
Völliger Unsinn ist die Nicht-Nummerierung der Anmerkungen im Anmerkungsteil, da das Sprungziel von Browsern vielfach nicht exakt getroffen wird. Wenn ich den Link bei Fn. 39 klicke, komme ich bei Fn. 32 heraus. Natürlich findet man in diesem Beispiel die passende Fußnote schnell, wenn man bemerkt, dass Fn. 39 die allerletzte ist. Wie eine funktionierende Fußnotenverwaltung aussieht, zeigt die Wikipedia. Oder irgendein Textverarbeitungsprogramm. So etwas ist ein absolutes No-Go.
Eine Docupedia als wissenschaftliche Alternative zur Wikipedia müsste auch technisch besser als die Mediawiki-Software sein, nicht schlechter!
Und wo bitteschön ist der Link, der vom Kommentar zum kommentierten Artikel führt?
Wieso gibt es keine internen Links, die Artikel vernetzen wie in der Wikipedia (was eine von deren großen Stärken ist)?
Wieso ist das Instrument "Kategorie" nicht genutzt worden?
Eher zu Amazon als zu einem seriösen wissenschaftlichen Portal passt, dass man bei einem Klick auf einen Literaturtitel zu einer Liste weiterer Titel aus dem gleichen Verlag kommt:
http://docupedia.de/zg/Literatur:Frei_Broszat_2007
In der Wikipedia könnte man bei dieser Seite sofort feststellen, welche Seiten auf sie verlinken, also das Werk zitieren. Docupedia: Pustekuchen!
Der rechte Bereich "Material" wird von lästiger H-SOZ-U-KULT-Werbung eingenommen, als ob sich das Internet auf H-SOZ-U-KULT reduzieren lasse. Selbstverständlich kein Link zur Wikipedia, zur Erfassung der Artikel hat die Clio-Online-Redaktion (die sich ja weißgott nicht überarbeitet) wie zu so vielem anderen wohl noch keine Zeit gefunden ...
Gewöhnungsbedürftig ist auch die Anordnung der Literaturtitel:
http://docupedia.de/docupedia/index.php?title=Generation/Feed&feed=lit
Offenbar gilt bei mehreren Autoren der letzte. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eine rigide Vereinheitlichung der Formalia bei den Literaturtiteln nicht stattgefunden hat. Da sind viele exzellente Artikel der Wikipedia formal besser aufgestellt.
An dieser Stelle müssen wir, bereits hinreichend verärgert von dem neuen Millionengrab, zurückblenden ins Jahr 2008, als vollmundig Ankündigungsprosa zu lesen war:
http://archiv.twoday.net/stories/5208922/ bzw.
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=292
"Alle Artikel der Docupedia-Zeitgeschichte werden im Open Access unter einer freien Lizenz zur Weiterverwendung zur Verfügung stehen."
Ist wohl auf der Strecke geblieben. Es heißt nunmehr in den Nutzungsbedingungen: "Für alle Verwendungen der Beiträge durch Dritte ist die schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber einzuholen". Ob Autoren eine CC-Lizenz wählen, was ihnen freigestellt ist, ist ihnen überlassen. Ich habe keinen einzelnen nachnutzbaren Artikel gefunden! Mit Open Access hat die Docupedia also allenfalls im Sinne von gratis Open Access zu tun.
Für eine URN-Vergabe war in der Projektlaufzeit wohl keine Zeit (die ersten Inhalte sollten eigentlich schon im Herbst 2009 online sein).
"Es soll erprobt werden, inwieweit mit der weitverbreiteten Software MediaWiki die thematische Vernetzung der Forschung gefördert und zugleich ein attraktiver Bereitstellungsort für Open Access-Publikationen wissenschaftlicher Autoren/innen aufgebaut werden kann."
Sieht nicht nach Mediawiki aus, fühlt sich auch nicht danach an. "In technischer Hinsicht erprobt Docupedia-Zeitgeschichte die weitverbreitete Software-Plattform MediaWiki, um damit ein Redaktionssystem zu schaffen, das durch andere wissenschaftliche Projekte mit vergleichbarer inhaltlicher Zielsetzung nachgenutzt werden kann. Die MediaWiki-Basisinstallation wurde durch zahlreiche Extensions ergänzt und die Standardoberfläche angepasst. " http://docupedia.de/zg/Docupedia:%C3%9Cber_Docupedia
Merkwürdigerweise ähnelt eine Vorversion, die noch im Google-Cache betrachtbar ist, wenn man Text only wählt und die Passworteingabe ignoriert eher der vertrauten Mediawiki-Oberfläche:
http://tinyurl.com/ygltelj
Hat man alles das, was Mediawiki nützlich macht, weggelassen, damit man die Docupedia nicht mit der Wikipedia verwechselt?
Dass die Docupedia technisch in den Sand gesetzt wurde - geschenkt! Geradezu lächerlich ist aber die Gesamtzahl der in den zwei Jahren zustandegebrachten Artikel:
http://docupedia.de/zg/Docupedia:Artikel
Es sind keine 20! Qualität statt Quantität? Schon, aber in zwei Jahren sollte man mehr als 20 Artikel organisieren können. Jedes kommerzielle Fachlexikon arbeitet da besser.
Zu den Planungen 2009 PDF.
Und dann mitunter der Stil! "Als „Vetorecht der Quellen" bezeichnet man eine geschichtstheoretische Denkfigur, nach der der quellenkritischen Deutung historischer Überreste die Funktion zukommt, historisch unwahre Aussagen als solche kenntlich werden zu lassen." Ich muss das mehrmals lesen, bevor ich das kapiere. Bin wohl zu sehr Wikipedia-geschädigt und kein Zeisthistoriker.
Wissenschaftlich hochkarätige Autoren haben gehaltvolle Darstellungen abgeliefert, aber das hätten sie auch in einem Druckwerk tun können. Die Wikipedia hat Standards gesetzt - nicht unbedingt auf dem Gebiet der zeitgeschichtlichen Forschung, das sei zugegeben - und Docupedia zeigt überzeugend, dass Murks herauskommt, wenn Internetausdrucker die Wikipedia kopieren und sich mit dem Begriff "Open Access" schmücken möchten.
 Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Schrottfoto von Commons: Mohylek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 16:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/983-BVerfG-Az-1-BvR-206209-Nichtannahme-einer-Verfassungsschwerde-gegen-97-Abs.-2-UrhG.html
Zweifel äußert das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Rückwirkung. Zum Ganzen siehe auch meine "Urheberrechtsfibel" zu § 97a UrhG http://www.contumax.de
Zweifel äußert das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Rückwirkung. Zum Ganzen siehe auch meine "Urheberrechtsfibel" zu § 97a UrhG http://www.contumax.de
KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 15:54 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.law.yale.edu/blogs/rarebooks/
http://www.flickr.com/photos/yalelawlibrary/sets/72157623409849202/

http://www.flickr.com/photos/yalelawlibrary/sets/72157623409849202/

KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 15:28 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Niedersächsische Münzkabinett der Deutschen Bank, das vom Land angekauft wurde, ist kein Einzelfall:
http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6358876/Kunst-und-Boerse-haben-vieles-gemeinsam.html
Übel wird es für die Öffentlichkeit dann, wenn wertvolles Kulturgut von einer Bank erworben wurde, um es für ein Museum zu sichern.
http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6358876/Kunst-und-Boerse-haben-vieles-gemeinsam.html
Übel wird es für die Öffentlichkeit dann, wenn wertvolles Kulturgut von einer Bank erworben wurde, um es für ein Museum zu sichern.

Die Kommunalarchivarinnen und -archivare aus dem Kreis Kleve gemeinsam mit dem Leiter des Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, Dr. Peter Weber, im Lesesaal des Kreisarchivs Kleve in Geldern
" ..... Am 09.02.2010 trafen sich die Kommunalarchivarinnen und -archivare aus dem Kreis Kleve zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung im Lesesaal des Kreisarchivs in Geldern. Auf Einladung der Kreisarchivarin, Dr. Beate Sturm, des Leiters des Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, Dr. Peter Weber sowie des Archivars der Stadt Kleve, Drs. Bert Thissen, verbrachten sie einen gemeinsam Arbeitstag voll anregender Diskussionen. ...
Auf der Tagesordnung standen viele aktuelle Themen aus der Arbeit der Kommunalarchivare. So wurden z.B. die Novellierung des NRW Archivgesetzes, die Zusammenarbeit mit Schulen und die Archivierung digitaler Verwaltungsdaten erörtert. Ein reger Austausch fand ebenfalls über die Neuauflage einer aktualisierten Fassung der Informationsbroschüre „Archive im Kreis Kleve“ statt. Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm: „Es ist vorbildlich, wie die Kommunalarchive – unterstützt durch das Archivberatungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland – im Kreis Kleve zusammenarbeiten. Der gute Zusammenhalt ermöglicht einen intensiven Austausch sowohl über eher alltägliche archivfachliche Fragen als auch über bedeutende Veränderungen im Archivwesen mit ihren Auswirkungen auf die Kommunalarchive.“"
Quelle: Pressemitteilung Kreis Kleve
Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 12:05 - Rubrik: Kommunalarchive
Die Berliner Zeitung vom 12.02.2010 über den Umgang mit Unterlagen der ersten Stasiüberprüfung des Potsdamer Landtags 1991:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0212/brandenburg/0087/index.html
Vgl. dazu die Archivordnung des Brandenburgischen Landtags in der Fassung vom 30.05.2007:
http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/Archivordnung.pdf
die auf der Grundlage des Brandenburgischen Archivgesetzes regelt, wann und durch wen eine Abgabe an welches Archiv erfolgt.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0212/brandenburg/0087/index.html
Vgl. dazu die Archivordnung des Brandenburgischen Landtags in der Fassung vom 30.05.2007:
http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/Archivordnung.pdf
die auf der Grundlage des Brandenburgischen Archivgesetzes regelt, wann und durch wen eine Abgabe an welches Archiv erfolgt.
ingobobingo - am Freitag, 12. Februar 2010, 10:30 - Rubrik: Bewertung
Christoph Seidler berichtet auf Spiegel online: " ..... Auch Heinz Miller vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) will der neuen Arbeit keine weltweite Aussagekraft zubilligen. Die Forscher um Dorale hätten "ein vielversprechendes Archiv" aufgetan, lobt der Glaziologe. "Doch ich würde dem Ergebnis eher lokale als globale Bedeutung beimessen." Änderungen des Meeresspiegels könnten regional ganz unterschiedlich ausfallen. ....."
Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 08:55 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Alle Infos unter: http://archiv.twoday.net/stories/5915409/
Wolf Thomas - am Freitag, 12. Februar 2010, 08:28 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:47 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Lars Barkhausen: Rezension zu: Sturm, Beate: Schüler ins Archiv! Archivführungen für Schulklassen. Berlin 2008, in: H-Soz-u-Kult, 11.02.2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-106 .
KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:15 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://scribalculture.org/weblog/2010/02/10/kings-palaeography-gets-press/
http://www.guardian.co.uk/education/2010/feb/09/writing-off-last-palaeographer-university
http://www.guardian.co.uk/education/2010/feb/09/writing-off-last-palaeographer-university
KlausGraf - am Freitag, 12. Februar 2010, 01:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:56 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:50 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute war Bd. 27 (2008, sic!) des Rottenburger Jahrbuchs für Kirchengeschichte in der Post, der eine Tagung aus dem Jahr 2006 dokumentiert:
http://www.gv-drs.de/publikationen/rjkg-aktuell.html (leider ohne detailliertes Inhaltsverzeichnis).
http://www.gv-drs.de/publikationen/rjkg-aktuell.html (leider ohne detailliertes Inhaltsverzeichnis).
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:33 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Klaus Graf. Ritterromantik? Renaissance und Kontinuität des Rittertums im
Spiegel des literarischen Lebens im 15. Jahrhundert, in: Zwischen
Deutschland und Frankreich. Elisabeth von Lothringen, Gräfin von
Nassau-Saarbrücken, hrsg. von Wolfgang Haubrichs/Hans-Walter Herrmann
(= Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische
Landesgeschichte und Volksforschung e.V. 34), St. Ingbert 2002, S.
517-532
Online (Scan mit unkorrigierter OCR):
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13794/
Online (E-Text, Preprint-Fassung):
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/elis.htm
Dazu Gerhold Scholz Williams, in: Arbitrium 2004, S. 171
DOI: 10.1515/ARBI.2004.170, 28/November/2004
"Erfreulicherweise fehlt es in diesem Band
nicht an Auseinandersetzungen mit der Problematik des Traditionsbezugs,
wie zum Beispiel Klaus Grafs Beitrag zur Ritterromantik überzeugend demonstriert.
In diesem Aufsatz besticht besonders die kritische Bestandsaufnahme
der Thesen von Huizinga und Elias, die die Forschung zum spätmittelalterlichen
Rittertum bis heute maßgeblich beherrschen. Graf verweist
unter anderem auf ein dringendes Desiderat der Elisabeth-Forschung: die
detaillierte Untersuchung des Einflusses der burgundischen Hof- und Buchkultur
auf die deutsche Adelswelt, besonders aber auch deren Rezeption im
französisch-burgundisch-deutschen Grenzland."
Spiegel des literarischen Lebens im 15. Jahrhundert, in: Zwischen
Deutschland und Frankreich. Elisabeth von Lothringen, Gräfin von
Nassau-Saarbrücken, hrsg. von Wolfgang Haubrichs/Hans-Walter Herrmann
(= Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische
Landesgeschichte und Volksforschung e.V. 34), St. Ingbert 2002, S.
517-532
Online (Scan mit unkorrigierter OCR):
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13794/
Online (E-Text, Preprint-Fassung):
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/elis.htm
Dazu Gerhold Scholz Williams, in: Arbitrium 2004, S. 171
DOI: 10.1515/ARBI.2004.170, 28/November/2004
"Erfreulicherweise fehlt es in diesem Band
nicht an Auseinandersetzungen mit der Problematik des Traditionsbezugs,
wie zum Beispiel Klaus Grafs Beitrag zur Ritterromantik überzeugend demonstriert.
In diesem Aufsatz besticht besonders die kritische Bestandsaufnahme
der Thesen von Huizinga und Elias, die die Forschung zum spätmittelalterlichen
Rittertum bis heute maßgeblich beherrschen. Graf verweist
unter anderem auf ein dringendes Desiderat der Elisabeth-Forschung: die
detaillierte Untersuchung des Einflusses der burgundischen Hof- und Buchkultur
auf die deutsche Adelswelt, besonders aber auch deren Rezeption im
französisch-burgundisch-deutschen Grenzland."
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Source: mail exchange. Update to: http://archiv.twoday.net/stories/6171809/
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:36 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 22:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.medpilot.de/
Auch medizinhistorische Aufsätze. Ergiebiger ist dafür freilich:
http://catalogue.wellcome.ac.uk/
Auch medizinhistorische Aufsätze. Ergiebiger ist dafür freilich:
http://catalogue.wellcome.ac.uk/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.museumsblog.de/2010/01/wohnhaus-studio-archiv-galerie.html
http://www.soane.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soane_Museum
Eine Reise in die Museumsgeschichte!

http://www.soane.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soane_Museum
Eine Reise in die Museumsgeschichte!

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:47 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dl.maekeler.eu/
Eine private Initiative von Hendrik Mäkeler. Zum Hintergrund:
http://www.hendrik.maekeler.eu/hamburger-schule-der-numismatik-online/
Es wäre wichtig, wenn die PDFs auf einem Museums- oder Bibliotheksserver gespiegelt werden könnten, damit ein langfristiger Zugriff gewährleistet ist. Es stehen bislang zwei Monographien
Peter Berghaus: Währungsgrenzen des westfälischen Oberwesergebietes im Spätmittelalter (Numismatische Studien, 1), Hamburg 1951
Gert Hatz: Die Anfänge des Münzwesens in Holstein. Die Prägungen der Grafen von Schauenburg bis 1325 (Numismatische Studien, 5), Hamburg 1952
zur Verfügung und Artikel aus den ersten vier Heften der Hamburger Beiträge zur Numismatik 1947-1950.
#numismatik
Eine private Initiative von Hendrik Mäkeler. Zum Hintergrund:
http://www.hendrik.maekeler.eu/hamburger-schule-der-numismatik-online/
Es wäre wichtig, wenn die PDFs auf einem Museums- oder Bibliotheksserver gespiegelt werden könnten, damit ein langfristiger Zugriff gewährleistet ist. Es stehen bislang zwei Monographien
Peter Berghaus: Währungsgrenzen des westfälischen Oberwesergebietes im Spätmittelalter (Numismatische Studien, 1), Hamburg 1951
Gert Hatz: Die Anfänge des Münzwesens in Holstein. Die Prägungen der Grafen von Schauenburg bis 1325 (Numismatische Studien, 5), Hamburg 1952
zur Verfügung und Artikel aus den ersten vier Heften der Hamburger Beiträge zur Numismatik 1947-1950.
#numismatik
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
We are happy to announce the electronic publication of the University
Museums and Collections Journal 2/2009 (Proceedings of the 8th
Conference of the International Committee of ICOM for University Museums
and Collections in Manchester), edited by Sally MacDonald, Nathalie Nyst and
Cornelia Weber at:
http://edoc.hu-berlin.de/umacj
Table of Contents
Evoking humanity: Reflections on the importance of university museums
and collections
Alan D. Gilbert
University museums and the community
Sally MacDonald
Experiments in the boundary zone: Science Gallery at Trinity College Dublin
Michael John Gorman
Ivory tower or welcoming neighbor? Engaging our local communities
Jane Pickering
What opportunities can university museums offer for academic-public
interaction?
Some lessons from London’s Beacon for Public Engagement
Steve Cross
University museums and outreach: the Newcastle upon Tyne case study
Lindsay Allason-Jones
Web communication. A content analysis of German university collections
and museums websites
Cornelia Weber
Chasing the online audience
Mark Carnall
The effect of digitalized museum information on learning
Damon Monzavi
Beyond teaching: Out of hours at the Grant Museum
Jack Ashby
Internal audience: A key to success
MirnaHeruc
Courting controversy – the Lindow Man exhibition at the Manchester Museum
Bryan Sitch
On the road again: Reaching out to isolated school communities
Karl Van Dyke
A purpose-driven university museum
Juliette Bianco
Building creative communities: How does a university museum work with
family learning in a challenging community context?
Celine West
Family matters: The role of university museums in intergenerational
learning
RebekahMoran
Secondary school program at the Oxford University Museum of Natural History
Sarah Lloyd
The community service of the Ghent University Zoology Museum
Dominick Verschelde
The role of the university museum in community development
David Ellis
University museums in a university town: University of Tartu Museums in
the service of the local community
ReetMägi
Ways of seeing: A model for community partnership working
Gill Hart
Accessibility to university museums: A strategical objective
EdmonCastell
From ACUMG-L
Museums and Collections Journal 2/2009 (Proceedings of the 8th
Conference of the International Committee of ICOM for University Museums
and Collections in Manchester), edited by Sally MacDonald, Nathalie Nyst and
Cornelia Weber at:
http://edoc.hu-berlin.de/umacj
Table of Contents
Evoking humanity: Reflections on the importance of university museums
and collections
Alan D. Gilbert
University museums and the community
Sally MacDonald
Experiments in the boundary zone: Science Gallery at Trinity College Dublin
Michael John Gorman
Ivory tower or welcoming neighbor? Engaging our local communities
Jane Pickering
What opportunities can university museums offer for academic-public
interaction?
Some lessons from London’s Beacon for Public Engagement
Steve Cross
University museums and outreach: the Newcastle upon Tyne case study
Lindsay Allason-Jones
Web communication. A content analysis of German university collections
and museums websites
Cornelia Weber
Chasing the online audience
Mark Carnall
The effect of digitalized museum information on learning
Damon Monzavi
Beyond teaching: Out of hours at the Grant Museum
Jack Ashby
Internal audience: A key to success
MirnaHeruc
Courting controversy – the Lindow Man exhibition at the Manchester Museum
Bryan Sitch
On the road again: Reaching out to isolated school communities
Karl Van Dyke
A purpose-driven university museum
Juliette Bianco
Building creative communities: How does a university museum work with
family learning in a challenging community context?
Celine West
Family matters: The role of university museums in intergenerational
learning
RebekahMoran
Secondary school program at the Oxford University Museum of Natural History
Sarah Lloyd
The community service of the Ghent University Zoology Museum
Dominick Verschelde
The role of the university museum in community development
David Ellis
University museums in a university town: University of Tartu Museums in
the service of the local community
ReetMägi
Ways of seeing: A model for community partnership working
Gill Hart
Accessibility to university museums: A strategical objective
EdmonCastell
From ACUMG-L
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:37 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.art-lawyer.de/index.php5?page=7&id=2783
http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6023370/Gericht-Berlin-darf-Sachs-Sammlung-behalten.html
Das Kammergericht Berlin entschied in zweiter Instanz, dass Sachs-Sohn Peter zwar der Eigentümer ist, er aber die Herausgabe der Sammlung nicht erzwingen kann.
Nach Ansicht des Kammergerichts hat sich das Museum um die Sammlung verdient gemacht. Es habe zu Recht davon ausgehen können, dass es die Sammlung behalten dürfe, sagte Bulling. «Die jahrzehntelange Bewahrung von mehr als 4000 Plakaten geht über eine bloße Nutzung hinaus.» artefacti
Ein Aktenzeichen habe ich nicht gefunden, ebenso wenig einen Volltext auf: http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/
Update:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kammergericht_8_U_56_09_Urteil_vom_28.1.2010.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/75238596/
http://www.welt.de/die-welt/kultur/article6023370/Gericht-Berlin-darf-Sachs-Sammlung-behalten.html
Das Kammergericht Berlin entschied in zweiter Instanz, dass Sachs-Sohn Peter zwar der Eigentümer ist, er aber die Herausgabe der Sammlung nicht erzwingen kann.
Nach Ansicht des Kammergerichts hat sich das Museum um die Sammlung verdient gemacht. Es habe zu Recht davon ausgehen können, dass es die Sammlung behalten dürfe, sagte Bulling. «Die jahrzehntelange Bewahrung von mehr als 4000 Plakaten geht über eine bloße Nutzung hinaus.» artefacti
Ein Aktenzeichen habe ich nicht gefunden, ebenso wenig einen Volltext auf: http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/
Update:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kammergericht_8_U_56_09_Urteil_vom_28.1.2010.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/75238596/
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:23 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Juni 2009 veröffentlichte ich hier eine Liste über twitternde Museen im deutschsprachigen Raum:
http://archiv.twoday.net/stories/5778662/
Es gab damals noch keine andere solche Liste. Die Liste ist natürlich überholt, bleibt aber interessant als Momentaufnahme mit Followerzahlen.
Beispiel: Müritzeum damals 182 Follower, heute über 6000 Follower.
Den aktuellen Stand spiegeln:
http://www.visitatio.de/Tourismus-in-Deutschland/Twittermania-in-deutschen-Museen/Rankingliste-der-twitternden-Museen/ (Rankings vom 27. Januar)
http://www.visitatio.de/Visitatio-News/Bilanz-von-FollowAMuseum.html
(Bilanz des Followamuseum-Tags)
http://www.followamuseum.com/germany.html
http://visuellepr.wordpress.com/2010/02/01/heute-ist-follow-a-museum-day/
Zu Museumblogs:
http://archiv.twoday.net/stories/6179499

http://archiv.twoday.net/stories/5778662/
Es gab damals noch keine andere solche Liste. Die Liste ist natürlich überholt, bleibt aber interessant als Momentaufnahme mit Followerzahlen.
Beispiel: Müritzeum damals 182 Follower, heute über 6000 Follower.
Den aktuellen Stand spiegeln:
http://www.visitatio.de/Tourismus-in-Deutschland/Twittermania-in-deutschen-Museen/Rankingliste-der-twitternden-Museen/ (Rankings vom 27. Januar)
http://www.visitatio.de/Visitatio-News/Bilanz-von-FollowAMuseum.html
(Bilanz des Followamuseum-Tags)
http://www.followamuseum.com/germany.html
http://visuellepr.wordpress.com/2010/02/01/heute-ist-follow-a-museum-day/
Zu Museumblogs:
http://archiv.twoday.net/stories/6179499

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:05 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Rechnungshof stellt Österreichs Bundesmuseen kein gutes Zeugnis aus: Außer in der Galerie Belvedere seien die Sammlungen nicht zur Gänze erfasst. „Ein etwaiger Verlust von Sammlungsobjekten fiele daher nicht auf“, heißt es in dem Bericht über das Kunsthistorische Museum (KHM), die Albertina, die Galerie Belvedere und das Technische Museum (TM).
Für den Opernball 2007 stellte das TM eine Kutsche zur Verfügung, obwohl die hauseigenen Restaurateure davon abgeraten hatten. 2008 verlieh die Galerie Belvedere insgesamt 74 Meisterwerke mit einem Versicherungswert von 416 Millionen Euro für eine Ausstellung in Italien. Die Genehmigung vom Bundesdenkmalamt holte man sich erst, als der Vertrag mit den Italienern bereits unterzeichnet war.
Madonna in Privatwohnung
Ministerien, Kammern und Botschaften sehen die Museen als Selbstbedienungsladen: So zierten 360 Objekte des KHM und rund 260 des Belvederes diverse Büros – obwohl die Werke öffentlich zugänglich sein müssten. Auch ein Kuratoriumsmitglied der Albertina schmückte sein Büro aus Sammlungsbeständen. Die Missstände bestehen seit Jahrzehnten: 1968 verlieh das KHM einige Gemälde an die Wiener Sängerknaben. Diese nahm Direktor Walter Tautschnig, als er in Pension ging, einfach in seine Privatwohnung mit. 2008 starb er – die Erben wollten das wertvollste Stück, eine Madonna mit Kind (italienische Renaissance) verkaufen. Das KHM konnte den Fall erst 2009 klären.(nak)
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Rechnungshof-deckt-Museums-Chaos-auf-0639433.ece
Mehr dazu:
http://derstandard.at/1263707180825/Bundesmuseen-Rechnungshof-Lausiger-Umgang-mit-dem-Sammlungsgut
http://www.krone.at/krone/S25/object_id__184913/hxcms/

Für den Opernball 2007 stellte das TM eine Kutsche zur Verfügung, obwohl die hauseigenen Restaurateure davon abgeraten hatten. 2008 verlieh die Galerie Belvedere insgesamt 74 Meisterwerke mit einem Versicherungswert von 416 Millionen Euro für eine Ausstellung in Italien. Die Genehmigung vom Bundesdenkmalamt holte man sich erst, als der Vertrag mit den Italienern bereits unterzeichnet war.
Madonna in Privatwohnung
Ministerien, Kammern und Botschaften sehen die Museen als Selbstbedienungsladen: So zierten 360 Objekte des KHM und rund 260 des Belvederes diverse Büros – obwohl die Werke öffentlich zugänglich sein müssten. Auch ein Kuratoriumsmitglied der Albertina schmückte sein Büro aus Sammlungsbeständen. Die Missstände bestehen seit Jahrzehnten: 1968 verlieh das KHM einige Gemälde an die Wiener Sängerknaben. Diese nahm Direktor Walter Tautschnig, als er in Pension ging, einfach in seine Privatwohnung mit. 2008 starb er – die Erben wollten das wertvollste Stück, eine Madonna mit Kind (italienische Renaissance) verkaufen. Das KHM konnte den Fall erst 2009 klären.(nak)
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Rechnungshof-deckt-Museums-Chaos-auf-0639433.ece
Mehr dazu:
http://derstandard.at/1263707180825/Bundesmuseen-Rechnungshof-Lausiger-Umgang-mit-dem-Sammlungsgut
http://www.krone.at/krone/S25/object_id__184913/hxcms/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.artknowledgenews.com/Indianapolis_Museum_of_Art_Searchable_Database_of_Deaccessioned_Artworks.html
Dass es eine öffentliche Datenbank der zum Verkauf anstehenden Werke gibt, ist natürlich besser als die übliche Heimlichtuerei in diesem Bereich, aber das ändert nichts daran, dass Museen als Sacharchive die Aufgabe haben, den Zugang zu Kulturgütern für die Öffentlichkeit dauerhaft sicherzustellen. Jede Abgabe an den Handel entzieht Geschichtsquellen der Forschung, da die Stücke in der Regel nicht an ein anderes öffentliches Museum kommen, sondern unzugänglich oder unauffindbar in Privatsammlungen verschwinden.
Solche Verkäufer untergraben auch das Vertrauen möglicher Stifter, und verstoßen gegen den impliziten Vertrag von Schenkern, die ihre Werke in einem sicheren Haften glaubten.
Siehe auch:
http://www.e-stuttgart.org/2009/12/der-grose-ausverkauf/

Dass es eine öffentliche Datenbank der zum Verkauf anstehenden Werke gibt, ist natürlich besser als die übliche Heimlichtuerei in diesem Bereich, aber das ändert nichts daran, dass Museen als Sacharchive die Aufgabe haben, den Zugang zu Kulturgütern für die Öffentlichkeit dauerhaft sicherzustellen. Jede Abgabe an den Handel entzieht Geschichtsquellen der Forschung, da die Stücke in der Regel nicht an ein anderes öffentliches Museum kommen, sondern unzugänglich oder unauffindbar in Privatsammlungen verschwinden.
Solche Verkäufer untergraben auch das Vertrauen möglicher Stifter, und verstoßen gegen den impliziten Vertrag von Schenkern, die ihre Werke in einem sicheren Haften glaubten.
Siehe auch:
http://www.e-stuttgart.org/2009/12/der-grose-ausverkauf/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ICOMSecretariat and ICOM Disaster Relief For Museums Task Force (DRFM) have immediately reacted to the Haiti earthquake and were extremely busy in seeking direct or indirect information about museums in Haiti. As every other NGO, ICOM faced enormous difficulties in getting reliable information directly from Haiti. Particular helpful were the nearby ICOM National Committee of the Dominican Republic and the Museum Association of the Caribbean (MAC).
Based on a list of Haiti museums (2008), we know of 14 institutions in the earthquake region: 4 museums open to the public, 6 museum projects with valuable collections and 4 other museum projects.
On ICOM website you will find a regularly updated "Status Report" in three languages:
http://icom.museum/risk_management.html
On the special Haiti webpage you may read details about museum colleagues, museum buildings and collections. We have received pictures from the Parc historique de la Canne à sucre museum. You can find them here:
http://icom.museum/disaster_relief/haiti.html
On the initiative of ICOM Haiti, a crisis unit "Patrimoine en Danger" has been established to co-ordinate support activities and take the most urgent actions. A list of urgent demand has been compiled and is under study.
Most important is the quick salvage of collections from collapsed or unstable buildings, because the rain season is expected latest by March. With only two appointed architects to evaluate the damage to the public buildings, our colleagues in Haiti stress that they need foreign experts of building static. Additional security measures are a common need as well, because the ordinary ones are disrupted or weakened.
There had been promising talks between ICOM DG Julien Anfruns and Alain Godonou, new Director of the Division of Cultural Objects and Intangible Heritage at UNESCO, concerning
- needs of a UN embargo on Haitian cultural goods to avoid (or reduce) art trafficking
- protection of damaged sites in the meantime ("cordon de sécurité")
- search for storage places
- preparation of a better coordination with various entities UNESCO/Heritage NGOs ...
BLUE SHIELD, was very active, too. It acted from the beginning as co-ordinator between ICA, IFLA, ICOMOS, CCAAA and ICOM. We also are exchanging all news that our different missions in Haiti get. The International Committee has edited a statement:
http://icom.museum/icbs-press/100115_BlueShield%20Statement_Haiti_EN.pdf
The Association of the national committees has created web 2.0 tools for heritage assistance:
1) a special web site in English, French and Spanish, where volunteers may apply online: "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity".
http://haiti2010.blueshield-international.org
About 450 volunteers have already joined! This initiative is based on the great success last year, when two BLUE SHIELD teams assisted the collapsed Cologne City Archive; more than 100 international volunteers took part at the two "international weeks".
2) This website is accompanied by the "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity" group on Facebook with more than 800 members. This is the best information source for Haiti heritage damage:
http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=247281734340
3) On Twitter you will find "Blueshieldcoop":
http://twitter.com/blueshieldcoop.
General Web link:
On January 16th, UNOSAT has published a satellite analysis of 110 major public buildings in Port-au-Prince - more than half of them are destroyed or damaged
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/HT/EQ20100114HTI/UNOSAT_HTI_EQ2010_BldDamages_v1_LR.pdf
Contact:
ICOMSecretariat: Stanislas Tarnowski, Director for the development of programmes
Email: Stanislas.tarnowski@icom.museum
DRFM: Mr Thomas Schuler, Chair.
Email: Th.Schuler@t-online.de
Dr. Stefan Sommer
Director, Colorado Plateau Biodiversity Center, http://www.mpcer.nau.edu/cpbc
Executive Producer, A River Reborn, http://www.mpcer.nau.edu/riverreborn
Faculty Advisor, Grand Canyon SEEDS Chapter, http://www.mpcer.nau.edu/seeds
Board of Directors, Assoc. of College & University Museums & Galleries, http://www.acumg.org
Faculty, Department of Biological Sciences
Northern Arizona University
Campus Box 5640
Flagstaff, AZ 86011
O: (928) 523-4463
F: (928) 523-7500
Stefan.Sommer@nau.edu
From ACUMG-L

Based on a list of Haiti museums (2008), we know of 14 institutions in the earthquake region: 4 museums open to the public, 6 museum projects with valuable collections and 4 other museum projects.
On ICOM website you will find a regularly updated "Status Report" in three languages:
http://icom.museum/risk_management.html
On the special Haiti webpage you may read details about museum colleagues, museum buildings and collections. We have received pictures from the Parc historique de la Canne à sucre museum. You can find them here:
http://icom.museum/disaster_relief/haiti.html
On the initiative of ICOM Haiti, a crisis unit "Patrimoine en Danger" has been established to co-ordinate support activities and take the most urgent actions. A list of urgent demand has been compiled and is under study.
Most important is the quick salvage of collections from collapsed or unstable buildings, because the rain season is expected latest by March. With only two appointed architects to evaluate the damage to the public buildings, our colleagues in Haiti stress that they need foreign experts of building static. Additional security measures are a common need as well, because the ordinary ones are disrupted or weakened.
There had been promising talks between ICOM DG Julien Anfruns and Alain Godonou, new Director of the Division of Cultural Objects and Intangible Heritage at UNESCO, concerning
- needs of a UN embargo on Haitian cultural goods to avoid (or reduce) art trafficking
- protection of damaged sites in the meantime ("cordon de sécurité")
- search for storage places
- preparation of a better coordination with various entities UNESCO/Heritage NGOs ...
BLUE SHIELD, was very active, too. It acted from the beginning as co-ordinator between ICA, IFLA, ICOMOS, CCAAA and ICOM. We also are exchanging all news that our different missions in Haiti get. The International Committee has edited a statement:
http://icom.museum/icbs-press/100115_BlueShield%20Statement_Haiti_EN.pdf
The Association of the national committees has created web 2.0 tools for heritage assistance:
1) a special web site in English, French and Spanish, where volunteers may apply online: "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity".
http://haiti2010.blueshield-international.org
About 450 volunteers have already joined! This initiative is based on the great success last year, when two BLUE SHIELD teams assisted the collapsed Cologne City Archive; more than 100 international volunteers took part at the two "international weeks".
2) This website is accompanied by the "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity" group on Facebook with more than 800 members. This is the best information source for Haiti heritage damage:
http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=247281734340
3) On Twitter you will find "Blueshieldcoop":
http://twitter.com/blueshieldcoop.
General Web link:
On January 16th, UNOSAT has published a satellite analysis of 110 major public buildings in Port-au-Prince - more than half of them are destroyed or damaged
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/HT/EQ20100114HTI/UNOSAT_HTI_EQ2010_BldDamages_v1_LR.pdf
Contact:
ICOMSecretariat: Stanislas Tarnowski, Director for the development of programmes
Email: Stanislas.tarnowski@icom.museum
DRFM: Mr Thomas Schuler, Chair.
Email: Th.Schuler@t-online.de
Dr. Stefan Sommer
Director, Colorado Plateau Biodiversity Center, http://www.mpcer.nau.edu/cpbc
Executive Producer, A River Reborn, http://www.mpcer.nau.edu/riverreborn
Faculty Advisor, Grand Canyon SEEDS Chapter, http://www.mpcer.nau.edu/seeds
Board of Directors, Assoc. of College & University Museums & Galleries, http://www.acumg.org
Faculty, Department of Biological Sciences
Northern Arizona University
Campus Box 5640
Flagstaff, AZ 86011
O: (928) 523-4463
F: (928) 523-7500
Stefan.Sommer@nau.edu
From ACUMG-L

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 16:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem aktuellen Newsletter des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
http://www.blha.de/FilePool/NewsletterArchiv_2_2010.pdf
Im Mittelpunkt der Fortbildungsveranstaltung der Landesfachstelle am 27. Januar 2010 standen Konsequenzen aus dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs für den Bau und das Risikomanagement von Archiven. Folgen-de Präsentationen von Alexandra Jeberien MA, Dipl.-Restauratorin (FH), Hochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin, zur Notfallplanung in Museen und Archiven sind abrufbar unter:
- Zur Notwendigkeit der Katastrophenprävention ( http://www.blha.de/FilePool/Jeberien_Notfallpraevention_I.pdf )
- Inhalte und Umsetzung von Notfall- und Evakuierungsplänen ( http://www.blha.de/FilePool/Jeberien_Notfallpraevention_II.pdf )
http://www.blha.de/FilePool/NewsletterArchiv_2_2010.pdf
Im Mittelpunkt der Fortbildungsveranstaltung der Landesfachstelle am 27. Januar 2010 standen Konsequenzen aus dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs für den Bau und das Risikomanagement von Archiven. Folgen-de Präsentationen von Alexandra Jeberien MA, Dipl.-Restauratorin (FH), Hochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin, zur Notfallplanung in Museen und Archiven sind abrufbar unter:
- Zur Notwendigkeit der Katastrophenprävention ( http://www.blha.de/FilePool/Jeberien_Notfallpraevention_I.pdf )
- Inhalte und Umsetzung von Notfall- und Evakuierungsplänen ( http://www.blha.de/FilePool/Jeberien_Notfallpraevention_II.pdf )
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 16:21 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The International Council on Archives wants to publicize throughout the international community the efforts of our Haitian colleagues, who have formed a crisis cell "Heritage in danger", on the fringes of the official commission for the evaluation of buildings and reconstruction. An initial statement of requirements has been issued and you will find a copy of it attached. The Secretariat has very recently been in touch with Jean-Wilfrid Bertrand, the National Archivist of Haiti, and Jérémy Lachal, Executive Director of Libraries Without Borders, currently on mission in Port-au-Prince. Jean-Wilfrid and others have confirmed that the items on the requirements list are really needed, and that, if anything, it is an under-statement. Jean-Wilfrid has in particular emphasized the urgent requirement for tarpaulins. These are needed to protect records that are at present lying on the ground, because the buildings that previously housed them have been destroyed. If nothing is done now, they will be completely exposed during the forthcoming rainy season. ICA is now working as a matter of urgency on ways of getting these and other materials to him at Port-au-Prince as quickly as possible.
At present the efforts of ICA, through its participation in the Blue Shield Network, are focused on the collection of hard information, as the basis for a first report on damage to cultural property in Haiti. All information collected by organizations in the Blue Shield will be made available to governments, associations and other organizations. The report will give an indication of the likely resources that will be needed to safeguard the heritage of this country. ICA will also be encouraging the Blue Shield to provide timely help, in the form of a detailed action plan, for the Crisis Cell "Heritage in danger" in its work of coordinating and organizing rescue teams.
The ICA would like to take this opportunity to thank the nearly 500 volunteers who have already responded to the appeals for help. Our goal now is to adapt the operations of aid and assistance to the needs that have been identified on the spot, in conditions of maximum security.
David Leitch
Secretary General/Secrétaire Général
International Council on Archives/Conseil International des Archives
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS
FRANCE
tel: + 33 (0)1 40 27 63 49
fax: + 33 (0)1 42 72 20 65
e-mail: leitch@ica.org
web: http://www.ica.org
Link
At present the efforts of ICA, through its participation in the Blue Shield Network, are focused on the collection of hard information, as the basis for a first report on damage to cultural property in Haiti. All information collected by organizations in the Blue Shield will be made available to governments, associations and other organizations. The report will give an indication of the likely resources that will be needed to safeguard the heritage of this country. ICA will also be encouraging the Blue Shield to provide timely help, in the form of a detailed action plan, for the Crisis Cell "Heritage in danger" in its work of coordinating and organizing rescue teams.
The ICA would like to take this opportunity to thank the nearly 500 volunteers who have already responded to the appeals for help. Our goal now is to adapt the operations of aid and assistance to the needs that have been identified on the spot, in conditions of maximum security.
David Leitch
Secretary General/Secrétaire Général
International Council on Archives/Conseil International des Archives
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS
FRANCE
tel: + 33 (0)1 40 27 63 49
fax: + 33 (0)1 42 72 20 65
e-mail: leitch@ica.org
web: http://www.ica.org
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 14:48 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The International Internet Preservation Consortium (IIPC) has launched a new registry ( http://netpreserve.org/about/archiveList.php ) of its members’ web archives. Preserving the web is not a task of any single institution. It is a mission common to all IIPC members, and many practices and lessons are transferable.
The launch of the members' web archive registry showcases international collaboration for preserving internet content for future generations. The registry currently includes descriptions of twenty one archives from around the world. As additional archives are made available by IIPC members, the registry will be updated.
The registry provides an overview of all members web archiving efforts and outputs, offering a single point of access to users of archived web content. It also provide detailed description of each web archive, including information about the collecting institution, the harvesting methods (domain, selective, or thematic), the language of the user interface, methods for accessing the archived content, and whether there are any access restrictions that researchers need to be aware of.
The registry was put in place by IIPC’s Access Working Group, which focuses on initiatives, procedures and tools required to provide immediate access and to preserve the future access to Internet material in a Web archive. The registry provides a basis for IIPC to explore integrated access and search in the future.
http://netpreserve.org/press/pr20091222.php
The launch of the members' web archive registry showcases international collaboration for preserving internet content for future generations. The registry currently includes descriptions of twenty one archives from around the world. As additional archives are made available by IIPC members, the registry will be updated.
The registry provides an overview of all members web archiving efforts and outputs, offering a single point of access to users of archived web content. It also provide detailed description of each web archive, including information about the collecting institution, the harvesting methods (domain, selective, or thematic), the language of the user interface, methods for accessing the archived content, and whether there are any access restrictions that researchers need to be aware of.
The registry was put in place by IIPC’s Access Working Group, which focuses on initiatives, procedures and tools required to provide immediate access and to preserve the future access to Internet material in a Web archive. The registry provides a basis for IIPC to explore integrated access and search in the future.
http://netpreserve.org/press/pr20091222.php
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Februar 2010, 01:51 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Le Cabinet des Médailles et Antiques à Paris est un musée de premier plan qui abrite des trésors nationaux (trésor de Childéric, trône de Dagobert, échecs "de Charlemagne", etc.) et s'est enrichi jusqu'à nos jours de nombreux dons. Il constitue une des plus importantes collections au monde de vases grecs, pierres fines et monnaies, mais aussi marbres, bronzes, ivoires... Mais il est aujourd'hui gravement menacé. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site :
< http://www.cabinetdesmedailles.net/ >
[Wiki site in English:
< http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_des_M%C3%A9dailles >]
Et pour nous aider à sauver le musée, n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, signer la pétition... et venir visiter.
Pour la pétition :
http://jesigne.fr/sign/petition/sauvonsleplusancienmuseedefrance>,
la procédure est la suivante :
1. Cliquer sur Signez au bas de la première page.
2. Une feuille d'enregistrement s'affiche. Remplir les champs (ceux avec * sont indispensables pour l'enregistrement : Prénom et Nom, Mail et Code postal), recopier les 5 chiffres inscrits en bas dans la case à côté, et cliquer sur Signez.
3. Une nouvelle page s'affiche : ne pas tenir compte des questions posées et cliquer directement sur Envoyer.
Via Françoise Briquel Chatonnet
Voir aussi:
DER SPIEGEL 6/2010 vom 8.2.2010 Kein Geld für Münzen
http://www.cabinetdesmedailles.net/Association_pour_le_Cabinet_des_medailles/Accueil.html

#numismatik
< http://www.cabinetdesmedailles.net/ >
[Wiki site in English:
< http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_des_M%C3%A9dailles >]
Et pour nous aider à sauver le musée, n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, signer la pétition... et venir visiter.
Pour la pétition :
http://jesigne.fr/sign/petition/sauvonsleplusancienmuseedefrance>,
la procédure est la suivante :
1. Cliquer sur Signez au bas de la première page.
2. Une feuille d'enregistrement s'affiche. Remplir les champs (ceux avec * sont indispensables pour l'enregistrement : Prénom et Nom, Mail et Code postal), recopier les 5 chiffres inscrits en bas dans la case à côté, et cliquer sur Signez.
3. Une nouvelle page s'affiche : ne pas tenir compte des questions posées et cliquer directement sur Envoyer.
Via Françoise Briquel Chatonnet
Voir aussi:
DER SPIEGEL 6/2010 vom 8.2.2010 Kein Geld für Münzen
http://www.cabinetdesmedailles.net/Association_pour_le_Cabinet_des_medailles/Accueil.html

#numismatik
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 23:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neue Beiträge auf http://www.ordensarchive.at.
* ORGANISATION IN ORDENSARCHIVEN
Rückblick auf die Informationstagung im Rahmen des Herbsttreffens der österreichischen Ordensgemeinschaften am 23. November 2009 zum Thema: „Organisation und Arbeitsplanung in Ordensarchiven.“
* MATRIKENWORKSHOP
Einladung der Fachgruppe „Archive der Kirchen und anerkannten staatlichen Religionsgemeinschaften“ im Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare zu einem Workshop am 25. Februar 2010 in Wien zum Thema „Rechtlicher Umgang mit Matrikenauskünften“.
* INFORMATIONSTAGUNG FÜR BIBLIOTHEKARE
Einladung zu einem Treffen der Bibliothekare der Klöster und Orden am 10. März 2010 in St. Pölten, Thema: das EDV-Programm „Dabis“ und der „Verbund der theologischen und kirchlichen Bibliotheken“.
* JAHRESTAGUNG 2010
Die Jahrestagung der Ordensarchive findet heuer gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Diözesanarchive statt, und zwar von 15. bis 17. Juni 2010 im Stift St. Lambrecht.
* NEUE ARCHIVARE
Wir stellen die neuen Stiftsarchivare vor.
* ORGANISATION IN ORDENSARCHIVEN
Rückblick auf die Informationstagung im Rahmen des Herbsttreffens der österreichischen Ordensgemeinschaften am 23. November 2009 zum Thema: „Organisation und Arbeitsplanung in Ordensarchiven.“
* MATRIKENWORKSHOP
Einladung der Fachgruppe „Archive der Kirchen und anerkannten staatlichen Religionsgemeinschaften“ im Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare zu einem Workshop am 25. Februar 2010 in Wien zum Thema „Rechtlicher Umgang mit Matrikenauskünften“.
* INFORMATIONSTAGUNG FÜR BIBLIOTHEKARE
Einladung zu einem Treffen der Bibliothekare der Klöster und Orden am 10. März 2010 in St. Pölten, Thema: das EDV-Programm „Dabis“ und der „Verbund der theologischen und kirchlichen Bibliotheken“.
* JAHRESTAGUNG 2010
Die Jahrestagung der Ordensarchive findet heuer gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Diözesanarchive statt, und zwar von 15. bis 17. Juni 2010 im Stift St. Lambrecht.
* NEUE ARCHIVARE
Wir stellen die neuen Stiftsarchivare vor.
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 23:04 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diese unterscheiden zwischen Suchanfragen und Internetseiten. Heute hab ich mal nach den beiden Zeichenfolgen gesucht (Chrome gibt die Trefferanzahl bei Strg-F aus):
462 Suchanfragen, 213 http-Seiten, macht 675.
Ganz wenige Adressen/Suchanfragen haben mehr als einen Treffer (an der Spitze steht heute eine Wikipedia-Seite mit 27 Treffern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Urheberrechtsfragen )
Man kann also behaupten, dass Archivalia mindestens einige hundert Besucher pro Tag hat.
462 Suchanfragen, 213 http-Seiten, macht 675.
Ganz wenige Adressen/Suchanfragen haben mehr als einen Treffer (an der Spitze steht heute eine Wikipedia-Seite mit 27 Treffern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Urheberrechtsfragen )
Man kann also behaupten, dass Archivalia mindestens einige hundert Besucher pro Tag hat.
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 22:47 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 22:16 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 22:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.cispea.org/allegati/Archivi_Digitali.htm Kommentiert auf Italienisch.
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ab sofort online auf Monasterium.net: Die Urkunden des Wiener Stadt- und Landesarchivs und zwar:
Die Urkunden des Wiener Bürgerspitals
Hauptarchiv Urkunden
Hauptarchiv Urkunden - Abschriften
Innungsurkunden
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/MOM-CA/start.do

Die Urkunden des Wiener Bürgerspitals
Hauptarchiv Urkunden
Hauptarchiv Urkunden - Abschriften
Innungsurkunden
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/MOM-CA/start.do

KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mgh.de/home/aktuelles/newsdetails/prof-dr-mark-mersiowsky-berufung-nach-innsbruck/e96693fac8/
Wir wünschen dem sympathischen Töttchen-Liebhaber natürlich alles Gute.
Wir wünschen dem sympathischen Töttchen-Liebhaber natürlich alles Gute.
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:30 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Januar 2010 wurden folgende Projekte neu hinzugefügt:
Bücher
Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1894, Berlin 1893.
Hermann MOECK-CELLE: Heimat- und Einwohnerbuch Kehdingen 1926-30
Karl RÜBEL: Dortmund/Urkundenbuch 1910
Christian QUIX: Geschichte der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid
Bremen/Staatshandbuch 1904
Bremen/Staatshandbuch 1908
Bremen/Staatshandbuch 1926
Albert GSELL: Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare
P. WITTEBORG: Ein frühvollendetes Missionarsleben (1900)
Transkribiert wurde: N. SIEBERG: Geschichte der Pfarre und Pfarrkirche St. Jacob in Aachen 1884 (Transkription: Heiner Pelzer)
Adressbücher
Sorau/Adressbuch 1913
Sorau/Adressbuch 1921
Worms/Adressbuch 1939
Meiningen/Adressbuch 1904
Deutschland/Kolonialadressbuch 1897
Aachen/Adressbuch 1938
Kiel/Adressbuch 1934
Kiel/Adressbuch 1940
Alle Direktlinks findet man unter: http://wiki-de.genealogy.net/Portal:DigiBib/Neu_
Bücher
Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1894, Berlin 1893.
Hermann MOECK-CELLE: Heimat- und Einwohnerbuch Kehdingen 1926-30
Karl RÜBEL: Dortmund/Urkundenbuch 1910
Christian QUIX: Geschichte der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid
Bremen/Staatshandbuch 1904
Bremen/Staatshandbuch 1908
Bremen/Staatshandbuch 1926
Albert GSELL: Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare
P. WITTEBORG: Ein frühvollendetes Missionarsleben (1900)
Transkribiert wurde: N. SIEBERG: Geschichte der Pfarre und Pfarrkirche St. Jacob in Aachen 1884 (Transkription: Heiner Pelzer)
Adressbücher
Sorau/Adressbuch 1913
Sorau/Adressbuch 1921
Worms/Adressbuch 1939
Meiningen/Adressbuch 1904
Deutschland/Kolonialadressbuch 1897
Aachen/Adressbuch 1938
Kiel/Adressbuch 1934
Kiel/Adressbuch 1940
Alle Direktlinks findet man unter: http://wiki-de.genealogy.net/Portal:DigiBib/Neu_
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:27 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Autoren der jeweiligen Quellen bitten um Beachtung, dass die Einträge (Kirchenbuchauszüge, Transkriptionen von Regesten und Gerichtsbüchern) dem Urheberrecht unterliegen."
Netter Versuch, aber genauso dumm und falsch wie die Machenschaften der anderen Public-Domain-Betrüger.
http://www.webgenealogie.de/pgv/
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2010/02
Netter Versuch, aber genauso dumm und falsch wie die Machenschaften der anderen Public-Domain-Betrüger.
http://www.webgenealogie.de/pgv/
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2010/02
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:18 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mediatheeknhl.blogspot.com/2010/02/website-scholtenhuis-wint-prijs.html
http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/156_668/content/811/Juryrapport_GOP_09.html

http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/156_668/content/811/Juryrapport_GOP_09.html
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:15 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat schon Ende 2008 verordnet, dass die Sicherungsregister und Zweitbücher der Personenstandsunterlagen nach Ablauf der Fortführungsfristen der Landesarchivverwaltung, d. h. an das Landeshauptarchiv Koblenz, abzuliefern sind. Grund für diese Verordnung war das neue Personenstandsgesetz, das neue Fristen für die Einsichtnahme in die Standesamtsakten festgelegt hat. Bereits seit 1798 gibt es im ehemals französisch besetzen Rheinland Zivilstandsregister, die nun in ein zentrales Archiv wandern. Die Erstschriften, Beleg- und Sammelakten bleiben weiter in kommunaler Verwahrung.
Beim Landeshauptarchiv Koblenz wird bis zum 31.12.2010 ein zentrales Personenstandsarchiv eingerichtet. Es erhält die frei gewordenen Personenstandsunterlagen, die bisher von den Standesämtern und Kreisverwaltungen bzw. kreisfreien Städte aufbewahrt wurden. Damit steht der Öffentlichkeit auch in Rheinland-Pfalz erstmalig geschlossen eine personengeschichtliche Quelle zur Verfügung, die genauso wie in Teilen Nordrhein-Westfalens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurückreicht. Einen Wermutstropfen hat diese geplante Zentralisierung der Bücher in einer angemieteten Halle in Koblenz: Die Benutzung ist ab 1. Januar 2011 bis auf weiteres leider nur nach Voranmeldung möglich.
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2010/02#Neues_Personenstandsarchiv_in_Koblenz
http://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=189&printView=1
Beim Landeshauptarchiv Koblenz wird bis zum 31.12.2010 ein zentrales Personenstandsarchiv eingerichtet. Es erhält die frei gewordenen Personenstandsunterlagen, die bisher von den Standesämtern und Kreisverwaltungen bzw. kreisfreien Städte aufbewahrt wurden. Damit steht der Öffentlichkeit auch in Rheinland-Pfalz erstmalig geschlossen eine personengeschichtliche Quelle zur Verfügung, die genauso wie in Teilen Nordrhein-Westfalens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurückreicht. Einen Wermutstropfen hat diese geplante Zentralisierung der Bücher in einer angemieteten Halle in Koblenz: Die Benutzung ist ab 1. Januar 2011 bis auf weiteres leider nur nach Voranmeldung möglich.
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2010/02#Neues_Personenstandsarchiv_in_Koblenz
http://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=189&printView=1
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 21:03 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 20:53 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 20:43 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 20:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bildblog.de/16083/a-streetviewcar-named-desire/
Zu StreetView siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
Zu StreetView siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
Google Street Car In Berlin from Evan Roth on Vimeo.
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 20:25 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Twitter-Feed von Margit Rambow wies auf den entsprechenden Blogeintrag hin (in dem es heraldische Links gibt):
http://www.rambow.de/haus-fuerstenberg-suedwestdeutscher-reichsadel.html
Mauerer, Esteban: Südwestdeutscher Reichsadel im 17. und 18. Jahrhundert, Geld, Reputation, Karriere: das Haus Fürstenberg, Göttingen, 2001
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00044557/images/
Dieses Buch habe ich 2004 in den Sehepunkten rezensiert:
http://www.sehepunkte.de/2004/06/4508.html
Auszug:
Mauerers Studie, dankenswerterweise durch ein Orts- und Personenregister erschlossen, stellt einen gewichtigen Beitrag zur frühneuzeitlichen Adelsgeschichte dar. Der biografische Ansatz überzeugt. Facettenreich und kulturhistorisch fesselnd wird dem Leser das Ringen um Reputation vor dem Hintergrund knapper finanzieller Ressourcen vor Augen geführt. Lehrreicher als die Erfolge sind die gescheiterten Pläne, die strukturellen Hürden und individuellen Konfliktlagen.
Hinsichtlich eines Teilaspekts, den ich durchaus nicht für marginal halte, kann ich dem Autor Kritik nicht ganz ersparen. Es ist schade, dass sich Mauerer nicht mehr um den erhaltenen Buchbesitz der Fürstenberger gekümmert hat. Als er seine Dissertation erarbeitete, waren die Druckschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen noch nicht in alle Winde zerstreut (das Gros wurde 1999 einem angloamerikanischen Antiquariatskonsortium verkauft). Im Quellenverzeichnis sind die Titel der frühneuzeitlichen Drucke zwar minuziös wiedergegeben, aber die Standorte der meist seltenen Schriften erfährt man leider nicht. Man darf vermuten, dass Mauerer manche in Donaueschingen eingesehen hat. Über die Rolle der Bücher bei der Erziehung der Fürstenberger wird nicht viel gesagt (34f.) - nur bei dem Staatsroman "Argenis" von John Barclay weist Mauerer darauf hin, dass er in der Bibliothek des Landvogts Anton Bidermann, die in die spätere Hofbibliothek Donaueschingen gelangte, vorhanden war (34, Anm. 47). Dass anscheinend bereits in den 1920er-Jahren das Haus Fürstenberg hausgeschichtlich wertvolle Materialien undokumentiert veräußerte, geht aus einem anmerkungsweise gegebenen Hinweis hervor, wonach das gedruckte Thesenblatt der Prager Disputation Christoph Friedrichs von 1679, das Sigmund Riezler 1883 in Donaueschingen noch vorlag, inzwischen verschollen ist (43, Anm. 110). Maurer beschäftigt sich in einem Exkurs mit den in einem Nachlassverzeichnis des 1684 gefallenen Friedrich Christoph (179-186) aufgeführten 20 Werken, die er selbstsicher identifiziert, ohne dem Leser die Möglichkeit zu geben, durch einen Abdruck der kurzen Bücherliste die Resultate zu kontrollieren. Es wäre ohne weiteres zumutbar gewesen, die Existenz der aufgelisteten Bücher in der Donaueschinger Bibliothek zu überprüfen - Mauerer hat dies zum bleibenden Schaden der Wissenschaft unterlassen.
Er wäre fündig geworden, denn der amerikanische Antiquar Bruce McKittrick bot im Jahr 2002 einen Lipsius-Sammelband aus der Hofbibliothek Donaueschingen an, den er aufgrund der Lektüre von Mauerers Arbeit (183f.), auf die ich ihn aufmerksam gemacht hatte, mit dem Studium Friedrich Christophs von Fürstenberg in Verbindung bringen wollte. Im Bücherverzeichnis erscheint ja die "Politik" des Lipsius. Der exorbitante Preis (16.000 US-Dollar) des ehemals Donaueschinger Bandes verhinderte einen Ankauf durch eine deutsche Bibliothek. In der Beschreibung des Antiquars [1] wird die Verfasserschaft des Hofmeisters Kappeler als Faktum dargestellt - eine Hypothese, die zu überprüfen wäre, vorausgesetzt der Band stünde der Forschung zur Verfügung.
Dass erhaltene Adelsbibliotheken bedeutsame Quellen der Bildungsgeschichte sind, ist wiederholt herausgestellt worden. [2] Die mit dem unzutreffenden Dubletten-Argument begründete Weigerung des Landes Baden-Württemberg, die Donaueschinger Druckschriften 1999 durch Ankauf zu sichern [3], hat eine unikale Geschichtsquelle irreversibel vernichtet und der Forschung die Möglichkeit genommen, Hausgeschichte und frühneuzeitlichen Buchbesitz aufeinander zu beziehen. Ob es neben dem bildungsgeschichtlich so faszinierenden Lipsius-Sammelband vergleichbare weitere Zeugnisse für die Adelserziehung der Fürstenberger in der Hofbibliothek Donaueschingen gab? Möglicherweise wird es die Wissenschaft nie erfahren.
Anmerkungen:
[1] Lipsius, Justus. Politicorvm Sive Civilis Doctrinae Libri Sex. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 304p. & pp. 305-19 of ms. Pages in typographic frames, inner & outer shoulder notes, title in red & black with a Wechel device. 17th century reversed? calf (soiled), the entire volume interleaved to quarto, quarto leaves uncut. with: Lipsius, J. Adversus Dialogistam Liber. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 77, [2]p. & [44]p. of ms. index. Typography & device as above (I). With: Lipsius, J. De Constantia Libri Dvo. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 126, [2 blank]p.
Typography & device as above (I-II). $16000.00
Ad I-III: This intensively annotated Sammelband illuminates the late baroque education of a Catholic prince: Friedrich Christoph von Fürstenberg (1662-84). It figures prominently among the twenty books he inventoried just months before his death (Mauerer). The manuscript contributions can be attributed to Friedrich Kappeler, who tutored Friedrich Christoph and his three younger brothers from 1668 to 1682. Kappeler had the three printed books inter- leaved with blank quarto bifolia and had the new book block pressed so the printed leaves left a blind impression on the adjoining blanks, creating new "text" and "margin" areas that mimicked the letterpress text with its inner and outer columns of shoulder notes. The tutor first tackled On Politics (I). (He handled Adversus dialogistam (II) less exhaustively and left De constantia (III) virgin.) He numbered its 2159 maxims and inserted interlinear textual elaborations. In the inner margin, he completed every printed citation - literary, historical, military, technical or philosophical - emending them where necessary. In the outer margin he commented on the printed subject summaries. He then similarly annotated the blank quarto leaves in up to four columns. He used the "text" area for quotations, observations, exempla and ancillary citations and the "margins" for primary citations and detailed amplifications. Lastly, he underlined in red all significant manuscript passages and compiled a forty-four page double-column alphabetic subject index to this complex manuscript. Even the index bears revisions, commentary and corrections. Above all, Kappeler was pragmatic, not pedantic, in his work. For example, one page of Lipsius' text on explosives, artillery and war machines sparked nearly 1000 words of four-column manuscript on the facing blank: the Fürstenbergs lost six family members in military service between 1676 and 1704, including Friedrich Christoph. Though Kappeler's charge excelled in his studies, the family called him home from his Kavaliertour in late 1682 to serve the Emperor in Hungary. On 18 July 1684 the boy lay carrion before Ofen. In excellent condition, Donaueschingen library stamp, shelf mark in pencil and in ink (on loose spine label).
[2] Bedauerlicherweise haben die von dem Wuppertaler Germanisten Rainer Gruenter und seiner "Arbeitsstelle Achtzehntes Jahrhundert" unternommenen Versuche, die Bestände noch existierender Adelsbibliotheken auszuwerten, nach seinem Tod keine Fortführung erfahren. 1982 publizierte Gruenter einen programmatischen Aufsatz "Hof- und Hofmeister-Literatur in Adelsbibliotheken", in: Euphorion 76 (1982), 361-388. Von den Arbeiten seines Schülerkreises widmete sich eine Monografie ganz der Adelserziehung: Heinke Wunderlich: Studienjahre der Grafen Salm-Reifferscheid (1780-1791). Ein Beitrag zur Adelserziehung am Ende des Ancien Régime, Heidelberg 1984 (die dort behandelte Adelsbibliothek auf Schloss Dyck wurde 1992/93 versteigert). Mir liegt der 120 Seiten umfassende maschinenschriftliche undatierte, 1979 oder später entstandene Bericht "Erforschung von Bibliotheken und Buchbeständen des 18. Jahrhunderts im rheinisch-westfälischen Raum" der Wuppertaler Arbeitsstelle vor, der schätzenswerte Angaben zu Adelsbibliotheken enthält, die nur zum Teil in gedruckter Form publiziert wurden.
[3] Dokumentation des Falles Donaueschingen im WWW:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/don.htm

http://www.rambow.de/haus-fuerstenberg-suedwestdeutscher-reichsadel.html
Mauerer, Esteban: Südwestdeutscher Reichsadel im 17. und 18. Jahrhundert, Geld, Reputation, Karriere: das Haus Fürstenberg, Göttingen, 2001
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00044557/images/
Dieses Buch habe ich 2004 in den Sehepunkten rezensiert:
http://www.sehepunkte.de/2004/06/4508.html
Auszug:
Mauerers Studie, dankenswerterweise durch ein Orts- und Personenregister erschlossen, stellt einen gewichtigen Beitrag zur frühneuzeitlichen Adelsgeschichte dar. Der biografische Ansatz überzeugt. Facettenreich und kulturhistorisch fesselnd wird dem Leser das Ringen um Reputation vor dem Hintergrund knapper finanzieller Ressourcen vor Augen geführt. Lehrreicher als die Erfolge sind die gescheiterten Pläne, die strukturellen Hürden und individuellen Konfliktlagen.
Hinsichtlich eines Teilaspekts, den ich durchaus nicht für marginal halte, kann ich dem Autor Kritik nicht ganz ersparen. Es ist schade, dass sich Mauerer nicht mehr um den erhaltenen Buchbesitz der Fürstenberger gekümmert hat. Als er seine Dissertation erarbeitete, waren die Druckschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen noch nicht in alle Winde zerstreut (das Gros wurde 1999 einem angloamerikanischen Antiquariatskonsortium verkauft). Im Quellenverzeichnis sind die Titel der frühneuzeitlichen Drucke zwar minuziös wiedergegeben, aber die Standorte der meist seltenen Schriften erfährt man leider nicht. Man darf vermuten, dass Mauerer manche in Donaueschingen eingesehen hat. Über die Rolle der Bücher bei der Erziehung der Fürstenberger wird nicht viel gesagt (34f.) - nur bei dem Staatsroman "Argenis" von John Barclay weist Mauerer darauf hin, dass er in der Bibliothek des Landvogts Anton Bidermann, die in die spätere Hofbibliothek Donaueschingen gelangte, vorhanden war (34, Anm. 47). Dass anscheinend bereits in den 1920er-Jahren das Haus Fürstenberg hausgeschichtlich wertvolle Materialien undokumentiert veräußerte, geht aus einem anmerkungsweise gegebenen Hinweis hervor, wonach das gedruckte Thesenblatt der Prager Disputation Christoph Friedrichs von 1679, das Sigmund Riezler 1883 in Donaueschingen noch vorlag, inzwischen verschollen ist (43, Anm. 110). Maurer beschäftigt sich in einem Exkurs mit den in einem Nachlassverzeichnis des 1684 gefallenen Friedrich Christoph (179-186) aufgeführten 20 Werken, die er selbstsicher identifiziert, ohne dem Leser die Möglichkeit zu geben, durch einen Abdruck der kurzen Bücherliste die Resultate zu kontrollieren. Es wäre ohne weiteres zumutbar gewesen, die Existenz der aufgelisteten Bücher in der Donaueschinger Bibliothek zu überprüfen - Mauerer hat dies zum bleibenden Schaden der Wissenschaft unterlassen.
Er wäre fündig geworden, denn der amerikanische Antiquar Bruce McKittrick bot im Jahr 2002 einen Lipsius-Sammelband aus der Hofbibliothek Donaueschingen an, den er aufgrund der Lektüre von Mauerers Arbeit (183f.), auf die ich ihn aufmerksam gemacht hatte, mit dem Studium Friedrich Christophs von Fürstenberg in Verbindung bringen wollte. Im Bücherverzeichnis erscheint ja die "Politik" des Lipsius. Der exorbitante Preis (16.000 US-Dollar) des ehemals Donaueschinger Bandes verhinderte einen Ankauf durch eine deutsche Bibliothek. In der Beschreibung des Antiquars [1] wird die Verfasserschaft des Hofmeisters Kappeler als Faktum dargestellt - eine Hypothese, die zu überprüfen wäre, vorausgesetzt der Band stünde der Forschung zur Verfügung.
Dass erhaltene Adelsbibliotheken bedeutsame Quellen der Bildungsgeschichte sind, ist wiederholt herausgestellt worden. [2] Die mit dem unzutreffenden Dubletten-Argument begründete Weigerung des Landes Baden-Württemberg, die Donaueschinger Druckschriften 1999 durch Ankauf zu sichern [3], hat eine unikale Geschichtsquelle irreversibel vernichtet und der Forschung die Möglichkeit genommen, Hausgeschichte und frühneuzeitlichen Buchbesitz aufeinander zu beziehen. Ob es neben dem bildungsgeschichtlich so faszinierenden Lipsius-Sammelband vergleichbare weitere Zeugnisse für die Adelserziehung der Fürstenberger in der Hofbibliothek Donaueschingen gab? Möglicherweise wird es die Wissenschaft nie erfahren.
Anmerkungen:
[1] Lipsius, Justus. Politicorvm Sive Civilis Doctrinae Libri Sex. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 304p. & pp. 305-19 of ms. Pages in typographic frames, inner & outer shoulder notes, title in red & black with a Wechel device. 17th century reversed? calf (soiled), the entire volume interleaved to quarto, quarto leaves uncut. with: Lipsius, J. Adversus Dialogistam Liber. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 77, [2]p. & [44]p. of ms. index. Typography & device as above (I). With: Lipsius, J. De Constantia Libri Dvo. Frankfurt a.M., J. Wechel & P. Fischer 1591. 8vo. 126, [2 blank]p.
Typography & device as above (I-II). $16000.00
Ad I-III: This intensively annotated Sammelband illuminates the late baroque education of a Catholic prince: Friedrich Christoph von Fürstenberg (1662-84). It figures prominently among the twenty books he inventoried just months before his death (Mauerer). The manuscript contributions can be attributed to Friedrich Kappeler, who tutored Friedrich Christoph and his three younger brothers from 1668 to 1682. Kappeler had the three printed books inter- leaved with blank quarto bifolia and had the new book block pressed so the printed leaves left a blind impression on the adjoining blanks, creating new "text" and "margin" areas that mimicked the letterpress text with its inner and outer columns of shoulder notes. The tutor first tackled On Politics (I). (He handled Adversus dialogistam (II) less exhaustively and left De constantia (III) virgin.) He numbered its 2159 maxims and inserted interlinear textual elaborations. In the inner margin, he completed every printed citation - literary, historical, military, technical or philosophical - emending them where necessary. In the outer margin he commented on the printed subject summaries. He then similarly annotated the blank quarto leaves in up to four columns. He used the "text" area for quotations, observations, exempla and ancillary citations and the "margins" for primary citations and detailed amplifications. Lastly, he underlined in red all significant manuscript passages and compiled a forty-four page double-column alphabetic subject index to this complex manuscript. Even the index bears revisions, commentary and corrections. Above all, Kappeler was pragmatic, not pedantic, in his work. For example, one page of Lipsius' text on explosives, artillery and war machines sparked nearly 1000 words of four-column manuscript on the facing blank: the Fürstenbergs lost six family members in military service between 1676 and 1704, including Friedrich Christoph. Though Kappeler's charge excelled in his studies, the family called him home from his Kavaliertour in late 1682 to serve the Emperor in Hungary. On 18 July 1684 the boy lay carrion before Ofen. In excellent condition, Donaueschingen library stamp, shelf mark in pencil and in ink (on loose spine label).
[2] Bedauerlicherweise haben die von dem Wuppertaler Germanisten Rainer Gruenter und seiner "Arbeitsstelle Achtzehntes Jahrhundert" unternommenen Versuche, die Bestände noch existierender Adelsbibliotheken auszuwerten, nach seinem Tod keine Fortführung erfahren. 1982 publizierte Gruenter einen programmatischen Aufsatz "Hof- und Hofmeister-Literatur in Adelsbibliotheken", in: Euphorion 76 (1982), 361-388. Von den Arbeiten seines Schülerkreises widmete sich eine Monografie ganz der Adelserziehung: Heinke Wunderlich: Studienjahre der Grafen Salm-Reifferscheid (1780-1791). Ein Beitrag zur Adelserziehung am Ende des Ancien Régime, Heidelberg 1984 (die dort behandelte Adelsbibliothek auf Schloss Dyck wurde 1992/93 versteigert). Mir liegt der 120 Seiten umfassende maschinenschriftliche undatierte, 1979 oder später entstandene Bericht "Erforschung von Bibliotheken und Buchbeständen des 18. Jahrhunderts im rheinisch-westfälischen Raum" der Wuppertaler Arbeitsstelle vor, der schätzenswerte Angaben zu Adelsbibliotheken enthält, die nur zum Teil in gedruckter Form publiziert wurden.
[3] Dokumentation des Falles Donaueschingen im WWW:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/don.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige subjektive Randnotizen zum neuesten Jahrgang des traditionsreichen Periodikums (kein Peer Review).
Eberhard Dobler, Spätmerowingischer Adel in Südalamannien, S. 1-40
Diesen genealogisch-spekulativen Unfug hätte ich als Herausgeber nicht ins Blatt gelassen. Es darf bezweifelt werden, dass außer bei den unerschütterlichen Fans der "genealogisch-besitzgeschichtlichen Methode"
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=288
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=353
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5781/
diese Spekulationen rezipiert werden.
Christof Rolker, "Eine Behörde - ein Buch"? Studien zu den Konstanzer Gemächtebüchern, S. 41-61
Es geht um die ältesten Konstanzer Bürgertestamente. Ein bislang übersehenes drittes Gemächtebuch führt zur Neubewertung der Entwicklung der Stadtbücher.
Wenn S. 47 Anm. 26 eine Liste in der Monographie von Baur 1989 als in vielen Punkten fehlerhaft bezeichnet wird, bestätigt mich das in meiner Einschätzung:
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=342
Thorsten Huthwelker, Elizabet de Baviere (†1478) - eine Tochter Pfalzgraf Ludwigs III. als Vertraute der heiligen Colette und die geplante Gründung eines Klarissenkonvents in Heidelberg, S. 63-77
Eine Genter Klarissenchronik wirft neues Licht auf die kurpfälzische Kirchengeschichte.
Volkhard Huth, Der ‚Oberrheinische Revolutionär'. Freigelegte Lebensspuren und Wirkungsfelder eines "theokratischen Terroristen" im Umfeld Kaiser Maximilians I., S. 79-100
Glücklicherweise hat Klaus Lauterbach in seiner inzwischen erschienenen Edition der Reformschrift darauf verzichtet, seine bisherige Verfasseridentifizierung Matthias Wurm von Geudertheim zu propagieren. Der neue Kandidat Dr. Jakob Merswin ist sehr viel überzeugender. Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4342526/
http://archiv.twoday.net/stories/6152272/
Meine von Huth wiederholt zitierte Stellungnahme hat leider eine neue Internetadresse (wofür ich nichts kann):
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2002/0028.html
Erik Beck, Andreas Bihrer et al., Altgläubige Bistumshistoriographie in einer evangelischen Stadt. Die Konstanzer Bistumschronik des Beatus Widmer von 1527: Untersuchung und Edition, S. 101-189
Die bisher anonyme Quelle, für die Andreas Bihrer die Verfasserschaft von Beatus Widmer vermutete, wurde von Studierenden Im Rahmen eines Projektseminars bei Birgit Studt in Freiburg ediert, kommentiert und mit einer Einführung versehen.
An der Verfasserschaft des Konstanzer Kuriennotars Widmers (1475-nach 1533) der im GLA 65/11229 überlieferten Bistumschronik kann nach den überzeugenden Ermittlungen kein Zweifel bestehen.
Abweichungen der wenig älteren Version der Bischofsliste und kurzen Konstanzer Stadtgeschichte sind in den Anmerkungen der Edition (S. 152-189) vermerkt. Diese ältere Version ist Teil der von Peter-Johannes Schuler in der Festschrift Tilo Brandis 2000 vorgestellten Chronik Widmers "Cosmographia" (1526), LB Stuttgart HB V 32
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0069_b045_jpg.htm
Dass in der Edition textkritische Anmerkungen und Sachanmerkungen in einem gemeinsamen Apparat geboten werden, ist nicht nur unüblich, sondern auch nicht sinnvoll. Quellennachweise zu den Angaben werden - mit Ausnahme der Hauptquelle für die ältere Zeit, Gallus Öhems Reichenauer Klosterchronik
http://archiv.twoday.net/stories/6106570/
- so gut wie nicht gegeben. Was S. 112-116 zu Quellen und Vorlagen mitgeteilt wird, befriedigt durchaus nicht. Dass "heute unbekannte Quellen" herangezogen wurden, mag im Einzelfall zutreffen, vermittelt aber ein falsches Bild. Es ist sehr mühsam, die Entlehnungen aus Öhem im Apparat nachzuvollziehen.
Zu den Quellen bezüglich des von Bihrer erforschten 14. Jahrhunderts hat man nach wie vor den Fundbericht Rieders, der die Chronik in der ZGO 1905 vorstellte, heranzuziehen (hier: S. 341). Der Quellenabschnitt stammt auch nicht von Bihrer, sondern von T. Gilgert.
Rieder:
http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrdi13langoog#page/n363/mode/2up
E. Beck widmet sich S. 121-137 etwas zu ausführlich den Erwähnungen archäologischer Überreste in der Chronik. Er bereitet dazu eine Dissertation vor. Wenn er S. 133 behauptet, als erster habe Mennel die aus Winterthur nach Konstanz gebrachte römische Inschrift transkribiert, so ist das falsch, da er übersehen hat, dass bereits Ulrich Molitoris in seinem stadtgeschichtlichen Exkurs zu seinem Rechtsgutachten zur Konstanzer Gewerbeordnung (1485) die Inschrift wiedergegeben hatte, ediert von Jörg Mauz, Ulrich Molitoris Schriften, 1997, S. 46.
Zu Matthäus von Pappenheim wird S. 124 der Handschriftenkatalog von Klein angeführt, obwohl Clemens Joos (Freiburg!) in dem 2006 erschienenen Band "Grafen und Herren" ausführlich über Pappenheim gehandelt hatte (inzwischen erschienen 2009 die Monographie von Thomas Schauerte zu Pappenheim und mein parallel erstellter Artikel im Humanismus-Teil des Verfasserlexikons).
Verfehlt erscheint mir die Druckanordnung S. 185ff. mit Paralleldruck. Man braucht einige Zeit, bis einem klar wird, dass die Versionsangabe sich auf die folgende Seite bezieht.
Unglücklich ist die Angaben der Autoren. In Bibliographien und bei Zitaten wird - entgegen der Vorgabe des Inhaltsverzeichnisses (in der lebenden Kolumne heißt es jeweils links treffend "Andreas Bihrer et al.") nur der erste Autor zitiert, nicht aber Bihrer, der als Spiritus rector der Gemeinschaftsarbeit gelten darf und - wenn nicht die alphabetische Anordnung gewählt worden wäre - an erster Stelle zu stehen hätte.
Trotz der vorstehenden Kritik: ein wichtiger Aufsatz bzw. eine wichtige Quellenedition und eine gelungene studentische Gemeinschaftsarbeit auf hohem Niveau!
Kurt Weissen, Die Reformation in Baden-Durlach im Jahre 1556 aus Sicht des Fürstbischofs von Basel, S. 191-202
Liliane Châtelet-Lange, Das emblematische Tagebuch eines sonderbaren Patrioten aus den Jahren 1620 bis 1630, S. 203-222
Zu Straßburg, BNU, Ms 2750.
Christian Greiner, Heiratspolitik und Heiraten der katholischen Markgrafen von Baden im 17. Jahrhundert. Ein Überblick, S. 223-248
Ilas Bartusch, Die Wiederherstellung der markgräflich badischen Grablege in der Stiftskirche der Stadt Baden nach ihrer Zerstörung von 1689, S. 249-300
Baden auf dem Weg in die Moderne 1800-1850
Vorwort, S. 301-303
Rainer Brüning, Karl Friedrich Nebenius (1784-1857) als Vertreter der badischen Reformpolitik, S. 305-314
Udo Wennemuth, Die Religionsgemeinschaften in Baden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen Aufbruch und Beharrung, S. 315-341
Christian Wirtz, Karl von Rotteck als Autor und Politiker, S. 343-356
Niels Grüne, Kommunalistische Rhetorik zwischen sozialer Differenzierung und obrigkeitlichem Zugriff. Dörfliche Politik in einer kurpfälzischen Gemeinde an der Wende zum 19. Jahrhundert, S. 357-385
Es geht um Käfertal (Stadt Mannheim).
Frank Engehausen, Die Anfänge der Sozialdemokraten im badischen Landtag 1891-1904: Zur Vorgeschichte des Großblocks, S. 387-402
Bernd Braun, "Solange man schnaufen kann, muss man kämpfen!" - Zu Krankheit und Tod von Reichskanzler Hermann Müller, S. 403-428
Tobias Seidl, Personelle Säuberungen an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1933-1937, S. 429-492
Mit Kurzbiographien (und einem Abschnitt zu den rechtlichen Grundlagen der NS-Vertreibungen S. 438-446).
Buchbesprechungen, S. 493-654
Boris Bigott und Martin Furtwängler, Das Handbuch der baden-württembergischen Geschichte, Bde. 1/1 - 5, Stuttgart 1992-2007, S. 655-664
Eine unnötige Selbstbeweihräucherung der Kommission.
Inhaltsverzeichnis der Revue d'Alsace 2009, S. 665-666
Bericht der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg für das Jahr 2008, S. 667-670
Eberhard Dobler, Spätmerowingischer Adel in Südalamannien, S. 1-40
Diesen genealogisch-spekulativen Unfug hätte ich als Herausgeber nicht ins Blatt gelassen. Es darf bezweifelt werden, dass außer bei den unerschütterlichen Fans der "genealogisch-besitzgeschichtlichen Methode"
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=288
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=353
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5781/
diese Spekulationen rezipiert werden.
Christof Rolker, "Eine Behörde - ein Buch"? Studien zu den Konstanzer Gemächtebüchern, S. 41-61
Es geht um die ältesten Konstanzer Bürgertestamente. Ein bislang übersehenes drittes Gemächtebuch führt zur Neubewertung der Entwicklung der Stadtbücher.
Wenn S. 47 Anm. 26 eine Liste in der Monographie von Baur 1989 als in vielen Punkten fehlerhaft bezeichnet wird, bestätigt mich das in meiner Einschätzung:
http://naxos.bsz-bw.de/rekla/show.php?mode=source&id=342
Thorsten Huthwelker, Elizabet de Baviere (†1478) - eine Tochter Pfalzgraf Ludwigs III. als Vertraute der heiligen Colette und die geplante Gründung eines Klarissenkonvents in Heidelberg, S. 63-77
Eine Genter Klarissenchronik wirft neues Licht auf die kurpfälzische Kirchengeschichte.
Volkhard Huth, Der ‚Oberrheinische Revolutionär'. Freigelegte Lebensspuren und Wirkungsfelder eines "theokratischen Terroristen" im Umfeld Kaiser Maximilians I., S. 79-100
Glücklicherweise hat Klaus Lauterbach in seiner inzwischen erschienenen Edition der Reformschrift darauf verzichtet, seine bisherige Verfasseridentifizierung Matthias Wurm von Geudertheim zu propagieren. Der neue Kandidat Dr. Jakob Merswin ist sehr viel überzeugender. Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4342526/
http://archiv.twoday.net/stories/6152272/
Meine von Huth wiederholt zitierte Stellungnahme hat leider eine neue Internetadresse (wofür ich nichts kann):
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2002/0028.html
Erik Beck, Andreas Bihrer et al., Altgläubige Bistumshistoriographie in einer evangelischen Stadt. Die Konstanzer Bistumschronik des Beatus Widmer von 1527: Untersuchung und Edition, S. 101-189
Die bisher anonyme Quelle, für die Andreas Bihrer die Verfasserschaft von Beatus Widmer vermutete, wurde von Studierenden Im Rahmen eines Projektseminars bei Birgit Studt in Freiburg ediert, kommentiert und mit einer Einführung versehen.
An der Verfasserschaft des Konstanzer Kuriennotars Widmers (1475-nach 1533) der im GLA 65/11229 überlieferten Bistumschronik kann nach den überzeugenden Ermittlungen kein Zweifel bestehen.
Abweichungen der wenig älteren Version der Bischofsliste und kurzen Konstanzer Stadtgeschichte sind in den Anmerkungen der Edition (S. 152-189) vermerkt. Diese ältere Version ist Teil der von Peter-Johannes Schuler in der Festschrift Tilo Brandis 2000 vorgestellten Chronik Widmers "Cosmographia" (1526), LB Stuttgart HB V 32
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0069_b045_jpg.htm
Dass in der Edition textkritische Anmerkungen und Sachanmerkungen in einem gemeinsamen Apparat geboten werden, ist nicht nur unüblich, sondern auch nicht sinnvoll. Quellennachweise zu den Angaben werden - mit Ausnahme der Hauptquelle für die ältere Zeit, Gallus Öhems Reichenauer Klosterchronik
http://archiv.twoday.net/stories/6106570/
- so gut wie nicht gegeben. Was S. 112-116 zu Quellen und Vorlagen mitgeteilt wird, befriedigt durchaus nicht. Dass "heute unbekannte Quellen" herangezogen wurden, mag im Einzelfall zutreffen, vermittelt aber ein falsches Bild. Es ist sehr mühsam, die Entlehnungen aus Öhem im Apparat nachzuvollziehen.
Zu den Quellen bezüglich des von Bihrer erforschten 14. Jahrhunderts hat man nach wie vor den Fundbericht Rieders, der die Chronik in der ZGO 1905 vorstellte, heranzuziehen (hier: S. 341). Der Quellenabschnitt stammt auch nicht von Bihrer, sondern von T. Gilgert.
Rieder:
http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrdi13langoog#page/n363/mode/2up
E. Beck widmet sich S. 121-137 etwas zu ausführlich den Erwähnungen archäologischer Überreste in der Chronik. Er bereitet dazu eine Dissertation vor. Wenn er S. 133 behauptet, als erster habe Mennel die aus Winterthur nach Konstanz gebrachte römische Inschrift transkribiert, so ist das falsch, da er übersehen hat, dass bereits Ulrich Molitoris in seinem stadtgeschichtlichen Exkurs zu seinem Rechtsgutachten zur Konstanzer Gewerbeordnung (1485) die Inschrift wiedergegeben hatte, ediert von Jörg Mauz, Ulrich Molitoris Schriften, 1997, S. 46.
Zu Matthäus von Pappenheim wird S. 124 der Handschriftenkatalog von Klein angeführt, obwohl Clemens Joos (Freiburg!) in dem 2006 erschienenen Band "Grafen und Herren" ausführlich über Pappenheim gehandelt hatte (inzwischen erschienen 2009 die Monographie von Thomas Schauerte zu Pappenheim und mein parallel erstellter Artikel im Humanismus-Teil des Verfasserlexikons).
Verfehlt erscheint mir die Druckanordnung S. 185ff. mit Paralleldruck. Man braucht einige Zeit, bis einem klar wird, dass die Versionsangabe sich auf die folgende Seite bezieht.
Unglücklich ist die Angaben der Autoren. In Bibliographien und bei Zitaten wird - entgegen der Vorgabe des Inhaltsverzeichnisses (in der lebenden Kolumne heißt es jeweils links treffend "Andreas Bihrer et al.") nur der erste Autor zitiert, nicht aber Bihrer, der als Spiritus rector der Gemeinschaftsarbeit gelten darf und - wenn nicht die alphabetische Anordnung gewählt worden wäre - an erster Stelle zu stehen hätte.
Trotz der vorstehenden Kritik: ein wichtiger Aufsatz bzw. eine wichtige Quellenedition und eine gelungene studentische Gemeinschaftsarbeit auf hohem Niveau!
Kurt Weissen, Die Reformation in Baden-Durlach im Jahre 1556 aus Sicht des Fürstbischofs von Basel, S. 191-202
Liliane Châtelet-Lange, Das emblematische Tagebuch eines sonderbaren Patrioten aus den Jahren 1620 bis 1630, S. 203-222
Zu Straßburg, BNU, Ms 2750.
Christian Greiner, Heiratspolitik und Heiraten der katholischen Markgrafen von Baden im 17. Jahrhundert. Ein Überblick, S. 223-248
Ilas Bartusch, Die Wiederherstellung der markgräflich badischen Grablege in der Stiftskirche der Stadt Baden nach ihrer Zerstörung von 1689, S. 249-300
Baden auf dem Weg in die Moderne 1800-1850
Vorwort, S. 301-303
Rainer Brüning, Karl Friedrich Nebenius (1784-1857) als Vertreter der badischen Reformpolitik, S. 305-314
Udo Wennemuth, Die Religionsgemeinschaften in Baden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen Aufbruch und Beharrung, S. 315-341
Christian Wirtz, Karl von Rotteck als Autor und Politiker, S. 343-356
Niels Grüne, Kommunalistische Rhetorik zwischen sozialer Differenzierung und obrigkeitlichem Zugriff. Dörfliche Politik in einer kurpfälzischen Gemeinde an der Wende zum 19. Jahrhundert, S. 357-385
Es geht um Käfertal (Stadt Mannheim).
Frank Engehausen, Die Anfänge der Sozialdemokraten im badischen Landtag 1891-1904: Zur Vorgeschichte des Großblocks, S. 387-402
Bernd Braun, "Solange man schnaufen kann, muss man kämpfen!" - Zu Krankheit und Tod von Reichskanzler Hermann Müller, S. 403-428
Tobias Seidl, Personelle Säuberungen an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1933-1937, S. 429-492
Mit Kurzbiographien (und einem Abschnitt zu den rechtlichen Grundlagen der NS-Vertreibungen S. 438-446).
Buchbesprechungen, S. 493-654
Boris Bigott und Martin Furtwängler, Das Handbuch der baden-württembergischen Geschichte, Bde. 1/1 - 5, Stuttgart 1992-2007, S. 655-664
Eine unnötige Selbstbeweihräucherung der Kommission.
Inhaltsverzeichnis der Revue d'Alsace 2009, S. 665-666
Bericht der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg für das Jahr 2008, S. 667-670
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 18:01 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Leicht ungehalten kommentiert Hendrik Wieduwilt die anschwellende Anti-Google-Hysterie
http://hendrikwieduwilt.de/?p=244
Zu StreetView:
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
http://hendrikwieduwilt.de/?p=244
Zu StreetView:
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 14:04 - Rubrik: Datenschutz
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039917/images/
Weyer-Übersetzung von Rebenstock 1586.
Wie nicht selten mit Lesefehlern in den Metadaten am Kopf der Seite. Natürlich kein Direktlink zum VD 16, der hat ja meines Wissens auch keine permanenten oder verlinkbaren Adressen.

Weyer-Übersetzung von Rebenstock 1586.
Wie nicht selten mit Lesefehlern in den Metadaten am Kopf der Seite. Natürlich kein Direktlink zum VD 16, der hat ja meines Wissens auch keine permanenten oder verlinkbaren Adressen.

KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 13:53 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mitglieder des Bielefelder Bardenbundes (1861). Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,1/Westermann-Sammlung, Bd. 21
Bernd J. Wagner: 20. Februar 1860: Maskenfest und Maskenball am Rosenmontag in Bielefeld
Link zum Text
Der "Historische RückKlick" startete am 15.1.2007 und hat seitdem seine Community gefunden: 2007 wurden 10.000 Aufrufe verzeichnet , 2008 bereits 70.000 und 2009 etwa 80.000, wie Kollege Dr. Rath mitteilte.
Ältere Artikel sind unter http://www.bielefeld.de/de/biju/stadtar/rc/rar/ gelistet und weiterhin abrufbar.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 08:53 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.handschriftencensus.de/21580
Digitalisat:
http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/getSETS.asp?ITEM=2013992
Digitalisat:
http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/getSETS.asp?ITEM=2013992
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Februar 2010, 02:38 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen