KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:53 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Für Einträge rund um die Hochschulen und die Wissenschaft, die eher nicht so gut zu "Universitätsarchive" oder "Open Access" passen, gibt es nun eine neue Kategorie.
Zu Kategorien in Archivalia sei nochmals an die Festlegungen in:
http://archiv.twoday.net/stories/1821974/
erinnert.
Immer wieder muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich Allgemeines auf Archivalia bezieht, nicht auf allgemeine Archivthemen. Was nicht in eine andere Schublade passt, kommt in MISCELLANEA.
Zu Kategorien in Archivalia sei nochmals an die Festlegungen in:
http://archiv.twoday.net/stories/1821974/
erinnert.
Immer wieder muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich Allgemeines auf Archivalia bezieht, nicht auf allgemeine Archivthemen. Was nicht in eine andere Schublade passt, kommt in MISCELLANEA.
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:34 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:33 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2010/04/housekeeping.html
Das Archiv wird bestehen bleiben. OATP ist pluralistischer als Suber es war, aber kein Ersatz für Subers brillant abwägende Kommentare, die gerade bei den "hot stories" wichtig waren. Dass Suber auf das veraltete Mittel des per Mail verteilten monatlichen Newsletters für längere Reflexionen über aktuelle Entwicklungen setzt, erscheint mir nicht die beste Entscheidung zu sein. Dass es unmöglich war, den Neuigkeiten-Output zu Open Access selbst mit einem Assistenten zu bewältigen - zugegeben. Aber muss man deshalb auf wertende Kommentare zu zentralen Entwicklungen verzichten? Es wäre wichtig gewesen, weiter ein besonnenes Gegengewicht zu den sektiererischen Positionen Harnads zu haben, der mit seinem dogmatischen Geschrei den Bereich "Meinung" im Bereich Open Access dominieren kann.
Das Archiv wird bestehen bleiben. OATP ist pluralistischer als Suber es war, aber kein Ersatz für Subers brillant abwägende Kommentare, die gerade bei den "hot stories" wichtig waren. Dass Suber auf das veraltete Mittel des per Mail verteilten monatlichen Newsletters für längere Reflexionen über aktuelle Entwicklungen setzt, erscheint mir nicht die beste Entscheidung zu sein. Dass es unmöglich war, den Neuigkeiten-Output zu Open Access selbst mit einem Assistenten zu bewältigen - zugegeben. Aber muss man deshalb auf wertende Kommentare zu zentralen Entwicklungen verzichten? Es wäre wichtig gewesen, weiter ein besonnenes Gegengewicht zu den sektiererischen Positionen Harnads zu haben, der mit seinem dogmatischen Geschrei den Bereich "Meinung" im Bereich Open Access dominieren kann.
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:07 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ieb.usp.br/online/index.asp (Internet-Explorer ist empfehlenswert)
Beispiel eines englischen Werks über Guinea
http://143.107.31.150/bibliotecaPdf/Lt-1080_Original_WEB.pdf
Beispiel eines englischen Werks über Guinea
http://143.107.31.150/bibliotecaPdf/Lt-1080_Original_WEB.pdf
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 23:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 22:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Viele ältere Jahrgänge sind digital bei ALO verfügbar:
http://www.literature.at/collection.alo?objid=1015038&orderby=author&sortorder=a
http://www.literature.at/collection.alo?objid=1015038&orderby=author&sortorder=a
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 22:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://webapp6.rrz.uni-hamburg.de/GLOGEMIS/
Es sollte inzwischen Standard sein, dass man Abkürzungen von Quellenausgaben entweder gar nicht in den Artikel aufnimmt oder automatisch zur vollständigen Titelausgabe verlinkt.
Es fehlen Links zu Digitalisaten (viele der Quellenausgaben liegen online vor) und zu anderen Wörterbüchern, die das Lemma enthalten. Die Vernetzung ist also völlig unzureichend.
Es sollte inzwischen Standard sein, dass man Abkürzungen von Quellenausgaben entweder gar nicht in den Artikel aufnimmt oder automatisch zur vollständigen Titelausgabe verlinkt.
Es fehlen Links zu Digitalisaten (viele der Quellenausgaben liegen online vor) und zu anderen Wörterbüchern, die das Lemma enthalten. Die Vernetzung ist also völlig unzureichend.
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 22:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,692264,00.html
Eine Journalistin hat einen wichtigen Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht errungen: Die Richter in Leipzig haben die Weigerung des Kanzleramts zur Herausgabe von Akten über den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann für rechtswidrig erklärt. Die geltend gemachten Geheimhaltungsgründe seien nur teilweise berechtigt und erlaubten zudem keine vollständige Zurückhaltung, entschied der zuständige Fachsenat des Gerichts.
Siehe auch
http://www.gabyweber.com/prozesse_bnd.php
Pressemitteilung des BVerwG zu BVerwG 20 F 13.09
Eine Journalistin hat einen wichtigen Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht errungen: Die Richter in Leipzig haben die Weigerung des Kanzleramts zur Herausgabe von Akten über den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann für rechtswidrig erklärt. Die geltend gemachten Geheimhaltungsgründe seien nur teilweise berechtigt und erlaubten zudem keine vollständige Zurückhaltung, entschied der zuständige Fachsenat des Gerichts.
Siehe auch
http://www.gabyweber.com/prozesse_bnd.php
Pressemitteilung des BVerwG zu BVerwG 20 F 13.09
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 21:59 - Rubrik: Staatsarchive
"Der neue Lehrplan für saarländische Gymnasien sieht vor, dass der Geschichtsunterricht in Klasse zehn zukünftig von den Schülern abgewählt werden kann. Ist Geschichtsunterricht wirklich verzichtbar?
Der Saarländische Philologenverband übt heftige Kritik an den Plänen des saarländischen Bildungsministeriums. Der Verband sprach von einem "bundesweit einmaligen Beispiel für Geschichtsvergessenheit". Angesichts ständiger Querelen um den Lehrplan fordern Gymnasiallehrer, dass der vorläufige Plan zurück genommen und mehr Zeit zur Erarbeitung eines neuen Konzepts investiert wird. Die Wahlfreiheit für die Zehntklässler könne dazu führen, dass saarländische Abiturienten in Zukunft in der Schule nichts mehr über den Holocaust, die Diktaturen in Deutschland oder über die deutsch-französische Aussöhnung lernen, kritisiert der bildungspolitische Sprecher des Philologenverbandes Marcus Hahn."
Quelle: 3sat. Kulturzeit-Nachrichten
Sollte man den saarländischen Philologen nicht als VdA zur Seite springen? Immerhin hat der VdA einen Arbeitskreis Archivpädagogik.
Der Saarländische Philologenverband übt heftige Kritik an den Plänen des saarländischen Bildungsministeriums. Der Verband sprach von einem "bundesweit einmaligen Beispiel für Geschichtsvergessenheit". Angesichts ständiger Querelen um den Lehrplan fordern Gymnasiallehrer, dass der vorläufige Plan zurück genommen und mehr Zeit zur Erarbeitung eines neuen Konzepts investiert wird. Die Wahlfreiheit für die Zehntklässler könne dazu führen, dass saarländische Abiturienten in Zukunft in der Schule nichts mehr über den Holocaust, die Diktaturen in Deutschland oder über die deutsch-französische Aussöhnung lernen, kritisiert der bildungspolitische Sprecher des Philologenverbandes Marcus Hahn."
Quelle: 3sat. Kulturzeit-Nachrichten
Sollte man den saarländischen Philologen nicht als VdA zur Seite springen? Immerhin hat der VdA einen Arbeitskreis Archivpädagogik.
Wolf Thomas - am Freitag, 30. April 2010, 10:58 - Rubrik: Archivpaedagogik

Anlässlich der Frühlingsevents der Nürnberger Kultureinrichtungen veranstaltet das Stadtarchiv ein kleine Weinreise durch die Geschichte. Der Bibliothekar des Archivs, Walter Gebhardt, stellt sowohl weine aus historische Reborten als auch Aspekte Nürnberger Stadtgeschichte mit Wein-Bezug vor.
Link zur Verantstaltungsbroschüre (PDF)
Wolf Thomas - am Freitag, 30. April 2010, 09:21 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 30. April 2010, 03:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bewertungsfragen sind auch in diesem Weblog alles andere als populär. Man kann ziemlich rasch die einschlägigen Beiträge unter
http://archiv.twoday.net/topics/Bewertung/
sichten.
Die politische Debatte über die Kassation der Stasi-Akten, die von der Birthler-Behörde mit archivischen Gepflogenheiten begründet wird
http://archiv.twoday.net/stories/6315338/
zeigt für mich, dass wir entschieden weg müssen von den archivischen Dogmata, die den gesellschaftlichen Diskurs über Kassationen kleinzuhalten bestrebt sind.
Dass Archivare im Lauf der Archivgeschichte gravierende Fehlentscheidungen, die ihrer Natur nach irreversibel sind, gefällt haben, steht außer Zweifel. Mit der die Öffentlichkeit für dumm verkaufenden Binsenweisheit, dass das Hauptgeschäft bei der Aktenübernahme nun einmal das Kassieren ist, lässt sich noch die abstruseste Vernichtung wertvoller Unterlagen begründen.
Aber solange Historiker und die kritische Öffentlichkeit sich nicht an der fachlichen Bewertungsdebatte beteiligen, wird es immer nur ein Strohfeuer geben.
Ich plädiere ganz bewusst für die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen im Bereich der Überlieferungsbildung:
http://archiv.twoday.net/stories/2699909/
Zitat: "Archivare sind, wenn sie bewerten, nicht unfehlbar. Eine Kontrolle ihrer Entscheidungen durch Wissenschaft, Öffentlichkeit und - notfalls - auch durch die Gerichte ist nicht nur sinnvoll, sondern auch geboten!"
 Andrew Huff http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
Andrew Huff http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
http://archiv.twoday.net/topics/Bewertung/
sichten.
Die politische Debatte über die Kassation der Stasi-Akten, die von der Birthler-Behörde mit archivischen Gepflogenheiten begründet wird
http://archiv.twoday.net/stories/6315338/
zeigt für mich, dass wir entschieden weg müssen von den archivischen Dogmata, die den gesellschaftlichen Diskurs über Kassationen kleinzuhalten bestrebt sind.
Dass Archivare im Lauf der Archivgeschichte gravierende Fehlentscheidungen, die ihrer Natur nach irreversibel sind, gefällt haben, steht außer Zweifel. Mit der die Öffentlichkeit für dumm verkaufenden Binsenweisheit, dass das Hauptgeschäft bei der Aktenübernahme nun einmal das Kassieren ist, lässt sich noch die abstruseste Vernichtung wertvoller Unterlagen begründen.
Aber solange Historiker und die kritische Öffentlichkeit sich nicht an der fachlichen Bewertungsdebatte beteiligen, wird es immer nur ein Strohfeuer geben.
Ich plädiere ganz bewusst für die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen im Bereich der Überlieferungsbildung:
http://archiv.twoday.net/stories/2699909/
Zitat: "Archivare sind, wenn sie bewerten, nicht unfehlbar. Eine Kontrolle ihrer Entscheidungen durch Wissenschaft, Öffentlichkeit und - notfalls - auch durch die Gerichte ist nicht nur sinnvoll, sondern auch geboten!"
 Andrew Huff http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
Andrew Huff http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en"In der Birthler-Behörde sollen bis zu sechs Regalkilometer Akten durch den Reißwolf vernichtet worden sein. Experten für die Stasi-Aktivitäten sowie FDP-Politier kritisieren das Vorgehen und fordern ein Ende der Aktenvernichtung. Die mögliche Relevanz des vernichteten Materials sei nicht geklärt.
Hintergrund ist ein Bericht der Wochenzeitung "Jungle World", wonach die Stasiunterlagen-Behörde geschätzt etwa 20 Millionen Blatt entsorgt habe. Die Hälfte der Unterlagen wurde seit 2005 ausgesondert, heißt es in der Behörde. Ein Sprecher der Behörde verteidigte das Vorgehen: "Wenn die Archivare unterschiedslos alles, was sie in den Bündeln finden, erschließen, würden Arbeitszeit und Steuermittel sinnlos vergeudet." Nach Angaben von Insidern werden auch Papiere vernichtet, die möglicherweise Bedeutung für zukünftige Forschungen haben. So sind zahlreiche Postbücher ausgesondert worden, die den Stasi-internen Schriftverkehr, aber auch Kontakte mit anderen DDR-Behörden dokumentieren.
Rainer Deutschmann, Berichterstatter der FDP-Bundestagsfraktion für die Stasi-Akten, forderte deshalb, bis zur Klärung offener Fragen "vom Schreddern weiterer Akten abzusehen". Auch Hubertus Knabe, Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, kritisiert das Vorgehen der Behörde: "Es kann nicht sein, dass hinter den Kulissen Unterlagen vernichtet werden, die Bürgerrechtler vor zwanzig Jahren vor der Vernichtung gerettet haben. Dazu ist die Behörde nicht befugt." Auf Nachfragen hat die Birthler-Behörde bisher oft mit Verweis auf die Zulässigkeit von Aktenvernichtung in anderen Archiven verwiesen.
Nach beinahe 20 Jahren sind bei der Stasiunterlagen-Behörde erst vier Fünftel des erhaltenen Materials überhaupt erschlossen, mehr als die Hälfte davon ausschließlich durch Karteien, die noch die Stasi selbst angefertigt hatte. Hinzu kommt der Inhalt von rund 15.500 Säcken, in denen sich Überreste von Unterlagen befinden, die die Stasi im Frühjahr 1990 selbst "vorvernichtete". Über den Gehalt dieser Dokumentenreste besteht derzeit völlige Unkenntnis."
Quelle: 3sat Kulturzeitnachrichten, 29.04.2010
Link zum erwähnten Artikel der Jungle World
Hintergrund ist ein Bericht der Wochenzeitung "Jungle World", wonach die Stasiunterlagen-Behörde geschätzt etwa 20 Millionen Blatt entsorgt habe. Die Hälfte der Unterlagen wurde seit 2005 ausgesondert, heißt es in der Behörde. Ein Sprecher der Behörde verteidigte das Vorgehen: "Wenn die Archivare unterschiedslos alles, was sie in den Bündeln finden, erschließen, würden Arbeitszeit und Steuermittel sinnlos vergeudet." Nach Angaben von Insidern werden auch Papiere vernichtet, die möglicherweise Bedeutung für zukünftige Forschungen haben. So sind zahlreiche Postbücher ausgesondert worden, die den Stasi-internen Schriftverkehr, aber auch Kontakte mit anderen DDR-Behörden dokumentieren.
Rainer Deutschmann, Berichterstatter der FDP-Bundestagsfraktion für die Stasi-Akten, forderte deshalb, bis zur Klärung offener Fragen "vom Schreddern weiterer Akten abzusehen". Auch Hubertus Knabe, Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, kritisiert das Vorgehen der Behörde: "Es kann nicht sein, dass hinter den Kulissen Unterlagen vernichtet werden, die Bürgerrechtler vor zwanzig Jahren vor der Vernichtung gerettet haben. Dazu ist die Behörde nicht befugt." Auf Nachfragen hat die Birthler-Behörde bisher oft mit Verweis auf die Zulässigkeit von Aktenvernichtung in anderen Archiven verwiesen.
Nach beinahe 20 Jahren sind bei der Stasiunterlagen-Behörde erst vier Fünftel des erhaltenen Materials überhaupt erschlossen, mehr als die Hälfte davon ausschließlich durch Karteien, die noch die Stasi selbst angefertigt hatte. Hinzu kommt der Inhalt von rund 15.500 Säcken, in denen sich Überreste von Unterlagen befinden, die die Stasi im Frühjahr 1990 selbst "vorvernichtete". Über den Gehalt dieser Dokumentenreste besteht derzeit völlige Unkenntnis."
Quelle: 3sat Kulturzeitnachrichten, 29.04.2010
Link zum erwähnten Artikel der Jungle World
Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 21:39 - Rubrik: Bewertung
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 21:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 21:14 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jason Baron, Director of Litigation from the US National Archives and Records Administration, kindly accepted the request to speak about e-discovery. During the interview, Jason shared his views and experience about the balance between what to keep and legal compliance, risk management and change management, and the role of the Archivist of the future.
Link
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5713468/
Link
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5713468/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 21:08 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die bei Ausgrabungen am Greifswalder Markt entdeckten Silbermünzen sind nach Ansicht von Fachleuten einer der außergewöhnlichsten Funde in Mecklenburg-Vorpommerns jüngerer Vergangenheit. Die 1.958 Geldstücke aus dem 14. Jahrhundert seien der größte mittelalterliche Münzschatz, der in den vergangenen 20 Jahren im Nordosten entdeckt worden sei, sagte Grabungsleiter Peter Kaute am Donnerstag in Greifswald. Die aus Hinterpommern stammenden Silbermünzen waren in einem Latrinenschacht gefunden worden. Wie sie dorthin gelangten, ist den Archäologen noch ein Rätsel. Im selben Schacht lagen auch zwei Siegelstempel früherer Ratsherren der Hansestadt.
Die Münzen - sogenannte Finkenaugen - haben ein Gesamtgewicht von einem halben Kilogramm. Als kleinere Währungseinheit sind sie den Wissenschaftlern zufolge in der Region um Wolgast, Greifswald und Stralsund unüblich gewesen. Hier wurde im 14. Jahrhundert mit sogenannten Hohlaugen bezahlt. Die Silbermünzen befanden sich nicht ein einem Tongefäß oder Lederbeutel, sondern waren auf einen größeren Raum verteilt. "Wir gehen davon aus, dass sie unbeabsichtigt fallen gelassen wurden", sagte Kaute. Der Gesamtwert der Münzen entspreche dem damaligen Monatslohn eines gut bezahlten Handwerksmeisters.
Der Latrinenschacht, in dem der Münzschatz lag, wurde an der Markt-Südseite freigelegt. Dort hatten früher die Wohlhabenden ihre Häuser. Dank der von den Archäologen in dem Schacht auch entdeckten Siegelstempel der beiden Ratsherren Arnold und Ludolph Lange (Amtszeit 1353 bis 1360) lasse sich der Schacht nicht nur zeitlich ein-, sondern auch Personen zuordnen. Mit den nach ihrer Amtszeit traditionell im Schacht versenkten Messingstempeln, die zuvor für Rechtsgeschäfte genutzt wurden, hinterließen sie in den Toilettenschächten quasi ihre Visitenkarten.
Seit November 2009 untersuchten die Archäologen sieben Latrinen und einen mittelalterlichen Brunnen. Neben Geld fanden sie eine Holzlaterne aus dem 14. Jahrhundert. Eine ähnliche, aber weitaus schlechter erhaltene Laterne ist laut den Wissenschaftlern bisher nur in Lübeck entdeckt worden. Zudem stießen sie in den Schächten auf Ton- und Holzgeschirr.
Die Funde werden jetzt im Landesamt für Denkmalpflege wissenschaftlich untersucht. Nach Abschluss der Grabungen beginnen an der Greifswalder Markt-Südseite die Bauarbeiten für das Stadthaus, ein Erweiterungsbau des Rathauses."
Quelle: NDR Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern
#numismatik
Die Münzen - sogenannte Finkenaugen - haben ein Gesamtgewicht von einem halben Kilogramm. Als kleinere Währungseinheit sind sie den Wissenschaftlern zufolge in der Region um Wolgast, Greifswald und Stralsund unüblich gewesen. Hier wurde im 14. Jahrhundert mit sogenannten Hohlaugen bezahlt. Die Silbermünzen befanden sich nicht ein einem Tongefäß oder Lederbeutel, sondern waren auf einen größeren Raum verteilt. "Wir gehen davon aus, dass sie unbeabsichtigt fallen gelassen wurden", sagte Kaute. Der Gesamtwert der Münzen entspreche dem damaligen Monatslohn eines gut bezahlten Handwerksmeisters.
Der Latrinenschacht, in dem der Münzschatz lag, wurde an der Markt-Südseite freigelegt. Dort hatten früher die Wohlhabenden ihre Häuser. Dank der von den Archäologen in dem Schacht auch entdeckten Siegelstempel der beiden Ratsherren Arnold und Ludolph Lange (Amtszeit 1353 bis 1360) lasse sich der Schacht nicht nur zeitlich ein-, sondern auch Personen zuordnen. Mit den nach ihrer Amtszeit traditionell im Schacht versenkten Messingstempeln, die zuvor für Rechtsgeschäfte genutzt wurden, hinterließen sie in den Toilettenschächten quasi ihre Visitenkarten.
Seit November 2009 untersuchten die Archäologen sieben Latrinen und einen mittelalterlichen Brunnen. Neben Geld fanden sie eine Holzlaterne aus dem 14. Jahrhundert. Eine ähnliche, aber weitaus schlechter erhaltene Laterne ist laut den Wissenschaftlern bisher nur in Lübeck entdeckt worden. Zudem stießen sie in den Schächten auf Ton- und Holzgeschirr.
Die Funde werden jetzt im Landesamt für Denkmalpflege wissenschaftlich untersucht. Nach Abschluss der Grabungen beginnen an der Greifswalder Markt-Südseite die Bauarbeiten für das Stadthaus, ein Erweiterungsbau des Rathauses."
Quelle: NDR Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern
#numismatik
Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 20:41 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Entwurf des Haushaltsicherungskonzept des Stadtkämmerers (Link zur PDF):
" .....Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung der Entgelte für die Nutzung des Archivs
Erläuterungen:
Das Ermöglichen der Benutzung des Stadtarchivs durch den Bürger ist eine freiwillige Leistung der Stadt. Zur Zeit wird eine Tagesgebühr von 3 € für die Nutzung erhoben. Die Gebühr könnte auf einen
Betrag von 5 € erhöht werden. Auch bei einem Rückgang der Besucherzahl von rund 800 Personen sollten dennoch Mehreinnahmen in Höhe von 1.000 € möglich sein. .....
Bezeichnung der Maßnahme:
Digitalisierung des Verwaltungsarchivs
Erläuterungen:
Eine Arbeitsgruppe zur Einführung eines Dokumenten-Management-Systems ist in der Stadtverwaltung bereits eingerichtet. Das Stadtarchiv sollte hier beteiligt werden. Ob eine elektronische
Vorhaltung von Akten einen geringeren Zeit-/Personalaufwand verursacht bleibt noch zu klären. Mit Sicherheit können jedoch Raumkosten eingespart werden. ...."
" .....Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung der Entgelte für die Nutzung des Archivs
Erläuterungen:
Das Ermöglichen der Benutzung des Stadtarchivs durch den Bürger ist eine freiwillige Leistung der Stadt. Zur Zeit wird eine Tagesgebühr von 3 € für die Nutzung erhoben. Die Gebühr könnte auf einen
Betrag von 5 € erhöht werden. Auch bei einem Rückgang der Besucherzahl von rund 800 Personen sollten dennoch Mehreinnahmen in Höhe von 1.000 € möglich sein. .....
Bezeichnung der Maßnahme:
Digitalisierung des Verwaltungsarchivs
Erläuterungen:
Eine Arbeitsgruppe zur Einführung eines Dokumenten-Management-Systems ist in der Stadtverwaltung bereits eingerichtet. Das Stadtarchiv sollte hier beteiligt werden. Ob eine elektronische
Vorhaltung von Akten einen geringeren Zeit-/Personalaufwand verursacht bleibt noch zu klären. Mit Sicherheit können jedoch Raumkosten eingespart werden. ...."
Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 20:31 - Rubrik: Kommunalarchive
Für digitale Sammlungen von Archiven, Bibliotheken, Museen usw. und virtuelle Ausstellungen sind die folgenden Grundregeln gedacht, die ich zur Diskussion stelle.
1. NICHT AN DER AUFLÖSUNG SPAREN! Jede Bildseite muss in hoher Auflösung vorliegen, denn nur diese garantiert die wissenschaftliche Nutzbarkeit.
2. PERMANENT-LINKS! Jede einzelne Bildseite muss mit einem deutlich angebrachten KURZEN dauerhaften Link versehen werden.
3. META-DATEN ZU JEDEM DIGITALEN OBJEKT! Zu jedem digitalen Objekt (auch zu separat nutzbaren Einzelseiten wie Druckgrafik, Zeichnungen) muss es entsprechende Metadaten geben, die professionellen Ansprüchen genügen müssen.
4. OAI-PMH NUTZEN! Alle Meta-Daten müssen für OAI-Harvester zur Verfügung stehen.
5. KEIN COPYFRAUD! Die Rechtslage ist in den Metadaten möglichst objektiv und auf jeden Fall ohne Copyfraud zu beschreiben. Was gemeinfrei ist, muss auch als Digitalisat gemeinfrei bleiben! Wenn das Projekt über Urheberrechte verfügt, ist eine Nachnutzbarkeit über eine möglichst liberale CC-Lizenz vorzusehen.
6. WEB 2.0! Nutzer sollten die Möglichkeit haben, Ergänzungen und Korrekturen anzubringen (Tags, Transkriptionen usw.)
7. LANGZEITARCHIVIERUNG! Die dauerhafte öffentliche Verfügbarkeit ist ggf. durch Kooperation mit Bibliotheken sicherzustellen.
Diskussion gern in den Kommentaren!
Hinweis: das sind Grundregeln, die spezifisch für digitale Sammlungen gelten sollten. Allgemeine Grundsätze wie einfache Nutzbarkeit (geräte- und browserunabhängig, keine exotischen Plugins, Barrierefreiheit usw.) wurden bewusst ausgeklammert, da diese für alle Internetseiten gelten sollten.
1. NICHT AN DER AUFLÖSUNG SPAREN! Jede Bildseite muss in hoher Auflösung vorliegen, denn nur diese garantiert die wissenschaftliche Nutzbarkeit.
2. PERMANENT-LINKS! Jede einzelne Bildseite muss mit einem deutlich angebrachten KURZEN dauerhaften Link versehen werden.
3. META-DATEN ZU JEDEM DIGITALEN OBJEKT! Zu jedem digitalen Objekt (auch zu separat nutzbaren Einzelseiten wie Druckgrafik, Zeichnungen) muss es entsprechende Metadaten geben, die professionellen Ansprüchen genügen müssen.
4. OAI-PMH NUTZEN! Alle Meta-Daten müssen für OAI-Harvester zur Verfügung stehen.
5. KEIN COPYFRAUD! Die Rechtslage ist in den Metadaten möglichst objektiv und auf jeden Fall ohne Copyfraud zu beschreiben. Was gemeinfrei ist, muss auch als Digitalisat gemeinfrei bleiben! Wenn das Projekt über Urheberrechte verfügt, ist eine Nachnutzbarkeit über eine möglichst liberale CC-Lizenz vorzusehen.
6. WEB 2.0! Nutzer sollten die Möglichkeit haben, Ergänzungen und Korrekturen anzubringen (Tags, Transkriptionen usw.)
7. LANGZEITARCHIVIERUNG! Die dauerhafte öffentliche Verfügbarkeit ist ggf. durch Kooperation mit Bibliotheken sicherzustellen.
Diskussion gern in den Kommentaren!
Hinweis: das sind Grundregeln, die spezifisch für digitale Sammlungen gelten sollten. Allgemeine Grundsätze wie einfache Nutzbarkeit (geräte- und browserunabhängig, keine exotischen Plugins, Barrierefreiheit usw.) wurden bewusst ausgeklammert, da diese für alle Internetseiten gelten sollten.
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 19:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 19:49 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitalhumanitiesnow.org/
"Digital Humanities Now is a real-time, crowdsourced publication. It takes the pulse of the digital humanities community and tries to discern what articles, blog posts, projects, tools, collections, and announcements are worthy of greater attention."
"Digital Humanities Now is a real-time, crowdsourced publication. It takes the pulse of the digital humanities community and tries to discern what articles, blog posts, projects, tools, collections, and announcements are worthy of greater attention."
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 19:41 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 19:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.flickr.com/photos/rotterdam_municipal_archives/sets/72157623949132260/
Via
http://www.digitalearchivaris.nl/2010/04/oorlogsdagboeken-online.html

Via
http://www.digitalearchivaris.nl/2010/04/oorlogsdagboeken-online.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 19:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Schlosskapelle Liebig in Kobern-Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz) ist ein schmuckes Kulturdenkmal. Seit 1892 trotzt die Kapelle Kriegen, Stürmen und dem Zahn der Zeit. Doch ihr heutiger Eigentümer hat für den neugotischen Bau nichts übrig. Er will die Kapelle abreißen. Aber Koblenzer Richter versagten ihm die Genehmigung. Und zwar zu Recht. Das entschied jetzt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Verfassgungsgericht-Eigentuemer-darf-Schlosskapelle-nicht-abreissen-_arid,81867.html
Volltext:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20100414_1bvr214008.html
Das Gericht wird vergleichsweise deutlich, wenn es dem Trick von Denkmaleigentümern, unrentable Teile "herauszuschneiden", einen Riegel vorschiebt:
"Die in Art. 14 Abs. 1 GG garantierte Privatnützigkeit des Eigentums gewährleistet mithin nicht, dass der Grundstücksertrag der Eigentümer einer denkmalgeschützten Gesamtanlage, deren Erhalt für sich genommen wirtschaftlich zumutbar ist, dadurch gesteigert wird, dass einzelne, wirtschaftlich unrentable Teile mit Denkmalbestand eigentumsrechtlich aus einem solchen Ensemble „herausgeschnitten“ werden und dadurch der Erhalt dieser Denkmäler infrage gestellt oder dessen Kosten letztlich der Allgemeinheit auferlegt werden."
 Schloss Liebig 2005 von mir fotografiert, die Schlosskapelle war auch auf einem meiner Bilder, aber damals lud ich diese nur in sehr kleiner Auswahl in die Wikipedia hoch
Schloss Liebig 2005 von mir fotografiert, die Schlosskapelle war auch auf einem meiner Bilder, aber damals lud ich diese nur in sehr kleiner Auswahl in die Wikipedia hoch
http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Verfassgungsgericht-Eigentuemer-darf-Schlosskapelle-nicht-abreissen-_arid,81867.html
Volltext:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20100414_1bvr214008.html
Das Gericht wird vergleichsweise deutlich, wenn es dem Trick von Denkmaleigentümern, unrentable Teile "herauszuschneiden", einen Riegel vorschiebt:
"Die in Art. 14 Abs. 1 GG garantierte Privatnützigkeit des Eigentums gewährleistet mithin nicht, dass der Grundstücksertrag der Eigentümer einer denkmalgeschützten Gesamtanlage, deren Erhalt für sich genommen wirtschaftlich zumutbar ist, dadurch gesteigert wird, dass einzelne, wirtschaftlich unrentable Teile mit Denkmalbestand eigentumsrechtlich aus einem solchen Ensemble „herausgeschnitten“ werden und dadurch der Erhalt dieser Denkmäler infrage gestellt oder dessen Kosten letztlich der Allgemeinheit auferlegt werden."
 Schloss Liebig 2005 von mir fotografiert, die Schlosskapelle war auch auf einem meiner Bilder, aber damals lud ich diese nur in sehr kleiner Auswahl in die Wikipedia hoch
Schloss Liebig 2005 von mir fotografiert, die Schlosskapelle war auch auf einem meiner Bilder, aber damals lud ich diese nur in sehr kleiner Auswahl in die Wikipedia hochnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/details/MedievalLatinLexicon
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Rechteinhaber Brill das erlaubt hat, lautet die Devise: Weitersagen und Runterladen, solange verfügbar!
Via http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Rechteinhaber Brill das erlaubt hat, lautet die Devise: Weitersagen und Runterladen, solange verfügbar!
Via http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 18:32 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Der Leiter der BGH-Bibliothek Dietrich Pannier zieht in INETBIB ordentlich vom Leder:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg42065.html
Siehe dazu auch:
http://blog.beck.de/2010/04/29/google-gewinnt-der-bgh-und-suchmaschinen
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg42065.html
Siehe dazu auch:
http://blog.beck.de/2010/04/29/google-gewinnt-der-bgh-und-suchmaschinen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 18:17 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2468174_0_9223_-bibliotheken-bieten-neuen-service-rund-um-das-buch.html
Auch die Universitätsbibliotheken Tübingen und Konstanz wollen ihre Daten freigeben.
Auch die Universitätsbibliotheken Tübingen und Konstanz wollen ihre Daten freigeben.
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 18:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-14892
Auf gravierende Mängel der Ausgabe machten Anton Doll und Michael Gocker aufmerksam, siehe die Nachweise unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Edelini
Siehe auch die Rezension im DA:
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?IDDOC=266641&PHYSID=phys690
Auf gravierende Mängel der Ausgabe machten Anton Doll und Michael Gocker aufmerksam, siehe die Nachweise unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Edelini
Siehe auch die Rezension im DA:
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?IDDOC=266641&PHYSID=phys690
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 17:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Larndorfer, Peter (2009) Gedächtnis und Musealisierung.
Diplomarbeit, Universität Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
http://othes.univie.ac.at/9039/
Diplomarbeit, Universität Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
http://othes.univie.ac.at/9039/
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 17:33 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.welt.de/kultur/article7376038/Nibelungen-bestehen-auch-gegen-Metropolis.html
Das folgende Video von Youtube ist natürlich nicht die restaurierte Fassung.
Das folgende Video von Youtube ist natürlich nicht die restaurierte Fassung.
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 17:26 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wann immer ich die European Library besuchte, war ich angewidert von der Benutzerunfreundlichkeit dieses Projekts. So auch jetzt:
http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/roma_journey/eng/manuscripts.html
Intuitiv ist da nichts benutzbar, man hat keine Lust, länger als eine halbe Minute auf der Schrott-Seite zu bleiben.
http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/roma_journey/eng/manuscripts.html
Intuitiv ist da nichts benutzbar, man hat keine Lust, länger als eine halbe Minute auf der Schrott-Seite zu bleiben.
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 16:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 16:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pressemitteilung
Kommentar Hoeren:
http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:urteil-zum-urheberrecht-kuenstlerin-unterliegt-google/50107666.html
Aus Sicht des Medienrechtlers Thomas Hoeren ist die Entscheidung richtig. "Das ist ein gutes Urteil", sagte Hoeren, Leiter des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität Münster, der Deutschen Presse-Agentur. "Wer im Netz unterwegs ist, muss Google hinnehmen", sagte Hoeren, der auch Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf ist. Google sei mit bestimmten Funktionalitäten wie seiner Suchmaschine schon seit Jahren im Internet. Internetnutzer müssten dies etwa bei der Planung einer Homepage einkalkulieren. Die klagende Künstlerin etwa habe ihre Inhalte zu einem Zeitpunkt ins Internet gestellt, zu dem es Google und seine Suchmaschine schon längst gab.
Update:
http://iuwis.de/blog/aufatmen-nach-bgh-urteil-zur-google-bildersuche-suchmaschinenbetreiber-haften-nur-bei-hinweis-a
Update:
Interessanter Kommentar
http://www.law-blog.de/471/der-bgh-und-die-google-bildersuche-pragmatik-vs-geschriebenes-recht/
"Vielmehr statuiert der BGH hier mal eben so ein völlig neues urheberrechtliches Paradigma: wer Inhalte hat, der muss sie halt schützen, und wenn er das nicht tut, dann darf er auch nichts dagegen haben, wenn jemand anders die Inhalte verwendet. Opt-out statt Opt-in also."

Kommentar Hoeren:
http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:urteil-zum-urheberrecht-kuenstlerin-unterliegt-google/50107666.html
Aus Sicht des Medienrechtlers Thomas Hoeren ist die Entscheidung richtig. "Das ist ein gutes Urteil", sagte Hoeren, Leiter des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität Münster, der Deutschen Presse-Agentur. "Wer im Netz unterwegs ist, muss Google hinnehmen", sagte Hoeren, der auch Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf ist. Google sei mit bestimmten Funktionalitäten wie seiner Suchmaschine schon seit Jahren im Internet. Internetnutzer müssten dies etwa bei der Planung einer Homepage einkalkulieren. Die klagende Künstlerin etwa habe ihre Inhalte zu einem Zeitpunkt ins Internet gestellt, zu dem es Google und seine Suchmaschine schon längst gab.
Update:
http://iuwis.de/blog/aufatmen-nach-bgh-urteil-zur-google-bildersuche-suchmaschinenbetreiber-haften-nur-bei-hinweis-a
Update:
Interessanter Kommentar
http://www.law-blog.de/471/der-bgh-und-die-google-bildersuche-pragmatik-vs-geschriebenes-recht/
"Vielmehr statuiert der BGH hier mal eben so ein völlig neues urheberrechtliches Paradigma: wer Inhalte hat, der muss sie halt schützen, und wenn er das nicht tut, dann darf er auch nichts dagegen haben, wenn jemand anders die Inhalte verwendet. Opt-out statt Opt-in also."

KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 14:53 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 14:41 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Umbau der Remise neben dem Rheinsberger Schloss wird billiger als bisher geplant. Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) und Bauamtsleiter Jens Eggert haben entschieden, dass ein eigenes Archiv für das Rheinsberger Rathaus nicht nötig ist."
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11786654/61299/Rau-Rheinsberg-braucht-es-nicht-Stadt-will-auf.html
Allerdings muss noch die Stadtverordnetenversammlung am 5. Mai der geänderten Entwurfsplanung zustimmen:
http://www.rheinsberg.ratsinfo-online.org/bi/vo020.asp
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11786654/61299/Rau-Rheinsberg-braucht-es-nicht-Stadt-will-auf.html
Allerdings muss noch die Stadtverordnetenversammlung am 5. Mai der geänderten Entwurfsplanung zustimmen:
http://www.rheinsberg.ratsinfo-online.org/bi/vo020.asp
ingobobingo - am Donnerstag, 29. April 2010, 10:35 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Donnerstag, 29. April 2010, 06:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wilfried Meyer 2010
Vorsitzender: Dr. Henning Steinführer, Stadtarchiv Braunschweig
Stellv. Vorsitzender: Heiner Schüpp, Kreisarchiv Emsland
Schatzmeister: Martin Hartmann, Stadtarchiv Hildesheim
Schriftführer: Wolfgang Jürries, Kreisarchiv Lüchow-Dannenberg
Beisitzer/in: Ingo Wilfling, Samtgemeindearchiv Harsefeld; Sabine Maehnert, Stadtarchiv Celle; Silke Schulte, Stadtarchiv Hameln
Quelle: ANKA-online
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. April 2010, 21:45 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The universal archiving module (UAM) is a software created by the National Archives for the preparation and transfer of digital documents extracted from electronic records managements systems. Use of UAM requires the ability of an institution’s ERMS to export documents and their metadata in XML format."
Link
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. April 2010, 21:36 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitale Urkundenpräsentationen:
Laufende Projekte und aktuelle Entwicklungen
Workshop zum Abschluss des DFG-Projekts „Urkundenportal“
16. Juni 2010, München
Veranstaltungsort:
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns,
Schönfeldstraße 5, 80539 München, Vortragsraum (Raum 207)
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte und am Bayerischen Hauptstaatsarchiv angesiedelte Pro-jekt „Urkundenportal“ („Aufbau eines elektronischen, internet-basierten Portals für größere Bestände von digitalisierten Ur-kunden des süddeutschen Raumes“) ist im März 2010 nach insgesamt 24 Monaten Laufzeit abgeschlossen worden. Dies ist Anlass, im Rahmen eines eintägigen Workshops die Ergebnisse dieses umfangreichen Digitalisierungs- und Erschließungsprojekts der Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Zugleich sollen weitere derzeit laufende Projekte bzw. Urkundenpräsentationen aus dem In- und Ausland vorgestellt werden.
In einem zweiten Themenblock werden ausgewählte technische Fragen und Aspekte des sog. Web 2.0 bzw. der kollaborativen Bearbeitung von Urkunden behandelt; ebenso soll ein Blick auf die (mögliche) Zukunft der Urkundendigitalisierung im archivischen Bereich geworfen werden. Während des Workshops wird ausreichend Zeit für eine Diskussion der Referate sein.
Der Workshop wird veranstaltet von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Die Teilnahme am Workshop ist selbstverständlich kostenlos.
Um Anmeldung per E-Mail bis 11. Juni wird gebeten:
amtsleitung@gda.bayern.de, Tel. +49 (0) 89 / 286 38-2482
Programm
10.45 Begrüßung
(Christian Kruse, Generaldirektion der Staatlichen Ar-chive Bayerns; Thomas Aigner, „International center for archival research“, Wien)
11.00 Bayerische Urkunden im Netz: Erfahrungen und Perspektiven aus dem DFG-Projekt „Urkundenportal“
(Joachim Kemper, Staatsarchiv München, gemeinsam mit Katharina Elisabeth Wolff, München)
11.30 Die Digitalisierung größerer Urkundenbestände in Archiven: Strategie, Methoden und Ziele
(Francesco Roberg, Staatsarchiv Marburg)
11.50 Von Bonifatius bis Napoleon. „Online-Edition“ der Urkunden der Reichsabtei Fulda 751–1837 im Hessischen Staatsarchiv Marburg
(Steffen Arndt, Thüringisches Staatsarchiv Gotha)
12.10 Collectio Diplomatica Hungarica. Mittelalterliche Urkunden online
(Csaba Reisz, Generaldirektor des Ungarischen Staats-archivs)
12.30–13.45 Mittagspause
13.45 Das virtuelle Urkundenarchiv „Monasterium“ am Beispiel Österreichs
(Thomas Just, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, und Karl Heinz, „International center for archival research“, Wien)
14.15 Das DFG-Projekt „Marburger Lichtbildarchiv Online“
(Sebastian Müller, Forschungsinstitut Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden bis 1250, Philipps-Universität Marburg)
14.45 Kaffeepause
15.00 Das Verhältnis von Archiven und Diplomatik im Netz: Von der Bereitstellung zur Kollaboration
(Georg Vogeler, Historische Grundwissenschaften und Historische Medienkunde, Ludwig-Maximilians-Universität München)
15.30 Urkundendigitalisierung und virtuelle Netzwerke
(Manfred Thaller, Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung, Universität Köln, gemeinsam mit Maria Magdalena Rückert, Landesarchiv Baden-Württemberg/Abt. Fachprogramme und Bildungsarbeit, sowie Joachim Kemper, Staatsarchiv München)
16.15 Schlussdiskussion
Laufende Projekte und aktuelle Entwicklungen
Workshop zum Abschluss des DFG-Projekts „Urkundenportal“
16. Juni 2010, München
Veranstaltungsort:
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns,
Schönfeldstraße 5, 80539 München, Vortragsraum (Raum 207)
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte und am Bayerischen Hauptstaatsarchiv angesiedelte Pro-jekt „Urkundenportal“ („Aufbau eines elektronischen, internet-basierten Portals für größere Bestände von digitalisierten Ur-kunden des süddeutschen Raumes“) ist im März 2010 nach insgesamt 24 Monaten Laufzeit abgeschlossen worden. Dies ist Anlass, im Rahmen eines eintägigen Workshops die Ergebnisse dieses umfangreichen Digitalisierungs- und Erschließungsprojekts der Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Zugleich sollen weitere derzeit laufende Projekte bzw. Urkundenpräsentationen aus dem In- und Ausland vorgestellt werden.
In einem zweiten Themenblock werden ausgewählte technische Fragen und Aspekte des sog. Web 2.0 bzw. der kollaborativen Bearbeitung von Urkunden behandelt; ebenso soll ein Blick auf die (mögliche) Zukunft der Urkundendigitalisierung im archivischen Bereich geworfen werden. Während des Workshops wird ausreichend Zeit für eine Diskussion der Referate sein.
Der Workshop wird veranstaltet von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Die Teilnahme am Workshop ist selbstverständlich kostenlos.
Um Anmeldung per E-Mail bis 11. Juni wird gebeten:
amtsleitung@gda.bayern.de, Tel. +49 (0) 89 / 286 38-2482
Programm
10.45 Begrüßung
(Christian Kruse, Generaldirektion der Staatlichen Ar-chive Bayerns; Thomas Aigner, „International center for archival research“, Wien)
11.00 Bayerische Urkunden im Netz: Erfahrungen und Perspektiven aus dem DFG-Projekt „Urkundenportal“
(Joachim Kemper, Staatsarchiv München, gemeinsam mit Katharina Elisabeth Wolff, München)
11.30 Die Digitalisierung größerer Urkundenbestände in Archiven: Strategie, Methoden und Ziele
(Francesco Roberg, Staatsarchiv Marburg)
11.50 Von Bonifatius bis Napoleon. „Online-Edition“ der Urkunden der Reichsabtei Fulda 751–1837 im Hessischen Staatsarchiv Marburg
(Steffen Arndt, Thüringisches Staatsarchiv Gotha)
12.10 Collectio Diplomatica Hungarica. Mittelalterliche Urkunden online
(Csaba Reisz, Generaldirektor des Ungarischen Staats-archivs)
12.30–13.45 Mittagspause
13.45 Das virtuelle Urkundenarchiv „Monasterium“ am Beispiel Österreichs
(Thomas Just, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, und Karl Heinz, „International center for archival research“, Wien)
14.15 Das DFG-Projekt „Marburger Lichtbildarchiv Online“
(Sebastian Müller, Forschungsinstitut Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden bis 1250, Philipps-Universität Marburg)
14.45 Kaffeepause
15.00 Das Verhältnis von Archiven und Diplomatik im Netz: Von der Bereitstellung zur Kollaboration
(Georg Vogeler, Historische Grundwissenschaften und Historische Medienkunde, Ludwig-Maximilians-Universität München)
15.30 Urkundendigitalisierung und virtuelle Netzwerke
(Manfred Thaller, Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung, Universität Köln, gemeinsam mit Maria Magdalena Rückert, Landesarchiv Baden-Württemberg/Abt. Fachprogramme und Bildungsarbeit, sowie Joachim Kemper, Staatsarchiv München)
16.15 Schlussdiskussion
J. Kemper - am Mittwoch, 28. April 2010, 16:19 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Links sind eine Schande für traditionelle Presseorgane, sie sind der Anfang vom Ende, sozusagen der Sargnadel der darniederliegenden Printlandschaft. Daher bestätigt es nur die Vorurteile, dass man lange suchen muss, bis man zur (dpa-)Meldung (die es auch in den Rundfunk geschafft hat), dass Russland Archivdokumente zum Massaker von Katyn veröffentlicht hat, einen Link findet.
Soweit zum Thema Qualitätsjournalismus.
Dazu Tipp 8 von
http://opalkatze.wordpress.com/2010/04/26/liebe-online-presse/
"Keine Links setzen, das festigt die Kundenbindung. Der Leser weiß, daß er bei Ihnen auch die Hintergründe bekommt, die Sie für wichtig halten."
Via
http://www.bildblog.de/
Hier wurde ich fündig:
http://polskaweb.eu/geheime-dokumente-ueber-taeter-von-katyn-4673563.html
Suchabfrage:
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&tbo=p&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&channel=s&tbs=nws%3A1&q=katyn+%2Bspisok&btnG=Suche&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Also einige polnische Medien, eine deutschsprachige Seite aus Polen (siehe oben) und spanische Medien.
Link zu rusarchives.ru
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
(Extrem langsamer Server. Selbst im Wissenschaftsnetz bauen sich die Faksimileseiten z.B. http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/7.jpg quälend langsam auf.)
Update:
KEIN LInk auf Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,691914,00.html
Soweit zum Thema Qualitätsjournalismus.
Dazu Tipp 8 von
http://opalkatze.wordpress.com/2010/04/26/liebe-online-presse/
"Keine Links setzen, das festigt die Kundenbindung. Der Leser weiß, daß er bei Ihnen auch die Hintergründe bekommt, die Sie für wichtig halten."
Via
http://www.bildblog.de/
Hier wurde ich fündig:
http://polskaweb.eu/geheime-dokumente-ueber-taeter-von-katyn-4673563.html
Suchabfrage:
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&tbo=p&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&channel=s&tbs=nws%3A1&q=katyn+%2Bspisok&btnG=Suche&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Also einige polnische Medien, eine deutschsprachige Seite aus Polen (siehe oben) und spanische Medien.
Link zu rusarchives.ru
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
(Extrem langsamer Server. Selbst im Wissenschaftsnetz bauen sich die Faksimileseiten z.B. http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/7.jpg quälend langsam auf.)
Update:
KEIN LInk auf Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,691914,00.html
KlausGraf - am Mittwoch, 28. April 2010, 15:05 - Rubrik: Internationale Aspekte
Reinhard Markner schrieb mir eine Mail mit dem Hinweis auf seinen Bericht über eine Gothaer Tagung, aus dem ich folgendes zitieren möchte:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0428/feuilleton/0008/index.html
Schon heute sind für jedermann Millionen urheberrechtlich nicht mehr geschützter Bücher im Netz frei zugänglich. Für die historisch gewachsenen Sammlungen bedeutet dies einen enormen Wertverlust.
Michael Knoche, Direktor der Weimarer Amalienbibliothek, berichtete von den Bemühungen um die Wiederbeschaffung der beim Brand von 2004 vernichteten Bücher. Die technische Entwicklung hat sie überholt, denn soweit es um die Inhalte geht, sind die Digitalisate ja angemessener Ersatz. Die im Antiquariatshandel überhaupt noch zu beschaffenden alten Drucke haben ihnen gegenüber einen zweifelhaften Mehrwert, denn ihre individuellen Eigenschaften zeugen von je anderen Bücherschicksalen. Namenszüge oder Randbemerkungen früherer Besitzer signalisieren geradezu ihre Unzugehörigkeit zum Weimarer Bestand.
Siehe dazu meinen Beitrag in netbib 2006:
http://log.netbib.de/archives/2006/07/12/gut-gemeint-aber-frevel/
Markner weiter:
Aus bisweilen übertriebener Sorge um die Originale werden die Benutzer nach Möglichkeit von ihnen fern gehalten und mit Mikrofilmen oder neueren Nachdrucken abgespeist. Die Forscher haben es meist gleichmütig hingenommen, weil das Buch in seinem Buchsein in der Regel eben doch nicht die Botschaft ist, auf die es ankommt. Welcher Philosoph studiert schon die "Critik der reinen Vernunft" im Erstdruck, "Riga, verlegts Johann Friedrich Hartknoch, 1781"? Wer hat sich jemals dafür interessiert, welche Wasserzeichen das Papier trägt, auf dem sie gedruckt wurde? Möglicherweise erfahren buchkundliche Fragestellungen gerade in dieser Zeit des beschleunigten Medienwandels eine Konjunktur. Für weite Bereiche der Forschung spielen sie jedoch, wie auch begeisterte Bibliophile zugeben sollten, keine nennenswerte Rolle. Die Volltextsuche bietet hingegen Möglichkeiten zur Durchforstung der schriftlichen Tradition, die auszuschöpfen die spannendste Aufgabe der heutigen Geisteswissenschaften ist.

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0428/feuilleton/0008/index.html
Schon heute sind für jedermann Millionen urheberrechtlich nicht mehr geschützter Bücher im Netz frei zugänglich. Für die historisch gewachsenen Sammlungen bedeutet dies einen enormen Wertverlust.
Michael Knoche, Direktor der Weimarer Amalienbibliothek, berichtete von den Bemühungen um die Wiederbeschaffung der beim Brand von 2004 vernichteten Bücher. Die technische Entwicklung hat sie überholt, denn soweit es um die Inhalte geht, sind die Digitalisate ja angemessener Ersatz. Die im Antiquariatshandel überhaupt noch zu beschaffenden alten Drucke haben ihnen gegenüber einen zweifelhaften Mehrwert, denn ihre individuellen Eigenschaften zeugen von je anderen Bücherschicksalen. Namenszüge oder Randbemerkungen früherer Besitzer signalisieren geradezu ihre Unzugehörigkeit zum Weimarer Bestand.
Siehe dazu meinen Beitrag in netbib 2006:
http://log.netbib.de/archives/2006/07/12/gut-gemeint-aber-frevel/
Markner weiter:
Aus bisweilen übertriebener Sorge um die Originale werden die Benutzer nach Möglichkeit von ihnen fern gehalten und mit Mikrofilmen oder neueren Nachdrucken abgespeist. Die Forscher haben es meist gleichmütig hingenommen, weil das Buch in seinem Buchsein in der Regel eben doch nicht die Botschaft ist, auf die es ankommt. Welcher Philosoph studiert schon die "Critik der reinen Vernunft" im Erstdruck, "Riga, verlegts Johann Friedrich Hartknoch, 1781"? Wer hat sich jemals dafür interessiert, welche Wasserzeichen das Papier trägt, auf dem sie gedruckt wurde? Möglicherweise erfahren buchkundliche Fragestellungen gerade in dieser Zeit des beschleunigten Medienwandels eine Konjunktur. Für weite Bereiche der Forschung spielen sie jedoch, wie auch begeisterte Bibliophile zugeben sollten, keine nennenswerte Rolle. Die Volltextsuche bietet hingegen Möglichkeiten zur Durchforstung der schriftlichen Tradition, die auszuschöpfen die spannendste Aufgabe der heutigen Geisteswissenschaften ist.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. April 2010, 11:41 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Hamburger Staatsarchiv zeigt ab dem 5. Mai eine Ausstellung über das zerstörte Kölner Stadtarchiv. In der Schau «Nach dem Einsturz: Das Historische Archiv der Stadt Köln» würden das Ausmaß des Einsturzes, die Bergung und die Verluste einmaligen Kulturgutes dokumentiert, teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Zudem erhielten die Besucher einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der modernen Restaurierung.
Zusätzlich zur Ausstellung sind Vorträge im Staatsarchiv geplant. Am 11. Mai erinnert Franklin Kopitzsch in seinem Vortrag «Hamburgs langer Weg zur Reichsfreiheit» an den diesjährigen 500. Jahrestag Hamburgs als Reichstadt. Am 25. Mai stellt Anna von Villiez ihre Forschungen zur Verfolgung von jüdischen Ärzten in der NS-Zeit vor, die auf Quellen des Staatsarchivs basieren. Alle Veranstaltungen sind öffentlich.
Die Ausstellung ist bis zum 28. Mai jeweils montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. ....
Quelle: Link
Veranstaltungsflyer des Hamburger Staatsarchivs (PDF)
Zusätzlich zur Ausstellung sind Vorträge im Staatsarchiv geplant. Am 11. Mai erinnert Franklin Kopitzsch in seinem Vortrag «Hamburgs langer Weg zur Reichsfreiheit» an den diesjährigen 500. Jahrestag Hamburgs als Reichstadt. Am 25. Mai stellt Anna von Villiez ihre Forschungen zur Verfolgung von jüdischen Ärzten in der NS-Zeit vor, die auf Quellen des Staatsarchivs basieren. Alle Veranstaltungen sind öffentlich.
Die Ausstellung ist bis zum 28. Mai jeweils montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. ....
Quelle: Link
Veranstaltungsflyer des Hamburger Staatsarchivs (PDF)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. April 2010, 11:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der amerikanische Archivdienstleister Iron Mountain hat seine NRW-Niederlassung in Bochum erweitert. In der 2500 Quadratmeter großen Halle können insgesamt rund 400 Kilometer Aktenordner und 100.000 elektronische Datenträger eingelagert werden. Wer seine Akten von dem Dienstleister archivieren lässt, ist streng geheim. Von Arztpraxen und Anwaltskanzleien bis hin zu börsennotierten internationalen Unternehmen ist alles vertreten. Für die Kunden bedeutet der Service: sie brauchen sich um Aufbewahrungsfristen nicht zu kümmern und sie sparen Lager- und Personalkosten. Dringend benötigte Unterlagen können trotzdem innerhalb weniger Stunden zugestellt werden. Aus Versehen haben Kunden in einigen Aktenkartons auch schon Kaffeemaschinen oder Sparschweine in die Archivzentrale nach Bochum geschickt. Solche Gegenstände gehen aus Sicherheitsgründen schnellstmöglich zurück."
Quelle: WDR-Lokalzeit Essen, Nachrichten
Homepage Iron mountain
Quelle: WDR-Lokalzeit Essen, Nachrichten
Homepage Iron mountain
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:42 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:25 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
" Finanziell leisten kann sich Steinfurt einen Archivar eigentlich nicht. Und doch soll wieder einer eingestellt werden, Vollzeit sogar. Da ist sich die Mehrheit der Kommunalpolitiker einig und dazu hat auch das Archivamt des Landschaftesverbandes Westfalen-Lippe geraten.
Ansonsten könnte es zu Verlusten in der historischen Überlieferung kommen und das will natürlich keiner riskieren. „Wir haben uns von der Notwendigkeit überzeugen lassen“, erklärte Doris Gremplinski am Mittwochabend im Hauptausschuss für die CDU. Auch die FWS will laut Fraktionschef Willi Wobbe „in den sauren Apfel beißen“ und die Vollzeitstelle ausschreiben.
Dagegen stimmte als einzige Fraktion die Grün-Alternative Liste (GAL): „Wir haben das Geld einfach nicht“, will Christian Franke auf Luxus dieser Art freiwillig verzichten. Bauchschmerzen hat auch Robert Lambertz von den Linken. Trotzdem unterstützte er für seine Partei den Beschlussvorschlag.
Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten. Die sind bereit, eher mehr als weniger zu bezahlen, wie Alfred Voges im Hauptausschuss sagte. Um vernünftige Bewerber zu bekommen, wollte die SPD die Stelle im Archiv höher dotieren. Was jedoch nicht geht. Darauf wies Steinfurts Erster Beigeordnete Dirk Wigant hin: „Wir sind an den Tarif gebunden.“
Bis 1989 gab es im Archiv eine Vollzeitstelle, zum Schluss hatte Dr. Ralf Klötzer einen Vertrag über 19,25 Stunden."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Ansonsten könnte es zu Verlusten in der historischen Überlieferung kommen und das will natürlich keiner riskieren. „Wir haben uns von der Notwendigkeit überzeugen lassen“, erklärte Doris Gremplinski am Mittwochabend im Hauptausschuss für die CDU. Auch die FWS will laut Fraktionschef Willi Wobbe „in den sauren Apfel beißen“ und die Vollzeitstelle ausschreiben.
Dagegen stimmte als einzige Fraktion die Grün-Alternative Liste (GAL): „Wir haben das Geld einfach nicht“, will Christian Franke auf Luxus dieser Art freiwillig verzichten. Bauchschmerzen hat auch Robert Lambertz von den Linken. Trotzdem unterstützte er für seine Partei den Beschlussvorschlag.
Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten. Die sind bereit, eher mehr als weniger zu bezahlen, wie Alfred Voges im Hauptausschuss sagte. Um vernünftige Bewerber zu bekommen, wollte die SPD die Stelle im Archiv höher dotieren. Was jedoch nicht geht. Darauf wies Steinfurts Erster Beigeordnete Dirk Wigant hin: „Wir sind an den Tarif gebunden.“
Bis 1989 gab es im Archiv eine Vollzeitstelle, zum Schluss hatte Dr. Ralf Klötzer einen Vertrag über 19,25 Stunden."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:21 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Rumänen haben nicht genug gespendet. Deshalb musste ein ambitioniertes Projekt von Journalisten zunächst auf Eis gelegt werden. Frühere Macher von "Radio Free Europe" wollen das Archiv des Senders nach Bukarest holen, doch sind statt der dafür erforderlichen 200.000 Euro bislang erst 60.000 Euro gespendet worden. - Während des Kalten Krieges sollen in Rumänien täglich neun Millionen Menschen "Radio Free Europe" gehört haben. Damit war der von den USA finanzierte Sender dort weitaus beliebter als in Polen, Ungarn oder der Tschechoslowakei. "
Quelle: Deutschlandradio Kultur, 21.04.2010
Quelle: Deutschlandradio Kultur, 21.04.2010
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:18 - Rubrik: Medienarchive
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:14 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Today, it's an astonishing, even eerie, scene: the icon of modern American conservatism, whose rise to political prominence was galvanized by the cultural rebellion of the 1960s, fighting off an attack-at-gunpoint by the quintessential modern American rebel. But when "The Dark, Dark Hours" episode of General Electric Theater aired live from Hollywood on December 12, 1954, Ronald Reagan and James Dean were just two actors yet to find the roles that would define them.
No one has seen this episode in the decades since; the kinescope has been locked away, until now. My friend Wayne Federman, a writer for NBC's Late Night with Jimmy Fallon, unearthed the broadcast, condensing it from its original 23 minutes (without commercials) into the six-minute version you see below. (Federman is planning a retrospective of Reagan's television career for next year's Reagan centennial.)
Here, Reagan is a physician, forced to defend his home and family from Dean, a teenage lawbreaker seeking medical treatment for an injured friend..... "
The Atlantic
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:10 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Architekt Fähmel hat eine Abtei gebaut. Sein Sohn ließ sie sprengen, wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Enkel will sie nun wieder errichten. Heinrich Bölls Roman "Billard um halb zehn" spielt in Köln und passt perfekt als Kommentar zum heutigen Umgang der Stadt mit ihrer Architektur. Gerade erst haben die Bürger den Stadtrat gezwungen, das denkmalgeschützte Schauspielhaus nicht abzureißen. Gegen den Sturz des Stadtarchivs in einen U-Bahn-Schacht konnten sie nichts ausrichten. Da grenzt es fast an ein Wunder, dass der Dom noch steht.
Anna Viebrock, die geniale Bühnen- und Kostümbildnerin, ist in Köln geboren, wie Heinrich Böll und die Schauspielintendantin Karin Beier. Seit einiger Zeit inszeniert Viebrock auch. Bölls komplexen Roman, in dem Rückblenden, Erinnerungen und Gegenwart sich fließend ineinander verschlingen, hat sie unter dem Titel "Wozuwozuwozu" auf die Bühne gebracht. Das fragen sich im Buch auch die Bauern, als der Sprengmeister Robert Fähmel im Auftrag der Nazis die Abtei in die Luft jagt. Für die Regisseurin schwebt diese Frage über der gesamten Handlung.
Aus dem Muff der 50er-Jahre hat Anna Viebrock schon als Mitarbeiterin von Christoph Marthaler Inspirationen gezogen, holzvertäfelte Wartesäle sind ihr Erkennungszeichen. Wieder hat sie so einen Verlorenheitsraum entworfen, der als Restaurant, Büro und Kino fungiert. Die Männer tragen graue Anzüge und Pomade im Haar, die Sekretärin Kostüm und Toupetfrisur, eine jüngere Frau Petticoat. Die Aufführung richtet sich ganz in der Zeit ein, die der Roman vorgibt.
Die nationalsozialistischen Verbrechen sind noch sehr nah. Alle drei Generationen der Familie Fähmel wirken wie gelähmt. Michael Wittenborns als Vater Heinrich spricht fast nur über seine Frühstückstradition mit Paprikakäse, Sohn Robert (Ernst Surberg) findet seine Erfüllung im einsamen Billardspiel jeden Morgen um halb zehn, und Maik Solbachs Enkel Joseph rast todessehnsüchtig mit dem Auto über die Straßen. Wenn die Handlung ganz zum Stehen kommt, singt Rosemary Hardy, aus vielen Marthaler-Inszenierungen bekannt, melancholische Melodien. Nur die tapfere Mutter Johanna (Julia Wieninger) wagt eine Aktion und schießt auf einen Altnazi.
Anna Viebrock ist tief eingetaucht in den Roman und seine Rezeptionsgeschichte. Am Anfang tönt per Einspielung eine Diskussion über die Möglichkeit epischen Erzählens in die Szene, auch Straub/Huillets Verfilmung des Romans unter dem Titel "Nicht versöhnt" von 1965 spielt eine große Rolle. So wie die französischen Filmemacher, die damals noch für ihren betont kargen Stil verhöhnt wurden, sucht Viebrock in den meisten Rollen nach einem direkten, einfachen Ton. Aber das zieht sie nicht konsequent durch, andere Schauspieler gestalten psychologisch ausgefeilte Figuren. Martin Reinke hat einen unglaublich starken Auftritt als Mitläufer Dr. Nettlinger, ein Mensch ohne Gesinnung und Gewissen, erst Nazi, dann Demokrat. Wie er einem zurück gekehrten Flüchtling die Vorteile einer Lachsvorspeise anpreist, wirkt unendlich fies, gerade weil er so freundlich ist und an seine Liebenswürdigkeit glaubt. Auf diese Nettlingers wurde die frühe Bundesrepublik gebaut. Neben Reinkes Auftritt wirkt die Bescheidenheit vieler Akteure wie laienhaftes Textaufsagen. ...." - aus der Rezension in der Welt.
Anna Viebrock, die geniale Bühnen- und Kostümbildnerin, ist in Köln geboren, wie Heinrich Böll und die Schauspielintendantin Karin Beier. Seit einiger Zeit inszeniert Viebrock auch. Bölls komplexen Roman, in dem Rückblenden, Erinnerungen und Gegenwart sich fließend ineinander verschlingen, hat sie unter dem Titel "Wozuwozuwozu" auf die Bühne gebracht. Das fragen sich im Buch auch die Bauern, als der Sprengmeister Robert Fähmel im Auftrag der Nazis die Abtei in die Luft jagt. Für die Regisseurin schwebt diese Frage über der gesamten Handlung.
Aus dem Muff der 50er-Jahre hat Anna Viebrock schon als Mitarbeiterin von Christoph Marthaler Inspirationen gezogen, holzvertäfelte Wartesäle sind ihr Erkennungszeichen. Wieder hat sie so einen Verlorenheitsraum entworfen, der als Restaurant, Büro und Kino fungiert. Die Männer tragen graue Anzüge und Pomade im Haar, die Sekretärin Kostüm und Toupetfrisur, eine jüngere Frau Petticoat. Die Aufführung richtet sich ganz in der Zeit ein, die der Roman vorgibt.
Die nationalsozialistischen Verbrechen sind noch sehr nah. Alle drei Generationen der Familie Fähmel wirken wie gelähmt. Michael Wittenborns als Vater Heinrich spricht fast nur über seine Frühstückstradition mit Paprikakäse, Sohn Robert (Ernst Surberg) findet seine Erfüllung im einsamen Billardspiel jeden Morgen um halb zehn, und Maik Solbachs Enkel Joseph rast todessehnsüchtig mit dem Auto über die Straßen. Wenn die Handlung ganz zum Stehen kommt, singt Rosemary Hardy, aus vielen Marthaler-Inszenierungen bekannt, melancholische Melodien. Nur die tapfere Mutter Johanna (Julia Wieninger) wagt eine Aktion und schießt auf einen Altnazi.
Anna Viebrock ist tief eingetaucht in den Roman und seine Rezeptionsgeschichte. Am Anfang tönt per Einspielung eine Diskussion über die Möglichkeit epischen Erzählens in die Szene, auch Straub/Huillets Verfilmung des Romans unter dem Titel "Nicht versöhnt" von 1965 spielt eine große Rolle. So wie die französischen Filmemacher, die damals noch für ihren betont kargen Stil verhöhnt wurden, sucht Viebrock in den meisten Rollen nach einem direkten, einfachen Ton. Aber das zieht sie nicht konsequent durch, andere Schauspieler gestalten psychologisch ausgefeilte Figuren. Martin Reinke hat einen unglaublich starken Auftritt als Mitläufer Dr. Nettlinger, ein Mensch ohne Gesinnung und Gewissen, erst Nazi, dann Demokrat. Wie er einem zurück gekehrten Flüchtling die Vorteile einer Lachsvorspeise anpreist, wirkt unendlich fies, gerade weil er so freundlich ist und an seine Liebenswürdigkeit glaubt. Auf diese Nettlingers wurde die frühe Bundesrepublik gebaut. Neben Reinkes Auftritt wirkt die Bescheidenheit vieler Akteure wie laienhaftes Textaufsagen. ...." - aus der Rezension in der Welt.
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 21:02 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ...Um dem Status einer Nothaushaltskommune zu entgehen, muss gespart werden. Davon sind auch die freiwilligen Leistungen betroffen. Die Folge ist, dass sie reduziert oder eingestellt werden. ....
Um das Schreckensszenario abzuwenden, hätten sich Verwaltung und Politik an einen Tisch gesetzt und ein 20-Punkte-Konsolidierungsprogramm aufgestellt. Als Ergebnis werde in der alten Schule in Lahde kein Stadtarchiv eingerichtet. ...."
Quelle: Mindener Tagblatt
Um das Schreckensszenario abzuwenden, hätten sich Verwaltung und Politik an einen Tisch gesetzt und ein 20-Punkte-Konsolidierungsprogramm aufgestellt. Als Ergebnis werde in der alten Schule in Lahde kein Stadtarchiv eingerichtet. ...."
Quelle: Mindener Tagblatt
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:53 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
* 25. 2. 1877 Wien, † 28. 11. 1935 Cambridge (Großbritannien), Musikwissenschaftler und Ethnologe; Enkel von Theodor von Hornbostel. Ging 1900 nach Berlin, wandte sich der Tonpsychologie von C. Stumpf zu, 1905/06 dessen Assistent, 1906-33 Leiter des Berliner Phonogrammarchivs, dann Professor in New York (1933), London und Cambridge (1934). Gilt als Begründer der "Berliner Schule" der Musikwissenschaft.
Quelle: Österreich-Lexikon
Wikipedia-Artikel
Quelle: Österreich-Lexikon
Wikipedia-Artikel
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:48 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivists have a close connection with history, but there are very different concepts about the nature of this relationship.The term 'to archive' encompasses a number of functions and activities carried out by an archivist in the course of their professional duties, including acquisition, appraisal, selection, arrangement, cataloguing and preservation, to enable future generations of historians and other researchers to work with them. Those functions require archivists to interpret the records and collections in their care, as does aspects of access to the collections, incuding the production of exhibitions, presentations and publications. How do archivists ensure objectivitiy and impartiality and is this possible? Do archivists create history in the course of their professional duties through decision-making during acquisition, selection and interpretation? How also do archivists know what might be of interest for historians in the future? Should they consult their users about that? Or should they, as a part of their professional duties, follow actual research and methodological discussions in history to react to changing preferences and aspects of historical research?
Often, archivists are asked to produce historical works concerning the institution they are working in: exhibitions, brochures, even books describing the history of the institution. So, do they have to be trained historians as well as archivists? In Central Europe, for example, (including Germany and Austria as well) there is a long tradition that archivists, particularly those with an academic background, are expected - as a part of their professional profile as archivists - to participate actively in historical research, editing documents, publishing professional books and articles on historical subjects.
University and research institution archives may have a particularly close organizational connection with the historical profession, especially if they are affiliated with the history department or headed by a professor in history. In this case, archivists themselves may be actively engaged in historical research, which may lead to a conflict of interest with their professional duties as archivists and/or records managers (e.g. in terms of collection development or sharing knowledge regarding primary sources). This Conference will explore the different professional profiles of archivists as historians within an international perspective.
The 2010 Conference Programme Committee invites you to submit proposals for the SUV annual conference. Within the following themes we seek individual or panel proposals, the aim being to encourage discussion and debate throughout each session. Proposals should be analytical, not descriptive, and should reflect the changing nature of archival cultures, traditions, theory, and practice.
Abstracts of 500 words for each presentation (in English), which should aim to last for a maximum of 20 minutes should be submitted to petr.svobodny@ruk.cuni.cz no later than Friday 30 April 2010.
Proposals must include a brief CV (1 page) of each speaker.
Themes should focus on the following topics:
1. the practice of acquisition, appraisal, and description and their role in creating or shaping the historical record
2. access and outreach, description and interpretation: the 'making' of history and professional impartiality
3. facilitating research in university and research institutions: the role of the archivist
4. archivist as historian?: different national archival traditions and the burdens of a dual role (e.g. in terms of academic training, ongoing education, and just getting the work done)
5. institutional outreach: the archivist as institutional historian
The format of all sessions is intended to promote vigorous debate amongst participants.
Link
29 Sept - 3 Oct 2010, Charles University, Prague, Czech Republic
International Council on Archives - Section on University and Research Institution Archives (SUV)
Often, archivists are asked to produce historical works concerning the institution they are working in: exhibitions, brochures, even books describing the history of the institution. So, do they have to be trained historians as well as archivists? In Central Europe, for example, (including Germany and Austria as well) there is a long tradition that archivists, particularly those with an academic background, are expected - as a part of their professional profile as archivists - to participate actively in historical research, editing documents, publishing professional books and articles on historical subjects.
University and research institution archives may have a particularly close organizational connection with the historical profession, especially if they are affiliated with the history department or headed by a professor in history. In this case, archivists themselves may be actively engaged in historical research, which may lead to a conflict of interest with their professional duties as archivists and/or records managers (e.g. in terms of collection development or sharing knowledge regarding primary sources). This Conference will explore the different professional profiles of archivists as historians within an international perspective.
The 2010 Conference Programme Committee invites you to submit proposals for the SUV annual conference. Within the following themes we seek individual or panel proposals, the aim being to encourage discussion and debate throughout each session. Proposals should be analytical, not descriptive, and should reflect the changing nature of archival cultures, traditions, theory, and practice.
Abstracts of 500 words for each presentation (in English), which should aim to last for a maximum of 20 minutes should be submitted to petr.svobodny@ruk.cuni.cz no later than Friday 30 April 2010.
Proposals must include a brief CV (1 page) of each speaker.
Themes should focus on the following topics:
1. the practice of acquisition, appraisal, and description and their role in creating or shaping the historical record
2. access and outreach, description and interpretation: the 'making' of history and professional impartiality
3. facilitating research in university and research institutions: the role of the archivist
4. archivist as historian?: different national archival traditions and the burdens of a dual role (e.g. in terms of academic training, ongoing education, and just getting the work done)
5. institutional outreach: the archivist as institutional historian
The format of all sessions is intended to promote vigorous debate amongst participants.
Link
29 Sept - 3 Oct 2010, Charles University, Prague, Czech Republic
International Council on Archives - Section on University and Research Institution Archives (SUV)
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:45 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivist's Toolkit
View more presentations from infoclio.ch.
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:43 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Masse erinnert an Erdnussriegel und lagert in Nestern der Amerikanischen Buschratte: Für Wissenschaftler ist die Mischung aus Kot und Urin ein unschätzbares botanisches und kulturelles Archiv. Aus den Exkrementen und ihrem Fundort lernen sie erstaunliche Dinge über Klima- und Vegetationswandel. ....." weiter geht es bei Spon.
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:37 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
so Sandra Sieber, Professorin für Informationssysteme an der IESE Business School in Barcelona, in der FAZ. Diese Feststellung trifft auch für die Mehrheit der deutschen Archivierenden zu.
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:33 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6303440/
2. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6303828/
3. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6303983/
4. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6305220/
War es denn so schwer?
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:10 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 18:31 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 15:47 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/last_update/100/0
Darunter 2 Kopialbücher aus dem Kloster Wettingen im Staatsarchiv Aarau.
Darunter 2 Kopialbücher aus dem Kloster Wettingen im Staatsarchiv Aarau.
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 13:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sie finden ausführliche Berichte über folgende Veranstaltungen neu auf www.ordensarchive.at:
1. Workshop zum Thema „Rechtliche Fragen zur Matrikeneinsicht“ der Fachgruppe „Archive der Kirchen und staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften“ beim Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare mit Download des Vortrags von Mag. Ulrike Michel (Leiterin der Abteilung III/2 im Bundesministerium für Inneres)
2. Treffen der Bibliothekare der Stifte, Klöster und Orden, besonders betreffend das Bibliotheksprogramm DABIS
3. 14. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ordensarchive (AGOA)
Außerdem online: Einladung zum Steirischen Archivtag am Steiermärkischen Landesarchiv in Graz am 5. Mai 2010.
Wir dürfen weiters darauf hinweisen, dass am 30. April die Anmeldefrist für folgende Veranstaltungen endet:
1. Gemeinsame Jahrestagung der ARGE Diözesanarchive und der ARGE Ordensarchive Österreichs, 15.-17. Juni 2010, Stift St. Lambrecht
(Programm und Anmeldeformular auf www.ordensarchive.at und auf www.superiorenkonferenz.at – geschlossene Veranstaltung für DiözesanarchivarInnen und OrdensarchivarInnen Österreichs)
2. Grundkurs für Archivarinnen und Archivare, 6.-10. September, Wien, Österreichisches Staatsarchiv (Anmeldeunterlagen auf www.voea.at)
1. Workshop zum Thema „Rechtliche Fragen zur Matrikeneinsicht“ der Fachgruppe „Archive der Kirchen und staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften“ beim Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare mit Download des Vortrags von Mag. Ulrike Michel (Leiterin der Abteilung III/2 im Bundesministerium für Inneres)
2. Treffen der Bibliothekare der Stifte, Klöster und Orden, besonders betreffend das Bibliotheksprogramm DABIS
3. 14. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ordensarchive (AGOA)
Außerdem online: Einladung zum Steirischen Archivtag am Steiermärkischen Landesarchiv in Graz am 5. Mai 2010.
Wir dürfen weiters darauf hinweisen, dass am 30. April die Anmeldefrist für folgende Veranstaltungen endet:
1. Gemeinsame Jahrestagung der ARGE Diözesanarchive und der ARGE Ordensarchive Österreichs, 15.-17. Juni 2010, Stift St. Lambrecht
(Programm und Anmeldeformular auf www.ordensarchive.at und auf www.superiorenkonferenz.at – geschlossene Veranstaltung für DiözesanarchivarInnen und OrdensarchivarInnen Österreichs)
2. Grundkurs für Archivarinnen und Archivare, 6.-10. September, Wien, Österreichisches Staatsarchiv (Anmeldeunterlagen auf www.voea.at)
Helga Penz - am Dienstag, 27. April 2010, 11:24 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Gründer des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz, Reinhard Hippen, ist tot. Der Grafikdesigner starb am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren.
Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) würdigte Hippen in einer Mitteilung: "Reinhard Hippen hat fast fünfzig Jahre lang das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz bereichert. Als Gründer des Deutschen Kabarett-Archivs hat er in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland große Anerkennung erfahren.
Er war nicht nur ein engagierter Sammler und Chronist des Kabaretts, er liebte diese Kunstform und war ihr von Herzen zugetan. Das Kabarett hat er zu seiner Lebensaufgabe und Lebensleistung gemacht. Künstler und Kunstfreunde trauern um einen treuen, guten Freund."
Der in Leer/Ostfriesland geborene Hippen hatte das Deutsche Kabarettarchiv 1961 in Mainz gegründet, 1989 ging es an die Stadt über. Heute wird die "Stiftung Deutsches Kabarettarchiv" von der Stadt Mainz und vom Land Rheinland-Pfalz getragen, seit 1999 fördert auch der Bund die Einrichtung. Die Sammlung umfasst laut Mainzer Staatskanzlei mehr als 80 künstlerisch-dokumentarische Nachlässe und Materialien zu mehr als 80.000 Namen aus der Geschichte des Kabaretts.
Archivleiter Jürgen Kessler betonte, Hippen habe sich bis zuletzt aktiv unter anderem bei den Nominierungen für die Sterne auf dem "Walk of Fame der Satire" in Mainz eingebracht. Hippen lebte in einer Wohnung direkt über dem Archiv. Kessler sagte: "Wir trauern um einen leidenschaftlichen Sammler und Bewahrer, der sein Leben in den Dienst des von ihm so geliebten Kabaretts gestellt hat."
Quelle: SWR
" ..... Kessler kündigte an, das Mainzer Kabarettarchiv zu einem Museum umbauen zu wollen, in dem die Geschichte der Satire aufgezeigt werden soll. Das Museum feiert im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum. "
Quelle: Deutschlandradio kultur
Link zur mp3-Datei
Nachruf in der Allgemeinen Zeitung
Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) würdigte Hippen in einer Mitteilung: "Reinhard Hippen hat fast fünfzig Jahre lang das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz bereichert. Als Gründer des Deutschen Kabarett-Archivs hat er in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland große Anerkennung erfahren.
Er war nicht nur ein engagierter Sammler und Chronist des Kabaretts, er liebte diese Kunstform und war ihr von Herzen zugetan. Das Kabarett hat er zu seiner Lebensaufgabe und Lebensleistung gemacht. Künstler und Kunstfreunde trauern um einen treuen, guten Freund."
Der in Leer/Ostfriesland geborene Hippen hatte das Deutsche Kabarettarchiv 1961 in Mainz gegründet, 1989 ging es an die Stadt über. Heute wird die "Stiftung Deutsches Kabarettarchiv" von der Stadt Mainz und vom Land Rheinland-Pfalz getragen, seit 1999 fördert auch der Bund die Einrichtung. Die Sammlung umfasst laut Mainzer Staatskanzlei mehr als 80 künstlerisch-dokumentarische Nachlässe und Materialien zu mehr als 80.000 Namen aus der Geschichte des Kabaretts.
Archivleiter Jürgen Kessler betonte, Hippen habe sich bis zuletzt aktiv unter anderem bei den Nominierungen für die Sterne auf dem "Walk of Fame der Satire" in Mainz eingebracht. Hippen lebte in einer Wohnung direkt über dem Archiv. Kessler sagte: "Wir trauern um einen leidenschaftlichen Sammler und Bewahrer, der sein Leben in den Dienst des von ihm so geliebten Kabaretts gestellt hat."
Quelle: SWR
" ..... Kessler kündigte an, das Mainzer Kabarettarchiv zu einem Museum umbauen zu wollen, in dem die Geschichte der Satire aufgezeigt werden soll. Das Museum feiert im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum. "
Quelle: Deutschlandradio kultur
Link zur mp3-Datei
Nachruf in der Allgemeinen Zeitung
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 10:24 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://feeds.feedburner.com/actu_ad_france
http://latribunedesarchives.blogspot.com/2010/04/un-fils-rss-unique-pour-suivre.html
Den erbärmlichen Rückstand der deutschen Archivlandschaft in Sachen Internet beleuchtet der Umstand, dass man hierzulande überhaupt noch nicht kapiert hat, was RSS ist und leistet.

http://latribunedesarchives.blogspot.com/2010/04/un-fils-rss-unique-pour-suivre.html
Den erbärmlichen Rückstand der deutschen Archivlandschaft in Sachen Internet beleuchtet der Umstand, dass man hierzulande überhaupt noch nicht kapiert hat, was RSS ist und leistet.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Article on Open Access and responses, temporarily free at
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g920250275~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g920250275~db=all
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 02:09 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=2242
http://pantonprinciples.org/faq/#q1-what-are-the-panton-principles
http://pantonprinciples.org/faq/#q1-what-are-the-panton-principles
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 02:07 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ.
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 01:50 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.histnet.ch/archives/3723
"Der Inhalt unterliegt der Creative Commons-Lizenz 2.0: attribution, non-profit, share-alike."
Die werten alpenländischen Bloggerkollegen blasen sich aus meines Erachtens nichtigem Anlass wegen einer ihnen nicht genehmen Nachnutzung auf. Ich möchte ihrer Interpretation der CC-Lizenz meine eigene entgegensetzen, die sich auf viele Jahre intensiver Befassung mit den Rechtsfragen freier Lizenzen stützen kann.
"Wenn Sie den Schutzgegenstand oder eine Bearbeitung oder ein Sammelwerk vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, müssen Sie alle Urhebervermerke für den Schutzgegenstand unverändert lassen und die Urheberschaft oder Rechtsinhaberschaft in einer der von Ihnen vorgenommenen Nutzung angemessenen Form anerkennen, indem Sie den Namen (oder das Pseudonym, falls ein solches verwendet wird) des Urhebers oder Rechteinhabers nennen, wenn dieser angegeben ist. Dies gilt auch für den Titel des Schutzgegenstandes, wenn dieser angeben ist, sowie - in einem vernünftigerweise durchführbaren Umfang - für die mit dem Schutzgegenstand zu verbindende Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI), wie sie der Lizenzgeber angegeben hat, sofern dies geschehen ist, es sei denn, diese Internetadresse verweist nicht auf den Urhebervermerk oder die Lizenzinformationen zu dem Schutzgegenstand."
Der Lizenzgeber muss bei der Lizenz deutlich machen, in welcher Form er eine Attribution wünscht. Keinesfalls darf die zitierte Passage so verstanden werden, als müsse in jedem Fall die Internetadresse des Beitrags genannt werden. Nur wenn der Lizenzgeber unmissverständlich deutlich gemacht hat, welche Internetadresse er als Teil des Urhebervermerks versteht, ist diese als Teil der Attribution zu nennen.
Wenn ich ein CC-Foto verwende, das von Flickr stammt und das ich in Wikimedia Commons gefunden habe, bin ich nach meiner Rechtsauffassung überhaupt nicht verpflichtet außer dem Hinweis auf den Urheber (Fotografen) und der Verlinkung der Lizenz noch eine weitere Quell-Internetadresse anzugeben. Dies ergibt sich aus dem sonst sinnlosen "sofern dies geschehen ist" und dem Zusatz "es sei denn, diese Internetadresse verweist nicht auf den Urhebervermerk oder die Lizenzinformationen zu dem Schutzgegenstand" in der reichlich hölzernen Übersetzung.
Natürlich wirds wie so oft im Englischen deutlicher: "If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work" (Hervorhebung von mir).
Da es sich um eine Übersetzung handelt, ist die Originalversion für die Auslegung der Klausel ausschlaggebend. Und demzufolge bedarf es einer Mitteilung des Lizenzgebers an den Nutzer, die tunlichst beim Urheber- bzw. Lizenzvermerk zu stehen hat, wenn er möchte, dass man auch eine Internetadresse angibt. Zusätzlich muss diese Adresse auf den Urheberrechtsvermerk und die Lizenzangaben verweisen, was man im Sinne des Urhebers nicht zu streng nehmen sollte.
Wir halten also fest:
Die Angabe einer Internetadresse ist aus Gründen sauberer Blogger-Praxis dringend wünschenswert; eine Rechtspflicht besteht nur dann, wenn die Adresse ausdrücklich spezifiziert wurde.
Überzogen erscheint auch die Auslegung von "Durch die Ausübung Ihrer Rechte aus dieser Lizenz dürfen Sie ohne eine vorherige, separat und schriftlich vorliegende Zustimmung des Lizenzgebers und / oder des Zuschreibungsempfängers weder explizit noch implizit irgendeine Verbindung zum Lizenzgeber oder Zuschreibungsempfänger und ebenso wenig eine Unterstützung oder Billigung durch ihn andeuten." Es ist Sinn der CC-Lizenz, dass Inhalte weiterverbreitet werden, solange dies lizenzkonform passiert. Es ist übertrieben zu fordern, dass man klarstellen muss, dass der Inhalt nicht für das übernehmende Medium geschrieben wurde. Bei der Annahme einer - juristisch gesprochen - Herkunftstäuschung wäre ich bei CC-Lizenzen vorsichtig. Nur wenn eindeutig etwas Falsches suggeriert wird, sehe ich einen Lizenzverstoß.
Fazit: Wer CC-Lizenzen verwendet, sollte sich soweit mit ihnen befassen, dass er seine Nachnutzer nicht durch frei erfundene Lizenz-Auslegungen schikaniert!

"Der Inhalt unterliegt der Creative Commons-Lizenz 2.0: attribution, non-profit, share-alike."
Die werten alpenländischen Bloggerkollegen blasen sich aus meines Erachtens nichtigem Anlass wegen einer ihnen nicht genehmen Nachnutzung auf. Ich möchte ihrer Interpretation der CC-Lizenz meine eigene entgegensetzen, die sich auf viele Jahre intensiver Befassung mit den Rechtsfragen freier Lizenzen stützen kann.
"Wenn Sie den Schutzgegenstand oder eine Bearbeitung oder ein Sammelwerk vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, müssen Sie alle Urhebervermerke für den Schutzgegenstand unverändert lassen und die Urheberschaft oder Rechtsinhaberschaft in einer der von Ihnen vorgenommenen Nutzung angemessenen Form anerkennen, indem Sie den Namen (oder das Pseudonym, falls ein solches verwendet wird) des Urhebers oder Rechteinhabers nennen, wenn dieser angegeben ist. Dies gilt auch für den Titel des Schutzgegenstandes, wenn dieser angeben ist, sowie - in einem vernünftigerweise durchführbaren Umfang - für die mit dem Schutzgegenstand zu verbindende Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI), wie sie der Lizenzgeber angegeben hat, sofern dies geschehen ist, es sei denn, diese Internetadresse verweist nicht auf den Urhebervermerk oder die Lizenzinformationen zu dem Schutzgegenstand."
Der Lizenzgeber muss bei der Lizenz deutlich machen, in welcher Form er eine Attribution wünscht. Keinesfalls darf die zitierte Passage so verstanden werden, als müsse in jedem Fall die Internetadresse des Beitrags genannt werden. Nur wenn der Lizenzgeber unmissverständlich deutlich gemacht hat, welche Internetadresse er als Teil des Urhebervermerks versteht, ist diese als Teil der Attribution zu nennen.
Wenn ich ein CC-Foto verwende, das von Flickr stammt und das ich in Wikimedia Commons gefunden habe, bin ich nach meiner Rechtsauffassung überhaupt nicht verpflichtet außer dem Hinweis auf den Urheber (Fotografen) und der Verlinkung der Lizenz noch eine weitere Quell-Internetadresse anzugeben. Dies ergibt sich aus dem sonst sinnlosen "sofern dies geschehen ist" und dem Zusatz "es sei denn, diese Internetadresse verweist nicht auf den Urhebervermerk oder die Lizenzinformationen zu dem Schutzgegenstand" in der reichlich hölzernen Übersetzung.
Natürlich wirds wie so oft im Englischen deutlicher: "If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work" (Hervorhebung von mir).
Da es sich um eine Übersetzung handelt, ist die Originalversion für die Auslegung der Klausel ausschlaggebend. Und demzufolge bedarf es einer Mitteilung des Lizenzgebers an den Nutzer, die tunlichst beim Urheber- bzw. Lizenzvermerk zu stehen hat, wenn er möchte, dass man auch eine Internetadresse angibt. Zusätzlich muss diese Adresse auf den Urheberrechtsvermerk und die Lizenzangaben verweisen, was man im Sinne des Urhebers nicht zu streng nehmen sollte.
Wir halten also fest:
Die Angabe einer Internetadresse ist aus Gründen sauberer Blogger-Praxis dringend wünschenswert; eine Rechtspflicht besteht nur dann, wenn die Adresse ausdrücklich spezifiziert wurde.
Überzogen erscheint auch die Auslegung von "Durch die Ausübung Ihrer Rechte aus dieser Lizenz dürfen Sie ohne eine vorherige, separat und schriftlich vorliegende Zustimmung des Lizenzgebers und / oder des Zuschreibungsempfängers weder explizit noch implizit irgendeine Verbindung zum Lizenzgeber oder Zuschreibungsempfänger und ebenso wenig eine Unterstützung oder Billigung durch ihn andeuten." Es ist Sinn der CC-Lizenz, dass Inhalte weiterverbreitet werden, solange dies lizenzkonform passiert. Es ist übertrieben zu fordern, dass man klarstellen muss, dass der Inhalt nicht für das übernehmende Medium geschrieben wurde. Bei der Annahme einer - juristisch gesprochen - Herkunftstäuschung wäre ich bei CC-Lizenzen vorsichtig. Nur wenn eindeutig etwas Falsches suggeriert wird, sehe ich einen Lizenzverstoß.
Fazit: Wer CC-Lizenzen verwendet, sollte sich soweit mit ihnen befassen, dass er seine Nachnutzer nicht durch frei erfundene Lizenz-Auslegungen schikaniert!

http://www.tagesspiegel.de/wissen/bibliothek-zu-voll-hu-quotiert-plaetze/1805858.html
Ein weiterer Grund, auf die Digitalisierung zu setzen! Bibliotheken machen nur dann Spaß, wenn sie gute Arbeitsbedingungen bieten.
Ein weiterer Grund, auf die Digitalisierung zu setzen! Bibliotheken machen nur dann Spaß, wenn sie gute Arbeitsbedingungen bieten.
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 00:56 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Stefan Guzy: Bestandsübersicht der Aktenüberlieferung schlesischer Amtsgerichte bis 1945. Ein Beitrag zur Verzeichnung personengeschichtlicher Quellen Schlesiens, in: Schlesische Geschichtsblätter 37 (2010), Heft 1, S. 20-30. Der fleißige Beitrag weist die Überlieferung der ehemals preußisch-schlesischen Amtsgerichte in deutschen, polnischen und tschechischen Archiven nach. Wünschenswert wäre, dass diese insbesondere für die genealogische Forschung nützliche Zusammenstellung auch online (z.B. im GenWiki) verfügbar wäre.
KlausGraf - am Dienstag, 27. April 2010, 00:11 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Digital Scriptorium, the University of California, Berkeley, and
Columbia University announce the return of the Digital Scriptorium to its
original home at Berkeley.
The Digital Scriptorium is an image and cataloguing database that unites the
medieval and Renaissance manuscript holdings of a growing number of American
libraries. It began in 1997 with the combined resources of Berkeley and
Columbia; present membership includes thirty institutions with over 5000
manuscripts and 27,000 images, all freely available on the web. Member
institutions include the Huntington Library, New York Public Library, the
Houghton Library at Harvard, and the Ransom Center at the University of Texas.
"We look forward to expanding the membership of the Digital Scriptorium and
to developing its Web 2.0 capabilities," says Thomas C. Leonard, University
Librarian at Berkeley. "Since the base technology for the project originated
on this campus, we are confident that the expertise of our staff will
re-integrate the program smoothly into our present system, and that we will
make the Digital Scriptorium even more useful to medievalists."
During its six-year tenure as host to the Digital Scriptorium, Columbia also
contributed to the database's increasing strength. James G. Neal, Columbia's
University Librarian, adds that "extensive work was carried out by our
Libraries Digital Program Division to build a highly specific scholarly
search engine, and the coverage of the database was significantly expanded."
Columbia's Curator of Medieval and Renaissance Manuscripts, Consuelo
Dutschke, was re-elected in the annual Digital Scriptorium members' meeting
to a second term as Executive Director; she will retain that post until
September 2012.
The new URL for Digital Scriptorium, http://www.digital-scriptorium.org
currently directs users to the Columbia site; when the transfer to Berkeley
is completed in January of 2011, it will point seamlessly to Berkeley servers.

Columbia University announce the return of the Digital Scriptorium to its
original home at Berkeley.
The Digital Scriptorium is an image and cataloguing database that unites the
medieval and Renaissance manuscript holdings of a growing number of American
libraries. It began in 1997 with the combined resources of Berkeley and
Columbia; present membership includes thirty institutions with over 5000
manuscripts and 27,000 images, all freely available on the web. Member
institutions include the Huntington Library, New York Public Library, the
Houghton Library at Harvard, and the Ransom Center at the University of Texas.
"We look forward to expanding the membership of the Digital Scriptorium and
to developing its Web 2.0 capabilities," says Thomas C. Leonard, University
Librarian at Berkeley. "Since the base technology for the project originated
on this campus, we are confident that the expertise of our staff will
re-integrate the program smoothly into our present system, and that we will
make the Digital Scriptorium even more useful to medievalists."
During its six-year tenure as host to the Digital Scriptorium, Columbia also
contributed to the database's increasing strength. James G. Neal, Columbia's
University Librarian, adds that "extensive work was carried out by our
Libraries Digital Program Division to build a highly specific scholarly
search engine, and the coverage of the database was significantly expanded."
Columbia's Curator of Medieval and Renaissance Manuscripts, Consuelo
Dutschke, was re-elected in the annual Digital Scriptorium members' meeting
to a second term as Executive Director; she will retain that post until
September 2012.
The new URL for Digital Scriptorium, http://www.digital-scriptorium.org
currently directs users to the Columbia site; when the transfer to Berkeley
is completed in January of 2011, it will point seamlessly to Berkeley servers.

KlausGraf - am Montag, 26. April 2010, 21:18 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 26. April 2010, 20:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2007 schrieb ich unter diesem Titel einen Beitrag, der dafür plädierte, Bücher zu verschenken statt zu vernichten:
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/
Für aktualisierende Hinweise wäre ich dankbar.
 Foto: JochenB
Foto: JochenB
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/
Für aktualisierende Hinweise wäre ich dankbar.
 Foto: JochenB
Foto: JochenB Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 26. April 2010, 17:52 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.uni-muenster.de/Rektorat/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=0&monat=201001&nummer=12465 (14.1.2010)
Knapp 7.000 alte Bücher aus den Klosterbibliotheken Münster, Werne und Koblenz sind Gegenstand der Übereinkunft - darunter 96 Inkunabeln, das heißt, alte Drucke aus der Zeit bis 1530. Sie werden als Leihgabe mindestens für die nächsten dreißig Jahre ihre neue Heimstatt in den Sondermagazinen der ULB finden. Neben der Aufbewahrung und Erhaltung der Bücher erschließt die ULB die Bestände auch nach geltenden Regeln, so dass sie über die Recherche in Katalogen auch für die Forschung zugänglich sind. Eine Auswahl der Bücher soll zudem auch elektronisch verfügbar gemacht werden.
Die Werke der Kapuzinerbibliothek spiegeln das Bildungsinteresse und den Bildungshorizont der Kapuziner wider. „Ihr Denken und Spiritualität der Kapuziner lässt sich gut aus diesen Büchern herleiten", meint Reinhard Feldmann, Leiter des Dezernats Historische Bestände in der ULB. Insbesondere für interdisziplinäre Studien sieht der Buch-Experte Feldmann im Bestand der Kapuzinerbibliotheken wertvolle Quellen - zum Beispiel für die Forscher am Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne".
Unter den Werken befindet sich eine Abhandlung über die Tibetische Mission aus dem Jahr 1740 ebenso wie ein Psalter in sieben verschiedenen Sprachen mit Kommentar von 1516 zur wissenschaftlichen Arbeit und eine Kirchengeschichte aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der durch einen besonders schönen Holzdeckeleinband aus der Renaissancezeit auffällt. Ein Buch von Dionysius von Luxemburg (1652 - 1702), einem herausragenden Predigern der rheinischen Kapuzinerprovinz, fällt nicht nur durch seine bemerkenswerte äußere Ausstattung auf. Drastisch werden hier in deutlichen Worten die Strafen für Verfehlungen aufgezeigt: „Wilstu ohn Todes Schrecken leben, Dich keinem Laster thu ergeben".
Zum Thema hier
http://archiv.twoday.net/search?q=kapuziner
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
Knapp 7.000 alte Bücher aus den Klosterbibliotheken Münster, Werne und Koblenz sind Gegenstand der Übereinkunft - darunter 96 Inkunabeln, das heißt, alte Drucke aus der Zeit bis 1530. Sie werden als Leihgabe mindestens für die nächsten dreißig Jahre ihre neue Heimstatt in den Sondermagazinen der ULB finden. Neben der Aufbewahrung und Erhaltung der Bücher erschließt die ULB die Bestände auch nach geltenden Regeln, so dass sie über die Recherche in Katalogen auch für die Forschung zugänglich sind. Eine Auswahl der Bücher soll zudem auch elektronisch verfügbar gemacht werden.
Die Werke der Kapuzinerbibliothek spiegeln das Bildungsinteresse und den Bildungshorizont der Kapuziner wider. „Ihr Denken und Spiritualität der Kapuziner lässt sich gut aus diesen Büchern herleiten", meint Reinhard Feldmann, Leiter des Dezernats Historische Bestände in der ULB. Insbesondere für interdisziplinäre Studien sieht der Buch-Experte Feldmann im Bestand der Kapuzinerbibliotheken wertvolle Quellen - zum Beispiel für die Forscher am Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne".
Unter den Werken befindet sich eine Abhandlung über die Tibetische Mission aus dem Jahr 1740 ebenso wie ein Psalter in sieben verschiedenen Sprachen mit Kommentar von 1516 zur wissenschaftlichen Arbeit und eine Kirchengeschichte aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der durch einen besonders schönen Holzdeckeleinband aus der Renaissancezeit auffällt. Ein Buch von Dionysius von Luxemburg (1652 - 1702), einem herausragenden Predigern der rheinischen Kapuzinerprovinz, fällt nicht nur durch seine bemerkenswerte äußere Ausstattung auf. Drastisch werden hier in deutlichen Worten die Strafen für Verfehlungen aufgezeigt: „Wilstu ohn Todes Schrecken leben, Dich keinem Laster thu ergeben".
Zum Thema hier
http://archiv.twoday.net/search?q=kapuziner
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu http://archiv.twoday.net/stories/6304600/
"Stellungnahme Büchervernichtung
Märkischer Kreis. (pmk) Die Landeskundliche Bibliothek des Märkischen Kreises, gegründet 1875, erwirbt und bewahrt Publikationen über das Gebiet der ehemaligen Grafschaft Mark sowie den Märkischen Kreis und seine 15 Städte und Gemeinden. Aber auch das, was an grundlegenden Werken außerhalb der Grenzen des Märkischen Kreises publiziert wird, ist von Bedeutung, ebenso wichtige Veröffentlichungen zur Geschichte Westfalens, welche die Landeskundliche Bibliothek ihren Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stellt. Von herausragender Qualität ist ihr umfangreicher Bestand an regionaler grauer Literatur. Sie ist damit eine der größten und bedeutendsten Spezialbibliotheken dieser Art in Westfalen.
Angesichts dieser langen Tradition hat sich der Buchbestand der Landeskundlichen Bibliothek kontinuierlich vergrößert und umfasst aktuell rund 110.000 Bände sowie mehr als 450 laufende Meter Zeitschriften. In den 130 Jahren ihres Bestehens sind indes zahlreiche Publikationen in den Bestand gelangt, die inhaltlich nicht in die Spezialbibliothek passen. Darüber hinaus ist in den vergangenen Jahrzehnten die Verwaltungsliteratur in einem physisch und inhaltlich nicht mehr vertretbaren Maße gewachsen. Deshalb hat sich der Märkische Kreis dazu entschlossen, den Buchbestand einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und sich von verzichtbaren Büchern zu trennen.
Parallel zu der Entscheidung, den Sammlungsschwerpunkt auf die Region der ehemaligen Grafschaft Mark, den Märkischen Kreis und die Region Südwestfalen zu konzentrieren, sind statische Probleme in dem 1908 errichteten ehemaligen Landratsamt in Altena zu Tage getreten, in dem die Landeskundliche Bibliothek ihre Besucherinnen und Besucher willkommen heißt und wo auch die Buchmagazine untergebracht sind. Somit besteht ein akuter Handlungsbedarf.
Die der Vernichtung zugeführte veraltete Verwaltungsliteratur ist zuvor regionalen Institutionen zur Abgabe angeboten worden, mehrfach vorhandene, gut erhaltene Bücher mit landeskundlichen Inhalten werden zusammen mit Altbeständen des Heimatbunds Märkischer Kreis am 29.05.2010 im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ kostenlos an Interessierte abgegeben.
Zu der ausgesonderten landeskundlichen Literatur gehören auch Bücher aus den Nachlässen Emil Dösseler und Dietrich Woeste. Diese wurden zuvor sorgfältig mit dem Kernbestand der Landeskundlichen Bibliothek abgeglichen und die Exemplare übernommen, die den Bestand ergänzen bzw. die gut erhalten sind. Die aussortierten Bücher sollten vor der Verteilaktion am 29. Mai mit einem Entwertungsstempel versehen werden. Irrtümlicherweise sind diese Bücherkartons jedoch in die Charge derjenigen geraten, die vernichtet werden sollten.
Die Archivbestände Emil Dösseler und Dietrich Woeste befinden sich weiterhin vollständig im Besitz des Kreisarchivs und sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Welch hohen Stellenwert die Landeskundliche Bibliothek dem Thema Familienforschung beimisst, belegen die in den vergangenen Jahren erfolgreichen und viel besuchten „Tage der Familienforschung“. Die aktuelle „Bunte Liste Genealogie“ ist im Internet abrufbar (www.maerkischer-kreis.de/kultur) oder kann kostenlos angefordert werden unter: Märkischer Kreis, Fachdienst Kultur, Kreisarchiv und Landeskundliche Bibliothek, Bismarckstraße 15, 58762 Altena, Tel. 02352 9667053, E-Mail: k.mueller@maerkischer-kreis.de. " (Hervorhebung von mir)
Die ganze Sache stinkt aus meiner Sicht zum Himmel. Wenn Frau Dr. Todrowski erklärte, die Bücher stammten nicht aus dem Kreisarchiv, hat sie demnach gelogen. Und wenn sie in der Presse zitiert wurde mit „Den Band von Schücking und Freiligrath würden wir doch nie aus der Hand geben. Und die Bände Süderland-Heimatland von 1926 bis 1935 hätte ich gerne – bei uns gibt es sie nämlich nicht.“, dann kann ja wohl von einem sorgfältigen Abgleich keine Rede sein.
"Stellungnahme Büchervernichtung
Märkischer Kreis. (pmk) Die Landeskundliche Bibliothek des Märkischen Kreises, gegründet 1875, erwirbt und bewahrt Publikationen über das Gebiet der ehemaligen Grafschaft Mark sowie den Märkischen Kreis und seine 15 Städte und Gemeinden. Aber auch das, was an grundlegenden Werken außerhalb der Grenzen des Märkischen Kreises publiziert wird, ist von Bedeutung, ebenso wichtige Veröffentlichungen zur Geschichte Westfalens, welche die Landeskundliche Bibliothek ihren Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stellt. Von herausragender Qualität ist ihr umfangreicher Bestand an regionaler grauer Literatur. Sie ist damit eine der größten und bedeutendsten Spezialbibliotheken dieser Art in Westfalen.
Angesichts dieser langen Tradition hat sich der Buchbestand der Landeskundlichen Bibliothek kontinuierlich vergrößert und umfasst aktuell rund 110.000 Bände sowie mehr als 450 laufende Meter Zeitschriften. In den 130 Jahren ihres Bestehens sind indes zahlreiche Publikationen in den Bestand gelangt, die inhaltlich nicht in die Spezialbibliothek passen. Darüber hinaus ist in den vergangenen Jahrzehnten die Verwaltungsliteratur in einem physisch und inhaltlich nicht mehr vertretbaren Maße gewachsen. Deshalb hat sich der Märkische Kreis dazu entschlossen, den Buchbestand einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und sich von verzichtbaren Büchern zu trennen.
Parallel zu der Entscheidung, den Sammlungsschwerpunkt auf die Region der ehemaligen Grafschaft Mark, den Märkischen Kreis und die Region Südwestfalen zu konzentrieren, sind statische Probleme in dem 1908 errichteten ehemaligen Landratsamt in Altena zu Tage getreten, in dem die Landeskundliche Bibliothek ihre Besucherinnen und Besucher willkommen heißt und wo auch die Buchmagazine untergebracht sind. Somit besteht ein akuter Handlungsbedarf.
Die der Vernichtung zugeführte veraltete Verwaltungsliteratur ist zuvor regionalen Institutionen zur Abgabe angeboten worden, mehrfach vorhandene, gut erhaltene Bücher mit landeskundlichen Inhalten werden zusammen mit Altbeständen des Heimatbunds Märkischer Kreis am 29.05.2010 im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ kostenlos an Interessierte abgegeben.
Zu der ausgesonderten landeskundlichen Literatur gehören auch Bücher aus den Nachlässen Emil Dösseler und Dietrich Woeste. Diese wurden zuvor sorgfältig mit dem Kernbestand der Landeskundlichen Bibliothek abgeglichen und die Exemplare übernommen, die den Bestand ergänzen bzw. die gut erhalten sind. Die aussortierten Bücher sollten vor der Verteilaktion am 29. Mai mit einem Entwertungsstempel versehen werden. Irrtümlicherweise sind diese Bücherkartons jedoch in die Charge derjenigen geraten, die vernichtet werden sollten.
Die Archivbestände Emil Dösseler und Dietrich Woeste befinden sich weiterhin vollständig im Besitz des Kreisarchivs und sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Welch hohen Stellenwert die Landeskundliche Bibliothek dem Thema Familienforschung beimisst, belegen die in den vergangenen Jahren erfolgreichen und viel besuchten „Tage der Familienforschung“. Die aktuelle „Bunte Liste Genealogie“ ist im Internet abrufbar (www.maerkischer-kreis.de/kultur) oder kann kostenlos angefordert werden unter: Märkischer Kreis, Fachdienst Kultur, Kreisarchiv und Landeskundliche Bibliothek, Bismarckstraße 15, 58762 Altena, Tel. 02352 9667053, E-Mail: k.mueller@maerkischer-kreis.de. " (Hervorhebung von mir)
Die ganze Sache stinkt aus meiner Sicht zum Himmel. Wenn Frau Dr. Todrowski erklärte, die Bücher stammten nicht aus dem Kreisarchiv, hat sie demnach gelogen. Und wenn sie in der Presse zitiert wurde mit „Den Band von Schücking und Freiligrath würden wir doch nie aus der Hand geben. Und die Bände Süderland-Heimatland von 1926 bis 1935 hätte ich gerne – bei uns gibt es sie nämlich nicht.“, dann kann ja wohl von einem sorgfältigen Abgleich keine Rede sein.
KlausGraf - am Montag, 26. April 2010, 14:30 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://historischesarchivkoeln.de/
Dies sind nahezu alle Wallraf-Handschriften (Best. 7010) und Sonstige Handschriften (Best. 7020). Insgesamt sind damit über 700 Handschriften mit ca. 90.000 Einzelbildern im Digitalen Archiv verfügbar. Damit wurde die Gesamtzahl der Einträge an einem Tag verzehnfacht.
Beispiel für die Wiedergabequalität:
http://historischesarchivkoeln.de/documents/org/1181838.jpg

Dies sind nahezu alle Wallraf-Handschriften (Best. 7010) und Sonstige Handschriften (Best. 7020). Insgesamt sind damit über 700 Handschriften mit ca. 90.000 Einzelbildern im Digitalen Archiv verfügbar. Damit wurde die Gesamtzahl der Einträge an einem Tag verzehnfacht.
Beispiel für die Wiedergabequalität:
http://historischesarchivkoeln.de/documents/org/1181838.jpg

KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 23:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00042520/image_87
(Kann nicht jemand der BSB Bescheid sagen, dass es superdämlich ist, einen Zitier-Permalink fürs Kopieren mit der rechten Maustaste zu blockieren? )
(Kann nicht jemand der BSB Bescheid sagen, dass es superdämlich ist, einen Zitier-Permalink fürs Kopieren mit der rechten Maustaste zu blockieren? )
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 17:04 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 16:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.freitag.de/politik/1016-wie-der-blauflossenthunfisch
Zur Autorin: "Eva-Maria Schnurr ist freie Wissenschaftsjournalistin in Hamburg. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Freischreiber e.V., Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten. Sie hat an diesem Beitrag 16 Stunden gearbeitet und dafür 125 Euro erhalten."
Zur Autorin: "Eva-Maria Schnurr ist freie Wissenschaftsjournalistin in Hamburg. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Freischreiber e.V., Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten. Sie hat an diesem Beitrag 16 Stunden gearbeitet und dafür 125 Euro erhalten."
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 16:47 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 15:32 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es stehen auch acht deutschsprachige Titel zur Einsicht aufgrund der Partnerschaft mit der Cinémathèque bereit:
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=1458

http://blog.bnf.fr/gallica/?p=1458

KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 15:24 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
vom hofe - am Sonntag, 25. April 2010, 12:32 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://cd.dgb.uanl.mx
Die Suche nach leipzig und berlin ergibt einige Treffer (wobei die Metadaten natürlich inakzeptabel sind).
(Weiteres: unter humboldt)
Título: Breve descripción de la República de Chile. Escrita según datos principales con un mapa y 36 grabados.
Pie de imprenta: Leipzig: Imprenta de F.A. Brockhaus, 1901
Materia: Chile.
Número de control (Bibid): 66810
Ver documento
Título: Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, compléte, dans les principales matieres, par des apercus historiques et politiques / par Herri Ahrens
Autor: Ahrens, Heinrich, 1808-1874.
Pie de imprenta: Leipzig: F. A. Brockhaus, 1868
Materia: Derecho natural. / Derecho -- Filosofía.
Número de control (Bibid): 70432
Ver documento
Título: Das wasser: eine Darstellung Tur gebildete leser und Leserinnen / von E.A. Rossmaessler.
Autor: Rossmaessler, Emil Adolf, 1806-1867.
Pie de imprenta: Leipzig: F. Brandstetter, 1860
Materia: Agua.
Número de control (Bibid): 82388
Ver documento
Título: Die Nibelungen ; e in deuts hes trauerspiel in drei abteilunget von Friedrich Gebbel
Pie de imprenta: Leipzig : P. Reclam
Número de control (Bibid): UANL000171612
Ver documento
Título: Homers Odyssee : im auszuge ; In never ubersetzung ; herausge geben von Oskar Hubatsch
Autor: Homero.
Pie de imprenta: Vielefeld, Leipzig : Velhagen & Kalfing
Número de control (Bibid): UANL000169639
Ver documento
Título: Italie meridionale, Sicile Sardaigne et excursions a Malte Tunis et Corfou : Manuel du Voyager / Karl Baedeker.
Autor: Baedeker, Karl.
Pie de imprenta: Leipzig : Karl Baedeker, 1900
Materia: Italia -- Descripción y viajes.
Número de control (Bibid): 64062
Ver documento
Título: Leuthen Blattor der Crinnerung an den grofen konig und das Jahr 1757 / van Theodor Rehtwisch.
Autor: Rehtwisch, Theodor 1864-
Pie de imprenta: Leipzig : Georg Wigand, 1907
Número de control (Bibid): UANL000176499
Ver documento
Título: Nouvelle méthode pratique et facile pour apprendre la langue anglaise / composée d'après les principes de F. Ahn par Charles Graeser. Premier cours.
Autor: Graeser, Karl.
Pie de imprenta: Leipzig : F.A. Brockhaus, 1885.
Materia: Inglés Textos para extranjeros, Francés.
Número de control (Bibid): UANL001007793
Ver documento
Título: Paris et ses environs ; Manauel de Voyageur / par K. Baedeker.
Autor: Baedeker, Karl
Pie de imprenta: Leipzig : K. Baedeker, 1884
Materia: París -- Descripción -- Guías de viajeros.
Número de control (Bibid): 17397
Ver documento
***
Título: Códice Aubin: manuscrito azteca de la Biblioteca Real de Berlín, anales en mexicano y jeroglíficos desde la salida de las Tribus de Aztlán hasta la muerte de Cuauhtémoc.
Autor: Códice Aubin
Pie de imprenta: México: Of. Tip. de la Secretaría de Fomento, 1902
Materia: Indios de México -- Historia -- Fuentes. / México -- Historia -- Hasta 1519 -- Fuentes.
Número de control (Bibid): 78516
Ver documento
Título: Der Wilde Jager : fine waidmannsmar / von Julius Wolff
Autor: Wolff, Julius, 1834-1910.
Pie de imprenta: Berlin : G. Grote : 1888
Número de control (Bibid): 82437
Ver documento
Título: Gesangsunterricht übungen für die Frauen-Stimme für ihre Schülerinnen verfafst von Pauline Viardot-Garcia; deutsch von Ferd. Gumbert
Autor: Viardot García, Paulina, 1821-1910.
Pie de imprenta: Berlin Ed. Bote & G. Bock, [s.a.]
Materia: Canto -- Instrucción y estudio.
Número de control (Bibid): UANL000211266
Ver documento
Título: Herne buch der lieder
Autor: Heine, Heinrich, 1797-1856.
Pie de imprenta: Berlín : Deutsche Bibliotet in Berlín, 1939
Número de control (Bibid): 82239
Ver documento
Título: Quatro conts experiences de physique, mecanique, acoustigue, chaleur, oetique, electricite : livre d'exercices en rapport avoc la cassettea experience
Autor: Merser & Mortig.
Pie de imprenta: Berlin : Leonard Simion, 1891
Materia: Física. / Física -- Experimentos.
Número de control (Bibid): 9376
Ver documento
Título: The merchant of berlin ; an historical novel / by L. Muhlbach (pseud) ; tr. from the german by Amory Coffin
Autor: Mundt, Frau Klara Muller, 1814-1873.
Pie de imprenta: New York : A.L. Fowler, Publisher, 1905.
Materia: Guerra de los cien años, 1756-1763 - Novela.
Número de control (Bibid): UANL000171642
Ver documento
Die Suche nach leipzig und berlin ergibt einige Treffer (wobei die Metadaten natürlich inakzeptabel sind).
(Weiteres: unter humboldt)
Título: Breve descripción de la República de Chile. Escrita según datos principales con un mapa y 36 grabados.
Pie de imprenta: Leipzig: Imprenta de F.A. Brockhaus, 1901
Materia: Chile.
Número de control (Bibid): 66810
Ver documento
Título: Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, compléte, dans les principales matieres, par des apercus historiques et politiques / par Herri Ahrens
Autor: Ahrens, Heinrich, 1808-1874.
Pie de imprenta: Leipzig: F. A. Brockhaus, 1868
Materia: Derecho natural. / Derecho -- Filosofía.
Número de control (Bibid): 70432
Ver documento
Título: Das wasser: eine Darstellung Tur gebildete leser und Leserinnen / von E.A. Rossmaessler.
Autor: Rossmaessler, Emil Adolf, 1806-1867.
Pie de imprenta: Leipzig: F. Brandstetter, 1860
Materia: Agua.
Número de control (Bibid): 82388
Ver documento
Título: Die Nibelungen ; e in deuts hes trauerspiel in drei abteilunget von Friedrich Gebbel
Pie de imprenta: Leipzig : P. Reclam
Número de control (Bibid): UANL000171612
Ver documento
Título: Homers Odyssee : im auszuge ; In never ubersetzung ; herausge geben von Oskar Hubatsch
Autor: Homero.
Pie de imprenta: Vielefeld, Leipzig : Velhagen & Kalfing
Número de control (Bibid): UANL000169639
Ver documento
Título: Italie meridionale, Sicile Sardaigne et excursions a Malte Tunis et Corfou : Manuel du Voyager / Karl Baedeker.
Autor: Baedeker, Karl.
Pie de imprenta: Leipzig : Karl Baedeker, 1900
Materia: Italia -- Descripción y viajes.
Número de control (Bibid): 64062
Ver documento
Título: Leuthen Blattor der Crinnerung an den grofen konig und das Jahr 1757 / van Theodor Rehtwisch.
Autor: Rehtwisch, Theodor 1864-
Pie de imprenta: Leipzig : Georg Wigand, 1907
Número de control (Bibid): UANL000176499
Ver documento
Título: Nouvelle méthode pratique et facile pour apprendre la langue anglaise / composée d'après les principes de F. Ahn par Charles Graeser. Premier cours.
Autor: Graeser, Karl.
Pie de imprenta: Leipzig : F.A. Brockhaus, 1885.
Materia: Inglés Textos para extranjeros, Francés.
Número de control (Bibid): UANL001007793
Ver documento
Título: Paris et ses environs ; Manauel de Voyageur / par K. Baedeker.
Autor: Baedeker, Karl
Pie de imprenta: Leipzig : K. Baedeker, 1884
Materia: París -- Descripción -- Guías de viajeros.
Número de control (Bibid): 17397
Ver documento
***
Título: Códice Aubin: manuscrito azteca de la Biblioteca Real de Berlín, anales en mexicano y jeroglíficos desde la salida de las Tribus de Aztlán hasta la muerte de Cuauhtémoc.
Autor: Códice Aubin
Pie de imprenta: México: Of. Tip. de la Secretaría de Fomento, 1902
Materia: Indios de México -- Historia -- Fuentes. / México -- Historia -- Hasta 1519 -- Fuentes.
Número de control (Bibid): 78516
Ver documento
Título: Der Wilde Jager : fine waidmannsmar / von Julius Wolff
Autor: Wolff, Julius, 1834-1910.
Pie de imprenta: Berlin : G. Grote : 1888
Número de control (Bibid): 82437
Ver documento
Título: Gesangsunterricht übungen für die Frauen-Stimme für ihre Schülerinnen verfafst von Pauline Viardot-Garcia; deutsch von Ferd. Gumbert
Autor: Viardot García, Paulina, 1821-1910.
Pie de imprenta: Berlin Ed. Bote & G. Bock, [s.a.]
Materia: Canto -- Instrucción y estudio.
Número de control (Bibid): UANL000211266
Ver documento
Título: Herne buch der lieder
Autor: Heine, Heinrich, 1797-1856.
Pie de imprenta: Berlín : Deutsche Bibliotet in Berlín, 1939
Número de control (Bibid): 82239
Ver documento
Título: Quatro conts experiences de physique, mecanique, acoustigue, chaleur, oetique, electricite : livre d'exercices en rapport avoc la cassettea experience
Autor: Merser & Mortig.
Pie de imprenta: Berlin : Leonard Simion, 1891
Materia: Física. / Física -- Experimentos.
Número de control (Bibid): 9376
Ver documento
Título: The merchant of berlin ; an historical novel / by L. Muhlbach (pseud) ; tr. from the german by Amory Coffin
Autor: Mundt, Frau Klara Muller, 1814-1873.
Pie de imprenta: New York : A.L. Fowler, Publisher, 1905.
Materia: Guerra de los cien años, 1756-1763 - Novela.
Número de control (Bibid): UANL000171642
Ver documento
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 04:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zwingliana.ch/index.php/zwa
Bis auf die letzten drei Jahrgänge sind die Volltexte der wichtigen kirchenhistorischen Zeitschrift kostenlos zugänglich.
Bis auf die letzten drei Jahrgänge sind die Volltexte der wichtigen kirchenhistorischen Zeitschrift kostenlos zugänglich.
KlausGraf - am Sonntag, 25. April 2010, 04:05 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es sei die Hauptaufgabe eines Historikers, schrieb Reinhart Koselleck,„zunächst einmal davon auszugehen, dass immer alles anders war als gesagt. Und diese Regel trifft fast immer zu. Die zweite Regel ist, dass alles immer anders ist als gedacht. Und wenn man diese Regeln kennt, dann hat man was gelernt. Dann muss man nämlich fragen, wie es dahinter eigentlich aussieht, wenn es anders ist als gesagt und anders ist als gedacht. Diejenigen, die bei mir überhaupt was gelernt haben, haben das hoffentlich mitgenommen: ... die professionelle Skepsis, die das Selbstbewusstsein mit Selbstkritik verbinden kann“
FAZ leider ohne Quellenangabe (§ 63 UrhG).
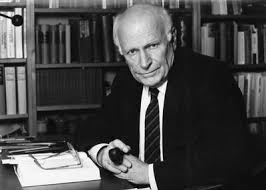 Bildnachweis: Stadtarchiv Bielefeld, Fotograf: Jobst Lohöfener
Bildnachweis: Stadtarchiv Bielefeld, Fotograf: Jobst Lohöfener
FAZ leider ohne Quellenangabe (§ 63 UrhG).
KlausGraf - am Samstag, 24. April 2010, 17:43 - Rubrik: Geschichtswissenschaft






