Mit daten.berlin.de hat Berlin heute als erstes Bundesland ein eigenständiges OpenData-Portal gestartet.
http://daten.berlin.de/
Die Stadt Berlin veröffentlicht Daten für die weitere Nutzung durch die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Medien und die Institutionen.
Für verzeichneten Datensatz gilt – soweit nicht anders gekennzeichnet – die Lizenz:
„Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland“
(CC-BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de)
Für die Zusammenstellung der Daten auf daten.berlin.de gilt die Lizenz:
„Open Data Commons Attribution“
(ODC-BY http://okfn.de/licence/odc-by/)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec from Monolithe Multimedia on Vimeo.
Vidéo réalisée par Monolithe Multimedia.Clip promo
Tournage réalisée avec Sony FS100, Nikkon 50mm f1.4, Stock lens 18-200mm
Zeitungen zur Jahreswende 1907 / 1908
Signatur:
Kreisarchiv Kleve, Zeitungen (Z)
Alter:
Dezember 1907 / Januar 1908....."
Link zur PDF-Datei
Wie sehen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Urheber, Autoren, Interpreten, Aufnahmeleiter, Sammler, Archivare, Techniker und Nutzer heute aus? Was hat sich im digitalen Zeitalter verändert? Was musste aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, angepasst werden? Die Digitalisierung ist zwar zu einer conditio sine qua non geworden, aber wie sehen vereinbarte Normen aus, wie können Archiv-Lösungen gemeinsam genutzt werden – von der technischen Seite bis hin zu den Datenbanken! Für all diese Fragen bietet die Konferenz ein Forum für Experten und Fachinteressierte.
Gastgeber für die 42. Internationale IASA-Tagung sind die Deutsche Nationalbibliothek (DNB), der Hessische Rundfunk (hr) und das Deutsches Rundfunkarchiv (DRA). Rund 150 Teilnehmer aus über 30 Ländern tagen und diskutieren von Montag, 5. bis Donnerstag, 8. September 2011 in den Räumen der Deutschen Nationalbibliothek.
Nähere Informationen zur IASA finden Sie auf der website http://www.iasa-web.org, zur Konferenz selbst und zum Rahmenprogramm unter http://www.iasa-conference.com ."
IASA, Pressemitteilung
OU Historxy of Science Collections has recently made available, in its entirety, high resolution images of the most lavishly-illustrated treatise on the Earth in the 17th century.
http://hos.ou.edu/galleries//17thCentury/Kircher/1665/

Zitat:
" .... Das Chefbüro hat er bereits Anfang des Monats für seinen Nachfolger Roland Gerber geräumt .... In diesen Tagen sitzt Erne am Pult des derzeit abwesenden Zivildienstleistenden, um sein Know-how an den neuen Stadtarchivar weiterzugeben. Diese Konstellation birgt eine gewisse Symbolik in sich. Erne hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. ...."
and a resource guide for educators.
Born in Camagüey, Cuba in 1921, Emilio Sanchez began his artistic training at the Art Students League in 1944 when he moved to New York City, and where he lived until he died in 1999. In 2010, The Bronx Museum was one of four museums selected by the Emilio Sanchez Foundation to receive a gift of paintings and drawings by the internationally renowned artist, as well as an archival database of Sanchez’s works, photographs, and documents, to add to their permanent collections.
The Bronx Museum received a selection of 25 oils, watercolors, and drawings that focus exclusively on Bronx scenes completed in the late 1980s. The series comprises urban landscapes depicting the Bronx as well as archival photographs and documents. This donation strengthens the Museum’s mission to present and collect works by artists for whom the Bronx has been critical to their artistic practice and development. ...."
Link: Bronx museum, press release, 6.4.2011
"Zweimal diese Woche im #Staatsarchiv Hamburg gewesen. Keine große Hilfe und ein arroganter Beratungsdienst nach meiner Empfindung. Behörde"
2 hours ago via web
Die Eigenplagiate werden im Freyplag Wiki untersucht:
http://freyplag.wikia.com/wiki/FreyPlag_Wiki
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/38730427/
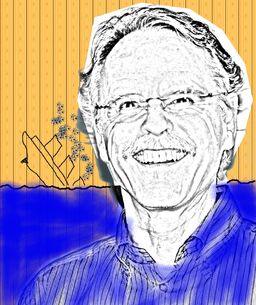
Entsetzt sahen ihn die Archivare an.
Adolf: "Es freut mich sehr, nach vielen Jahren, diesen Ort zu besuchen. Ich möchte gerne Unterlagen einsehen, meine Korrespondenz, meine letztwilligen Verfügungen, meine Papiere ...Ich weiss nicht, was nach 1936 geschehen ist."
Aus dem Kreis der Archivare tritt der Archivleiter an den ehemaligen Fürsten heran und erwidert: "Durchlaucht, das Hausarchiv dürfen Sie leider nicht einsehen, dazu benötigen Sie die Zustimmung des Fürsten".
Adolf: "Das verwundert mich doch sehr. Immerhin sind es meine Unterlagen, es ist doch mein Archiv, meine Briefe, Bei der Gelegenheit die Frage: Gibt es inzwischen einen neuen Fürsten ? Ich habe doch abgedankt. Ist die Monarchie wieder eingeführt worden ? Was ist nach dem 26 März 1936 geschehen ?"
Archivleiter: "Es tut mir wirklich leid, aber wir dürfen Durchlaucht keine Auskunft erteilen. Fragen Sie Ihren Grossneffen Alexander. er ist der Enkel Ihres Bruders Wolrad. Ihm gehören sämtliche Unterlagen. Sie wissen doch, alles war Hausvermögen, Sie waren arm, bettelarm, hochverschuldet, vermögenslos, Ihnen gehören nicht einmal Weihnachtsgrusskarten, auch keine Fotos von Ihnen und Ihrer Gattin. Wo ist sie eigentlich ?".
Adolf: "Palais Schaumburg in Bonn, Gut Steyrling, Villa Belle Maison in Höllriegelskreuth und .......das war doch alles mein Besitz. Sie sind Teil meiner Erinnerungen, meines Lebens, meine Taten, meine Vergangenheit. Wo sind sie geblieben ? Wo ist Valentin Graf Henckel von Donnersmarck ?"
Ein Angestellter der Fürstlichen Hofkammer, nicht der Grossneffe, kam in das Treppenhaus des Staatsarchivs und rief herauf:
"Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass einer Einsichtnahme in die Unterlagen des Fürsten nicht entsprochen werden kann. Der Fürst lässt seinem Grossonkel mitteilen, dass eine Einsichtnahme nur in Frage käme, wenn er ein ernstzunehmender Wissenschaftler wäre. Sie sind es aber nicht, Sie verfolgen nur persönliche Interessen, Ihre eigenen Interessen."
Der Archivleiter beendete das Gespräch und liess Adolf im Treppenhaus stehen.
Nachdenklich und schweigsam stieg er die Treppen herab und betrat den Schlossplatz. Er drehte sich und sah sich die die Fassade der Schlossanlage an. An keinem Fenster erkannte er ein Gesicht. Doch die Archivare beobachteten ihn, von ihren Arbeitszimmern aus. Er konnte sie aber nicht erkennen.
Dann ging er über die Schlossbrücke und spazierte durch den Schlosspark bis zum Mausoleum, das er vor vielen Jahren hatte errichten lassen. Lange stand er dort, vor verschlossenen Toren.
http://vierprinzen.blogspot.com/2011/09/absurdes.html
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=8600714/1twp5ap/
Az: 9 S 2667/10
http://vghmannheim.de/servlet/PB/menu/1271235/index.html?ROOT=1153033
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gericht-der-prozess-koennte-ihn-den-titel-kosten.71abd2fd-54bc-4337-8afd-f33413702d1b.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Sch%C3%B6n
Update:
http://klawtext.blogspot.com/2011/09/wieder-ein-doktor-weniger-oder-was-heit.html
Die Kriegsordnung mit der Signatur Ms. boruss. fol. 1254 wurde mit Mitteln der Kulturstiftung der Länder, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie der Ernst von Siemens Kunststiftung erworben, letztere ist damit Miteigentümer geworden. Die Handschrift ist eine der wenigen überlieferten, die in Preußen im 16. Jahrhundert hochwertig illuminiert wurden.
Entstanden ist die großformatige Handschrift unter der Aufsicht von Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Vermutlich war sie aufgrund ihres höchst sensiblen Inhalts zu Organisation und Ausstattung des Militärs nur wenigen Personen je bekannt – beides wird mit farbenprächtigen Bildern und Texten auf 381 Blättern ausführlich dargelegt.
Siehe auch
http://staatsbibliothek-berlin.de/nc/aktuelles/presse/detail/article/2011-09-13-4978/


noch nicht auf
http://thepublicindex.org/documents/libraries
zu finden ist. Das ist auch kein Wunder, denn diese Liste weist noch andere Lücken auf. Nicht berücksichtigt ist der Vertrag von Lyon, der möglicherweise wieder aus dem Netz verschwunden ist, aber seinerzeit kommentiert wurde:
http://bloguniversdoc.blogspot.com/2010/01/contrat-passe-entre-google-et-la-ville.html
Zitat:
Darüber hinaus war im Gesundheitsamt geregelt, dass die Akten der Kinder
bis zu deren 18. Lebensjahr dort verbleiben und dann im sog. Medizinalarchiv des Landkreises weitere zehn Jahre aufbewahrt werden. Eine Speicherung der Untersuchungsdaten der Kinder bis zum 28. Lebensjahr, obwohl
mehrheitlich eine letzte Untersuchung in der 6. Klasse, d. h. mit ca. 12 Jahren, erfolgte, erschien zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben nicht zwingend
erforderlich (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 DSG-LSA). Das Gesundheitsamt schlug daraufhin vor, die Akten direkt nach der schulärztlichen Untersuchung in der 6.
Klasse an das Medizinalarchiv zu geben. Das Medizinalarchiv würde dann
entscheiden, wie lange die Akten dort verbleiben und sie nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist vernichten. Da es sich bei dem Medizinalarchiv wohl
auch um eine Verwaltungsregistratur in Verantwortung des Gesundheitsamtes handelt, wurde empfohlen, die Aufbewahrungsfristen für die jeweiligen
Datenbestände konkret festzulegen und die gebotene und datenschutzkonforme Löschung zu kontrollieren. Außerdem hat der Landesbeauftragte auf
das verpflichtende Angebot der Verwaltung an das zuständige archivrechtliche Archiv vor der Löschung hingewiesen (§ 11 Archivgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt).
Via
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5083
DNA- Digital Namibian Archive Project from Valentina Bilancieri on Vimeo.
The DNA (Digital Namibian Archive) is a partnership between Utah Valley University, Polytechnic University of Namibia and the National Archives of Namibia. This partnership was created to aid Namibia in the digitization of their archived material, and to promote further archiving to preserve the history of the country. I was so fortunate to go to Namibia and be a part of this partnership as a representative for UVU and this is just a little snippet video I made of what the DNA project is all about. This video will be touring around in a mobile exhibit other students from UVU and myself put together to promote the DNA project.ARCHIVE PHOTO INSERTS FROM MOTALKO from Miklós Falvay on Vimeo.
3d camera mapping scenes from the documentary MOTALKO. The whole process (modelling, texturing, compositing) was done with Blender 2.49.created by: Miklós Falvay
layout artist: Domonkos Pinke
MOTALKO is a documentary about the first Hungarian petrol station.
Directed by Attila Kekesi, produced by Miklos Havas.
Released in 2011.

Empfang der Tagungsteilnehmer im Schottischen Nationalarchiv am 31. August 2011 (v.l.nr.): George Mackenzie, Keeper of the Records of Scotland and Register General for Scotland / Katy Goodrum, Vorstandsmitglied der ARA, Leiterin des West Yorkshire Archivs in Leeds / Fiona Hyslop M.S.P., Cabinet Secretary for Culture and External Affairs. Foto: ICA
"Vom 31. August bis 2. September 2011 fand in Edinburgh die Jahrestagung des Verbandes der Archivare von England, Schottland und Irland (Archives and Records Association UK and Ireland) mit rund 250 Teilnehmern statt. Diese Vereinigung der größten Nationalverbände von England, Schottland und Irland wurde erst kürzlich vollzogen, um dem Archivwesen in Zeiten von Mittelkürzungen mehr Gewicht bei den Verhandlungen mit der Politik zu verschaffen und sich auch geschlossen im Kampf um Mittel zu positionieren.
Die Tagung beinhaltete unter dem Titel Advocating for Archives and Records: The Impact oft he Profession in the 21st Century Veranstaltungen zum Archivwesen und Records Management sowie zu konservatorischen Problemen und Techniken. Weiterhin bot das Steering Committee der Sektion der Fachverbände (SPA) des ICA eine Reihe von Diskussionsrunden. Unter dem Titel „Governments and Archives Politics“ wurde das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zwischen Archiven und vorgesetzten Behörden diskutiert. Die Berufsverbände haben hier in vielen Fällen die Aufgabe, als Beistand der Archive wirksam zu werden.
Das Engagement des VdA bei der Frage der Nachbesetzung der Leitung des Bundesarchivs durch einen Facharchivar/eine Facharchivarin ist im Ausland sehr aufmerksam verfolgt worden und wird dort inzwischen bereits als Beispiel für die Bedeutung der Fachverbände zitiert. Eine ähnlich schwere Auseinandersetzung führen beispielsweise die französischen Kolleginnen und Kollegen angesichts der Pläne von Präsident Sarkozy, das Nationalarchiv aus seinem traditionellen Hauptsitz, dem Hôtel de Soubise in Paris, zu verdrängen und stattdessen hier ein „Maison de l’histoire de France“ im Marais einzurichten. Vorgestellt wurde weiterhin der Entwurf eines Kompetenz Models für die Standards der fachlichen Qualifikation von Archivarinnen und Archivare in Europa, gemeinsam entwickelt von SPA und EURBICA. Bei der Vorstellung der Universal Declaration on Archives wurde positiv registriert, dass es der Schweiz, Österreich und Deutschland gelungen war, sich auf eine gemeinsame Übersetzung zu verständigen. Wie George MacKanzie, der Leiter des schottischen Nationalarchivs feststellte, werden auch für den englischsprachigen Raum die nationalen Sprachentwicklungen zunehmend zum Problem.
Die SPA nutzte die Veranstaltung, um mit einer internationalen Fachmesse der Verbände an ihr 35jähriges Bestehen zu erinnern. Der VdA hatte die Messe zum Anlass genommen, Werbematerial in englischer Sprache zu produzieren.
Erschüttert waren die Anwesenden von einem spontanen Vortrag einer japanischen Kollegin zu den Schäden, welche die dreifache Katastrophe vom Frühjahr 2011 auch beim Kulturgut hinterlassen hatten. Bewundernswert ist der Ideenreichtum, mit dem auch Massen von Archivgut gerettet und beispielsweise nach Durchfeuchtung mit Meerwasser getrocknet wurden. "

SPA-Gesprächsrunde Governments and Archives Politics am 1. September 2011 (V.l.n.r.): Xavier de la Selle, Präsident der Association des archivistes français und Leiter des Centre Mémoires et Société - Le Rize in Villeurbanne bei Lyon; Joan Antonio Jiménez, Präsident der Associaciód’ Arxivers Gestors de Documents de Catalunya und Leiter des Archivs der medizinischen Dienste beim Ministerium für Gesundheit in Katalonien/Spanien; Dr. Bernhard Post, Mitglied der Steering Commission der SPA und Leiter des Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar; Michal Henkin, Vorsitzende des israelischen Archivarsverbandes und Leiterin des Stadtarchivs von Haifa. Foto: ICA
Quelle: VdA, Meldungen
13. September 2011 bis 29. Januar 2012
Ort: Karmeliterkloster, Dormitorium
Veranstalter: Institut für Stadtgeschichte
Eintritt: frei
Die Ausstellung zeigt die traditionsreiche Geschichte des Archivs und seine wechselnden Aufgabenstellungen. Wichtige Themen sind die Entwicklung von der Altregistratur der Stadtverwaltung über die Hinwendung zum historischen Archiv im Zusammenhang mit dem Entstehen der modernen Geschichtswissenschaft bis zur heutigen, aktiven Geschichtsvermittlung.
Quelle: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt/Main, Veranstaltungen
Presseecho zur Eröffnung:
hr-online.de, 12.9.11 mit Bildergalerie
FAZ, 13.9.2011
frankfurt-live.com, 13.9.11
Welt, 13.9.11

"Ein Schwerpunkt von Heft 1/2011 der „Mitteilungen aus dem Bundesarchiv“ liegt auf der Amtseinführung des neuen Präsidenten des Bundesarchivs am 3. Mai. Die Ansprache von Staatsminister Bernd Neumann MdB, der aus diesem Anlass nach Koblenz gekommen war, der Dank von Dr. Michael Hollmann und das Grußwort von Dr. Michael Diefenbacher, dem Vorsitzenden des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., können hier nachgelesen werden.
Wie immer nehmen Informationen über die Bearbeitung von Beständen breiten Raum ein. Dieses Mal geht es u.a. um das Reichspostministerium, das Amt für Kernforschung und Kerntechnik der DDR, die Deutsche Lufthansa der DDR, das „Berliner Büro der Internationalen Konferenz zur friedlichen Lösung der deutschen Frage“ und vier Nachlässe hochrangiger Militärs. Dass ein frühzeitiger Blick über den „Tellerrand“ des eigenen Archivs den Zugang zu Archivgut erheblich verbessern kann, belegt die Vereinbarung von Bundesarchiv und Archiv des Liberalismus, gleichzeitig Findmittel zum Nachlass des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel online zu stellen.
Außerdem wird u.a. über die Weiterentwicklung des „Informationsportals Zwangsarbeit im NS-Staat“ berichtet und über das KOMINTERN-Projekt, das aus verschiedenen Gründen als „Modellfall internationaler Kooperation“ bezeichnet werden kann.
Heft 2/2011 soll zum Jahresende erscheinen. 2010 gab es leider nur eine Ausgabe der „Mitteilungen“."
Quelle: Bundesarchiv, Aktuelle Meldungen
Vertragstext:
http://kb.nl/nieuws/2011/contract-google-kb.pdf
Ob es die Verträge von München und Wien auch mal gibt?
Zu ArchiveGrid siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=archivegrid
Der Internetrechtler Thomas Hoeren schreibt:
Am Montag ist es in Brüssel zu einer wegweisenden Entscheidung im europäischen Urheberrecht gekommen. Die lange auf Eis liegende Schutzfristverlängerung für Tonaufnahmen (ausübende Künstler/Tonträgerhersteller) von 50 auf 70 Jahre wurde vom Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. Gegner waren unter anderem Belgien, Schweden und die Niederlande. Deutschland stimmte für die Verlängerung, Österreich enthielt sich. Die Verlängerung muß nun binnen zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden.
Die letzten Entwicklungen sind weitgehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit im Schnellverfahren vorangetrieben worden. Durch ein Einlenken von Dänemark, Portugal und Finnland ist inzwischen die Sperrminorität gefallen. Die massive Kritik vieler europäischer Wissenschaftler an diesem Entwurf wurde schlichtweg nicht beachtet.
Die Neuregelung ist eine Unverschämtheit. Vorgeschoben wird ein Schutz der ausübenden Künstler, insbesondere der Studiomusiker. Doch denen werden ohnehin die Rechte (auch in neuer verlängerter Form) im Wegen eines Rechtebuyouts zugunsten der Musikindusterie abgenommen. Und mit der neuen Richtlinie werden auch die Tonträgerhersteller geschützt. Warum diese eine Verlängerung der Schutzdauer verdient haben, wurde nie begründet. Wieder einmal versteckt sich die Musikindustrie hinter den Kreativen, um ihre einseitigen Interessen vorbei an der Öffentlichkeit durchzudrücken.
Siehe auch
http://www.heise.de/tp/blogs/6/150459
http://www.homo-numericus.net/spip.php?article304
Via Mareike König/G+
Quelle: Bundesarchiv, Öffentlichkeitsarbeit
Zur Diskussion über die Veröffentlichung s. http://archiv.twoday.net/stories/38760371/
Quelle: Radio Siegen, Aktuelles, 13.9.2011
the Quebec Writers Union, and eight individual authors have filed
a copyright infringement lawsuit in federal court against
HathiTrust, the University of Michigan, the University of
California, the University of Wisconsin, Indiana University, and
Cornell University. Plaintiff authors include children's book
author and illustrator Pat Cummings, novelists Angelo Loukakis,
Roxana Robinson, Daniele Simpson, and Fay Weldon, poet Andre Roy,
Columbia University professor and Shakespeare scholar James
Shapiro, and Pulitzer Prize and National Book Award winning
biographer T.J. Stiles.
The universities obtained from Google unauthorized scans of an
estimated 7 million copyright-protected books, the rights to
which are held by authors in dozens of countries. The
universities have pooled the unauthorized files in a repository
organized by the University of Michigan called HathiTrust.
Via liblicense
http://blog.authorsguild.org/2011/09/12/authors-guild-australian-society-of-authors-quebec-writers-union-sue-five-u-s-universities/
See also
http://chronicle.com/blogs/ticker/authors-guild-sues-hathitrust-5-universities-over-digitized-books/36178
http://archiv.twoday.net/search?q=hathitrust
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/158962910/
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45874.html
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45888.html
Zur Diskussion:
http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2011-September/date.html
http://en.wikinews.org/wiki/User:Dendodge/Project_focus
Es wäre eine gute Idee, das völlig nutzlose deutschsprachige Wikinews ersatzlos zu schließen.
Update: Tempodivalse in foundation-l
To be clear, OpenGlobe was not created due to a dispute with the Foundation.
The main reason for forking was the perceived hostility and rudeness among Wikinews editors,
especially to newbies and outsiders, which makes it difficult to get anything done
and drives off new recruits. Bureaucracy also
played a role: article standards have become so high that very few stories
make it to the front page; the project currently averages fewer
than two published pages a day and 75%+ of stories are deleted as old news before they see
"daylight". The stories that are published generally go live only after a lengthy delay and
some time after the event has taken place, making their usefulness questionable.
Re how we're going to be different from Wikinews: OpenGlobe is still in the developing
stage, so I'm not sure what direction things will take, but two important things are on our
agenda: make publication of articles much easier and more rewarding, and put the focus on
quality, in-depth reporting, and articles on underreported but relevant events,
instead of just rewriting an article done by AP or Reuters. We also might allow more
"human interest stories", that are unbiased but thought-provoking, as an addition to the
more typical coverage. (There's been a complaint that I've created several articles from the PD
Voice of America, but rest assured I don't want to do that on a daily basis; I just needed "filler" for the main page
until better articles could be made.)
http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen

"Das Historische Archiv der Stadt Köln kann ab sofort Dokumente, die beim Einsturz 2009 nass wurden, selbst gefriertrocknen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben von Montag (12.09.11) mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder eine 100.000 Euro teure Anlage dafür angeschafft.
Bisher war das Kölner Archiv darauf angewiesen, dass andere Institutionen ihm Gefriertrocknungsanlagen zur Verfügung stellten. Die aus dem Grundwasser geborgenen Dokumente, die zum Schutz vor Schimmel zunächst schockgefroren worden waren, müssen vor der Restaurierung gefriergetrocknet werden."
Quelle: WDR.de, Panorama, 12.9.11
Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger, 11.9.11
Die schwarz-gelbe Koalition will die in der Stasi-Unterlagen-Behörde beschäftigten 47 ehemaligen Stasi-Mitarbeiter per Gesetz aus der Behörde entfernen und auf andere Posten in der Bundesverwaltung versetzen.
http://www.handschriftencensus.de/1876
via Twitter from ARA 2011'(Archives & Records Association, UK)
Collier/ Fong - Casting Submission from Leanna Fong on Vimeo.
Ron Collier and Leanna Fong are PhD students who are too dynamic to be confined within plain text, libraries and archives. This video on Rocco Perri features the adventurous duo exploring the gritty past of Hamilton.Keeper Of The Mountains Trailer from Allison Otto on Vimeo.
In a post-World War II era during which few women traveled and lived independently, young journalist Elizabeth Hawley decided to settle alone in 1960 in Kathmandu. Carving out a niche for herself as the foremost Himalayan mountaineering historian in the world, Hawley, now 87, has chronicled roughly 80,000 ascents in the Himalaya, including those on Everest.A legacy keeper with her own legacy, Hawley's reports and interviews are so respected and thorough that mountaineers have dubbed her interrogations an expedition's “second summit,” and they consider her archives to be crucial to providing insight into the history of mountaineering and for maintaining integrity and accuracy in the mountaineering world.
But now Miss Hawley and her records face an uncertain future: Miss Hawley is pondering retirement but hasn’t groomed a successor. Since the archives aren’t a revenue-generating venture, how they will be maintained—and by whom—remains in doubt.
This is the story of an independent woman and her archives, of a self-professed “city girl” who played a key role in the Golden Age of Himalayan Mountaineering, who shared deep friendships with everyone from Sir Edmund Hillary to Nepalese royalty, and who witnessed firsthand mountaineering’s transformation from a fringe pursuit to a big-business obsession and the impact it had upon Nepal.
Special thanks to:
Lisa Choegyal and Michael and Meg Leonard for use of the still photographs
AND
Serac Adventure Films for additional footage
"Seit dem frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart haben Generationen von Archivaren, Historikern und Archäologen die aus einer mehr als tausendjährigen Vergangenheit überkommenen schriftlichen und sonstigen Quellen Brandenburgs gesichert, erforscht und dargestellt. Die "Lebensbilder brandenburgischer Archivare und Landeshistoriker" beschreiben in biografischen Aufsätzen Lebensweg und -werk von über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in verschiedenen historischen Disziplinen gewirkt haben. Berücksichtigt sind bekannte Namen der brandenburgischen Landesgeschichtsforschung wie etwa Adolf Friedrich Riedel, Georg Wilhelm von Raumer aus dem 19. Jahrhundert, Johannes Schultze, Rudolf Lehmann und Lieselott Enders aus dem 20. Darüber hinaus sind viele zu Unrecht in Vergessenheit geratene Persönlichkeiten aufgenommen, insbesondere aus dem Bereich der Kommunal- und Kirchenarchive sowie der Regional- und Lokalgeschichtsforschung. Die Biografen schildern sowohl die beruflichen Lebensumstände der behandelten Personen als auch ihre wissenschaftlichen Leistungen."
gebundene Ausgabe (Gebunden)
Verlag: Bebra Verlag
Sprache: Deutsch
Original Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3937233903
ISBN-13: 9783937233901
Seiten: 600
Quelle: druckfrisches.de, 1.9.11
Als Nachfolge der jetzigen Stelleninhaberin, die in Pension geht, sucht die Pfadfinderinnen-stiftung Calancatal eine/n
Archivleiter/in
(in Teilzeit)
Ihre Aufgaben:
- Sie sammeln im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten Kulturgut des Calancatals, sorgen für dessen sachgerechte Aufbewahrung, erfassen es mit dem vorhandenen elektronischen Programm und beraten Benutzer
- Sie führen den kleinen Laden und das Bistro Bottega Vecchia Posta für Einheimische und Touristen in Cauco und geben Auskünfte über das Tal
- Sie organisieren einzelne kulturelle Anlässe zu Geschichte und Kultur des Tales
Eine Einarbeitung durch die bisherige Stelleninhaberin wird gewährleistet.
Sie bringen mit:
-sehr gute Kenntnisse des Calancatals (Geschichte und heutige Situation) und Liebe zu diesem südlichen Schweizer-Bergtal
- Erfahrung in Archivierung, ev. Ausbildung für Archivare (der Grundkurs könnte auch berufsbegleitend besucht werden)
-Erfahrung im Führen eines Treffpunktes mit Laden
- PC-Kenntnisse (Office 2007, CMISTAR, Programm der Website typo 3)
- Selbständiges, initiatives Arbeiten
- Italienisch- und Deutschkenntnisse
Stellenantritt: Frühling 2012 oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Cauco/Calancatal
Anstellungsgrad: rund 400h/Jahr mit Schwergewicht im Sommer
Arbeitgeberin: Pfadfinderinnenstiftung Calancatal
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Sabina Spinnler, jetzige Archivleiterin, gerne zur Verfügung, Tel. 091 828 14 40.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 1.November 2011 an: Anne-Marie Saxer-Steinlin, Präsidentin Archivkommission, Weiherstr. 10, 3073 Gümligen BE.
Link zur Stellenanzeige (PDF)
Enticing, what mysteries!
Wooden cart awaits...
by Kate Mollan
Marg’ret, don’t be cross:
archives now proliferate
ike lakeside bunnies
by Ann Heinrichs
Hey, handsome stranger
Saw your pic in the archives
Too bad you’re dead now
by Rebecca Goldman
Link
The research - which starts in an echo-free recording chamber and uses latest computer modelling techniques - has also been used to recreate the acoustics of Coventry Cathedral before it was destroyed in World War II.
The same work is also being used to design better buildings of the future - with the acoustics of Stonehenge for instance, helping to inspire modern concert venues. It is also influencing the way museums use sound to give visitors a sense of history, such as the hustle and bustle of railway stations during the age of steam.
For BBC Radio 4, Prof Jim Al-Khalili went to investigate the sounds of the past. "
Link and listen to the audio!
Bei den Kleinen wird zuerst gespart. Das stimmt auch im Fall der außeruniversitären Bibliotheken in Österreich, speziell der sieben unabhängigen Frauenbibliotheken*. Für die gab es bereits bisher kaum Gelder aus dem Wissenschaftsministerium: 2010 32.690 Euro, 2011 nur mehr 23.800 Euro ergab eine Anfrage der Grünen. Und 2012 gibt es gar nichts mehr. ...." - weiter im Standard, 8.9.11
As keepers of recorded and artifactual history, archival repositories provide communities with the raw materials to support collective memory and create an effective “sense of place.” Part of this requires exposing the underlying geographical locations whose history is documented by archival records. But traditional archival principles of arrangement and description primarily emphasize provenance, respect des fonds, and temporal organization rather than the spatial aspects of records. Internet-based GIS tools such as Google Maps and Google Earth offer opportunities for archives to present records in new and exciting ways, and can help better connect archives to the communities they s ....
....Conclusion
Just as in other professions, digital technologies are rapidly permeating every aspect of the archival field. To some degree, technology simply extends activities that archivists have always undertaken — allowing them, for example, to make “flat” finding aids available online or to answer reference queries by e–mail. But to truly take advantage of new technologies, archivists must consider the implications new capabilities and weigh the changing expectations of users.
The online availability of archival collections means that they are no longer the exclusive domain of specialists who can spend days poring over finding aids. Online archives allow the general public to interact with history in new ways, and can attract nontraditional users to existing collections. To serve these new users, archivists must help them discover the real connections between the records and their own lives. Highlighting the places documented by their records is one particularly effective way of demonstrating this relevance. David Glassberg (1998) has observed that cultural resource managers “...can help residents and visitors alike see what ordinarily cannot be seen: both the memories attached to places and the larger social and economic processes that shaped how the places were made.” I would argue that this assertion is as true for those charged with historical records as with historical sites. Web 2.0 GIS tools like Google Maps are an accessible way for archivists to better present the spatial aspects of their collections, making it easier for communities of users to discover and utilize records of a place in new and different ways. These developments point toward a future where archival users can browse historical documentation as easily as they can seek out a new apartment."
Library Student Journal,
June 2010

Mitglieder des Koordinierungsausschusses des Arbeitskreises (von links nach rechts): Dr. Sabine Happ (Universitätsarchiv Münster), Heike Fiedler (Landesarchiv NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe), Dr. Annekatrin Schaller (Stadtarchiv Neuss), Kärstin Weirauch (Brandenburgisches Landeshauptarchiv), Roswitha Link (Stadtarchiv Münster), Merit Kegel (Hauptstaatsarchiv Dresden), Dr. Jens Murken (Landeskirchliches Archiv Bielefeld).
"Auf seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September 2011 in Münster ernannte der Koordinierungsausschuss eine neue Leiterin für den Arbeitskreis Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit im VdA.
Dr. Annekatrin Schaller (Stadtarchiv Neuss) übernimmt ab sofort diese Funktion von Roswitha Link (Stadtarchiv Münster). Roswitha Link hat über zehn Jahre den Arbeitskreis geleitet. In ihrer Zeit als AK-Leiterin entwickelte sich der Arbeitskreis mit seiner eigenen Veranstaltung auf dem Deutschen Archivtag, der jährlichen Archivpädagogenkonferenz, der Beteiligung an zahlreichen Veranstaltungen und Fortbildungen sowie einem eigenen Internetangebot zum zentralen Ansprechpartner für die Bereiche Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit. Die erfolgreiche Arbeit will Dr. Annekatrin Schaller in Zukunft fortsetzen."
Quelle: VdA, Meldungen 9.9.11
Link zum heutigen Artikel
Stellt sich archivisch, wenn wir denn schon angesprochen werden, die Frage, ob wir für den neuen Trend gewappnet sind?

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_upload/DE
Alle 4 gezeigten Bilder sind von mir und zeigen Denkmale in Ratzeburg (SH).
 UB Kiel
UB Kiel
"„Wann bricht schon mal ein Staat zusammen!“ – Der Untergang der DDR-Diktatur ermöglicht seit zwei Jahrzehnten eine intensive und breite Forschungsarbeit, zuweilen ist im Bezug auf die DDR-Geschichte gar von intellektueller Goldgräberstimmung die Rede. Diese Forschungen stützen sich wesentlich auf Archivmaterial, für dessen Aufbewahrung verschiedene Institutionen zuständig sind. Wie sehen diese Orte aus, an denen im staatlichen Auftrag die DDR archiviert wird? Im Gegensatz zur Erinnerungsarbeit, die über Gedenkstätten und Museen eine Verortung erfährt und darüber ein Bild anbietet von der DDR, ihrem Alltagsleben und ihren Denkmälern, der Mauer, der Stasi-Zentrale oder den Untersuchungshaftanstalten, fehlt ein Bild von den Orten und Räumen, die existieren, weil die DDR existiert hat. Anja Bohnhof hat sich diesem Thema in der Neuerscheinung angenommen.
Das Buch „Zu den Akten“ zeigt Ansichten der Orte, an denen gesammelt, verwaltetet, archiviert, ausgewertet und geforscht wird: Unnahbar wirkender Zweckbauten, endlose Flure und Regalreihen mit Kilometern von Akten, Filmrollen und Papier, gekennzeichnet, nummeriert und in säurefreien Kartons verstaut.
Über die visualisierte Ästhetik muten die Ansichten der der Öffentlichkeit unzugängliche Orte geheimnisvoll und gleichermaßen machtvoll an, ohne dabei etwas von ihrer Inhaltlichkeit preiszugeben. Das fotografische Ergebnis verweigert dem Betrachter (scheinbare) Teilhabe und verkehrt so das Prinzip, mit dem mediale Vermittlung zunehmend häufiger operiert, um interessensabhängige Meinungsbildung gezielt zu betreiben.
Das Buch „Zu den Akten“ verweist auf die Grenzen der Visualisierbarkeit im Zeitalter der Bilder, ebenso wie auf die Abhängigkeit von Zeit und vorherrschenden Werten in einer Gesellschaft im Bezug auf die Auslegung und Deutungsweise von Geschichte.
Beteiligte Institutionen:
Bundesarchiv: Berlin Lichterfelde & Hoppegarten; Bundesfilmarchiv: Wilhelmshagen & Hoppegarten; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes; Landesarchiv Berlin; Hauptstaatsarchiv Dresden; Hauptstaatsarchiv Weimar; BStU: Berlin & BStU Außenstelle Magdeburg; Akademie der Künste Berlin.
Hesperus Verlag Potsdam/Dresden, 111 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-932607-26-4 ...."
Quelle: prophoto-online, Fotobücher 8/2011
s. a. Homepage Anja Bohnhof
Wenn US-Universitätsbibliotheken Orphan Works scannen und nur ihren Mitarbeitern und Studenten statt der Allgemeinheit zugänglich machen ist das der falsche Weg, mit dem Problem verwaister Werke umzugehen. Dies vergrößert den "Affiliation gap", die Kluft zwischen denjenigen, die sich z.B. JSTOR leisten können oder Public-Domain-Bücher in HathiTrust ganz herunterladen dürfen, und denjenigen, die nicht zu diesen Happy few gehören.
Über das Archiv als Reservoir und Schatzhaus, als Arbeitsplatz und Zeichen herrschaftlicher Macht.
Was charakterisiert Archive? Die französische Historikerin Arlette Farge gibt in ihrem Essay eine mehrfache Antwort. Sie erschließt das Archiv als Schatzhaus, mitunter als Wunderkammer; sie umreißt es als Arbeitsplatz von Archivaren, Magazinern und Historikerinnen; sie zeigt es als Ort, der Auskunft über das Wirken herrschaftlicher Macht gibt.
Als unerschöpfliches Reservoir schildert Farge das Archiv. Die Namen und Lebensläufe der Vielen, der angeblich Namenlosen stehen für Anstrengungen - für vielerlei Formen des Versagens wie des Glücks. In Einzelepisoden folgt die Historikerin den Unregelmäßigkeiten, wenn nicht Brüchen dieser Leben.
Gerade in seiner Materialität, in seinen Prozeduren wie Skurrilitäten - und den stets möglichen Überraschungsfunden lässt Farge den »Geschmack« des Archivs erkennen.
http://www.wallstein-verlag.de/9783835305984.html
Einen kurzen Auszug übersetzte Alf Lüdtke und präsentierte ihn in WerkstattGeschichte 1993:
http://www.werkstattgeschichte.de/werkstatt_site/archiv/WG5_013-015_FARGE_ARCHIVS.pdf

http://archiv.twoday.net/search?q=facebook (derzeit 190 Treffer)
http://www.freesound.org/
Weitere Klangarchive unter
http://archiv.twoday.net/topics/Musikarchive/
El Portal de Portales Latindex (PPL) proporciona acceso a los contenidos y textos completos de revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, el Caribe, España y Portugal, adheridas al movimiento de acceso abierto. El objetivo de este portal es difundir el conocimiento científico que se publica en la región iberoamericana. El desarrollo informático utiliza el OAI Harvester2 desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP) basado en el protocolo OAI-PMH.
Nicht alle Quellen sind in BASE!
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Open_Access#Open-Access-Portal_in_der_Wikipedia
Dazu Hubertus Kohle: Fast die Hälfte aller Leibniz-Preisträger stellt hier 10 ihrer nach eigener Einschätzung wichtigsten Publikationen online und open access zur Verfügung, der Erschließungs-Aufwand, der betrieben wurde, ist enorm. Zur Erinnerung: Der Leibniz-Preis ist das Größte, was ein Forscher in Deutschland erreichen kann. Er ist mit mehreren Millionen Forschungsgeld verbunden und jeder Menge Renommée. Der Gedanke hinter dem Projekt: Angesichts der Tatsache, dass online und open access weiterhin ein Schattendasein fristen und vor allem als Publikationsmodus des Minderwertigen verschrieen sind, sollte die Präsenz von höchstrenommierten Forschern das Image des Mediums bessern. Klingt logisch, nicht wahr? Ich mache die Probe aufs Exempel und schaue unter dem einzigen Leibniz-Preisträger aus der Kunstgeschichte nach: Martin Warnke aus Hamburg. Ich hatte es befürchtet: nichts. Gibt es jemanden, der ihn davon überzeugt, dass das ein sehr schönes Projekt ist? Ich werde es selber mal versuchen, aber seine Skepsis gegenüber dem Medium ist bekannt. Dann schaue ich mal unter dem Namen des jetzigen DFG-Präsidenten: Matthias Kleiner. Wieder nichts. Das ist dann doch schon auffällig, ist doch die DFG der treibende Faktor hinter dem Projekt.
http://blog.arthistoricum.net/leibniz-publik/
Schon die Namensgebung, die zur Verwechslung mit Leibniz Open einlädt, dem Repositorium der Leibnitz-Gemeinschaft,
http://archiv.twoday.net/stories/38758116/
ist verfehlt:
Siehe auch meinen Kommentar zu
http://log.netbib.de/archives/2011/09/10/bucher-und-aufsatze-von-leibnizpreistragern-gratis-im-netz/
Die von der BSB verantwortete Präsentation signalisiert: Open Access ist langweilig!
Technisch lehnt sie sich an das Projekt Digi20 an (das aber schon durch die Schlagwortwolke auf der Startseite einen flotteren Eindruck macht), es gibt also eine Volltextsuche, aber keine gekennzeichneten Permanentlinks für Einzelseiten oder Werke. Man kann allerdings die URL kürzen und erhält dann z.B.
http://www.leibniz-publik.de/de/fs1/object/display/bsb00058769_00011.html
Schon die Beschränkung auf maximal 10 Arbeiten finde ich nicht gut. Das niederländische Cream of Science ist da für mich eher ein Vorbild:
http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/mettrop.html
http://archiv.twoday.net/stories/5910055/ (Archivalia-Meldung von 2009 zur Planung von Leibniz Publik)
Sind zwei kurze Aufsätze von Jürgen Habermas wirklich eine großartige Werbung für Open Access? Wer soll die in Leibniz Publik auffinden?
Update: http://archivbib.twoday.net/stories/dfg-erste-sahne/ (mit korrekter Quellenangabe)
mehrfach wurde hier auf die Forschungsblockade durch den Internationalen Suchdienst (ITS) des Roten Kreuzes in Bad Arolsen hingewiesen. Der ITS weigert sich seit Januar, Arbeitskopien herauszugeben, die für eine Recherche im Auftrag des Bezirksamts Neukölln bestellt worden waren. Damit verhindert er sei als einem Dreivierteljahr erfolgreich Forschungen zu Zwangsarbeit, Holocaust und Widerstand in Berlin.
Anfangs begründete der ITS dies damit, dass einzelne Listen, etwa 13 Blatt mit Namen von niederländischen Zwangsarbeitern "Bestände" seien und als solche nicht laut Benutzerordnung herausgegeben werden dürfen. Später weitete der ITS seine Definition von "Beständen" dahingehend, dass er jede einzelne "als selbständig erkennbare Schriftguteinheit" als "Bestand" definiert. Diese Definition scheint dahin zu gehen, dass der ITS jedes einzelne Dokument als "Bestand" interpretiert und daher der Auswertung durch Forscher vorenthalten kann. Jedenfalls hat der ITS sämtliche im Januar bestellte Dokumente zurückgehalten - sowohl umfassende Listen als auch einzelne Dokumente.
Die Presse hat in den letzten Wochen darüber geschrieben, u. a. die Juedische Allgemeine vom 1.9.2011: http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/11133 (ferner FAZ 9.8.11 und ND 9.9.11; leider online nicht lesbar, aber beide Artikel verschicke ich gerne auf Nachfrage.)
Daher zwei Fragen an alle Kolleginnen und Kollegen der Archivliste:
1.) Wie sind Ihre Erfahrungen mit Kopien, die Sie beim Internationalen Suchdienst bestellt haben?
2.) In obigem Artikel ist die Rede davon, dass kommenden Oktober eine Tagung von Archivaren stattfinden. Es steht zu befürchten, dass dabei diese merkwürdige Praxis, die der ITS derzeit unter Missachtung seiner Benutzerregelung und unter willkürlicher Umdefinition von Archivbegriffen praktiziert, um damit die Forschung zu "regulieren", abgesegnet wird. Weiß jemand von ihnen, wann diese Tagung stattfindet, wer daran teilnimmt und ob sie öffentlich oder geheim ist? Ist die Presse eingeladen?
Weitere Links zu Beiträgen aus den vergangenen Monaten:
http://www.gedenkstaettenforum.de/offenes-forum/offenes-forum/news/suchdienst_des_roten_kreuzes_blockiert_historische_forschungen_zu_zwangsarbeit_und_holocaust_in_berl/
http://archiv.twoday.net/stories/16556128/,
http://archiv.twoday.net/stories/25481910/,
http://archiv.twoday.net/stories/25481967/,
http://archiv.twoday.net/stories/38745320/,
Mit besten Grüßen
Bernhard Bremberger
-----------------------------------
Dr. Bernhard Bremberger
Reuterstrasse 78
12053 Berlin
Tel. 030 / 6237187
www.zwangsarbeit-forschung.de
Aus der Archivliste
Beispiel einer digitalisierten Handschrift:
http://www.uni-trier.de/index.php?id=41041&zimk_stmatthias[action]=showDetails&zimk_stmatthias[uid]=353&zimk_stmatthias[tabelle]=kodizes
Am Mittwoch, 15. November 1972 um 15 Uhr besetzten Mitglieder des "Aktionsrates Wohnungsnot" das Haus Grevener Straße 31. Bereits ein Jahr lang stand dieses Gebäude leer, es sollte für den geplanten Umbau des Kreuzungsbereiches abgerissen werden. Damit begann eine viele Jahre andauernde, zum Teil sehr hitzige Auseinandersetzung um fehlenden Wohnraum und besetzte Häuser in der Stadt.
Der bekannteste Fall ist die Besetzung des Hauses Frauenstraße 24 am 3. Oktober 1973. Aber auch die nächtliche Besetzung der Häuser in der Sertürner Straße, an der sich etwa 500 Personen beteiligten, die Besetzung der Marientalstraße 8 oder des Coca-Cola-Gebäudes an der Steinfurter Straße sind manch einem noch in der Erinnerung.
Alle Aktionen haben zu einem umfangreichen Medien-Echo geführt. Nicht nur die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung berichteten über die Ereignisse, auch die sogenannten alternativen Blätter wie Knipperdolling, Stadtblatt und Grünes Blatt sowie der Semesterspiegel informierten regelmäßig über die Aktivitäten der Hausbesetzerszene.
Inwieweit es den Hausbesetzern in Münster in den Jahren 1970 bis 1982 gelang, ihre Themen, Forderungen und Ziele in der Lokalpresse und auf der Tagesordnung des Stadtrates zu platzieren, hat Jessica Bönsch untersucht. Die Historikerin hat sowohl Flugblätter und Veröffentlichungen der Hausbesetzer als auch die Medienresonanz und die Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Rates der Stadt Münster aus dieser Zeit analysiert. Ihre Ergebnisse stellt sie anhand von Beispielen vor.
INFO
Stadtarchiv Münster
An den Speichern 8 in Coerde
15. September, 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
http://www.grabbe-portal.de
Das Portal wurde erarbeitet in Kooperation mit dem Heinrich-Heine-Institut der Stadt Düsseldorf und dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren der Uni Trier und gefördert von der DFG. Zugänglich ist hier der volle Text der Kritischen Akademie-Ausgabe der Werke und Briefe Grabbes, ergänzt um weitere seit dem Erscheinen der Ausgabe bekanntgewordene Briefe. Der Text ist verknüpft mit den digitalen Faksimiles sowohl der Handschriften (soweit vorhanden) als auch der Erstdrucke; ebenfalls stellenweise verknüpft ist der volle Kommentar der Ausgabe.
Technisch baut das Portal auf den Erfahrungen auf, die Heine-Institut und Kompetenzzentrum bei der Arbeit am Heine-Portal (http://www.heine-portal.de/ )gewonnen haben. (INETBIB)
Und ist genauso ein benutzerunfreundlicher Murks. Ich habe
gerade minutenlang auf den Bildschirm gestarrt, um
herauszufinden, wie man im Faksimile des "Barbarossa", das
rechts angezeigt wird, blättern kann. Antwort: Gar nicht!
Man muss links im E-Text auf das blaue kleine Seitensymbol
klicken. Vielleicht mögen es Grabbe-Wissenschaftler ja,
wenn es möglichst enigmatisch und kontra-intuitiv zugeht
und man erst eine Anleitung durchlesen muss - ich aber
nicht!
Von fehlenden Permalinks für die Einzelseite mal ganz zu schweigen!

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa
(Von den Adressen http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/blockbuecher
und http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/blockbooks
wird automatisch weitergeleitet.)
Den beteiligten BLO-Mitarbeiter(inne)n danke ich sehr herzlich für ihre Arbeit.
Die Präsentation bietet als Ergänzung zu den bisherigen lokalen Angeboten einen strukturierten Zugangs zu den Werken, die in Form von mehrseitigen xylographischen Drucken des 15. Jahrhunderts verbreitet wurden. Besonders vorteilhaft ist die Möglichkeit, Digitalisate der Drucke mit Thermographieaufnahmen der Wasserzeichen und Metadaten sowie typographischen Ausgaben zu verknüpfen. Daneben werden die Blockbücher unter den jeweiligen Vorprovenienzen (insbesondere bayerische Klosterbibliotheken) und den heutigen Aufbewahrungsorten (Sammlungen) aufgelistet:
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa-werke
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa-provenienz
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa-sammlungen
Die Präsentation wird in der Restlaufzeit des Projekts (bis Mitte 2012) um weitere Informationen angereichert. Korrekturen und Ergänzungen nehmen wir gerne entgegen; auch für Hinweise auf weitere Blockbücher des 15. Jahrhunderts, die bereits im Internet zugänglich sind, wären wir dankbar. (Bettina Wagner in Incunabula-L)
Natürlich wird die Linksammlung "Blockbücher" von Wikisource von der BSB nicht verlinkt:
http://de.wikisource.org/wiki/Blockbücher

*Fachgruppe Historische Hilfswissenschaften*
Montag, 14. November 2011, um 17.00 Uhr
/zu folgenden Themen:/
Prof. Dr. Eckart Henning M.A.: Vom Quellenwert der Bilder
und
Priv.-Doz. Dr. Klaus Neitmann (Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs): Vom Quellenwert der Urkunden unter besonderer Berücksichtigung der Editionsprobleme
Die Fachgruppe Historische Hilfswissenschaften innerhalb des HEROLD, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, lädt zu regelmäßigen thematischen Vortragsveranstaltungen ein. Anliegen der Reihe ist es, sich in Vorträgen und Einzelprojekten der Pflege und weiteren Entwicklung hilfswissenschaftlicher Fächer im Raum von Berlin und Brandenburg zu widmen. Neben der Familiengeschichtsforschung und Wappenkunde sollen als "verwandte Wissenschaften" auch Disziplinen wie die Urkundenlehre und Aktenkunde, Schriftkunde, Namenforschung und Historische Geographie, die Siegel-, Münz- und Medaillenkunde, die Fahnen- und Flaggenkunde, die Insignologie oder das Ordenswesen einbezogen werden.
Veranstaltungsort ist das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
(Boltzmannstraße 14, 14195 Berlin-Dahlem).
Um telefonische Voranmeldung wird wegen der begrenzten Zahl der
verfügbaren Plätze herzlich und dringend gebeten!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Sekretariat: Simone Pelzer Tel. (030) 8413-3701
oder:
E-Mail: *mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de*
via Marburger Mailingliste

Mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher kamen trotz regnerischen Wetters zum Tag des offenen Denkmals nach Schloss Kalkum; das Landesarchiv war damit einer der Top-Acts des diesjährigen Denkmaltages in Düsseldorf.
Passend zum Motto des Tages „Romantik, Realismus, Revolution – Das 19. Jahrhundert“ hatte das Landesarchiv in seiner Außenstelle im Schloss Kalkum ein reiches und vielgestaltiges Kulturprogramm aufgelegt. In Führungen, Vorträgen, Workshops, Rezitationen, Konzerten und einer Ausstellung wurden schlaglichtartig die politischen Umbrüche, aber auch die Lebenswelten von Adel und Bürgertum im 19. Jahrhundert anschaulich und am historischen Ort erlebbar. Nicht nur Erwachsene wurden dabei angesprochen, sondern ganz bewusst auch Kinder. Mit einem Workshop zur Revolution, historischen Kinderspielen, einer Schreibwerkstatt und der Möglichkeit zum Papierschöpfen und Siegelgießen bot das Landesarchiv Geschichte zum Anfassen. Die Beteiligung am Tag des offenen Denkmals ist Teil der historischen Bildungsarbeit des Landesarchivs NRW.
Kulturministerin Ute Schäfer, die das Programm am Morgen mit einem Grußwort eröffnete, würdigte die Rolle des Landesarchivs NRW bei der Vermittlung von Geschichte. „Gerade Kinder und Jugendliche erhalten in den originalen Quellen einen unverstellten Zugang zur Vergangenheit und können historisches Geschehen greifbar nachvollziehen. Mit ihrer historischen Kompetenz und ihren wertvollen Unterlagen sind Archive für die historisch-kulturelle Bildungsarbeit besonders wichtig.“ Die Landesregierung unterstütze gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden diese Arbeit durch die jüngst ins Leben gerufene Initiative „Bildungspartner NRW – Archiv und Schule“.
Das Landesarchiv NRW wird sich noch bis zum 6. Oktober (immer donnerstags um 19 Uhr in Schloss Kalkum) in einer Vortragsreihe mit dem Rahmenthema des Denkmaltages beschäftigen. Das Spektrum der Vorträge reicht von der Rheinromantik über die Revolution von 1848/49 in Rheinland und Westfalen, die Reichsverfassungskampagne, die Geschichte der Schokoladenproduktion bis hin zur Entwicklung der Neugotik. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Zu den Vortragsterminen ist auch die Ausstellung des Landesarchivs zum Tag des offenen Denkmals noch zugänglich. Nähere Informationen zur Vortragsreihe finden Sie auf der Internetseite des Landesarchivs NRW.
Kontakt:
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Abteilung Rheinland
Tanja Priebe
Mauerstraße 55
40476 Düsseldorf
Tel. 0211 – 220 65 214
Fax 0211 – 220 65 55 214
E-Mail: tanja.priebe@lav.nrw.de

Eingereicht bei Wiki loves monuments von Sissssou
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://agfnz.historikerverband.de/?p=854
PS:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/09/12/early-modern-peace-treaties-a-postscript/
Die Bände stehen eigenartigerweise bei HathiTrust als Public Domain zur Verfügung.
Zoepfls Artikel über Matthäus Marschalk von Pappenheim ist somit früher online einsehbar als mein eigener (in Worstbrocks Humanismus-VL).
http://hdl.handle.net/2027/uc1.b3281028?urlappend=%3Bseq=29
Update: Und schon sind sie wieder weg, siehe Kommentar.
Link zur Seite der Tatortfolge

".... Was verbindet eigentlich die Beatles mit einem Krimi? Eine Frage, die sich der Betrachter des Buches von Richard Lifka und Christian Pfarr unmittelbar nach dem Lesen seines Titels stellt. Ist es der Songtext „Help!“, der die beiden Autoren auf die Idee brachte, 10 originelle Beatles-Krimis zu veröffentlichen .... Auch „Yesterday“ veranlasste die beiden Autoren dazu, den Mythos Beatles bestehen zu lassen und statt dessen einen Adligen zu opfern. Doch als wären das der Schandtaten nicht genug, gehen sie gehen sogar soweit, historisch wertvolle Erbstücke zu vernichten und eine junge Archivarin in den Tod stürzen zu lassen. Welch eine heroische Tat! Und alles nur, um den Ruf vier berühmter Musiker zu retten. ...." aus der Besprechung auf dem Weblog Beatleskrimis.
Beim diesjährigen Ferienspass im Landesarchiv Liechtenstein konnten sich die Kinder auf die Spur der Hexen in Liechtenstein begeben. Auch der "Archivgeist" liess sich blicken,
,,Bei einem Besuch des Landesarchivs waren die Mitglieder des Bildungsausschusses nicht nur von seinem architektonischem Aufbau und seiner umfassenden Arbeit vor Ort in den Werkstätten beeindruckt, sondern auch von seiner vielseitigen Fachlichkeit." Diese besondere fachliche Stärke stelle das Archiv nicht allein dem Land zur Verfügung, sondern auch den Kreisen, Städten und Gemeinden sowie Privatunternehmen.
,,Da es dabei auch darum gehen muss, dass diese Fachlichkeit aufrecht erhalten werden kann, bedarf es natürlich einer gewissen Ausstattung mit Fachpersonal. Ich bin deswegen froh, dass wir die Kürzungswelle der letzten Jahre im Bereich des Archivwesens mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 stoppen konnten." Dabei seien neue Mittel für die Ausbildung für Nachwuchs im Archivwesen zur Verfügung gestellt worden. Des Weiteren habe es eine Aufstockung von Mitteln für zeitweise benötigte zusätzliche Kräfte beispielsweise im Funktionsbereich der technischer Aufbereitung von Aktenbeständen, Aktenverzeichnungsaufgaben, Duplizierung von aufgenommenen Sicherungsfilmen gegeben. Damit die Archive und Bibliotheken dieses Landes auch als historisches Gedächtnis das bedrohte schriftliche Kulturgut retten könnten, habe das Kulturministerium im Juni dieses Jahres Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.
,,Ein wichtiges Signal, das während der Kulturkonferenz im Mai von Kulturminister Dr. Klug ausging, war, dass seiner Überzeugung nach im Kulturbereich die Grenzen der Einsparmöglichkeiten erreicht seien. Weitere Einschnitte seien nicht tragbar." Trotz dieser klaren und starken Aussage des Ministers könnten weitere Umstrukturierungen im Personalbereich heute nicht pauschal ausgeschlossen werden, da technische Entwicklungen den benötigten Personal- und Fachpersonalbestand verändern könnten. Aber die Äußerung von Minister Klug sei ein starkes Signal, von künftigen Personalkürzungen abzusehen, erklärt Funke abschließend. ...."
Quelle: Presseticker Landtag Schleswig-Holstein, 25.8.2011
Link zum Plenarprotokoll der Sitzung (PDF)
Tomb Finder from saassoft on Vimeo.
TombFinder.com is a web-based TombFinder.com is a web-based memorial archive and social network that uses geo-location technology to easily and inexpensively direct clients to burial plots while creating a passive revenue stream. Unlike a static memorial website or expensive and often out of date GIS systems which offer no cemetery involvement, control or input, our system accurately pinpoints plots in real-time, is interactive through our web service and mobile tools, and give cemeteries control, ability to make money, connect clients to communities and has a low initial cost. that uses geo-location technology to easily and inexpensively direct clients to burial plots while creating a passive revenue stream. Unlike a static memorial website or expensive and often out of date GIS systems which offer no cemetery involvement, control or input, our system accurately pinpoints plots in real-time, is interactive through our web service and mobile tools, and give cemeteries control, ability to make money, connect clients to communities and has a low initial cost.Memory of a Nation from Lightwell on Vimeo.
Visitors to the Memory of a Nation exhibition at the National Archives of Australia can view a range of documents relating to Australia's past. The Archives' collection contains many records on paper such as war records, immigration certificates, photographs and drawings, as well as film footage and physical objects.Visitors can use the multitouch interactive program to browse a range of documents and zoom in to details. The program lets visitors handle a digital version of the paper artefact without any concern for object conservation. Thematic links between records encourage exploration by visitors.
The 'show everything' interface was developed in conjunction with Dr Mitchell Whitelaw from the University of Canberra. Exhibition Design by Freeman Ryan Design.
Responsible body
London Metropolitan archives
Objective
The project seeks to demonstrate the importance of information management in recording not only the sporting events held during the games, but also the impact that the games have on the host city.
Products
A website which provides a definitive online directory of resources and archives relating to the games recording where material is held and how it can be accessed.
Completion date
2012 (London Olympic Games) ...."
Homepage ICA
New Maps of Time, Vienna: Vienna Sound Locations from sound locations on Vimeo.
'New Maps of Time' is a workshop about mapping spaces (mental, architectural and environmental) using sound as a means to analyze and express actions within a space. What is seen here can be considered a document of our activities and sketches for ideas that can be developed further. The workshop was held in August 2011 and was hosted by Transforming Freedom and X-OP. This video combines a sequence of sounds recorded in different locations with images and video from the same places. A more complete report can be found at: maaheli.ee/main/archives/2731
"Klappentext
Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats. Dieser "Klasse" fehlt jede Zukunftshoffnung: Die selbst gesetzten Maßstäbe an die universitäre Lehre lassen sich nicht aufrecht erhalten; die eigene Forschung führt zu keinem greifbaren Resultat. Für das Spezialgebiet des Rüdiger Stolzenburg, den im 18. Jahrhundert in Wien lebenden Schauspieler, Librettisten und Kartografen Friedrich Wilhelm Weiskern, lassen sich weder Drittmittel noch Publikationsmöglichkeiten beschaffen. Und dann erweist sich das angeblich sensationelle neue Material aus dem Nachlass von Weiskern auch noch als Fälschung. Seine Bemühungen, eine ihn ruinierende Steuernachforderung zu erfüllen, machen ihm endgültig deutlich: die Welt, die Wirtschaft, die Politik, die privaten Beziehungen - alles ist prekär. Sie zerbrechen, sie setzen Gewalt frei, geben in großem Ausmaß den Schein für Sein aus. "
Weitere Informationen auf Perlentaucher.

"Vom 9. Oktober bis 9. November 2011 werden wir - und das bundesweit erstmalig - einen ersten Versuch starten, um das umfangreiche Thema „Stasi und die ostdeutsche Homosexuellenbewegung“ in Form einer kleinen Ausstellung mit dem Titel STASI Schwule Staatsräson und einer interessanten Buchpräsentation (mehr Infos dazu folgen) öffentlich in Leipzig zu präsentieren.
Geplant ist das gesamte Projekt später als erweiterte Wanderausstellung (ohne die Tafeln der BStU Leipzig), wobei wir hier schon jetzt tatkräftige Unterstützung von der BStU (Außenstelle Leipzig) erfahren haben, denn unsere erste geplante Übersicht wird eine kombinierte Version sein und dazu stellt uns die BStU Leipzig 18 großformatige Anschauungsobjekte bereit, die wir durch unsere Darstellungen ergänzen.
Um die Aufarbeitung dieses Themenkomplexes, der bisher noch keinerlei öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr, zu bewerkstelligen, haben wir die AG "STASI und die ostdeutsche Homosexuellenbewegung“ gegründet, die der Karl-Heinrich-Ulrichs-Gesellschaft (ff. KHU-G) angegliedert ist.
Der erste Versuch um 1986, die KHU-G im ehemaligen diktatorischen und kommunistisch regierten Ostdeutschland zu gründen schlug fehl, da die STASI geschickt fungierte und schwule Spitzel dafür einsetzte, diese Aktivitäten einzudämmen und das leider auch erfolgreich schaffte.
Die STASI legte dazu u. a. die OPK "Verbund" mit über einhundert Seiten an, die wir großenteils im Bestand haben und auszugsweise präsentieren werden. Unterdessen ist die Karl-Heinrich-Ulrichs-Gesellschaft seit 2010 gegründet und sie ist bundesweit die einzige Initiative, die sich mit der Aufarbeitung und Veröffentlichung des Themas „Stasi und die ostdeutsche Homosexuellenbewegung“ beschäftigt und in einer zweiten Präsentation 2012 dann auch bundesdeutsche "Fälle" präsentieren wird.
Also bitte schön neugierig bleiben!.
Die Ausstellung wird am 9. Oktober 2011 eröffnet und ist dann täglich, also bis zum 9. November 2011 immer Mo. – So. von 13 – 21 Uhr geöffnet und im Karl-Heinrich-Ulrichs-Zentrum in der Leipziger Nikolaistr. 16 (nur 300 Meter vom HBF entfernt) durchgehend zu sehen.
Die Buchpräsentation wird ebenfalls am 9. Oktober stattfinden.
"
Quelle: Rosa Archiv Leipzig, 30.8.2011
Bird Achive from Fredrik Strid on Vimeo.
MECHANICAL SCULPTURE, 60x60x45cm. Lacquered wood from a cabinet circa 1920, electrical motor, glass, lamps, mechanical parts. Ten small birds are slowly passing in a laterna magica box. A motor is moving a paper with cut outs of birds; the paper is backlit in the box. This is a short video excerpt from the mechanical light box sculpture Bird Archive.Quelle: Homepage Frederik Strid
Im Mittelpunkt stand vor allem das Bewahren der Museums- und Archivsammlungen unter konservatorischen Gesichtspunkten mit besonderem Hinblick auf Planung, Bewirtschaftung, Klima und Gesamtbilanzierung. Anhand von aktuellen Beispielen aus der Schweiz, Dänemark, Schweden, Österreich und Deutschland wurden Lösungsmöglichkeiten für wirtschaftliche, energieeffiziente und kostengünstige Depot- und Archivbauten aufgezeigt und Schwierigkeiten diskutiert. Dabei wurden sowohl Neubauten, umgebaute Bestandsgebäude und neu genutzte Baudenkmale vorgestellt, in welchen die umfangreichen Sammlungen von Museen und Archiven aufbewahrt werden."
Quelle: Denkmalpflegezentrum Benediktbeuren, 12.5.11
Brewster Kahle and Rick Prelinger on the "Understanding 9/11: A Television News Archive" from Democracy Now! on Vimeo.
DemocracyNow.org - As the nation prepares to mark the 10th anniversary of the September 11 attacks, a pair of leading Internet archivists are launching an ambitious project called Understanding 9/11: A Television News Archive. The online archive catalogs 3,000 hours of domestic and international TV news footage from 20 channels from the week around September 11, 2001. The footage begins within minutes of the attack on the World Trade Center as television stations across the world aired images of raging fires, collapsing buildings, and a terrified public. Anchors struggled to make sense of the shocking images streaming in from the World Trade Center and Pentagon. Television news coverage of the September 11 attacks and their aftermath not only documented one of the most important events in mass memory, but also influenced public perception. The archive was organized by Internet archivists Brewster Kahle and Rick Prelinger, who are interviewed by Amy Goodman on Democracy Now! August 24.Rick Prelinger is an archivist, writer, filmmaker and founder of the Prelinger Archives, a collection of 60,000 advertising, educational, industrial and amateur films acquired by the Library of Congress in 2002 after 20 years' operation. Brewster Kahle is a computer engineer, Internet entrepreneur, activist, digital librarian and founder of the Internet Archive and the Open Content Alliance, a group of organizations committed to making a permanent, publicly accessible archive of digitized texts.
For the complete transcript, to download the podcast, or for Democracy Now!’s reports on the Sept. 11 attacks and everything that happened afterwards, visit http://democracynow.org/tags/
FOLLOW DEMOCRACY NOW! ONLINE:
Facebook: http://facebook.com/democracynow
Twitter: @democracynow
Subscribe on YouTube: http://youtube.com/democracynow
Daily Email News Digest: http://democracynow.org/subscribe
Please consider supporting independent media by making a donation to Democracy Now!
today, visit http://democracynow.org/donate/YT
Unreal City Archive from Brendan Rehill on Vimeo.

Amazon-Fundstück. Vielen Dank nach München!
ETC, etc. from George Karalis on Vimeo.
The Experimental Television Center has been a hub for video art since the advent of the medium. In summer of 2011, the center ended the majority of its programs including all artist residencies and grants programs. The studio space in Owego, NY was also closed. This short documentary video explores the spatial concept of ETC as it moved from a physical, actively productive studio to a Web-based, historical archive. Foto Lukas Dostal
Foto Lukas Dostal"26.09.2011–11.11.2011
Seidengasse 13 – Ein Haus für Literatur
Foto-Ausstellung von Lukas Dostal
Mit gezieltem Blick und inszenatorischen Mitteln begegnet der Fotograf Lukas Dostal dem Literaturhaus und schafft damit ein Porträt als Bestandsaufnahme. Nicht die vielfältigen Aktivitäten stehen im Vordergrund, sondern Architektur und Atmosphäre, Literatur und Topografie.
Das Literaturhaus hat viele Gesichter, ist Zentrum und Zuhause und will Inspiration sein. Die Bibliothek und das Archiv sind Echoraum für Empirie und Erkenntnis, für Abenteuer und Erlebnis, für Fiktion und Fakten, für Vergangenheit und Gegenwart, für Reflexion und Rituale: Bücher als Boten, als Begleiter, das Archiv als Hüterin von Schätzen, auch von Biografien.
Zugleich soll die von Robert Huez kuratierte Schau auch die Entwicklung der drei Vereine festhalten, v. a. aber die ersten 20 Jahre eines Ortes im Dienste der Kultur: Seidengasse 13 –Ein Haus für Literatur.
Lukas Dostal, geb. 1964, lebt und arbeitet in Wien und Bad Fischau. Absolvent der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, seit 1992 selbstständiger Fotograf. http://www.lukasdostal.at
Eröffnung: Mo, 26.09.2011, 19.00 Uhr
Öffnungszeiten: 26.09.–11.11.2011, Mo–Mi jeweils 9.00–17.00 Uhr (September),
ab Oktober Mo–Mi 9.00–17.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr."
Quelle: Literaturhaus Wien
Vorstellung des Nationalarchivs from Edy Brix on Vimeo.
Leitfaden für Archivbenutzer from Edy Brix on Vimeo.
Dienstleistungen from Edy Brix on Vimeo.
Ablieferung von Archivalien from Edy Brix on Vimeo.
In dem neuen, gemeinsamen Archiv- und Dokumentationszentrum werden beide Institutionen mit neuen Konzepten eine aktivere Rolle im Kulturleben der Stadt Köln und darüber hinaus spielen. Insbesondere die Möglichkeit zur Bereicherung des baukulturellen Dialogs in Köln durch die Nachlasssammlung des Historischen Archivs, die Bestände der Bibliothek zu Architektur und Stadtplanung sowie des Rheinischen Bildarchivs zur Kölner Stadtentwicklung sind für das Architektur-Forum Rheinland von Interesse.
Über ihre Planungen berichten die beiden Leiterinnen von Archiv und Bibliothek, Bettina Schmidt-Czaia und Elke Purpus. Felix Waechter vom Büro Waechter + Waechter stellt seinen Entwurf vor und erläutert, welche Möglichkeiten das neue Haus für die Arbeit und die Öffentlichkeitswirkung von Archiv und Bibliothek bietet.
Termin: Montag, 12. September 2011, 19.30 Uhr
Ort: Historisches Archiv der Stadt Köln, Heumarkt 14, 50667 Köln"
Quelle: BauNetz, 6.9.2011

Entwurf Max Dudler, Quelle: Baunetz.de
"Reue in Bronze" - so betitelt Inci Yilmaz seinen Artikel in der StadtRevue, Ausgabe 8/2011 und bilanziert: " .... Dass es besser geht, zeigt der lediglich mit einer Anerkennung honorierte Entwurf des Schweizer Architekten Max Dudler. Basierend auf einer typologischen Analyse der Tradition städtischer Kulturbauten, überträgt er die Anforderungen in eine zeitgemäße und konsequente Architektursprache. Insbesondere der gebäudehohe, beeindruckend möblierte Lesesaal überzeugt neben seiner Dimension auch mit seiner Organisation, einer angemessenen Zugänglichkeit der Bestände, einer besonderen Atmosphäre. Dieser Raum würde eher als das pseudo-plakative »Schatzhaus« eine »auratische« Wirkung entfalten und Lust am Kulturgut entfachen.
Leider entgeht Köln mit der Entscheidung für Waechter + Waechter ein solches Forschungs- und Raumerlebnis und somit ein ernstzunehmendes architektonisches Zeichen. Stattdessen ist nun ein mittelmäßiger Bau zu erwarten. Den ersten Kaffee im neuen Forschungszentrum prophezeit Baudezernent Bernd Streitberger optimistisch für 2015. "
Wäre ein schöner Beginn für die morgige Diskussion .......
100 suns from Jodi Darby on Vimeo.
Produced by Jodi Darby. Score by Marisa Anderson.100 Suns is a composition of declassified nuclear test films from 1952-61 as well as other archival 16mm footage.
Quelle: Spiegel 25/2011, Hohlspiegel
Cabinet of Curiosities from GaboV on Vimeo.
Cabinet of curiosities is a video installation that I made in 2011 for the annual exhibition at the Academy of Media Arts Cologne – Germany. Visitors can browse through personal diaries developed by different people who have interacted with a work of Media Art, narrating their own personal experience.These personal diaries are the result of a series of workshops where I made an open call for different types of people inviting them to develop their own personal diary where they described and reinterpreted a work of art over a period of four days.
The original diaries, which resulted from those workshops, were hung and exhibited in this cabinet of curiosities along with two screens that showed the video documentation of the workshops.
From these workshops, I published a book that describes each and every one of the personal diaries. When people read this book in the video installation, it interacted with the space illuminating the original diaries and also bringing parallel stories of videos and interviews related to the personal diary, the person who did it, the artwork and the artist.
Every original diary and the parallel histories appeared and disappeared while reading the book, as a light that was illuminated or hid the histories of the experiences that at some time a person had with a work of art.
The inert bodies hanging in the cabinet of curiosities returned to life across the reading of the histories in each diary, which gave a detailed narrative of the reinterpretation and experience that once had a stranger in an intimate relationship with a work of art.
After finishing the period of exhibition of the video installation, the original hanging diaries were returned to be preserved and archived in a series of encyclopedic volumes titled, "Codex Media Art."
Unter Kabarettisten und anderen Künstlern regt sich empörter Protest gegen den Exodus. Alfred Dorfer, Thomas Maurer oder Lukas Resetarits forderten die politischen Entscheidungsträger zu einer Lösung auf. Ob die kommen wird, ist unklar. Das steirische Landesarchiv kommt als Herberge nicht in Frage, da dort große Teile der Kabarett-Sammlung nicht ausgestellt werden dürften. Das Land Steiermark sicherte neben seiner jährlichen Zahlung von 10.000 Euro eine Sonderzahlung in der gleichen Höhe zu, um Iris Fink auf ihrem Posten zu halten. Der Bund zahlt nur vereinzelt für Programme und Ausstellungen. Eine allgemeine Subvention sei gesetzlich gar nicht möglich."
Quelle: Wiener Zeitung, 6.9.11
Visite virtuelle aux Archives départementales de l'Ain from Service TIC on Vimeo.
Une recherche aux Archives départementales de l'Ain Quelle: 2)
Quelle: 2)Mit einer Wanderpräsentation informiert das Historische Archiv in den nächsten Wochen und Monaten über seine jüngste Geschichte. Zwölf Info-Tafeln geben einen Einblick in die Bergungs- und Restaurierungsarbeiten und stellen mit eindrucksvollen Bildern und Texten das Ausmaß des Einsturzes dar. Auch der Neubau und die Geschichte des Historischen Archivs vor dem Einsturz kommen nicht zu kurz.
Die Präsentationseröffnung fand am Freitag, den 9. September von 12 bis 14 Uhr im Rathaus der Stadt Köln, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln statt.
Die Wanderpräsentation bleibt zunächst eineinhalb Wochen im Spanischen Bau des Rathauses und kann dort besucht werden. Dann geht sie auf Wanderschaft durch ganz Köln, um die Öffentlichkeit über Geschichte und Zukunftsaussichten des Archivs zu informieren. Zeitgleich wird die Ausstellung ab dem 10.09. auch bereits im Bürgerhaus Stollwerck in der Dreikönigenstr. 23 zu sehen sein, welches 24 Stunden geöffnet ist.
Öffnungszeiten der Wanderpräsentation im Spanischen Bau des Rathauses:
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8 bis 16 Uhr
Dienstag: 8 bis 18 Uhr
Freitag: 8 bis 12 Uhr
Interessenten, die die Wanderpräsentation in ihren eigenen Räumlichkeiten zeigen wollen, können sich jederzeit beim Historischen Archiv melden. Ansprechpartner ist Herr Neweling, frank.neweling@stadt-koeln.de, 0221-221 24146.
Quellen:
1)Stiftung Stadtgedächtnis, 9.9.11
2) Historisches Archiv Köln, Homepage

Slevogthof in Leinsweiler (Quelle: Wikimedia Commons, PD, Autor: Nitefly85)
"Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur hat den schriftlichen Nachlass des Landschaftsmalers Max Slevogt erworben. Damit solle das Erbe des Künstlers gesichert und für die Nachwelt erhalten werden, teilte das Kulturministerium in Mainz mit. Die Stücke stammten vom Sommer- und Alterssitz des Künstlers, dem Slevogthof im pfälzischen Leinsweiler. .... Bereits 1971 erwarb das Land Rheinland-Pfalz einen großen Teil seines Nachlasses."
Quelle: 3satText 09.09.11 18:58:01 S.506-1
Die Nachlassdatenbank des Bundesarchivs weist auf einen Teilnachlass (?) im Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg hin, der Veröffentlichungen, Ausstellungsdrucksachen, Zeitungsartikel und Fotos seiner Grabstätte enthält. Die Unterlagen stammen aus den Jahren 1918 bis 1992 und umfassen 0,1 lfd m.
Das Kalliope-Portal weist 111 Nachweise (i.d.R. Briefe von bzw. an Max Slevogt) in folgenden Institutionen aus:
Badische Landesbibliothek Karlsruhe
Bayerische Staatsbibliothek München
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Neckar/Handschriftenabteilung
Freies Deutsches Hochstift Frankfurt, Main
Generallandesarchiv Karlsruhe
Georg-Kolbe-Museum Berlin
Goethe-Museum Düsseldorf
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz/Pfälzische Landesbibliothek
Münchner Stadtbibliothek / Monacensia
Slevogthof Neukastel bei Leinsweiler (Pfalz)
Staatsbibliothek Bamberg
Staatsbibliothek Berlin / Handschriftenabteilung
Staatsbibliothek Berlin / Musikabteilung
Stadtarchiv Hannover
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Theaterwissenschaftliche Sammlung / Institut für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft Universität zu Köln
Universitätsbibliothek Giessen
Universitätsbibliothek Regensburg
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Wikipedia-Artikel Slevogt
Für Archivtagsbesucher interessant: Im Bremer Ratskeller befinden sich Fresken Slevogts, die einizgen erhaltenen neben denen auf den erwähnten Slevogtshof.
http://www.sueddeutsche.de/85D38N/190825/Evangelische-Kirche-baut-neues-Archi.html
Das Landeskirchliche Archiv zeigt auf seiner Internetpräsenz den Siegerentwurf des Architektenbüros von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg.
http://www.lkan-elkb.de/357.php
Grundsteinlegung soll am 16.09.2011 sein, die Fertigstellung ist für Mitte 2013 geplant.
In Wittenberg laufen die Vorbereitungen für die Sanierung des Schlosskirchenensembles auf Hochtouren. Pünktlich zum 500. Jahrestag des Thesenanschlages sollen Schlosskirche, Schloss und Co. in neuem Glanz erstrahlen. Vorher allerdings werden im Schloss erst einmal die Umzugskisten gepackt:

Roy Tennant hat vorgeschlagen, zu Ehren von Michael Hart, dessen Nachruf gestern hier erschien, etwas der Public Domain zu überstellen:
http://blog.libraryjournal.com/tennantdigitallibraries/2011/09/08/to-honor-project-gutenbergs-founder-dedicate-something-to-the-public-domain/
Ich habe mich nicht für einen Text entschieden, sondern für über 40 Fotos aus dem Schlossmuseum Eutin (Fotografieren gegen Extragebühr von 5 Euro erlaubt), die ich im Rahmen von Wiki loves monuments hochgeladen habe. Einige sind in der Collage oben zu sehen, Screenshot von
http://toolserver.org/~raymond/latest20.html
Beispiel:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eutin_2011_04.jpg Schlosskapelle (Nr. 13 im Screenshot oben)
http://www.copfs.gov.uk/sites/default/files/2010%20-%202011%20TT%20Report_0.pdf
Archives SENSibles from Obatala on Vimeo.
Une promenade patrimoniale au cœur d’une sélection d’archives représentatives de l’histoire du Pays basque.Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque

Historisches RWSG um 1940
" ....Kurzbeschreibung des Denkmals: Verklinkerter Stahlbeton-Getreidespeicher von 1936
.....
Grundstück: Schifferstraße 30 -32 47059 Duisburg
Gemarkung: Flur: Flurstück(e): Duisburg 17 18,98
Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals
Der östlich der Schwanentorbrücke gelegene verklinkerte Stahlbeton-Getreidespeicher der Rheinisch-Westfälischen-Speditions-Gesellschaft mbH (RWSG-Speicher) entstand im Jahre 1936. Der 10-geschossige, aus zwei Quer- und einem Langhaus H-förmig am Innenhafenbecken sich erstreckende Bau weist mit seiner Schauseite nach Westen, wo der höhergezogene Mittelteil einen Dreiecksgiebel und darüber einen Firstturm mit Zeltdach und Dachknauf aufweist. Die vollkommen glatten, von Querrechteckfenstern durchschnittenen und nur mit einfachem Stufensims nach oben abgeschlossenen Mauerflächen umhüllen in sieben Geschossen untergebrachte Schüttböden und 24 Speicherzellen für Getreidelagerung, die im Erdgeschoss durch schwere Rechteckpfeiler unterfangen sind.
Der Zustand der Gesamtanlage stellt sich auch nach 14 Jahren als unverändert im kompletten Originalzustand dar. Im Gegensatz zu den mittlerweile stark veränderten Mühlenkomplexen im östlichen Teil des Innenhafens: ehem. Mühlenanlage Küppers & Werner, heute Küppersmühle,Wehrhanmühle oder Allgemeiner-Speicher (Neubau) hat der bis heute fortdauernde Betrieb des RWSG-Speichers zur vollständigen Erhaltung von Architektur und technischer Ausstattung geführt.
Die Gesamtanlage des RWSG-Speichers erscheint daher in ihrem nahezu komplett originalen Zustand aus dem Erbauungsjahr 1933. Veränderungen am Außenbau sind nicht festzustellen, sämtliche Fenster- und Türöffnungen zeigen den ursprünglichen Zustand. Die Innenzonen bieten teilweise Raumcharakter von starker gestalterischer Anmut, zum Beispiel das unter dem Stahlbeton-Dachstuhl liegende Dachgeschoss, wo ein nahezu sakral zu nennender Raumeindruck entsteht. Diese Bautechnik macht den Speicherbau zu einem Anwendungsgebiet des armierten Betonbaues „par excellence“.
Auch sind im Originalzustand zahlreiche technische Einrichtungen des vertikalen und horizontalen Getreidetransports im Gebäudeinnern erhalten gebliebenden, wie Redler- und Becherwerke.
Umfang des Denkmals:
Gesamter Baubestand ohne technische Innenausstattung, einschließlich der am Hafenbecken vorgelagerten Portalkrananlagen mit ihrem Gleisunterbau.
Die Prüfung der Denkmaleigenschaften ist der folgenden Darstellung der Prüfschritte zu entnehmen:
Prüfung der Bedeutung für die Geschichte des Menschen: -
Prüfung der Bedeutung für Städte und Siedlungen
Der RWSG-Speicher ist ein weiteres Element der die Zweckbestimmung des Duisburger Innenhafens charakterisierenden Staffel der Getreidespeicher. Sie sind am Südufer des Innenhafens mit Bauten von etwa 1900 bis 1950 dokumentiert. Die Nordseite des Innenhafens wird heute nur mehr durch zwei historische Großkomplexe charakterisiert: Lehnkering und RWSG-Speicher.
Als typische historische Bauaufgabe einer Hafenstadt und als stadtbildprägender Teil der Duisburger Innenstadt ist das RWSG-Speichergebäude bedeutend für die Geschichte der Stadt und die städtebauliche Situation.
Eine Bedeutung für die Stadt Duisburg erwächst zudem aus der Tatsache, dass es sich bei dem Speicher um ein Unternehmen der Familie Alfred Flechtheim handelt, die nicht zuletzt über den
bedeuteten Sammler und Galeristen im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus zu Berühmtheit gelangte.
Aus dem Zeitraum der zweiten Hälfte der 1930er Jahre stammend, stellt der RWSG-Speicher einen authentischen Beleg der von der Organisation des damaligen NS-„Reichsnährstands“ betriebenen
Aktivität eines reichsweiten Speicherbauprogramms zur Sicherung der wirtschaftlichen Autarkie des „Dritten Reiches“ dar, wie er nur an wenigen Stellen der Bundesrepublik zu beobachten ist. Der
dem gleichen Programm entstammende sog. Koch-Speicher auf der gleichen Seite des Innenhafens ist mittlerweile verschwunden, so dass nach nahezu komplettem Neubau des Allgemeinen–Speichers der RWSG-Bau der einzige Beleg für diese Zeitspanne im Leben des „Brotkorbes des Ruhrgebiets“ darstellt.
Prüfung der Bedeutung für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse:
Eine Bedeutung für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse wird anhand des Speichers insofern anschaulich, als hier die Entwicklung der Umschlags- und Verarbeitungstechnik Wasser - Land abgebildet wird sowie der enge Bezug zwischen Stadtkern und dem für die ökonomische Entwicklung Duisburgs maßgeblichen Verkehrsareal.
Prüfung der künstlerischen Gründe für die Erhaltung und Nutzung: -
Prüfung der wissenschaftlichen Gründe für die Erhaltung und Nutzung
Für den Erhalt und die Nutzung des Speichergebäudes mit vorgelagerten Portalkrananlagen liegen architekturhistorische Gründe vor, da hier exemplarisch der Stand der Industriearchitektur auf dem Sektor des Großspeicherbaus anschaulich wird.
Prüfung der volkskundlichen Gründe für die Erhaltung und Nutzung: -
Prüfung der städtebaulichen Gründe für die Erhaltung und Nutzung
Darüber hinaus liegen städtebauliche Gründe für den Erhalt und die sinnvolle Nutzung des Bauwerkes vor, da anhand der historischen Speichergebäude bis heute der Standort Innenhafen im Stadtbild deutlich ablesbar ist. An städtebaulich exponierter Stelle flankiert der RWSG-Speicher markant gemeinsam mit dem Lehnkering-Speicher die Schwanentor-Brücke - gewissermaßen als nördliches Tor zur Stadt.
Auswertung der Prüfung der Kriterien für die Bedeutung
Die Bedeutung im Sinne des § 2 DSchG NRW wurde für die olgenden Kriterien nachgewiesen:
· Städte und Siedlungen
· Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse
Auswertung der Prüfung der Kriterien für die Erhaltung und Nutzung
Die Gründe für die Erhaltung und Nutzung im Sinne des § 2 DSchG NRW wurden für die folgenden Kriterien nachgewiesen:
· wissenschaftliche Gründe
· städtebauliche Gründe
Auswertung der Prüfung der Denkmalbegriffsbestimmungen
Die Denkmaleigenschaften im Sinne von § 2 DSchG NRW sind vorhanden."
Was war eigentlich so missverständlich an diesem Text:

Baustelle Landesarchiv Duisburg, 18.8.2011, Quelle: Wikimedia Commons (gemeinfrei)
Link zum Eintragungstext (PDF)
ARCHIVE TEAM: A Distributed Preservation of Service Attack from Jason Scott on Vimeo.
For the last few years, historian and archivist Jason Scott has been involved with a loose, rogue band of data preservation activists called The Archive Team. As major sites with brand recognition and the work of millions announce short-notice shutdowns of their entire services, including Geocities, Friendster, and Yahoo Video, Archive Team arrives on the scene to duplicate as much as they possibly can for history before all the data is wiped forever. To do this, they have been rude, crude and far outside the spectrum of polite requests to save digital history, and have used a variety of techniques to retrieve and extract data that might have otherwise been unreachable. Come for the rough-and-tumble extraction techniques and teamwork methods, stay for the humor and ranting.".... Welche Aufgaben hat ein Museum? Museen erfüllen mehrere Aufgaben gleichzeitig [sic!]. Die vier wichtigsten Bereich sind:
a) Sammeln
Während Archive hauptsächlich schriftliche Quellen sammeln (Dokumente, Akten, Briefe, ....), versuchen Museen, auch Sachgegenstände aus der Vergangenheit zusammenzutragen (Bekleidung, Münzen, Schulbücher, Haushaltsgegenstände, ....) ...."
Im aufgebauten Gegensatz zwischen (vermeintlich) emotionslosen Schriftquellen und den Emotions besetzten Sachquellen (z. B. Klamotten) lebt das Voruteil des spannungsarmen Archiv mit dem mühsam zu erschließenden Quellen fort. Solange solche Vorurteile, wenn auch unterschwellig, vermittelt werden, haben es die archivpädagogischen Bemühungen schwer, eine breite Wirkung zu erzielen.
Nebenkriegsschauplatz: Museen sammeln wohl auch Dokumente, Briefe und Akten. Dies ist ja nicht unrichtig. Aber: Wenn ich jung wäre, würde ich mir die Frage stellen, warum es eigentlich zwei Institutionen gibt, die dies tun. Man bräuchte ja eigentlich nur eine Sammelstelle; am besten die, die ohnehin mehr sammelt.
M. E. gilt es nun, das Archivbild in Schulbüchern zu prüfen und zu korrigieren. Klingt nach einer gemeinsamen Aufgabe für VdA, Geschichtslehrerverband und Buchverlagen.
This is just to say that if we think keeping our scholarly work primarily out of public sight [except for the occasional conference presentation] until its penultimate moment of publication in a conventional venue such as the academic journal or book, at which point quite a few years of our lives [mainly spent in the solitude of studies and libraries or other semi-private spaces where we could manage a foothold] may have been devoted to that work whose "arrival" in print may even occur long after we have moved on to other projects, then we risk working too much in the dark, apart from the world which has bequeathed to us our objects and methods of study and reflection [I might also add here that this traditional way of doing things also keeps our work sequestered within the academy, and does not allow us to reach a more broadly public audience, which, in my mind, is a real perversion of the term "humanities"]. We also do our work largely apart from the very peers whom we hope will welcome and even love it when it is "finished." [...]
I am also trying to say: we need to learn better how to live in the scholarly NOW, and blogs have certainly increased the opportunities for doing that. It takes some extra work, of course, to spend part of each day reading and commenting on blogs and maybe also contributing substantive posts to a weblog now and again, but the payoff is that the small burst of conversation that might occur in the last thirty minutes of a conference session has now been extended beyond the conference itself, maybe even for months on end. With traditional academic publishing, one might wait years, from the conception of a work to its completion and then publication in a traditional print venue, before one "hears" or "sees" any kind of reaction to one's work, and there might be no reaction at all, at least, not one that is palpably articulated, whether in a review or an email.
Heute (8. September 2011) wurde ein enormer Fortschritt erzielt: Alle 26.380 Artikel der Allgemeinen Deutschen Biographie („ADB“) sind mindestens einmal korrekturgelesen worden. Begonnen am 24. August 2005, hat es also 6 Jahre bis zu diesem Meilenstein gedauert. Momentan sind aber auch schon fast 5.000 Artikel im Bearbeitungsstand „fertig“, das heißt, sie sind
a) zweimal korrekturgelesen
b) mit dem Wikipedia-Artikel (soweit vorhanden) verlinkt
c) intern innerhalb der ADB verlinkt
d) mit einer PND-Nummer (soweit vorhanden) versehen.
Hoffen wir, dass es nicht bis September 2017 dauert, bis dieses Projekt abgeschlossen wird.
http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite
Details zum Bearbeitungsstand:
http://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Allgemeine_Deutsche_Biographie#Chronik.2C_Statistik_und_Wasserstandsmeldung
Seit Februar 2010 ist ein mit viel öffentlichem Geld erstelltes Volltextangebot verfügbar. Rasch stellte sich heraus, dass die Textqualität des BSB-Angebots miserabel ist:
http://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Allgemeine_Deutsche_Biographie#ADB_im_Volltext_http:.2F.2Fwww.deutsche-biographie.de
Eine Schweizer Mini-Firma hat übrigens in drei Monaten einen Gesamtvolltext der ADB mit sehr guter Fraktur-OCR erarbeitet und als Demo ins Netz gestellt:
http://www.pfeffel.ch/media/archive1/produkte/ARPA%20Digitalisierungskonzept.pdf
http://www.arpa-info.ch/index.php?page=784&book_id=10
In Wikisource werden die ADB-Artikel zwar (in der Regel) bewusst nicht kommentiert, aber mit den Wikipedia-Artikeln, den Wikisource-Autorenseiten und via PND mit weiteren Angeboten verknüpft. Anders als bei der BSB kommt man durch die Seitenzahl leichter zum Scan der betreffenden Seite, was bei langen Artikeln unbestreitbar ein Gewinn ist. Vor allem aber werden alle Personennamen intern in der ADB verlinkt (da gibt es leider aber auch bei "fertigen" Artikeln erhebliche Lücken).
Beispiel eines Wikisource-ADB-Artikels mit Verlinkungen:
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Albrecht_III._(Herzog_von_Bayern-M%C3%BCnchen)
Die Qualität der Wikisource-ADB ist also merklich besser als die des offiziellen Angebots!
Nun liest man ebenfalls heute von einer Erweiterung des Angebots
http://www.deutsche-biographie.de/index.html
Siehe etwa
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=16864
Durch die digitale Erschließung der sogenannten Hauptkartei, die bisher nur intern von der NDB-Redaktion genutzt worden ist, sind jetzt mehr als 128.000 Persönlichkeiten recherchierbar. Die eigens mit PND-ID versehene Personenzahl stieg nun um 46.000. Dies bedeutet, dass nun für insgesamt 120.000 Personen eindeutige und stabile Links zur Ansteuerung externer Webangebote verfügbar sind.
Das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist, dass die freien Projekte Wikipedia und Wikisource ausgegrenzt werden und eine dicke fette Lüge über die Qualität von deutsche-biographie.de verbreitet wird.
Ein Alleinstellungsmerkmal von www.deutsche-biographie.de besteht in der Verlinkung mit derzeit 44 Online-Ressourcen, die biographisch relevante Informationen mit wissenschaftlich gesicherter Qualität anbieten, insbesondere Bibliothekskataloge und Bibliographien, biographische Lexika und Online-Editionen, Quellennachweise und Nachlassverzeichnisse. Die OPAC-Verlinkung gewährleistet, dass das Verzeichnis der Schriften von und über eine Person stets up to date ist.
Der erste Satz ist eine glatte Lüge.
Richtig ist, dass man über Wikisource von jedem ADB-Artikel und jeder Autoren-/Personenseite ebenfalls via PND-Verknüpfung zu Online-Ressourcen kommt.
Beispiel: die Wittelsbacherin Maria Antonia Walburga
http://www.deutsche-biographie.de/sfz58360.html
Während die Deutsche Nationalbibliothek die Wikipedia verlinkt, ignoriert das bayerische Staatsangebot Wikipedia (und Wikisource).
nformationsangebote zu
Maria Antonia Walburga
PND
118781871
Normdaten
Personennamendatei (PND)
Virtual International Authority File (VIAF)
Lexika
Sächsische Biografie
Bayerisches Musikerlexikon Online (BMLO)
Bibliothekskataloge und Bibliographien
Bibliotheksverbund Bayern (BVB)
OPAC der BSB München
Gesamtkatalog deutschsprachiger Leichenpredigten (GESA)
Portraitnachweise
Digitaler Portraitindex
Virtuelles Kupferstichkabinett
Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
Nachlässe der SLUB
Nachlässe
Kalliope
Klickt man in der Wikipedia ganz unten bei den Normdaten WP-Personeninfo an, so kommt man zu weiteren Angeboten mit PND:
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Maria_Antonia_von_Bayern
Wieso werden vom Staatsangebot nicht auch die anderen Verbundkataloge mit PND-Erschließung (Hebis und GBV) verlinkt? HEBIS liefert in diesem Fall sogar Hinweise auf Digitalisate der Porträt-Sammlung Manskopf in Freiburg.
Es fehlen im Apper-Tool allerdings nicht wenige wichtige Quellen, die das Staatsangebot anbietet. Leider verlinkt die Wikipedia nicht auf die umfangreichste Zusammenstellung
http://beacon.findbuch.de
Wohl aber Wikisource! Der Artikel zu der Fürstin
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Maria_Antonia_Walburga
verlinkt nicht nur auf das Staatsangebot, sondern über den Link "weitere Angebote" auch auf (das von Thomas Berger betriebene) beacon-findbuch.de:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118781871
Und dieses Angebot bietet mehr Quellen als das Staatsangebot! Dieses wertet 44 Quellen aus, beacon-findbuch.de aber 73:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks
Damit steht fest: Der Benutzer, der sich - über die PND-Beacon-Dateien - über weitere biographische Informationsangebote informieren will, wird bei Wikisource (aufgrund der Einbindung von findbuch.beacon.de) besser und unvoreingenommener bedient als im Staatsangebot. Nicht nur, weil die Anzahl der Quellen größer ist, sie sind auch unideologischer zusammengestellt, da Wikipedia, Wikisource und Wikimedia Commons berücksichtigt sind.
Im Bereich des UWG könnte man die großmäulige Rede vom "Alleinstellungsmerkmal" des Staatsangebots als irreführende Werbung abmahnen.
Warum ist es schäbig und zutiefst unmoralisch, die freien Angebot in dieser Weise auszugrenzen?
Weil der entscheidende Schlüssel zu den PND-Links die BEACON-Dateien sind und dieses Instrument, dessen sich das Staatsangebot bedient, wurde wesentlich von Wikipedianern entwickelt:
http://archiv.twoday.net/search?q=beacon
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:APPER/BEACON
Wikipedianer haben mit riesiger ehrenamtlicher Arbeit für externe Angebote Beacon-Dateien erstellt, die Public Domain = Open Data sind. Nehmen wir den Artikel Jakob Mennel. Von der Autorenseite bei Wikisource kommt man mit SeeAlso zu
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118580876
Für das Historische Lexikon der Schweiz hat der Wikipedianer Praefcke die BEACON-Datei erstellt; vermutlich bedient sich das Staatsangebot genau dieser Datei.
Nur beacon.findbuch-de, nicht aber das Staatsangebot, verweist auf das gute private Angebot von Helmut Schulze, das in diesem Fall sogar mehr Digitalisate enthält als Wikisource:
http://www.liberley.it/m/mennel_j.htm
Es gibt in Wikisource nicht nur die ADB-Seiten, sondern auch sehr viele sehr gute Autorenseiten, die Digitalisate nachweisen. Eine willkürliche Auswahl:
http://de.wikisource.org/wiki/Ludwig_Uhland (Staatsangebot: 6 Quellen, beacon.findbuch.de 18!)
http://de.wikisource.org/wiki/Goethe (unschätzbar zeitsparend durch Direktlinks auf die Bände der Weimarer Ausgabe)
http://de.wikisource.org/wiki/Arno_Holz
Usw.
Das Staatsangebot erweist sich als mieser Schmarotzer: es benützt das im Umfeld von Open Content und der Wikipedia entwickelte und bereitgestellte Werkzeug BEACON, tut aber so, als ob es die Wikipedia und Wikisource mit teilweise ausgesprochen hochwertigen biographischen Informationen nicht gäbe.
Michael Stern Hart was born in Tacoma, Washington on March 8, 1947. He died on September 6, 2011 in his home in Urbana, Illinois, at the age of 64. His is survived by his mother, Alice, and brother, Bennett. Michael was an Eagle Scout (Urbana Troop 6 and Explorer Post 12), and served in the Army in Korea during the Vietnam era.
Hart was best known for his 1971 invention of electronic books, or eBooks. He founded Project Gutenberg, which is recognized as one of the earliest and longest-lasting online literary projects. He often told this story of how he had the idea for eBooks. He had been granted access to significant computing power at the University of Illinois at Urbana-Champaign. On July 4 1971, after being inspired by a free printed copy of the U.S. Declaration of Independence, he decided to type the text into a computer, and to transmit it to other users on the computer network. From this beginning, the digitization and distribution of literature was to be Hart's life's work, spanning over 40 years.
Hart was an ardent technologist and futurist. A lifetime tinkerer, he acquired hands-on expertise with the technologies of the day: radio, hi-fi stereo, video equipment, and of course computers. He constantly looked into the future, to anticipate technological advances. One of his favorite speculations was that someday, everyone would be able to have their own copy of the Project Gutenberg collection or whatever subset desired. This vision came true, thanks to the advent of large inexpensive computer disk drives, and to the ubiquity of portable mobile devices, such as cell phones.
Hart also predicted the enhancement of automatic translation, which would provide all of the world's literature in over a hundred languages. While this goal has not yet been reached, by the time of his death Project Gutenberg hosted eBooks in 60 different languages, and was frequently highlighted as one of the best Internet-based resources.
A lifetime intellectual, Hart was inspired by his parents, both professors at the University of Illinois, to seek truth and to question authority. One of his favorite recent quotes, credited to George Bernard Shaw, is characteristic of his approach to life:
"Reasonable people adapt themselves to the world. Unreasonable
people attempt to adapt the world to themselves. All progress,
therefore, depends on unreasonable people."
Michael prided himself on being unreasonable, and only in the later years of life did he mellow sufficiently to occasionally refrain from debate. Yet, his passion for life, and all the things in it, never abated.
Frugal to a fault, Michael glided through life with many possessions and friends, but very few expenses. He used home remedies rather than seeing doctors. He fixed his own house and car. He built many computers, stereos, and other gear, often from discarded components.
Michael S. Hart left a major mark on the world. The invention of eBooks was not simply a technological innovation or precursor to the modern information environment. A more correct understanding is that eBooks are an efficient and effective way of unlimited free distribution of literature. Access to eBooks can thus provide opportunity for increased literacy. Literacy, and the ideas contained in literature, creates opportunity.
In July 2011, Michael wrote these words, which summarize his goals and his lasting legacy: “One thing about eBooks that most people haven't thought much is that eBooks are the very first thing that we're all able to have as much as we want other than air. Think about that for a moment and you realize we are in the right job." He had this advice for those seeking to make literature available to all people, especially children:
"Learning is its own reward. Nothing I can
say is better than that."
Michael is remembered as a dear friend, who sacrificed personal luxury to fight for literacy, and for preservation of public domain rights and resources, towards the greater good.
This obituary is granted to the public domain by its author, Dr. Gregory B. Newby.
http://www.gutenberg.org/wiki/Michael_S._Hart
http://www.facebook.com/Speyer.Stadtarchiv#!/pages/Universit%C3%A4tsarchiv-D%C3%BCsseldorf/134314356662726

