Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch in Deutschland der aus England übernommene „Sport“ immer populärer. Häufig wird dabei vor allem an die Sportarten Rugby bzw. Fußball gedacht, die großen Anklang fanden. Aber unter anderem auch Golf, Hockey und Tennis gehören zum „Englischen Sport“, der immer stärker mit dem herkömmlichen (deutschen) „Turnen“ konkurrierte.
Während es viele sportgeschichtliche Beiträge gibt, die sich mit dem Fußballsport beschäftigen, wurden andere „englische“ Sportarten bisher eher zurückhaltend behandelt. Dies gilt insbesondere auch für den Golf-Sport.
Gerade in Hessen breitete sich dieses Spiel jedoch recht schnell aus. So verfügt Bad Homburg über den ältesten Golfplatz Deutschlands, auf dem seit 1889 Spiele ausgetragen wurden. Außerdem gab es in Darmstadt, Wiesbaden und Bad Nauheim schon sehr früh Aktivitäten zur Einführung des Golfsports.
Golf in Bad Homburg
„Obwohl nur klein, bietet der Homburger Golfplatz den Spielern nicht geringe Schwierigkeiten. Hohe Bäume und dichtes Gebüsch, langes Gras und eigens aufgestellte Hürden müssen überwunden werden, ehe der kleine weiße Ball glücklich ins Loch fällt.“
So beurteilt ein Chronist zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Anlage. Über 100 Jahre später sind im Kurpark noch sechs Spielbahnen erhalten. Der „Old Course“ ist öffentlich – d.h. dort kann auch ohne die Mitgliedschaft in einem Golfclub gespielt werden.
Die Historie des Homburger Golf-Clubs ist ebenfalls einzigartig. Überwiegend von angloamerikanischen Kurgästen 1899 gegründet, sind 1901 schon gut 1.150 Mitglieder registriert. Die „Damen und Herren der Gesellschaft“ pflegen ein reges Clubleben, und für den Sommer 1902 wird die Ergänzung weiterer Spielbahnen anvisiert.
Schon in der Gründerzeit sind z.B. Leila von Meister und Alfred Merton in der Mitgliederliste zu finden. Frau von Meister ist gebürtige Amerikanerin, mit einem „königlichen“ Landrat verheiratet und übernimmt nach dem 1. Weltkrieg den Vorsitz des Homburger Golf-Clubs (HGC). Alfred Merton aus Frankfurt gehört 1913 zu den Initiatoren des Frankfurter Golf-Clubs, und der am 26. Mai 1907 gegründete Deutsche Golf Verband (DGV) wählt ihn 1932 zu seinem Präsidenten.
1911 gehören über 2.000 Personen zum HGC; darunter aber auch eine große Zahl passiver Mitglieder. Mit 26 „Herren der Gesellschaft“ und „Seiner Kaiserlichen Hoheit Prinz Heinrich von Preußen“ ist der Vorstand sehr nobel besetzt. Bis 1914 steigt die Zahl der Mitglieder auf über 3.000.
Auf das 125-jährige Jubiläum ist man in Homburg gut vorbereit. Im Mai 2011 konnte der Ausbau des „New Course“ am Stadtrand von Bad Homburg auf 18 Löcher beendet werden. Der Club wurde im April 2013 als erster Club in Deutschland von Queen Elisabeth II. zum „Royal Golf-Club“ ernannt.
Golf in Darmstadt, Wiesbaden und Bad Nauheim
Bereits im Februar 1892 wurde auch in Darmstadt ein Golf-Club gegründet, dessen Schutzherr Großherzog Ludwig IV. war. Dieser regierte seit 1877 und starb am 13. März desselben Jahres. Dieser Umstand ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass bis zur Neugründung im Jahre 1911 keine weiteren Belege für Golfaktivitäten in Darmstadt existieren.
An der Eröffnung von Platz und Clubhaus im Jahr 1913 nahm Prinz Heinrich von Preußen teil. Großherzog Ernst Ludwig genehmigte kurz darauf die Bezeichnung als „Großherzoglicher Golf-Klub Darmstadt“.
Zeitungsberichte und persönliche Erinnerungen belegen von 1893 an auch das Golfspiel in Wiesbaden. Als eingetragener Verein ist der Wiesbadener Golf-Club ab 1911 in hessischen Archiven zu finden.
Mit Bad Nauheim gibt es in Hessen schon vor der DGV-Gründung im Jahr 1907 einen weiteren Spielort für den „grünen Sport“. Im Juni 1903 bildete sich ein Komitee zur Anlage eines Platzes – auch hier vorzugsweise für die angloamerikanischen Kurgäste. Das stilvolle Clubhaus aus den Anfangstagen existiert bis heute. 1996 erwarb der Club das gesamte Areal vom Hessischen Staatsbad.
Kuno Schuch (Golfarchiv Köln)
Während es viele sportgeschichtliche Beiträge gibt, die sich mit dem Fußballsport beschäftigen, wurden andere „englische“ Sportarten bisher eher zurückhaltend behandelt. Dies gilt insbesondere auch für den Golf-Sport.
Gerade in Hessen breitete sich dieses Spiel jedoch recht schnell aus. So verfügt Bad Homburg über den ältesten Golfplatz Deutschlands, auf dem seit 1889 Spiele ausgetragen wurden. Außerdem gab es in Darmstadt, Wiesbaden und Bad Nauheim schon sehr früh Aktivitäten zur Einführung des Golfsports.
Golf in Bad Homburg
„Obwohl nur klein, bietet der Homburger Golfplatz den Spielern nicht geringe Schwierigkeiten. Hohe Bäume und dichtes Gebüsch, langes Gras und eigens aufgestellte Hürden müssen überwunden werden, ehe der kleine weiße Ball glücklich ins Loch fällt.“
So beurteilt ein Chronist zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Anlage. Über 100 Jahre später sind im Kurpark noch sechs Spielbahnen erhalten. Der „Old Course“ ist öffentlich – d.h. dort kann auch ohne die Mitgliedschaft in einem Golfclub gespielt werden.
Die Historie des Homburger Golf-Clubs ist ebenfalls einzigartig. Überwiegend von angloamerikanischen Kurgästen 1899 gegründet, sind 1901 schon gut 1.150 Mitglieder registriert. Die „Damen und Herren der Gesellschaft“ pflegen ein reges Clubleben, und für den Sommer 1902 wird die Ergänzung weiterer Spielbahnen anvisiert.
Schon in der Gründerzeit sind z.B. Leila von Meister und Alfred Merton in der Mitgliederliste zu finden. Frau von Meister ist gebürtige Amerikanerin, mit einem „königlichen“ Landrat verheiratet und übernimmt nach dem 1. Weltkrieg den Vorsitz des Homburger Golf-Clubs (HGC). Alfred Merton aus Frankfurt gehört 1913 zu den Initiatoren des Frankfurter Golf-Clubs, und der am 26. Mai 1907 gegründete Deutsche Golf Verband (DGV) wählt ihn 1932 zu seinem Präsidenten.
1911 gehören über 2.000 Personen zum HGC; darunter aber auch eine große Zahl passiver Mitglieder. Mit 26 „Herren der Gesellschaft“ und „Seiner Kaiserlichen Hoheit Prinz Heinrich von Preußen“ ist der Vorstand sehr nobel besetzt. Bis 1914 steigt die Zahl der Mitglieder auf über 3.000.
Auf das 125-jährige Jubiläum ist man in Homburg gut vorbereit. Im Mai 2011 konnte der Ausbau des „New Course“ am Stadtrand von Bad Homburg auf 18 Löcher beendet werden. Der Club wurde im April 2013 als erster Club in Deutschland von Queen Elisabeth II. zum „Royal Golf-Club“ ernannt.
Golf in Darmstadt, Wiesbaden und Bad Nauheim
Bereits im Februar 1892 wurde auch in Darmstadt ein Golf-Club gegründet, dessen Schutzherr Großherzog Ludwig IV. war. Dieser regierte seit 1877 und starb am 13. März desselben Jahres. Dieser Umstand ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass bis zur Neugründung im Jahre 1911 keine weiteren Belege für Golfaktivitäten in Darmstadt existieren.
An der Eröffnung von Platz und Clubhaus im Jahr 1913 nahm Prinz Heinrich von Preußen teil. Großherzog Ernst Ludwig genehmigte kurz darauf die Bezeichnung als „Großherzoglicher Golf-Klub Darmstadt“.
Zeitungsberichte und persönliche Erinnerungen belegen von 1893 an auch das Golfspiel in Wiesbaden. Als eingetragener Verein ist der Wiesbadener Golf-Club ab 1911 in hessischen Archiven zu finden.
Mit Bad Nauheim gibt es in Hessen schon vor der DGV-Gründung im Jahr 1907 einen weiteren Spielort für den „grünen Sport“. Im Juni 1903 bildete sich ein Komitee zur Anlage eines Platzes – auch hier vorzugsweise für die angloamerikanischen Kurgäste. Das stilvolle Clubhaus aus den Anfangstagen existiert bis heute. 1996 erwarb der Club das gesamte Areal vom Hessischen Staatsbad.
Kuno Schuch (Golfarchiv Köln)
Peter Schermer - am Dienstag, 28. Oktober 2014, 19:38 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
fragt sich im Nachgang zum 84. Dt. Archivtag Bastian Gillner
"...Wenn ein Unternehmen keine Kunden mehr hat, dann geht es pleite. Wenn ein Archiv keine Nutzer mehr hat, dann bleibt mehr Zeit für Erschließungs- oder gar Forschungsarbeiten..."
und vergleicht mit der Haltung von Bibliotheken und Museen zu diesem Thema.
http://archive20.hypotheses.org/2123
"...Wenn ein Unternehmen keine Kunden mehr hat, dann geht es pleite. Wenn ein Archiv keine Nutzer mehr hat, dann bleibt mehr Zeit für Erschließungs- oder gar Forschungsarbeiten..."
und vergleicht mit der Haltung von Bibliotheken und Museen zu diesem Thema.
http://archive20.hypotheses.org/2123
ingobobingo - am Dienstag, 28. Oktober 2014, 16:07 - Rubrik: Archive in der Zukunft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dmm.travel/news/artikel/lesen/2014/10/eu-weite-internet-abgabe-63766/
"In Ungarn gab es erst heftige Proteste gegen die von der Regierung geplante Internetabgabe. Nun ist von Seiten der EU-Kommission zu hören, dass Günther Oettinger, designierter EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, das Urheberrecht in der EU harmonisieren und eine Abgabe für die Nutzung geistigen Eigentums einführen will."
Was für ein Schwachsinn. Wir brauchen weniger statt mehr Urheberrecht im digitalen Zeitalter!
"In Ungarn gab es erst heftige Proteste gegen die von der Regierung geplante Internetabgabe. Nun ist von Seiten der EU-Kommission zu hören, dass Günther Oettinger, designierter EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, das Urheberrecht in der EU harmonisieren und eine Abgabe für die Nutzung geistigen Eigentums einführen will."
Was für ein Schwachsinn. Wir brauchen weniger statt mehr Urheberrecht im digitalen Zeitalter!
Von den 14 Beiträgen hervorheben möchte ich die beiden längeren Stücke gegen Dark Deposits und zur unzulänglichen Nutzung der OA-Komponente der Allianz- und Nationallizenzen.
In Archivalia erschienen sehr viele Beiträge über Open Access.
"Die Suche nach »open access« hat 2331 Resultate geliefert"
Die Rubrik "Open Access" zählt über 1870 Beiträge seit 2003:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1870
Nicht wenige der vielen Artikel zu den Open-Access-Wochen bündeln frühere Beiträge und helfen bei der Erschließung des großen Bestands bzw. enthalten aus meiner Sicht wichtige Impulse.
***
Beitragsverzeichnis 2014 (jüngste zuerst)
Zehn Fakten über Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/1022220897/
Zurück zur grauen Literatur - Dark deposits in Open-Access-Repositorien schaden der Wissenschaft
http://archiv.twoday.net/stories/1022220766/
Gut, dass es Gutknecht gibt
http://archiv.twoday.net/stories/1022220679/
Mehr als die Hälfte der wissenschaftlichen Artikel 2007-2012 frei lesbar?
http://archiv.twoday.net/stories/1022220559/
Open Access bedeutet nicht: Der Autor zahlt
http://archiv.twoday.net/stories/1022220552/
Die Open-Access-Komponente der Allianz- und Nationallizenzen in Deutschland: ein Flop
http://archiv.twoday.net/stories/1022220413/
Publikationsserver des Instituts für Deutsche Sprache
http://archiv.twoday.net/stories/1022220377/
Interview mit Open-Access-Forscher Bo-Christer Björk
http://archiv.twoday.net/stories/1022220356/
Open Access Button erweitert
http://archiv.twoday.net/stories/1022220344/
Teil 2 der Netzpolitik-Artikelserie zu Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/1022220340/
Dauerhafter Open Access wäre besser ...
http://archiv.twoday.net/stories/1022219951/
Open-Access-Symbol in der Literaturliste der Wikipedia
http://archiv.twoday.net/stories/1022219920/
Lektüren für die Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/1022219726/
Diese Woche ist Open Access Week!
http://archiv.twoday.net/stories/1022219661/
***
Beitragsverzeichnis 2013 (jüngste zuerst)
Hüpfen für Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528988345/
Historische Vereine in der Schweiz und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528988162/
Rückschritt für grünen Open Access: Professor Wolfgang Behringer (Saarbrücken) entfernte Volltexte
http://archiv.twoday.net/stories/528987975/
Open Access und deutschsprachige Geschichtswissenschaft: Sie wird einfach nicht grün
http://archiv.twoday.net/stories/528987964/
Archäologie und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528986987/
Deutsche Sportwissenschaft und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528986981/
Open Access publishing has no negative effect on book sales!
http://archiv.twoday.net/stories/528986972/
Neue Open-Access-Internetplattform: Regensburger Beiträge zur Heimatforschung
http://archiv.twoday.net/stories/528986938/
Open Access Week: Die Veranstaltungen vom 21.-25.10.2013 in Paris
http://archiv.twoday.net/stories/528986319/
Prosopographische Datenbank zum Frühmittelalter Nomen et Gens online
http://archiv.twoday.net/stories/524916397/
Internationale Open Access Week: Wie Wissenschaftsblogger Open Access fördern können
http://archiv.twoday.net/stories/524897246/
Hinweis auf meinen Beitrag im Redaktionsblog
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1742
Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen
http://archiv.twoday.net/stories/524897129/
DHI Paris unterstützt Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/524897119/
Helmholtz-Gemeinschaft verankert Open-Access-Richtlinie
http://archiv.twoday.net/stories/524897083/
Über 800 wissenschaftliche Gesellschaften weltweit publizieren Open Access Zeitschriften
http://archiv.twoday.net/stories/524897077/
Veranstaltungen der Open Access Week 2013 im Livestream
http://archiv.twoday.net/stories/524896804/
arbido 2000-2013/2 online
http://archiv.twoday.net/stories/524896777/
IFLA's institutional repository
http://archiv.twoday.net/stories/524896725/
Let’s be open about Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/524896703/
Katalog der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Heidelberg, des Instituts für Geschichte der Medizin und des Stadtarchivs Heidelberg
http://archiv.twoday.net/stories/524896678/
Klimpel über: Die verbreitetsten Missverständnisse zu freien Lizenzen
http://archiv.twoday.net/stories/524896657/
Internationale Open Access Week hat begonnen
http://archiv.twoday.net/stories/524896502/
***
Beitragsverzeichnis 2012
Internationale Open-Access-Woche vom 22. bis 28. Oktober 2012
http://archiv.twoday.net/stories/172011655/
Open-Access-Strategien für wissenschaftlichen Einrichtungen - Bausteine und Beispiele
http://archiv.twoday.net/stories/176658189/
Katalogdaten der Veröffentlichungen des DHI Paris als Open Data CC0 bereit gestellt
http://archiv.twoday.net/stories/176833200/
Elf Bände der Pariser Historischen Studien online verfügbar
http://archiv.twoday.net/stories/176833209/
Open Access im Aufwind
http://archiv.twoday.net/stories/176833864/
Open Access-Neuigkeiten
http://archiv.twoday.net/stories/185148129/
Open Access now
http://archiv.twoday.net/stories/187506474/
Rechtsfragen von Open Access (2012)
http://archiv.twoday.net/stories/197330649/
(aufgrund technischer Probleme mit Twoday erst nach Abschluss der OA-Woche veröffentlicht.)
***
Beitragsverzeichnis 2011
Open-Access-Woche 2011 geht zuende
http://archiv.twoday.net/stories/49599068/
Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/49595818/
Die Open-Access-Woche hat begonnen!
http://archiv.twoday.net/stories/49592335/
***
Beitragsverzeichnis 2010
aus:
http://archiv.twoday.net/stories/8404435/
http://archiv.twoday.net/stories/8401787/
Über Eric Steinhauer: Open Access und Wissenschaftsfreiheit
Eric W. Steinhauer: Das Recht auf Sichtbarkeit. Überlegungen zu Open Access und Wissenschaftsfreiheit. Münster 2010, 96 S. online:
http://fiz1.fh-potsdam.de/volltext/aueintrag/10497.pdf
oder http://deposit.fernuni-hagen.de/2752/
http://archiv.twoday.net/stories/8401432/
Bedenken gegen Open Access
Auseinandersetzung mit
http://digiwis.de/blog/2010/10/20/zukunftsgespraeche-open-access-2010-in-berlin-kritische-gedanken/
http://archiv.twoday.net/stories/8401238/
Ärgernis: Einträge in Repositorien ohne Volltexte
http://archiv.twoday.net/stories/8401116/
Zu: Online Access to the Catalogue and Bibliography of Cartographic Materials of the National Library of Poland (NLP)
http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000509/article.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/8397846/
Kurzinterview mit Friedrich Polerroß
http://archiv.twoday.net/stories/8396897/
Fallstudien zu Open-Access-Policies - ZORA überbewertet
http://archiv.twoday.net/stories/8396826/
Frustration über die konservative Haltung der Wissenschaftler
Zu: http://acrlog.org/2010/10/18/why-im-not-in-the-mood-to-celebrate-open-access-week/ (Steven Bell)
http://archiv.twoday.net/stories/8396724/
Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013636
http://archiv.twoday.net/stories/8396608/
Spam in SearchPigeon
http://archiv.twoday.net/stories/8396596/
Creative Commons und Open Access
http://wiki.creativecommons.org/Creative_Commons_and_Open_Access
http://archiv.twoday.net/stories/8396385/
Erfolge 2010: Freigabe von Bibliotheksdaten
http://www.uebertext.org/2010/10/2010-das-open-bibliographic-data-jahr.html
http://archiv.twoday.net/stories/8396208/
VG Wort diskriminiert Repositorien
http://archiv.twoday.net/stories/8392756/
Bibliografische Daten der UB Tübingen unter CC0
http://archiv.twoday.net/stories/8392772/
Open Access Woche hat begonnen
In weiteren Rubriken wurden veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/8404317/
The end of Open Access Week 2010, from SPARC
http://archiv.twoday.net/stories/8396923/
Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten
Das Buch (Schriftenreihe Humangeographie) gibt es Open Access in Zürich:
https://www.zora.uzh.ch/10134/
***
Beitragsverzeichnis 2009
19.-23. Oktober 2009: Internationale Open Access Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6000141/
Links:
http://open-access.net/de/aktivitaeten/internationale_open_access_week/
http://www.openaccessweek.org/
Institutional Repository Bibliography
http://archiv.twoday.net/stories/6000169/
Link: http://digital-scholarship.org/irb/irb.html
Institutionelles Repositorium der UB Regensburg als Mogelpackung
http://archiv.twoday.net/stories/6000197/
Link: http://epub.uni-regensburg.de/
Informationsbroschüre zu OA
http://archiv.twoday.net/stories/6000243/
Link: http://www.allianz-initiative.de/fileadmin/openaccess.pdf
Rückblick: Beiträge zum Open-Access-Tag 2008
http://archiv.twoday.net/stories/6000403/
Link: http://archiv.twoday.net/stories/5256322/
Artikel über Zürichs ZORA
http://archiv.twoday.net/stories/6000560/
Link: http://www.oai.uzh.ch/images/stories/oa_medien/fuhrer_arbido_2009.pdf
Buchbesprechung: Uwe Jochum. "Open Access". Zur Korrektur einiger populärer Annahmen. (Göttinger Sudelblätter). Göttingen: Wallstein-Verlag 2009
http://archiv.twoday.net/stories/6001358/
Biographische Enzyklopädie aus Italien kostenlos zugänglich
http://archiv.twoday.net/stories/6001368/
Link: http://www.treccani.it/Portale/ricerche/searchUniversale.html
Auftaktbericht über Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6001391/
Link: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31318/1.html
Über 60 Publikationen von Franz Quarthal Open Access auf dem Stuttgarter Hochschulschriftenserver
http://archiv.twoday.net/stories/6002425/
Link: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/index.php?la=de
Wichtige Aufsätze zum Thema Gewalt aus historischer Sicht
http://archiv.twoday.net/stories/6002477/
Link: http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Material-1-2008
Deutschsprachige Historiker und Open Access: der grüne Weg und sonstige Netzpublikationen
http://archiv.twoday.net/stories/6002752/
Hochschularchiv Aachen beteiligt sich an Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6002809/
Link: http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/2009/10/gruwort-von-christine-roll-zur-open.html
Welcome to Open Access Week, from SPARC
http://archiv.twoday.net/stories/6005968/
Link: http://vimeo.com/7048906
Universitäres Wissen teilen
http://archiv.twoday.net/stories/6006017/
Link: http://www.vdf.ethz.ch/vdf.asp?showArtDetail=3-7281-3196-2&fromOA=1
Videoaufzeichnung der Auftaktveranstaltung zu internationalen Open-Access-Woche am 19. Oktober 2009 in der BSB
http://archiv.twoday.net/stories/6006151/
Link
Gibt es Studierendeninitiativen für OA in Deutschland?
http://archiv.twoday.net/stories/6006158/
Link: http://www.righttoresearch.org/index.shtml
190,000 Welsh Wills Online – Free to View
http://archiv.twoday.net/stories/6006289/
Link: http://cat.llgc.org.uk/cgi-bin/gw/chameleon?skin=profeb&lng=en
Niederlande: Informationsseite zu Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/6006529/
Link: http://www.openaccess.nl/
Publisher's Open Access Policies: ROMEO Upgrade
http://archiv.twoday.net/stories/6006564/
Link: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
UK's DEPOT becomes Universal Open Access Repository
http://archiv.twoday.net/stories/6006575/
Link: http://edina.ac.uk/cgi-bin/news.cgi?filename=2009-10-19-depot.txt
Kurzvortrag von Eberhard Hilf zur OA-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6007602/
Link: http://www.youtube.com/watch?v=vHmP8eAJMak
OA - zu wenig grüner Weg
http://archiv.twoday.net/stories/6007663/
Link: http://fm-cab.blogspot.com/2009/10/open-access-week-self-archiving-case.html
Nach offiziellem Abschluss der Woche:
BCK: Hybrid publizieren, doppelt abkassieren ...
http://archiv.twoday.net/stories/6013528/
***
2008 gab es nur einen Open-Access-Tag
Am gestrigen Open-Access-Tag wurden in Archivalia 32 Einträge in der Rubrik Open Access veröffentlicht (darunter 6 Gastbeiträge eingeladener Aktivisten für die nochmals gedankt sei):
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
I. Gastbeiträge (alphabetisch)
Gudrun Gersmann
http://archiv.twoday.net/stories/5252988/
Eberhard Hilf
http://archiv.twoday.net/stories/5255913/
Thomas Hoeren
http://archiv.twoday.net/stories/5253008/
Rainer Kuhlen
http://archiv.twoday.net/stories/5254044/
Eric Steinhauer
http://archiv.twoday.net/stories/5253711/
Peter Suber
http://archiv.twoday.net/stories/5254012/
II. Allgemeine Informationen
Open Access - eine sehr kurze Einführung
http://archiv.twoday.net/stories/5251765/
Schlüsselbegriffe der Open-Access-Terminologie
http://archiv.twoday.net/stories/5253977/
Wo finde ich Informationen zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5251767/
Wie finde ich Open-Access-Dokumente?
http://archiv.twoday.net/stories/5256264/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ...
http://archiv.twoday.net/stories/5251764/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Access auch für Kulturgut
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Educational Resources
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
III. Spezielle Themen
Heute ist internationaler Open Access Tag
http://archiv.twoday.net/stories/5252968/
Open Access im Küchenradio
http://archiv.twoday.net/stories/5253559/
Ideen, wie man die Dokumentenserver füllen kann
http://archiv.twoday.net/stories/5254162/
Dean Giustini's Top Five Ways for Librarians to Contribute to Open Access Movement
http://archiv.twoday.net/stories/5254166/
Dramatic Growth of Open Access, September 30, 2008
http://archiv.twoday.net/stories/5254167/
Wo kann ich archivische Fachbeiträge Open Access veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/5251769/
Tagungsband Offener Bildungsraum Hochschule gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251716/
Tagungsband zum Social Tagging gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251739/
Offene Bildungsressourcen - Ausgabe der eLearning-Papers
http://archiv.twoday.net/stories/5251751/
Wie kam ich zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5254157/
Neue Version des Hoeren-Skripts zum Download bereit
http://archiv.twoday.net/stories/5254830/
Die Public Domain festigen - eine Idee für Google
http://archiv.twoday.net/stories/5254117/
Kurzer Bericht von den Open Access Tagen Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255238/
Einladung zum Creative Commons Salon Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255243/
Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA launched
http://archiv.twoday.net/stories/5255673/
Open Access Tag weltweit voller Erfolg
http://archiv.twoday.net/stories/5255679/
Open Access Haiku
http://archiv.twoday.net/stories/5255704/
Make all research results CC-BY (and the data PD)!
http://archiv.twoday.net/stories/5255746/
(zu libre Oben Access)
Elektronische Semesterapparate und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/5255903/
(auch zum § 52a UrhG)
Update: Beiträge 2015
http://archiv.twoday.net/stories/1022484964/

In Archivalia erschienen sehr viele Beiträge über Open Access.
"Die Suche nach »open access« hat 2331 Resultate geliefert"
Die Rubrik "Open Access" zählt über 1870 Beiträge seit 2003:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1870
Nicht wenige der vielen Artikel zu den Open-Access-Wochen bündeln frühere Beiträge und helfen bei der Erschließung des großen Bestands bzw. enthalten aus meiner Sicht wichtige Impulse.
***
Beitragsverzeichnis 2014 (jüngste zuerst)
Zehn Fakten über Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/1022220897/
Zurück zur grauen Literatur - Dark deposits in Open-Access-Repositorien schaden der Wissenschaft
http://archiv.twoday.net/stories/1022220766/
Gut, dass es Gutknecht gibt
http://archiv.twoday.net/stories/1022220679/
Mehr als die Hälfte der wissenschaftlichen Artikel 2007-2012 frei lesbar?
http://archiv.twoday.net/stories/1022220559/
Open Access bedeutet nicht: Der Autor zahlt
http://archiv.twoday.net/stories/1022220552/
Die Open-Access-Komponente der Allianz- und Nationallizenzen in Deutschland: ein Flop
http://archiv.twoday.net/stories/1022220413/
Publikationsserver des Instituts für Deutsche Sprache
http://archiv.twoday.net/stories/1022220377/
Interview mit Open-Access-Forscher Bo-Christer Björk
http://archiv.twoday.net/stories/1022220356/
Open Access Button erweitert
http://archiv.twoday.net/stories/1022220344/
Teil 2 der Netzpolitik-Artikelserie zu Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/1022220340/
Dauerhafter Open Access wäre besser ...
http://archiv.twoday.net/stories/1022219951/
Open-Access-Symbol in der Literaturliste der Wikipedia
http://archiv.twoday.net/stories/1022219920/
Lektüren für die Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/1022219726/
Diese Woche ist Open Access Week!
http://archiv.twoday.net/stories/1022219661/
***
Beitragsverzeichnis 2013 (jüngste zuerst)
Hüpfen für Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528988345/
Historische Vereine in der Schweiz und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528988162/
Rückschritt für grünen Open Access: Professor Wolfgang Behringer (Saarbrücken) entfernte Volltexte
http://archiv.twoday.net/stories/528987975/
Open Access und deutschsprachige Geschichtswissenschaft: Sie wird einfach nicht grün
http://archiv.twoday.net/stories/528987964/
Archäologie und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528986987/
Deutsche Sportwissenschaft und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/528986981/
Open Access publishing has no negative effect on book sales!
http://archiv.twoday.net/stories/528986972/
Neue Open-Access-Internetplattform: Regensburger Beiträge zur Heimatforschung
http://archiv.twoday.net/stories/528986938/
Open Access Week: Die Veranstaltungen vom 21.-25.10.2013 in Paris
http://archiv.twoday.net/stories/528986319/
Prosopographische Datenbank zum Frühmittelalter Nomen et Gens online
http://archiv.twoday.net/stories/524916397/
Internationale Open Access Week: Wie Wissenschaftsblogger Open Access fördern können
http://archiv.twoday.net/stories/524897246/
Hinweis auf meinen Beitrag im Redaktionsblog
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1742
Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen
http://archiv.twoday.net/stories/524897129/
DHI Paris unterstützt Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/524897119/
Helmholtz-Gemeinschaft verankert Open-Access-Richtlinie
http://archiv.twoday.net/stories/524897083/
Über 800 wissenschaftliche Gesellschaften weltweit publizieren Open Access Zeitschriften
http://archiv.twoday.net/stories/524897077/
Veranstaltungen der Open Access Week 2013 im Livestream
http://archiv.twoday.net/stories/524896804/
arbido 2000-2013/2 online
http://archiv.twoday.net/stories/524896777/
IFLA's institutional repository
http://archiv.twoday.net/stories/524896725/
Let’s be open about Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/524896703/
Katalog der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Heidelberg, des Instituts für Geschichte der Medizin und des Stadtarchivs Heidelberg
http://archiv.twoday.net/stories/524896678/
Klimpel über: Die verbreitetsten Missverständnisse zu freien Lizenzen
http://archiv.twoday.net/stories/524896657/
Internationale Open Access Week hat begonnen
http://archiv.twoday.net/stories/524896502/
***
Beitragsverzeichnis 2012
Internationale Open-Access-Woche vom 22. bis 28. Oktober 2012
http://archiv.twoday.net/stories/172011655/
Open-Access-Strategien für wissenschaftlichen Einrichtungen - Bausteine und Beispiele
http://archiv.twoday.net/stories/176658189/
Katalogdaten der Veröffentlichungen des DHI Paris als Open Data CC0 bereit gestellt
http://archiv.twoday.net/stories/176833200/
Elf Bände der Pariser Historischen Studien online verfügbar
http://archiv.twoday.net/stories/176833209/
Open Access im Aufwind
http://archiv.twoday.net/stories/176833864/
Open Access-Neuigkeiten
http://archiv.twoday.net/stories/185148129/
Open Access now
http://archiv.twoday.net/stories/187506474/
Rechtsfragen von Open Access (2012)
http://archiv.twoday.net/stories/197330649/
(aufgrund technischer Probleme mit Twoday erst nach Abschluss der OA-Woche veröffentlicht.)
***
Beitragsverzeichnis 2011
Open-Access-Woche 2011 geht zuende
http://archiv.twoday.net/stories/49599068/
Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/49595818/
Die Open-Access-Woche hat begonnen!
http://archiv.twoday.net/stories/49592335/
***
Beitragsverzeichnis 2010
aus:
http://archiv.twoday.net/stories/8404435/
http://archiv.twoday.net/stories/8401787/
Über Eric Steinhauer: Open Access und Wissenschaftsfreiheit
Eric W. Steinhauer: Das Recht auf Sichtbarkeit. Überlegungen zu Open Access und Wissenschaftsfreiheit. Münster 2010, 96 S. online:
http://fiz1.fh-potsdam.de/volltext/aueintrag/10497.pdf
oder http://deposit.fernuni-hagen.de/2752/
http://archiv.twoday.net/stories/8401432/
Bedenken gegen Open Access
Auseinandersetzung mit
http://digiwis.de/blog/2010/10/20/zukunftsgespraeche-open-access-2010-in-berlin-kritische-gedanken/
http://archiv.twoday.net/stories/8401238/
Ärgernis: Einträge in Repositorien ohne Volltexte
http://archiv.twoday.net/stories/8401116/
Zu: Online Access to the Catalogue and Bibliography of Cartographic Materials of the National Library of Poland (NLP)
http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000509/article.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/8397846/
Kurzinterview mit Friedrich Polerroß
http://archiv.twoday.net/stories/8396897/
Fallstudien zu Open-Access-Policies - ZORA überbewertet
http://archiv.twoday.net/stories/8396826/
Frustration über die konservative Haltung der Wissenschaftler
Zu: http://acrlog.org/2010/10/18/why-im-not-in-the-mood-to-celebrate-open-access-week/ (Steven Bell)
http://archiv.twoday.net/stories/8396724/
Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013636
http://archiv.twoday.net/stories/8396608/
Spam in SearchPigeon
http://archiv.twoday.net/stories/8396596/
Creative Commons und Open Access
http://wiki.creativecommons.org/Creative_Commons_and_Open_Access
http://archiv.twoday.net/stories/8396385/
Erfolge 2010: Freigabe von Bibliotheksdaten
http://www.uebertext.org/2010/10/2010-das-open-bibliographic-data-jahr.html
http://archiv.twoday.net/stories/8396208/
VG Wort diskriminiert Repositorien
http://archiv.twoday.net/stories/8392756/
Bibliografische Daten der UB Tübingen unter CC0
http://archiv.twoday.net/stories/8392772/
Open Access Woche hat begonnen
In weiteren Rubriken wurden veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/8404317/
The end of Open Access Week 2010, from SPARC
http://archiv.twoday.net/stories/8396923/
Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten
Das Buch (Schriftenreihe Humangeographie) gibt es Open Access in Zürich:
https://www.zora.uzh.ch/10134/
***
Beitragsverzeichnis 2009
19.-23. Oktober 2009: Internationale Open Access Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6000141/
Links:
http://open-access.net/de/aktivitaeten/internationale_open_access_week/
http://www.openaccessweek.org/
Institutional Repository Bibliography
http://archiv.twoday.net/stories/6000169/
Link: http://digital-scholarship.org/irb/irb.html
Institutionelles Repositorium der UB Regensburg als Mogelpackung
http://archiv.twoday.net/stories/6000197/
Link: http://epub.uni-regensburg.de/
Informationsbroschüre zu OA
http://archiv.twoday.net/stories/6000243/
Link: http://www.allianz-initiative.de/fileadmin/openaccess.pdf
Rückblick: Beiträge zum Open-Access-Tag 2008
http://archiv.twoday.net/stories/6000403/
Link: http://archiv.twoday.net/stories/5256322/
Artikel über Zürichs ZORA
http://archiv.twoday.net/stories/6000560/
Link: http://www.oai.uzh.ch/images/stories/oa_medien/fuhrer_arbido_2009.pdf
Buchbesprechung: Uwe Jochum. "Open Access". Zur Korrektur einiger populärer Annahmen. (Göttinger Sudelblätter). Göttingen: Wallstein-Verlag 2009
http://archiv.twoday.net/stories/6001358/
Biographische Enzyklopädie aus Italien kostenlos zugänglich
http://archiv.twoday.net/stories/6001368/
Link: http://www.treccani.it/Portale/ricerche/searchUniversale.html
Auftaktbericht über Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6001391/
Link: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31318/1.html
Über 60 Publikationen von Franz Quarthal Open Access auf dem Stuttgarter Hochschulschriftenserver
http://archiv.twoday.net/stories/6002425/
Link: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/index.php?la=de
Wichtige Aufsätze zum Thema Gewalt aus historischer Sicht
http://archiv.twoday.net/stories/6002477/
Link: http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Material-1-2008
Deutschsprachige Historiker und Open Access: der grüne Weg und sonstige Netzpublikationen
http://archiv.twoday.net/stories/6002752/
Hochschularchiv Aachen beteiligt sich an Open-Access-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6002809/
Link: http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/2009/10/gruwort-von-christine-roll-zur-open.html
Welcome to Open Access Week, from SPARC
http://archiv.twoday.net/stories/6005968/
Link: http://vimeo.com/7048906
Universitäres Wissen teilen
http://archiv.twoday.net/stories/6006017/
Link: http://www.vdf.ethz.ch/vdf.asp?showArtDetail=3-7281-3196-2&fromOA=1
Videoaufzeichnung der Auftaktveranstaltung zu internationalen Open-Access-Woche am 19. Oktober 2009 in der BSB
http://archiv.twoday.net/stories/6006151/
Link
Gibt es Studierendeninitiativen für OA in Deutschland?
http://archiv.twoday.net/stories/6006158/
Link: http://www.righttoresearch.org/index.shtml
190,000 Welsh Wills Online – Free to View
http://archiv.twoday.net/stories/6006289/
Link: http://cat.llgc.org.uk/cgi-bin/gw/chameleon?skin=profeb&lng=en
Niederlande: Informationsseite zu Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/6006529/
Link: http://www.openaccess.nl/
Publisher's Open Access Policies: ROMEO Upgrade
http://archiv.twoday.net/stories/6006564/
Link: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
UK's DEPOT becomes Universal Open Access Repository
http://archiv.twoday.net/stories/6006575/
Link: http://edina.ac.uk/cgi-bin/news.cgi?filename=2009-10-19-depot.txt
Kurzvortrag von Eberhard Hilf zur OA-Woche
http://archiv.twoday.net/stories/6007602/
Link: http://www.youtube.com/watch?v=vHmP8eAJMak
OA - zu wenig grüner Weg
http://archiv.twoday.net/stories/6007663/
Link: http://fm-cab.blogspot.com/2009/10/open-access-week-self-archiving-case.html
Nach offiziellem Abschluss der Woche:
BCK: Hybrid publizieren, doppelt abkassieren ...
http://archiv.twoday.net/stories/6013528/
***
2008 gab es nur einen Open-Access-Tag
Am gestrigen Open-Access-Tag wurden in Archivalia 32 Einträge in der Rubrik Open Access veröffentlicht (darunter 6 Gastbeiträge eingeladener Aktivisten für die nochmals gedankt sei):
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
I. Gastbeiträge (alphabetisch)
Gudrun Gersmann
http://archiv.twoday.net/stories/5252988/
Eberhard Hilf
http://archiv.twoday.net/stories/5255913/
Thomas Hoeren
http://archiv.twoday.net/stories/5253008/
Rainer Kuhlen
http://archiv.twoday.net/stories/5254044/
Eric Steinhauer
http://archiv.twoday.net/stories/5253711/
Peter Suber
http://archiv.twoday.net/stories/5254012/
II. Allgemeine Informationen
Open Access - eine sehr kurze Einführung
http://archiv.twoday.net/stories/5251765/
Schlüsselbegriffe der Open-Access-Terminologie
http://archiv.twoday.net/stories/5253977/
Wo finde ich Informationen zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5251767/
Wie finde ich Open-Access-Dokumente?
http://archiv.twoday.net/stories/5256264/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ...
http://archiv.twoday.net/stories/5251764/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Access auch für Kulturgut
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Educational Resources
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
III. Spezielle Themen
Heute ist internationaler Open Access Tag
http://archiv.twoday.net/stories/5252968/
Open Access im Küchenradio
http://archiv.twoday.net/stories/5253559/
Ideen, wie man die Dokumentenserver füllen kann
http://archiv.twoday.net/stories/5254162/
Dean Giustini's Top Five Ways for Librarians to Contribute to Open Access Movement
http://archiv.twoday.net/stories/5254166/
Dramatic Growth of Open Access, September 30, 2008
http://archiv.twoday.net/stories/5254167/
Wo kann ich archivische Fachbeiträge Open Access veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/5251769/
Tagungsband Offener Bildungsraum Hochschule gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251716/
Tagungsband zum Social Tagging gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251739/
Offene Bildungsressourcen - Ausgabe der eLearning-Papers
http://archiv.twoday.net/stories/5251751/
Wie kam ich zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5254157/
Neue Version des Hoeren-Skripts zum Download bereit
http://archiv.twoday.net/stories/5254830/
Die Public Domain festigen - eine Idee für Google
http://archiv.twoday.net/stories/5254117/
Kurzer Bericht von den Open Access Tagen Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255238/
Einladung zum Creative Commons Salon Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255243/
Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA launched
http://archiv.twoday.net/stories/5255673/
Open Access Tag weltweit voller Erfolg
http://archiv.twoday.net/stories/5255679/
Open Access Haiku
http://archiv.twoday.net/stories/5255704/
Make all research results CC-BY (and the data PD)!
http://archiv.twoday.net/stories/5255746/
(zu libre Oben Access)
Elektronische Semesterapparate und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/5255903/
(auch zum § 52a UrhG)
Update: Beiträge 2015
http://archiv.twoday.net/stories/1022484964/

KlausGraf - am Montag, 27. Oktober 2014, 17:25 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Dieses Portal stellt bibliographische Informationen zu ausgewählten älteren, vorzüglich deutschsprachigen Autoren, Werken und Sagen zusammen. "
http://gottfried.unistra.fr/?page_id=2491
Peter Andersen widmet sich nicht nur dem Tristan-Stoff, sondern auch Stoffen der Heldensage.
http://gottfried.unistra.fr/?page_id=2491
Peter Andersen widmet sich nicht nur dem Tristan-Stoff, sondern auch Stoffen der Heldensage.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 20:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 17:29 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Angelehnt an und teilweise übersetzt aus:
http://jculibrarynews.blogspot.de/2014/10/ten-fast-facts-about-open-access.html
1. "Durch das Zusammentreffen einer alten Tradition mit einer neuen Technologie ist ein bisher beispielloses Gemeingut verfügbar geworden. Mit der alten Tradition ist die Bereitschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gemeint, die Ergebnisse ihres Arbeitens in Fachzeitschriften zu veröffentlichen und diese Veröffentlichungen anderen zur Verfügung zu stellen, ohne hierfür bezahlt zu werden. Die neue Technologie ist das Internet. Das Gemeingut, das aus deren Zusammentreffen hervorgehen kann, besteht darin, dass Zeitschriftenbeiträge, die das Peer-Review durchlaufen haben, weltweit elektronisch zugänglich gemacht werden können - kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen für Forschende, Lehrende und Studierende und für alle anderen, die an den Ergebnissen der Wissenschaft interessiert sind" (Budapest Open Access Initiative 2002).
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/german-translation
2. Bibliotheken sind große Befürworter von Open Access. Manchmal sind sie aber auch große Heuchler.
http://archiv.twoday.net/stories/573860379/
3. Grüner Open Access - hinterlegen Sie Ihre Arbeit in der akzeptierten Version (das ist leider nicht die "Version of record" bzw. Verlagsversion) auf einem Open-Access-Server, wenn Ihnen das vertraglich vom Verlag gestattet ist. Die SHERPA-ROMEO-Liste gibt über die Standardgenehmigungen der Verlage Auskunft:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Siehe auch:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/2581
4. Goldener Open Access - publizieren Sie in einer Fachzeitschrift, in denen die Beiträge unter CC-BY stehen.
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/
5. Große traditionelle Wissenschaftsverlage machen enorme Profite.
https://twitter.com/ceptional/status/524291895397056513
6. Es gibt 10.500 Open-Access-Journal mit Peer Review weltweit. Nicht alle davon sind seriös.
http://www.doaj.org
http://archiv.twoday.net/search?q=%23beall
http://archiv.twoday.net/search?q=bohannon
7. Autoren können die Zukunft von Open Access über den Ort, wo sie publizieren, mitbestimmen.
8. Gutachter können sich für Open Access einsetzen, indem sie Gutachten für Zeitschriften ablehnen, die Open Access nicht fördern.
9. Herausgeber können sich für Open Access einsetzen, indem sie die Hausregeln ihrer Zeitschriften mit Blick auf Open Access überprüfen.
10. Vervollständigen Sie diese Liste selbst - was können Sie tun, um Open Access zu unterstützen?


http://jculibrarynews.blogspot.de/2014/10/ten-fast-facts-about-open-access.html
1. "Durch das Zusammentreffen einer alten Tradition mit einer neuen Technologie ist ein bisher beispielloses Gemeingut verfügbar geworden. Mit der alten Tradition ist die Bereitschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gemeint, die Ergebnisse ihres Arbeitens in Fachzeitschriften zu veröffentlichen und diese Veröffentlichungen anderen zur Verfügung zu stellen, ohne hierfür bezahlt zu werden. Die neue Technologie ist das Internet. Das Gemeingut, das aus deren Zusammentreffen hervorgehen kann, besteht darin, dass Zeitschriftenbeiträge, die das Peer-Review durchlaufen haben, weltweit elektronisch zugänglich gemacht werden können - kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen für Forschende, Lehrende und Studierende und für alle anderen, die an den Ergebnissen der Wissenschaft interessiert sind" (Budapest Open Access Initiative 2002).
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/german-translation
2. Bibliotheken sind große Befürworter von Open Access. Manchmal sind sie aber auch große Heuchler.
http://archiv.twoday.net/stories/573860379/
3. Grüner Open Access - hinterlegen Sie Ihre Arbeit in der akzeptierten Version (das ist leider nicht die "Version of record" bzw. Verlagsversion) auf einem Open-Access-Server, wenn Ihnen das vertraglich vom Verlag gestattet ist. Die SHERPA-ROMEO-Liste gibt über die Standardgenehmigungen der Verlage Auskunft:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Siehe auch:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/2581
4. Goldener Open Access - publizieren Sie in einer Fachzeitschrift, in denen die Beiträge unter CC-BY stehen.
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/
5. Große traditionelle Wissenschaftsverlage machen enorme Profite.
https://twitter.com/ceptional/status/524291895397056513
6. Es gibt 10.500 Open-Access-Journal mit Peer Review weltweit. Nicht alle davon sind seriös.
http://www.doaj.org
http://archiv.twoday.net/search?q=%23beall
http://archiv.twoday.net/search?q=bohannon
7. Autoren können die Zukunft von Open Access über den Ort, wo sie publizieren, mitbestimmen.
8. Gutachter können sich für Open Access einsetzen, indem sie Gutachten für Zeitschriften ablehnen, die Open Access nicht fördern.
9. Herausgeber können sich für Open Access einsetzen, indem sie die Hausregeln ihrer Zeitschriften mit Blick auf Open Access überprüfen.
10. Vervollständigen Sie diese Liste selbst - was können Sie tun, um Open Access zu unterstützen?


KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 16:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43174/1.html
"Wie erst jetzt bekannt wurde, durchsuchten von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden beauftragte Ermittler letzte Woche sechs Wohn- und Geschäftsräume in vier Bundesländern, die sie mit den Betreibern des von der Filmindustrie nicht lizenzierten Streamingportals Kinox.to in Verbindung bringen. [...]
Der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke hält es für möglich, "dass die Staatsanwaltschaft schon bald Zugriff auf die jeweiligen Server haben wird" und verweist auf eine Warnung des Portals Tarnkappe.info, wo man befürchtet, dass die Dienste gegenwärtig oder in naher Zukunft "als Honeypot betrieben werden", um IP-Adressen und andere Nutzerdaten zu sammeln.
Ein solches Szenario wäre dem Rechtsanwalt Christian Solmecke nach zwar "theoretisch denkbar", aber "aus Sicht der anwaltlichen Praxis eher ungewöhnlich". Streaming-Nutzer haben seiner Meinung nach "keine Straftat begangen, da der reine Konsum von Streamingdiensten nicht rechtswidrig ist". "

creative commons licensed ( BY-NC-SA ) flickr photo shared by johnb/Derbys/UK.
"Wie erst jetzt bekannt wurde, durchsuchten von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden beauftragte Ermittler letzte Woche sechs Wohn- und Geschäftsräume in vier Bundesländern, die sie mit den Betreibern des von der Filmindustrie nicht lizenzierten Streamingportals Kinox.to in Verbindung bringen. [...]
Der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke hält es für möglich, "dass die Staatsanwaltschaft schon bald Zugriff auf die jeweiligen Server haben wird" und verweist auf eine Warnung des Portals Tarnkappe.info, wo man befürchtet, dass die Dienste gegenwärtig oder in naher Zukunft "als Honeypot betrieben werden", um IP-Adressen und andere Nutzerdaten zu sammeln.
Ein solches Szenario wäre dem Rechtsanwalt Christian Solmecke nach zwar "theoretisch denkbar", aber "aus Sicht der anwaltlichen Praxis eher ungewöhnlich". Streaming-Nutzer haben seiner Meinung nach "keine Straftat begangen, da der reine Konsum von Streamingdiensten nicht rechtswidrig ist". "

creative commons licensed ( BY-NC-SA ) flickr photo shared by johnb/Derbys/UK.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 15:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fordert Thomas Hoeren bezüglich des Leistungsschutzrechtes für Verleger im UrhG:
http://blog.beck.de/2014/10/26/was-sollte-das-berlegungen-zum-ende-des-leistungsschutzrechts-f-r-verleger
Siehe auch:
http://www.medien-internetrecht.de/2014/10/das-faktische-aus-des.html
Es bleibt abzuwarten, ob die LSR-durchsetzungswilligen Verleger, die so viel von Chancengleichheit gegenüber Google gejault haben, nun auch den von ihnen eingeschüchterten oder faktisch zur Aufgabe gezwungenen kleinen Aggregatoren die gleiche Gratiseinwilligung gewähren werden:
http://archiv.twoday.net/stories/1022220691/
Ich sag es gern auch hier: Das "Unerhört" war IRONIE.
http://blog.beck.de/2014/10/26/was-sollte-das-berlegungen-zum-ende-des-leistungsschutzrechts-f-r-verleger
Siehe auch:
http://www.medien-internetrecht.de/2014/10/das-faktische-aus-des.html
Es bleibt abzuwarten, ob die LSR-durchsetzungswilligen Verleger, die so viel von Chancengleichheit gegenüber Google gejault haben, nun auch den von ihnen eingeschüchterten oder faktisch zur Aufgabe gezwungenen kleinen Aggregatoren die gleiche Gratiseinwilligung gewähren werden:
http://archiv.twoday.net/stories/1022220691/
Ich sag es gern auch hier: Das "Unerhört" war IRONIE.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 15:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Seit Freitag ist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv über das soziale Netzwerk Facebook erreichbar. Damit möchten auch wir uns im Bereich des Web 2.0 breiter aufstellen und uns unseren unterschiedlichen Nutzergruppen anpassen.
Auf der Facebook-Seite werden ab sofort auch alle unsere Blogartikel veröffentlicht und durch weiterführende Verlinkungen ergänzt. Darüber hinaus finden interessierte Nutzer dort Veranstaltungshinweise, Fotos zu Veranstaltungen und zur Arbeit im Archiv sowie weitere Neuigkeiten aus dem BBWA. In regelmäßigen Abständen werden neue Inhalte auf der Seite zur Verfügung gestellt um einen Blick in die Arbeit des Archivs und hinter dessen Kulissen werfen zu können.
Wir hoffen, dass sich die Besucher und Nutzer unserer Facebook-Seite mit Anmerkungen, Kommentaren und auch Anregungen - sowohl für die Seite selbst, als auch für die tägliche Arbeit - beteiligen werden und damit einen direkten Austausch mit dem Archivpersonal ermöglichen. Neben den bereits vorgestellten Angeboten finden sie auf unserer Seite bei Facebook auch alle wichtigen Informationen zum Archiv sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten.
Wir würden uns sehr über ihren Besuch auf unserer Seite freuen!
Unter diesem Link ist unsere Facebook-Seite aufrufbar:"
http://www.facebook.de/wirtschaftsarchiv.bb
Quelle:
http://www.bb-wa.de/de/neuigkeiten/360-neue-wege-ins-archiv.html
Auf der Facebook-Seite werden ab sofort auch alle unsere Blogartikel veröffentlicht und durch weiterführende Verlinkungen ergänzt. Darüber hinaus finden interessierte Nutzer dort Veranstaltungshinweise, Fotos zu Veranstaltungen und zur Arbeit im Archiv sowie weitere Neuigkeiten aus dem BBWA. In regelmäßigen Abständen werden neue Inhalte auf der Seite zur Verfügung gestellt um einen Blick in die Arbeit des Archivs und hinter dessen Kulissen werfen zu können.
Wir hoffen, dass sich die Besucher und Nutzer unserer Facebook-Seite mit Anmerkungen, Kommentaren und auch Anregungen - sowohl für die Seite selbst, als auch für die tägliche Arbeit - beteiligen werden und damit einen direkten Austausch mit dem Archivpersonal ermöglichen. Neben den bereits vorgestellten Angeboten finden sie auf unserer Seite bei Facebook auch alle wichtigen Informationen zum Archiv sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten.
Wir würden uns sehr über ihren Besuch auf unserer Seite freuen!
Unter diesem Link ist unsere Facebook-Seite aufrufbar:"
http://www.facebook.de/wirtschaftsarchiv.bb
Quelle:
http://www.bb-wa.de/de/neuigkeiten/360-neue-wege-ins-archiv.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die französischen Forscher Joachim Schöpfel und Helene Prost haben sich auf einer Konferenz über graue Literatur (Ende 2013) ein Thema vorgenommen, das mich schon wiederholt beschäftigt hat:
Back to Grey. Disclosure and Concealment of Electronic Theses and Dissertations
http://hdl.handle.net/10068/1024623
Optimistisch dachte man nach dem Aufkommen des Internets im Forschungsfeld der "Grey Literature", die Lösung des Zugangsproblems sei das Internet und Open Access. Nun aber zeigt sich, dass insbesondere bei den elektronischen Dissertationen (ETD) neue Barrieren errichtet werden. Aus dem Abstract: "Our paper describes a new and unexpected effect of the development of digital libraries and open access, as a paradoxical practice of hiding information from the scientific community and society, while partly sharing it with a restricted population (campus). The study builds on a review of recent papers on ETDs in IRs and evaluates the availability of ETDs in a small panel of European and American academic IRs and networks."
Besonders hoch ist die Quote der extern unzugänglichen Dissertationen in Lüttich/Liège, einem Vorzeige-IR der Harnadianer. Nicht weniger als 43 % können nicht von der Allgemeinheit eingesehen werden. 33 % sind für Campus-Nutzer zugänglich. Dass es in Lüttichs Repositorium ORBI besonders schlecht aussieht, kann ich bestätigen. In einem Beitrag von 2014 schrieb ich (nicht nur auf ETDs bezogen):
"Leider kann man die Anzahl der dark deposits mit der Suche nicht ermitteln. Von 3147 Peer-Reviewed-Beiträgen im Jahr 2009 (Embargos dieses Jahrs sind längst abgelaufen) sind nach einer Stichprobe von 2x100 Treffern ca. 37 % dark deposits. Also etwa 1164 unnötige dark deposits!"
http://archiv.twoday.net/stories/894826152/
Schon 2010 hatte ich meinem Unmut über ORBI Luft gemacht:
http://archiv.twoday.net/stories/6228378/
Immer wieder habe ich mich (von Schöpfel/Prost unbeachtet) gegen "dark deposits", also für die Allgemeinheit unzugängliche Einstellungen in institutionellen Repositorien (IRs), und campus-weite universitäre Datenbanken wie Bildserver, ausgesprochen.
1. Dark deposits und der Eprint Button
Richard Poynder hat in seinem Interview mit Kathleen Shearer ausgeführt:
"However, not all records in OA repositories do provide access to the full-text, and many seem to offer little more than the bibliographic details. Even a poster child of the OA movement — Harvard’s DASH repository — has been criticised for not providing the full text (e.g. here). These criticisms were made a few years ago, but DASH does still today contain records without any full-text attached. Moreover, some do not even provide a link to the full-text (and DASH does not seem to have a RequestCopy Button). When I looked in DASH the other day, for instance, I found (at random) five examples of this (one, two, three, four, five).
I think this cannot be a consequence of publisher embargoes since the articles concerned date back as far as 1993, with the two most recent published five years ago (and in any case the Harvard OA Policies claim to moot publisher embargoes). Moreover, where in a couple of cases the DASH records do point to the full-text this is a link to the publisher’s version, where the user is asked to pay for access ($35 in one case). This cannot be described as OA."
http://poynder.blogspot.de/2014/05/interview-with-kathleen-shearer.html
Der Link zur Kritik führt auf meinen Beitrag von 2009 über DASH:
http://archiv.twoday.net/stories/5918219/
Stuart Shieber hat darauf reagiert und in den Kommentaren auf seinen Beitrag "The importance of dark deposit" hingewiesen:
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/03/12/the-importance-of-dark-deposit/
Stevan Harnad hat immer wieder dafür plädiert, jede akzeptierte Version in jedem Fall in das IR aufzunehmen, einen Eprint-Button, mit dem man vom Autor eine Version anfordern kann, zu installieren und nach Ablauf des jeweiligen Embargos den Eprint freizuschalten. Peter Suber unterstützt diese Vorgehensweise. Ich zitiere eine Zusammenfassung von Wortmeldungen Harnads durch Suber 2009:
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/2009/05/dark-deposits-when-oa-is-not-permitted.html
In den BOAI-10-Empfehlungen von 2012 heißt es demzufolge:
"When publishers will not allow OA on the university’s preferred terms, we recommend either of two courses. The policy may require dark or non-OA deposit in the institutional repository until permission for OA can be obtained."
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
2008 habe ich gegen den Request-a-copy-Button erhebliche Einwände (unter anderem nach deutschem Recht) erhoben:
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
2010 berichtete ich über ein Gutachten, wonach nach Schweizer Recht der Button illegal sein kann.
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
Im gleichen Jahr schrieb ich: "Wenn man als Inhalt der Mandate die sofortige Hinterlegung im IR ohne Verpflichtung, sofortigen OA zu gewähren, propagiert, schafft man eine Woge von "dark deposits", die für unabsehbare Zeit (maximal 70 Jahre nach dem Tod des Autors) allenfalls mit dem fragwürdigen Instrument des Request-Buttons externen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen.
Ignoriert werden dabei die folgenden empirischen Fakten:
(i) In Deutschland werden Mandate überwiegend als juristisch unmöglich angesehen.
(ii) Wissenschaftler neigen dazu anstelle des Final Draft das Verlags-PDF zu deponieren mit der Konsequenz, dass der jeweilige Beitrag dauerhaft NICHT OA ist.
(iii) Universitätsintern zugängliche dark deposits schaffen einen unfairen Vorteil für die jeweiligen Universitätsangehörigen. Werden Preprints vor der Publikation der eigenen Universitätsöffentlichkeit zugänglich gemacht, so bedeutet das einen Verstoß gegen das wissenschaftliche Gleichheitsprinzip und Förderung eines Universitäts-Egoismus."
Dass ich mit meinen Bedenken nicht ganz allein stand, zeigte die Diskussion zu einem Blogpost 2010, bei der es auch zu einem Schlagabtausch zwischen Harnad und mir kam:
http://www.open.ac.uk/blogs/ORO/?p=92
Heather Morrison schrieb damals: "My perspective is that when requesters have to identify themselves, this raises privacy issues. There are also many potential fairness issues when researchers choose who can view the work. The sooner we move to full, immediate, and preferably libre OA, the better, in my view."
2011 schaute ich mir das IR von Glasgow etwas näher an:
http://archiv.twoday.net/stories/38747477/
Ebenfalls 2011 berichtete ich über eine Studie, die allgemein die Email-Anforderung von nicht OA-verfügbaren Artikeln beim Autor betraf: "In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte".
http://archiv.twoday.net/stories/55769627/
Ein Jahr zuvor hatte eine Mini-Studie anhand von drei IRs mit Button von Sale und Harnad und anderen ergeben, dass in Minho 72 % der Anfragen ignoriert wurden bzw. unbeantwortet blieben (1 % wurde abgelehnt). Am besten schnitt die Uni Striling mit 60 % Erfolgsrate ab.
http://archipel.uqam.ca/2614/
Vor einer "inakzeptablen Zweiklassengesellschaft" warnte ich 2013:
http://archiv.twoday.net/stories/323399688/
Aus meiner Sicht hat der Button soviel mit OA zu tun wie die in Deutschland exzellente Fernleihe oder Direkttlieferdienste. OA hat für mich eigentlich im Kern mit wissenschaftlicher Chancengleichheit zu tun. Der Button macht den Anfragenden zum Bittsteller beim Autor, der nach Belieben den Zugang verweigern oder gewähren kann.
Um es klar zu sagen: Ich kann mit dark deposits in IRs leben, wenn diese ausschließlich dazu genutzt werden, ein genau definiertes (nicht zu langes) Embargo zu überbrücken, an dessen Ende die automatische Freischaltung steht.
Aber dieses Ideal hat nichts mit der empirischen Realität der Repositorien zu tun, die oft ihren Autoren die Wahl lassen, ob sie die Allgemeinheit, die Campus-Öffentlichkeit oder niemand als Benutzer des Eprints zulassen wollen. Es ist klar, dass sachfremden Erwägungen damit Tür und Tor geöffnet sind. Autoren deponieren beispielsweise gern Verlags-PDF, die aufgrund der Verlags-Polycies dauerhaft weggeschlossen werden müssen.
Harvards DASH, das nach wie vor keinen Eprint-Button kennt, ermöglicht es den Autoren, ohne Begründung ihre Arbeiten als dark deposits einzustellen.
Den "Open Access Button", der etwas anderes ist als der IR-Button und inzwischen auch die Anfrage beim Autor ermöglicht, unterstütze ich dagegen:
http://archiv.twoday.net/stories/1022220344/
2. ETDs und Embargos
Sollen Abschlussarbeiten zu Dissertationen ausgebaut werden, kann ein Embargo aus meiner Sicht vertreten werden. Bei Dissertationen müssen Mandate die sofortige, embargolose Open-Access-Veröffentlichung vorsehen. Hier muss dem Interesse der Wissenschaft eindeutig der Vorzug gegeben werden. Siehe nur
http://archiv.twoday.net/stories/444871448/
Ich habe im Lauf der letzten Jahre über 100 Links gesammelt, die fast alle besagen, dass entgegen landläufigem Vorurteil eine Open-Access-Buchpublikation den Verkaufszahlen der gedruckten Version nicht schadet:
https://www.diigo.com/user/klausgraf/monograph_open_access
3. Universitäre Bildserver und Ähnliches
2010 schrieb ich aus Anlass eines Innsbrucker Dissertations-Digitalisierungsprojekts:
"Wie bei ORBI Lüttich, dem Heidelberger oder Karlsruher Bildserver usw. gilt auch hier: Projekte, die Digitalisate den Angehörigen der eigenen Hochschule vorbehalten, schaffen einen unfairen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil. (Das gilt natürlich auch für das Bildarchiv Prometheus, in dem zehntausendfach Urheberrechtsverletzungen begangen werden.)"
http://archiv.twoday.net/stories/6385290/
Campus-weit zugängliche Bildserver dürften die Regel sein, auch wenn es Gastzugänge wie in HEIDICON
https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/
gibt. Es besteht kein Zweifel, dass solche Bild- und Medienserver unter die wissenschaftlichen Materialien fallen, für die etwa die Berliner Erklärung Open Access vorsieht.
Wie noch zu zeigen ist, macht es aus urheberrechtlicher Sicht keinen Unterschied, wenn unbefugt hochschulweit oder weltweit genutzt wird.
Grundsätzlich muss gelten: Alle an der Hochschule erzeugten Forschungsunterlagen, die aus Urheberrechtsgründen frei zugänglich sein könnten und die nicht aus anderen Gründen als vertraulich zu behandeln sind, haben Open Access weltweit zur Verfügung zu stehen.
Die von Schöpfel/Prost behandelte ETD-Problematik hätte eingebunden werden müssen in ein Gesamtbild der Zugangsbeschränkungen auf universitären Servern.
4. Hinweise zur deutschen Rechtslage
Ein generelles Recht, die urheberrechtlich geschützte Produktion einer Hochschule zu archivieren, besteht (leider) nicht. Ich sage das, weil Shieber bei Harvards DASH diese Archivfunktion besonders unterstrichen hat.
Das Erstellen einer elektronischen Vervielfältigung fürs IR oder den Medienserver setzt voraus, dass eine Urheberrechtsschranke dies erlaubt.
Zu § 52b UrhG verweise ich auf meine Ausführungen:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg53908.html
Gibt es kein gedrucktes Exemplar in der Hochschulbibliothek (z.B: bei E-Journals) kommt eine Berufung auf § 52b UrhG nicht in Betracht. Ebenso bei unveröffentlichten Arbeiten.
Für einen campus-weiten Zugang kommt § 52a UrhG nicht in Betracht. Zur Anwendung siehe etwa die Handreichung der Uni Mainz von 2014:
https://www.e-science-services-ub.uni-mainz.de/files/2014/04/140425_D_UrhR_Vermerk_%C2%A752aUrhG_aktualisiert.pdf
Bei § 53 UrhG setzt die Erstellung einer Archivkopie ein eigenes Werkstück voraus; das E-Journal bleibt also auch hier außen vor. Bei der Vervielfältigung zu wissenschaftlichen Zwecken wird man eher an konkrete Forschungsprojekte zu denken haben.
Zu Bedenken hinsichtlich des Eprint-Buttons verweise ich auf die oben bereits genannten Links:
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
Wenn Harnad beton, es sei legal, eine Publikation im final draft in einem IR zu hinterlegen, muss dahinter aus Sicht des deutschen Rechts ein Fragezeichen gesetzt werden. Hat der Autor nur einfache Rechte abgetreten, dürfte er ohnehin den Beitrag Open Access im IR publizieren. Bei ausschließlichem Recht des Verlags muss eine Schranke des Urheberrechts gegeben sein (es sei denn der Verlag stimmt dem dark deposit ausdrücklich zu), um die erforderliche Kopie des Beitrags zu erstellen, die für das IR benötigt wird. Bei E-Journals kommt allenfalls die eher fragwürdige Rechtfertigung des wissenschaftlichen Gebrauchs in Betracht. Das Recht des Verlags bezieht sich auf jedwede Version, also auch auf die akzeptierte Autorenversion (final draft).
Werden Medien in einem universitären Medienserver campus-weit bereitgestellt, so bedeutet das:
1. Es erfolgt bei Unveröffentlichtem eine Veröffentlichung im urheberrechtlichen Sinn (z.B. darf aus dem Beitrag dann wörtlich zitiert werden)
2. Es handelt sich um eine öffentliche Zugänglichmachung (Intranet-Nutzung), die nur mit Zustimmung des Berechtigten erfolgen darf.
Allenfalls das Risiko, dass die Rechtsverletzung entdeckt oder verfolgt wird, dürfte geringer sein als bei weltweiter Veröffentlichung. Ein Unterlassungsanspruch ist aber auf jeden Fall gegeben. bei der Schadenshöhe könnte natürlich eine campus-weite Nutzung den Verletzer billiger kommen.
Meines Wissens wurde noch nicht juristisch geprüft, ob die öffentlichrechtlich organisierten deutschen Universitäten, mit ihren campus-weiten Angeboten, die sich auch der Allgemeinheit zugänglich machen dürften, nicht gegen Art. 3 GG (Gleichheitssatz) oder Art. 5 GG verstoßen, von einer eventuellen Relevanz des Informationsweiterverwendungsgesetzes IWG oder dem UWG abgesehen. Hinsichtlich Forschung und Lehre nehmen die Informationsfreiheitsgesetze die Hochschulen aus, was mit Blick auf Transparenz und Open Access ein Unding ist.
5. Zusammenfassung
Open Access hat für mich zentral mit wissenschaftlicher Chancengleichheit zu tun, und diese ist für mich eindeutig verletzt, wenn für die Forschung bedeutsame Informationen elektronisch nur den Hochschulangehörigen zur Verfügung stehen. Das kann man allgemein so formulieren und auch auf die lizenzierten Datenbanken usw. beziehen, aber hier geht es um Materialien, die die Autoren - ohne Rechte Dritter zu verletzen - auch weltweit verfügbar machen könnten.
Ein geschützter Diskussionsraum ist ein kleines Forschungsteam, aber nicht eine ganze Universität. Werden unveröffentlichte Working Papers oder Dissertationen oder Preprints nur campus-weit zugänglich gemacht, ist das ein eklatanter Verstoß gegen die wissenschaftliche Ethik, da es sich nach der Einstellung um PUBLIKATIONEN handelt, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssten, also etwa auch für die Fernleihe.
Wer hinreichend Sozialkapital hat oder Kontakte zu Studierenden der Universität herstellen kann, kommt natürlich an die gesperrten Dokumente (ob IR oder Medienserver) heran, auch wenn er sich scheut, den Autor zu kontaktieren.
Das ist schlicht und einfach nicht fair.
Wir brauchen eine wissenschaftliche Community, bei der Open Access der Standard ist und Vertraulichkeit/Nutzungsbeschränkungen die begründungsbedürftige Ausnahme.
Dark deposits nach Belieben der Autoren ohne festgelegtes Embargo-Enddatum sind von Übel und schaden Open Access. Campus-weit zugängliche Dokumente und Medien wie Bilder, die auch Open Access zugänglich gemacht werden dürften, schaden ebenfalls Open Access.
Je mehr der "grüne Weg" von OA von Harnad und anderen als Heilslehre evangelisiert und der Eprint-Button in IRs als Beinahe-OA zurechtgelogen wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kritisierten wissenschaftsfeindlichen Zugangsbeschränkungen nicht eliminiert werden können.

Back to Grey. Disclosure and Concealment of Electronic Theses and Dissertations
http://hdl.handle.net/10068/1024623
Optimistisch dachte man nach dem Aufkommen des Internets im Forschungsfeld der "Grey Literature", die Lösung des Zugangsproblems sei das Internet und Open Access. Nun aber zeigt sich, dass insbesondere bei den elektronischen Dissertationen (ETD) neue Barrieren errichtet werden. Aus dem Abstract: "Our paper describes a new and unexpected effect of the development of digital libraries and open access, as a paradoxical practice of hiding information from the scientific community and society, while partly sharing it with a restricted population (campus). The study builds on a review of recent papers on ETDs in IRs and evaluates the availability of ETDs in a small panel of European and American academic IRs and networks."
Besonders hoch ist die Quote der extern unzugänglichen Dissertationen in Lüttich/Liège, einem Vorzeige-IR der Harnadianer. Nicht weniger als 43 % können nicht von der Allgemeinheit eingesehen werden. 33 % sind für Campus-Nutzer zugänglich. Dass es in Lüttichs Repositorium ORBI besonders schlecht aussieht, kann ich bestätigen. In einem Beitrag von 2014 schrieb ich (nicht nur auf ETDs bezogen):
"Leider kann man die Anzahl der dark deposits mit der Suche nicht ermitteln. Von 3147 Peer-Reviewed-Beiträgen im Jahr 2009 (Embargos dieses Jahrs sind längst abgelaufen) sind nach einer Stichprobe von 2x100 Treffern ca. 37 % dark deposits. Also etwa 1164 unnötige dark deposits!"
http://archiv.twoday.net/stories/894826152/
Schon 2010 hatte ich meinem Unmut über ORBI Luft gemacht:
http://archiv.twoday.net/stories/6228378/
Immer wieder habe ich mich (von Schöpfel/Prost unbeachtet) gegen "dark deposits", also für die Allgemeinheit unzugängliche Einstellungen in institutionellen Repositorien (IRs), und campus-weite universitäre Datenbanken wie Bildserver, ausgesprochen.
1. Dark deposits und der Eprint Button
Richard Poynder hat in seinem Interview mit Kathleen Shearer ausgeführt:
"However, not all records in OA repositories do provide access to the full-text, and many seem to offer little more than the bibliographic details. Even a poster child of the OA movement — Harvard’s DASH repository — has been criticised for not providing the full text (e.g. here). These criticisms were made a few years ago, but DASH does still today contain records without any full-text attached. Moreover, some do not even provide a link to the full-text (and DASH does not seem to have a RequestCopy Button). When I looked in DASH the other day, for instance, I found (at random) five examples of this (one, two, three, four, five).
I think this cannot be a consequence of publisher embargoes since the articles concerned date back as far as 1993, with the two most recent published five years ago (and in any case the Harvard OA Policies claim to moot publisher embargoes). Moreover, where in a couple of cases the DASH records do point to the full-text this is a link to the publisher’s version, where the user is asked to pay for access ($35 in one case). This cannot be described as OA."
http://poynder.blogspot.de/2014/05/interview-with-kathleen-shearer.html
Der Link zur Kritik führt auf meinen Beitrag von 2009 über DASH:
http://archiv.twoday.net/stories/5918219/
Stuart Shieber hat darauf reagiert und in den Kommentaren auf seinen Beitrag "The importance of dark deposit" hingewiesen:
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/03/12/the-importance-of-dark-deposit/
Stevan Harnad hat immer wieder dafür plädiert, jede akzeptierte Version in jedem Fall in das IR aufzunehmen, einen Eprint-Button, mit dem man vom Autor eine Version anfordern kann, zu installieren und nach Ablauf des jeweiligen Embargos den Eprint freizuschalten. Peter Suber unterstützt diese Vorgehensweise. Ich zitiere eine Zusammenfassung von Wortmeldungen Harnads durch Suber 2009:
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/2009/05/dark-deposits-when-oa-is-not-permitted.html
In den BOAI-10-Empfehlungen von 2012 heißt es demzufolge:
"When publishers will not allow OA on the university’s preferred terms, we recommend either of two courses. The policy may require dark or non-OA deposit in the institutional repository until permission for OA can be obtained."
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
2008 habe ich gegen den Request-a-copy-Button erhebliche Einwände (unter anderem nach deutschem Recht) erhoben:
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
2010 berichtete ich über ein Gutachten, wonach nach Schweizer Recht der Button illegal sein kann.
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
Im gleichen Jahr schrieb ich: "Wenn man als Inhalt der Mandate die sofortige Hinterlegung im IR ohne Verpflichtung, sofortigen OA zu gewähren, propagiert, schafft man eine Woge von "dark deposits", die für unabsehbare Zeit (maximal 70 Jahre nach dem Tod des Autors) allenfalls mit dem fragwürdigen Instrument des Request-Buttons externen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen.
Ignoriert werden dabei die folgenden empirischen Fakten:
(i) In Deutschland werden Mandate überwiegend als juristisch unmöglich angesehen.
(ii) Wissenschaftler neigen dazu anstelle des Final Draft das Verlags-PDF zu deponieren mit der Konsequenz, dass der jeweilige Beitrag dauerhaft NICHT OA ist.
(iii) Universitätsintern zugängliche dark deposits schaffen einen unfairen Vorteil für die jeweiligen Universitätsangehörigen. Werden Preprints vor der Publikation der eigenen Universitätsöffentlichkeit zugänglich gemacht, so bedeutet das einen Verstoß gegen das wissenschaftliche Gleichheitsprinzip und Förderung eines Universitäts-Egoismus."
Dass ich mit meinen Bedenken nicht ganz allein stand, zeigte die Diskussion zu einem Blogpost 2010, bei der es auch zu einem Schlagabtausch zwischen Harnad und mir kam:
http://www.open.ac.uk/blogs/ORO/?p=92
Heather Morrison schrieb damals: "My perspective is that when requesters have to identify themselves, this raises privacy issues. There are also many potential fairness issues when researchers choose who can view the work. The sooner we move to full, immediate, and preferably libre OA, the better, in my view."
2011 schaute ich mir das IR von Glasgow etwas näher an:
http://archiv.twoday.net/stories/38747477/
Ebenfalls 2011 berichtete ich über eine Studie, die allgemein die Email-Anforderung von nicht OA-verfügbaren Artikeln beim Autor betraf: "In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte".
http://archiv.twoday.net/stories/55769627/
Ein Jahr zuvor hatte eine Mini-Studie anhand von drei IRs mit Button von Sale und Harnad und anderen ergeben, dass in Minho 72 % der Anfragen ignoriert wurden bzw. unbeantwortet blieben (1 % wurde abgelehnt). Am besten schnitt die Uni Striling mit 60 % Erfolgsrate ab.
http://archipel.uqam.ca/2614/
Vor einer "inakzeptablen Zweiklassengesellschaft" warnte ich 2013:
http://archiv.twoday.net/stories/323399688/
Aus meiner Sicht hat der Button soviel mit OA zu tun wie die in Deutschland exzellente Fernleihe oder Direkttlieferdienste. OA hat für mich eigentlich im Kern mit wissenschaftlicher Chancengleichheit zu tun. Der Button macht den Anfragenden zum Bittsteller beim Autor, der nach Belieben den Zugang verweigern oder gewähren kann.
Um es klar zu sagen: Ich kann mit dark deposits in IRs leben, wenn diese ausschließlich dazu genutzt werden, ein genau definiertes (nicht zu langes) Embargo zu überbrücken, an dessen Ende die automatische Freischaltung steht.
Aber dieses Ideal hat nichts mit der empirischen Realität der Repositorien zu tun, die oft ihren Autoren die Wahl lassen, ob sie die Allgemeinheit, die Campus-Öffentlichkeit oder niemand als Benutzer des Eprints zulassen wollen. Es ist klar, dass sachfremden Erwägungen damit Tür und Tor geöffnet sind. Autoren deponieren beispielsweise gern Verlags-PDF, die aufgrund der Verlags-Polycies dauerhaft weggeschlossen werden müssen.
Harvards DASH, das nach wie vor keinen Eprint-Button kennt, ermöglicht es den Autoren, ohne Begründung ihre Arbeiten als dark deposits einzustellen.
Den "Open Access Button", der etwas anderes ist als der IR-Button und inzwischen auch die Anfrage beim Autor ermöglicht, unterstütze ich dagegen:
http://archiv.twoday.net/stories/1022220344/
2. ETDs und Embargos
Sollen Abschlussarbeiten zu Dissertationen ausgebaut werden, kann ein Embargo aus meiner Sicht vertreten werden. Bei Dissertationen müssen Mandate die sofortige, embargolose Open-Access-Veröffentlichung vorsehen. Hier muss dem Interesse der Wissenschaft eindeutig der Vorzug gegeben werden. Siehe nur
http://archiv.twoday.net/stories/444871448/
Ich habe im Lauf der letzten Jahre über 100 Links gesammelt, die fast alle besagen, dass entgegen landläufigem Vorurteil eine Open-Access-Buchpublikation den Verkaufszahlen der gedruckten Version nicht schadet:
https://www.diigo.com/user/klausgraf/monograph_open_access
3. Universitäre Bildserver und Ähnliches
2010 schrieb ich aus Anlass eines Innsbrucker Dissertations-Digitalisierungsprojekts:
"Wie bei ORBI Lüttich, dem Heidelberger oder Karlsruher Bildserver usw. gilt auch hier: Projekte, die Digitalisate den Angehörigen der eigenen Hochschule vorbehalten, schaffen einen unfairen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil. (Das gilt natürlich auch für das Bildarchiv Prometheus, in dem zehntausendfach Urheberrechtsverletzungen begangen werden.)"
http://archiv.twoday.net/stories/6385290/
Campus-weit zugängliche Bildserver dürften die Regel sein, auch wenn es Gastzugänge wie in HEIDICON
https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/
gibt. Es besteht kein Zweifel, dass solche Bild- und Medienserver unter die wissenschaftlichen Materialien fallen, für die etwa die Berliner Erklärung Open Access vorsieht.
Wie noch zu zeigen ist, macht es aus urheberrechtlicher Sicht keinen Unterschied, wenn unbefugt hochschulweit oder weltweit genutzt wird.
Grundsätzlich muss gelten: Alle an der Hochschule erzeugten Forschungsunterlagen, die aus Urheberrechtsgründen frei zugänglich sein könnten und die nicht aus anderen Gründen als vertraulich zu behandeln sind, haben Open Access weltweit zur Verfügung zu stehen.
Die von Schöpfel/Prost behandelte ETD-Problematik hätte eingebunden werden müssen in ein Gesamtbild der Zugangsbeschränkungen auf universitären Servern.
4. Hinweise zur deutschen Rechtslage
Ein generelles Recht, die urheberrechtlich geschützte Produktion einer Hochschule zu archivieren, besteht (leider) nicht. Ich sage das, weil Shieber bei Harvards DASH diese Archivfunktion besonders unterstrichen hat.
Das Erstellen einer elektronischen Vervielfältigung fürs IR oder den Medienserver setzt voraus, dass eine Urheberrechtsschranke dies erlaubt.
Zu § 52b UrhG verweise ich auf meine Ausführungen:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg53908.html
Gibt es kein gedrucktes Exemplar in der Hochschulbibliothek (z.B: bei E-Journals) kommt eine Berufung auf § 52b UrhG nicht in Betracht. Ebenso bei unveröffentlichten Arbeiten.
Für einen campus-weiten Zugang kommt § 52a UrhG nicht in Betracht. Zur Anwendung siehe etwa die Handreichung der Uni Mainz von 2014:
https://www.e-science-services-ub.uni-mainz.de/files/2014/04/140425_D_UrhR_Vermerk_%C2%A752aUrhG_aktualisiert.pdf
Bei § 53 UrhG setzt die Erstellung einer Archivkopie ein eigenes Werkstück voraus; das E-Journal bleibt also auch hier außen vor. Bei der Vervielfältigung zu wissenschaftlichen Zwecken wird man eher an konkrete Forschungsprojekte zu denken haben.
Zu Bedenken hinsichtlich des Eprint-Buttons verweise ich auf die oben bereits genannten Links:
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
http://archiv.twoday.net/stories/6166949/
Wenn Harnad beton, es sei legal, eine Publikation im final draft in einem IR zu hinterlegen, muss dahinter aus Sicht des deutschen Rechts ein Fragezeichen gesetzt werden. Hat der Autor nur einfache Rechte abgetreten, dürfte er ohnehin den Beitrag Open Access im IR publizieren. Bei ausschließlichem Recht des Verlags muss eine Schranke des Urheberrechts gegeben sein (es sei denn der Verlag stimmt dem dark deposit ausdrücklich zu), um die erforderliche Kopie des Beitrags zu erstellen, die für das IR benötigt wird. Bei E-Journals kommt allenfalls die eher fragwürdige Rechtfertigung des wissenschaftlichen Gebrauchs in Betracht. Das Recht des Verlags bezieht sich auf jedwede Version, also auch auf die akzeptierte Autorenversion (final draft).
Werden Medien in einem universitären Medienserver campus-weit bereitgestellt, so bedeutet das:
1. Es erfolgt bei Unveröffentlichtem eine Veröffentlichung im urheberrechtlichen Sinn (z.B. darf aus dem Beitrag dann wörtlich zitiert werden)
2. Es handelt sich um eine öffentliche Zugänglichmachung (Intranet-Nutzung), die nur mit Zustimmung des Berechtigten erfolgen darf.
Allenfalls das Risiko, dass die Rechtsverletzung entdeckt oder verfolgt wird, dürfte geringer sein als bei weltweiter Veröffentlichung. Ein Unterlassungsanspruch ist aber auf jeden Fall gegeben. bei der Schadenshöhe könnte natürlich eine campus-weite Nutzung den Verletzer billiger kommen.
Meines Wissens wurde noch nicht juristisch geprüft, ob die öffentlichrechtlich organisierten deutschen Universitäten, mit ihren campus-weiten Angeboten, die sich auch der Allgemeinheit zugänglich machen dürften, nicht gegen Art. 3 GG (Gleichheitssatz) oder Art. 5 GG verstoßen, von einer eventuellen Relevanz des Informationsweiterverwendungsgesetzes IWG oder dem UWG abgesehen. Hinsichtlich Forschung und Lehre nehmen die Informationsfreiheitsgesetze die Hochschulen aus, was mit Blick auf Transparenz und Open Access ein Unding ist.
5. Zusammenfassung
Open Access hat für mich zentral mit wissenschaftlicher Chancengleichheit zu tun, und diese ist für mich eindeutig verletzt, wenn für die Forschung bedeutsame Informationen elektronisch nur den Hochschulangehörigen zur Verfügung stehen. Das kann man allgemein so formulieren und auch auf die lizenzierten Datenbanken usw. beziehen, aber hier geht es um Materialien, die die Autoren - ohne Rechte Dritter zu verletzen - auch weltweit verfügbar machen könnten.
Ein geschützter Diskussionsraum ist ein kleines Forschungsteam, aber nicht eine ganze Universität. Werden unveröffentlichte Working Papers oder Dissertationen oder Preprints nur campus-weit zugänglich gemacht, ist das ein eklatanter Verstoß gegen die wissenschaftliche Ethik, da es sich nach der Einstellung um PUBLIKATIONEN handelt, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssten, also etwa auch für die Fernleihe.
Wer hinreichend Sozialkapital hat oder Kontakte zu Studierenden der Universität herstellen kann, kommt natürlich an die gesperrten Dokumente (ob IR oder Medienserver) heran, auch wenn er sich scheut, den Autor zu kontaktieren.
Das ist schlicht und einfach nicht fair.
Wir brauchen eine wissenschaftliche Community, bei der Open Access der Standard ist und Vertraulichkeit/Nutzungsbeschränkungen die begründungsbedürftige Ausnahme.
Dark deposits nach Belieben der Autoren ohne festgelegtes Embargo-Enddatum sind von Übel und schaden Open Access. Campus-weit zugängliche Dokumente und Medien wie Bilder, die auch Open Access zugänglich gemacht werden dürften, schaden ebenfalls Open Access.
Je mehr der "grüne Weg" von OA von Harnad und anderen als Heilslehre evangelisiert und der Eprint-Button in IRs als Beinahe-OA zurechtgelogen wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kritisierten wissenschaftsfeindlichen Zugangsbeschränkungen nicht eliminiert werden können.

KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 02:47 - Rubrik: Open Access
"The Ebstorf Map (Wilke, 2001; Kugler, 2007; Wolf, 2004, 2006, 2007, 2009a, b), the largest medieval map of the world whose original has been lost, is not only a geographical map. In the Middle Ages, a map contained mystic, historical and religious motifs. Of central importance is Jesus Christ, who, in the Ebstorf Map, is part of the earth. The Ebstorf Map contains the knowledge of the time of its creation; it can be used for example as an atlas, as a chronicle of the world, or as an illustrated Bible."
Pischke, Gudrun: The Ebstorf Map: tradition and contents of a medieval picture of the world, Hist. Geo Space. Sci., 5, 155-161, doi: http://dx.doi.org/10.5194/hgss-5-155-2014, 2014

Pischke, Gudrun: The Ebstorf Map: tradition and contents of a medieval picture of the world, Hist. Geo Space. Sci., 5, 155-161, doi: http://dx.doi.org/10.5194/hgss-5-155-2014, 2014

KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 01:44 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext. 83. Deutscher Archivtag in Saarbrücken (=Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, Band 18), Fulda 2014, [ISBN 978-3-9811618-7-8]
Demnächst wird hoffentlich ein Inhaltsverzeichnismindestens bei der DNB online sein. Der VdA sieht keinen Anlass, eines [bei der Ankündigung in der News-Sektion] anzubieten. Es kaufen ja eh nur die üblichen Verdächtigen das überwiegend langweilige Werk, in dem Archivalia, wenn ich nichts übersehen habe, allein in dem lesenswerten beitrag von Ziwes über die GND-Einbindung S. 86 Anm. 27 zitiert wird.
Update: Ich habe aufgrund des Hinweises im Kommentar den Beitrag korrigiert.
Demnächst wird hoffentlich ein Inhaltsverzeichnis
Update: Ich habe aufgrund des Hinweises im Kommentar den Beitrag korrigiert.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Oktober 2014, 01:22 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Werner Tannhof erörtert die Konsequenzen:
http://wp.ub.hsu-hh.de/16535/dfg-beendet-foerderung-fuer-deutsche-sondersammelgebiete-literaturversorgung-fuer-fachgebiet-psychologie-in-gefahr/
http://wp.ub.hsu-hh.de/16535/dfg-beendet-foerderung-fuer-deutsche-sondersammelgebiete-literaturversorgung-fuer-fachgebiet-psychologie-in-gefahr/
KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:46 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.vallesiana.ch/kulturerbe/digitale-kulturgut-wallis-3.html#!search
Eine Metasuche, auch zu den Beständen des Staatsarchivs.
Eine Metasuche, auch zu den Beständen des Staatsarchivs.
KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die bedeutendste unheimliche Geschichte, die je geschrieben wurde, ist möglicherweise 'Die Weiden' von Algernon Blackwood." Zitiert die Wikipedia H. P. Lovecraft.
Blackwood gehörte den zu vielen Freiwilligen, über die ein neues Portal unterrichtet.
http://www.redcross.org.uk/en/About-us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War/Algernon-Henry-Blackwood
http://www.redcross.org.uk/en/About-us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War

Blackwood gehörte den zu vielen Freiwilligen, über die ein neues Portal unterrichtet.
http://www.redcross.org.uk/en/About-us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War/Algernon-Henry-Blackwood
http://www.redcross.org.uk/en/About-us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War

KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:33 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://schmalenstroer.net/blog/2014/10/einfach-mal-bei-der-vg-media-anfragen/
"Es ist zum Glück selten, dass sich ein Gesetz völlig absehbar in ein totales Desaster verwandelt. Mit dem Leistungsschutzrecht ist das jetzt passiert. "
"Es ist zum Glück selten, dass sich ein Gesetz völlig absehbar in ein totales Desaster verwandelt. Mit dem Leistungsschutzrecht ist das jetzt passiert. "
KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:28 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archaeologik.blogspot.de/2014/10/alle-schwedischen-archaologischen.html
Mit Link zur Petition.
Update: war erfolgreich
http://archaeologik.blogspot.de/2014/11/petition-mit-erfolg-schwedische.html
Mit Link zur Petition.
Update: war erfolgreich
http://archaeologik.blogspot.de/2014/11/petition-mit-erfolg-schwedische.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/gallia-pontificia
Bd. 7 folgt wohl frühestens 2017.
Via
http://dfmfa.hypotheses.org/1624
Bd. 7 folgt wohl frühestens 2017.
Via
http://dfmfa.hypotheses.org/1624
KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:21 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://heise.de/-2432125
Das Projekt Diptychon hat im Netz nichts vorzuweisen außer einer Mini-Projektbeschreibung.
Das Projekt Diptychon hat im Netz nichts vorzuweisen außer einer Mini-Projektbeschreibung.
KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:11 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/date1.html
In INETBIB wurde passend zur Open-Access-Woche über das Verhältnis der Bibliotheken zum Paid Content diskutiert.

In INETBIB wurde passend zur Open-Access-Woche über das Verhältnis der Bibliotheken zum Paid Content diskutiert.

KlausGraf - am Samstag, 25. Oktober 2014, 17:06 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 20:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.nature.com/news/2014/10/more-than-half-of-2007-2012-research-articles-now-free-to-read.html?WT.mc_id=TWT_NatureNews
Ich bin bei solchen hohen Zahlen eher skeptisch und sehe keinen Anlass, die Sachlage jetzt anders zu sehen als im letzten Jahr, als ich anlässlich der Vorgängerstudie eine entsprechende Erhebung veranstaltete:
http://archiv.twoday.net/stories/528987964/
Damals formulierte ich als Hypothese: "Weniger als 10 % der 2011 erschienenen deutschsprachigen wissenschaftlichen Beiträge aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft sind kostenlos im Netz verfügbar".
Ich bin bei solchen hohen Zahlen eher skeptisch und sehe keinen Anlass, die Sachlage jetzt anders zu sehen als im letzten Jahr, als ich anlässlich der Vorgängerstudie eine entsprechende Erhebung veranstaltete:
http://archiv.twoday.net/stories/528987964/
Damals formulierte ich als Hypothese: "Weniger als 10 % der 2011 erschienenen deutschsprachigen wissenschaftlichen Beiträge aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft sind kostenlos im Netz verfügbar".
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:53 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/24/mi5-spied-historians-eric-hobsbawm-christopher-hill-secret-files
Eric Hobsbawm and Christopher Hill had phones tapped, correspondence intercepted and friends and wives monitored.

Eric Hobsbawm and Christopher Hill had phones tapped, correspondence intercepted and friends and wives monitored.

KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:46 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Laut https://netzpolitik.org/2014/youtube-content-id-wie-microsoft-und-google-unsere-berichterstattung-behindern-und-niemand-schuld-ist/ wurde der treffende Begriff von FragDenStaat erfunden.
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:35 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dougsarchaeology.wordpress.com/2014/10/20/open-access-does-not-equal-you-the-author-paying/ räumt einmal mehr mit Vorurteilen auf.
"Angaben über hohe Gebühren für eine OpenAccess-Publikation sollen ganz offensichtlich abschrecken", sagt Schreg:
http://archaeologik.blogspot.de/2014/10/hohe-gebuhren-sollen-vor-open-access.html

"Angaben über hohe Gebühren für eine OpenAccess-Publikation sollen ganz offensichtlich abschrecken", sagt Schreg:
http://archaeologik.blogspot.de/2014/10/hohe-gebuhren-sollen-vor-open-access.html

KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:24 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibts nur in Ebook-Formaten und von David Schraven arrogantes Gesülze darüber, wieso man es nicht als PDF anbietet.
https://www.correctiv.org/ratgeber-behoerden-zur-auskunft-zwingen/
https://www.correctiv.org/ratgeber-behoerden-zur-auskunft-zwingen/
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:16 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://krautreporter.de/
Das Medium wurde mit Crowdfunding finanziert.
Via
http://heise.de/-2431628
Das Medium wurde mit Crowdfunding finanziert.
Via
http://heise.de/-2431628
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 19:03 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Schwenke erläutert das Urteil:
http://rechtsanwalt-schwenke.de/eugh-embedding-haftung-youtube/
Update: Skeptischer ist RA Ferner
http://www.ferner-alsdorf.de/rechtsanwalt/it-recht/urheberrecht/eugh-zum-urheberrecht-framing-und-embedded-content-koennen-urheberrechtsverletzung-sein/13684/
Weniger skeptisch RAin Diercks
http://www.munich-digitals.com/fachartikel/recht-datenschutz/embedding-von-videos-ist-keine-urheberrechtsverletzung
http://rechtsanwalt-schwenke.de/eugh-embedding-haftung-youtube/
Update: Skeptischer ist RA Ferner
http://www.ferner-alsdorf.de/rechtsanwalt/it-recht/urheberrecht/eugh-zum-urheberrecht-framing-und-embedded-content-koennen-urheberrechtsverletzung-sein/13684/
Weniger skeptisch RAin Diercks
http://www.munich-digitals.com/fachartikel/recht-datenschutz/embedding-von-videos-ist-keine-urheberrechtsverletzung
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 18:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es handelt sich um Trittbrettfahrer der Redtube-Abmahnung.
http://www.focus.de/digital/internet/rechtsanwalt-warnt-achtung-betrueger-schocken-porno-nutzer-mit-abmahnwelle_id_4224294.html
http://www.focus.de/digital/internet/rechtsanwalt-warnt-achtung-betrueger-schocken-porno-nutzer-mit-abmahnwelle_id_4224294.html
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 18:54 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Erstdruck von Georg Rüxners Turnierbuch (Simmern 1530, VD16 R 3541) ist online:
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00090290-0
(Kolophon: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00090290/image_833 )
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00090290-0
(Kolophon: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00090290/image_833 )
clausscheffer - am Freitag, 24. Oktober 2014, 10:33 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ebersberger-historie.de/hv/jahrbuch.htm
"Die vergriffenen Bände 1,2 und 6 bieten wir Ihnen im PDF-Format zum Download an."
#histverein
"Die vergriffenen Bände 1,2 und 6 bieten wir Ihnen im PDF-Format zum Download an."
#histverein
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 02:39 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Oktober 2014, 00:35 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ende April 2012 wies ich auf die Handreichung zur Open-Access-Komponente der deutschen Allianz- und Nationallizenzen hin:
http://archiv.twoday.net/stories/97008660/
(Weitere Erwähnungen hier:
http://archiv.twoday.net/stories/197330649/
http://archiv.twoday.net/stories/410257771/ )
Diese Handreichung ist mehrfach im Netz einsehbar, beispielsweise unter folgendem DOI:
http://dx.doi.org/10.2312/ALLIANZOA.004
Eingedenk des Bekenntnisses der DFG zu Open Access hat man bei den Verhandlungen für die National- und die Allianz-Lizenzen darauf Wert gelegt, dass bei den lizenzierten Angeboten die Möglichkeit eingeräumt werden musste, dass die autorisierten Einrichtungen ohne Zusatzkosten Artikel der ihnen angehörigen Autoren in ihr Open-Access-Repositorium (Institutional Repository = IR) aufnehmen dürfen und zwar - das ist besonders attraktiv - in vielen Fällen in der Verlagsversion. Es sind meistens aber Embargos zu beachten.
Mirjam Blümm (SUB Göttingen) hat noch 2012 in "Perspektive Bibliothek" die Möglichkeiten vorgestellt:
http://dx.doi.org/10.11588/pb.2012.2.9457
Auch auf dem Bibliothekartag in Hamburg 2012 war dieser Aspekt Thema. Im Netz sind die Folien von Christine Hillenkötter, ebenfalls aus Göttingen:
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2012/1276/pdf/Bibliothekartag_2012_Allianz_Lizenzen_Hillenkoetter.pdf
Dort heißt es abschließend, die OA-Komponente sei erfolgreich.
Die Druckfassung erschien 2012 in "Bibliothek, Forschung und Praxis":
http://dx.doi.org/10.1515/bfp-2012-0039 bzw.
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?gs-1/10454
Obwohl ich mich einigermaßen intensiv über OA informiere, sind mir Diskussionen der OA-Community über den deutschen Weg und die von Hillenkötter (nicht aber Blümml) genannten internationalen Parallelen nicht erinnerlich. Dabei sind Vereinbarungen, die Vorteile gegenüber den an sich (insbesondere nach der SHERPA/ROMEO List) eingeräumten Selbstarchivierungsrechten bieten, ein wichtiges Werkzeug für besseren grünen Open Access. Das betrifft vor allem das nicht nur für Geisteswissenschaftler wichtige Formatproblem, wenn die Verlagsfassung verwendet werden darf. Den Ansatz, für Open Access bei Lizenzverhandlungen möglichst viel herauszuholen, finde ich grundsätzlich richtig. Er sollte weiterverfolgt werden.
Aber das beste Werkzeug ist wertlos, wenn es so gut wie nicht genutzt wird.
Schauen wir also zwei Jahre später an, welche Publikationen aufgrund der OA-Komponente frei zur Verfügung stehen. Da es eine eindeutige Empfehlung gibt, die Vermerke
"Dieser Beitrag ist mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich."
"This publication is with permission of the rights owner freely accessible due to an Alliance licence and a national licence (funded by the DFG, German Research Foundation) respectively."
beizufügen, kann sich eine Erfolgskontrolle darauf beschränken, nach diesem Text zu recherchieren - in allgemeinen und Repositoriums-Suchmaschinen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass allzuviele Autoren oder IR-Manager unter Berufung auf die OA-Komponente selbstarchivieren, ohne dies wie empfohlen kenntlich zu machen.
Leichter gesagt als getan, denn gerade die IR-Suchmaschinen sind meist hundsmiserabel.
Zunächst ein Blick on Google Scholar:
http://scholar.google.de/scholar?q=+%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&btnG=&hl=de&as_sdt=0%2C5
Bis auf einen Beitrag ÜBER die Komponente und zwei Dokumenten der DB Thüringen gibt es von den ca. 31 Treffern nur Publikationen vom Institut für deutsche Sprache (IDS). Die Suche nach der englischen Fassung erbringt nur die zwei Dokumente aus Thüringen in Google Scholar.
Wie sieht es in der Google-Websuche aus? Von den 90 Treffern
https://www.google.de/search?q=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&num=100&espv=2&filter=0&biw=1024&bih=719
beziehen sich etliche auf das IDS, vielleicht die meisten aber auf den Kasseler Hochschulschriftenserver KOBRA (die Dubletten - siehe etwa Suche nach Namibia - habe ich nicht weggestrichen.) Weiter vertreten Sachsens Qucosa, Thüringen (wie gehabt). Abgeschlagen SSOAR mit 3 und Econstor sowie Wildenau mit einem Dokument (wobei letzteres aus Econstor stammt).
BING hat insgesamt nur 13 Treffer zu
http://www.bing.com/search?q=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22
3 davon handeln über die OA-Komponente. Vertreten sind DB Thüringen, IDS, KOBRA, Qucosa. Hinzu kommen zwei Trefferlisten aus Sciencegate, die auf Qucosa-Dokumente zurückgehen.
Metager hat mit Phrasensuche 15 Treffer, davon 4 über die OA-Komponente, darunter ein in Google nicht erfasster Mailinglistenbeitrag von mir. Vertreten sind die gleichen Repositorien wie in BING, wobei http://waesearch.kobv.de/ auf Econstore zurückgehen dürfte.
Auch der Sieger meines letzten Metasuchmaschinentests ( http://archiv.twoday.net/stories/714908537/ ) info.com bot kein neues Material, ebensowenig einige andere Metasuchmaschinen.
Etwas anders sieht es bei BASE aus:
http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&type=all&oaboost=1&ling=0&name=&thes=&refid=dcresde&newsearch=1
271 Qucosa
13 DB Thüringen
6 Econstor (die 3 von Leibniz-Open gehören ebenfalls dazu)
Also 290 Dokumente, vorausgesetzt die drei Quellen überschneiden sich nicht.
KOBRA fehlt, da die dortigen "Bemerkungen" offenbar nicht zu von BASE eingesammelten Metadaten gehören.
Die OAN-Volltextsuche ist wertlos, da sie keine Phrasensuche unterstützt:
http://oansuche.open-access.net/oansearch/search?query=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22
Über 500 Treffer bei der Suche nach
Rechteinhabers
durchzusehen, habe ich mir erspart. Eine Suchanleitung habe ich nicht gefunden, die Suchergebnisse werden anscheinend nicht mit UND standardmäßig verknüpft.
Suche mit +rechteinhabers +nationallizenz findet nur ein einziges einschlägiges Dokument (in SSOAR).
Gehen wir nun die einzelnen lokalen Volltextsuchen der ermittelten IRs durch. Begonnen habe ich immer mit "mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer".
In Kassels IR (DSpace) finde ich mit Google eine zweistellige Anzahl von Beiträgen:
https://www.google.de/search?q=site:kobra.bibliothek.uni-kassel.de/+%22mit+zustimmung+des+rechteinhabers+aufgrund+einer%22&num=100&filter=0&biw=1024&bih=719
Die lokale Volltext-Suche (die ich auf Anhieb gar nicht fand) versagt völlig. Das entsprechende Feld ist offensichtlich nicht suchbar; bei der Suche nach Rechteinhabers wurden keine relevanten Treffer gefunden.
Bei Qucosa werden (wie in Base) 271 Einträge gefunden, die aber alle auf die TU Dresden entfallen. Bei den anderen sieben Hochschulen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen Fehlanzeige.
http://www.db-thueringen.de/ findet 20 Dokumente (BASE: 13), die allesamt aus der TU Ilmenau stammen.
Das IDS erfasst die entsprechende Bemerkung weder in seiner Suche noch liefert es diesen Teil der Metadaten an BASE (wo die Dokumente von LeibnizOpen geliefert werden.)
Bei Econstor führt die Suche ebenfalls nicht zum Ziel.
Bei SSOAR (Google findet 6 einschlägige Dokumente) denkt man zunächst, dass der Vermerk nur in den PDFs hinterlegt ist, die von der Suche offenbar nicht erfasst werden. Aber das trifft nicht zu, der Vermerk erscheint nicht in den suchbaren Metadaten, obwohl er Teil der Metadaten z.B. von
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-369004
ist.
Fazit:
Open Access braucht Transparenz und insbesondere transparente Erfolgskontrollen. Es ist ein Unding, dass es keine öffentliche Abfrage gibt, die zuverlässig die Anzahl der mit dem Vermerk eingestellten Dokumente (samt Links zu diesen) liefert, aufschlüsselbar nach Institution, Jahr, Lizenzgeber usw.
Es ist ebenfalls ein Unding, dass von den sechs bisher geprüften Volltextsuchen der Repositorien nur zwei Ergebnisse lieferten.
Setzt man sowohl den KOBRA- als auch den IDS-Bestand großzügig mit jeweils 100 Dokumenten an, kommt man mit den anderen Daten auf etwas mehr als 500 Eprints. Das ist aus meiner Sicht angesichts des möglichen Bestands erbärmlich wenig, bedenkt man, dass von den vielen Hochschulen und autorisierten Institutionen in Deutschland bisher nur die TU Dresden, die TU Ilmenau, die Uni Kassel sowie das IDS das Werkzeug der OA-Komponente in ihren IRs genutzt haben (SSOAR und Econstor sind keine IRs, sondern disziplinäre Repositorien).
Diese Schlussfolgerungen beziehen sich NUR auf die deutsche Formulierung. Es ist ärgerlich, dass man nach der deutschen und der englischen Formulierung parallel suchen muss, weil sich die IR je nach Gutdünken dafür entschieden haben, nur deutsch, nur englisch oder alle beiden Versionen in ihre Metadaten einzutragen.
Eine massive Erweiterung des Bestands liefert aber auch die Suche nach der englischen Fassung nicht.
In SSRN gibt es 9 Papers des Max Planck Institute for Comparative and International Private Law.
Dagegen übertrumpft das bislang schmerzlich vermisste Göttingen (wir erinnern uns an die beiden eingangs erwähnten Propagatorinnen der OA-Komponente) mit 283 Aufsätzen knapp die fleißige TU Dresden.
http://goedoc.uni-goettingen.de/goescholar/search?order=DESC&rpp=10&sort_by=2&page=28&query=%22This+publication+is+with+permission+of+the+rights+owner+freely+accessible+due%22&etal=0
In BASE sind diese Beiträge aber nicht über den Vermerk auffindbar!
Schätzungsweise über zwei Drittel des Gesamtaufkommens entfallen auf die Uni Göttingen und die TU Dresden.
Die unerträgliche Trägheit der Masse der deutschen Hochschulbibliotheken, die anscheinend keinen einzigen Beitrag aufgrund der OA-Komponente in ihr IR eingestellt haben, ist nur ein weiteres Beispiel für das, was ich seit Jahren als die "Open Access-Heuchelei der Bibliotheken" geißele:
http://archiv.twoday.net/stories/573860379/

http://archiv.twoday.net/stories/97008660/
(Weitere Erwähnungen hier:
http://archiv.twoday.net/stories/197330649/
http://archiv.twoday.net/stories/410257771/ )
Diese Handreichung ist mehrfach im Netz einsehbar, beispielsweise unter folgendem DOI:
http://dx.doi.org/10.2312/ALLIANZOA.004
Eingedenk des Bekenntnisses der DFG zu Open Access hat man bei den Verhandlungen für die National- und die Allianz-Lizenzen darauf Wert gelegt, dass bei den lizenzierten Angeboten die Möglichkeit eingeräumt werden musste, dass die autorisierten Einrichtungen ohne Zusatzkosten Artikel der ihnen angehörigen Autoren in ihr Open-Access-Repositorium (Institutional Repository = IR) aufnehmen dürfen und zwar - das ist besonders attraktiv - in vielen Fällen in der Verlagsversion. Es sind meistens aber Embargos zu beachten.
Mirjam Blümm (SUB Göttingen) hat noch 2012 in "Perspektive Bibliothek" die Möglichkeiten vorgestellt:
http://dx.doi.org/10.11588/pb.2012.2.9457
Auch auf dem Bibliothekartag in Hamburg 2012 war dieser Aspekt Thema. Im Netz sind die Folien von Christine Hillenkötter, ebenfalls aus Göttingen:
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2012/1276/pdf/Bibliothekartag_2012_Allianz_Lizenzen_Hillenkoetter.pdf
Dort heißt es abschließend, die OA-Komponente sei erfolgreich.
Die Druckfassung erschien 2012 in "Bibliothek, Forschung und Praxis":
http://dx.doi.org/10.1515/bfp-2012-0039 bzw.
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?gs-1/10454
Obwohl ich mich einigermaßen intensiv über OA informiere, sind mir Diskussionen der OA-Community über den deutschen Weg und die von Hillenkötter (nicht aber Blümml) genannten internationalen Parallelen nicht erinnerlich. Dabei sind Vereinbarungen, die Vorteile gegenüber den an sich (insbesondere nach der SHERPA/ROMEO List) eingeräumten Selbstarchivierungsrechten bieten, ein wichtiges Werkzeug für besseren grünen Open Access. Das betrifft vor allem das nicht nur für Geisteswissenschaftler wichtige Formatproblem, wenn die Verlagsfassung verwendet werden darf. Den Ansatz, für Open Access bei Lizenzverhandlungen möglichst viel herauszuholen, finde ich grundsätzlich richtig. Er sollte weiterverfolgt werden.
Aber das beste Werkzeug ist wertlos, wenn es so gut wie nicht genutzt wird.
Schauen wir also zwei Jahre später an, welche Publikationen aufgrund der OA-Komponente frei zur Verfügung stehen. Da es eine eindeutige Empfehlung gibt, die Vermerke
"Dieser Beitrag ist mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich."
"This publication is with permission of the rights owner freely accessible due to an Alliance licence and a national licence (funded by the DFG, German Research Foundation) respectively."
beizufügen, kann sich eine Erfolgskontrolle darauf beschränken, nach diesem Text zu recherchieren - in allgemeinen und Repositoriums-Suchmaschinen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass allzuviele Autoren oder IR-Manager unter Berufung auf die OA-Komponente selbstarchivieren, ohne dies wie empfohlen kenntlich zu machen.
Leichter gesagt als getan, denn gerade die IR-Suchmaschinen sind meist hundsmiserabel.
Zunächst ein Blick on Google Scholar:
http://scholar.google.de/scholar?q=+%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&btnG=&hl=de&as_sdt=0%2C5
Bis auf einen Beitrag ÜBER die Komponente und zwei Dokumenten der DB Thüringen gibt es von den ca. 31 Treffern nur Publikationen vom Institut für deutsche Sprache (IDS). Die Suche nach der englischen Fassung erbringt nur die zwei Dokumente aus Thüringen in Google Scholar.
Wie sieht es in der Google-Websuche aus? Von den 90 Treffern
https://www.google.de/search?q=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&num=100&espv=2&filter=0&biw=1024&bih=719
beziehen sich etliche auf das IDS, vielleicht die meisten aber auf den Kasseler Hochschulschriftenserver KOBRA (die Dubletten - siehe etwa Suche nach Namibia - habe ich nicht weggestrichen.) Weiter vertreten Sachsens Qucosa, Thüringen (wie gehabt). Abgeschlagen SSOAR mit 3 und Econstor sowie Wildenau mit einem Dokument (wobei letzteres aus Econstor stammt).
BING hat insgesamt nur 13 Treffer zu
http://www.bing.com/search?q=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22
3 davon handeln über die OA-Komponente. Vertreten sind DB Thüringen, IDS, KOBRA, Qucosa. Hinzu kommen zwei Trefferlisten aus Sciencegate, die auf Qucosa-Dokumente zurückgehen.
Metager hat mit Phrasensuche 15 Treffer, davon 4 über die OA-Komponente, darunter ein in Google nicht erfasster Mailinglistenbeitrag von mir. Vertreten sind die gleichen Repositorien wie in BING, wobei http://waesearch.kobv.de/ auf Econstore zurückgehen dürfte.
Auch der Sieger meines letzten Metasuchmaschinentests ( http://archiv.twoday.net/stories/714908537/ ) info.com bot kein neues Material, ebensowenig einige andere Metasuchmaschinen.
Etwas anders sieht es bei BASE aus:
http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22&type=all&oaboost=1&ling=0&name=&thes=&refid=dcresde&newsearch=1
271 Qucosa
13 DB Thüringen
6 Econstor (die 3 von Leibniz-Open gehören ebenfalls dazu)
Also 290 Dokumente, vorausgesetzt die drei Quellen überschneiden sich nicht.
KOBRA fehlt, da die dortigen "Bemerkungen" offenbar nicht zu von BASE eingesammelten Metadaten gehören.
Die OAN-Volltextsuche ist wertlos, da sie keine Phrasensuche unterstützt:
http://oansuche.open-access.net/oansearch/search?query=%22mit+Zustimmung+des+Rechteinhabers+aufgrund+einer%22
Über 500 Treffer bei der Suche nach
Rechteinhabers
durchzusehen, habe ich mir erspart. Eine Suchanleitung habe ich nicht gefunden, die Suchergebnisse werden anscheinend nicht mit UND standardmäßig verknüpft.
Suche mit +rechteinhabers +nationallizenz findet nur ein einziges einschlägiges Dokument (in SSOAR).
Gehen wir nun die einzelnen lokalen Volltextsuchen der ermittelten IRs durch. Begonnen habe ich immer mit "mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer".
In Kassels IR (DSpace) finde ich mit Google eine zweistellige Anzahl von Beiträgen:
https://www.google.de/search?q=site:kobra.bibliothek.uni-kassel.de/+%22mit+zustimmung+des+rechteinhabers+aufgrund+einer%22&num=100&filter=0&biw=1024&bih=719
Die lokale Volltext-Suche (die ich auf Anhieb gar nicht fand) versagt völlig. Das entsprechende Feld ist offensichtlich nicht suchbar; bei der Suche nach Rechteinhabers wurden keine relevanten Treffer gefunden.
Bei Qucosa werden (wie in Base) 271 Einträge gefunden, die aber alle auf die TU Dresden entfallen. Bei den anderen sieben Hochschulen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen Fehlanzeige.
http://www.db-thueringen.de/ findet 20 Dokumente (BASE: 13), die allesamt aus der TU Ilmenau stammen.
Das IDS erfasst die entsprechende Bemerkung weder in seiner Suche noch liefert es diesen Teil der Metadaten an BASE (wo die Dokumente von LeibnizOpen geliefert werden.)
Bei Econstor führt die Suche ebenfalls nicht zum Ziel.
Bei SSOAR (Google findet 6 einschlägige Dokumente) denkt man zunächst, dass der Vermerk nur in den PDFs hinterlegt ist, die von der Suche offenbar nicht erfasst werden. Aber das trifft nicht zu, der Vermerk erscheint nicht in den suchbaren Metadaten, obwohl er Teil der Metadaten z.B. von
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-369004
ist.
Fazit:
Open Access braucht Transparenz und insbesondere transparente Erfolgskontrollen. Es ist ein Unding, dass es keine öffentliche Abfrage gibt, die zuverlässig die Anzahl der mit dem Vermerk eingestellten Dokumente (samt Links zu diesen) liefert, aufschlüsselbar nach Institution, Jahr, Lizenzgeber usw.
Es ist ebenfalls ein Unding, dass von den sechs bisher geprüften Volltextsuchen der Repositorien nur zwei Ergebnisse lieferten.
Setzt man sowohl den KOBRA- als auch den IDS-Bestand großzügig mit jeweils 100 Dokumenten an, kommt man mit den anderen Daten auf etwas mehr als 500 Eprints. Das ist aus meiner Sicht angesichts des möglichen Bestands erbärmlich wenig, bedenkt man, dass von den vielen Hochschulen und autorisierten Institutionen in Deutschland bisher nur die TU Dresden, die TU Ilmenau, die Uni Kassel sowie das IDS das Werkzeug der OA-Komponente in ihren IRs genutzt haben (SSOAR und Econstor sind keine IRs, sondern disziplinäre Repositorien).
Diese Schlussfolgerungen beziehen sich NUR auf die deutsche Formulierung. Es ist ärgerlich, dass man nach der deutschen und der englischen Formulierung parallel suchen muss, weil sich die IR je nach Gutdünken dafür entschieden haben, nur deutsch, nur englisch oder alle beiden Versionen in ihre Metadaten einzutragen.
Eine massive Erweiterung des Bestands liefert aber auch die Suche nach der englischen Fassung nicht.
In SSRN gibt es 9 Papers des Max Planck Institute for Comparative and International Private Law.
Dagegen übertrumpft das bislang schmerzlich vermisste Göttingen (wir erinnern uns an die beiden eingangs erwähnten Propagatorinnen der OA-Komponente) mit 283 Aufsätzen knapp die fleißige TU Dresden.
http://goedoc.uni-goettingen.de/goescholar/search?order=DESC&rpp=10&sort_by=2&page=28&query=%22This+publication+is+with+permission+of+the+rights+owner+freely+accessible+due%22&etal=0
In BASE sind diese Beiträge aber nicht über den Vermerk auffindbar!
Schätzungsweise über zwei Drittel des Gesamtaufkommens entfallen auf die Uni Göttingen und die TU Dresden.
Die unerträgliche Trägheit der Masse der deutschen Hochschulbibliotheken, die anscheinend keinen einzigen Beitrag aufgrund der OA-Komponente in ihr IR eingestellt haben, ist nur ein weiteres Beispiel für das, was ich seit Jahren als die "Open Access-Heuchelei der Bibliotheken" geißele:
http://archiv.twoday.net/stories/573860379/

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 20:07 - Rubrik: Open Access
http://ids-pub.bsz-bw.de/home
Von den 2524 Dokumenten ist den allermeisten (2490) ein Volltext beigegeben! Respekt, möchte man ausrufen, um dann festzustellen, dass häufig "Dieser Beitrag ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht frei zugänglich." zu lesen. Ärgerlich, dass es keine Filtermöglichkeit für Open-Access-Beiträge gibt.
Immerhin, ein gewisser Fortschritt gegenüber 2007:
http://archiv.twoday.net/stories/4093621/

Von den 2524 Dokumenten ist den allermeisten (2490) ein Volltext beigegeben! Respekt, möchte man ausrufen, um dann festzustellen, dass häufig "Dieser Beitrag ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht frei zugänglich." zu lesen. Ärgerlich, dass es keine Filtermöglichkeit für Open-Access-Beiträge gibt.
Immerhin, ein gewisser Fortschritt gegenüber 2007:
http://archiv.twoday.net/stories/4093621/

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 19:36 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://officeforscholarlycommunicationharvardlibrary.createsend.com/t/ViewEmailArchive/t/EB6E64DBC8091835/C67FD2F38AC4859C/
"The Harvard Library is pleased to announce a new policy on the use of digital reproductions of works in the public domain. When the Library makes such reproductions and makes them openly available online, it will treat the reproductions themselves as objects in the public domain. It will not try to restrict what users can do with them, nor will it grant or deny permission for any use."
This is something which really ought to be a matter of course.
See also http://via.lib.harvard.edu/ (this should be a library website)
"The Harvard Library is pleased to announce a new policy on the use of digital reproductions of works in the public domain. When the Library makes such reproductions and makes them openly available online, it will treat the reproductions themselves as objects in the public domain. It will not try to restrict what users can do with them, nor will it grant or deny permission for any use."
This is something which really ought to be a matter of course.
See also http://via.lib.harvard.edu/ (this should be a library website)
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://openscience.com/open-access-advocates-like-mensheviks-bolsheviks/
Zur Größenordnung aktueller OA-Publikationen:
"Pretty soon we are going to reach the point where open access journals have a 15% share of newly published articles. There are also (very often really high profile) journals that make all their content open access on their own websites, let’s say, after one year from initial publication. There are about 500 journals like that. When you count it together, there will be 22-23% of articles available for free on publishers’ websites, one year after publication. Together with green open access (copies that were self-archived by authors) it will be something around one third of all articles. Thus, approximately 33% of all scholarly articles are available for free one year after publication. This is not a small number."
Björk äußert sich auch zu unseriösen OA-Journals und hält diese nicht für ein schwerwiegendes Problem. Skeptisch ist er gegenüber dem grünen Weg.
"In the long term, when open access journals and article processing charges become more and more popular libraries will be reluctant to pay subscription fees. And if in addition green open access would start to reach high uptake levels of say 50%, publishers would respond with a counterattack, to try to enforce longer embargo rules. There is an internal contradiction within the green model – if it succeeds it will kill the whole subscription based system. When you take into account the current economic situation it is clear that current embargo periods will not be enough to protect journals. Universities are looking for cost reduction, and will not be able to pay for journals that will be virtually free after a short period of time. In medical research, embargo periods are important for researchers, but in the humanities and social sciences for example, they are not that crucial.
Gold open access is so simple that is almost esthetically beautiful."
Grüne Artikel müssen erst einmal gefunden werden und haben einen Format-Nachteil:
"You have to search for a green copy in various places, and a green copy may also have a different layout and page numbers than in the published version, which makes references more difficult. And it may come a year or longer after publication. People are lazy. If they cannot make a citation in just one click they will simply not do it at all."

Zur Größenordnung aktueller OA-Publikationen:
"Pretty soon we are going to reach the point where open access journals have a 15% share of newly published articles. There are also (very often really high profile) journals that make all their content open access on their own websites, let’s say, after one year from initial publication. There are about 500 journals like that. When you count it together, there will be 22-23% of articles available for free on publishers’ websites, one year after publication. Together with green open access (copies that were self-archived by authors) it will be something around one third of all articles. Thus, approximately 33% of all scholarly articles are available for free one year after publication. This is not a small number."
Björk äußert sich auch zu unseriösen OA-Journals und hält diese nicht für ein schwerwiegendes Problem. Skeptisch ist er gegenüber dem grünen Weg.
"In the long term, when open access journals and article processing charges become more and more popular libraries will be reluctant to pay subscription fees. And if in addition green open access would start to reach high uptake levels of say 50%, publishers would respond with a counterattack, to try to enforce longer embargo rules. There is an internal contradiction within the green model – if it succeeds it will kill the whole subscription based system. When you take into account the current economic situation it is clear that current embargo periods will not be enough to protect journals. Universities are looking for cost reduction, and will not be able to pay for journals that will be virtually free after a short period of time. In medical research, embargo periods are important for researchers, but in the humanities and social sciences for example, they are not that crucial.
Gold open access is so simple that is almost esthetically beautiful."
Grüne Artikel müssen erst einmal gefunden werden und haben einen Format-Nachteil:
"You have to search for a green copy in various places, and a green copy may also have a different layout and page numbers than in the published version, which makes references more difficult. And it may come a year or longer after publication. People are lazy. If they cannot make a citation in just one click they will simply not do it at all."

KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:44 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit dem Open Access Button meldet man verweigerten Zugriff zu wissenschaftlichen Beiträgen via Bezahlschranke. Der neue Button sucht nun nach kostenlosen Alternativen und ermöglicht eine Anfrage beim Autor nach einer kostenlosen Version.
https://openaccessbutton.org/livelaunch
http://etseq.law.harvard.edu/2014/10/open-access-button/
https://creativecommons.org/?p=43858


https://openaccessbutton.org/livelaunch
http://etseq.law.harvard.edu/2014/10/open-access-button/
https://creativecommons.org/?p=43858


KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=2120
Digitalisiert, aber unverständlicherweise ohne Volltextsuche.
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2014/10/22/magnum-bullarium-romanum-online-limponente-opera-di-l-tomassetti/
Digitalisiert, aber unverständlicherweise ohne Volltextsuche.
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2014/10/22/magnum-bullarium-romanum-online-limponente-opera-di-l-tomassetti/
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://portal-militaergeschichte.de/
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/10/bibliothek-fur-zeitgeschichte-stellt.html
Via
http://zkbw.blogspot.de/2014/10/bibliothek-fur-zeitgeschichte-stellt.html
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 17:04 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 16:48 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 16:47 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der "Verein Naturschutzpark" wurde am 23.10.1909 in München mit dem Ziel gegründet, nach Vorbild der amerikanischen Nationalparke großflächig Naturschutz zu betreiben.
http://www.verein-naturschutzpark.de
Zwei Broschüren aus der frühen Geschichte des Vereins liegen digitalisiert im Internet Archive vor:
"Naturschutzparke in Deutschland und Österreich. Ein Mahnwort an das deutsche und österreichische Volk"
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/n0/mode/2up
"Der erste deutsche Naturschutzpark in der Lüneburger Heide : eine Werbeschrift"
https://archive.org/stream/dererstedeutsche00vere#page/n5/mode/2up
Keimzelle des Vereins ist die 1904 unter dem Dach der später umbenannten "Franckh’schen Verlagshandlung" in Stuttgart gegründete "Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde". Mitglieder der "Kosmos"-Gesellschaft erhielten regelmäßig die Zeitschrift "Kosmos - Handweiser für Naturfreunde", in der Kurt Floericke im April 1909 in einer "Umschau über die Naturschutzbewegung" für die Schaffung eines möglichst großen Naturschutzparks warb. Dem Aprilheft lag ein "Aufruf zur Gründung von Naturschutzparken" bei:
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/n57/mode/2up
Nach einem überraschend großen Erfolg des Aufrufs kam es noch im gleichen Jahr zur Gründung des Vereins, dem im Laufe der kommenden Jahre zahlreiche Interessierte beitraten. Die Entwicklung der Naturschutzpark-Idee und die ersten Bestrebungen des Vereins zur Wahl und zum Ankauf für das Vorhaben geeigneter Flächen lassen sich anhand der Berichterstattung in "Kosmos" nachvollziehen (Auswahl):
I. Floericke, K.: "Umschau über die Naturschutzbewegung", Kosmos (1909), Heft 4
II. Ders.: "Der gegenwärtige Stand der Naturschutzpark-Bewegung", Kosmos (1909), Heft 12
III. Ders.: "Entwicklung, Stand und Aussichten der Naturschutzparkbewegung", (1912?)
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/6/mode/2up
außerdem: Regensberg, F.: "Umschau über die Naturschutzparkbewegung", Kosmos (1910), Heft 12
Kurze Notiz zum Naturschutzgedanken (Zitate aus III.): Floericke verwirft das "Nützlichkeitsprinzip", nach dem nur diejenigen Lebewesen geschützt werden, welche nach Maßgabe des Menschen einen Nutzen erfüllen, und stellt diesem ein ästhetisches Prinzip gegenüber: "[…] wir wollen den Vogel schützen um des Vogels selbst willen, weil er in seiner Art ein herrliches Geschöpf ist, ein Dichtergedanke gewissermaßen der schaffenden Natur, weil ohne die anmutigen Bewegungen, die bunten Farben und die lieblichen Gesänge unserer Vögel unsere Wälder und Fluren unendlich öde, tot und traurig erscheinen würden." Beginnend mit dem starken "um des Vogels selbst willen", setzt Floericke im Fortgang dem engen Prinzip der Nützlichkeit eines der Ästhetik entgegen, welches aber gleichermaßen vom Menschen her gedacht wird.
Dem Bestreben, einzelne herausgestellte Tier- und Pflanzenarten zu schützen, setzt Floericke ein ökologisches Modell entgegen: "Alles bildet ja ein zusammengehöriges, unauflösliches Ganzes, und eben dieses Ganze wollen wir uns erhalten, wenn es natürlich auch nur streckenweise und in kleinen Restbeständen möglich sein wird." Dieses Modell eines aufeinander abgestimmten Zusammenwirkens der Lebewesen, für das Floericke an anderer Stelle in geradezu mechanistische Metaphorik verfällt, findet man auch heute noch in populären Naturschutzbestrebungen. Dabei lässt sich das Ganze der Natur nur als Prozess begreifen, der das Entstehen und Vergehen einzelner Arten beinhaltet. Metaphern von einem Räderwerk, dessen Teile reibungslos ineinandergreifen oder einer Kette, deren Glieder lückenlos zusammenhängen, entlarven unzulässige Idealisierungen.
Der Sitz des "Vereins Naturschutzpark" verlagerte sich im Laufe der Vereinsgeschichte von Stuttgart über Hamburg nach Niederhaverbeck in der Lüneburger Heide. Hier kamen im frühen 20. Jahrhundert Bemühungen auf, die überkommene historische Kulturlandschaft durch Ankauf von Flächen im Umkreis von Wilsede vor Bebauung und Überformung zu schützen.
Wolfgang Brandes, Stadtarchivar in Bad Fallingbostel, arbeitet den Beitrag der Heimatschutzbewegung zur Entdeckung und Erhaltung der historischen Lüneburger Heide heraus:
Brandes, W.: "»Wer dies Bild kommenden Geschlechtern erhielte, der täte ein großes gutes Werk«", Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte (2006), S. 133ff:
https://archive.org/stream/Niedersaechsisches_Jahrbuch_fuer_Landesgeschichte_2006#page/n147/mode/2up
In Arbeit ist eine auf vier Bände angelegte Publikation, deren Bände auch online verfügbar sein werden:
Thomas Kaiser (Hg.): "Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang"
Bd. 1: http://www.verein-naturschutzpark.de/downloads/schriften_004_web.pdf
Hingewiesen sei hier noch auf die beliebte Monographie Richard Lindes:
https://archive.org/stream/dielneburgerheid00lind#page/n3/mode/2up
außerdem: http://de.wikisource.org/wiki/Lüneburger_Heide
Literatur zum 100-jährigen Jubiläum:
Landkreis Soltau Fallingbostel (Hg.): Jahrbuch 2009
Verein Naturschutzpark (Hg.): Naturschutz und Naturparke (2009), Heft 214
http://www.verein-naturschutzpark.de
Zwei Broschüren aus der frühen Geschichte des Vereins liegen digitalisiert im Internet Archive vor:
"Naturschutzparke in Deutschland und Österreich. Ein Mahnwort an das deutsche und österreichische Volk"
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/n0/mode/2up
"Der erste deutsche Naturschutzpark in der Lüneburger Heide : eine Werbeschrift"
https://archive.org/stream/dererstedeutsche00vere#page/n5/mode/2up
Keimzelle des Vereins ist die 1904 unter dem Dach der später umbenannten "Franckh’schen Verlagshandlung" in Stuttgart gegründete "Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde". Mitglieder der "Kosmos"-Gesellschaft erhielten regelmäßig die Zeitschrift "Kosmos - Handweiser für Naturfreunde", in der Kurt Floericke im April 1909 in einer "Umschau über die Naturschutzbewegung" für die Schaffung eines möglichst großen Naturschutzparks warb. Dem Aprilheft lag ein "Aufruf zur Gründung von Naturschutzparken" bei:
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/n57/mode/2up
Nach einem überraschend großen Erfolg des Aufrufs kam es noch im gleichen Jahr zur Gründung des Vereins, dem im Laufe der kommenden Jahre zahlreiche Interessierte beitraten. Die Entwicklung der Naturschutzpark-Idee und die ersten Bestrebungen des Vereins zur Wahl und zum Ankauf für das Vorhaben geeigneter Flächen lassen sich anhand der Berichterstattung in "Kosmos" nachvollziehen (Auswahl):
I. Floericke, K.: "Umschau über die Naturschutzbewegung", Kosmos (1909), Heft 4
II. Ders.: "Der gegenwärtige Stand der Naturschutzpark-Bewegung", Kosmos (1909), Heft 12
III. Ders.: "Entwicklung, Stand und Aussichten der Naturschutzparkbewegung", (1912?)
https://archive.org/stream/naturschutzparke22635vere#page/6/mode/2up
außerdem: Regensberg, F.: "Umschau über die Naturschutzparkbewegung", Kosmos (1910), Heft 12
Kurze Notiz zum Naturschutzgedanken (Zitate aus III.): Floericke verwirft das "Nützlichkeitsprinzip", nach dem nur diejenigen Lebewesen geschützt werden, welche nach Maßgabe des Menschen einen Nutzen erfüllen, und stellt diesem ein ästhetisches Prinzip gegenüber: "[…] wir wollen den Vogel schützen um des Vogels selbst willen, weil er in seiner Art ein herrliches Geschöpf ist, ein Dichtergedanke gewissermaßen der schaffenden Natur, weil ohne die anmutigen Bewegungen, die bunten Farben und die lieblichen Gesänge unserer Vögel unsere Wälder und Fluren unendlich öde, tot und traurig erscheinen würden." Beginnend mit dem starken "um des Vogels selbst willen", setzt Floericke im Fortgang dem engen Prinzip der Nützlichkeit eines der Ästhetik entgegen, welches aber gleichermaßen vom Menschen her gedacht wird.
Dem Bestreben, einzelne herausgestellte Tier- und Pflanzenarten zu schützen, setzt Floericke ein ökologisches Modell entgegen: "Alles bildet ja ein zusammengehöriges, unauflösliches Ganzes, und eben dieses Ganze wollen wir uns erhalten, wenn es natürlich auch nur streckenweise und in kleinen Restbeständen möglich sein wird." Dieses Modell eines aufeinander abgestimmten Zusammenwirkens der Lebewesen, für das Floericke an anderer Stelle in geradezu mechanistische Metaphorik verfällt, findet man auch heute noch in populären Naturschutzbestrebungen. Dabei lässt sich das Ganze der Natur nur als Prozess begreifen, der das Entstehen und Vergehen einzelner Arten beinhaltet. Metaphern von einem Räderwerk, dessen Teile reibungslos ineinandergreifen oder einer Kette, deren Glieder lückenlos zusammenhängen, entlarven unzulässige Idealisierungen.
Der Sitz des "Vereins Naturschutzpark" verlagerte sich im Laufe der Vereinsgeschichte von Stuttgart über Hamburg nach Niederhaverbeck in der Lüneburger Heide. Hier kamen im frühen 20. Jahrhundert Bemühungen auf, die überkommene historische Kulturlandschaft durch Ankauf von Flächen im Umkreis von Wilsede vor Bebauung und Überformung zu schützen.
Wolfgang Brandes, Stadtarchivar in Bad Fallingbostel, arbeitet den Beitrag der Heimatschutzbewegung zur Entdeckung und Erhaltung der historischen Lüneburger Heide heraus:
Brandes, W.: "»Wer dies Bild kommenden Geschlechtern erhielte, der täte ein großes gutes Werk«", Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte (2006), S. 133ff:
https://archive.org/stream/Niedersaechsisches_Jahrbuch_fuer_Landesgeschichte_2006#page/n147/mode/2up
In Arbeit ist eine auf vier Bände angelegte Publikation, deren Bände auch online verfügbar sein werden:
Thomas Kaiser (Hg.): "Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang"
Bd. 1: http://www.verein-naturschutzpark.de/downloads/schriften_004_web.pdf
Hingewiesen sei hier noch auf die beliebte Monographie Richard Lindes:
https://archive.org/stream/dielneburgerheid00lind#page/n3/mode/2up
außerdem: http://de.wikisource.org/wiki/Lüneburger_Heide
Literatur zum 100-jährigen Jubiläum:
Landkreis Soltau Fallingbostel (Hg.): Jahrbuch 2009
Verein Naturschutzpark (Hg.): Naturschutz und Naturparke (2009), Heft 214
SW - am Donnerstag, 23. Oktober 2014, 08:40 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Leider verfügen wir weder über ein Corpus profaner Wandmalereien des Mittelalters noch über eine Zusammenstellung literarisch relevanter Bildzeugnisse außerhalb der Handschriften. Sakrale Werke dominieren in der Zusammenstellung von Johannes Wilhelm: Augsburger Wandmalerei 1368-1530 (1983).
Um 1416 datiert Wilhelm (S. 164-168 Katalog Nr. 15) den Turnierkampf mit Keulen und Schwertern aus dem Stettenhaus Martin Lutherplatz 3/5 (Nachzeichnung und Fragmente erhalten). Ob tatsächlich nur das im August 1416 überlieferte Turnier als Anlass in Betracht kommt, bleibt zu überprüfen.
Zur späteren Pflege des Turnierwesens durch Augsburger Bürger (Turnierbuch Marx Walthers):
http://archiv.twoday.net/stories/948994034/
Zeitlich früher liegen die Malereien des Pfettner-Hauses (S. 140-148 Katalog Nr. 3), 1968 bei Umbauarbeiten des Hauses Philippine-Welser-Straße 20 aufgedeckt. Aufgrund der Darstellung einer Katze bringt Wilhelm die Jagd-Darstellungen mit dem wichtigen Augsburger Ratsherrn Paul Pfettner, der 1366 und 1367 Augsburger Stadtpfleger war und eine schleichende Katze im Wappen führte, in Verbindung. Da Pfettner nach 1368 das Haus nicht mehr bewohnt, setzt Wilhelm die Bilder vor 1368 an, was stilistisch von Kunsthistorikern zu überprüfen wäre.
Die Bilder zeigen: "Hirschhetze mit Jagdgefolge", "Hirschhetze" und eine von Wilhelm um 1370 datierte Darstellung "Wand mit Brustbildern berühmter Männer". Wilhelm schreibt: "Es entspricht sicherlich nicht dem Normalbild eines Patriziers, sich auf Hochwildjagd, noch dazu vom Pferd aus, zu begeben" (S. 144). Das scheint mir die historischen Verhältnisse zu verkennen: Vornehme Patrizier lebten adelsgleich und pflegten selbstverständlich die Jagd auf hohem Ross.
Unglücklich ist die für das 14. Jahrhundert in Deutschland eher anachronistische Bezeichnung "berühmte Männer" für zwei Brustbilder barhäuptiger Männer, die jeweils ein Spruchband mit Inschrift halten. Wilhelm liest:
"I wár vbel zwár .. all nam wu.. wár" (bei Wilhelm steht statt á a mit einem - darüber, desgleichen bei dem v in vber)
"Der ze lang ..."
Wer möchte, kann ja auf Abbildung 7 im Anhang von Wilhelm die Lesung überprüfen. Vielleicht helfen dereinst die Deutschen Inschriften weiter (oder das, was von ihnen nach Auslauf der Akademienfinanzierung übriggeblieben ist ...).
Meines Erachtens handelt es sich um Darstellungen von sogenannten "Autoritäten", also im Mittelalter bekannten Persönlichkeiten, denen man Sprüche in Prosa oder Versen in den Mund legte. Die Worte Zwar und war deuten in diesem Fall auf gereimte Sprüche hin. Wilhelm sagt zu Recht, dass die Barhäuptigkeit gegen die Darstellung von Propheten, die sonst dem ikonographischen Typus entsprechen, spricht (S. 147), zeigt sich aber wenig kenntnisreich, wenn er zugleich behauptet: "Auch der Standort in dem Saal eines Privathauses ist mit der Prophetenausdeutung nicht vereinbar". Gerne hat man im Mittelalter auch im profanen Kontext Autoritäten-Sprüche den Propheten in den Mund gelegt.
Zu Autoritäten-Sprüche außerhalb von Handschriften, also auf (meist profanen) Sachzeugnissen, kann man sich im Netz auf einer Seite des Freidank-Repertoriums
http://www.mrfreidank.de/inschriften
unterrichten und vor allem in dem von Ulrich Seelbach verantworteten "Repertorium deutschsprachiger Autoritäten"
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/siglen.html
Ärgerlich ist das Fehlen einer Volltextsuche; immerhin scheint die lokale Suchmaschine der Uni Bielefeld brauchbar.
Solche Sprüche waren im Spätmittelalter in Rathäusern (z.B. in Magdeburg) sicher beliebter als es die fragmentarischen Bezeugungen nahelegen.
Weder bei Seelbach noch im Freidank-Projekt berücksichtigt sind die Ulmer Wandbilder im Ehinger Hof, obwohl Norbert H. Ott auf Freidank-Sprüche aufmerksam gemacht hatte.
http://books.google.de/books?id=a7W6GRG0G0UC&pg=PA164
Wenig hilfreich ist es, als einzige Sekundärliteratur einen extrem entlegenen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1971 zu nennen - mit der recht hypothetischen Behauptung eines Zusammenhangs mit den Bozener Runkelsteinbildern (in Bozen wirkte der Ulmer Maler Hans Stocinger).
Ich habe im Augenblick nur den Aufsatz von Karl Siegfried Bader zur Hand: Zur Deutung des alten Gemachs und seiner Fresken im ehemaligen Ehinger Hof in Ulm, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 6 (1942), S. 305-322. Bader gibt S. 310f. den Wortlaut der Sprüche.
Nordwand:
"Es ist wol das im guot geschicht der rainen frowen guotes get"
"Marian raines keusches lebe(n) hat allen frowen preis geben"
Nordostwand
"der haillig gaist werket das das die sonne schint durch d(as) glas"
"du sult vessen das da ist die namen vrouwe vatter krist"
Südostwand:
"verlürt sin er hüt ain man er moß ir immel mangel han"
"got est an strengen gerechtigkeit der kein übel die (l)engin vertret"
Südliche Schmalseite:
"lieb ist ain wildiu hab - hüt lib moren schbab"
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Verse in Professor Seelbachs Repertorium gehören. Sie stellen aber eine zeitgenössische Parallele zu den Augsburger Wandbildern dar.
In der Wikipedia heißt es zum späteren Ehinger und früheren Reichenauer Hof und dem heute als Minnesängersaal bezeichneten Raum,
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichenauer_Hof_%28Ulm%29
das Haus sei von Bürgermeister Ulrich Krafft erbaut worden, und die Ausmalung stamme von ca. 1370/80. Jedenfalls weisen die Wappen auf vornehme Ulmer Familien des 14. Jahrhunderts. Eine Farbabbildung der Darstellung an der Nordostwand gibt es auf Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulm_-_Deckenfreske_im_Minnesängersaal_im_Grünen_Hof.JPG
"[U]nzweifelhaft jüdische Physiognomie" wollte der spätere herausragende Rechtshistoriker Bader 1942 (!) bei zwei Weisen der Nord- und Ostwand erkennen (S. 318). Seiner Ansicht, dass Gestalten des Alten Testaments dargestellt werden sollten, kann man jedoch zustimmen.
Der angebliche Freidank-Spruch ("got est ...") findet sich in der Freidank-Handschrift Cgm 523 (eventuell aus Augsburg),
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Mue1.html
gehört aber nicht zum Freidank-Corpus. Zum darüberstehenden Spruch (verliert ein Mann einmal seine Ehre, ist sie für immer verloren) finde ich bei Seelbach eine Parallele in einer Basler Handschrift:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Ba6.html
(Erwähnt sei noch, dass der ein Liebespaar begleitende Spruch an der südlichen Schmalseite etwas abgewandelt sprichwörtlich war:
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS03150 s.v. schabab)
Aus dem 14. Jahrhundert stammen auch die Erfurter Rundschilde (ehemals im Großen Ratssaal des Erfurter Rathauses) "mit Brustbildern männlicher Personen und Sprüchen aus Freidank".
http://www.mrfreidank.de/11
Diese Zeugnisse lassen den Schluss zu, dass städtische Oberschichten es im 14. Jahrhundert (anscheinend in der zweiten Hälfte) liebten, auf Wandbildern oder anderen Gegenständen "Autoritäten" darzustellen, denen man prägnante und verbreitete (sonst in Handschriften greifbare) Spruchweisheiten als Inschriften beigab.
Update: Das Landesmuseum Mainz verwahrt Wandmalereifragmente mit der Darstellung eines Propheten (?) aus dem Haus zum Widder in Mainz (Brand 9), zweite Hälfte 14. Jahrhundert. Über ihm befindet sich ein Spruchband mit nicht mehr lesbarer Inschrift. Einer anderen Person (thronend, wohl weiblich) ist ebenfalls ein Spruchband beigegeben: Gutenberg aventur und kunst (2000), S. 62.
Update:
Seelbach hat das Ulmer Zeugnis registriert:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Ul4.html
Und auch das Augsburger:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Au3.html
#forschung
#epigraphik
 Franzfoto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Franzfoto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Um 1416 datiert Wilhelm (S. 164-168 Katalog Nr. 15) den Turnierkampf mit Keulen und Schwertern aus dem Stettenhaus Martin Lutherplatz 3/5 (Nachzeichnung und Fragmente erhalten). Ob tatsächlich nur das im August 1416 überlieferte Turnier als Anlass in Betracht kommt, bleibt zu überprüfen.
Zur späteren Pflege des Turnierwesens durch Augsburger Bürger (Turnierbuch Marx Walthers):
http://archiv.twoday.net/stories/948994034/
Zeitlich früher liegen die Malereien des Pfettner-Hauses (S. 140-148 Katalog Nr. 3), 1968 bei Umbauarbeiten des Hauses Philippine-Welser-Straße 20 aufgedeckt. Aufgrund der Darstellung einer Katze bringt Wilhelm die Jagd-Darstellungen mit dem wichtigen Augsburger Ratsherrn Paul Pfettner, der 1366 und 1367 Augsburger Stadtpfleger war und eine schleichende Katze im Wappen führte, in Verbindung. Da Pfettner nach 1368 das Haus nicht mehr bewohnt, setzt Wilhelm die Bilder vor 1368 an, was stilistisch von Kunsthistorikern zu überprüfen wäre.
Die Bilder zeigen: "Hirschhetze mit Jagdgefolge", "Hirschhetze" und eine von Wilhelm um 1370 datierte Darstellung "Wand mit Brustbildern berühmter Männer". Wilhelm schreibt: "Es entspricht sicherlich nicht dem Normalbild eines Patriziers, sich auf Hochwildjagd, noch dazu vom Pferd aus, zu begeben" (S. 144). Das scheint mir die historischen Verhältnisse zu verkennen: Vornehme Patrizier lebten adelsgleich und pflegten selbstverständlich die Jagd auf hohem Ross.
Unglücklich ist die für das 14. Jahrhundert in Deutschland eher anachronistische Bezeichnung "berühmte Männer" für zwei Brustbilder barhäuptiger Männer, die jeweils ein Spruchband mit Inschrift halten. Wilhelm liest:
"I wár vbel zwár .. all nam wu.. wár" (bei Wilhelm steht statt á a mit einem - darüber, desgleichen bei dem v in vber)
"Der ze lang ..."
Wer möchte, kann ja auf Abbildung 7 im Anhang von Wilhelm die Lesung überprüfen. Vielleicht helfen dereinst die Deutschen Inschriften weiter (oder das, was von ihnen nach Auslauf der Akademienfinanzierung übriggeblieben ist ...).
Meines Erachtens handelt es sich um Darstellungen von sogenannten "Autoritäten", also im Mittelalter bekannten Persönlichkeiten, denen man Sprüche in Prosa oder Versen in den Mund legte. Die Worte Zwar und war deuten in diesem Fall auf gereimte Sprüche hin. Wilhelm sagt zu Recht, dass die Barhäuptigkeit gegen die Darstellung von Propheten, die sonst dem ikonographischen Typus entsprechen, spricht (S. 147), zeigt sich aber wenig kenntnisreich, wenn er zugleich behauptet: "Auch der Standort in dem Saal eines Privathauses ist mit der Prophetenausdeutung nicht vereinbar". Gerne hat man im Mittelalter auch im profanen Kontext Autoritäten-Sprüche den Propheten in den Mund gelegt.
Zu Autoritäten-Sprüche außerhalb von Handschriften, also auf (meist profanen) Sachzeugnissen, kann man sich im Netz auf einer Seite des Freidank-Repertoriums
http://www.mrfreidank.de/inschriften
unterrichten und vor allem in dem von Ulrich Seelbach verantworteten "Repertorium deutschsprachiger Autoritäten"
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/siglen.html
Ärgerlich ist das Fehlen einer Volltextsuche; immerhin scheint die lokale Suchmaschine der Uni Bielefeld brauchbar.
Solche Sprüche waren im Spätmittelalter in Rathäusern (z.B. in Magdeburg) sicher beliebter als es die fragmentarischen Bezeugungen nahelegen.
Weder bei Seelbach noch im Freidank-Projekt berücksichtigt sind die Ulmer Wandbilder im Ehinger Hof, obwohl Norbert H. Ott auf Freidank-Sprüche aufmerksam gemacht hatte.
http://books.google.de/books?id=a7W6GRG0G0UC&pg=PA164
Wenig hilfreich ist es, als einzige Sekundärliteratur einen extrem entlegenen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1971 zu nennen - mit der recht hypothetischen Behauptung eines Zusammenhangs mit den Bozener Runkelsteinbildern (in Bozen wirkte der Ulmer Maler Hans Stocinger).
Ich habe im Augenblick nur den Aufsatz von Karl Siegfried Bader zur Hand: Zur Deutung des alten Gemachs und seiner Fresken im ehemaligen Ehinger Hof in Ulm, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 6 (1942), S. 305-322. Bader gibt S. 310f. den Wortlaut der Sprüche.
Nordwand:
"Es ist wol das im guot geschicht der rainen frowen guotes get"
"Marian raines keusches lebe(n) hat allen frowen preis geben"
Nordostwand
"der haillig gaist werket das das die sonne schint durch d(as) glas"
"du sult vessen das da ist die namen vrouwe vatter krist"
Südostwand:
"verlürt sin er hüt ain man er moß ir immel mangel han"
"got est an strengen gerechtigkeit der kein übel die (l)engin vertret"
Südliche Schmalseite:
"lieb ist ain wildiu hab - hüt lib moren schbab"
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Verse in Professor Seelbachs Repertorium gehören. Sie stellen aber eine zeitgenössische Parallele zu den Augsburger Wandbildern dar.
In der Wikipedia heißt es zum späteren Ehinger und früheren Reichenauer Hof und dem heute als Minnesängersaal bezeichneten Raum,
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichenauer_Hof_%28Ulm%29
das Haus sei von Bürgermeister Ulrich Krafft erbaut worden, und die Ausmalung stamme von ca. 1370/80. Jedenfalls weisen die Wappen auf vornehme Ulmer Familien des 14. Jahrhunderts. Eine Farbabbildung der Darstellung an der Nordostwand gibt es auf Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulm_-_Deckenfreske_im_Minnesängersaal_im_Grünen_Hof.JPG
"[U]nzweifelhaft jüdische Physiognomie" wollte der spätere herausragende Rechtshistoriker Bader 1942 (!) bei zwei Weisen der Nord- und Ostwand erkennen (S. 318). Seiner Ansicht, dass Gestalten des Alten Testaments dargestellt werden sollten, kann man jedoch zustimmen.
Der angebliche Freidank-Spruch ("got est ...") findet sich in der Freidank-Handschrift Cgm 523 (eventuell aus Augsburg),
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Mue1.html
gehört aber nicht zum Freidank-Corpus. Zum darüberstehenden Spruch (verliert ein Mann einmal seine Ehre, ist sie für immer verloren) finde ich bei Seelbach eine Parallele in einer Basler Handschrift:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Ba6.html
(Erwähnt sei noch, dass der ein Liebespaar begleitende Spruch an der südlichen Schmalseite etwas abgewandelt sprichwörtlich war:
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS03150 s.v. schabab)
Aus dem 14. Jahrhundert stammen auch die Erfurter Rundschilde (ehemals im Großen Ratssaal des Erfurter Rathauses) "mit Brustbildern männlicher Personen und Sprüchen aus Freidank".
http://www.mrfreidank.de/11
Diese Zeugnisse lassen den Schluss zu, dass städtische Oberschichten es im 14. Jahrhundert (anscheinend in der zweiten Hälfte) liebten, auf Wandbildern oder anderen Gegenständen "Autoritäten" darzustellen, denen man prägnante und verbreitete (sonst in Handschriften greifbare) Spruchweisheiten als Inschriften beigab.
Update: Das Landesmuseum Mainz verwahrt Wandmalereifragmente mit der Darstellung eines Propheten (?) aus dem Haus zum Widder in Mainz (Brand 9), zweite Hälfte 14. Jahrhundert. Über ihm befindet sich ein Spruchband mit nicht mehr lesbarer Inschrift. Einer anderen Person (thronend, wohl weiblich) ist ebenfalls ein Spruchband beigegeben: Gutenberg aventur und kunst (2000), S. 62.
Update:
Seelbach hat das Ulmer Zeugnis registriert:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Ul4.html
Und auch das Augsburger:
http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Au3.html
#forschung
#epigraphik
 Franzfoto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Franzfoto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Mittwoch, 22. Oktober 2014, 16:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://www.westline.de/westfalen/muenster/nachrichten/lnrn/Uni-Muenster-entzieht-einem-Mediziner-den-Doktortitel;art1789,2033286
In einem zweiten Fall gabs nur eine Rüge.
In einem zweiten Fall gabs nur eine Rüge.
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Oktober 2014, 16:48 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://books.google.de/books?id=3EkJAwAAQBAJ (Auszüge)
Die 2014 von Brill zu einem Wucherpreis (auch das E-Book kostet 138 Euro zuzüglich Steuer) publizierte preisgekrönte Augsburger Dissertation fängt ja gut an: Mit einem unverständlichen Foucault-Zitat ...
Die 2014 von Brill zu einem Wucherpreis (auch das E-Book kostet 138 Euro zuzüglich Steuer) publizierte preisgekrönte Augsburger Dissertation fängt ja gut an: Mit einem unverständlichen Foucault-Zitat ...
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Oktober 2014, 16:39 - Rubrik: Hilfswissenschaften

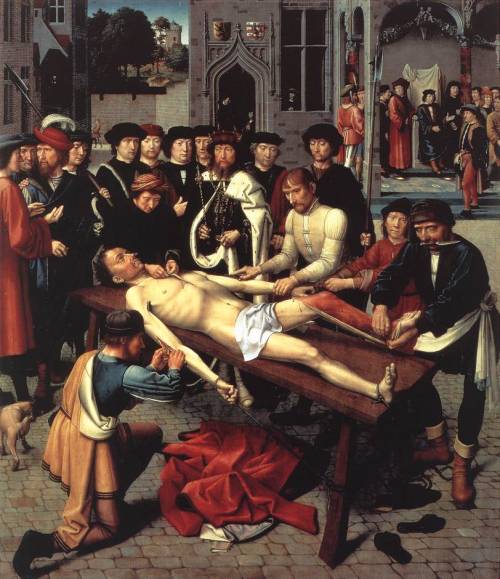
 Foto: Awersowy
Foto: Awersowy