http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/hintergrundinformationen-zum-verfahren-zur-ueberpruefung-der-promotion-von-prof-dr-dr-hc-mult.html
Zitat:
"Es haben sich vor allem solche Stimmen zu Wort gemeldet, die finanziell vom Bundes-Wissenschaftsministerium abhängig sind, sie dürfen durchaus als befangen angesehen werden."
Hört, hört! Alles lassen sich auch die Düsseldorfer nicht gefallen.
Danke an Maria Rottler.
Zitat:
"Es haben sich vor allem solche Stimmen zu Wort gemeldet, die finanziell vom Bundes-Wissenschaftsministerium abhängig sind, sie dürfen durchaus als befangen angesehen werden."
Hört, hört! Alles lassen sich auch die Düsseldorfer nicht gefallen.
Danke an Maria Rottler.
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 22:05 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus UB Tübingen Mc 28 = Johannes Stöffler : Commentum in Geographiam Ptolemaei. Tübingen, um 1515
Persistente URL: http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mc28
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:53 - Rubrik: Kodikologie
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:36 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Digitalen Sammlungen der UB Regensburg haben jetzt eine eigene Seite:
http://bvbm1.bib-bvb.de/R/DXC7FKSAIHEPRETG7IK6J44PS5EMN31Y7TAAGSR1UE3FBIF848-00717?local_base=UBR&pds_handle=GUEST
Die UB digitalisiert auch für einige kleinere Bibliotheken mit:
Staatliche Bibliothek Regensburg
Hochschulbibliothek Regensburg
Institut für Ost- und Südosteuropa
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing
Siebenbürgische Bibliothek Gundelsheim
Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek
Es gibt einen RSS-Feed für BVB-Digitalisate und einzelne RSS-Feeds.
http://bvbm1.bib-bvb.de/rssfeeds/bvball.xml
Die Digitalisate aus der Straubinger Gymnasialbibliothek gehören zum Projekt "Kartause Prüll". Bisher waren nur einige wenige Digitalisate aus der Hamburger Christianeumsbibliothek bekannt, was historische Schubibliotheken angeht.
Update:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2501

http://www.turmair-gymnasium.de/index.php/2-uncategorised/26-homepagegruppe
http://bvbm1.bib-bvb.de/R/DXC7FKSAIHEPRETG7IK6J44PS5EMN31Y7TAAGSR1UE3FBIF848-00717?local_base=UBR&pds_handle=GUEST
Die UB digitalisiert auch für einige kleinere Bibliotheken mit:
Staatliche Bibliothek Regensburg
Hochschulbibliothek Regensburg
Institut für Ost- und Südosteuropa
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing
Siebenbürgische Bibliothek Gundelsheim
Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek
Es gibt einen RSS-Feed für BVB-Digitalisate und einzelne RSS-Feeds.
http://bvbm1.bib-bvb.de/rssfeeds/bvball.xml
Die Digitalisate aus der Straubinger Gymnasialbibliothek gehören zum Projekt "Kartause Prüll". Bisher waren nur einige wenige Digitalisate aus der Hamburger Christianeumsbibliothek bekannt, was historische Schubibliotheken angeht.
Update:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2501

http://www.turmair-gymnasium.de/index.php/2-uncategorised/26-homepagegruppe
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Nicht nur bei Doktortiteln gibt es Schmu
http://www.taz.de/Geschaeft-mit-Doktortiteln/!110717/
"[A]us der Abteilung von Schavans Abteilungsleiter Lukas flossen Millionenbeträge an ein Institut der Technischen Universität Berlin. Diese bedachte den leitenden Ministerialbeamten wiederum mit einer besonderen Ehre – und machte ihn zum Honorarprofessor."
http://www.taz.de/Geschaeft-mit-Doktortiteln/!110717/
"[A]us der Abteilung von Schavans Abteilungsleiter Lukas flossen Millionenbeträge an ein Institut der Technischen Universität Berlin. Diese bedachte den leitenden Ministerialbeamten wiederum mit einer besonderen Ehre – und machte ihn zum Honorarprofessor."
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bei dem hier gezeigten Passauischen Tagebuch aus der Staatlichen Bibliothek Passau handelt es sich um eine Abschrift des 1745 entstandenen Originals von Karl Ludwig Seyffert [Cgm 1745, KG], welches sich in der Bayerischen Staatsbibliothek befindet. Die Abschrift wurde 1787 von einem uns unbekannten Verfasser erstellt und umfangreich ergänzt. "
http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/staadi/dpt.html

http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/staadi/dpt.html

KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 20:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Johann Fistenport (* 14. Jahrhundert in Mainz) lebte nach eigenen Angaben seit 1410 im Heilig-Grab-Konvent zu Speyer und ist als Verfasser einer bis 1421 reichenden lateinischen Fortsetzung des lateinischen Geschichtswerks Flores temporum bekannt geworden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Fistenport
Die Stuttgarter Handschrift HB V 86 ist jetzt online:
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023
Zu den Flores temporum:
http://archiv.twoday.net/search?q=flores+temporum
Nachtrag: Die Flores temporum-Hs. (nicht: Fistenport!) Paris lat. 10770 (Ende 13./14. Jh. - Mierau usw. 1996, S. 63: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Nikolaus IV. ist online:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90667378/f2.item
Dagegen enthält Paris lat. 4930 (2. H. 15. Jh. - Mierau usw. ebd.: Textstufe 3, Redaktion B, Typ b bis Clemens VI.) Auszüge aus dem Fistenport
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90669658
Online ist auch Harvard Houghton Library Riant 23 (15. Jh., nach SW-Mikrofilm) - Textstufe 1, Rezension B, Typ c (Mierau usw. S. 55)
http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:10255240
Desgleichen, Frankfurt UB Barth. 92 (ca. 1402/04 - Textstufe 1, Rezension A Typ b bis Nikolaus IV., Mierau usw. S. 56)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/2105162
Ebenda Leonh. 9 (1453/54, Mierau usw. ebd.: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Adolf)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/1968970
http://www.manuscriptorium.com/ bietet Prag Nationalbibliothek IV H 18 und VII E 27 (Mierau usw. S. 64, jeweils Textstufe 3, Redaktion E, Typ b), während ich die Handschrift in Brünn bei Mierau usw. nicht finde.
Zu Clm 14281 und den Ausgaben siehe schon
https://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke
Nachtrag:
BAV, Pal. lat. 1356
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1356/0279
http://archiv.twoday.net/stories/1022394058/
http://archiv.twoday.net/stories/1022411306/
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Fistenport
Die Stuttgarter Handschrift HB V 86 ist jetzt online:
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz350733023
Zu den Flores temporum:
http://archiv.twoday.net/search?q=flores+temporum
Nachtrag: Die Flores temporum-Hs. (nicht: Fistenport!) Paris lat. 10770 (Ende 13./14. Jh. - Mierau usw. 1996, S. 63: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Nikolaus IV. ist online:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90667378/f2.item
Dagegen enthält Paris lat. 4930 (2. H. 15. Jh. - Mierau usw. ebd.: Textstufe 3, Redaktion B, Typ b bis Clemens VI.) Auszüge aus dem Fistenport
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90669658
Online ist auch Harvard Houghton Library Riant 23 (15. Jh., nach SW-Mikrofilm) - Textstufe 1, Rezension B, Typ c (Mierau usw. S. 55)
http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:10255240
Desgleichen, Frankfurt UB Barth. 92 (ca. 1402/04 - Textstufe 1, Rezension A Typ b bis Nikolaus IV., Mierau usw. S. 56)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/2105162
Ebenda Leonh. 9 (1453/54, Mierau usw. ebd.: Textstufe 1, Rezension A, Typ b bis Adolf)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/1968970
http://www.manuscriptorium.com/ bietet Prag Nationalbibliothek IV H 18 und VII E 27 (Mierau usw. S. 64, jeweils Textstufe 3, Redaktion E, Typ b), während ich die Handschrift in Brünn bei Mierau usw. nicht finde.
Zu Clm 14281 und den Ausgaben siehe schon
https://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke
Nachtrag:
BAV, Pal. lat. 1356
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1356/0279
http://archiv.twoday.net/stories/1022394058/
http://archiv.twoday.net/stories/1022411306/
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 19:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige wenige Beispiele gibt es dazu in meinem Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/
Viele weitere findet man, wenn man sagengestalt und narrenzunft googelt.
Exemplarisch:
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/mittleres_filstal/Sagengestalt-als-Namensgeber;art5777,1003250
Es war der Rosenmontagsball 1993 im Winzinger Hasenheim, als acht Fasnetsbuzzen in launiger Stimmung beschlossen, eine Narrenzunft ganz nach dem Vorbild der schwäbisch-alemannischen Fasnet zu gründen. Ein geschichtlicher Hintergrund war mit der Sage um Baron von Roth schnell gefunden. Der lebte vor über 400 Jahren im Schloss von Winzingen und war kein angenehmer Zeitgenosse. Die bildhübsche Magd Schön-Dorle war seine Geliebte. Als der Baron starb, wurde Schön-Dorle aus dem Schloss vertrieben. Der Sage nach treiben seitdem der Baron als kleiner grüner Kobold, der in den Wäldern um Winzingen Holz "bricht" (Holzbrockeler) und Schön-Dorle als Ramprechtsweible ihr Unwesen. Eine weitere Sagengestalt stellt der Suhlochs dar.
1994 wurde die Zunftgruppe "Holzbrockeler" ins Vereinsregister eingetragen. Allerdings gibt es den Baron, das Schön-Dorle und den Suhlochs nur jeweils einmal in der Gruppe. Alle übrigen Mitglieder nehmen die Gestalt des Holzbrockelers ein. "Inzwischen sind wir etwa 50 Mitglieder, davon 16 Kinder und Jugendliche", erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Messerschmid und erzählt von den Anfängen des Vereins.
Website:
http://www.holzbrockeler.de/
Zur Holzbrockeler-Sage
http://archiv.twoday.net/stories/16578482/
Aus den dortigen Nachweisen digital:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu?page= (Gaugele)
http://archive.org/details/BilderAusSchwaben.LandUndLeute (Hofele)
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Gmuend_460.jpg (OAB)
 Holzbrockeler (Bild von der Website)
Holzbrockeler (Bild von der Website)
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/
Viele weitere findet man, wenn man sagengestalt und narrenzunft googelt.
Exemplarisch:
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/mittleres_filstal/Sagengestalt-als-Namensgeber;art5777,1003250
Es war der Rosenmontagsball 1993 im Winzinger Hasenheim, als acht Fasnetsbuzzen in launiger Stimmung beschlossen, eine Narrenzunft ganz nach dem Vorbild der schwäbisch-alemannischen Fasnet zu gründen. Ein geschichtlicher Hintergrund war mit der Sage um Baron von Roth schnell gefunden. Der lebte vor über 400 Jahren im Schloss von Winzingen und war kein angenehmer Zeitgenosse. Die bildhübsche Magd Schön-Dorle war seine Geliebte. Als der Baron starb, wurde Schön-Dorle aus dem Schloss vertrieben. Der Sage nach treiben seitdem der Baron als kleiner grüner Kobold, der in den Wäldern um Winzingen Holz "bricht" (Holzbrockeler) und Schön-Dorle als Ramprechtsweible ihr Unwesen. Eine weitere Sagengestalt stellt der Suhlochs dar.
1994 wurde die Zunftgruppe "Holzbrockeler" ins Vereinsregister eingetragen. Allerdings gibt es den Baron, das Schön-Dorle und den Suhlochs nur jeweils einmal in der Gruppe. Alle übrigen Mitglieder nehmen die Gestalt des Holzbrockelers ein. "Inzwischen sind wir etwa 50 Mitglieder, davon 16 Kinder und Jugendliche", erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Messerschmid und erzählt von den Anfängen des Vereins.
Website:
http://www.holzbrockeler.de/
Zur Holzbrockeler-Sage
http://archiv.twoday.net/stories/16578482/
Aus den dortigen Nachweisen digital:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu?page= (Gaugele)
http://archive.org/details/BilderAusSchwaben.LandUndLeute (Hofele)
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Gmuend_460.jpg (OAB)
 Holzbrockeler (Bild von der Website)
Holzbrockeler (Bild von der Website)KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:41 - Rubrik: Unterhaltung
Nicht nur für Bibliotheks- und Informationsmanagement
http://recherche.bib-blog.de/
Siehe
http://bib-blog.de/blog/2013/02/05/info-ressourcen-im-ueberblick/
Update: 31.10.2014 nicht mehr online
Siehe
http://bib-blog.de/blog/2013/02/05/info-ressourcen-im-ueberblick/
Update: 31.10.2014 nicht mehr online
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Stift Kremsmünster hat nun ein externes Institut mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit betraut. Indes arbeitet ein Pater, dem Missbrauch vorgeworfen wurde, weiterhin im Klosterarchiv."
http://derstandard.at/1360161439222/Verjaehrung-und-Verdraengung-hinter-Klostermauern
http://derstandard.at/1360161439222/Verjaehrung-und-Verdraengung-hinter-Klostermauern
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:31 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Burgerbibliothek Bern teilt in Bezug auf meinen erneuten Antrag zu
http://www.e-codices.unifr.ch/en/call-for-collaboration
mit:
"Vielen Dank für Ihren Digitalisierungsvorschlag betreffend Thomas Fincks medizinisches Vademecum (Burgerbibliothek Bern, Cod. A 28). Aufgrund des vielfältigen und für die Medizingeschichte bedeutsamen Inhalts der Handschrift sowie der Tatsache, dass das bedeutende Oeuvre Fincks bislang viel zu wenig gewürdigt wurde, ist Ihr Anliegen durchaus berechtigt. Es wäre tatsächlich zu begrüssen, wenn die Handschrift online verfügbar wäre.
Doch leider erlauben es uns die Umstände derzeit nicht, Ihrem Antrag stattzugeben und die Handschrift ins Programm von e-codices aufzunehmen. Lassen Sie mich dies kurz erläutern: Die Burgerbibliothek Bern besitzt zahlreiche international bedeutende Handschriften aus karolingischer Zeit, die von der Forschung rege nachgefragt werden. Infolge der häufigen Benutzung weisen mittlerweile vor allem die illuminierten Exemplare zum Teil massive Schäden auf, die eine rigorose Einschränkung erforderlich machen. Aus diesem Grund hat sich die Burgerbibliothek vor zwei Jahren entschlossen, eine Politik der ‚Schutzdigitalisierung‘ durch e-codices zu verfolgen, so dass die Originale nur noch in Ausnahmefällen konsultiert werden müssen. Aufgrund unserer begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen können wir von dieser Politik derzeit nicht abweichen und frühneuzeitliche, nicht illuminierte Handschriften in unser Digitalisierungsprogramm aufnehmen."
Ich finde es nicht in Ordnung, wenn solche allgemeinen Vorbehalte nicht von vornherein bei der Ausschreibung transparent gemacht werden. Ich habe einfach meinen seinerzeitigen Antrag nochmals wiederholt, aber jemand anderes hätte durchaus einige Stunden in einen völlig nutzlosen Antrag investieren können. Es ist von der Bibliothek auch ein wenig kühn, die autographe Handschrift Fincks, der 1523 starb, als frühneuzeitlich abzuwerten.
Am 5. Januar 2010 hatte die Absage gelautet:
"Sie haben uns am 3. Juli 2009 einen Antrag für die Digitalisierung der Berner Handschrift (Burgerbibliothek, Cod. A 28) geschickt.
Wie wir Ihnen schon in einem Rundmail vom 29. Juli 2009 mitgeteilt haben, hat uns das Echo unseres "call for collaboration" überrascht. Bis heute sind insgesamt 145 Handschriften vorgeschlagen worden. Wir bekamen Anträge von über fünfzig Wissenschaftlern aus 14 Ländern.
Ausserdem konnten wir das neue Projektjahr und damit auch das Teilprojekt "call for collaboration" dank der weiteren Unterstützung der Mellon Foundation und E-lib.ch und neuerdings auch der Unterstützung der Niarchos Foundation finanzieren.
Wir müssen Ihnen nun mitteilen, dass wir Ihnen sehr interessanten Antrag leider nicht in die Planung des nächsten Jahrs aufnehmen können. Der Grund ist nicht etwa die Bedeutung Ihres Projekts oder die Bedeutung der Handschrift. Intensive Gespräche mit der Burgerbibliothek haben ergeben, dass die Zeit für eine digitale Präsentation von Handschriften aus dieser wichtigen Bibliothek noch nicht reif ist.
Die Tatsache jedoch, dass allein für diesen "call for collaboration" innert eines Monats 16 vollständige Anträge eingereicht worden sind, wurde von der Bibliotheksleitung durchaus mit Interesse zur Kenntnis genommen. Seitdem haben weitere Gespräche stattgefunden und mit etwas Geduld scheint es uns nicht unmöglich, nächstens einen wichtigen Schritt weiterzukommen.
Ich bitte Sie also um Nachsicht und etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüssen.
Christoph Flüeler"
http://www.e-codices.unifr.ch/en/call-for-collaboration
mit:
"Vielen Dank für Ihren Digitalisierungsvorschlag betreffend Thomas Fincks medizinisches Vademecum (Burgerbibliothek Bern, Cod. A 28). Aufgrund des vielfältigen und für die Medizingeschichte bedeutsamen Inhalts der Handschrift sowie der Tatsache, dass das bedeutende Oeuvre Fincks bislang viel zu wenig gewürdigt wurde, ist Ihr Anliegen durchaus berechtigt. Es wäre tatsächlich zu begrüssen, wenn die Handschrift online verfügbar wäre.
Doch leider erlauben es uns die Umstände derzeit nicht, Ihrem Antrag stattzugeben und die Handschrift ins Programm von e-codices aufzunehmen. Lassen Sie mich dies kurz erläutern: Die Burgerbibliothek Bern besitzt zahlreiche international bedeutende Handschriften aus karolingischer Zeit, die von der Forschung rege nachgefragt werden. Infolge der häufigen Benutzung weisen mittlerweile vor allem die illuminierten Exemplare zum Teil massive Schäden auf, die eine rigorose Einschränkung erforderlich machen. Aus diesem Grund hat sich die Burgerbibliothek vor zwei Jahren entschlossen, eine Politik der ‚Schutzdigitalisierung‘ durch e-codices zu verfolgen, so dass die Originale nur noch in Ausnahmefällen konsultiert werden müssen. Aufgrund unserer begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen können wir von dieser Politik derzeit nicht abweichen und frühneuzeitliche, nicht illuminierte Handschriften in unser Digitalisierungsprogramm aufnehmen."
Ich finde es nicht in Ordnung, wenn solche allgemeinen Vorbehalte nicht von vornherein bei der Ausschreibung transparent gemacht werden. Ich habe einfach meinen seinerzeitigen Antrag nochmals wiederholt, aber jemand anderes hätte durchaus einige Stunden in einen völlig nutzlosen Antrag investieren können. Es ist von der Bibliothek auch ein wenig kühn, die autographe Handschrift Fincks, der 1523 starb, als frühneuzeitlich abzuwerten.
Am 5. Januar 2010 hatte die Absage gelautet:
"Sie haben uns am 3. Juli 2009 einen Antrag für die Digitalisierung der Berner Handschrift (Burgerbibliothek, Cod. A 28) geschickt.
Wie wir Ihnen schon in einem Rundmail vom 29. Juli 2009 mitgeteilt haben, hat uns das Echo unseres "call for collaboration" überrascht. Bis heute sind insgesamt 145 Handschriften vorgeschlagen worden. Wir bekamen Anträge von über fünfzig Wissenschaftlern aus 14 Ländern.
Ausserdem konnten wir das neue Projektjahr und damit auch das Teilprojekt "call for collaboration" dank der weiteren Unterstützung der Mellon Foundation und E-lib.ch und neuerdings auch der Unterstützung der Niarchos Foundation finanzieren.
Wir müssen Ihnen nun mitteilen, dass wir Ihnen sehr interessanten Antrag leider nicht in die Planung des nächsten Jahrs aufnehmen können. Der Grund ist nicht etwa die Bedeutung Ihres Projekts oder die Bedeutung der Handschrift. Intensive Gespräche mit der Burgerbibliothek haben ergeben, dass die Zeit für eine digitale Präsentation von Handschriften aus dieser wichtigen Bibliothek noch nicht reif ist.
Die Tatsache jedoch, dass allein für diesen "call for collaboration" innert eines Monats 16 vollständige Anträge eingereicht worden sind, wurde von der Bibliotheksleitung durchaus mit Interesse zur Kenntnis genommen. Seitdem haben weitere Gespräche stattgefunden und mit etwas Geduld scheint es uns nicht unmöglich, nächstens einen wichtigen Schritt weiterzukommen.
Ich bitte Sie also um Nachsicht und etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüssen.
Christoph Flüeler"
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 18:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus einem nicht näher bezeichneten Schembartbuch der Nürnberger Stadtbibliothek.
Demnach 55. Lauf 1515.
Siehe auch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Schembartlauf/Synopse
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 16:22 - Rubrik: Unterhaltung
Ohne deutschsprachige Kataloge und auch sonst sehr lückenhafte Linkliste:
http://bibliologiemedievale.wordpress.com/catalogues/
Verlinkt ist u.a. ein Katalog von Emil Hirsch, in dem
http://archive.org/stream/valuablemanuscri00emilrich#page/8/mode/2up
ich die Chicagoer Seifrit-Handschrift (früher Schloß Podgora bei Görz/Gorizia, Bibliothek der Grafen von Attems) fand:
http://www.handschriftencensus.de/4640
http://bibliologiemedievale.wordpress.com/catalogues/
Verlinkt ist u.a. ein Katalog von Emil Hirsch, in dem
http://archive.org/stream/valuablemanuscri00emilrich#page/8/mode/2up
ich die Chicagoer Seifrit-Handschrift (früher Schloß Podgora bei Görz/Gorizia, Bibliothek der Grafen von Attems) fand:
http://www.handschriftencensus.de/4640
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:21 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fundiertes von Otto Vervaart:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/12/the-first-papal-abdication-since-six-centuries/
und von der in Rom wirkenden Kanonistin Cathy Caridi (Eintrag vom 3. Januar 2013):
http://canonlawmadeeasy.com/2013/01/03/can-a-pope-everresign/
 Coelestin V.
Coelestin V.
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/12/the-first-papal-abdication-since-six-centuries/
und von der in Rom wirkenden Kanonistin Cathy Caridi (Eintrag vom 3. Januar 2013):
http://canonlawmadeeasy.com/2013/01/03/can-a-pope-everresign/
 Coelestin V.
Coelestin V.KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Besonders ärmlich ist die neueste Ausgabe des Newsletters ausgefallen:
http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_2_2013.pdf
http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_2_2013.pdf
KlausGraf - am Dienstag, 12. Februar 2013, 15:05 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2013 werden von transfer media - aufgrund der großen Nachfrage - die Archivseminare erneut angeboten: ein umfangreiches Seminarangebot für Mitarbeiter von audiovisuellen Archiven, Produktionsfirmen, TV-Sendern und Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung und Archivierung von filmischen Inhalten befassen. In Doppelworkshops wird dabei die digitale Herausforderung für Archive von audiovisuellen Inhalten vollständig durchgespielt: technische Grundlagen, die effiziente Nutzung von Metadaten, die richtige Digitalisierungstechnik, Datenspeicherung und -verwaltung und rechtliche Fragen der digitalen Distribution sowie Möglichkeiten der Zugänglichmachung über Internet werden von Fachexperten vermittelt.
Die Seminare werden in Doppelworkshops an zwei Tagen angeboten und kosten pro Workshop 350,00 Euro.
Der erste Termin findet am 18./19.3.2013 jeweils 10-17 Uhr statt.
HIER geht's zu weiteren Informationen & Anmeldung.

Die Seminare werden in Doppelworkshops an zwei Tagen angeboten und kosten pro Workshop 350,00 Euro.
Der erste Termin findet am 18./19.3.2013 jeweils 10-17 Uhr statt.
HIER geht's zu weiteren Informationen & Anmeldung.

Claire Müller - am Dienstag, 12. Februar 2013, 12:25 - Rubrik: Medienarchive
Der vielleicht unqualifizierteste Beitrag zur Causa Schavan stammt, wie ich finde, nicht von Kurt Biedenkopf, der besonders unqualifiziert
http://www.welt.de/debatte/article113508570/Der-wirkliche-Skandal-in-der-Causa-Schavan.html
ebenso wie der HU-Präsident Olbertz (in offizieller Pressemitteilung!)
https://www.facebook.com/deplagio/posts/188404254617124
sich äußerte, sondern von WELT-Schreiberling Tilmann Krause, was auf Twitter für Amüsemang sorgte:
http://www.derwesten.de/panorama/schuld-ist-nur-die-spd-spass-mit-diespdwars-bei-twitter-id7584449.html
Krause behauptete, Schavan sei ein Opfer des SPD-Bildungswahns:
http://m.welt.de/article.do?id=kultur%252Farticle113455288%252FSchavan-ist-ein-spaetes-Opfer-des-SPD-Bildungswahns&wtmc=social
Lakaien-Nachfahre Krause hat etwas gegen soziale Mobilität, wogegen ich als Arbeiterkind (väterlicherseits) meinerseits etwas habe. Er wurde hier schon als Monarchist geoutet:
http://archiv.twoday.net/stories/3013603/ (Kommentare)
Mehr zu ihm von Andreas Kemper:
http://andreaskemper.wordpress.com/2013/02/09/wer-ist-dieser-tilman-krause/
http://www.welt.de/debatte/article113508570/Der-wirkliche-Skandal-in-der-Causa-Schavan.html
ebenso wie der HU-Präsident Olbertz (in offizieller Pressemitteilung!)
https://www.facebook.com/deplagio/posts/188404254617124
sich äußerte, sondern von WELT-Schreiberling Tilmann Krause, was auf Twitter für Amüsemang sorgte:
http://www.derwesten.de/panorama/schuld-ist-nur-die-spd-spass-mit-diespdwars-bei-twitter-id7584449.html
Krause behauptete, Schavan sei ein Opfer des SPD-Bildungswahns:
http://m.welt.de/article.do?id=kultur%252Farticle113455288%252FSchavan-ist-ein-spaetes-Opfer-des-SPD-Bildungswahns&wtmc=social
Lakaien-Nachfahre Krause hat etwas gegen soziale Mobilität, wogegen ich als Arbeiterkind (väterlicherseits) meinerseits etwas habe. Er wurde hier schon als Monarchist geoutet:
http://archiv.twoday.net/stories/3013603/ (Kommentare)
Mehr zu ihm von Andreas Kemper:
http://andreaskemper.wordpress.com/2013/02/09/wer-ist-dieser-tilman-krause/
KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 22:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2013/02/10/why-we-must-support-cc-by-e-g-rcuk-policy-its-good-for-us-and-good-for-the-world/
By Peter Murray Rust
See also
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/

By Peter Murray Rust
See also
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss1/5/

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 21:54 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Maria Rottler, der unzählige Hinweise auf und für Archivalia verdankt werden.
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2313
Mit dem dort vorgeschlagenen Rautenschlagwort #HistBav für Beiträge zur bayerischen Geschichte bin ich einverstanden.
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/2313
Mit dem dort vorgeschlagenen Rautenschlagwort #HistBav für Beiträge zur bayerischen Geschichte bin ich einverstanden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/streit-um-das-hessen-wappen-witwe-des-kuenstlers-will-geld-vom-land-12054670.html
"Das hessische Wappen prangt auf Flaggen und Briefpapier: Der rot-weiße Löwe auf blauem Grund wurde 1949 von dem Künstler Gerhard Matzat entworfen. Seine Witwe verlangt nun eine angemessen Entlohnung."
Ausführlicher:
http://www.wiesbadener-kurier.de/nachrichten/politik/hessen/12816105.htm
"Der Künstler, der zuletzt in Hattersheim lebte, starb 1994. Seine Witwe, Avietta Matzat-Rogoshina, fordert jetzt vom Land eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Nutzung des Wappens, schließlich werde der Hessen-Löwe mittlerweile kommerziell genutzt. Und sie möchte, dass ihr Mann als Urheber genannt wird."
Eine Klage wäre aus meiner Sicht abzuweisen. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen
Dort heißt es, auf eine Formulierung von mir zurückgehend: Das OLG Karlsruhe wies am 18. Oktober 1933 die Klage eines Grafikers, der das badische Staatswappen entworfen hatte, zurück. In der Berufungsbegründung hieß es: "Nach dem Urteil des Landgerichts soll die Reichsdruckerei nicht einmal das Wappen des badischen Staates abdrucken dürfen und einem Privatmann das Urheberrecht am badischen Staatswappen zustehen und der badische Staat nur eine Lizenz an seinem eigenen Wappen haben. Eine solche Ansicht ist unerträglich"
Schwachsinn schreiben dagegen die gängigen Kommentare des Urheberrechts, z.B. Katzenberger, der Schricker 3. Auflage § 5 Rn. 49, der für Banknoten, Münzen, Postwertzeichen (Briefmarken, siehe Loriot-Fehlurteil http://archiv.twoday.net/stories/96993869/ ), Wappen der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und sonstigen künstlerisch gestalteten Hoheitszeichen meint, eine Anerkennung als amtliche Werke nach § 5 Abs. 2 liefe dem amtlichen Interesse "geradezu zuwider".
Eine Übertragung des Urheberrechts kennt das deutsche Recht nicht. Dem Urheber verbleibt immer eine gewisse Restherrschaft. Daher kann nur die Eigenschaft als amtliches Werk Ansprüche des Urhebers ausschließen. Die Interessen der Allgemeinheit sind in diesem Fall die Interessen des Staats, der bei Hoheitszeichen selbstverständlich ohne Namensnennung nutzen können muss. Werke nach Absatz 2 des § 5 UrhG unterliegen zwar dem Änderungsverbot und der Pflicht zur Quellenangabe, aber nicht der Urheber, sondern der Rechtsträger der veröffentlichenden Behörde ist befugt, dagegen zu klagen (Katzenberger Rn. 58).
Bei amtlichen Hoheitszeichen liegt die Sache anders als bei dem sogenannten "Gies-Adler":
http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=388 (die Ausführungen zu § 5 UrhG wurden vom BGH nicht beanstandet)
Eine angemessene Vergütung des privaten Urhebers, dessen Werk zu einem amtlichen Werk wurde, kann über eine Entschädigung aufgrund enteignungsgleichen Eingriffs erfolgen (Katzenberger Rn. 24).
Es ist aber schon zu bezweifeln, dass Matzat die nötige Schöpfungshöhe erreicht hat. Ein deutliches Überragen, das bei Werken der angewandten Kunst zu fordern ist, vermag ich nicht festzustellen, da er sich an die heraldischen Konventionen hielt und sowohl das Wappenbild (der gestreifte Löwe und die Farben gehen auf das Hochmittelalter zurück) als auch das Gewinde aus goldenem Laubwerk (entsprechend der Volkskrone des Wappens des Volksstaats Hessen 1920) gemeinfreie traditionelle Gestaltungen sind. Siehe
http://books.google.de/books?id=dj8LASAlnhAC&pg=PR4
"Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen
Vom 4. August 1948
§ 1
Das Landeswappen zeigt im blauen Schilde einen neunmal silbern und rot geteilten steigenden Löwen mit goldenen Krallen. Auf dem Schilde ruht ein Gewinde aus goldenem Laubwerk mit von blauen Perlen gebildeten Früchten." http://www.rv.hessenrecht.hessen.de
Farb-Abbildung als Beilage:
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/docs/anlage/heh/pdf/he17-1+1948+111+beilage.jpg
Nach meiner Ansicht sind alle Gestaltungen, die dieser Blasonierung im heraldischen Sinn entsprechen UND Schöpfungshöhe aufweisen, als amtliches Hoheitszeichen nach § 5 Abs. 2 UrhG nicht geschützt. Eine Verpflichtung des Landes Hessen, Matzat zu nennen, besteht nicht. Soweit die Allgemeinheit nicht in die öffentlich-rechtlichen Befugnisse und die bürgerlichrechtlichen Namensrechte des Landes Hessen eingreift, darf sie das Wappen frei verwenden.
Update: Die Rechtsanwältin ist anscheinend bekannt dafür, dubiose Fälle zu vertreten:
http://www.raben-politik-isolde.org/
Keine Prozesskostenhilfe (2014)
http://archiv.twoday.net/stories/1022216714/

"Das hessische Wappen prangt auf Flaggen und Briefpapier: Der rot-weiße Löwe auf blauem Grund wurde 1949 von dem Künstler Gerhard Matzat entworfen. Seine Witwe verlangt nun eine angemessen Entlohnung."
Ausführlicher:
http://www.wiesbadener-kurier.de/nachrichten/politik/hessen/12816105.htm
"Der Künstler, der zuletzt in Hattersheim lebte, starb 1994. Seine Witwe, Avietta Matzat-Rogoshina, fordert jetzt vom Land eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Nutzung des Wappens, schließlich werde der Hessen-Löwe mittlerweile kommerziell genutzt. Und sie möchte, dass ihr Mann als Urheber genannt wird."
Eine Klage wäre aus meiner Sicht abzuweisen. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen
Dort heißt es, auf eine Formulierung von mir zurückgehend: Das OLG Karlsruhe wies am 18. Oktober 1933 die Klage eines Grafikers, der das badische Staatswappen entworfen hatte, zurück. In der Berufungsbegründung hieß es: "Nach dem Urteil des Landgerichts soll die Reichsdruckerei nicht einmal das Wappen des badischen Staates abdrucken dürfen und einem Privatmann das Urheberrecht am badischen Staatswappen zustehen und der badische Staat nur eine Lizenz an seinem eigenen Wappen haben. Eine solche Ansicht ist unerträglich"
Schwachsinn schreiben dagegen die gängigen Kommentare des Urheberrechts, z.B. Katzenberger, der Schricker 3. Auflage § 5 Rn. 49, der für Banknoten, Münzen, Postwertzeichen (Briefmarken, siehe Loriot-Fehlurteil http://archiv.twoday.net/stories/96993869/ ), Wappen der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und sonstigen künstlerisch gestalteten Hoheitszeichen meint, eine Anerkennung als amtliche Werke nach § 5 Abs. 2 liefe dem amtlichen Interesse "geradezu zuwider".
Eine Übertragung des Urheberrechts kennt das deutsche Recht nicht. Dem Urheber verbleibt immer eine gewisse Restherrschaft. Daher kann nur die Eigenschaft als amtliches Werk Ansprüche des Urhebers ausschließen. Die Interessen der Allgemeinheit sind in diesem Fall die Interessen des Staats, der bei Hoheitszeichen selbstverständlich ohne Namensnennung nutzen können muss. Werke nach Absatz 2 des § 5 UrhG unterliegen zwar dem Änderungsverbot und der Pflicht zur Quellenangabe, aber nicht der Urheber, sondern der Rechtsträger der veröffentlichenden Behörde ist befugt, dagegen zu klagen (Katzenberger Rn. 58).
Bei amtlichen Hoheitszeichen liegt die Sache anders als bei dem sogenannten "Gies-Adler":
http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=388 (die Ausführungen zu § 5 UrhG wurden vom BGH nicht beanstandet)
Eine angemessene Vergütung des privaten Urhebers, dessen Werk zu einem amtlichen Werk wurde, kann über eine Entschädigung aufgrund enteignungsgleichen Eingriffs erfolgen (Katzenberger Rn. 24).
Es ist aber schon zu bezweifeln, dass Matzat die nötige Schöpfungshöhe erreicht hat. Ein deutliches Überragen, das bei Werken der angewandten Kunst zu fordern ist, vermag ich nicht festzustellen, da er sich an die heraldischen Konventionen hielt und sowohl das Wappenbild (der gestreifte Löwe und die Farben gehen auf das Hochmittelalter zurück) als auch das Gewinde aus goldenem Laubwerk (entsprechend der Volkskrone des Wappens des Volksstaats Hessen 1920) gemeinfreie traditionelle Gestaltungen sind. Siehe
http://books.google.de/books?id=dj8LASAlnhAC&pg=PR4
"Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Hessen
Vom 4. August 1948
§ 1
Das Landeswappen zeigt im blauen Schilde einen neunmal silbern und rot geteilten steigenden Löwen mit goldenen Krallen. Auf dem Schilde ruht ein Gewinde aus goldenem Laubwerk mit von blauen Perlen gebildeten Früchten." http://www.rv.hessenrecht.hessen.de
Farb-Abbildung als Beilage:
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/docs/anlage/heh/pdf/he17-1+1948+111+beilage.jpg
Nach meiner Ansicht sind alle Gestaltungen, die dieser Blasonierung im heraldischen Sinn entsprechen UND Schöpfungshöhe aufweisen, als amtliches Hoheitszeichen nach § 5 Abs. 2 UrhG nicht geschützt. Eine Verpflichtung des Landes Hessen, Matzat zu nennen, besteht nicht. Soweit die Allgemeinheit nicht in die öffentlich-rechtlichen Befugnisse und die bürgerlichrechtlichen Namensrechte des Landes Hessen eingreift, darf sie das Wappen frei verwenden.
Update: Die Rechtsanwältin ist anscheinend bekannt dafür, dubiose Fälle zu vertreten:
http://www.raben-politik-isolde.org/
Keine Prozesskostenhilfe (2014)
http://archiv.twoday.net/stories/1022216714/

KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:21 - Rubrik: Archivrecht
Das Tool vergleicht: Shakespeare’s Othello (Act 1, Scene 3) with 37 German translations (1766–2010).
http://www.delightedbeauty.org/vvv/Home/Project
http://blog.okfn.org/2013/02/08/version-variation-visualisation/
http://www.delightedbeauty.org/vvv/Home/Project
http://blog.okfn.org/2013/02/08/version-variation-visualisation/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/02/treasures-wonderful-to-behold.html
"And when we say "treasures", we really mean it! The six books in question are none other than (drumroll, please) the Harley Golden Gospels, the Silos Apocalypse, the Golf Book, the Petit Livre d'Amour ... and, um, two others. What were they again? Oh yes, remember now. Only Beowulf and Leonardo da Vinci's Notebook."
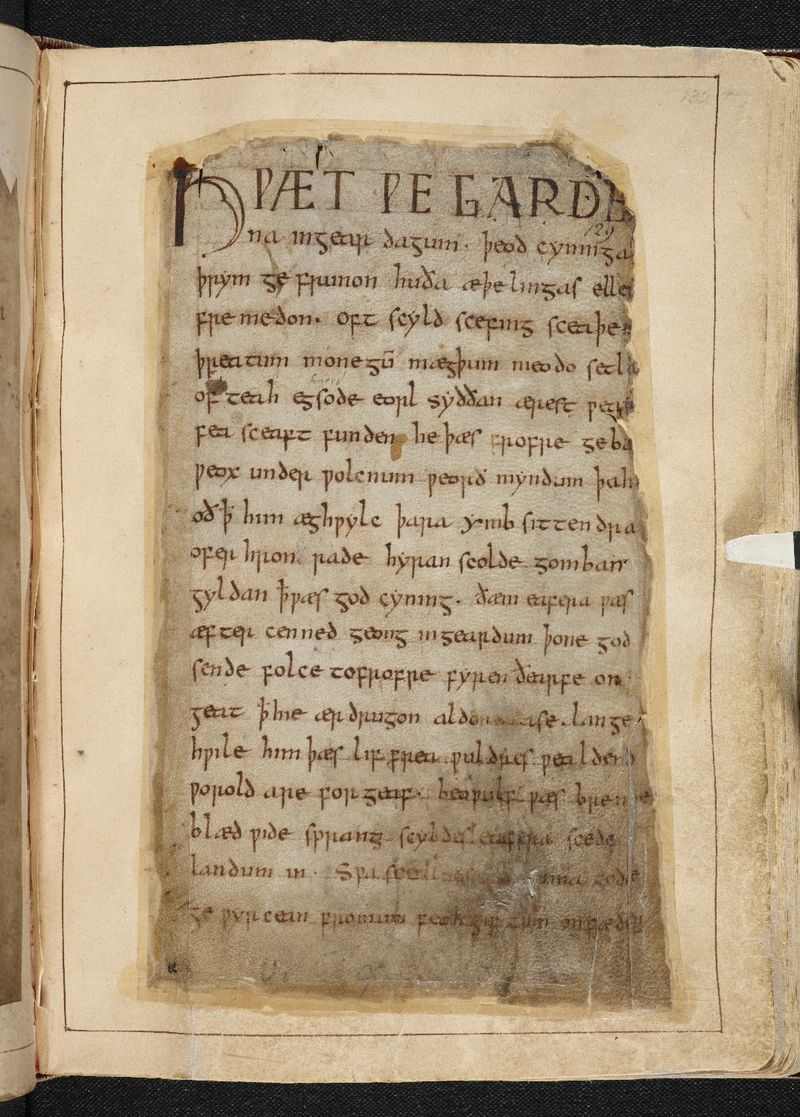
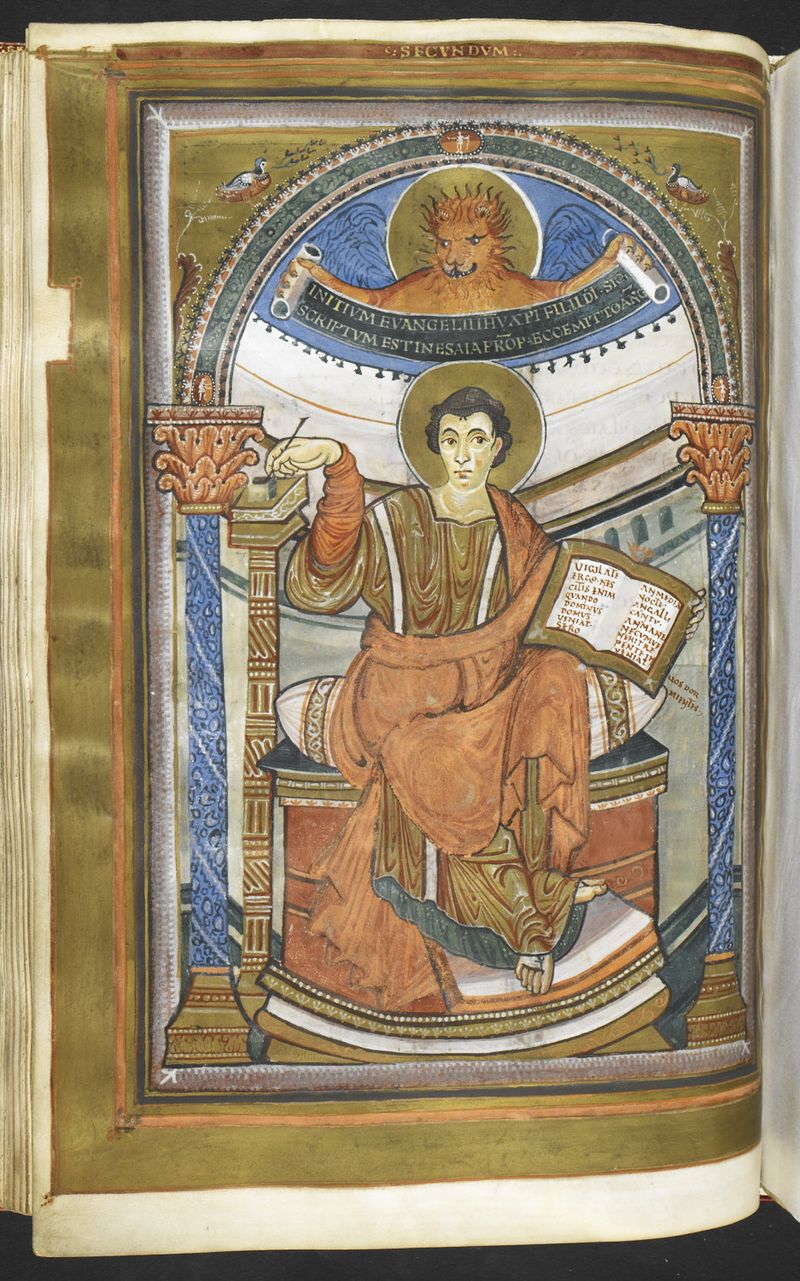
"And when we say "treasures", we really mean it! The six books in question are none other than (drumroll, please) the Harley Golden Gospels, the Silos Apocalypse, the Golf Book, the Petit Livre d'Amour ... and, um, two others. What were they again? Oh yes, remember now. Only Beowulf and Leonardo da Vinci's Notebook."
KlausGraf - am Sonntag, 10. Februar 2013, 00:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year/2012/Finalists
Zur Wahl stehen überwiegend Postkartenmotive ohne enzyklopädischen Wert.

Zur Wahl stehen überwiegend Postkartenmotive ohne enzyklopädischen Wert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://vifabenelux.wordpress.com/2013/02/08/nederlands-dagboekarchief-zukunftig-beim-meertens-instituut/
"Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en briefwisselingen uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. Poëzie-albums vormen een apart onderdeel van de collecte.Maandag 11 februari 2013 wordt het Dagboekarchief officieel opgenomen in het Meertens Instituut in Amsterdam. Het beheer van de collectie blijft in handen van de Stichting Nederlands Dagboekarchief."
http://www.dagboekarchief.nl/
"Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en briefwisselingen uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. Poëzie-albums vormen een apart onderdeel van de collecte.Maandag 11 februari 2013 wordt het Dagboekarchief officieel opgenomen in het Meertens Instituut in Amsterdam. Het beheer van de collectie blijft in handen van de Stichting Nederlands Dagboekarchief."
http://www.dagboekarchief.nl/
KlausGraf - am Samstag, 9. Februar 2013, 23:49 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schavan-tritt-als-bildungsministerin-zurueck-a-882389.html
KlausGraf - am Samstag, 9. Februar 2013, 14:36 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://archiv.twoday.net/stories/97020473/
Es ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit, dass mein Beitrag, der ja erstmals einen Druck des Fürstenspiegels nachwies und Material zum Schreiber der Basler Handschrift zusammenstellte, nicht zitiert wird.
Es ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit, dass mein Beitrag, der ja erstmals einen Druck des Fürstenspiegels nachwies und Material zum Schreiber der Basler Handschrift zusammenstellte, nicht zitiert wird.
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 21:39 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vorgestellt im neuesten Bericht von V. Huth:
http://www.personengeschichte.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Mitteilungen-2012-3.pdf
http://www.personengeschichte.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Mitteilungen-2012-3.pdf
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 21:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich schaute wieder einmal in meinen Beitrag zur Liste der Schlüsselseiten-Digitalisate
http://archiv.twoday.net/stories/5324640/
und verirrte mich nach Osnabrück, wo mir nach wie vor nicht einleuchtet, welchen Sinn es hat, solche Digitalisate im OPAC zu verstecken, wo sie niemand sucht und findet. Mit dem Geld hätte man etliche ganze Bücher digitalisieren können. Aber egal.
Profunde Provenienz-Kenntnis zeichnet die Osnabrücker Bibliothek jedenfalls nicht aus. Der OPAC wirft 18 Bücher mit der Angabe "Provenienz: F. Loew. Ros. Canzlei-Bibliothek / Stempel" aus, ohne einen Versuch zu unternehmen, die Bibliothek zu identifizieren. Ist ja auch irre schwierig.
Update: Zur Bibliothek 1893
http://archive.org/stream/adressbuchderdeu00schw#page/362/mode/2up/search/1548
http://archiv.twoday.net/stories/5324640/
und verirrte mich nach Osnabrück, wo mir nach wie vor nicht einleuchtet, welchen Sinn es hat, solche Digitalisate im OPAC zu verstecken, wo sie niemand sucht und findet. Mit dem Geld hätte man etliche ganze Bücher digitalisieren können. Aber egal.
Profunde Provenienz-Kenntnis zeichnet die Osnabrücker Bibliothek jedenfalls nicht aus. Der OPAC wirft 18 Bücher mit der Angabe "Provenienz: F. Loew. Ros. Canzlei-Bibliothek / Stempel" aus, ohne einen Versuch zu unternehmen, die Bibliothek zu identifizieren. Ist ja auch irre schwierig.
Update: Zur Bibliothek 1893
http://archive.org/stream/adressbuchderdeu00schw#page/362/mode/2up/search/1548
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Buch aus dem Ersten Weltkrieg und eine digitale Rettung
"Das Thema Digitalisierung wird meistens aus der Sicht von Institutionen betrachtet. Es sind Museen, die ihre Sammlungen online stellen. Es sind Archive, die ihre Archivalien verfügbar machen. Es sind Bibliotheken und Google, die Bücher scannen. Dabei gerät häufig die “Digitalisierung von unten”, die von vielen tausenden Menschen betrieben wird, etwas ins Hintertreffen. Dabei birgt gerade die massenhafte Digitalisierung durch viele verschiedene Privatpersonen enormes Potential."
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ein-buch-aus-dem-ersten-weltkrieg-und-eine-digitale-rettung/
"Das Thema Digitalisierung wird meistens aus der Sicht von Institutionen betrachtet. Es sind Museen, die ihre Sammlungen online stellen. Es sind Archive, die ihre Archivalien verfügbar machen. Es sind Bibliotheken und Google, die Bücher scannen. Dabei gerät häufig die “Digitalisierung von unten”, die von vielen tausenden Menschen betrieben wird, etwas ins Hintertreffen. Dabei birgt gerade die massenhafte Digitalisierung durch viele verschiedene Privatpersonen enormes Potential."
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ein-buch-aus-dem-ersten-weltkrieg-und-eine-digitale-rettung/
SW - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich bin kein Freund von Askeys Ansichten über das Wegwerfen von Büchern:
http://archiv.twoday.net/stories/64954619/
Aber dass die Mellon Press ihn und die McMaster University wegen eines kritischen Blogpostings von 2010 mit einer 3-Mio.-$-Verleumdungsklage überzieht, ist unerhört und eine Attacke gegen die akademische Freiheit.
http://leiterreports.typepad.com/blog/academic_freedom/
http://boingboing.net/2013/02/08/publisher-launches-3000000.html
http://www.insidehighered.com/news/2013/02/08/academic-press-sues-librarian-raising-issues-academic-freedom
Und etliche andere mehr.
I just signed the petition "Edwin Mellen Press: End libel suit against Dale Askey and McMaster University " on Change.org.
It's important. Will you sign it too? Here's the link:
http://www.change.org/petitions/edwin-mellen-press-end-libel-suit-against-dale-askey-and-mcmaster-university
Thanks!
http://archiv.twoday.net/stories/64954619/
Aber dass die Mellon Press ihn und die McMaster University wegen eines kritischen Blogpostings von 2010 mit einer 3-Mio.-$-Verleumdungsklage überzieht, ist unerhört und eine Attacke gegen die akademische Freiheit.
http://leiterreports.typepad.com/blog/academic_freedom/
http://boingboing.net/2013/02/08/publisher-launches-3000000.html
http://www.insidehighered.com/news/2013/02/08/academic-press-sues-librarian-raising-issues-academic-freedom
Und etliche andere mehr.
I just signed the petition "Edwin Mellen Press: End libel suit against Dale Askey and McMaster University " on Change.org.
It's important. Will you sign it too? Here's the link:
http://www.change.org/petitions/edwin-mellen-press-end-libel-suit-against-dale-askey-and-mcmaster-university
Thanks!
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:21 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Maxi Maria Platz betreibt ein mittelalterarchäologisches Doktorandenblog auf hyptheses.org und zieht eine sehr positive Bilanz: "Ein Jahr Bloggerin – Rückschau, Dank, Ausblick und meine ganz persönliche Sicht aufs Bloggen"
http://minuseinsebene.hypotheses.org/384
http://minuseinsebene.hypotheses.org/384
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Rahmen des an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel angesiedelten Forschungsprojekts „Wissensproduktion an der Universität Helmstedt – Die Entwicklung der philosophischen Fakultät 1576-1810“ wurden alle Studenten und Universitätsangehörigen aus dem Zeitraum 1574 bis 1810 in eine Datenbank eingegeben. Seit Januar sind nun die ungefähr 45.000 Studenten auf dem Internetportal http://uni-helmstedt.hab.de online unter den Kategorien Name, Herkunft sowie Semester durchsuchbar."

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 20:00 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dlib.gnm.de/item/Hs998/20/html
Die 1441 datierte Handschrift Hs. 998 des GNM überliefert:
Bl. 2r-151r = Konrad von Würzburg: 'Trojanerkrieg' (N1 [e])
Bl. 151r-200v = 'Trojanerkrieg'-Fortsetzung (N1)
Bl. 201r-266v = Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (n)
Bl. 267r-297v = 'Herzog Ernst' B (a)
http://www.handschriftencensus.de/5468
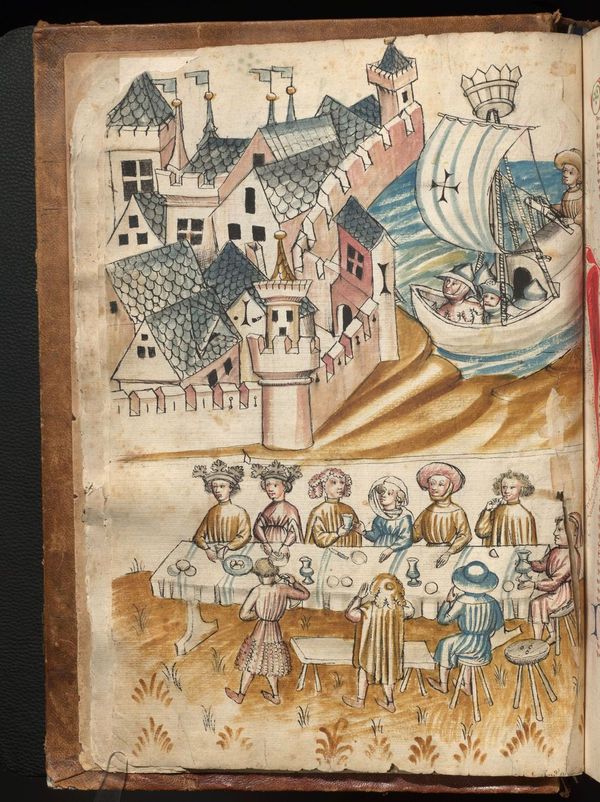
Die 1441 datierte Handschrift Hs. 998 des GNM überliefert:
Bl. 2r-151r = Konrad von Würzburg: 'Trojanerkrieg' (N1 [e])
Bl. 151r-200v = 'Trojanerkrieg'-Fortsetzung (N1)
Bl. 201r-266v = Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (n)
Bl. 267r-297v = 'Herzog Ernst' B (a)
http://www.handschriftencensus.de/5468
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bertram Reinartz widmete sein Poem dem Frankfurter Stadtregiment (um 1695):
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4256140
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4256140
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/hdbl-findbuecher
Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?
Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:47 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://infobib.de/blog/2013/02/08/10-regeln-fur-persistente-uris/ mit weiteren Links.
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Soeben habe ich die mich bestürzende Nachricht vom Tod des Landeshistorikers Rolf Götz erhalten, dessen Publikationen aus meiner Sicht weit über den Kirchheimer Raum von Bedeutung sind. Seit ich bei der Vorbereitung meiner "Sagen rund um Stuttgart" (1993) seine unprätentiöse Hilfsbereitschaft zu schätzen lernte standen wir in freundschaftlichem Kontakt. Seine quellennahen Studien habe ich immer als vorbildliche "Heimatforschung" im besten Sinn bewundert. Götz war Gymnasiallehrer und hat erst spät mit einer Arbeit über die Traditionsbildung der Herzöge von Teck promoviert (2007).
Nachruf:
http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html
Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/285828206/
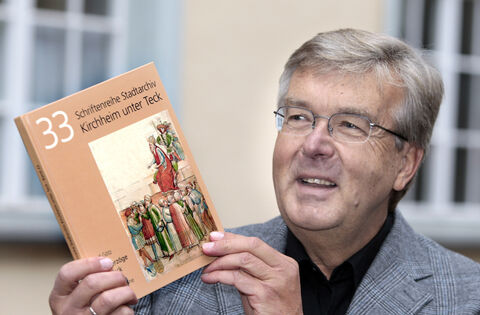
Nachruf:
http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html
Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/285828206/
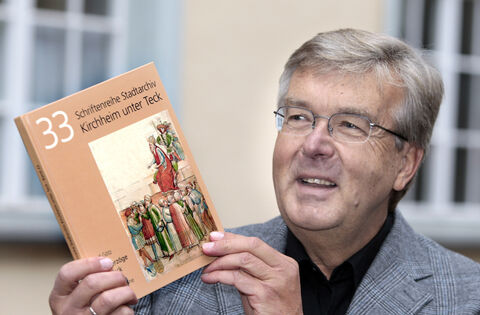
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 18:29 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 16:40 - Rubrik: Archivsoftware
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Johan Weitzmann erläutert die Probleme mit dem Datenportal des Bundes:
http://irights.info/?q=content/datenportal-des-bundes-preussen-im-internet
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/
Update:
http://infobib.de/blog/2013/02/09/harsche-kritik-an-govdata-de/
http://irights.info/?q=content/datenportal-des-bundes-preussen-im-internet
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/topics/E-Government/
Update:
http://infobib.de/blog/2013/02/09/harsche-kritik-an-govdata-de/
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 16:37 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://orf.at/stories/2165542/
"Weißrussland hat möglicherweise sein Exemplar der historischen Urkunde über die Auflösung der Sowjetunion und der Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten verloren. Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk bestätigte gestern, das Dokument sei unauffindbar. „Wir müssen in den Archiven suchen, um die Situation aufzuklären“, hieß es."
"Weißrussland hat möglicherweise sein Exemplar der historischen Urkunde über die Auflösung der Sowjetunion und der Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten verloren. Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk bestätigte gestern, das Dokument sei unauffindbar. „Wir müssen in den Archiven suchen, um die Situation aufzuklären“, hieß es."
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 15:43 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Internetrecherchen für LandeshistorikerInnen
Zu http://archiv.twoday.net/stories/219048535/
Bibliographieren von Digitalisaten
Anleitung:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren
Einzelne Werkzeuge:
* http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ - Deutsche Digitale Bibliothek (zur Kritik: http://archiv.twoday.net/stories/219044776/ - Suche: hexenprozesse)
* http://www.europeana.eu/ - Europeana (Suche: reichenau beyerle)
* http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - Karlsruher Virtueller Katalog mit Online-Filter (Suche: hilgard, speyer)
* http://www.base-search.net/ - Suchmaschine BASE der UB Bielefeld (Suchen: quarthal franz, graf klaus, breisach geschichte)
Google Book Search und vergleichbare Volltext-Angebote
Google Book Search
Anleitung Google Book Search:
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search
Waltzing edierte Texte über Petrus Jacobi aus einem Darmstädter Codex im Musée belge 1908 :
http://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)
Benutzter Proxy: http://harvarddegree.info/
Angebote von München, Gent und Oxford.
HathiTrust
* http://www.hathitrust.org/ - HathiTrust (Suche: fürstenbergisches urkundenbuch)
* http://hdl.handle.net/2027/nnc1.1002689790?urlappend=%3Bseq=9 (US)
Welche Telefonnummer hatte 1993 Dr. Klaus Graf (Suche: sachav graf)
Internet Archive
Anleitung:
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
Cool: die Wayback Machine:
* http://web.archive.org/web/19971007031523/http://www.uni-freiburg.de/
* http://archive.org/details/texts (Suche: chroniken lübeck, chroniken lubeck) - PDF nicht von Google: https://ia700304.us.archive.org/28/items/diechronikender01brungoog/
Libreka, Amazon, PaperC
* http://www.libreka.de (Suche: christoph lehmann speyer)
* http://www.amazon.de (Volltextsuche möglich, Seitenansicht nur nach Anmeldung; Suchwort: weblog archivalia)
* http://paperc.de/ (Suche: hagenau)
Web 2.0, das Mitmach-Web
Wikisource
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen Digitale Sammlungen
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven Digitale Sammlungen von Archiven
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse Digitalisierte Nachlässe
* http://de.wikisource.org/wiki/ZS (Suche: ZGO 1905)
* http://de.wikisource.org/wiki/FDA Freiburger Diözesanarchiv
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche Biographische Recherche
* http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke Biographische Nachschlagewerke
* http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege
* http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd Projekt Schwäbisch Gmünd
* http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg
Wikipedia
* http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster Nachschlagewerke Klöster
Wikiversity
* http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche_in_der_Geschichtswissenschaft Aufsatzrecherche in der Geschichtswissenschaft
* http://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche Bildrecherche
Weblogs
* http://archiv.twoday.net Archivalia
* http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315
* http://de.hypotheses.org/ Portal für Wissenschaftsblogs
Wünsche an die landesgeschichtliche Forschung
- Lücken schließen und noch nicht Digitalisiertes ins Netz stellen! (ULB Düsseldorf digitalisiert kostenlos für ihre eingeschriebenen Benutzer.)
- Google-Scans, die nur mit Proxy zugänglich sind, ins Internet Archive hochladen!
- Digitalisate müssen an prominenter Stelle nachgewiesen werden (z.B. in Wikisource oder in der Wikipedia)
* https://www.google.de/search?q=w%C3%BCrdtwein+subsidia
- In den Wikimedia-Projekten mitarbeiten!
- Gegebenenfalls Genehmigung des Rechteinhabers einholen!
- Bei jedem Projekt (z.B. Veröffentlichung, auch Aufsätze) sich fragen: Welche Quellen und Sekundärliteratur kann ich online der Allgemeinheit zugänglich machen?
- Eigene Publikationen Open Access zur Verfügung stellen! (Zu den Rechtsfragen: http://archiv.twoday.net/stories/197330649/)
- Blogs lesen und selber bloggen!
Zu http://archiv.twoday.net/stories/219048535/
Bibliographieren von Digitalisaten
Anleitung:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren
Einzelne Werkzeuge:
* http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ - Deutsche Digitale Bibliothek (zur Kritik: http://archiv.twoday.net/stories/219044776/ - Suche: hexenprozesse)
* http://www.europeana.eu/ - Europeana (Suche: reichenau beyerle)
* http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - Karlsruher Virtueller Katalog mit Online-Filter (Suche: hilgard, speyer)
* http://www.base-search.net/ - Suchmaschine BASE der UB Bielefeld (Suchen: quarthal franz, graf klaus, breisach geschichte)
Google Book Search und vergleichbare Volltext-Angebote
Google Book Search
Anleitung Google Book Search:
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search
Waltzing edierte Texte über Petrus Jacobi aus einem Darmstädter Codex im Musée belge 1908 :
http://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)
Benutzter Proxy: http://harvarddegree.info/
Angebote von München, Gent und Oxford.
HathiTrust
* http://www.hathitrust.org/ - HathiTrust (Suche: fürstenbergisches urkundenbuch)
* http://hdl.handle.net/2027/nnc1.1002689790?urlappend=%3Bseq=9 (US)
Welche Telefonnummer hatte 1993 Dr. Klaus Graf (Suche: sachav graf)
Internet Archive
Anleitung:
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
Cool: die Wayback Machine:
* http://web.archive.org/web/19971007031523/http://www.uni-freiburg.de/
* http://archive.org/details/texts (Suche: chroniken lübeck, chroniken lubeck) - PDF nicht von Google: https://ia700304.us.archive.org/28/items/diechronikender01brungoog/
Libreka, Amazon, PaperC
* http://www.libreka.de (Suche: christoph lehmann speyer)
* http://www.amazon.de (Volltextsuche möglich, Seitenansicht nur nach Anmeldung; Suchwort: weblog archivalia)
* http://paperc.de/ (Suche: hagenau)
Web 2.0, das Mitmach-Web
Wikisource
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen Digitale Sammlungen
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven Digitale Sammlungen von Archiven
* http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse Digitalisierte Nachlässe
* http://de.wikisource.org/wiki/ZS (Suche: ZGO 1905)
* http://de.wikisource.org/wiki/FDA Freiburger Diözesanarchiv
* http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche Biographische Recherche
* http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke Biographische Nachschlagewerke
* http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege
* http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd Projekt Schwäbisch Gmünd
* http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg
Wikipedia
* http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster Nachschlagewerke Klöster
Wikiversity
* http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche_in_der_Geschichtswissenschaft Aufsatzrecherche in der Geschichtswissenschaft
* http://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche Bildrecherche
Weblogs
* http://archiv.twoday.net Archivalia
* http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315
* http://de.hypotheses.org/ Portal für Wissenschaftsblogs
Wünsche an die landesgeschichtliche Forschung
- Lücken schließen und noch nicht Digitalisiertes ins Netz stellen! (ULB Düsseldorf digitalisiert kostenlos für ihre eingeschriebenen Benutzer.)
- Google-Scans, die nur mit Proxy zugänglich sind, ins Internet Archive hochladen!
- Digitalisate müssen an prominenter Stelle nachgewiesen werden (z.B. in Wikisource oder in der Wikipedia)
* https://www.google.de/search?q=w%C3%BCrdtwein+subsidia
- In den Wikimedia-Projekten mitarbeiten!
- Gegebenenfalls Genehmigung des Rechteinhabers einholen!
- Bei jedem Projekt (z.B. Veröffentlichung, auch Aufsätze) sich fragen: Welche Quellen und Sekundärliteratur kann ich online der Allgemeinheit zugänglich machen?
- Eigene Publikationen Open Access zur Verfügung stellen! (Zu den Rechtsfragen: http://archiv.twoday.net/stories/197330649/)
- Blogs lesen und selber bloggen!
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Vereinigung der polnischen Archive hat angekündigt, 2,3 Millionen Personenstandsurkunden online zu stellen. Ein erster Schwung wird im März diesen Jahres veröffentlicht werden, der zweite Teil soll im Juni folgen."
http://pommerscher-greif.de/nachrichtenleser_a/items/personenstandsurkunden.html
http://pommerscher-greif.de/nachrichtenleser_a/items/personenstandsurkunden.html
KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 15:08 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Masturbations-Debatte http://archiv.twoday.net/stories/235552833/
Valentin Groebner hat in einer persönlichen Mail bedauert, dass ich seine Ausführungen als persönlichen Angriff missverstanden hätte. Zu den Thesen von Tim Wu und Geert Lovink möchte ich mich jetzt nicht äußern, sondern nur zur abschließenden Frage, ob ich denn wirklich meine, "dass digitales Publizieren die Lese-Zeit, die jedem von uns zur Verfügung steht, tatsächlich erweitert?"
Ja, meine ich.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich mehr Zeit zum Lesen brauchen oder nicht vielmehr mehr Zeit zum Nachdenken. Aber geschenkt.
Ich frage zurück, ob Groebner tatsächlich meint, dass analoges Publizieren die Lese-Zeit erweitert? Eine gute Publikation regt zum Weiterdenken an, sie fördert aber auch den Verzicht auf tausende weitere Arbeiten, die womöglich einschlägig wären (was niemand wissen kann). Ob sie gedruckt oder online verfügbar ist, spielt keine Rolle. Denn dass Online-Publikationen schlechter seien, wäre eine unbewiesene Behauptung.
Bei quantitativen Studien kommt es auf Masse an, da sind maschinenlesbare Daten, die man statistisch mittels Text-Mining durchdringen kann, unverzichtbar. Wer seine Datengrundlage, soweit rechtlich möglich, als Open Data zur Verfügung stellt, spart anderen Wissenschaftlern enorm viel Zeit.
Groebner und ich arbeiten qualitativ. Da kommt es darauf an, schlagende Quellenbeispiele und relevante Sekundärliteratur zu kennen. Seit ich 1975 zu forschen begann, hat sich in Sachen Heuristik fast alles verändert. Keine schwierig benutzbaren Zettelkataloge mehr, sondern OPACs. Bibliographien gibt es online, Open Access und kostenpflichtig. Viele Millionen Bücher sind mit ihren Volltexten durchsuchbar online, alte Drucke oft bequem als Digitalisate am Bildschirm verfügbar. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal von Winningen in die Stadtbibliothek Mainz fuhr, um Nauklers Weltchronik in der Erstausgabe zu benutzen.
Das alles spart enorm viel Zeit, und mehr Open Access würde die übliche "Beschaffungskriminalität" noch weiter eindämmen.
Hinweise aus dem Social Web erleichtern das Filtern des Informationsschwalls. Im Bereich der Geschichtswissenschaft gibt es nur noch wenige "Referateorgane", die auch das unselbständige Schrifttum erschließen. Die "Historical Abstracts" stehen übrigens Aachener Geschichtsstudenten nicht zur Verfügung, da die Universität keine Lizenz besitzt. Soweit ich weiß, setzen die Referateorgane auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Wieso gelingt es nicht, kollaborativ umfassendere Nachweisinstrumente aufzusetzen? Niemand kann mir erzählen, dass eine gedruckte Bibliographie heute noch einen hinreichenden Nutzen stiftet. Das Netz ist da schlichtweg "alternativlos".
Digitales Publizieren ermöglicht das unmittelbare und schnellstmögliche Überprüfen jeder Quellenangabe und jeden Nachweises. Vorausgesetzt, es gibt etwas zu verlinken, also Digitalisate oder Open-Access-Volltexte. Ein Link ist sogar schneller als das Holen des Buchs in der eigenen Bibliothek, was sogar für das Verfasserlexikon gilt, das jetzt etwa 1,5 Meter von mir entfernt ist.
Zum Technischen:
http://archiv.twoday.net/stories/8357124/
Werfen wir ruhig einmal einen Blick in einen beliebigen Anmerkungsapparat
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:2002:2::54&id=hitlist&id2=&id3=
Ich weiß sofort, dass Barack (n. 5), Kress (n. 12) oder die Chroniken der deutschen Städte (n. 16) online sind, und das in n. 10 erwähnte Gemälde findet man ohne großes Suchen im Netz, wenngleich man sich wünschen würde, dass man die Darstellung mit den zwei bestechenden Damen (links unten) sich im Detail anschauen könnte.
Aber es geht mir eigentlich nicht darum, was jetzt schon möglich ist, sondern um das Potential, das intelligente Verknüpfungen bieten. Ich lasse auch die ganzen Probleme mit dem Urheberrecht und archivischem Copyfraud weg, die fast alle Wissenschaftler daran hindern, einfach die Kopien - sagen wir - aus dem Staatsarchiv Basel, die diversen Aufsätzen Groebners zugrundeliegen, zu scannen und ins Netz zu stellen, damit jeder die Quellengrundlage sofort überprüfen kann.
Nehmen wir das Montaigne-Zitat (n. 20). Würden Personennamen in den Fußnoten generell mit der GND ausgezeichnet (oder künftigen Normformaten), käme man zu der bereits jetzt ziemlich genialen Abfrage:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118583573
Vielfach erscheint mir das Zitieren biographischer Angaben als Selbstzweck. Nicht selten bietet die Wikipedia Qualitätvolleres als gedruckte Nachschlagewerke. Bloße Orientierungs-Zitate, bei denen es nicht um biographische Details geht, könnten ersatzlos eingespart werden und die eingesparte Zeit könnte dazu verwandt werden, eines von Groebners klugen Büchlein zu lesen.
Eine wissenschaftliche Darstellung, bei der alles sofort komplett via Link überprüfbar ist (davon gibt es hier unter meinen Forschungsmiszellen
http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung
schon einige Beispiele), ist eine bessere und transparentere Wissenschaft, die im übrigen Plagiate erheblich erschweren würde.

Valentin Groebner hat in einer persönlichen Mail bedauert, dass ich seine Ausführungen als persönlichen Angriff missverstanden hätte. Zu den Thesen von Tim Wu und Geert Lovink möchte ich mich jetzt nicht äußern, sondern nur zur abschließenden Frage, ob ich denn wirklich meine, "dass digitales Publizieren die Lese-Zeit, die jedem von uns zur Verfügung steht, tatsächlich erweitert?"
Ja, meine ich.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich mehr Zeit zum Lesen brauchen oder nicht vielmehr mehr Zeit zum Nachdenken. Aber geschenkt.
Ich frage zurück, ob Groebner tatsächlich meint, dass analoges Publizieren die Lese-Zeit erweitert? Eine gute Publikation regt zum Weiterdenken an, sie fördert aber auch den Verzicht auf tausende weitere Arbeiten, die womöglich einschlägig wären (was niemand wissen kann). Ob sie gedruckt oder online verfügbar ist, spielt keine Rolle. Denn dass Online-Publikationen schlechter seien, wäre eine unbewiesene Behauptung.
Bei quantitativen Studien kommt es auf Masse an, da sind maschinenlesbare Daten, die man statistisch mittels Text-Mining durchdringen kann, unverzichtbar. Wer seine Datengrundlage, soweit rechtlich möglich, als Open Data zur Verfügung stellt, spart anderen Wissenschaftlern enorm viel Zeit.
Groebner und ich arbeiten qualitativ. Da kommt es darauf an, schlagende Quellenbeispiele und relevante Sekundärliteratur zu kennen. Seit ich 1975 zu forschen begann, hat sich in Sachen Heuristik fast alles verändert. Keine schwierig benutzbaren Zettelkataloge mehr, sondern OPACs. Bibliographien gibt es online, Open Access und kostenpflichtig. Viele Millionen Bücher sind mit ihren Volltexten durchsuchbar online, alte Drucke oft bequem als Digitalisate am Bildschirm verfügbar. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal von Winningen in die Stadtbibliothek Mainz fuhr, um Nauklers Weltchronik in der Erstausgabe zu benutzen.
Das alles spart enorm viel Zeit, und mehr Open Access würde die übliche "Beschaffungskriminalität" noch weiter eindämmen.
Hinweise aus dem Social Web erleichtern das Filtern des Informationsschwalls. Im Bereich der Geschichtswissenschaft gibt es nur noch wenige "Referateorgane", die auch das unselbständige Schrifttum erschließen. Die "Historical Abstracts" stehen übrigens Aachener Geschichtsstudenten nicht zur Verfügung, da die Universität keine Lizenz besitzt. Soweit ich weiß, setzen die Referateorgane auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Wieso gelingt es nicht, kollaborativ umfassendere Nachweisinstrumente aufzusetzen? Niemand kann mir erzählen, dass eine gedruckte Bibliographie heute noch einen hinreichenden Nutzen stiftet. Das Netz ist da schlichtweg "alternativlos".
Digitales Publizieren ermöglicht das unmittelbare und schnellstmögliche Überprüfen jeder Quellenangabe und jeden Nachweises. Vorausgesetzt, es gibt etwas zu verlinken, also Digitalisate oder Open-Access-Volltexte. Ein Link ist sogar schneller als das Holen des Buchs in der eigenen Bibliothek, was sogar für das Verfasserlexikon gilt, das jetzt etwa 1,5 Meter von mir entfernt ist.
Zum Technischen:
http://archiv.twoday.net/stories/8357124/
Werfen wir ruhig einmal einen Blick in einen beliebigen Anmerkungsapparat
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:2002:2::54&id=hitlist&id2=&id3=
Ich weiß sofort, dass Barack (n. 5), Kress (n. 12) oder die Chroniken der deutschen Städte (n. 16) online sind, und das in n. 10 erwähnte Gemälde findet man ohne großes Suchen im Netz, wenngleich man sich wünschen würde, dass man die Darstellung mit den zwei bestechenden Damen (links unten) sich im Detail anschauen könnte.
Aber es geht mir eigentlich nicht darum, was jetzt schon möglich ist, sondern um das Potential, das intelligente Verknüpfungen bieten. Ich lasse auch die ganzen Probleme mit dem Urheberrecht und archivischem Copyfraud weg, die fast alle Wissenschaftler daran hindern, einfach die Kopien - sagen wir - aus dem Staatsarchiv Basel, die diversen Aufsätzen Groebners zugrundeliegen, zu scannen und ins Netz zu stellen, damit jeder die Quellengrundlage sofort überprüfen kann.
Nehmen wir das Montaigne-Zitat (n. 20). Würden Personennamen in den Fußnoten generell mit der GND ausgezeichnet (oder künftigen Normformaten), käme man zu der bereits jetzt ziemlich genialen Abfrage:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118583573
Vielfach erscheint mir das Zitieren biographischer Angaben als Selbstzweck. Nicht selten bietet die Wikipedia Qualitätvolleres als gedruckte Nachschlagewerke. Bloße Orientierungs-Zitate, bei denen es nicht um biographische Details geht, könnten ersatzlos eingespart werden und die eingesparte Zeit könnte dazu verwandt werden, eines von Groebners klugen Büchlein zu lesen.
Eine wissenschaftliche Darstellung, bei der alles sofort komplett via Link überprüfbar ist (davon gibt es hier unter meinen Forschungsmiszellen
http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung
schon einige Beispiele), ist eine bessere und transparentere Wissenschaft, die im übrigen Plagiate erheblich erschweren würde.
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 23:48 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://verteidige-dein-bild.de/
Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.
http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

Nicht weniger dümmlich als die Proteste gegen Google Books. Diese armseligen Würstchen könnten Google mit robots.txt ganz von ihren Internetseiten ausschließen, aber das machen sie nicht. Sie wollen Google nach ihrer Pfeife tanzen lassen.
http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/journalisten-verband-neue-google-bildersuche-schmarotzt/robots.txt/70489,3246239,3246239,read.html

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 21:53 - Rubrik: Bildquellen
http://www.hanauonline.de/2012-06-25-19-21-46/rhein-main/wetterau/3749-archivalien-im-bandhaus-buedingen-kuenftig-fuer-forschung-zugaenglich.html
Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.
Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.
„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.
Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.
Eine andere historische Entwicklung nahmen dagegen die Teilarchive der nach der Landesteilung von 1687 gebildeten Linien Ysenburg-Büdingen, Ysenburg-Wächtersbach und Ysenburg-Meerholz: In diesen Teilgrafschaften entstanden jeweils eigene Registraturen, deren Bestände in entsprechenden Teilarchiven überliefert sind. Nach Erlöschen der Teillinien im 20. Jahrhundert wurden die Archive nach Büdingen gebracht als die genannte Versorgungsstiftung bereits errichtet war. Aus diesem Grund sind sie nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens, sondern befinden sich im Privatbesitz der Adelsfamilie. Das Archivgut der Teillinien untersteht mithin auch nicht der Aufsicht des Fideikommissgerichts.
Die Unterlagen der Teillinien werden an verschiedenen Standorten in Büdingen aufbewahrt: Im Brauhaus lagern die Archivalien der Teillinien Wächtersbach und Meerholz. Im Bandhaus wird das Archivgut Ysenburg-Büdingen verwahrt.
Aufgrund der öffentlichen Diskussion um die Nutzung insbesondere des Archivguts im Bandhaus gab es einen Ortstermin mit einer Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das dort verwahrte Schriftgut gliedert sich in die beiden Hauptbestandteile Rentkammerakten (das sind Akten der herrschaftlichen Wirtschafts- und Finanzverwaltung) und Forstverwaltungsakten der Linie Ysenburg-Büdingen. Die im Erdgeschoss des Gebäudes in Archivkartons in Regalen aufbewahrten Unterlagen sind unter archivfachlichen Gesichtspunkten in einwandfreiem konservatorischem Zustand. „Von einer Gefährdung des Archivguts kann derzeit nicht gesprochen werden“, sagte Ministerin Kühne-Hörmann.
Danke an MM.
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/97014410/
Wiesbaden / Büdingen – Der Archivbestand im so genannten Bandhaus in Büdingen, der Akten der fürstlichen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des 19. und 20. Jahrhunderts umfasst, soll künftig zugänglich gemacht werden. Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann teilte bei einem Gespräch mit Abgeordneten, Bürgermeistern und Heimatforschern aus der Region heute in Büdingen mit, dass Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg-Büdingen zugesagt habe, die Nutzung dieser Archivbestände für die Forschung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestatten. Der Archivbestand ist inventarisiert; entsprechende Bestandsverzeichnisse liegen vor.
Sowohl das Gebäude des Bandhauses – ein ehemaliges Kelterhaus aus dem 16. Jahrhundert – als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch zur Nutzung der dort aufbewahrten Dokumente. Auch das Hessische Archivgesetz gilt nicht für Archive in privater Trägerschaft. Diese unterliegen vielmehr den Regeln des Privatrechts. „Insofern hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst keinen rechtlichen Handlungsspielraum“, hob die Ministerin hervor.
„Umso mehr freue ich mich, dass diese Archivbestände, die nicht zuletzt ein Stück hessischer Orts- und Landesgeschichte dokumentieren und an deren Nutzung mithin ein öffentliches Interesse besteht, auf diese Weise künftig zugänglich werden“, sagte Kühne-Hörmann. Im Schloss Büdingen gebe es Räume zur Vorlage der Archivalien mit zwei Benutzerplätzen. Interessenten könnten bei der Familie zu Ysenburg-Büdingen schriftlich einen Termin zur Einsicht vereinbaren.
Der weitaus größte Teil der Herrschaftsunterlagen der Adelsfamilie Ysenburg-Büdingen ist in einem Gesamtarchiv überliefert, das sich seit Errichtung der so genannten Versorgungsstiftung Ysenburg-Büdingen im Jahr 1931 im Eigentum dieser Stiftung befindet. Laut Stiftungszweck besteht die Pflicht zur Erhaltung und Unterhaltung; auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissgericht, einem Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Dieses im Büdinger Brauhaus lagernde Gesamtarchiv ist im Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen und umfasst rund 6.000 Urkunden, Amtsbücher, ältere Verwaltungsakten und eine Münzsammlung.
Eine andere historische Entwicklung nahmen dagegen die Teilarchive der nach der Landesteilung von 1687 gebildeten Linien Ysenburg-Büdingen, Ysenburg-Wächtersbach und Ysenburg-Meerholz: In diesen Teilgrafschaften entstanden jeweils eigene Registraturen, deren Bestände in entsprechenden Teilarchiven überliefert sind. Nach Erlöschen der Teillinien im 20. Jahrhundert wurden die Archive nach Büdingen gebracht als die genannte Versorgungsstiftung bereits errichtet war. Aus diesem Grund sind sie nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens, sondern befinden sich im Privatbesitz der Adelsfamilie. Das Archivgut der Teillinien untersteht mithin auch nicht der Aufsicht des Fideikommissgerichts.
Die Unterlagen der Teillinien werden an verschiedenen Standorten in Büdingen aufbewahrt: Im Brauhaus lagern die Archivalien der Teillinien Wächtersbach und Meerholz. Im Bandhaus wird das Archivgut Ysenburg-Büdingen verwahrt.
Aufgrund der öffentlichen Diskussion um die Nutzung insbesondere des Archivguts im Bandhaus gab es einen Ortstermin mit einer Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das dort verwahrte Schriftgut gliedert sich in die beiden Hauptbestandteile Rentkammerakten (das sind Akten der herrschaftlichen Wirtschafts- und Finanzverwaltung) und Forstverwaltungsakten der Linie Ysenburg-Büdingen. Die im Erdgeschoss des Gebäudes in Archivkartons in Regalen aufbewahrten Unterlagen sind unter archivfachlichen Gesichtspunkten in einwandfreiem konservatorischem Zustand. „Von einer Gefährdung des Archivguts kann derzeit nicht gesprochen werden“, sagte Ministerin Kühne-Hörmann.
Danke an MM.
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/97014410/
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 19:12 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhsl/content/titleinfo/1168551
Cod. Donaueschingen 138a, 138b (um 1600).
Siehe
Antje KNORR, Villinger Passion. Literarhistorische Einordnung und erstmalige Herausgabe des Urtextes und der Überarbeitungen (GAG 187), Göppingen 1976
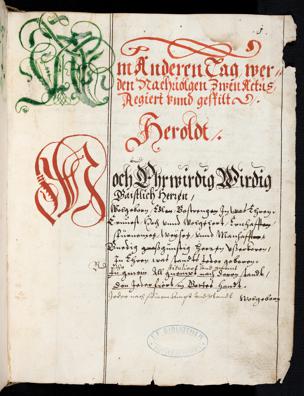
Cod. Donaueschingen 138a, 138b (um 1600).
Siehe
Antje KNORR, Villinger Passion. Literarhistorische Einordnung und erstmalige Herausgabe des Urtextes und der Überarbeitungen (GAG 187), Göppingen 1976
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:59 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Raul Rojas, Informatik-Professor in Berlin, weist in Telepolis die Schavanisten in die Schranken:
http://www.heise.de/tp/artikel/38/38522/1.html
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

http://www.heise.de/tp/artikel/38/38522/1.html
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schavan

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:53 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://www.its-arolsen.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Archivtagung/Archivterminologie_ITS.pdf
Kurz, aber durch die Liste anderssprachiger Äquivalente hilfreich.
Kurz, aber durch die Liste anderssprachiger Äquivalente hilfreich.
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:51 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Valentin Groebner schreibt in der FAZ davon, dass zu viel gebloggt wird. Wissenschaftliches Publizieren im Netz hätte eine Überproduktionskrise, die Lesezeit sei zu knapp und auf Wissenschaftsblogs stelle sich das “Gefühl rastloser Masturbation” ein. Da andere Plattformen wie YouPorn, die das gleiche Gefühl vermitteln, ja enorme Erfolge feiern, sollten wir vielleicht noch ein paar weitere Blogs gründen. "
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/blogs-die-noch-fehlen/
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/blogs-die-noch-fehlen/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lizenzstreit-ueberschattet-deutsches-Datenportal-1799991.html
"In der vorletzten Februarwoche soll das seit Ende 2010 geplante Online-Portal für offene Verwaltungsdaten unter dem Titel "GovData – das Datenportal für Deutschland" in den Probebetrieb gehen. Nun haben sich die Fronten zwischen Portalbetreibern und Nutzergruppen verhärtet: Vertreter der deutschen "Open-Data-Community" betonen, dass sie die Plattform in der derzeit vorgesehen Form nicht akzeptieren."
Bitte die "Gemeinsame Erklärung" unterzeichnen!
http://not-your-govdata.de/
Auszug:
"Die vor kurzem veröffentlichten Rechtemodelle für das Portal und die bisherigen Einblicke in die Plattform zeigen einen Ansatz, der weder offen im Sinne der weltweit anerkannten Standards ist noch zeitgemäß oder effektiv im Hinblick auf Umsetzung, Usability und Sicherheit. Auch ist bisher nicht ersichtlich, wie man gedenkt, eine Nachnutzung der Daten aktiv zu fördern und so eine Community rund um das Datenangebot zur Nachnutzung zu motivieren. Es besteht noch enormer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen.
Das vorgeschlagene Lizenzmodell ist eine Insellösung!
Auch wenn das vorgeschlagene Lizenzmodell in seiner Einfachheit besser als das völlig unbrauchbare GeoLizenzen-Modell ist, erschwert es dennoch über die Maßen die Verbreitung, Weiternutzung und Verschränkung der Daten. Anstatt auf international etablierte offene Lizenzmodelle zurückzugreifen wird ein neues Modell “Marke Eigenbau” als Insellösung geschaffen, das für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt. Dass entscheidende Begriffe wie “Quellenangabe” nicht bzw. nicht ausreichend definiert sind, hilft der Nachnutzung ebenfalls nicht."

"In der vorletzten Februarwoche soll das seit Ende 2010 geplante Online-Portal für offene Verwaltungsdaten unter dem Titel "GovData – das Datenportal für Deutschland" in den Probebetrieb gehen. Nun haben sich die Fronten zwischen Portalbetreibern und Nutzergruppen verhärtet: Vertreter der deutschen "Open-Data-Community" betonen, dass sie die Plattform in der derzeit vorgesehen Form nicht akzeptieren."
Bitte die "Gemeinsame Erklärung" unterzeichnen!
http://not-your-govdata.de/
Auszug:
"Die vor kurzem veröffentlichten Rechtemodelle für das Portal und die bisherigen Einblicke in die Plattform zeigen einen Ansatz, der weder offen im Sinne der weltweit anerkannten Standards ist noch zeitgemäß oder effektiv im Hinblick auf Umsetzung, Usability und Sicherheit. Auch ist bisher nicht ersichtlich, wie man gedenkt, eine Nachnutzung der Daten aktiv zu fördern und so eine Community rund um das Datenangebot zur Nachnutzung zu motivieren. Es besteht noch enormer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen.
Das vorgeschlagene Lizenzmodell ist eine Insellösung!
Auch wenn das vorgeschlagene Lizenzmodell in seiner Einfachheit besser als das völlig unbrauchbare GeoLizenzen-Modell ist, erschwert es dennoch über die Maßen die Verbreitung, Weiternutzung und Verschränkung der Daten. Anstatt auf international etablierte offene Lizenzmodelle zurückzugreifen wird ein neues Modell “Marke Eigenbau” als Insellösung geschaffen, das für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgt. Dass entscheidende Begriffe wie “Quellenangabe” nicht bzw. nicht ausreichend definiert sind, hilft der Nachnutzung ebenfalls nicht."

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:26 - Rubrik: E-Government
Archiv, einfach nur so Spaß
Das Feuer war vorüber und uns're Liebe kalt, o-ho c'est la vie!
Nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas Halt, o-ho c'est la vie!
Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las und bei den Inseraten fand ich das:
Willst du gern einmal ins Archiv, einfach so, nur zum Spaß?
Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?
Dieses Leben nach Plan ist mies, willst du endlich mal raus?
Dann schreib' mir unter Kennwort. "Steig' mit mir aus!"
Ich hatte zwar versprochen, nur einer treu zu sein, o-ho c'est la vie!
Doch völlig zu versauern, das fiel mir auch nicht ein, o-ho c'est la vie!
Und dieses Inserat da versprach ein bißchen Glück.
So nahm ich ein Papier und schrieb zurück:
Ich will gern einmal ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!
Ich stöber gern mal in Akten, und schau alte Bilder mir an!
Dieses Leben nach Plan ist mies, ich will endlich mal raus!
Darum treff' ich dich morgen. "Steig mit mir aus!"
Am Bahnhof hab ich pünktlich nach ihr dann ausgeschaut, o-ho c'est la vie!
Da kam sie um die Ecke, sah mich und lachte laut, o-ho c'est la vie!
Und dieses helle Lachen, das ich kannte ich genau:
Vor mir stand nämlich meine eig'ne Frau.
Willst Du gern einmal ins Archiv, hab' ich staunend gefragt.
Daß du gern mal stöberst, hast du mir nie gesagt.
Dieses Leben nach Plan ist mies und jetzt stellt sich heraus:
Wir versteh'n uns noch immer!
Darum komm mit mir ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!
Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?
Dieses Leben nach Plan ist mies, du und ich wollen raus.
Wir versteh'n uns noch immer, steig mit mir aus!
nach "Paris, einfach so nur zum Spaß (Musik/Text: Udo Jürgens)
Das Feuer war vorüber und uns're Liebe kalt, o-ho c'est la vie!
Nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas Halt, o-ho c'est la vie!
Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las und bei den Inseraten fand ich das:
Willst du gern einmal ins Archiv, einfach so, nur zum Spaß?
Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?
Dieses Leben nach Plan ist mies, willst du endlich mal raus?
Dann schreib' mir unter Kennwort. "Steig' mit mir aus!"
Ich hatte zwar versprochen, nur einer treu zu sein, o-ho c'est la vie!
Doch völlig zu versauern, das fiel mir auch nicht ein, o-ho c'est la vie!
Und dieses Inserat da versprach ein bißchen Glück.
So nahm ich ein Papier und schrieb zurück:
Ich will gern einmal ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!
Ich stöber gern mal in Akten, und schau alte Bilder mir an!
Dieses Leben nach Plan ist mies, ich will endlich mal raus!
Darum treff' ich dich morgen. "Steig mit mir aus!"
Am Bahnhof hab ich pünktlich nach ihr dann ausgeschaut, o-ho c'est la vie!
Da kam sie um die Ecke, sah mich und lachte laut, o-ho c'est la vie!
Und dieses helle Lachen, das ich kannte ich genau:
Vor mir stand nämlich meine eig'ne Frau.
Willst Du gern einmal ins Archiv, hab' ich staunend gefragt.
Daß du gern mal stöberst, hast du mir nie gesagt.
Dieses Leben nach Plan ist mies und jetzt stellt sich heraus:
Wir versteh'n uns noch immer!
Darum komm mit mir ins Archiv einfach so, nur zum Spaß!
Stöberst gern mal in Akten, schaust alte Bilder dir an?
Dieses Leben nach Plan ist mies, du und ich wollen raus.
Wir versteh'n uns noch immer, steig mit mir aus!
nach "Paris, einfach so nur zum Spaß (Musik/Text: Udo Jürgens)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 7. Februar 2013, 11:39 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mein Text steht im Redaktionsblog von de.hypotheses.org:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/951
Update: Anton Tantners Replik im Merkur-Blog:
http://www.merkur-blog.de/2013/02/werdet-bloggerinnen-eine-replik-auf-valentin-groebner/
Beitrag von Conradin Knabenhans (Student in Luzern):
http://studunilu.ch/2013/02/07/groebner-blogs-vermitteln-das-gefuhl-rastloser-masturbation/
Ben Kaden
http://libreas.wordpress.com/2013/02/08/history-repeating-die-geschichtswissenschaft-debattiert-auch-2013-uber-die-legitimitat-des-bloggens/
Weitere Überlegungen von mir
http://archiv.twoday.net/stories/235553726/
Groebner nun auch online
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/wissenschaftliches-publizieren-muss-ich-das-lesen-12051418.html
Schmalenstroer
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ja-du-solltest-das-leseneine-antwort-auf-valentin-groebner/
http://rivva.de/186978681

http://redaktionsblog.hypotheses.org/951
Update: Anton Tantners Replik im Merkur-Blog:
http://www.merkur-blog.de/2013/02/werdet-bloggerinnen-eine-replik-auf-valentin-groebner/
Beitrag von Conradin Knabenhans (Student in Luzern):
http://studunilu.ch/2013/02/07/groebner-blogs-vermitteln-das-gefuhl-rastloser-masturbation/
Ben Kaden
http://libreas.wordpress.com/2013/02/08/history-repeating-die-geschichtswissenschaft-debattiert-auch-2013-uber-die-legitimitat-des-bloggens/
Weitere Überlegungen von mir
http://archiv.twoday.net/stories/235553726/
Groebner nun auch online
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/wissenschaftliches-publizieren-muss-ich-das-lesen-12051418.html
Schmalenstroer
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/ja-du-solltest-das-leseneine-antwort-auf-valentin-groebner/
http://rivva.de/186978681

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.unilu.ch/deu/prof._dr._valentin_groebner_115998.html
"Als elektronische pre-prints jetzt verfügbar:
(Die Texte sind provisorische Fassungen und für den Informationsaustausch im fair use-Modus bestimmt. Bitte nicht zitieren ohne vorherige Rücksprache.)"
Was in der Öffentlichkeit ist, ist in der Öffentlichkeit. Basta. Wer einen Gedanken auf einer Tagung zur Diskussion stellt, muss damit leben, dass er von anderen aufgenommen wird. Korrekterweise zitiert der rezipierende Wissenschaftler dann den Vortrag, eventuell auch den Tagungsbericht bei H-SOZ-U-KULT. Dass er gehalten wäre, um Erlaubnis zu fragen oder den womöglich leicht schmierigen Kollegen persönlich zu kontaktieren, ist keine Voraussetzung der Verwertung. Wieso sollte es bei Preprints anders sein?
Alles fremdes Gedankengut ist zu kennzeichnen, verlangen die Regeln der wissenschaftlichen Redlichkeit. Wenn die Preprints für eine wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, dann muss man sie auch zitieren, unabhängig davon, was der Autor dazu meint. Man kann ja nicht einfach so tun, als ob man sie nicht kennen würde, wenn sie entscheidend zum eigenen Erkenntnisprozess beigetragen haben. Zitate haben eine Nachweisfunktion und eine Service-Funktion. Bei der letzteren ist der Spielraum des Autors größer, aber auch hier gilt, dass Zitate geboten sind, wenn sie für den Leser hilfreich sind.
"Als elektronische pre-prints jetzt verfügbar:
(Die Texte sind provisorische Fassungen und für den Informationsaustausch im fair use-Modus bestimmt. Bitte nicht zitieren ohne vorherige Rücksprache.)"
Was in der Öffentlichkeit ist, ist in der Öffentlichkeit. Basta. Wer einen Gedanken auf einer Tagung zur Diskussion stellt, muss damit leben, dass er von anderen aufgenommen wird. Korrekterweise zitiert der rezipierende Wissenschaftler dann den Vortrag, eventuell auch den Tagungsbericht bei H-SOZ-U-KULT. Dass er gehalten wäre, um Erlaubnis zu fragen oder den womöglich leicht schmierigen Kollegen persönlich zu kontaktieren, ist keine Voraussetzung der Verwertung. Wieso sollte es bei Preprints anders sein?
Alles fremdes Gedankengut ist zu kennzeichnen, verlangen die Regeln der wissenschaftlichen Redlichkeit. Wenn die Preprints für eine wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, dann muss man sie auch zitieren, unabhängig davon, was der Autor dazu meint. Man kann ja nicht einfach so tun, als ob man sie nicht kennen würde, wenn sie entscheidend zum eigenen Erkenntnisprozess beigetragen haben. Zitate haben eine Nachweisfunktion und eine Service-Funktion. Bei der letzteren ist der Spielraum des Autors größer, aber auch hier gilt, dass Zitate geboten sind, wenn sie für den Leser hilfreich sind.
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 21:37 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/praxisregeln_digitalisierung_2013.pdf
Ich komme darauf noch zurück.
Ich komme darauf noch zurück.
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wenn Hanna Albers sich in historische Dokumente wie diese vertieft, verbinden sich Interesse und Beruf: Die Archivarin der Gemeinde Swisttal ist die Herrin über eine Fülle von Schriften und Bildern, genauer gesagt über 265 laufende Regalmeter Archivakten.
Und da liegt das Problem: Es bleiben ihr nur noch 85 freie Regalmeter, ehe sie vom unausweichlich nachrückenden Material erdrückt zu werden droht. Das Archiv der Gemeinde, das seit 2000 im Erdgeschoss des alten Pfarrhauses beheimatet ist, platzt aus allen Nähten"
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/swisttal/Archiv-der-Gemeinde-Swisttal-stoesst-an-seine-Kapazitaetsgrenzen-article966589.html
Danke an SOvH.
Und da liegt das Problem: Es bleiben ihr nur noch 85 freie Regalmeter, ehe sie vom unausweichlich nachrückenden Material erdrückt zu werden droht. Das Archiv der Gemeinde, das seit 2000 im Erdgeschoss des alten Pfarrhauses beheimatet ist, platzt aus allen Nähten"
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/swisttal/Archiv-der-Gemeinde-Swisttal-stoesst-an-seine-Kapazitaetsgrenzen-article966589.html
Danke an SOvH.
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:20 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die TU Braunschweig digitalisiert die Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Im Jahrgang 2010 erschien ein kurzer Aufsatz von Niklot Klüßendorf, der leider nur eine Zusammenfassung eines anderweitig publizierten Aufsatzes darstellt:
"Die angeführten Beispiele und weitere Fälle sind näher belegt in dem in Druck befindlichen Vortragsband der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen zu ihrer
2005 in Konstanz veranstalteten Tagung: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts“, Teil II: Vorträge, hrsg. von HARALD R. DERSCHKA, SUZANNE FREY-KUPPER und
REINER CUNZ (Études de numismatique et d’histoire monétaire 7), Lausanne 2010, darin
NIKLOT KLÜSSENDORF und SIEGFRIED BECKER: Notgroschen und sagenhafte Schätze – Fundnumismatik und Volkskunde"
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048999
#numismatik
"Die angeführten Beispiele und weitere Fälle sind näher belegt in dem in Druck befindlichen Vortragsband der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen zu ihrer
2005 in Konstanz veranstalteten Tagung: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts“, Teil II: Vorträge, hrsg. von HARALD R. DERSCHKA, SUZANNE FREY-KUPPER und
REINER CUNZ (Études de numismatique et d’histoire monétaire 7), Lausanne 2010, darin
NIKLOT KLÜSSENDORF und SIEGFRIED BECKER: Notgroschen und sagenhafte Schätze – Fundnumismatik und Volkskunde"
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00048999
#numismatik
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 19:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eines meiner Lieblingsblogs hat eine sehr nette Würdigung von Archivalia geschrieben:
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/archivalia-wird-10/
Danke auch für die anderen Glückwünsche und Hilfsangebote!
http://schmalenstroer.net/blog/2013/02/archivalia-wird-10/
Danke auch für die anderen Glückwünsche und Hilfsangebote!
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 19:54 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr (Lesesaal, Stadtarchiv Speyer); Ausnahme: 20. Februar.
20.02.: „Vom Altar aus versöhnen“ -Speyerer Initiativen zur deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg
Prof. Dr. Michael Kissener (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
Der Vortrag findet im Historischen Ratssaal statt. Wir bitten um Voranmeldung bis 18.02.2013
06.03.: Vom Bürger-Arbeitskreis bis zur Internet-Präsenz. Die lange Geschichte des Forschungsprojekts „Die Wormser Juden 1933 bis 1945“ von Karl und Annelore Schlösser
Dr. Hermann Schlösser (Redakteur der „Wiener Zeitung“), Dr. Susanne Schlösser (Mannheim)
24.04.: Der Dichter Alexander von Bernus (1880-1965) und Speyer
Dr. Hans Bümlein (Oberkirchenrat i.R., Speyer)
15.05.: Konfessionelles Zusammenleben im Speyer des 16. Jahrhunderts
Diplom-Theologin Daniela Blum (Tübingen)
21.08.: Ein Mordanschlag in Speyer 1631? Konflikte zwischen Wormser Juden im Dreißigjährigen Krieg
Dr. Ursula Reuter (Köln)
18.09.: Speyer und seine Rheinübergänge einst und jetzt
Rudi Höhl (Speyer)
23.10.: Rechenkünstler und Büchersammler. Dem Speyerer Domherren Nicolaus Matz zum 500. Todestag
Dr. Lenelotte Möller (Speyer)
13.11.: Sep Rufs Bau für die Universität Speyer. Planung, Bau und Bedeutung
Prof. Dr. Stefan Fisch (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer)
20.02.: „Vom Altar aus versöhnen“ -Speyerer Initiativen zur deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg
Prof. Dr. Michael Kissener (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
Der Vortrag findet im Historischen Ratssaal statt. Wir bitten um Voranmeldung bis 18.02.2013
06.03.: Vom Bürger-Arbeitskreis bis zur Internet-Präsenz. Die lange Geschichte des Forschungsprojekts „Die Wormser Juden 1933 bis 1945“ von Karl und Annelore Schlösser
Dr. Hermann Schlösser (Redakteur der „Wiener Zeitung“), Dr. Susanne Schlösser (Mannheim)
24.04.: Der Dichter Alexander von Bernus (1880-1965) und Speyer
Dr. Hans Bümlein (Oberkirchenrat i.R., Speyer)
15.05.: Konfessionelles Zusammenleben im Speyer des 16. Jahrhunderts
Diplom-Theologin Daniela Blum (Tübingen)
21.08.: Ein Mordanschlag in Speyer 1631? Konflikte zwischen Wormser Juden im Dreißigjährigen Krieg
Dr. Ursula Reuter (Köln)
18.09.: Speyer und seine Rheinübergänge einst und jetzt
Rudi Höhl (Speyer)
23.10.: Rechenkünstler und Büchersammler. Dem Speyerer Domherren Nicolaus Matz zum 500. Todestag
Dr. Lenelotte Möller (Speyer)
13.11.: Sep Rufs Bau für die Universität Speyer. Planung, Bau und Bedeutung
Prof. Dr. Stefan Fisch (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer)
J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:53 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jahresbericht 2012 online:
J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:37 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB) hat die größte noch in Privatbesitz befindliche Sammlung von Briefen des Göttinger Gelehrten Georg Christoph Lichtenberg erworben: Ende 2012 erstand sie 27 Briefe des Naturwissenschaftlers, die der Darmstädter Buchhändler und Antiquar Ludwig Saeng (1877 bis 1967) neben Sammlungen von Briefen anderer Wissenschaftler und Dichter zusammengetragen hatte. Die Briefe in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro ergänzen die Sammlung von Lichtenberg-Handschriften der SUB, die als die weltweit größte Sammlung ihrer Art gilt.
http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=4382
Grüße
J. Paul
http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=4382
Grüße
J. Paul
J. Paul - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 12:21 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserlautern, veranstaltet 2013 zusammen mit dem Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg und der Stadt und dem Bistum Speyer ein interdisziplinäres Klostersymposium, um den fachlichen, aber auch den Blick eines interessierten Publikums auf ein bisher wenig beachtetes, aber sehr vielfältiges Thema der pfälzischen Geschichte zu lenken.
Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.
Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.
Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:
„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“
Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte
Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•
Termin: 8. – 9. März 2013
•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer
•Veranstalter:
◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern
◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg
◦Stadt Speyer
◦Bistumsarchiv Speyer
•Tagungsleitung:
◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern
◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer
◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer
◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg
Programm
Freitag, 8. März 2013
15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster
Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang
Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer
17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer
Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer
18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte
Hansjörg Eger
Oberbürgermeister der Stadt Speyer
Roland Paul
Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde
Dr. Joachim Kemper
Stadtarchiv Speyer
18.30 Festvortrag
Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg
Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit
anschließend Umtrunk
Samstag, 9. März 2013
09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern
Eröffnung, Begrüßung und Moderation
09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer
Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen
10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern
Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert
11.10 Kaffee-Pause
11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer
Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation
12.30 MITTAGSPAUSE
14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer
Einführung und Moderation
14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg
Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter
15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier
Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit
16.10 Kaffee-Pause
16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim
Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach
17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper
Resümee
17.40 Tagungsende
Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.
Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.
Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:
„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“
Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte
Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•
Termin: 8. – 9. März 2013
•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer
•Veranstalter:
◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern
◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg
◦Stadt Speyer
◦Bistumsarchiv Speyer
•Tagungsleitung:
◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern
◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer
◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer
◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg
Programm
Freitag, 8. März 2013
15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster
Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang
Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer
17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer
Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer
18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte
Hansjörg Eger
Oberbürgermeister der Stadt Speyer
Roland Paul
Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde
Dr. Joachim Kemper
Stadtarchiv Speyer
18.30 Festvortrag
Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg
Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit
anschließend Umtrunk
Samstag, 9. März 2013
09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern
Eröffnung, Begrüßung und Moderation
09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer
Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen
10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern
Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert
11.10 Kaffee-Pause
11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer
Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation
12.30 MITTAGSPAUSE
14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer
Einführung und Moderation
14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg
Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter
15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier
Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit
16.10 Kaffee-Pause
16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim
Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach
17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper
Resümee
17.40 Tagungsende
J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 09:23 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nichts krönt das zehnjährige Jubiläum von Archivalia mehr als die höchst erfreuliche Nachricht, dass der Düsseldorfer Fakultätsrat der Wissenschaftsministerin den Doktortitel entzogen hat.
Die Promotionsleistung sei für ungültig erklärt worden, sagte der Ratsvorsitzende Prof. Bruno Bleckmann. Für den Entzug des Doktorgrades hätten zwölf Mitglieder des Rats der Philosophischen Fakultät gestimmt. Außerdem gab es zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der Rat sieht es als erwiesen an, dass Schavan "systematisch und vorsätzlich" gedankliche Leistungen vorgegeben habe, die sie nicht selbst erbracht habe.
Die Anwälte von Schavan kündigten daraufhin an, Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen.
http://www.n-tv.de/politik/Annette-Schavan-verliert-Doktortitel-article10076861.html
Auszug aus der Düsseldorfer Presseerklärung:
Der Fakultätsrat hat sich nach dieser grundsätzlichen Klärung in seinen Beratungen nach gründlicher Prüfung und Diskussion abschließend die Bewertung des Promotionsausschusses zu eigen gemacht, dass in der Dissertation von Frau Schavan in bedeutendem Umfang nicht gekennzeichnete wörtliche Übernahmen fremder Texte zu finden sind. Die Häufung und Konstruktion dieser wörtlichen Übernahmen, auch die Nichterwähnung von Literaturtiteln in Fußnoten oder sogar im Literaturverzeichnis ergeben der Überzeugung des Fakultätsrats nach das Gesamtbild, dass die damalige Doktorandin systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte.
http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/aktuelle-sitzung-des-fakultaetsrats-der-philosophischen-fakultaet-und-presseerklaerung-vom-0502.html
http://archiv.twoday.net/search?q=schavan
Seit 2008 hat Archivalia in der Rubrik Wissenschaftsbetrieb gut 250 Beiträge publiziert. Ein Schwerpunkt waren Plagiate.
http://archiv.twoday.net/topics/Wissenschaftsbetrieb/?start=250
Auf Platz 8 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge liegt derzeit ein Beitrag zu Guttenberg:
http://archiv.twoday.net/stories/14638009/
Update: Interview mit Plagiatsjäger Stefan Weber
http://www.tagesschau.de/inland/schavan-interview100.html

Die Promotionsleistung sei für ungültig erklärt worden, sagte der Ratsvorsitzende Prof. Bruno Bleckmann. Für den Entzug des Doktorgrades hätten zwölf Mitglieder des Rats der Philosophischen Fakultät gestimmt. Außerdem gab es zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der Rat sieht es als erwiesen an, dass Schavan "systematisch und vorsätzlich" gedankliche Leistungen vorgegeben habe, die sie nicht selbst erbracht habe.
Die Anwälte von Schavan kündigten daraufhin an, Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen.
http://www.n-tv.de/politik/Annette-Schavan-verliert-Doktortitel-article10076861.html
Auszug aus der Düsseldorfer Presseerklärung:
Der Fakultätsrat hat sich nach dieser grundsätzlichen Klärung in seinen Beratungen nach gründlicher Prüfung und Diskussion abschließend die Bewertung des Promotionsausschusses zu eigen gemacht, dass in der Dissertation von Frau Schavan in bedeutendem Umfang nicht gekennzeichnete wörtliche Übernahmen fremder Texte zu finden sind. Die Häufung und Konstruktion dieser wörtlichen Übernahmen, auch die Nichterwähnung von Literaturtiteln in Fußnoten oder sogar im Literaturverzeichnis ergeben der Überzeugung des Fakultätsrats nach das Gesamtbild, dass die damalige Doktorandin systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte.
http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite/news-detailansicht/article/aktuelle-sitzung-des-fakultaetsrats-der-philosophischen-fakultaet-und-presseerklaerung-vom-0502.html
http://archiv.twoday.net/search?q=schavan
Seit 2008 hat Archivalia in der Rubrik Wissenschaftsbetrieb gut 250 Beiträge publiziert. Ein Schwerpunkt waren Plagiate.
http://archiv.twoday.net/topics/Wissenschaftsbetrieb/?start=250
Auf Platz 8 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge liegt derzeit ein Beitrag zu Guttenberg:
http://archiv.twoday.net/stories/14638009/
Update: Interview mit Plagiatsjäger Stefan Weber
http://www.tagesschau.de/inland/schavan-interview100.html

KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 22:24 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Nun online:
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gothein/gothein_index.html
Die Digitalisierung hatte ich dort vor Jahren angeregt, wenn ich mich recht entsinne.
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gothein/gothein_index.html
Die Digitalisierung hatte ich dort vor Jahren angeregt, wenn ich mich recht entsinne.
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 20:01 - Rubrik: Landesgeschichte
Die zehn erschienen Bände sind erfreulicherweise online:
http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/osiander.de.html
http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/osiander.de.html
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://vzg-easydb.gbv.de/pool/4
"Die Sammlung enthält den digitalisierten Glasnegativ-Bestand des Ateliers Zirkler. Es enthält hauptsächlich Personenporträt- und Gebäudefotografie. Regionsspezifisch sind dabei vor allem Aufnahmen in den Harzer Bergwerken unter Tage. Die Fotografien aus dem Hochschularchiv zeigen hauptsächlich Innen- und Außenaufnahmen der Institute der Hochschule." (DBIS)
Und natürlich das übliche Copyfraud: Die Bildrechte liegen bei der TU, wird behauptet. Aber der Gründer des Ateliers wurde 1827 geboren, und bei späteren Fotografen müsste nachgewiesen werden, dass sie noch keine 70 Jahre tot sind.
 Foto von 1892
Foto von 1892
"Die Sammlung enthält den digitalisierten Glasnegativ-Bestand des Ateliers Zirkler. Es enthält hauptsächlich Personenporträt- und Gebäudefotografie. Regionsspezifisch sind dabei vor allem Aufnahmen in den Harzer Bergwerken unter Tage. Die Fotografien aus dem Hochschularchiv zeigen hauptsächlich Innen- und Außenaufnahmen der Institute der Hochschule." (DBIS)
Und natürlich das übliche Copyfraud: Die Bildrechte liegen bei der TU, wird behauptet. Aber der Gründer des Ateliers wurde 1827 geboren, und bei späteren Fotografen müsste nachgewiesen werden, dass sie noch keine 70 Jahre tot sind.
 Foto von 1892
Foto von 1892KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:25 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.haw.uni-heidelberg.de/publikationen/publikationen.de.html
Ganz wenige Schriften - vor allem Naturwissenschaftliches aus der Zeit um 1910 - stehen als PDFs zur Verfügung.
Ganz wenige Schriften - vor allem Naturwissenschaftliches aus der Zeit um 1910 - stehen als PDFs zur Verfügung.
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:22 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Heidelberger Editionsprojekt hat wenigstens die Regesten frei online zugänglich gemacht:
http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/melanchthon/mbw-online.de.html
http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/melanchthon/mbw-online.de.html
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 19:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.museum-digital.de/westfalen/
Via
http://www.kulturkontakt-westfalen.de/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=190&cHash=d7086728dd4816ee73e445fab61d1367
 Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.
Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.
Via
http://www.kulturkontakt-westfalen.de/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=190&cHash=d7086728dd4816ee73e445fab61d1367
 Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.
Die meisten Objekte steuerte das Heimatmuseum Marsberg bei.KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 18:53 - Rubrik: Museumswesen
Unter den bislang drei Digitalisaten des Christ College in Cambridge ist auch ein handschriftliches Stundenbuch aus Nantes von ca. 1430/40 online:
http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/library_info/old_library/explore/
http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/library_info/old_library/explore/
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 18:12 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://umstrittenesgedaechtnis.hypotheses.org/132
"Über die letzten 10 Jahre haben zwei Männer (46, 53 Jahre) insgesamt zwei Regalmeter Archivbestände aus dem Rigsarkivet, dem Kopenhagener Landsarkivet und dem Archiv des Ordenswesen im Schloss Amalienborg gestohlen. Der Raub fiel erstmals im Oktober 2012 auf. Bei ihren vielen Besuchen gaben die bekennenden Nazi-Sympathisanten sich als Forscher mit einem dezidierten Interesse an dänischen Kollaborateure aus. "
Siehe auch
http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1316
"Über die letzten 10 Jahre haben zwei Männer (46, 53 Jahre) insgesamt zwei Regalmeter Archivbestände aus dem Rigsarkivet, dem Kopenhagener Landsarkivet und dem Archiv des Ordenswesen im Schloss Amalienborg gestohlen. Der Raub fiel erstmals im Oktober 2012 auf. Bei ihren vielen Besuchen gaben die bekennenden Nazi-Sympathisanten sich als Forscher mit einem dezidierten Interesse an dänischen Kollaborateure aus. "
Siehe auch
http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1316
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 17:38 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine historistische Schöpfung im Stil des 17. Jahrhunderts wurde angeboten von:
http://www.hermann-historica.de/auktion/hhm56.pl?f=NR&c=72838&t=temartic_P_D&db=kat56_p.txt
Den Hinweis verdanke ich PhiloBiblos, dessen wöchentliche Links für am alten Buch Interessierte unverzichtbar sind:
http://philobiblos.blogspot.de/2013/02/links-reviews.html?m=1
http://www.hermann-historica.de/auktion/hhm56.pl?f=NR&c=72838&t=temartic_P_D&db=kat56_p.txt
Den Hinweis verdanke ich PhiloBiblos, dessen wöchentliche Links für am alten Buch Interessierte unverzichtbar sind:
http://philobiblos.blogspot.de/2013/02/links-reviews.html?m=1
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 17:18 - Rubrik: Unterhaltung
http://glossae.hypotheses.org/
Es bloggt Otto Vervaart:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/04/blogging-about-medieval-glosses/
Es wäre ein Wunder, wenn ich nicht etwas Interessantes aus einem Beitrag von Otto lernen würde. Unter den Links auf der rechten Seite befindet sich ein mir noch nicht bekanntes Portal zu Digitalisaten (bislang 8 an der Zahl) frühneuzeitlicher annotierter Drucke:
http://www.annotatedbooksonline.com/

Es bloggt Otto Vervaart:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2013/02/04/blogging-about-medieval-glosses/
Es wäre ein Wunder, wenn ich nicht etwas Interessantes aus einem Beitrag von Otto lernen würde. Unter den Links auf der rechten Seite befindet sich ein mir noch nicht bekanntes Portal zu Digitalisaten (bislang 8 an der Zahl) frühneuzeitlicher annotierter Drucke:
http://www.annotatedbooksonline.com/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Zähler steht gerade auf 23663 Einträgen. Am 5. Februar 2003 eröffnete ich dieses Weblog als Gemeinschaftsblog mit Nachrichten rund um das Archivwesen. Mein Dank gilt allen Beiträgern (an erster Stelle ist Thomas Wolf zu nennen) und Kommentatoren, die dafür gesorgt haben, dass mich nie die Lust verließ, Neues und mir Wichtiges hier zu publizieren. Danke für die Glückwünsche aus der Blogosphäre und dem Social Web, danke auch an alle, die Archivalia verlinkt oder zitiert haben.
Archivalia hat sich ein beachtliches Renommé erarbeitet. Zur Resonanz siehe auch
http://archiv.twoday.net/topics/Allgemeines/
Ich möchte einige Punkte herausgreifen, die Archivalia aus meiner Sicht auszeichnen.
* Archivalia ist ein Schaufenster des Archivwesens
Archivalia bringt das Archivwesen in die Blogosphäre ein und vermittelt Archivisches auch über Suchmaschinen an ein großes Publikum.
* Archivalia wirbt für Web 2.0 im Archivwesen
Auch wenn der Rückstand bedenklich ist - Archivalia, hat einiges dafür getan, Web 2.0 im Archivwesen besser zu verankern. Uns freut das Lob des Siwiarchivs:
http://www.siwiarchiv.de/2013/02/10-jahre-archivalia/
* Archivalia schaut gern über den Tellerrand
Das betrifft die Einbindung in die bibliothekarische Blogosphäre, aber auch die ständige Berücksichtigung von Meldungen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Von Anfang an gab es eine "English Corner" mit englischsprachigen Meldungen.
* Archivalia setzt sich für Kulturgutschutz ein
Zuletzt hat die Causa Stralsund deutlich gemacht, was ein Blog (im Verbund mit anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und des Web 2.0) erreichen kann. Aber auch schon die intensive Berichterstattung zum Karlsruher Kulturgüterstreit dürfte Archivalia viele Leser gewonnen haben.
http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/
* Archivalia kämpft für Open Access und freie Inhalte, gegen Copyfraud
Hier ist im Archivwesen noch viel zu tun.
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
* Archivalia versteht sich als Wissenschaftsblog
Archivalia vermittelt nicht nur Wissenschaft, sondern liefert auch eigene Forschungsbeiträge (bislang über 140) und veröffentlicht Buchrezensionen (über 50 bisher).
* Archivalia findet das Recht zu wichtig, um es den Juristen zu überlassen
Archivalia setzt sich beispielsweise für ein anderes Urheberrecht ein. Die Rubrik "Archivrecht"
http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/
kann auch bei Jurablogs gelesen werden (derzeit auf Platz 90 des dortigen Rankings).
* Archivalia orientiert in Sachen Informationskompetenz
Es bietet nicht nur hilfreiche Linksammlungen, sondern immer wieder auch Tipps und Tricks für die Internetrecherche sowie News zu digitalen Sammlungen.
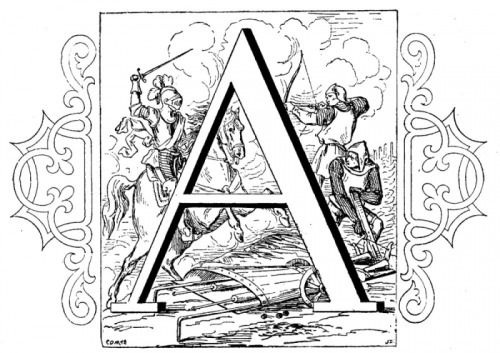
Soweit der Jubelteil. Ich habe vor weiterzumachen. Wie bisher. Auch wenn ich im Januar viel viel mehr Beiträge veröffentlicht habe als Schmalenstroer (der schrieb 13) und Archivalia als "unübersichtlich" empfunden wird und vor kurzem vom VG Greifswald einen tüchtigen und recht kostenträchtigen Tritt vors Schienbein bekam.
Weshalb ich mit Angst in die Zukunft schaue und mich kaum freuen kann liegt aber an etwas anderem. Es ist absehbar, dass Archivalia von Twoday weg muss. Was im November war, kann jederzeit wieder passieren. Heute "erfreute" mich Twoday damit, dass die von Thomas Wolf eingestellte Nachricht zum Jubiläum nicht auf der Startseite sichtbar war. Twoday ist ein veraltetes System mit schlechtem Service, wobei ich es aufgrund eines Sonderangebots von Anfang an kostenlos nutze.
Gern würde ich zu hypotheses.org wechseln, wo ich willkommen wäre. Aber das Problem ist der Import der Beiträge und ihre Vernetzung in der bisherigen Weise.
Obwohl ich als SACHAV-Programmierer vor ca. 20 Jahren durchaus eine gewisse technische Kompetenz besaß, HASSE ich es, am Blog rumzuschrauben. Daher sieht es bis heute so aus wie am ersten Tag. Es funktionierte bisher im wesentlichen so, dass es für mich den Zweck erfüllte. Die Suchfunktion ist gut. Obwohl ich gern einen Zähler hätte, habe ich es nie geschafft, einen dauerhaft zu installieren. Ich hasse es auch, andere anzubetteln, ob sie mir helfen können.
Schon der Export des Blogs, wie er bei Twoday vorgesehen ist, bedeutet aufgrund des mangelnden Entgegenkommens von Twoday, dass sich meine Konditionen verschlechtern. Da ich zu viel Platz belege, um eine Exportdatei erstellen zu können, muss ich zeitweilig auf einen Premium-Account gehen, und nach der Rückkehr wären meine alten Konditionen hinfällig. Dass der Import der Beiträge bei hypotheses.org klappt, kann mir niemand garantieren.
Schlimmer noch: Da ich sehr viel Wert auf Querverweise lege, sehe ich nicht, wie ohne nennenswerten Programmieraufwand die alten Links - auch auf die Suchfunktion - funktionsfähig gehalten werden könnten.
Archivalia als einzigartiges Informationssystem wäre gleichsam enthauptet, würde ich bei hypotheses.org ganz neu beginnen und dort Links auf die tunlichst beizubehaltende Archivalia-Präsenz setzen. Aber damit wäre die von hypotheses.org zugesicherte dauerhafte Verfügbarkeit des Blogs für die Alteinträge verspielt, und wie lange Twoday.net im Netz sein wird, weiß niemand.
Archivalia hat sich ein beachtliches Renommé erarbeitet. Zur Resonanz siehe auch
http://archiv.twoday.net/topics/Allgemeines/
Ich möchte einige Punkte herausgreifen, die Archivalia aus meiner Sicht auszeichnen.
* Archivalia ist ein Schaufenster des Archivwesens
Archivalia bringt das Archivwesen in die Blogosphäre ein und vermittelt Archivisches auch über Suchmaschinen an ein großes Publikum.
* Archivalia wirbt für Web 2.0 im Archivwesen
Auch wenn der Rückstand bedenklich ist - Archivalia, hat einiges dafür getan, Web 2.0 im Archivwesen besser zu verankern. Uns freut das Lob des Siwiarchivs:
http://www.siwiarchiv.de/2013/02/10-jahre-archivalia/
* Archivalia schaut gern über den Tellerrand
Das betrifft die Einbindung in die bibliothekarische Blogosphäre, aber auch die ständige Berücksichtigung von Meldungen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Von Anfang an gab es eine "English Corner" mit englischsprachigen Meldungen.
* Archivalia setzt sich für Kulturgutschutz ein
Zuletzt hat die Causa Stralsund deutlich gemacht, was ein Blog (im Verbund mit anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und des Web 2.0) erreichen kann. Aber auch schon die intensive Berichterstattung zum Karlsruher Kulturgüterstreit dürfte Archivalia viele Leser gewonnen haben.
http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/
* Archivalia kämpft für Open Access und freie Inhalte, gegen Copyfraud
Hier ist im Archivwesen noch viel zu tun.
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
* Archivalia versteht sich als Wissenschaftsblog
Archivalia vermittelt nicht nur Wissenschaft, sondern liefert auch eigene Forschungsbeiträge (bislang über 140) und veröffentlicht Buchrezensionen (über 50 bisher).
* Archivalia findet das Recht zu wichtig, um es den Juristen zu überlassen
Archivalia setzt sich beispielsweise für ein anderes Urheberrecht ein. Die Rubrik "Archivrecht"
http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/
kann auch bei Jurablogs gelesen werden (derzeit auf Platz 90 des dortigen Rankings).
* Archivalia orientiert in Sachen Informationskompetenz
Es bietet nicht nur hilfreiche Linksammlungen, sondern immer wieder auch Tipps und Tricks für die Internetrecherche sowie News zu digitalen Sammlungen.
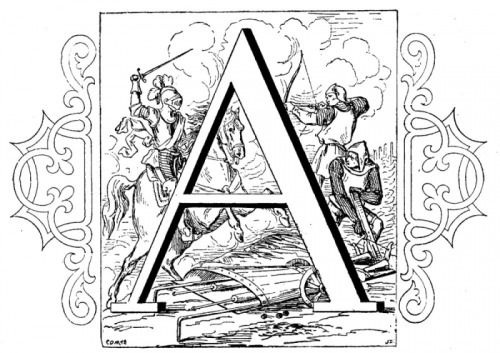
Soweit der Jubelteil. Ich habe vor weiterzumachen. Wie bisher. Auch wenn ich im Januar viel viel mehr Beiträge veröffentlicht habe als Schmalenstroer (der schrieb 13) und Archivalia als "unübersichtlich" empfunden wird und vor kurzem vom VG Greifswald einen tüchtigen und recht kostenträchtigen Tritt vors Schienbein bekam.
Weshalb ich mit Angst in die Zukunft schaue und mich kaum freuen kann liegt aber an etwas anderem. Es ist absehbar, dass Archivalia von Twoday weg muss. Was im November war, kann jederzeit wieder passieren. Heute "erfreute" mich Twoday damit, dass die von Thomas Wolf eingestellte Nachricht zum Jubiläum nicht auf der Startseite sichtbar war. Twoday ist ein veraltetes System mit schlechtem Service, wobei ich es aufgrund eines Sonderangebots von Anfang an kostenlos nutze.
Gern würde ich zu hypotheses.org wechseln, wo ich willkommen wäre. Aber das Problem ist der Import der Beiträge und ihre Vernetzung in der bisherigen Weise.
Obwohl ich als SACHAV-Programmierer vor ca. 20 Jahren durchaus eine gewisse technische Kompetenz besaß, HASSE ich es, am Blog rumzuschrauben. Daher sieht es bis heute so aus wie am ersten Tag. Es funktionierte bisher im wesentlichen so, dass es für mich den Zweck erfüllte. Die Suchfunktion ist gut. Obwohl ich gern einen Zähler hätte, habe ich es nie geschafft, einen dauerhaft zu installieren. Ich hasse es auch, andere anzubetteln, ob sie mir helfen können.
Schon der Export des Blogs, wie er bei Twoday vorgesehen ist, bedeutet aufgrund des mangelnden Entgegenkommens von Twoday, dass sich meine Konditionen verschlechtern. Da ich zu viel Platz belege, um eine Exportdatei erstellen zu können, muss ich zeitweilig auf einen Premium-Account gehen, und nach der Rückkehr wären meine alten Konditionen hinfällig. Dass der Import der Beiträge bei hypotheses.org klappt, kann mir niemand garantieren.
Schlimmer noch: Da ich sehr viel Wert auf Querverweise lege, sehe ich nicht, wie ohne nennenswerten Programmieraufwand die alten Links - auch auf die Suchfunktion - funktionsfähig gehalten werden könnten.
Archivalia als einzigartiges Informationssystem wäre gleichsam enthauptet, würde ich bei hypotheses.org ganz neu beginnen und dort Links auf die tunlichst beizubehaltende Archivalia-Präsenz setzen. Aber damit wäre die von hypotheses.org zugesicherte dauerhafte Verfügbarkeit des Blogs für die Alteinträge verspielt, und wie lange Twoday.net im Netz sein wird, weiß niemand.
KlausGraf - am Dienstag, 5. Februar 2013, 15:31 - Rubrik: Allgemeines

Archivalia veröffentlichte vor 10 (!) Jahren seinen ersten Eintrag. Mein Dank gilt Kollegen Graf für die hier gemachten Erfahrungen. Ohne Archivalia, kein siwiarchiv. Der Mutter der (bundes)deutschen, archivischen Web 2.0 Gemeinde gilt daher der Wunsch: ad multos annos!
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Februar 2013, 03:24 - Rubrik: Web 2.0
