Alles was ich habe #1 (2010) from Herbordt/ Mohren on Vimeo.
"„Alles was ich habe“ ist ein langfristiges, künstlerisches Rechercheprojekt zu Entwürfen und Visionen künftiger Gemeinschaftsformen. In Formaten zwischen Theater, Ausstellung und Gespräch, unter Anwendung unterschiedlicher performativer und diskursiver Strategien werden (Zwischen-) Ergebnisse präsentiert, fortgeschrieben und transformiert:„Alles was ich habe #1“, Stand 11.06.2010: 170 Fragen an eine unbestimmte Zukunft; 892 archivierte Antworten aus Filmen, Kunstwerken, Netzrecherchen und Expertengesprächen; diverse Gebrauchsgegenstände, Objekte und vergessene Memorabilia; ein Performance Tool als Archiv, mobile Forschungseinheit, Ausstellungsarchitektur und Bühne; 10 Höhenschnitte durch das Archiv als Karten und Landschaften einer kommenden Welt; Modelle für ein anderes Zusammenleben; ein Radio, das ununterbrochen läuft; ein 8,31 minütiger Lichtwechsel; drei Tonspuren als vorübergehende Antworten auf die Fragen: Worum geht es?, Wie schwer ist aller Anfang? und Brauchen wir eine neue Erzählung? ...
„Alles was ich habe #1“ ist alles was wir haben, um in den letzten 8 Minuten 31 Sekunden der uns bekannten Welt, eine andere zu kreieren. „Alles was ich habe #1“ ist alles was wir brauchen, um zu erfinden, was wir nicht sehen können, unsere Vorstellungen wahr werden zu lassen oder Raum für eine andere Zukunft zu öffnen. „Alles was ich habe #1“ ist das begehbare Archiv künftiger Gegenwarten - ohne weitere Darsteller wird der Zuschauer zum Zentrum einer inszenierten Ausstellung.
„Wir befinden uns in einer jener vielschichtig durchdachten, theatralischen Installationen des Performerduos Bernhard Herbordt und Melanie Mohren, die in Gestalt eines labyrinthischen Archivs aus Textzetteln, Stimmen und Ding-Kollagen nichts weniger darstellt als eine Grundinventur des Lebens schlechthin.“ Doris Meierhenrich, Berliner Zeitung, 14.06.2010
Konzept, Archiv, Ton: Bernhard Herbordt und Melanie Mohren
Performance Tool, Raum: Hannes Hartmann und Leonie Mohr
Sprecher: Max Landgrebe
Mitarbeit Bau: Stefan Pernthaller
Technik: Fabian Lehmann und Norman Duncan Thörel
Produktion: Herbordt/ Mohren in Koproduktion mit den Sophiensaelen Berlin und der Akademie Schloss Solitude Stuttgart. Mit freundlicher Unterstützung Aktion Kulturallianzen und Allianz Generalvertretung Kothe & Christ Berlin-Mitte, Akademie der Künste, Staatstheater Stuttgart. Mit besonderem Dank an René Liebert
Eröffnung am 11.06.2010, Sophiensaele Berlin
http://www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=770"
Alles was ich habe #2: Dear Visitor (2010) from Herbordt/ Mohren on Vimeo.
"Die zweite Episode von „Alles was ich habe“ arrangiert sämtliche Archivmaterialien zu einer begehbaren Installation. Als letzter verbliebener Protagonist, durchstreift der Zuschauer das Modell einer Welt, die es erst noch zu formulieren gilt. Zwischen Fragen, Objekten und Zetteln, zwischen Audio-Führungen und hinterlassenen Nachrichten, entspinnen sich immer neue Dialoge – stumme Gespräche darüber, wie es mit der Welt wie wir sie kannten auch weitergehen könnte.Das gesamte Archivmaterial findet sich sortiert, nach Fragen kategorisiert und inventarisiert in einem Ausstellungsaufbau bestehend aus: zwei leeren Europaletten, einem Panorama aus Worten, unzähligen Listen (die vorgeben, den Inhalt eines Archivs zu verzeichnen), ein „Alles was ich habe #2: Dear Visitor“ genannter Kurzfilmessay, ein mit „Dear Visitor“ adressierter Briefumschlag, ein Besucher (der dann alleine weitergeht...). Im nächsten Raum findet sich eine Auswahl an Fragen und was nach dieser Auswahl übrigbleibt: wie es weiter gehen, was kommen könnte; wo wir uns treffen oder versammeln würden; wer dann spräche; wie und woraus Welten entstünden; wer zuhörte und ob wir nicht doch alleine wären.
„Alles was ich habe #2: Dear Visitor“ gibt Raum und Zeit für eine letzte Inventur von dem, was wir für die Realität halten – gezimmert aus über einem Kilometer gehobelter Dachlatten, 170 Fragen, diversen Objekten, 957 Zetteln, 75 Metern Inventarlisten und drei Tonspuren.
Konzept, Archiv, Text, Ton: Bernhard Herbordt und Melanie Mohren
Performance Tool, Raum: Hannes Hartmann und Leonie Mohr
Produktion von Herbordt/ Mohren in Koproduktion mit der Akademie Schloss Solitude Stuttgart
Mit freundlicher Unterstützung durch die LBBW Stiftungen der Landesbank Baden-Württemberg
Mit herzlichem Dank den Mitarbeitern der Akademie Schloss Solitude, des Württembergischen Kunstvereins, Nadine Jäger, Konstantin Lom, Robert Gärtner, Viola van Beek, Christian Porstner und dem Schauspiel Staatstheater Stuttgart
Eröffnung am 28.09.2010, Württembergischer Kunstverein Stuttgart
http://www.wkv-stuttgart.de/programm/2010/veranstaltungen/performancereihe/
akademie-solitude.de/"
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 18:21 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Regionaal Archief Tilburg, 3.12.2010 20:00 (Quelle: RA TIlburg)

Österreichisches Staatsarchiv Wien, 3.12.2010 (Quelle: Facebook-Seite des ÖSTA)
Weitere Beispiele erwünscht!
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 17:59 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mitglieder des NAET bei der Diskussion: Foto: K.Uhde
"Am 25. und 26. November 2010 trafen sich in der Archivschule Marburg 14 Mitglieder des Networks of Archival Educatorurgs and Trainers (NAET), um die im August 2011 in Marburg stattfindende Summer School 2011 "Appraisal and Social Memory" zu planen.
NAET ist ein Zusammenschluss von Ausbildungseinrichtungen für Archivare und Records Manager in Skandinavien, Großbritannien, den Beneluxstaaten, Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Das Network hatte Anfang 2010 in Norwegen erfolgreich einen Förderantrag im Rahmen des Lifelong Learning Programms Erasmus der EU gestellt. Innerhalb des auf maximal drei Jahre angelegten Programms ARCHIDIS (Archives and Records Challenges in the Digital Information Society) wird zunächst im Sommer 2011 eine zweiwöchige Summer School mit Studierenden und Lehrenden von 13 Hochschulen aus 9 Ländern stattfinden."
Quelle: Homepage Archivschule Marburg
Link zum NAET
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 17:12 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Kölner Stadtarchiv hat einen Kalender für 2011 aufgelegt, in dem Fotos von zerstörten Dokumenten zu sehen sind. Einige Archivalien werden gezeigt, wie sie vor und wie sie nach dem Einsturz des historischen Archivs aussahen. Außerdem stellt der Kalender einige noch nicht restaurierte Stücke vor, für deren Reparatur noch Spender gesucht werden. Der Kalender ist ab sofort im Lesesaal des historischen Archivs am Heumarkt erhältlich."
Quelle: WDR.de, Studio Köln, Nachrichten v. 5.12.2010
Quelle: WDR.de, Studio Köln, Nachrichten v. 5.12.2010
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 11:08 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Liste von Zeitungen der LINKEN wurde vom Archiv der Rosa Luxemburg Stiftung zum August 2010 aktualisiert. Sie enthält noch existierende und eingestellte Titel, aber nur die alphabetisch sortierten Namen und dazu die Orte, keine Adressen: PDF unter www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/Kleine_Zeitungen_der_LINKEN.pdf
Bernd Hüttner - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 10:01 - Rubrik: Parteiarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die kirchenrechtliche Zeitschrift „De Processibus Matrimonialibus“ („Über die Eheprozesse“) dient in erster Linie der Publikation der Referate der gleichnamigen Tagung, die seit 1994 jährlich stattfindet. Alle bisher erschienen Bände sind Open Access auf der Seite der UB Augsburg einsehbar:
http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/dda/urn/urn_uba001400-uba001599/uba001399-uba001419/
http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/dda/urn/urn_uba001400-uba001599/uba001399-uba001419/
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 06:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 06:48 - Rubrik: Universitaetsarchive
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=2185
105 Urkunden aus den Jahren 1334 bis 1935.
105 Urkunden aus den Jahren 1334 bis 1935.
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 06:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 06:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=sav-001&id=browse&id2=browse4
Die moving wall beträgt 24 Monate.
Die moving wall beträgt 24 Monate.
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 05:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://agora.sub.uni-hamburg.de/subhh-adress/digbib/start
"Präsentiert werden zunächst die Jahrgänge 1787-1903 des Hamburger, 1802-1903 des Altonaer und einige Bände des Bergedorfer Adressbuchs, die Vorläufer aus dem 18. Jahrhundert sowie alle für Hamburg relevanten Adress- und Fernsprechbücher des Jahres 1926."
"Präsentiert werden zunächst die Jahrgänge 1787-1903 des Hamburger, 1802-1903 des Altonaer und einige Bände des Bergedorfer Adressbuchs, die Vorläufer aus dem 18. Jahrhundert sowie alle für Hamburg relevanten Adress- und Fernsprechbücher des Jahres 1926."
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 05:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 05:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.blb-karlsruhe.de/
Viewer der Visual Library (z.B. Düsseldorf, e-rara, usw.), gute Auflösung.
Digitalisiert wurden auch zahlreiche Handschriftenfragmente und Exemplare der mit Nachträgen versehenen Handschriftenkataloge:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/3201
Nicht in die "Virtuelle Schatzkammer" aufgenommen, für Germanisten aber von unschätzbarem Wert ist die komplett einsehbare Liedersaalhandschrift Lassbergs:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/19642
Das für teuer Geld von den geldgierigen Badenern erworbene Speculum humanae salvationis - siehe http://archiv.twoday.net/stories/8382369/ - ist nun auch online:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/1818
Unter den Autographen auch ein Brief Lassbergs an Uhland.

Viewer der Visual Library (z.B. Düsseldorf, e-rara, usw.), gute Auflösung.
Digitalisiert wurden auch zahlreiche Handschriftenfragmente und Exemplare der mit Nachträgen versehenen Handschriftenkataloge:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/3201
Nicht in die "Virtuelle Schatzkammer" aufgenommen, für Germanisten aber von unschätzbarem Wert ist die komplett einsehbare Liedersaalhandschrift Lassbergs:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/19642
Das für teuer Geld von den geldgierigen Badenern erworbene Speculum humanae salvationis - siehe http://archiv.twoday.net/stories/8382369/ - ist nun auch online:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/1818
Unter den Autographen auch ein Brief Lassbergs an Uhland.

KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 05:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sauerland, Karol: Wertherfieber, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 03.12.2010. URL: http://www.ieg-ego.eu/sauerlandk-2010-de URN: urn:nbn:de:0159-20100921636
Der 1936 geborene Autor ist eine Legende der polnischen Germanistik:
http://de.wikipedia.org/wiki/Karol_Sauerland
Das kann aber doch nicht bedeuten, dass man gänzlich auf Kritik verzichtet. Der Artikel informiert über die Werther-Rezeption, ohne freilich auf die europäischen Aspekte sonderlich einzugehen. Es wird nur deutschsprachige Literatur zitiert, man erfährt viel zu wenig über die internationale Rezeption, die ja eigentlich das Thema des Portals darstellen sollte. Wenn das Wertherfieber ein europäisches Phänomen war, dann darf man sich doch nicht auf die deutschsprachige Rezeption beschränken!
An die Redaktion richten sich die weiteren Monita:
Armselig und schlecht ist die Bebilderung. Beispielsweise hat die Wikipedia die Titelseite des Erstdrucks 1774.

Seit einiger Zeit ist die wertvolle Erstausgabe in Wien online:
http://phaidra.univie.ac.at/o:5501
Es fehlen auch sonst jegliche Nachweise zu Digitalisaten. Die Wikipedia hat in der Sektion Weblinks den Hinweis auf die unentbehrlichen Materialien des Goethezeitportals, z.B.
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=252
Es geht doch nicht an, dass man 2010 so tut, als seien nicht gewaltige Mengen aus dem 18. Jahrhundert bereits digitalisiert worden.
Schlettweins Des jungen Werthers Zuruf aus der Ewigkeit an die noch lebende Menschen auf der Erde, Carlsruhe 1775 liegt z.B. bei Google vor:
http://books.google.de/books?id=4mAHAAAAQAAJ
Dies gilt auch für spätere Sekundärliteratur.
Beispielsweise ist die Arbeit Bodes online:
http://www.archive.org/details/goetheinvertraul00bodeuoft
EGO ist ein Angebot im INTERNET und sollte dieses Medium demnach auch zur Kenntnis nehmen!!
Der 1936 geborene Autor ist eine Legende der polnischen Germanistik:
http://de.wikipedia.org/wiki/Karol_Sauerland
Das kann aber doch nicht bedeuten, dass man gänzlich auf Kritik verzichtet. Der Artikel informiert über die Werther-Rezeption, ohne freilich auf die europäischen Aspekte sonderlich einzugehen. Es wird nur deutschsprachige Literatur zitiert, man erfährt viel zu wenig über die internationale Rezeption, die ja eigentlich das Thema des Portals darstellen sollte. Wenn das Wertherfieber ein europäisches Phänomen war, dann darf man sich doch nicht auf die deutschsprachige Rezeption beschränken!
An die Redaktion richten sich die weiteren Monita:
Armselig und schlecht ist die Bebilderung. Beispielsweise hat die Wikipedia die Titelseite des Erstdrucks 1774.

Seit einiger Zeit ist die wertvolle Erstausgabe in Wien online:
http://phaidra.univie.ac.at/o:5501
Es fehlen auch sonst jegliche Nachweise zu Digitalisaten. Die Wikipedia hat in der Sektion Weblinks den Hinweis auf die unentbehrlichen Materialien des Goethezeitportals, z.B.
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=252
Es geht doch nicht an, dass man 2010 so tut, als seien nicht gewaltige Mengen aus dem 18. Jahrhundert bereits digitalisiert worden.
Schlettweins Des jungen Werthers Zuruf aus der Ewigkeit an die noch lebende Menschen auf der Erde, Carlsruhe 1775 liegt z.B. bei Google vor:
http://books.google.de/books?id=4mAHAAAAQAAJ
Dies gilt auch für spätere Sekundärliteratur.
Beispielsweise ist die Arbeit Bodes online:
http://www.archive.org/details/goetheinvertraul00bodeuoft
EGO ist ein Angebot im INTERNET und sollte dieses Medium demnach auch zur Kenntnis nehmen!!
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 00:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 us urheberrechtlichen Gründen verzichte ich darauf, die 47 wirklich eindrucksvollen Fotos vom National Geographic's Photography Contest 2010, die Big Picture ausgewählt hat, hier wiederzugeben:
us urheberrechtlichen Gründen verzichte ich darauf, die 47 wirklich eindrucksvollen Fotos vom National Geographic's Photography Contest 2010, die Big Picture ausgewählt hat, hier wiederzugeben:http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/national_geographics_photograp.html
Aber gibt es nicht auch genügend tolle freie Fotos? Ein "Best of" der Millionen Fotos auf Wikimedia Commons sind die exzellenten Bilder, und aus diesen werden die jeweiligen Bilder des Jahres ausgewählt.
Viele Links zu Open-Access-Datenbanken mit digitalisierten Fotos bietet unsere Rubrik Fotoüberlieferung:
http://archiv.twoday.net/topics/Fotoueberlieferung/
Gern verweisen wir natürlich auch auf die Link-Sammlung im Blog-Stil:
http://www.fotostoria.de/
Und nun einige Fotos aus den Bildern des Jahres bzw. den Kandidaten dafür auf Wikimedia Commons. Die Links führen zur Vollansicht und geben die Lizenz an.

Bild des Jahres 2009 von Paulrudd: Sikh-Pilger beim Goldenen Tempel in Amritsar (Indien) nach einem rituellen Bad. CC-BY-SA

Das Eilean Donan Castle in den Schottischen Highlands, fotografiert von Guillaume Piolle. CC-BY-SA
 Ein Weißflecken-Kugelfisch küsst die Kamera von Mila Zinkova vor Hawaii. CC-BY-SA
Ein Weißflecken-Kugelfisch küsst die Kamera von Mila Zinkova vor Hawaii. CC-BY-SA
Le grand foyer in der Opéra Garnier von Paris (von Eric Pouhier). CC-BY-SA
 Weil wir ein facharchivisches Forum sind darf nicht fehlen: Jan Mehlichs Foto des Siegels von König Władysław II Jagiełło von Polen (gest. 1434) - CC-BY-SA
Weil wir ein facharchivisches Forum sind darf nicht fehlen: Jan Mehlichs Foto des Siegels von König Władysław II Jagiełło von Polen (gest. 1434) - CC-BY-SAAlle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Sonntag, 5. Dezember 2010, 00:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach wie vor ein Standardwerk:
Modern, Heinrich: Die Zimmern'schen Handschriften der k. k. Hofbibliothek: Ein Beitrag zur Geschichte der Ambraser Sammlung und der k. k. Hofbibliothek. In: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 20.1899
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1899/0121
Modern, Heinrich: Die Zimmern'schen Handschriften der k. k. Hofbibliothek: Ein Beitrag zur Geschichte der Ambraser Sammlung und der k. k. Hofbibliothek. In: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 20.1899
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1899/0121
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 23:40 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fragt:
http://www.datenschutzbeauftragter-info.de/macht-sich-facebook-infolge-von-meinungszensur-strafbar/
"Wie bereits einige Tage zuvor in den Medien bekannt geworden ist, wehrt Facebook sich gegen Kritiker. So hatte Facebook nach Angaben diverser Medien beispielsweise Verlinkungen zur Facebook-Parodie Lamebook gesperrt."
http://www.datenschutzbeauftragter-info.de/macht-sich-facebook-infolge-von-meinungszensur-strafbar/
"Wie bereits einige Tage zuvor in den Medien bekannt geworden ist, wehrt Facebook sich gegen Kritiker. So hatte Facebook nach Angaben diverser Medien beispielsweise Verlinkungen zur Facebook-Parodie Lamebook gesperrt."
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 23:37 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zweitpublikation von Andreas C. Hofmann: Link-Hint Nr. 6/2010. Feldpostsammlung des Museums für Kommunikation Berlin, aus. einblicke. Geschichte im Kontext – ein offener Blog zur Geschichte im Kontext außerwissenschaftlicher Themenfelder [3. Dezember 2010], http://einblicke.andreashofmann.eu/2010/12/880/.
Einblicke ist Partner von historicum.net:
http://www.historicum.net/lehren-lernen/internetressourcen/link-hints-12010-ff/
Daher schleimt ACH auch die hier thematisierte Verstümmelung von Chronicon zu:
http://einblicke.andreashofmann.eu/2010/12/874/
Wer nicht in der Lage ist, eine bestehende einigermaßen funktionierende Metasuche bei einem Relaunch im bisherigen Umfang anzubieten, den möchte ich einen Stümper nennen.
Einblicke ist Partner von historicum.net:
http://www.historicum.net/lehren-lernen/internetressourcen/link-hints-12010-ff/
Daher schleimt ACH auch die hier thematisierte Verstümmelung von Chronicon zu:
http://einblicke.andreashofmann.eu/2010/12/874/
Wer nicht in der Lage ist, eine bestehende einigermaßen funktionierende Metasuche bei einem Relaunch im bisherigen Umfang anzubieten, den möchte ich einen Stümper nennen.
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 22:58 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2010/12/04/zur-geschichts-weblog-debatte/
Weblogs sind dann interessant, wenn sie gerade nicht den Charme der Fachtagungen und Fachzeitschriften der Zunft haben, in denen es fast ausschließlich um Profilierung im Sinne von Rechthaberei und Pöstchen und fast nie um die Sache geht. Die public digital historians, die mir vorschweben, sind engagierte Beiträger und Vermittler, keine Selbstdarsteller.
Weblogs sind dann interessant, wenn sie gerade nicht den Charme der Fachtagungen und Fachzeitschriften der Zunft haben, in denen es fast ausschließlich um Profilierung im Sinne von Rechthaberei und Pöstchen und fast nie um die Sache geht. Die public digital historians, die mir vorschweben, sind engagierte Beiträger und Vermittler, keine Selbstdarsteller.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zeit.de/2010/49/B-Bibliotheken?page=all
Ein mäßig erhellender, leicht kritischer ZEIT-Artikel zur Buchdigitalisierung in Deutschland.
Wie Bulaty ist auch Ulrich Johannes Schneider, Direktor der Universitätsbibliothek in Leipzig, ein Fan der Digitalisierung. Im wunderschön renovierten Gebäude der zweitältesten deutschen Bibliothek ist er Herr über 5,4 Millionen Bücher – und freut sich über jedes, das er digital präsentieren kann. »Ich habe gerade wieder Dankesmails aus Amerika bekommen«, erzählt er – seltene Drucke werden weltweit zugänglich, und die Bibliothek kann sie wegschließen.
Was für seltene Drucke mag Schneider nur meinen? Die UB Leipzig hat sich ja nun weissgott nicht bei der Digitalisierung hervorgetan:
http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/dhbl/index&lang=de&stil=fc
Es gibt überhaupt keine abendländischen seltene Drucke unter den Leipziger Digitalisaten, nicht ein einziges, denn die "Annalen der Naturphilosophie" sind eine Zeitschrift, die man nicht unbedingt als rar bezeichnen kann.
Ein mäßig erhellender, leicht kritischer ZEIT-Artikel zur Buchdigitalisierung in Deutschland.
Wie Bulaty ist auch Ulrich Johannes Schneider, Direktor der Universitätsbibliothek in Leipzig, ein Fan der Digitalisierung. Im wunderschön renovierten Gebäude der zweitältesten deutschen Bibliothek ist er Herr über 5,4 Millionen Bücher – und freut sich über jedes, das er digital präsentieren kann. »Ich habe gerade wieder Dankesmails aus Amerika bekommen«, erzählt er – seltene Drucke werden weltweit zugänglich, und die Bibliothek kann sie wegschließen.
Was für seltene Drucke mag Schneider nur meinen? Die UB Leipzig hat sich ja nun weissgott nicht bei der Digitalisierung hervorgetan:
http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/dhbl/index&lang=de&stil=fc
Es gibt überhaupt keine abendländischen seltene Drucke unter den Leipziger Digitalisaten, nicht ein einziges, denn die "Annalen der Naturphilosophie" sind eine Zeitschrift, die man nicht unbedingt als rar bezeichnen kann.
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 21:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Ich hätte mich bis auf die Knochen blamiert, hätte ich über die nicht lizenzgerechte Nutzung von
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomical_theatre_of_the_Archiginnasio,_Bologna,_Italy_-_the_statue_of_Galenus.JPG
in EGO http://www.ieg-ego.eu ( siehe http://archiv.twoday.net/stories/11437206/ ) gewettert. Aber dann löschte ich den bereits geschriebenen Beitrag, weil obiges Bild vom Urheber als Public Domain freigegeben worden war, also keinen Lizenzvorschriften unterliegt.
EGO nutzt häufig "Flachware" (und fast immer die ungeeignetsten oder hässlichsten Bilder), also muss man etwas suchen, bis man den ersten richtigen (als Urheberrechtsverletzung abmahnbaren) Lizenzverstoß findet. Gerade ein Portal, das selbst unter CC (leider CC-BY-NC-ND) lizenziert ist, sollte sich da wirklich keinen Lapsus erlauben.
http://www.ieg-ego.eu/de/threads/modelle-und-stereotypen/das-spanische-jahrhundert-16.-jhd
Die Seite nutzt das Bild
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_pilatos1.jpg

zu dem folgende Angaben zur Verfügung stehen:
Description: Patio principal de la Casa de Pilatos de Sevilla (Andalucía, España)
Date: 30 October 2007
Source: Flickr (http://www.flickr.com/photos/jamesdale10/1878300289/)
Author: James Gordon
Lizenz ist:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Das Bild ist auf Flickr nicht mehr vorhanden, es wurde aber nach dem Hochladen auf Wikimedia Commons überprüft, dass die Lizenz zutraf.
EGO gibt an:
Patio principal de la Casa de Pilatos de Sevilla (Andalusien, Spanien), Farbphotographie, 2007, unbekannter Photograph; Bildquelle: Wikimedia Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_pilatos1.jpg.
lizensiert unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License.
Das sind zwei dicke Hunde:
1. Der Fotograf ist keineswegs unbekannt, sondern James Gordon und das Weglassen seines Namens verpflichtet zum Schadensersatz (üblicherweise sprechen Gerichte das Doppelte der üblicherweise fälligen Lizenzgebühren zu, wenn die Urhebernennung rechtswidrig unterbleibt).
2. Man darf nicht einfach eine Creative-Commons-Lizenz durch eine andere ersetzen. CC-BY 2.0 ist etwas anderes als CC-BY-SA 3.0.
Auf der gleichen Seite wird auch bei
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventana2.jpg?uselang=de
behauptet, es handle sich um einen unbekannten Fotografen. Das ist falsch, anzugeben ist: AnTeMi (oder User::AnTeMi). Ob ein Fotograf unter Klarnamen oder Pseudonym ein Foto unter freie Lizenz stellt, ist wurscht. Wird die vorgesehene Urhebernennung nicht durchgeführt, handelt es sich um eine Urheberrechtsverletzung.
Ebenso verhält es sich bei
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cenotafio_de_Felipe_II_y_su_familia.jpg (angeblich "Unbekannter Photograph")
Weitere Fälle angeblich unbekannter Fotografen:
http://www.ieg-ego.eu/hoepelt-2010-de (5 Fälle)
Bei der Bundesarchiv-Fotografie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_170-682,_Potsdam,_Sanssouci,_Communs.jpg
wird auf die Datenbank des Bundesarchivs verlinkt, obwohl dort gar nichts von der CC-Lizenz steht, was zumindest irreführend ist. Außerdem wird wieder die falsche Lizenz angegeben. EGO sagt CC-BY-SA 3.0 Unported während es in Wirklichkeit CC-BY-SA 3.0 Germany ist! Wenn ich den Thesenanschlag Luthers in das Jahr 1519 setze, ist das ebenso schwachsinnig, wie wenn ich nicht in der Lage bin, exakt die richtige Lizenz auszuwählen. Bei einem Projekt, in das Massen von Steuergeldern geflossen sind, darf verlangt werden, dass es sich strikt an die Vorgaben der freien Lizenzen hält (vor allem, wenn Wikimedia Commons wohl die Hauptbilderquelle für Fotos dreidimensionaler Objekte ist). Die Wikipedia wird von EGO vornehm ignoriert, aber die Wikimedia-Commons-Fotografen, die unter Pseudonym agieren, werden um die ihnen zustehende Attribution gebracht! Und im ersten Fall wird sogar ein mit Klarname auftretender Fotograf nicht genannt.
Wenn solche Projekte es nicht anders lernen, lizenzgerecht zu nutzen, befürworte ich Abmahnungen durch die betroffenen Wikimedia-Benutzer.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomical_theatre_of_the_Archiginnasio,_Bologna,_Italy_-_the_statue_of_Galenus.JPG
in EGO http://www.ieg-ego.eu ( siehe http://archiv.twoday.net/stories/11437206/ ) gewettert. Aber dann löschte ich den bereits geschriebenen Beitrag, weil obiges Bild vom Urheber als Public Domain freigegeben worden war, also keinen Lizenzvorschriften unterliegt.
EGO nutzt häufig "Flachware" (und fast immer die ungeeignetsten oder hässlichsten Bilder), also muss man etwas suchen, bis man den ersten richtigen (als Urheberrechtsverletzung abmahnbaren) Lizenzverstoß findet. Gerade ein Portal, das selbst unter CC (leider CC-BY-NC-ND) lizenziert ist, sollte sich da wirklich keinen Lapsus erlauben.
http://www.ieg-ego.eu/de/threads/modelle-und-stereotypen/das-spanische-jahrhundert-16.-jhd
Die Seite nutzt das Bild
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_pilatos1.jpg

zu dem folgende Angaben zur Verfügung stehen:
Description: Patio principal de la Casa de Pilatos de Sevilla (Andalucía, España)
Date: 30 October 2007
Source: Flickr (http://www.flickr.com/photos/jamesdale10/1878300289/)
Author: James Gordon
Lizenz ist:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Das Bild ist auf Flickr nicht mehr vorhanden, es wurde aber nach dem Hochladen auf Wikimedia Commons überprüft, dass die Lizenz zutraf.
EGO gibt an:
Patio principal de la Casa de Pilatos de Sevilla (Andalusien, Spanien), Farbphotographie, 2007, unbekannter Photograph; Bildquelle: Wikimedia Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_pilatos1.jpg.
lizensiert unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License.
Das sind zwei dicke Hunde:
1. Der Fotograf ist keineswegs unbekannt, sondern James Gordon und das Weglassen seines Namens verpflichtet zum Schadensersatz (üblicherweise sprechen Gerichte das Doppelte der üblicherweise fälligen Lizenzgebühren zu, wenn die Urhebernennung rechtswidrig unterbleibt).
2. Man darf nicht einfach eine Creative-Commons-Lizenz durch eine andere ersetzen. CC-BY 2.0 ist etwas anderes als CC-BY-SA 3.0.
Auf der gleichen Seite wird auch bei
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventana2.jpg?uselang=de
behauptet, es handle sich um einen unbekannten Fotografen. Das ist falsch, anzugeben ist: AnTeMi (oder User::AnTeMi). Ob ein Fotograf unter Klarnamen oder Pseudonym ein Foto unter freie Lizenz stellt, ist wurscht. Wird die vorgesehene Urhebernennung nicht durchgeführt, handelt es sich um eine Urheberrechtsverletzung.
Ebenso verhält es sich bei
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cenotafio_de_Felipe_II_y_su_familia.jpg (angeblich "Unbekannter Photograph")
Weitere Fälle angeblich unbekannter Fotografen:
http://www.ieg-ego.eu/hoepelt-2010-de (5 Fälle)
Bei der Bundesarchiv-Fotografie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_170-682,_Potsdam,_Sanssouci,_Communs.jpg
wird auf die Datenbank des Bundesarchivs verlinkt, obwohl dort gar nichts von der CC-Lizenz steht, was zumindest irreführend ist. Außerdem wird wieder die falsche Lizenz angegeben. EGO sagt CC-BY-SA 3.0 Unported während es in Wirklichkeit CC-BY-SA 3.0 Germany ist! Wenn ich den Thesenanschlag Luthers in das Jahr 1519 setze, ist das ebenso schwachsinnig, wie wenn ich nicht in der Lage bin, exakt die richtige Lizenz auszuwählen. Bei einem Projekt, in das Massen von Steuergeldern geflossen sind, darf verlangt werden, dass es sich strikt an die Vorgaben der freien Lizenzen hält (vor allem, wenn Wikimedia Commons wohl die Hauptbilderquelle für Fotos dreidimensionaler Objekte ist). Die Wikipedia wird von EGO vornehm ignoriert, aber die Wikimedia-Commons-Fotografen, die unter Pseudonym agieren, werden um die ihnen zustehende Attribution gebracht! Und im ersten Fall wird sogar ein mit Klarname auftretender Fotograf nicht genannt.
Wenn solche Projekte es nicht anders lernen, lizenzgerecht zu nutzen, befürworte ich Abmahnungen durch die betroffenen Wikimedia-Benutzer.
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 21:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ieg-ego.eu/?set_language=de&-C=
Die Beiträge stehen sinnfrei unter CC-by-nd-nc, damit möglichst niemand etwas mit ihnen anfangen oder an ihnen weiterarbeiten kann. ND bedeutet: keine Bearbeitung, also nur komplette Übernahme, ungekürzt.
Die ersten beiden Bilder, die ich mir anschaute, waren ungenügend. In einem Fall fehlte eine genaue Quellenangabe, und im zweiten Fall wurde Erasmus mit einem hässlichen Schwarzweißfoto unterster Qualität repräsentiert.
Nett ist ein Textlink, der blitzschnell Medien vom rechten Rand herbeizitiert. Aber wenn Montesquieu mit einem Schwarzweißporträt aus dem 19. Jahrhundert illustriert wird, merkt man einmal mehr, dass die Bildredaktion unterdurchschnittlich schlecht ist (zum Vergleich kann man die wie üblich nicht verlinkte Wikipedia heranziehen).
Also nochmal zum Mitschreiben: Was da ins Netz gebracht wurde, hat nichts von der Wikipedia bzw. dem Web 2.0 begriffen. Es sind (vermutlich gute) Fachaufsätze mit ein wenig Multimedia-Schnickschnack.
"Die Einbindung externer Daten (VIAF, PND) in der rechten Spalte find ich ganz praktisch." sagt die Geschichtsweberin. Aber beide Verweise sind eine Einbahnstraße, während
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Charles_de_Secondat,_Baron_de_Montesquieu
oder
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100942717
State of the art wäre. Einfach nur ärgerlich das Ignorieren der Wikipedia.
Immerhin: Etwas besser als die Docupedia scheint das Angebot zu sein:
http://archiv.twoday.net/search?q=docupedia
Aber dazu habe ich es mir noch nicht genau genug angeschaut.
 Wer auch nur etwas Ahnung hat, wird die der U of Texas in Austin nachgeschriebene Angabe, es handle sich um "Wood engraving, 15th century" als puren Unsinn qualifizieren. Ein Blick in die Wikipedia genügt:
Wer auch nur etwas Ahnung hat, wird die der U of Texas in Austin nachgeschriebene Angabe, es handle sich um "Wood engraving, 15th century" als puren Unsinn qualifizieren. Ein Blick in die Wikipedia genügt:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vlad_Tepes_002.jpg
Update: Weitere kritische Notizen
* Es fehlen Nachweise von Digitalisaten und online vorliegender zitierter Fachliteratur.
* Völlig idiotisch ist das Browsen, das immer nur 5 Treffer auf einmal preisgibt - einen Überblick über den Aspekt "Räume" kann man sich so nur denkbar unbequem verschaffen.
Exemplarisch zum Wertherfieber:
http://archiv.twoday.net/stories/11437429/
Die Beiträge stehen sinnfrei unter CC-by-nd-nc, damit möglichst niemand etwas mit ihnen anfangen oder an ihnen weiterarbeiten kann. ND bedeutet: keine Bearbeitung, also nur komplette Übernahme, ungekürzt.
Die ersten beiden Bilder, die ich mir anschaute, waren ungenügend. In einem Fall fehlte eine genaue Quellenangabe, und im zweiten Fall wurde Erasmus mit einem hässlichen Schwarzweißfoto unterster Qualität repräsentiert.
Nett ist ein Textlink, der blitzschnell Medien vom rechten Rand herbeizitiert. Aber wenn Montesquieu mit einem Schwarzweißporträt aus dem 19. Jahrhundert illustriert wird, merkt man einmal mehr, dass die Bildredaktion unterdurchschnittlich schlecht ist (zum Vergleich kann man die wie üblich nicht verlinkte Wikipedia heranziehen).
Also nochmal zum Mitschreiben: Was da ins Netz gebracht wurde, hat nichts von der Wikipedia bzw. dem Web 2.0 begriffen. Es sind (vermutlich gute) Fachaufsätze mit ein wenig Multimedia-Schnickschnack.
"Die Einbindung externer Daten (VIAF, PND) in der rechten Spalte find ich ganz praktisch." sagt die Geschichtsweberin. Aber beide Verweise sind eine Einbahnstraße, während
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Charles_de_Secondat,_Baron_de_Montesquieu
oder
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100942717
State of the art wäre. Einfach nur ärgerlich das Ignorieren der Wikipedia.
Immerhin: Etwas besser als die Docupedia scheint das Angebot zu sein:
http://archiv.twoday.net/search?q=docupedia
Aber dazu habe ich es mir noch nicht genau genug angeschaut.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vlad_Tepes_002.jpg
Update: Weitere kritische Notizen
* Es fehlen Nachweise von Digitalisaten und online vorliegender zitierter Fachliteratur.
* Völlig idiotisch ist das Browsen, das immer nur 5 Treffer auf einmal preisgibt - einen Überblick über den Aspekt "Räume" kann man sich so nur denkbar unbequem verschaffen.
Exemplarisch zum Wertherfieber:
http://archiv.twoday.net/stories/11437429/
KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 19:38 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
" .... Vorsitzender Manfred Palmen: Dieser Tagesordnungspunkt wurde für die heutige Sitzung am 28. Oktober von der SPD-Landtagsfraktion beantragt. Es wird um Bericht der Landesregierung gebeten, ob dem Land gegebenenfalls Schaden entstanden und wie hoch dieser anzusetzen sei. – Ich gehe davon aus, dass der Unteraus-schuss „Landesbetriebe und Sondervermögen“ sich mit dieser Thematik in seiner nächsten Sitzung am 9. November befassen wird.
Ich möchte noch auf § 55 der Geschäftsordnung hinweisen: Für den Fall, dass bei der Auskunft Namen etc. angesprochen werden, müssen wir die Nichtöffentlichkeit herstellen. – Wer antwortet für die Landesregierung? – Herr Wehrmann, bitte.
MR Ralf Wehrmann (FM): Meine Damen und Herren! Sie haben von uns Auskunft zu der Frage verlangt, wie das Bauvorhaben Landesarchiv vonstatten gegangen ist. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass wir derzeit öffentlich tagen, sodass ich keine Details nennen kann; darauf hat der Vorsitzende schon hingewiesen.
Wir haben das Grundstück im Jahre 2008 von einer Gesellschaft erworben, die zu dem Unternehmenskreis Kölbl & Kruse gehört. Das Grundstück dient dazu, das Lan-desarchiv des Landes Nordrhein-Westfalen – nach Durchführung entsprechender Baumaßnahmen – zu beherbergen. Es ist der ehemalige Getreidespeicher, der jetzt das neue Landesarchiv als Gedächtnis des Landes Nordrhein-Westfalen beherbergen wird; dort sollen die Archivbestände gelagert werden.
Nach den Plänen der österreichischen Architekten Ortner & Ortner entsteht im Duisburger Innenhafen in einer Kombination von Alt- und Neubau eine Landmarke. Die bisher an verschiedenen Standorten lokalisierten Bestände des Landes werden dort zusammengeführt. Es sind Schriften, Schriftgut, Amtsbücher und Urkunden aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart, Karten, Pläne, Filme und Fotos.
Ausgangspunkt war 2004 eine Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass die verschiedenen Standorte des Landesarchivs, die wir bisher haben, an einem Stand-ort zusammengelegt werden sollten. Das ehemalige Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf mit zwei Außenstellen und das Personenstandsarchiv in Brühl sollen jetzt in Duisburg konzentriert werden. Man hat damals, bevor man diese Standortentscheidung getroffen hat, umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die auch andere Punkte im Ruhrgebiet als Standort des Landesarchivs vorgesehen haben. Zum Schluss ist man dann auf diesen Speicher im Duisburger Innenhafen gekommen. Er wurde als idealer Standort für das Landesarchiv angesehen.
Zu Beginn des Projekts wurde, da das Land nicht über die entsprechenden Grundstücke verfügte, sondern eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft Eigentümerin der betroffenen Grundstücke war, versucht, eine Planung zu errichten. Die Grundstücke, um die es geht, sind im Jahre 2007 von der Voreigentümerin verkauft worden. Gleichzeitig hat der Erwerber dieser Grundstücke auch noch im Jahre 2007 zusätzliche Grundstücke von der Stadt Duisburg, nämlich erbbaurechtsbelastete Grundstücke, erworben.
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb hat, weil er nicht im Besitz dieser Grundstücke war, auch im Jahre 2007 mit der neuen Grundstückseigentümerin verhandelt und ei-nen Mietvertrag abgeschlossen, der sicherstellen sollte, dass auf diesem Grundstück von der Eigentümerin das Grundstück entwickelt, ein Gebäude errichtet, das dann zusammen mit dem schon bestehenden Speichergebäude an das Land zur Beherbergung des Landesarchivs vermietet werden sollte.
Im Jahre 2007 fanden Architekturwettbewerbe statt, die von der jeweiligen Grund-stückseigentümerin ausgelobt worden sind. Ende 2007 hat man dann in der Situation des Ergebnisses eines Architektenwettbewerbs einen Siegerentwurf gefunden, der das dort befindliche Speichergebäude – zusätzlich mit einem Anbau als Welle – für das Landesarchiv vorgesehen hat. Während des Architektenwettbewerbes wurden natürlich auch Kostenschätzungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Kostenschätzungen lag der Siegerentwurf im Bereich dessen, was in dem Mietvertrag mit der Eigentümerin der Grundstücke vereinbart worden war.
Im Folgezeitraum hat man dann die Planung des Siegerwettbewerbs konkretisiert und versucht, im Rahmen von Planungen die Baukosten, die erforderlich sind, um das Landesarchiv auf diesem Grundstück zu errichten, zu verifizieren. Dabei zeigte sich, dass mit deutlichen Baukostensteigerungen zu rechnen war. Zum einen waren die Rohstoff- und damit auch die Stahlpreise gestiegen. Es war erforderlich, das Gebäude mit einer Stahlkonstruktion zu ertüchtigen. Zum anderen gab es die normalen Baupreissteigerungen und darüber hinaus die Situation, dass man bei den Planungen feststellte, dass Flächen gegenüber der ursprünglich eingeplanten Fläche erweitert werden mussten und im Inneren des Gebäudes weitere Maßnahmen erforderlich waren, die zu einer deutlichen Kostensteigerung führten.
Diese im Zuge der Planung festgestellten Kostensteigerungen führten dazu, dass die ursprünglich im Mietvertrag vereinbarte Miete nicht gehalten werden konnte. Sie wäre aufgrund einer Mietanpassungsklausel, die im Mietvertrag enthalten war, drastisch gestiegen. Daraufhin ist der BLB im Jahre 2008 zu dem Ergebnis gekommen, dass man Kaufpreisverhandlungen zum Ankauf dieses Geländes mit der Eigentümerin führen sollte, und hat dann noch im Jahre 2008 dieses Grundstück erworben.
Um die Probleme bei der Baukostensteigerung weiter zu sondieren, ist man hingegangen und hat erhebliche Vorplanungen geleistet und dann im Frühjahr 2010 einen endgültigen Bauvertrag mit dem errichtenden Bauunternehmen abgeschlossen. Im April 2010 war der offizielle Spatenstich. Derzeit sind die Baumaßnahmen im Gange, die zur Ertüchtigung des Getreidespeichers bzw. zur Errichtung der Welle führen sol-len.
Sofern Sie noch weitere Details zu dem Bauprojekt erfahren möchten, komme ich Ih-rem Informationsbedürfnis gerne nach, kann das aber aus dem vom Vorsitzenden eingangs genannten Grund nur in nichtöffentlicher bzw. vertraulicher Sitzung tun.
Vorsitzender Manfred Palmen: Vielen Dank, Herr Wehrmann. – Ich habe zwei Wortmeldungen vorliegen. Bitte, Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Ich würde gerne zunächst noch etwas zum Grundsatz erfahren. Der Vortrag war ja instruktiv; es ist aber ein bisschen kompliziert, das Ent-scheidende herauszudestillieren. Deshalb will ich fragen, ob ich das richtig verstanden habe.
Also: Irgendwann im Jahre 2007 hat irgendwer die Entscheidung getroffen, dass das Landesarchiv einen bestimmten Standort in Duisburg bekommen soll. Um diesen Zeitpunkt herum war natürlich klar, dass man bestimmte Grundstücke braucht. Die wollte man gerne von einem privaten Investor erwerben, jedenfalls in Teilen. Dieser private Investor hat sie dann aber nicht, wie gewünscht, an das Land oder eine landeseigene Gesellschaft verkauft, sondern an einen privaten Dritten, dessen Namen Sie uns ja soeben genannt haben.
Wenn das so richtig sein sollte – das scheint mir der erste relevante Komplex zu sein –, würde mich interessieren: Wer hat eigentlich wann in welcher Runde die Entscheidung getroffen, dass dort der Standort des Landesarchivs sein soll?
Zweitens: Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, welches Ziel der tatsächliche Erwerber mit dem Ankauf verfolgt hat? Haben Sie irgendeine Möglichkeit der Erkenntnis, was der eigentlich damit machen wollte? Wollte er es brachliegen lassen, etwas anderes bauen oder es teuer weiterverkaufen?
Drittens: Hat der Umstand, dass möglicherweise ein anderer privater Dritter dem Land notwendige Grundstücke sozusagen vor der Nase weggeschnappt hat, irgendwo landesseitig Argwohn erregt? Und hat das zu Prüfungen geführt, ob es da undichte Stellen oder Ähnliches gegeben haben könnte?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich fange mit der zweiten Frage an, Herr Börschel. Mir ist nicht bekannt, was der Erwerber des Grundstücks, der es letztlich an den BLB vermietet hat, mit diesem Grundstück konkret geplant hatte. Dazu kann ich keine Aussage machen.
Wir haben jetzt die Situation gehabt, dass der BLB dieses Grundstück angemietet hat. Wir haben keine Untersuchungen, Erörterungen, Prüfungen vorgenommen, warum das Grundstück zum damaligen Zeitpunkt, den wir gerade beschrieben haben, an den privaten Dritten verkauft worden ist.
Zu den weiteren Fragen würde ich die Kollegen aus dem heute für Kultur zuständigen Ministerium um Beantwortung bitten, weil wir keinerlei Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte in den Details haben, die Sie nachgefragt haben.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Die damalige Kulturabteilung der Staatskanzlei hatte den Auftrag, die Standortsuche vorzunehmen, nachdem sich die Landesregierung entschieden hatte, eine neue Fläche außerhalb Düsseldorfs zu finden, sprich konkret eine Industriebrache möglichst im Revier. Wir haben mit dem BLB und dem Nutzer, also dem Landesarchiv, zehn oder zwölf Standorte genauer untersucht. Auch unter dem Aspekt, dass viele Beschäftigte in Brühl und in Düsseldorf von der Verlagerung natürlich massiv betroffen sind, hat uns der Standort in Duisburg, auch aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage zu Düsseldorf, überzeugt.
Es hat dann Gespräche mit der Innenhafen-Entwicklungsgesellschaft gegeben. Der BLB wurde dann von uns gebeten, die Möglichkeiten, die sich dort im Innenhafen er-geben, genauer zu prüfen.
Die Entscheidungen, diese Planungen zu vertiefen, wurden auf der politischen Ebene, initiiert durch die Staatskanzlei bzw. den Kulturstaatssekretär, getroffen mit dem Ergebnis, dass im Dezember 2006 ein Mietvertrag mit dem BLB geschlossen wurde über die Errichtung eines Neubaus für den rheinischen Teil und die Leitung des Landesarchivs an einem noch zu bestimmenden Ort, aber möglichst an der Schifferstraße in Duisburg. Es wurde auch aufgenommen, dass für den Fall, dass der BLB die Eigentumsrechte nicht würde erwerben können – uns war ja damals nicht bekannt, wer genau Eigentümer ist –, er möglichst ein Untermietverhältnis für uns herstellen soll, wie es dann auch geschehen ist. Es gab noch die weitere Option für den Fall, dass dieses nicht gelingen sollte: Dann sollten der Landesregierung andere geeignete Grundstücke vom BLB vorgestellt werden.
Martin Börschel (SPD): Ich möchte an Sie, Herr Wehrmann, zunächst eine Nach-frage stellen. Sind Medienberichte richtig, dass es mit dem ursprünglichen privaten Eigentümer sehr konkrete Verhandlungen über den Eigentumserwerb gegeben hat, die dann kurz vor dem Notartermin geplatzt sind? Hat das nicht einen Nachforschungsbedarf – ich habe es eben Argwohn genannt – bei Ihnen erweckt, und was ist darauf erfolgt?
Dann eine Konkretisierung einer Frage in folgende Richtung: Medien berichteten ja auch darüber, dass es am 31. Januar zu der von mir vorhin nur sehr grob angespro-chenen Runde gekommen sein soll. Hat es sie gegeben? Wer war dabei? Welche Entscheidung ist da formell oder informell getroffen worden?
Vorsitzender Manfred Palmen: Moment! Die Frage, wer dabei war, kann nicht in öffentlicher Sitzung beantwortet werden.
(Thomas Eiskirch [SPD]: Es steht doch in der Zeitung!)
– Entschuldigung, Herr Eiskirch. Die Regeln stellt unsere Geschäftsordnung auf.
MR Ralf Wehrmann (FM): Sie hatten gefragt, Herr Börschel, ob jemand vonseiten des Landes mit dem ursprünglichen Grundstückseigentümer Verhandlungen aufgenommen hat. Das ist mir nicht bekannt. Ich kann nur für BLB sprechen, weil das mein Zuständigkeitsbereich ist. Mir ist nicht bekannt, dass der BLB mit dem Grundstückseigentümer intensive oder förmliche Verhandlungen geführt hat
MR Norbert Engels (MFKJKS): Es hat ein Gespräch gegeben, in dem hohe Vertreter – die Verwaltungsspitze – der Stadt Duisburg das Interesse der Stadt an der An-siedlung des Archivs deutlich gemacht haben. Es wurde dann auch hinsichtlich der Grundstücksverhältnisse gefragt: Wer kann dem BLB behilflich sein, da Kontakte herzustellen? – Dazu wurde Hilfestellung in Aussicht gestellt. Mehr nicht.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, ich möchte erst einmal die Strukturen klären. Wir haben einen alten Grundstückseigentümer, einen neuen Grundstückseigentümer und dann den Letzterwerber BLB. Ist das richtig so? – Ja. Frage: Ist es zutreffend, dass der neue Grundstückseigentümer Verhandlungsführer für den alten Grundstückseigentümer war, was die Verwertung des Grundstücks anbelangt?
Zweite Frage: Ist es zutreffend, dass aufgrund dieses Sachverhalts die Information an den neuen Grundstückseigentümer aus anderen Quellen gekommen sein kann als durch „Insider“ bzw. „Verrat“ durch die Stadt Duisburg oder wen auch immer? Wenn der neue Grundstückseigentümer der Verhandlungsführer des alten war, kann er doch seine Information auf ganz andere Art und Weise erhalten haben, als zunächst einmal unterstellt worden ist.
Dritte Frage: Herr Börschel hat darauf hingewiesen, dass das irgendwo Interesse erweckt haben muss, wie die Kostenentwicklung war. Ist es zutreffend, dass es im Verwaltungsrat des Bau- und Liegenschaftsbetriebes eine ausführliche Vorlage gegeben hat, worin diese Dinge geschildert wurden? Und ist es weiter zutreffend, dass dieser Vorlage dann die Mitglieder des Verwaltungsrates zugestimmt haben?
MR Ralf Wehrmann (FM): Herr Weisbrich, Sie haben zuerst gefragt, ob der neue Grundstückseigentümer Verhandlungsführer des alten war. – Dazu habe ich überhaupt keine Erkenntnisse; das weiß ich nicht.
Ihre zweite Frage war, ob da Informationen aus irgendwelchen Bereichen geflossen sein könnten. – Auch darüber ist mir nichts bekannt; ich habe keine Erkenntnisse darüber. Das war nicht Gegenstand meiner Wahrnehmung.
Was die Behandlung dieses Themas im Verwaltungsrat angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass die Beratungen vertraulich sind und dass ich dazu hier keine Auskunft geben kann.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich habe zwei, drei Kleinigkeiten. Die erste Frage: Wenn man die Vorgabe „Grundstücke im Revier“ hat – ist mit der Montan-Grundstücksgesellschaft auch darüber geredet worden? Für mich drängt sich das auf, weil die Gesellschaft mit 20.000 ha Flächen im Ruhrgebiet, Flächen aus dem Bergbau, genau dem Erfordernis, dass man etwas mit einem Industriezusammenhang im Revier haben will, entsprechen könnte.
Zweite Frage: Normalerweise habe ich ja eine Prioritäten-Reihenfolge. Ich habe dann jemanden an erster Stelle, und es ist durchaus plausibel, zu sagen: Duisburg wegen der Verkehrsanbindung. – Aber dann habe ich doch aus den Gesprächen, die ich geführt habe, eine Prioritätenabfolge, und wenn ich merke, dass das Grundstück kurzzeitig seinen Besitzer wechselt, kann ich doch noch einmal abwägen, ob ich dann nicht Priorität 2 oder 3 nehme. Also: Hat es eine solche Prioritätenliste gegeben? Und gibt es einen nachvollziehbaren Prozess, warum man sich dann trotzdem gegen Priorität 2 oder 3 entschieden hat?
Drittens. Ich bin etwas stutzig geworden, als Sie die Mietpreisgleitklausel angesprochen haben. Die Steigerung sei so exorbitant gewesen – so habe ich es verstanden, Sie können mich gerne korrigieren –, die Baukosten seien so explodiert, dass sich das drastisch im Mietpreis niedergeschlagen hätte. Jetzt kenne ich Mietpreisgleitklauseln, die man vereinbart, um bestimmte Indizes, die normal sind, damit aufzufangen. Dafür gibt es ja Vorgaben. Aber man vereinbart normalerweise doch nicht einen Freischein im Mietvertrag, wenn die Baukosten explodieren, dass ich mich dann so knebele, dass ich keine Ausstiegsmöglichkeiten mehr habe. Ist das völlig normal, oder ist das ein Stück weit nicht mehr nachvollziehbar gewesen? Haben Sie geprüft, ob die Vereinbarung der Gleitklausel ein normaler Vorgang ist oder ob das aus dem Rahmen fällt? Dadurch ist man ja zu der Entscheidung gekommen, das zu kaufen.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Zu der Frage der Standortauswahl: Da wir nicht so kundig sind, haben wir uns des Sachverstandes des Bauministeriums bedient. Das heißt, die Kollegen des Städtebaus haben uns zahlreiche Standorte genannt bzw. empfohlen, die wir dann gemeinsam mit dem BLB und dem LAV besucht haben. Die Kollegen des BLB haben sie nach einer Vielzahl von Kriterien bewertet.
Dazu gehörten die Nähe, die ich bereits ansprach, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die Baukosten usw. – alles das, was in der Beurteilung eine große Rolle spielt. Favorit war lange Zeit für die Landesregierung die Kokerei Zollverein, also klassische Brachen. Aber unter dem Strich – das hatte auch damit zu tun, dass erste Einschätzungen des Gebäudes und der Fläche in Duisburg sehr positiv waren – kam der BLB aus Kostengründen dazu, uns das Gebäude in Duisburg als sehr geeignet zu empfehlen.
MR Ralf Wehrmann (FM): Es ist üblich und normal, dass ich, wenn ich einen Bauvertrag abschließe, eine bestimmte Größenordnung des Gebäudes, was das Bauvolumen angeht, und den Baupreis, den ich habe, zugrunde lege und dass ich dann, wenn die Bausumme steigt, weil das Bauvolumen oder der Baupreis steigt, diesen gestiegenen Preis natürlich auch in der Miete abbilde. So ist das hier gewesen. Insofern ist das nichts Ungewöhnliches, sondern es ist einfach so, dass die Baupreise sehr drastisch gestiegen waren, was dann dazu geführt hat, dass sich der Mietpreis angepasst hat an diese gestiegenen Baupreise. Das ist etwas völlig Normales und in meinen Augen nicht zu beanstanden.
Christian Möbius (CDU): Es geht doch hier um den Mietvertrag – nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht – zwischen dem BLB und dem Land als Mieter. Ich habe Sie so verstanden, Herr Wehrmann, dass dann, wenn beispielsweise die Ressorts im Zuge der Planung Änderungswünsche haben und sich Kostensteigerungen ergeben, weil sie eine höhere Fläche haben wollen etc., natürlich der Mietpreis angepasst wird.
(Reiner Priggen [GRÜNE]: Ich habe es anders verstanden!)
MR Ralf Wehrmann (FM): Es war so angedacht: Es wird für den BLB gebaut, mit ei-er Miete, und der BLB überlässt dem Land für das Landesarchiv, ebenfalls über ei-e Miete, das von ihm angemietete Objekt. Und wenn ich eine Baukostensteigerung habe, habe ich automatisch auch eine Mietsteigerung. Das ist das Prinzip.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich möchte gerne nachfragen. Normalerweise miete ich doch etwas zu einem Preis pro Quadratmeter. Und dann gibt es Indizes mit Steigerungen. Büroflächen und Ähnliches, auch Sonderflächen für ein Archiv werden ja sicherlich in einer bestimmten Ebene gehandelt werden. Wenn ich nachher mehr Quadratmeter miete, muss ich natürlich auch mehr bezahlen; das ist eindeutig. Für mich ist aber die Frage wichtig: Was ist mit der exorbitanten Kostensteigerung, bevor der BLB gekauft hat?
Es drängt sich ja der Eindruck auf: Hier ist zunächst ein Vertrag mit einer bestimmten Miete abgeschlossen worden. Möglicherweise waren darin schon Bedingungen, die man normalerweise nicht akzeptiert. Und dann ist irgendwann gesagt worden: Jetzt nimmt der BLB demjenigen das Ganze ab. Da ist ja die Frage, ob es nicht sauber gewesen sein könnte. Wenn ich für 30 € eine Wirtschaftsimmobilie miete, und es gibt Indizes, die sich in normalem Rahmen bewegen, habe ich volles Verständnis dafür, wenn es Steigerungen gibt. Und wenn ich 1.000 qm mehr miete, zahle ich auch das mehr. Aber derartige Steigerungsraten, die davon abhängen, wie sich ein Architekt auf einer Großbaustelle austobt, und dann lande ich auf einmal bei dem Dreifachen und bin gezwungen zu kaufen, weil ich vorher so einen seltsamen Mietvertrag gemacht habe – da ist die Frage, ob das alles völlig korrekt gelaufen ist, in einem normalen Rahmen, oder ob Sie das überhaupt nicht geprüft haben.
MR Ralf Wehrmann (FM): Also: Wir haben das Jahr 2007. Zu dem Zeitpunkt, als der Mietvertrag gemacht wurde, hat man von beiden Seiten einen bestimmten Baupreis unterstellt und diesem Mietvertrag zugrunde gelegt, weil man die Planungen zum damaligen Zeitpunkt auf diesem Niveau gesehen hat. Das heißt, man hat die Bausumme, die man dem Mietvertrag zugrunde gelegt hat, an sich nach dem damals vorgesehenen Baustand, den man erreichen wollte, ausgerichtet. Ich möchte darauf hinweisen, dass es einen zweiten Architektenwettbewerb gegeben hat, bei dem der Siegerentwurf auch noch in dieser Größenordnung gelegen hat, die man im Mietvertrag zugrunde gelegt hat.
Reiner Priggen (GRÜNE): Darf ich eine Nachfrage stellen? – Sie sagen, man hat damals verhandelt. Wer waren die beiden Verhandlungspartner? Waren das der Private und der BLB? War das Erste, worauf sich die Steigerung bezieht, noch der Ver-trag zwischen dem Privaten und dem BLB? Muss ich das so verstehen?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ja.
Thomas Eiskirch (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe mitbekommen, dass Sie in Anbetracht der in Rede stehenden Persönlichkeiten eine sehr restriktive Auslegung der Geschäftsordnung für den heutigen Tag bevorzugen. Mir wurde ja auf Nachfrage deutlich gemacht, dass die Namen von Personen, die in Presseartikeln gegen ihren Willen oder nicht erkennbar mit ihrem Willen genannt worden sind, von mir augenscheinlich nicht erwähnt werden dürfen; ich dürfte diese hingegen zitieren, wenn sie freiwillig in der Presse ständen. – Ich halte das nach wie vor für eine ausgesprochen restriktive Auslegung der Geschäftsordnung, will mich aber bemühen, mich daran zu orientieren.
Ich will eine Frage stellen zu dem Artikel, der auf „derwesten.de“ erschienen ist und in dem es heißt: „Am 31. Januar 2007 kam in der Düsseldorfer Staatskanzlei eine vertrauliche Gesprächsrunde zusammen.“ Dann werden, mit Doppelpunkt beginnend, Persönlichkeiten aufgezählt, und die Aufzählung schließt mit: „… und eine Handvoll weiterer Teilnehmer, das neue Landesarchiv in Duisburg am Innenhafen auf dem Gelände des alten denkmalgeschützten Getreide-Speichers zu errichten“. Ich wüsste gerne, ob diese dort genannte Aufzählung unrichtig ist.
Vorsitzender Manfred Palmen: Ich darf vielleicht einmal sagen, Herr Eiskirch: Mit dem Untersuchungsausschuss, der hier in der vergangenen Legislaturperiode stattfand, und mit Auslaufen der Legislaturperiode ist die Handhabung des Schutzgutes „Mitarbeiter“ deutlich verschärft worden. Ich habe nur diese Position wiedergegeben. Es ist natürlich klar, dass ein Minister oder ein Staatssekretär weniger geschützt ist
(Thomas Eiskirch [SPD]: Auch ein Ministerpräsident!)
– der Ministerpräsident selbstverständlich auch. Aber so weit es um Mitarbeiter geht, ist das nach meiner Kenntnis seit Beginn der Legislaturperiode bei allen Kleinen Anfragen sehr restriktiv gehandhabt worden. Deshalb habe ich darauf hingewiesen, Herr Eiskirch, wir haben ja immer eine Lösungsmöglichkeit: Wir können in die nicht-öffentliche Sitzung gehen, wenn Sie sagen, dass Sie eine Frage in die Richtung stellen möchten.
(Thomas Eiskirch [SPD]: Nach Ihrer Interpretation dürfte ich ja die Namen teilweise auch in öffentlicher Sitzung nennen!)
– Herr Eiskirch, ich interpretiere nicht, sondern ich teile Ihnen die Rechtsauffassung mit, die der Landtag mit dem Auslaufen der letzten Legislaturperiode nach dem Untersuchungsausschuss eingenommen hat. Wenn ich interpretieren würde, würde ich sagen: Wir können Ihr Problem lösen, indem Sie Ihre Frage in nichtöffentlicher Sitzung stellen.
Thomas Eiskirch (SPD): Das ist derzeit nicht mein Interesse.
Vorsitzender Manfred Palmen: Soll denn die Frage, die Sie bisher gestellt haben, beantwortet werden? – Herr Wehrmann, bitte.
MR Ralf Wehrmann (FM): Herr Vorsitzender, mein Name taucht, glaube ich, in der „WAZ“ nicht auf. Ich habe an dieser Sitzung nicht teilgenommen und kann deshalb nichts dazu sagen.
Vorsitzender Manfred Palmen: Die Frage ist von Herrn Eiskirch allgemein gestellt worden. Will jemand aus der Staatskanzlei bzw. der Kulturabteilung der früheren Staatskanzlei dazu etwas sagen? – Bitte, Herr Engels.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ich bin zwar in dem Artikel wohl nicht genannt worden, ich war aber dabei. Ich gehöre zu der „Handvoll weiterer Teilnehmer“. Wie ich eben schon sagte: Die politische Spitze der Kultur und hochrangige Vertreter der Stadt Duisburg waren dort. Darauf muss ich mich aber bitte beschränken.
Thomas Eiskirch (SPD): Meine Frage war nicht darauf gerichtet, dass Sie mir Personen nennen. Meine Frage war, ob die in der Zeitung veröffentlichte Namensliste richtig ist. Beschränken wir uns auf die Genannten; wir haben ja gerade über das schutzwürdige Interesse die Ausführung bekommen, dass Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und auch Oberbürgermeister, weil im öffentlichen Leben stehend, von mir hätten persönlich benannt werden dürfen. Meine Frage war aber ausschließlich, ob diese Aufzählung unrichtig ist. Das ist eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Mir liegt dieser Artikel jetzt nicht vor.
Thomas Eiskirch (SPD): Kein Problem! Ich bringe Ihnen den Artikel rüber.
(Thomas Eiskirch [SPD] übergibt Herrn Engels den Presseartikel.)
MR Norbert Engels (MFKJKS): Dazu kann ich nur sagen, dass diese Aufzählung nicht richtig ist.
Martin Börschel (SPD): Ich habe noch zwei Fragen: Die eine setzt auf die Fragen von Herrn Priggen auf. Hat denn wirklich die hohe Preissteigerung – damit meine ich jetzt nicht die Baukostensteigerung in der späteren Phase, sondern die Steigerung der Grundstückserwerbskosten – nicht dazu geführt, eine erneute Abwägung vor dem Hintergrund bisheriger Prioritäten zu treffen? Und wenn nein, warum nicht? Sie haben doch gerade noch von einem lange favorisierten anderen Standort gesprochen. Man mag ja trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass die am Ende getroffene Standortentscheidung die richtige ist. Mich interessiert nur: Hat es noch einmal eine Abwägung gegeben? Wenn ja, mit welchen Kriterien? Wenn nein, warum nicht?
Zweite Frage: Wir haben ja hier von einer Runde am 31. Januar 2007 gesprochen. Was ich meine, kann in dieser oder in anderen Runden gewesen sein. Hat der von Ihnen benannte Spitzenvertreter der Stadt Duisburg oder haben andere Vertreter der Stadt Duisburg denn zu erkennen gegeben oder sogar noch konkreter festgehalten, dass die Stadt Duisburg diesen zur Errichtung des Archivs notwendigen Speicher kaufen wollte? Ist das als Absicht oder noch konkreter seitens der Stadt Duisburg artikuliert worden? Und wenn ja, in welcher Runde?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Zur zweiten Frage: Das ist mir nicht bekannt. Ich habe das später auch einmal gehört, aber in jüngerer Vergangenheit. Wir haben weitere Gespräche mit Vertretern der Stadt Duisburg geführt, die darin endeten – auch mit Vertretern des LAV und des BLB –, dass die Stadt Duisburg, die ja teilweise Miteigentümerin der Fläche ist oder Rechte auf den Grundstücken hat, in jedem Fall alles in ihren Kräften Stehende tun will, um für den BLB den Einstieg, den Kontakt zu den Eigentümern herzustellen und ihn bei Kaufverhandlungen zu unterstützen. Ansonsten war ich nicht beteiligt; auch an konkreten Kaufverhandlungen war ich nicht beteiligt.
Zu Frage 1: Diese Frage stellte sich für uns im Hinblick auf die Standortentscheidung nicht, weil unabhängig von der Frage, ob der BLB Eigentümer des Grundstücks wird oder nicht, die Umstände unter dem Strich so günstig waren, dass – auch durch diese Mietvertragsgestaltung, das heißt, die zwischengeschaltete Miete des BLB und das Land im Untermietverhältnis – alles für diesen Standort sprach.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dreht sich jetzt ein bisschen im Kreise. Im Kern – und das ist ja der Grund für die Antragstellung der SPD-Fraktion gewesen – ist in Frageform, juristisch gerade so tragbar, die Behauptung aufgestellt worden, dem Land sei ein Schaden in einer Größenordnung von mindestens 20 Millionen € entstanden – durch „Verrat“. Das hat Herr Börschel in seiner Presseerklärung vom 28. Oktober so zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie es direkt behauptet hätten, Herr Börschel, hätten Sie sich entsprechenden rechtlichen Schritten gegenübergesehen. Sie haben es raffiniert gemacht. Und dann verdächtigen Sie bestimmte Personen, beispielsweise den Oberbürgermeister von Duisburg, er könnte damit zu tun gehabt haben.
Deswegen habe ich eingangs schon die Frage gestellt, und ich will sie jetzt in Richtung von Herrn Engels wiederholen: Ist es völlig ausgeschlossen, dass der neue Erwerber, von dem der BLB dann gekauft hat, auch auf anderem Wege als durch einen Verrat von irgendwelchen in der Pressemitteilung genannten Personen Kenntnis von dem geplanten Grundstücksgeschäft erhalten hat? – Ich halte das für von erheblicher Bedeutung; denn wenn die Kenntnis auch auf anderem Weg erfolgt sein kann, darf man nicht einzelne Personen im Wege der Verdächtigung öffentlich an den Pranger stellen.
(Martin Börschel [SPD]: Man muss es aufklären!)
Dann habe ich die Frage: Kann man den Wert der – ich sage es einmal so – Manipulation durch den neuen Eigentümer, also durch Architektenwettbewerb und alles, was dazu gehört, beziffern?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Das kann ich baufachlich nicht bzw. zur zweiten Frage kenne ich die Zahlen nicht.
Vorsitzender Manfred Palmen: Wollen Sie zu der ersten Frage etwas sagen, Herr Engels?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ja, gerne. – Ich kann sagen, dass wir uns auch gefragt haben, wie das geschehen ist bzw. wieso die Presse die Landesregierung mit dem Vorwurf konfrontierte, da seien Indiskretionen begangen worden. Dazu kann ich allerdings nur sagen, dass unsere Kontakte mit der Innenhafen-Gesellschaft nicht unverborgen geblieben sind. Wir hatten zwar völlige Diskretion über diese Überlegungen vereinbart, aber im September 2006 hat es in der örtlichen Presse Berichterstattungen darüber gegeben, dass das Landesarchiv möglicherweise nach Duisburg kommt. Gleichzeitig hat es um den Zeitraum herum eine Kleine Anfrage von Herrn Keymis gegeben, ob es richtig sei, dass das Landesarchiv nach Zollverein, Essen, kommt. Es gab also in dem Zusammenhang auch öffentliche Erörterungen und Betrachtungen zu dem Thema.
Vorsitzender Manfred Palmen: Jetzt war noch eine weitere Frage an Herrn Wehrmann gerichtet.
MR Ralf Wehrmann (FM): Können Sie Ihre Frage vielleicht wiederholen?
Christian Weisbrich (CDU): Sie haben ja eine Vorlage für den Verwaltungsrat gemacht – Sie oder wer auch immer. Der Verwaltungsrat hat ja aufgrund einer Vorlage entschieden. Kann man den Wert der Architektenwettbewerbe und der erfolgten Planungen beziffern? Haben Sie das irgendwo erfasst?
MR Ralf Wehrmann (FM): Mir sind jetzt keine Daten oder Summen bekannt, die den Wert der Architektenwettbewerbe zusammengefasst haben. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen dazu eine Auskunft zu geben.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, wenn eine Entscheidungsvorlage gemacht wird, dann muss doch darin irgendeine Begründung für solche Preisverschiebungen stehen.
MR Ralf Wehrmann (FM): Wir sind jetzt wieder in der Situation, dass wir über den Verwaltungsrat reden. Da möchte ich doch bitten, dass wir die Vertraulichkeit wahren.
Christian Weisbrich (CDU): Na, das ist ja schön. Es wird also wild verdächtigt, und es wird nicht klargestellt.
Vorsitzender Manfred Palmen: Ich darf noch einmal sagen: Wenn wir das wollen, haben wir eine Lösungsmöglichkeit dadurch, dass wir in den nichtöffentlichen Teil gehen. Dann kann das alles beantwortet werden. Wird das gewünscht? – Ich sehe, Herr Eiskirch wünscht das, Herr Weisbrich wünscht das. Dann habe ich vorher aber noch eine Wortmeldung von Herrn Priggen.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich habe zwei kurze Fragen. Kann einer der Herren uns in der Größenordnung beziffern, wie hoch der Schaden ist?
Und jetzt will ich Ihnen folgen, Herr Weisbrich, bei der Frage der Indiskretionen. Das ist ja nichts, was Ihnen unbekannt ist und was nicht auch in Kommunen auftaucht, dass irgendwelche Leute von irgendwoher mitkriegen, da ist was im Busch, und sich dann engagieren. Egal, wer es war, da will ich gar nichts unterstellen – ich würde aber erwarten, dass man Sicherungsmechanismen einbaut. So kenne ich das auch aus Bauverwaltungen: Wenn man merkt, dass einem da in die Tasche gegriffen wird, weil Leute sehr geschickt sind, sollte man möglichst dafür noch einen Plan B in der Hand haben. Das habe ich manchmal auf kommunaler Ebene nicht, aber bei der Frage, ob ich im Ruhrrevier so etwas neu baue, habe ich doch Alternativen.
Noch einmal meine Fragen: Gibt es eine Größenordnung des Schadens, der egal von wem oder durch guten Jagdinstinkt entstanden ist? Und zweitens: Gibt es einen Sicherheitsmechanismus, der dann gegriffen hat, und einen nachweisbaren Abwägungsprozess, dass man gesagt hat, selbst wenn da jemand schneller gewesen ist, gibt es für uns nach Abwägung mit einem Standort B trotzdem vor diesem Hinter-grund diesen Standort, den wir nehmen? – Kann das beantwortet werden?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, zu beantworten, was beim Vergleich von Standorten günstiger und was nicht günstiger gewesen wäre. Das war ja, glaube ich, die Frage, die Sie gestellt haben.
Thomas Eiskirch (SPD): Gab es denn, nachdem klar wurde, das Ganze wird teurer, als wenn man es direkt erworben hätte, eine erneute Abwägung gegenüber konkreten anderen Standorten, die vorher schon im Gespräch waren, oder ganz neuen Standorten, um einen neuen Abwägungsprozess unter den dann vorherrschenden Kautelen vorzunehmen?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Es hat einen solchen Abwägungsprozess gegeben, allerdings zeitlich deutlich später, als uns nämlich der BLB mit Preissteigerungen konfrontierte, die sich aufgrund der Entwicklung ergeben haben, die wir nur sehr schwer nachvollziehen und akzeptieren konnten. Da hat es in der Tat Überlegungen gegeben, sich zum Beispiel von dem preisgekrönten Entwurf aus dem Architektenwettbewerb zu verabschieden, sprich einen schlichteren Nutzbau oder Ähnliches zu errichten.
Thomas Eiskirch (SPD): Ich habe Sie so verstanden, dass es nicht zu dem Zeitpunkt, wo deutlich wurde, dass dieses Gelände deutlich teurer wird, eine solche Abwägung gegeben hat, sondern erst dann, als – nachdem man trotz der höheren Kosten weiter an dem Gelände festgehalten hat – im Zuge der baulichen Errichtung weitere Kostensteigerungen gekommen sind. Also gab es erst zu diesem Zeitpunkt die Abwägung und nicht schon zu dem Zeitpunkt, als die Kosten für den Grundstückserwerb selber so deutlich gestiegen sind. Habe ich das richtig verstanden?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Da muss ich noch einmal auf unsere Position als Mieter und Nutzer zurückkommen. Wir sind nicht diejenigen, die die Preisentwicklung beurteilen können und die dabei sind. Wir wurden konfrontiert mit dieser Situation im Rahmen von Preissteigerungen, von Mietanhebungen. Das war deutlich später. Vor-her hatten wir keine Kenntnis über einen Preis, auch nicht über den Mietvertrag des BLB mit den Eigentümern etc.
Thomas Eiskirch (SPD): Das heißt, die erneute Abwägung und Ihre Kenntnis von den Preissteigerungen gab es zu einem Zeitpunkt, zu dem sich der BLB bereits zu den grundsätzlichen höheren Konditionen gebunden hatte? Habe ich das richtig verstanden?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ja.
Martin Börschel (SPD): Dann ist doch die Folgefrage konsequenterweise an den BLB gerichtet. Da das Land ja offensichtlich eine kommode Situation hatte – Mietvertrag zu festen Konditionen – und der BLB sozusagen auffangen musste, ob er das noch darstellen kann oder nicht, fragt sich: Hat es denn beim BLB zu dem Zeitpunkt der erhöhten Grundstückserwerbskosten eine Abwägung gegeben, den vorhandenen Mietvertrag mit dem Standort „möglichst Schifferstraße Duisburg“ – so ähnlich war es ja wohl formuliert – auf eine andere Art und Weise zu erfüllen?
MR Ralf Wehrmann (FM): Vom Ablauf her war es ja so, dass der BLB den Mietver-trag schon abgeschlossen hatte. Später stellte sich heraus, dass die Bausumme teurer wird. Das heißt, von daher war der BLB mietvertraglich gebunden.
(Martin Börschel [SPD]: Aber nicht für den Standort!)
– Doch. Der BLB hatte ja mit dem Grundstückseigentümer einen Mietvertrag abgeschlossen. Dieser Mietvertrag bezog sich auf die Errichtung eines Gebäudes. Damit war der BLB vertraglich gebunden.
Thomas Eiskirch (SPD): Noch eine Frage in Richtung BLB! Zu dem Zeitpunkt, als dem BLB klar wurde, dass das direkte Geschäft für ihn nicht möglich war, sondern dass er zu den anderen Konditionen des Erwerbs des Grundstücks in das Geschäft mit dem fremden Dritten eintreten muss, dass es also eine deutliche Steigerung gibt, hat es da eine Abwägung gegeben, ob es noch Sinn macht – nachdem der Eigenerwerb nicht geklappt hat und klar wurde, dass der Erwerb zu anderen Konditionen noch möglich war? Gab es zu diesem Zeitpunkt eine erneute Abwägung mit schon geprüften oder weiteren alternativen Standorten, ob diese Veränderung auf dem Hintergrund von anderen Möglichkeiten noch tragbar ist?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich kann nur wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, Herr Eiskirch. Als die Baupreissteigerungen bekannt wurden, gab es eine vertragliche Bindung.
Thomas Eiskirch (SPD): Noch einmal! Die Baupreissteigerungen sind doch, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, aus zwei Dingen zusammengesetzt: aus dem, was durch die exorbitante Verteuerung des Grundstückserwerbs, wenn auch nicht durch den BLB, entstanden ist, und durch wirkliche klassische Baupreissteigerungen im Verfahren. Jetzt mache ich es noch deutlicher: Gab es nach Kenntnisnahme des ersten Steigerungsprozesses, der sozusagen mit der Spekulation in dem Grund und Boden begründet ist, einen erneuten Abwägungsprozess? – Wir können die Kaskade gleich auch noch kleiner machen, wenn es nötig ist.
Vorsitzender Manfred Palmen: Augenblick! Es kann sein, dass Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind. Aber es ist eine Antwort gegeben worden. Ich will das nur gesagt haben. – Bitte, Herr Wehrmann.
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich kann nur noch einmal betonen: Ich glaube, wir unterscheiden uns hier im Sachverhalt, Herr Eiskirch. Wir haben die Situation, dass der BLB einen Mietvertrag abgeschlossen hatte, und zwar nicht mit der Staatskanzlei, sondern mit den Grundstückseigentümern. Das hatte ich eingangs gesagt. Und dann sind die Baupreissteigerungen zum Tragen gekommen. Damit hatten wir die Situation, dass der BLB sich mietvertraglich gebunden hatte. Ich glaube, Sie gehen von einem anderen Sachverhalt aus.
(Martin Börschel [SPD]: Es gibt doch zwei Mietverträge: den des Landes mit dem BLB und den des BLB mit dem privaten Grundstückseigentümer!)
– Genau. – Sie zielen aber doch jetzt auf die Baupreissteigerungen ab.
Thomas Eiskirch (SPD): Nein! Ich will es noch einmal deutlich machen: Ich ziele auf den Zeitpunkt ab, als der BLB gemerkt hat – ich sage es einmal umgangssprachlich –: „Verdammt, jetzt kann ich das Grundstück nicht selber kaufen und mit irgendwem darauf etwas bauen, um es dem Land zu vermieten, sondern jetzt gehört das einem, der mir ein Gesamtangebot macht für das, was darauf errichtet werden soll!“ – So habe ich den Sachverhalt doch hoffentlich richtig verstanden. Zu dem Zeitpunkt, als diese Erkenntnis beim BLB fruchtete, also nicht, als der Bau selber hinterher teurer wurde, sondern als klar war, dass der BLB es zu den Konditionen nicht mehr selber machen konnte, sondern nur noch mithilfe eines nicht wirklich frei ausgesuchten Dritten, zu dem Zeitpunkt musste man doch überlegen: Lasse ich mich auf das ein, was plötzlich x-fach teurer ist, oder gucke ich mich um nach einem neuen Standort und lasse den, der da spekuliert hat, ins Leere laufen? Das ist doch die simple Frage. Meine Frage ist: Gab es diese Abwägung?
MR Ralf Wehrmann (FM): Zu dem Zeitpunkt, den Sie gerade beschrieben haben, war das noch nicht x-fach teurer, sondern da ging man noch davon aus, dass die Bausumme die gleiche bleibt. – Um Ihre Frage zu beantworten: Ich habe keine Kenntnis darüber, welche Entscheidungen beim BLB und welche Erörterungen zu dem Zeitpunkt getroffen worden sind. Dazu kann ich im Moment überhaupt keine Auskunft geben.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, gab es nach Ihrem Kenntnisstand auf die Entscheidungsstrukturen im BLB von irgendeiner Seite eine externe Einflussnahme – beispielsweise aus dem Bereich der Politik? Oder ist das eine Situation, die der BLB selbst in Eigenverantwortung so durchstrukturiert hatte?
MR Ralf Wehrmann (FM): Grundsätzlich ist der BLB von seiner gesamten Struktur her so angelegt, dass er Grundstücksgeschäfte eigenverantwortlich durchführen kann. Das ist damit begründet, dass der BLB ein Bau- und Immobilienbetrieb des Landes ist, der entsprechenden Fachverstand verfügbar hat und vorrätig hält.
Zu der anderen Frage, die Sie mir gestellt haben, Herr Weisbrich, ob es irgendwelche Einflussnahmen gegeben hat: Das ist nicht im Rahmen meiner Wahrnehmung.
Vorsitzender Manfred Palmen: Jetzt stellt sich für mich die Frage: Gibt es bei der Antwortlage noch Bedarf, in nichtöffentlicher Sitzung Fragen zu stellen?
(Zuruf von der SPD: Ja!)
– Wenn das der Fall ist, dann muss ich jetzt nach § 55 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung, sofern es dagegen keinen Widerspruch gibt, die Öffentlichkeit ausschließen und die Nichtöffentlichkeit herstellen. Gibt es dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich alle, die mit diesem Verhandlungsgegenstand nicht unmittelbar zu tun haben, bitten, den Saal für den Zeitraum der Nichtöffentlichkeit zu verlassen. ..."
Quelle: Sitzungprotokoll APr 15/57
Ich möchte noch auf § 55 der Geschäftsordnung hinweisen: Für den Fall, dass bei der Auskunft Namen etc. angesprochen werden, müssen wir die Nichtöffentlichkeit herstellen. – Wer antwortet für die Landesregierung? – Herr Wehrmann, bitte.
MR Ralf Wehrmann (FM): Meine Damen und Herren! Sie haben von uns Auskunft zu der Frage verlangt, wie das Bauvorhaben Landesarchiv vonstatten gegangen ist. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass wir derzeit öffentlich tagen, sodass ich keine Details nennen kann; darauf hat der Vorsitzende schon hingewiesen.
Wir haben das Grundstück im Jahre 2008 von einer Gesellschaft erworben, die zu dem Unternehmenskreis Kölbl & Kruse gehört. Das Grundstück dient dazu, das Lan-desarchiv des Landes Nordrhein-Westfalen – nach Durchführung entsprechender Baumaßnahmen – zu beherbergen. Es ist der ehemalige Getreidespeicher, der jetzt das neue Landesarchiv als Gedächtnis des Landes Nordrhein-Westfalen beherbergen wird; dort sollen die Archivbestände gelagert werden.
Nach den Plänen der österreichischen Architekten Ortner & Ortner entsteht im Duisburger Innenhafen in einer Kombination von Alt- und Neubau eine Landmarke. Die bisher an verschiedenen Standorten lokalisierten Bestände des Landes werden dort zusammengeführt. Es sind Schriften, Schriftgut, Amtsbücher und Urkunden aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart, Karten, Pläne, Filme und Fotos.
Ausgangspunkt war 2004 eine Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass die verschiedenen Standorte des Landesarchivs, die wir bisher haben, an einem Stand-ort zusammengelegt werden sollten. Das ehemalige Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf mit zwei Außenstellen und das Personenstandsarchiv in Brühl sollen jetzt in Duisburg konzentriert werden. Man hat damals, bevor man diese Standortentscheidung getroffen hat, umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die auch andere Punkte im Ruhrgebiet als Standort des Landesarchivs vorgesehen haben. Zum Schluss ist man dann auf diesen Speicher im Duisburger Innenhafen gekommen. Er wurde als idealer Standort für das Landesarchiv angesehen.
Zu Beginn des Projekts wurde, da das Land nicht über die entsprechenden Grundstücke verfügte, sondern eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft Eigentümerin der betroffenen Grundstücke war, versucht, eine Planung zu errichten. Die Grundstücke, um die es geht, sind im Jahre 2007 von der Voreigentümerin verkauft worden. Gleichzeitig hat der Erwerber dieser Grundstücke auch noch im Jahre 2007 zusätzliche Grundstücke von der Stadt Duisburg, nämlich erbbaurechtsbelastete Grundstücke, erworben.
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb hat, weil er nicht im Besitz dieser Grundstücke war, auch im Jahre 2007 mit der neuen Grundstückseigentümerin verhandelt und ei-nen Mietvertrag abgeschlossen, der sicherstellen sollte, dass auf diesem Grundstück von der Eigentümerin das Grundstück entwickelt, ein Gebäude errichtet, das dann zusammen mit dem schon bestehenden Speichergebäude an das Land zur Beherbergung des Landesarchivs vermietet werden sollte.
Im Jahre 2007 fanden Architekturwettbewerbe statt, die von der jeweiligen Grund-stückseigentümerin ausgelobt worden sind. Ende 2007 hat man dann in der Situation des Ergebnisses eines Architektenwettbewerbs einen Siegerentwurf gefunden, der das dort befindliche Speichergebäude – zusätzlich mit einem Anbau als Welle – für das Landesarchiv vorgesehen hat. Während des Architektenwettbewerbes wurden natürlich auch Kostenschätzungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Kostenschätzungen lag der Siegerentwurf im Bereich dessen, was in dem Mietvertrag mit der Eigentümerin der Grundstücke vereinbart worden war.
Im Folgezeitraum hat man dann die Planung des Siegerwettbewerbs konkretisiert und versucht, im Rahmen von Planungen die Baukosten, die erforderlich sind, um das Landesarchiv auf diesem Grundstück zu errichten, zu verifizieren. Dabei zeigte sich, dass mit deutlichen Baukostensteigerungen zu rechnen war. Zum einen waren die Rohstoff- und damit auch die Stahlpreise gestiegen. Es war erforderlich, das Gebäude mit einer Stahlkonstruktion zu ertüchtigen. Zum anderen gab es die normalen Baupreissteigerungen und darüber hinaus die Situation, dass man bei den Planungen feststellte, dass Flächen gegenüber der ursprünglich eingeplanten Fläche erweitert werden mussten und im Inneren des Gebäudes weitere Maßnahmen erforderlich waren, die zu einer deutlichen Kostensteigerung führten.
Diese im Zuge der Planung festgestellten Kostensteigerungen führten dazu, dass die ursprünglich im Mietvertrag vereinbarte Miete nicht gehalten werden konnte. Sie wäre aufgrund einer Mietanpassungsklausel, die im Mietvertrag enthalten war, drastisch gestiegen. Daraufhin ist der BLB im Jahre 2008 zu dem Ergebnis gekommen, dass man Kaufpreisverhandlungen zum Ankauf dieses Geländes mit der Eigentümerin führen sollte, und hat dann noch im Jahre 2008 dieses Grundstück erworben.
Um die Probleme bei der Baukostensteigerung weiter zu sondieren, ist man hingegangen und hat erhebliche Vorplanungen geleistet und dann im Frühjahr 2010 einen endgültigen Bauvertrag mit dem errichtenden Bauunternehmen abgeschlossen. Im April 2010 war der offizielle Spatenstich. Derzeit sind die Baumaßnahmen im Gange, die zur Ertüchtigung des Getreidespeichers bzw. zur Errichtung der Welle führen sol-len.
Sofern Sie noch weitere Details zu dem Bauprojekt erfahren möchten, komme ich Ih-rem Informationsbedürfnis gerne nach, kann das aber aus dem vom Vorsitzenden eingangs genannten Grund nur in nichtöffentlicher bzw. vertraulicher Sitzung tun.
Vorsitzender Manfred Palmen: Vielen Dank, Herr Wehrmann. – Ich habe zwei Wortmeldungen vorliegen. Bitte, Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Ich würde gerne zunächst noch etwas zum Grundsatz erfahren. Der Vortrag war ja instruktiv; es ist aber ein bisschen kompliziert, das Ent-scheidende herauszudestillieren. Deshalb will ich fragen, ob ich das richtig verstanden habe.
Also: Irgendwann im Jahre 2007 hat irgendwer die Entscheidung getroffen, dass das Landesarchiv einen bestimmten Standort in Duisburg bekommen soll. Um diesen Zeitpunkt herum war natürlich klar, dass man bestimmte Grundstücke braucht. Die wollte man gerne von einem privaten Investor erwerben, jedenfalls in Teilen. Dieser private Investor hat sie dann aber nicht, wie gewünscht, an das Land oder eine landeseigene Gesellschaft verkauft, sondern an einen privaten Dritten, dessen Namen Sie uns ja soeben genannt haben.
Wenn das so richtig sein sollte – das scheint mir der erste relevante Komplex zu sein –, würde mich interessieren: Wer hat eigentlich wann in welcher Runde die Entscheidung getroffen, dass dort der Standort des Landesarchivs sein soll?
Zweitens: Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, welches Ziel der tatsächliche Erwerber mit dem Ankauf verfolgt hat? Haben Sie irgendeine Möglichkeit der Erkenntnis, was der eigentlich damit machen wollte? Wollte er es brachliegen lassen, etwas anderes bauen oder es teuer weiterverkaufen?
Drittens: Hat der Umstand, dass möglicherweise ein anderer privater Dritter dem Land notwendige Grundstücke sozusagen vor der Nase weggeschnappt hat, irgendwo landesseitig Argwohn erregt? Und hat das zu Prüfungen geführt, ob es da undichte Stellen oder Ähnliches gegeben haben könnte?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich fange mit der zweiten Frage an, Herr Börschel. Mir ist nicht bekannt, was der Erwerber des Grundstücks, der es letztlich an den BLB vermietet hat, mit diesem Grundstück konkret geplant hatte. Dazu kann ich keine Aussage machen.
Wir haben jetzt die Situation gehabt, dass der BLB dieses Grundstück angemietet hat. Wir haben keine Untersuchungen, Erörterungen, Prüfungen vorgenommen, warum das Grundstück zum damaligen Zeitpunkt, den wir gerade beschrieben haben, an den privaten Dritten verkauft worden ist.
Zu den weiteren Fragen würde ich die Kollegen aus dem heute für Kultur zuständigen Ministerium um Beantwortung bitten, weil wir keinerlei Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte in den Details haben, die Sie nachgefragt haben.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Die damalige Kulturabteilung der Staatskanzlei hatte den Auftrag, die Standortsuche vorzunehmen, nachdem sich die Landesregierung entschieden hatte, eine neue Fläche außerhalb Düsseldorfs zu finden, sprich konkret eine Industriebrache möglichst im Revier. Wir haben mit dem BLB und dem Nutzer, also dem Landesarchiv, zehn oder zwölf Standorte genauer untersucht. Auch unter dem Aspekt, dass viele Beschäftigte in Brühl und in Düsseldorf von der Verlagerung natürlich massiv betroffen sind, hat uns der Standort in Duisburg, auch aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage zu Düsseldorf, überzeugt.
Es hat dann Gespräche mit der Innenhafen-Entwicklungsgesellschaft gegeben. Der BLB wurde dann von uns gebeten, die Möglichkeiten, die sich dort im Innenhafen er-geben, genauer zu prüfen.
Die Entscheidungen, diese Planungen zu vertiefen, wurden auf der politischen Ebene, initiiert durch die Staatskanzlei bzw. den Kulturstaatssekretär, getroffen mit dem Ergebnis, dass im Dezember 2006 ein Mietvertrag mit dem BLB geschlossen wurde über die Errichtung eines Neubaus für den rheinischen Teil und die Leitung des Landesarchivs an einem noch zu bestimmenden Ort, aber möglichst an der Schifferstraße in Duisburg. Es wurde auch aufgenommen, dass für den Fall, dass der BLB die Eigentumsrechte nicht würde erwerben können – uns war ja damals nicht bekannt, wer genau Eigentümer ist –, er möglichst ein Untermietverhältnis für uns herstellen soll, wie es dann auch geschehen ist. Es gab noch die weitere Option für den Fall, dass dieses nicht gelingen sollte: Dann sollten der Landesregierung andere geeignete Grundstücke vom BLB vorgestellt werden.
Martin Börschel (SPD): Ich möchte an Sie, Herr Wehrmann, zunächst eine Nach-frage stellen. Sind Medienberichte richtig, dass es mit dem ursprünglichen privaten Eigentümer sehr konkrete Verhandlungen über den Eigentumserwerb gegeben hat, die dann kurz vor dem Notartermin geplatzt sind? Hat das nicht einen Nachforschungsbedarf – ich habe es eben Argwohn genannt – bei Ihnen erweckt, und was ist darauf erfolgt?
Dann eine Konkretisierung einer Frage in folgende Richtung: Medien berichteten ja auch darüber, dass es am 31. Januar zu der von mir vorhin nur sehr grob angespro-chenen Runde gekommen sein soll. Hat es sie gegeben? Wer war dabei? Welche Entscheidung ist da formell oder informell getroffen worden?
Vorsitzender Manfred Palmen: Moment! Die Frage, wer dabei war, kann nicht in öffentlicher Sitzung beantwortet werden.
(Thomas Eiskirch [SPD]: Es steht doch in der Zeitung!)
– Entschuldigung, Herr Eiskirch. Die Regeln stellt unsere Geschäftsordnung auf.
MR Ralf Wehrmann (FM): Sie hatten gefragt, Herr Börschel, ob jemand vonseiten des Landes mit dem ursprünglichen Grundstückseigentümer Verhandlungen aufgenommen hat. Das ist mir nicht bekannt. Ich kann nur für BLB sprechen, weil das mein Zuständigkeitsbereich ist. Mir ist nicht bekannt, dass der BLB mit dem Grundstückseigentümer intensive oder förmliche Verhandlungen geführt hat
MR Norbert Engels (MFKJKS): Es hat ein Gespräch gegeben, in dem hohe Vertreter – die Verwaltungsspitze – der Stadt Duisburg das Interesse der Stadt an der An-siedlung des Archivs deutlich gemacht haben. Es wurde dann auch hinsichtlich der Grundstücksverhältnisse gefragt: Wer kann dem BLB behilflich sein, da Kontakte herzustellen? – Dazu wurde Hilfestellung in Aussicht gestellt. Mehr nicht.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, ich möchte erst einmal die Strukturen klären. Wir haben einen alten Grundstückseigentümer, einen neuen Grundstückseigentümer und dann den Letzterwerber BLB. Ist das richtig so? – Ja. Frage: Ist es zutreffend, dass der neue Grundstückseigentümer Verhandlungsführer für den alten Grundstückseigentümer war, was die Verwertung des Grundstücks anbelangt?
Zweite Frage: Ist es zutreffend, dass aufgrund dieses Sachverhalts die Information an den neuen Grundstückseigentümer aus anderen Quellen gekommen sein kann als durch „Insider“ bzw. „Verrat“ durch die Stadt Duisburg oder wen auch immer? Wenn der neue Grundstückseigentümer der Verhandlungsführer des alten war, kann er doch seine Information auf ganz andere Art und Weise erhalten haben, als zunächst einmal unterstellt worden ist.
Dritte Frage: Herr Börschel hat darauf hingewiesen, dass das irgendwo Interesse erweckt haben muss, wie die Kostenentwicklung war. Ist es zutreffend, dass es im Verwaltungsrat des Bau- und Liegenschaftsbetriebes eine ausführliche Vorlage gegeben hat, worin diese Dinge geschildert wurden? Und ist es weiter zutreffend, dass dieser Vorlage dann die Mitglieder des Verwaltungsrates zugestimmt haben?
MR Ralf Wehrmann (FM): Herr Weisbrich, Sie haben zuerst gefragt, ob der neue Grundstückseigentümer Verhandlungsführer des alten war. – Dazu habe ich überhaupt keine Erkenntnisse; das weiß ich nicht.
Ihre zweite Frage war, ob da Informationen aus irgendwelchen Bereichen geflossen sein könnten. – Auch darüber ist mir nichts bekannt; ich habe keine Erkenntnisse darüber. Das war nicht Gegenstand meiner Wahrnehmung.
Was die Behandlung dieses Themas im Verwaltungsrat angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass die Beratungen vertraulich sind und dass ich dazu hier keine Auskunft geben kann.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich habe zwei, drei Kleinigkeiten. Die erste Frage: Wenn man die Vorgabe „Grundstücke im Revier“ hat – ist mit der Montan-Grundstücksgesellschaft auch darüber geredet worden? Für mich drängt sich das auf, weil die Gesellschaft mit 20.000 ha Flächen im Ruhrgebiet, Flächen aus dem Bergbau, genau dem Erfordernis, dass man etwas mit einem Industriezusammenhang im Revier haben will, entsprechen könnte.
Zweite Frage: Normalerweise habe ich ja eine Prioritäten-Reihenfolge. Ich habe dann jemanden an erster Stelle, und es ist durchaus plausibel, zu sagen: Duisburg wegen der Verkehrsanbindung. – Aber dann habe ich doch aus den Gesprächen, die ich geführt habe, eine Prioritätenabfolge, und wenn ich merke, dass das Grundstück kurzzeitig seinen Besitzer wechselt, kann ich doch noch einmal abwägen, ob ich dann nicht Priorität 2 oder 3 nehme. Also: Hat es eine solche Prioritätenliste gegeben? Und gibt es einen nachvollziehbaren Prozess, warum man sich dann trotzdem gegen Priorität 2 oder 3 entschieden hat?
Drittens. Ich bin etwas stutzig geworden, als Sie die Mietpreisgleitklausel angesprochen haben. Die Steigerung sei so exorbitant gewesen – so habe ich es verstanden, Sie können mich gerne korrigieren –, die Baukosten seien so explodiert, dass sich das drastisch im Mietpreis niedergeschlagen hätte. Jetzt kenne ich Mietpreisgleitklauseln, die man vereinbart, um bestimmte Indizes, die normal sind, damit aufzufangen. Dafür gibt es ja Vorgaben. Aber man vereinbart normalerweise doch nicht einen Freischein im Mietvertrag, wenn die Baukosten explodieren, dass ich mich dann so knebele, dass ich keine Ausstiegsmöglichkeiten mehr habe. Ist das völlig normal, oder ist das ein Stück weit nicht mehr nachvollziehbar gewesen? Haben Sie geprüft, ob die Vereinbarung der Gleitklausel ein normaler Vorgang ist oder ob das aus dem Rahmen fällt? Dadurch ist man ja zu der Entscheidung gekommen, das zu kaufen.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Zu der Frage der Standortauswahl: Da wir nicht so kundig sind, haben wir uns des Sachverstandes des Bauministeriums bedient. Das heißt, die Kollegen des Städtebaus haben uns zahlreiche Standorte genannt bzw. empfohlen, die wir dann gemeinsam mit dem BLB und dem LAV besucht haben. Die Kollegen des BLB haben sie nach einer Vielzahl von Kriterien bewertet.
Dazu gehörten die Nähe, die ich bereits ansprach, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die Baukosten usw. – alles das, was in der Beurteilung eine große Rolle spielt. Favorit war lange Zeit für die Landesregierung die Kokerei Zollverein, also klassische Brachen. Aber unter dem Strich – das hatte auch damit zu tun, dass erste Einschätzungen des Gebäudes und der Fläche in Duisburg sehr positiv waren – kam der BLB aus Kostengründen dazu, uns das Gebäude in Duisburg als sehr geeignet zu empfehlen.
MR Ralf Wehrmann (FM): Es ist üblich und normal, dass ich, wenn ich einen Bauvertrag abschließe, eine bestimmte Größenordnung des Gebäudes, was das Bauvolumen angeht, und den Baupreis, den ich habe, zugrunde lege und dass ich dann, wenn die Bausumme steigt, weil das Bauvolumen oder der Baupreis steigt, diesen gestiegenen Preis natürlich auch in der Miete abbilde. So ist das hier gewesen. Insofern ist das nichts Ungewöhnliches, sondern es ist einfach so, dass die Baupreise sehr drastisch gestiegen waren, was dann dazu geführt hat, dass sich der Mietpreis angepasst hat an diese gestiegenen Baupreise. Das ist etwas völlig Normales und in meinen Augen nicht zu beanstanden.
Christian Möbius (CDU): Es geht doch hier um den Mietvertrag – nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht – zwischen dem BLB und dem Land als Mieter. Ich habe Sie so verstanden, Herr Wehrmann, dass dann, wenn beispielsweise die Ressorts im Zuge der Planung Änderungswünsche haben und sich Kostensteigerungen ergeben, weil sie eine höhere Fläche haben wollen etc., natürlich der Mietpreis angepasst wird.
(Reiner Priggen [GRÜNE]: Ich habe es anders verstanden!)
MR Ralf Wehrmann (FM): Es war so angedacht: Es wird für den BLB gebaut, mit ei-er Miete, und der BLB überlässt dem Land für das Landesarchiv, ebenfalls über ei-e Miete, das von ihm angemietete Objekt. Und wenn ich eine Baukostensteigerung habe, habe ich automatisch auch eine Mietsteigerung. Das ist das Prinzip.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich möchte gerne nachfragen. Normalerweise miete ich doch etwas zu einem Preis pro Quadratmeter. Und dann gibt es Indizes mit Steigerungen. Büroflächen und Ähnliches, auch Sonderflächen für ein Archiv werden ja sicherlich in einer bestimmten Ebene gehandelt werden. Wenn ich nachher mehr Quadratmeter miete, muss ich natürlich auch mehr bezahlen; das ist eindeutig. Für mich ist aber die Frage wichtig: Was ist mit der exorbitanten Kostensteigerung, bevor der BLB gekauft hat?
Es drängt sich ja der Eindruck auf: Hier ist zunächst ein Vertrag mit einer bestimmten Miete abgeschlossen worden. Möglicherweise waren darin schon Bedingungen, die man normalerweise nicht akzeptiert. Und dann ist irgendwann gesagt worden: Jetzt nimmt der BLB demjenigen das Ganze ab. Da ist ja die Frage, ob es nicht sauber gewesen sein könnte. Wenn ich für 30 € eine Wirtschaftsimmobilie miete, und es gibt Indizes, die sich in normalem Rahmen bewegen, habe ich volles Verständnis dafür, wenn es Steigerungen gibt. Und wenn ich 1.000 qm mehr miete, zahle ich auch das mehr. Aber derartige Steigerungsraten, die davon abhängen, wie sich ein Architekt auf einer Großbaustelle austobt, und dann lande ich auf einmal bei dem Dreifachen und bin gezwungen zu kaufen, weil ich vorher so einen seltsamen Mietvertrag gemacht habe – da ist die Frage, ob das alles völlig korrekt gelaufen ist, in einem normalen Rahmen, oder ob Sie das überhaupt nicht geprüft haben.
MR Ralf Wehrmann (FM): Also: Wir haben das Jahr 2007. Zu dem Zeitpunkt, als der Mietvertrag gemacht wurde, hat man von beiden Seiten einen bestimmten Baupreis unterstellt und diesem Mietvertrag zugrunde gelegt, weil man die Planungen zum damaligen Zeitpunkt auf diesem Niveau gesehen hat. Das heißt, man hat die Bausumme, die man dem Mietvertrag zugrunde gelegt hat, an sich nach dem damals vorgesehenen Baustand, den man erreichen wollte, ausgerichtet. Ich möchte darauf hinweisen, dass es einen zweiten Architektenwettbewerb gegeben hat, bei dem der Siegerentwurf auch noch in dieser Größenordnung gelegen hat, die man im Mietvertrag zugrunde gelegt hat.
Reiner Priggen (GRÜNE): Darf ich eine Nachfrage stellen? – Sie sagen, man hat damals verhandelt. Wer waren die beiden Verhandlungspartner? Waren das der Private und der BLB? War das Erste, worauf sich die Steigerung bezieht, noch der Ver-trag zwischen dem Privaten und dem BLB? Muss ich das so verstehen?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ja.
Thomas Eiskirch (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe mitbekommen, dass Sie in Anbetracht der in Rede stehenden Persönlichkeiten eine sehr restriktive Auslegung der Geschäftsordnung für den heutigen Tag bevorzugen. Mir wurde ja auf Nachfrage deutlich gemacht, dass die Namen von Personen, die in Presseartikeln gegen ihren Willen oder nicht erkennbar mit ihrem Willen genannt worden sind, von mir augenscheinlich nicht erwähnt werden dürfen; ich dürfte diese hingegen zitieren, wenn sie freiwillig in der Presse ständen. – Ich halte das nach wie vor für eine ausgesprochen restriktive Auslegung der Geschäftsordnung, will mich aber bemühen, mich daran zu orientieren.
Ich will eine Frage stellen zu dem Artikel, der auf „derwesten.de“ erschienen ist und in dem es heißt: „Am 31. Januar 2007 kam in der Düsseldorfer Staatskanzlei eine vertrauliche Gesprächsrunde zusammen.“ Dann werden, mit Doppelpunkt beginnend, Persönlichkeiten aufgezählt, und die Aufzählung schließt mit: „… und eine Handvoll weiterer Teilnehmer, das neue Landesarchiv in Duisburg am Innenhafen auf dem Gelände des alten denkmalgeschützten Getreide-Speichers zu errichten“. Ich wüsste gerne, ob diese dort genannte Aufzählung unrichtig ist.
Vorsitzender Manfred Palmen: Ich darf vielleicht einmal sagen, Herr Eiskirch: Mit dem Untersuchungsausschuss, der hier in der vergangenen Legislaturperiode stattfand, und mit Auslaufen der Legislaturperiode ist die Handhabung des Schutzgutes „Mitarbeiter“ deutlich verschärft worden. Ich habe nur diese Position wiedergegeben. Es ist natürlich klar, dass ein Minister oder ein Staatssekretär weniger geschützt ist
(Thomas Eiskirch [SPD]: Auch ein Ministerpräsident!)
– der Ministerpräsident selbstverständlich auch. Aber so weit es um Mitarbeiter geht, ist das nach meiner Kenntnis seit Beginn der Legislaturperiode bei allen Kleinen Anfragen sehr restriktiv gehandhabt worden. Deshalb habe ich darauf hingewiesen, Herr Eiskirch, wir haben ja immer eine Lösungsmöglichkeit: Wir können in die nicht-öffentliche Sitzung gehen, wenn Sie sagen, dass Sie eine Frage in die Richtung stellen möchten.
(Thomas Eiskirch [SPD]: Nach Ihrer Interpretation dürfte ich ja die Namen teilweise auch in öffentlicher Sitzung nennen!)
– Herr Eiskirch, ich interpretiere nicht, sondern ich teile Ihnen die Rechtsauffassung mit, die der Landtag mit dem Auslaufen der letzten Legislaturperiode nach dem Untersuchungsausschuss eingenommen hat. Wenn ich interpretieren würde, würde ich sagen: Wir können Ihr Problem lösen, indem Sie Ihre Frage in nichtöffentlicher Sitzung stellen.
Thomas Eiskirch (SPD): Das ist derzeit nicht mein Interesse.
Vorsitzender Manfred Palmen: Soll denn die Frage, die Sie bisher gestellt haben, beantwortet werden? – Herr Wehrmann, bitte.
MR Ralf Wehrmann (FM): Herr Vorsitzender, mein Name taucht, glaube ich, in der „WAZ“ nicht auf. Ich habe an dieser Sitzung nicht teilgenommen und kann deshalb nichts dazu sagen.
Vorsitzender Manfred Palmen: Die Frage ist von Herrn Eiskirch allgemein gestellt worden. Will jemand aus der Staatskanzlei bzw. der Kulturabteilung der früheren Staatskanzlei dazu etwas sagen? – Bitte, Herr Engels.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ich bin zwar in dem Artikel wohl nicht genannt worden, ich war aber dabei. Ich gehöre zu der „Handvoll weiterer Teilnehmer“. Wie ich eben schon sagte: Die politische Spitze der Kultur und hochrangige Vertreter der Stadt Duisburg waren dort. Darauf muss ich mich aber bitte beschränken.
Thomas Eiskirch (SPD): Meine Frage war nicht darauf gerichtet, dass Sie mir Personen nennen. Meine Frage war, ob die in der Zeitung veröffentlichte Namensliste richtig ist. Beschränken wir uns auf die Genannten; wir haben ja gerade über das schutzwürdige Interesse die Ausführung bekommen, dass Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und auch Oberbürgermeister, weil im öffentlichen Leben stehend, von mir hätten persönlich benannt werden dürfen. Meine Frage war aber ausschließlich, ob diese Aufzählung unrichtig ist. Das ist eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten.
MR Norbert Engels (MFKJKS): Mir liegt dieser Artikel jetzt nicht vor.
Thomas Eiskirch (SPD): Kein Problem! Ich bringe Ihnen den Artikel rüber.
(Thomas Eiskirch [SPD] übergibt Herrn Engels den Presseartikel.)
MR Norbert Engels (MFKJKS): Dazu kann ich nur sagen, dass diese Aufzählung nicht richtig ist.
Martin Börschel (SPD): Ich habe noch zwei Fragen: Die eine setzt auf die Fragen von Herrn Priggen auf. Hat denn wirklich die hohe Preissteigerung – damit meine ich jetzt nicht die Baukostensteigerung in der späteren Phase, sondern die Steigerung der Grundstückserwerbskosten – nicht dazu geführt, eine erneute Abwägung vor dem Hintergrund bisheriger Prioritäten zu treffen? Und wenn nein, warum nicht? Sie haben doch gerade noch von einem lange favorisierten anderen Standort gesprochen. Man mag ja trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass die am Ende getroffene Standortentscheidung die richtige ist. Mich interessiert nur: Hat es noch einmal eine Abwägung gegeben? Wenn ja, mit welchen Kriterien? Wenn nein, warum nicht?
Zweite Frage: Wir haben ja hier von einer Runde am 31. Januar 2007 gesprochen. Was ich meine, kann in dieser oder in anderen Runden gewesen sein. Hat der von Ihnen benannte Spitzenvertreter der Stadt Duisburg oder haben andere Vertreter der Stadt Duisburg denn zu erkennen gegeben oder sogar noch konkreter festgehalten, dass die Stadt Duisburg diesen zur Errichtung des Archivs notwendigen Speicher kaufen wollte? Ist das als Absicht oder noch konkreter seitens der Stadt Duisburg artikuliert worden? Und wenn ja, in welcher Runde?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Zur zweiten Frage: Das ist mir nicht bekannt. Ich habe das später auch einmal gehört, aber in jüngerer Vergangenheit. Wir haben weitere Gespräche mit Vertretern der Stadt Duisburg geführt, die darin endeten – auch mit Vertretern des LAV und des BLB –, dass die Stadt Duisburg, die ja teilweise Miteigentümerin der Fläche ist oder Rechte auf den Grundstücken hat, in jedem Fall alles in ihren Kräften Stehende tun will, um für den BLB den Einstieg, den Kontakt zu den Eigentümern herzustellen und ihn bei Kaufverhandlungen zu unterstützen. Ansonsten war ich nicht beteiligt; auch an konkreten Kaufverhandlungen war ich nicht beteiligt.
Zu Frage 1: Diese Frage stellte sich für uns im Hinblick auf die Standortentscheidung nicht, weil unabhängig von der Frage, ob der BLB Eigentümer des Grundstücks wird oder nicht, die Umstände unter dem Strich so günstig waren, dass – auch durch diese Mietvertragsgestaltung, das heißt, die zwischengeschaltete Miete des BLB und das Land im Untermietverhältnis – alles für diesen Standort sprach.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dreht sich jetzt ein bisschen im Kreise. Im Kern – und das ist ja der Grund für die Antragstellung der SPD-Fraktion gewesen – ist in Frageform, juristisch gerade so tragbar, die Behauptung aufgestellt worden, dem Land sei ein Schaden in einer Größenordnung von mindestens 20 Millionen € entstanden – durch „Verrat“. Das hat Herr Börschel in seiner Presseerklärung vom 28. Oktober so zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie es direkt behauptet hätten, Herr Börschel, hätten Sie sich entsprechenden rechtlichen Schritten gegenübergesehen. Sie haben es raffiniert gemacht. Und dann verdächtigen Sie bestimmte Personen, beispielsweise den Oberbürgermeister von Duisburg, er könnte damit zu tun gehabt haben.
Deswegen habe ich eingangs schon die Frage gestellt, und ich will sie jetzt in Richtung von Herrn Engels wiederholen: Ist es völlig ausgeschlossen, dass der neue Erwerber, von dem der BLB dann gekauft hat, auch auf anderem Wege als durch einen Verrat von irgendwelchen in der Pressemitteilung genannten Personen Kenntnis von dem geplanten Grundstücksgeschäft erhalten hat? – Ich halte das für von erheblicher Bedeutung; denn wenn die Kenntnis auch auf anderem Weg erfolgt sein kann, darf man nicht einzelne Personen im Wege der Verdächtigung öffentlich an den Pranger stellen.
(Martin Börschel [SPD]: Man muss es aufklären!)
Dann habe ich die Frage: Kann man den Wert der – ich sage es einmal so – Manipulation durch den neuen Eigentümer, also durch Architektenwettbewerb und alles, was dazu gehört, beziffern?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Das kann ich baufachlich nicht bzw. zur zweiten Frage kenne ich die Zahlen nicht.
Vorsitzender Manfred Palmen: Wollen Sie zu der ersten Frage etwas sagen, Herr Engels?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ja, gerne. – Ich kann sagen, dass wir uns auch gefragt haben, wie das geschehen ist bzw. wieso die Presse die Landesregierung mit dem Vorwurf konfrontierte, da seien Indiskretionen begangen worden. Dazu kann ich allerdings nur sagen, dass unsere Kontakte mit der Innenhafen-Gesellschaft nicht unverborgen geblieben sind. Wir hatten zwar völlige Diskretion über diese Überlegungen vereinbart, aber im September 2006 hat es in der örtlichen Presse Berichterstattungen darüber gegeben, dass das Landesarchiv möglicherweise nach Duisburg kommt. Gleichzeitig hat es um den Zeitraum herum eine Kleine Anfrage von Herrn Keymis gegeben, ob es richtig sei, dass das Landesarchiv nach Zollverein, Essen, kommt. Es gab also in dem Zusammenhang auch öffentliche Erörterungen und Betrachtungen zu dem Thema.
Vorsitzender Manfred Palmen: Jetzt war noch eine weitere Frage an Herrn Wehrmann gerichtet.
MR Ralf Wehrmann (FM): Können Sie Ihre Frage vielleicht wiederholen?
Christian Weisbrich (CDU): Sie haben ja eine Vorlage für den Verwaltungsrat gemacht – Sie oder wer auch immer. Der Verwaltungsrat hat ja aufgrund einer Vorlage entschieden. Kann man den Wert der Architektenwettbewerbe und der erfolgten Planungen beziffern? Haben Sie das irgendwo erfasst?
MR Ralf Wehrmann (FM): Mir sind jetzt keine Daten oder Summen bekannt, die den Wert der Architektenwettbewerbe zusammengefasst haben. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen dazu eine Auskunft zu geben.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, wenn eine Entscheidungsvorlage gemacht wird, dann muss doch darin irgendeine Begründung für solche Preisverschiebungen stehen.
MR Ralf Wehrmann (FM): Wir sind jetzt wieder in der Situation, dass wir über den Verwaltungsrat reden. Da möchte ich doch bitten, dass wir die Vertraulichkeit wahren.
Christian Weisbrich (CDU): Na, das ist ja schön. Es wird also wild verdächtigt, und es wird nicht klargestellt.
Vorsitzender Manfred Palmen: Ich darf noch einmal sagen: Wenn wir das wollen, haben wir eine Lösungsmöglichkeit dadurch, dass wir in den nichtöffentlichen Teil gehen. Dann kann das alles beantwortet werden. Wird das gewünscht? – Ich sehe, Herr Eiskirch wünscht das, Herr Weisbrich wünscht das. Dann habe ich vorher aber noch eine Wortmeldung von Herrn Priggen.
Reiner Priggen (GRÜNE): Ich habe zwei kurze Fragen. Kann einer der Herren uns in der Größenordnung beziffern, wie hoch der Schaden ist?
Und jetzt will ich Ihnen folgen, Herr Weisbrich, bei der Frage der Indiskretionen. Das ist ja nichts, was Ihnen unbekannt ist und was nicht auch in Kommunen auftaucht, dass irgendwelche Leute von irgendwoher mitkriegen, da ist was im Busch, und sich dann engagieren. Egal, wer es war, da will ich gar nichts unterstellen – ich würde aber erwarten, dass man Sicherungsmechanismen einbaut. So kenne ich das auch aus Bauverwaltungen: Wenn man merkt, dass einem da in die Tasche gegriffen wird, weil Leute sehr geschickt sind, sollte man möglichst dafür noch einen Plan B in der Hand haben. Das habe ich manchmal auf kommunaler Ebene nicht, aber bei der Frage, ob ich im Ruhrrevier so etwas neu baue, habe ich doch Alternativen.
Noch einmal meine Fragen: Gibt es eine Größenordnung des Schadens, der egal von wem oder durch guten Jagdinstinkt entstanden ist? Und zweitens: Gibt es einen Sicherheitsmechanismus, der dann gegriffen hat, und einen nachweisbaren Abwägungsprozess, dass man gesagt hat, selbst wenn da jemand schneller gewesen ist, gibt es für uns nach Abwägung mit einem Standort B trotzdem vor diesem Hinter-grund diesen Standort, den wir nehmen? – Kann das beantwortet werden?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, zu beantworten, was beim Vergleich von Standorten günstiger und was nicht günstiger gewesen wäre. Das war ja, glaube ich, die Frage, die Sie gestellt haben.
Thomas Eiskirch (SPD): Gab es denn, nachdem klar wurde, das Ganze wird teurer, als wenn man es direkt erworben hätte, eine erneute Abwägung gegenüber konkreten anderen Standorten, die vorher schon im Gespräch waren, oder ganz neuen Standorten, um einen neuen Abwägungsprozess unter den dann vorherrschenden Kautelen vorzunehmen?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Es hat einen solchen Abwägungsprozess gegeben, allerdings zeitlich deutlich später, als uns nämlich der BLB mit Preissteigerungen konfrontierte, die sich aufgrund der Entwicklung ergeben haben, die wir nur sehr schwer nachvollziehen und akzeptieren konnten. Da hat es in der Tat Überlegungen gegeben, sich zum Beispiel von dem preisgekrönten Entwurf aus dem Architektenwettbewerb zu verabschieden, sprich einen schlichteren Nutzbau oder Ähnliches zu errichten.
Thomas Eiskirch (SPD): Ich habe Sie so verstanden, dass es nicht zu dem Zeitpunkt, wo deutlich wurde, dass dieses Gelände deutlich teurer wird, eine solche Abwägung gegeben hat, sondern erst dann, als – nachdem man trotz der höheren Kosten weiter an dem Gelände festgehalten hat – im Zuge der baulichen Errichtung weitere Kostensteigerungen gekommen sind. Also gab es erst zu diesem Zeitpunkt die Abwägung und nicht schon zu dem Zeitpunkt, als die Kosten für den Grundstückserwerb selber so deutlich gestiegen sind. Habe ich das richtig verstanden?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Da muss ich noch einmal auf unsere Position als Mieter und Nutzer zurückkommen. Wir sind nicht diejenigen, die die Preisentwicklung beurteilen können und die dabei sind. Wir wurden konfrontiert mit dieser Situation im Rahmen von Preissteigerungen, von Mietanhebungen. Das war deutlich später. Vor-her hatten wir keine Kenntnis über einen Preis, auch nicht über den Mietvertrag des BLB mit den Eigentümern etc.
Thomas Eiskirch (SPD): Das heißt, die erneute Abwägung und Ihre Kenntnis von den Preissteigerungen gab es zu einem Zeitpunkt, zu dem sich der BLB bereits zu den grundsätzlichen höheren Konditionen gebunden hatte? Habe ich das richtig verstanden?
MR Norbert Engels (MFKJKS): Ja.
Martin Börschel (SPD): Dann ist doch die Folgefrage konsequenterweise an den BLB gerichtet. Da das Land ja offensichtlich eine kommode Situation hatte – Mietvertrag zu festen Konditionen – und der BLB sozusagen auffangen musste, ob er das noch darstellen kann oder nicht, fragt sich: Hat es denn beim BLB zu dem Zeitpunkt der erhöhten Grundstückserwerbskosten eine Abwägung gegeben, den vorhandenen Mietvertrag mit dem Standort „möglichst Schifferstraße Duisburg“ – so ähnlich war es ja wohl formuliert – auf eine andere Art und Weise zu erfüllen?
MR Ralf Wehrmann (FM): Vom Ablauf her war es ja so, dass der BLB den Mietver-trag schon abgeschlossen hatte. Später stellte sich heraus, dass die Bausumme teurer wird. Das heißt, von daher war der BLB mietvertraglich gebunden.
(Martin Börschel [SPD]: Aber nicht für den Standort!)
– Doch. Der BLB hatte ja mit dem Grundstückseigentümer einen Mietvertrag abgeschlossen. Dieser Mietvertrag bezog sich auf die Errichtung eines Gebäudes. Damit war der BLB vertraglich gebunden.
Thomas Eiskirch (SPD): Noch eine Frage in Richtung BLB! Zu dem Zeitpunkt, als dem BLB klar wurde, dass das direkte Geschäft für ihn nicht möglich war, sondern dass er zu den anderen Konditionen des Erwerbs des Grundstücks in das Geschäft mit dem fremden Dritten eintreten muss, dass es also eine deutliche Steigerung gibt, hat es da eine Abwägung gegeben, ob es noch Sinn macht – nachdem der Eigenerwerb nicht geklappt hat und klar wurde, dass der Erwerb zu anderen Konditionen noch möglich war? Gab es zu diesem Zeitpunkt eine erneute Abwägung mit schon geprüften oder weiteren alternativen Standorten, ob diese Veränderung auf dem Hintergrund von anderen Möglichkeiten noch tragbar ist?
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich kann nur wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, Herr Eiskirch. Als die Baupreissteigerungen bekannt wurden, gab es eine vertragliche Bindung.
Thomas Eiskirch (SPD): Noch einmal! Die Baupreissteigerungen sind doch, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, aus zwei Dingen zusammengesetzt: aus dem, was durch die exorbitante Verteuerung des Grundstückserwerbs, wenn auch nicht durch den BLB, entstanden ist, und durch wirkliche klassische Baupreissteigerungen im Verfahren. Jetzt mache ich es noch deutlicher: Gab es nach Kenntnisnahme des ersten Steigerungsprozesses, der sozusagen mit der Spekulation in dem Grund und Boden begründet ist, einen erneuten Abwägungsprozess? – Wir können die Kaskade gleich auch noch kleiner machen, wenn es nötig ist.
Vorsitzender Manfred Palmen: Augenblick! Es kann sein, dass Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind. Aber es ist eine Antwort gegeben worden. Ich will das nur gesagt haben. – Bitte, Herr Wehrmann.
MR Ralf Wehrmann (FM): Ich kann nur noch einmal betonen: Ich glaube, wir unterscheiden uns hier im Sachverhalt, Herr Eiskirch. Wir haben die Situation, dass der BLB einen Mietvertrag abgeschlossen hatte, und zwar nicht mit der Staatskanzlei, sondern mit den Grundstückseigentümern. Das hatte ich eingangs gesagt. Und dann sind die Baupreissteigerungen zum Tragen gekommen. Damit hatten wir die Situation, dass der BLB sich mietvertraglich gebunden hatte. Ich glaube, Sie gehen von einem anderen Sachverhalt aus.
(Martin Börschel [SPD]: Es gibt doch zwei Mietverträge: den des Landes mit dem BLB und den des BLB mit dem privaten Grundstückseigentümer!)
– Genau. – Sie zielen aber doch jetzt auf die Baupreissteigerungen ab.
Thomas Eiskirch (SPD): Nein! Ich will es noch einmal deutlich machen: Ich ziele auf den Zeitpunkt ab, als der BLB gemerkt hat – ich sage es einmal umgangssprachlich –: „Verdammt, jetzt kann ich das Grundstück nicht selber kaufen und mit irgendwem darauf etwas bauen, um es dem Land zu vermieten, sondern jetzt gehört das einem, der mir ein Gesamtangebot macht für das, was darauf errichtet werden soll!“ – So habe ich den Sachverhalt doch hoffentlich richtig verstanden. Zu dem Zeitpunkt, als diese Erkenntnis beim BLB fruchtete, also nicht, als der Bau selber hinterher teurer wurde, sondern als klar war, dass der BLB es zu den Konditionen nicht mehr selber machen konnte, sondern nur noch mithilfe eines nicht wirklich frei ausgesuchten Dritten, zu dem Zeitpunkt musste man doch überlegen: Lasse ich mich auf das ein, was plötzlich x-fach teurer ist, oder gucke ich mich um nach einem neuen Standort und lasse den, der da spekuliert hat, ins Leere laufen? Das ist doch die simple Frage. Meine Frage ist: Gab es diese Abwägung?
MR Ralf Wehrmann (FM): Zu dem Zeitpunkt, den Sie gerade beschrieben haben, war das noch nicht x-fach teurer, sondern da ging man noch davon aus, dass die Bausumme die gleiche bleibt. – Um Ihre Frage zu beantworten: Ich habe keine Kenntnis darüber, welche Entscheidungen beim BLB und welche Erörterungen zu dem Zeitpunkt getroffen worden sind. Dazu kann ich im Moment überhaupt keine Auskunft geben.
Christian Weisbrich (CDU): Herr Wehrmann, gab es nach Ihrem Kenntnisstand auf die Entscheidungsstrukturen im BLB von irgendeiner Seite eine externe Einflussnahme – beispielsweise aus dem Bereich der Politik? Oder ist das eine Situation, die der BLB selbst in Eigenverantwortung so durchstrukturiert hatte?
MR Ralf Wehrmann (FM): Grundsätzlich ist der BLB von seiner gesamten Struktur her so angelegt, dass er Grundstücksgeschäfte eigenverantwortlich durchführen kann. Das ist damit begründet, dass der BLB ein Bau- und Immobilienbetrieb des Landes ist, der entsprechenden Fachverstand verfügbar hat und vorrätig hält.
Zu der anderen Frage, die Sie mir gestellt haben, Herr Weisbrich, ob es irgendwelche Einflussnahmen gegeben hat: Das ist nicht im Rahmen meiner Wahrnehmung.
Vorsitzender Manfred Palmen: Jetzt stellt sich für mich die Frage: Gibt es bei der Antwortlage noch Bedarf, in nichtöffentlicher Sitzung Fragen zu stellen?
(Zuruf von der SPD: Ja!)
– Wenn das der Fall ist, dann muss ich jetzt nach § 55 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung, sofern es dagegen keinen Widerspruch gibt, die Öffentlichkeit ausschließen und die Nichtöffentlichkeit herstellen. Gibt es dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich alle, die mit diesem Verhandlungsgegenstand nicht unmittelbar zu tun haben, bitten, den Saal für den Zeitraum der Nichtöffentlichkeit zu verlassen. ..."
Quelle: Sitzungprotokoll APr 15/57
Wolf Thomas - am Samstag, 4. Dezember 2010, 14:17 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"On May 10, 2010, the Library of Congress held Personal Archiving Day in conjunction with the American Library Association's annual Preservation Week. The Library invited members of the public to visit and learn about how to preserve their personal information in both digital and non-digital form.
During the event, Library staff gave talks about how to preserve specific kinds of information. In this video, Abigail Grotke, web archiving team lead and Gina Jones, digital media project coordinator, both from the Office of Strategic Initiatives' Web Archiving team at the Library of Congress, offer practical advice on preserving web content."
Link to Video: http://www.digitalpreservation.gov/videos/personal_archiving/web_content.html
During the event, Library staff gave talks about how to preserve specific kinds of information. In this video, Abigail Grotke, web archiving team lead and Gina Jones, digital media project coordinator, both from the Office of Strategic Initiatives' Web Archiving team at the Library of Congress, offer practical advice on preserving web content."
Link to Video: http://www.digitalpreservation.gov/videos/personal_archiving/web_content.html
Wolf Thomas - am Samstag, 4. Dezember 2010, 13:51 - Rubrik: Webarchivierung
http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=Adolf%20II.%20(Schaumburg-Lippe)&Zeitraum=3D
ein Projekt der
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/index.html
Wiki Watch: Portal für mehr Transparenz auf Wikipedia
http://vierprinzen.blogspot.com/
ein Projekt der
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/index.html
Wiki Watch: Portal für mehr Transparenz auf Wikipedia
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Samstag, 4. Dezember 2010, 13:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"Auf Antrag der Linksfraktion hat sich der Landtag heute in einer Aktuellen Stunde mit dem geplanten Landesarchiv befasst. Eine Kostensteigerung für Planung und Bau von 30 Mio. Euro auf das Dreifache oder sogar mehr, wie Abgeordnete befürchteten, gab Anlass zu Kritik im Speziellen wie im Allgemeinen und warf Fragen auf.
Für die antragstellende Fraktion sprach Özlem Alev Demirel (Linke) von einem unglaublichen Sumpf, der sich da auftue und den es auszutrocknen gelte. Obwohl bis auf den Spatenstich bisher nicht viel passiert sei, könne man in Presseberichten lesen, dass sich die Kosten jenseits von 150 Millionen Euro bewegten. Hier zeige sich, dass sich "private Investoren auf Kosten der Bürger dumm und dämlich verdienen".

Zu Kostensteigerungen müsse man den Bauherrn fragen, meinte Christian Weisbrich (CDU). Und dies sei nicht die vorige Landesregierung, sondern der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes. In einer Sitzung des zuständigen Ausschusses habe der BLB vor wenigen Tagen für Fragen zu Verfügung gestanden. Die Linksfraktion habe die Sitzung allerdings nach wenigen Minuten verlassen und sei offenbar nicht an Aufklärung interessiert.

Diesen Eindruck hatte auch Markus Töns (SPD), fragte aber, warum sich die ehemalige Landesregierung auf ein "windiges Verfahren" eingelassen und keine Alternativen gesucht habe: "Haben beim BLB oder in der Staatskanzlei keine Alarmglocken geschellt, oder war der politische Druck zu groß?" Für seine Fraktion wie auch die Bürgerinnen und Bürger sei die Kostenexplosion nicht nachvollziehbar.

Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) trennte zwischen persönlicher Verantwortlichkeit in dem Fall und strukturellen Mängeln beim BLB. Es könne nicht sein, dass letzterer nur prüfe, ob er das Geld vom Land erhalte, aber Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz oder andere Aspekte bei einer Kaufentscheidung keinerlei Rolle spielten. Diese strukturelle Schieflage gelte es systematisch aufzuarbeiten und zu beseitigen, forderte er.

Diesen Vorschlag unterstützte Angela Freimuth (FDP). Der BLB müsse mehr die Kosten des Nutzers, also des Landes, im Blick haben, schließlich schlügen sie sich im Haushalt nieder. Landesbauten hätten zwar beispielsweise städtebauliche oder ökologische Vorbildfunktion, dem müsse man Rechnung tragen. Das mache aber Kontrolle und Transparenz über die Kosten nicht überflüssig, mahnte die FDP-Sprecherin.

Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) hielt die immense Kostensteigerung, falls sie sich als wahr herausstelle, für einen Skandal. Daher sagte er der ermittelnden Staatsanwaltschaft die Unterstützung der Landesregierung und dem Parlament jede rechtlich mögliche Transparenz zu. Es gehe ihm weniger darum, eine Person zu beschuldigen, als vielmehr darum, das Vergangene aufzuklären und es in Zukunft besser zu machen.
Text: Sonja Wand
Fotos: Bernd Schälte"
Quelle: Pressemitteilung des Landtags, 3.12.2010
Link zum Abruf der Videostream der Landtagssitzung v. 3.12.2010
Meldung der Landtagsfraktion "Die Linke", 3.12.2010
Medienecho:
RP-Online.de, 3.12.2010
RP-Online.de, 4.12.2010
WDR.de, 3.12.2010 mit Links zur weiteren Berichterstattung der WDR-Medien
Ruhrnachrichten, 3.12.2010
xity.de, 3.12.2010
derwesten.de, 3.12.2010
RTL Regional, Nachrichten v. 3.12.2010
WDR, Westpol, 5.12.2010 mit Video zum Bericht
Mit diesem Thema beschäftigt sich auch: http://www.landesarchiv-forum.de/ . Dort finden sich auch weitere Dokumente (z. B. zur Grundstücksübereignung in Duisburg) und des besteht die Möglichkeit, das Thema zu diskutieren.
Das Bundesblog spekuliert über einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im neuen Jahr.
Archivalia-Artikel zum Thema sind hier abrufbar: http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Für die antragstellende Fraktion sprach Özlem Alev Demirel (Linke) von einem unglaublichen Sumpf, der sich da auftue und den es auszutrocknen gelte. Obwohl bis auf den Spatenstich bisher nicht viel passiert sei, könne man in Presseberichten lesen, dass sich die Kosten jenseits von 150 Millionen Euro bewegten. Hier zeige sich, dass sich "private Investoren auf Kosten der Bürger dumm und dämlich verdienen".

Zu Kostensteigerungen müsse man den Bauherrn fragen, meinte Christian Weisbrich (CDU). Und dies sei nicht die vorige Landesregierung, sondern der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes. In einer Sitzung des zuständigen Ausschusses habe der BLB vor wenigen Tagen für Fragen zu Verfügung gestanden. Die Linksfraktion habe die Sitzung allerdings nach wenigen Minuten verlassen und sei offenbar nicht an Aufklärung interessiert.

Diesen Eindruck hatte auch Markus Töns (SPD), fragte aber, warum sich die ehemalige Landesregierung auf ein "windiges Verfahren" eingelassen und keine Alternativen gesucht habe: "Haben beim BLB oder in der Staatskanzlei keine Alarmglocken geschellt, oder war der politische Druck zu groß?" Für seine Fraktion wie auch die Bürgerinnen und Bürger sei die Kostenexplosion nicht nachvollziehbar.

Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) trennte zwischen persönlicher Verantwortlichkeit in dem Fall und strukturellen Mängeln beim BLB. Es könne nicht sein, dass letzterer nur prüfe, ob er das Geld vom Land erhalte, aber Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz oder andere Aspekte bei einer Kaufentscheidung keinerlei Rolle spielten. Diese strukturelle Schieflage gelte es systematisch aufzuarbeiten und zu beseitigen, forderte er.

Diesen Vorschlag unterstützte Angela Freimuth (FDP). Der BLB müsse mehr die Kosten des Nutzers, also des Landes, im Blick haben, schließlich schlügen sie sich im Haushalt nieder. Landesbauten hätten zwar beispielsweise städtebauliche oder ökologische Vorbildfunktion, dem müsse man Rechnung tragen. Das mache aber Kontrolle und Transparenz über die Kosten nicht überflüssig, mahnte die FDP-Sprecherin.

Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) hielt die immense Kostensteigerung, falls sie sich als wahr herausstelle, für einen Skandal. Daher sagte er der ermittelnden Staatsanwaltschaft die Unterstützung der Landesregierung und dem Parlament jede rechtlich mögliche Transparenz zu. Es gehe ihm weniger darum, eine Person zu beschuldigen, als vielmehr darum, das Vergangene aufzuklären und es in Zukunft besser zu machen.
Text: Sonja Wand
Fotos: Bernd Schälte"
Quelle: Pressemitteilung des Landtags, 3.12.2010
Link zum Abruf der Videostream der Landtagssitzung v. 3.12.2010
Meldung der Landtagsfraktion "Die Linke", 3.12.2010
Medienecho:
RP-Online.de, 3.12.2010
RP-Online.de, 4.12.2010
WDR.de, 3.12.2010 mit Links zur weiteren Berichterstattung der WDR-Medien
Ruhrnachrichten, 3.12.2010
xity.de, 3.12.2010
derwesten.de, 3.12.2010
RTL Regional, Nachrichten v. 3.12.2010
WDR, Westpol, 5.12.2010 mit Video zum Bericht
Mit diesem Thema beschäftigt sich auch: http://www.landesarchiv-forum.de/ . Dort finden sich auch weitere Dokumente (z. B. zur Grundstücksübereignung in Duisburg) und des besteht die Möglichkeit, das Thema zu diskutieren.
Das Bundesblog spekuliert über einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im neuen Jahr.
Archivalia-Artikel zum Thema sind hier abrufbar: http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Samstag, 4. Dezember 2010, 09:36 - Rubrik: Staatsarchive
 ls viertes Türlein gibt es eine Mini-Anthologie zum Thema Winter aus Wikisource.
ls viertes Türlein gibt es eine Mini-Anthologie zum Thema Winter aus Wikisource.„Väterchen, Deine Nase!“ Diese Anrede hört man im Winter in Rußland bei strengem Frostwetter; denn dort gehört es zu den ersten Menschenpflichten, jeden, dem man in der Kälte begegnet, auf dessen Nase hin anzusehen. Dies hängt folgendermaßen zusammen: Glieder, die derart abgekühlt werden, daß sie nahe daran sind, zu erfrieren, werden gefühllos, aber man sieht ihnen die Gefahr an, da sie in diesem Zustande ganz weiß werden. Seine eigene Nase kann aber nicht jeder sehen, und so ist die Warnung eine Pflicht des Nächsten. Der Gewarnte nimmt alsdann Schnee und reibt seine Nase, um den Blutumlauf anzuregen. – Wenn wir auch nicht in Rußland leben, so ist doch auch bei uns dieser Warnungsruf im kalten Winter am Platze. Selbst leichte Grade des Erfrierens können als unangenehme Nachwehen eine rothe Nase zurücklassen. „Väterchen, Deine Nase!“ könnte man auch denjenigen zurufen, die zu tief ins Glas schauen. Vielleicht hilft’s! Versuchen kann man es jedenfalls. (Gartenlaube 1891)
FLUGZEUG AM WINTERHIMMEL
Ich fliege im Flockengewimmel.
Ach, guter Himmel, laß das doch sein!
Ich Flugriese bin nur klein Vögelein
Gegen dich, schüttender Himmel.
Sag Schneegestöber, ich bäte es sehr,
Ein wenig nachzulassen.
Denn meine Flügel tragen schon schwer
An sechs ganz dicken Insassen.
Die spielen Karten in meinem Leib
Und trinken, weil sie so frieren.
Und wollen nach Zoppot, um Zeitvertreib
Und Örtliches zu studieren.
Und käme ich dort nicht pünktlich hin,
Die würden es niemals verzeihen.
Lieber Himmel, wenn ich gelandet bin,
Dann darfst du gern wieder schneien.
(Joachim Ringelnatz, aus: Flugzeuggedanken, 1929)
An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang
O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe!
Welch neue Welt bewegest du in mir?
Was ists, daß ich auf einmal nun in dir
Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?
Einem Kristall gleicht meine Seele nun,
Den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen;
Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,
Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen,
Die aus dem klaren Gürtel blauer Luft
Zuletzt ein Zauberwort vor meine Sinne ruft.
Bei hellen Augen glaub ich doch zu schwanken;
Ich schließe sie, daß nicht der Traum entweiche.
Seh ich hinab in lichte Feenreiche?
Wer hat den bunten Schwarm von Bildern und Gedanken
Zur Pforte meines Herzens hergeladen,
Die glänzend sich in diesem Busen baden,
Goldfarbgen Fischlein gleich im Gartenteiche?
Ich höre bald der Hirtenflöten Klänge,
Wie um die Krippe jener Wundernacht,
Bald weinbekränzter Jugend Lustgesänge;
Wer hat das friedenselige Gedränge
In meine traurigen Wände hergebracht?
Und welch Gefühl entzückter Stärke,
Indem mein Sinn sich frisch zur Ferne lenkt!
Vom ersten Mark des heutgen Tags getränkt,
Fühl ich mir Mut zu jedem frommen Werke.
Die Seele fliegt, so weit der Himmel reicht,
Der Genius jauchzt in mir! Doch sage,
Warum wird jetzt der Blick von Wehmut feucht?
Ists ein verloren Glück, was mich erweicht?
Ist es ein werdendes, was ich im Herzen trage?
– Hinweg, mein Geist! hier gilt kein Stillestehn:
Es ist ein Augenblick, und Alles wird verwehn!
Dort, sieh, am Horizont lüpft sich der Vorhang schon!
Es träumt der Tag, nun sei die Nacht entflohn;
Die Purpurlippe, die geschlossen lag,
Haucht, halbgeöffnet, süße Atemzüge:
Auf einmal blitzt das Aug, und, wie ein Gott, der Tag
Beginnt im Sprung die königlichen Flüge!
(Eduard Mörike)
IM WINTER
Der Acker leuchtet weiß und kalt.
Der Himmel ist einsam und ungeheuer.
Dohlen kreisen über dem Weiher
Und Jäger steigen nieder vom Wald.
Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt.
Ein Feuerschein huscht aus den Hütten.
Bisweilen schellt sehr fern ein Schlitten
Und langsam steigt der graue Mond.
Ein Wild verblutet sanft am Rain
Und Raben plätschern in blutigen Gossen.
Das Rohr bebt gelb und aufgeschossen.
Frost, Rauch, ein Schritt im leeren Hain.
(Georg Trakl, aus: Gedichte, 1913)
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Samstag, 4. Dezember 2010, 00:07 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.idw-online.de/pages/de/news400327
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat die heutige Entscheidung der DFG, gegen vier Wissenschaftler eine schriftliche Rüge wegen Fehlverhaltens auszusprechen, begrüßt. „Ich finde es richtig, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft hier klare Kante zeigt. Aber wir müssen zugleich auch etwas tun, damit es zukünftig möglichst wenig schwarze Schafe in der Forschung gibt – Open Access in der Wissenschaft kann dabei eine Antwort sein“, sagte die Ministerin.
Von den vier Gerügten wird genau einer mit Namen genannt:
http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2010/pressemitteilung_nr_69/index.html
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat die heutige Entscheidung der DFG, gegen vier Wissenschaftler eine schriftliche Rüge wegen Fehlverhaltens auszusprechen, begrüßt. „Ich finde es richtig, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft hier klare Kante zeigt. Aber wir müssen zugleich auch etwas tun, damit es zukünftig möglichst wenig schwarze Schafe in der Forschung gibt – Open Access in der Wissenschaft kann dabei eine Antwort sein“, sagte die Ministerin.
Von den vier Gerügten wird genau einer mit Namen genannt:
http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2010/pressemitteilung_nr_69/index.html
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 21:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Library of Congress, Prints and Photographs Division recently received a collection of approximately 700 ambrotypes and tintypes of Civil War soldiers. The collection is now up in Flickr.
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157625520211184/
![[Unidentified soldier in Union sergeant's uniform] (LOC)](http://farm6.static.flickr.com/5166/5228559155_ae83c16a69.jpg)
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157625520211184/
![[Unidentified soldier in Union sergeant's uniform] (LOC)](http://farm6.static.flickr.com/5166/5228559155_ae83c16a69.jpg)
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 21:42 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Axel Schaper hat vielleicht den längsten jemals in netbib erschienenen Blog-Eintrag verfasst:
http://log.netbib.de/archives/2010/11/29/in-den-bucherhallen-hamburg-ist-rassismus-interkulturell/#more-78618701
Zitat: Ein sanftmütiger Mensch hat das deutsche Bibliothekswesen als verrottet bezeichnet. Tempi passati. Der Zustand der Verrottung ist in den des Kretinismus übergegangen.
http://log.netbib.de/archives/2010/11/29/in-den-bucherhallen-hamburg-ist-rassismus-interkulturell/#more-78618701
Zitat: Ein sanftmütiger Mensch hat das deutsche Bibliothekswesen als verrottet bezeichnet. Tempi passati. Der Zustand der Verrottung ist in den des Kretinismus übergegangen.
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 19:21 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Auswertung auf dem Stand von 2006
http://wiki.netbib.de/coma/SchulBibliothek
sei hier wiederholt.
Erfasste Exemplare im
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de
(Ohne von anderen Institutionen verwaltete Schulbibliotheken und Schulbibliotheken, deren Stücke verschollen sind.)
Aachen, Kaiser-Karls-Gymnasium 2
Ansbach, Gymnasium Carolinum 4
Augsburg, Humanistisches Gymnasium bei St. Anna 16
Bielefeld, Ratsgymnasium 6
Burghausen, Kurfürst-Maximilian-Gymnasium 3
Burgsteinfurt, Gymnasium Arnoldinum 3
Freiberg, Geschwister-Scholl-Gymnasium 109
Freiburg i. Br., Berthold-Gymnasium 3
Hamburg-Altona, Christianeum 39
Höxter, Städtisches König-Wilhelm-Gymnasium 3
Hof, Jean-Paul-Gymnasium 2
Jever, Mariengymnasium 1
Koblenz, Görresgymnasium 58
Konstanz, Heinrich-Suso-Gymnasium 206
Lingen, Georgianum 2
Meldorf, Gelehrtenschule 1
München, Wilhelmsgymnasium 2
Münnerstadt, Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium 1
Münstereifel, St. Michael-Gymnasium 12
Norden, Ulrichsgymnasium 1
Nürnberg, Melanchthon-Gymnasium 1
Osnabrück, Gymnasium Carolinum 29
Rastatt, Ludwig-Wilhelm-Gymnasium 159
Rottweil, Albertus-Magnus-Gymnasium 2
Schulpforte, Landesschule Pforta 227
Speyer, Gymnasium am Kaiserdom 3
Straubing, Johannes Turmair-Gymnasium 14
Wiesbaden, Dilthey-Schule 1
Zerbst, Gymnasium Francisceum 69
Nur ein Teil der vorhandenen Inkunabeln ist vom GW erfasst. So gibt etwa das Nürnberger Melanchthon-Gymnasium an, es verfüge über 27 Inkunabeln
http://www.melgym.de/index.php?id=68
Auswertung:
http://log.netbib.de/archives/2006/03/08/inkunabeln-in-deutschen-schulbibliotheken
Aus 29 Gymnasien wurden 979 Inkunabeln in Berlin registriert. Mehr als 30 Inkunabeln besitzen Schulen in Altona, Freiberg, Koblenz, Konstanz, Rastatt, Schulpforte (227!) und Zerbst.
Update 4.11.2011 Wiesbaden ist nicht mehr selbständig. Inzwischen gibt es im GW auch zusätzliche Nachweise für
Bonn
Brühl
Eichstätt
Hadamar
Emmerich
Frankfurt/Oder
HH Johanneum
Herford
Hersfeld
Husum
Kempten
Kleve
Lahr
Landshut
Meppen
Steinfurt
Wertheim
Worms
Insgesamt zähle ich 43 Bibliotheken, nicht alle im Handbuch der Hist. Buchbestände vertreten (z.B. Emmerich, Frankfurt/Oder).
 Inkunabel aus der Christianeumsbibliothek in Altona
Inkunabel aus der Christianeumsbibliothek in Altona
http://wiki.netbib.de/coma/SchulBibliothek
sei hier wiederholt.
Erfasste Exemplare im
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de
(Ohne von anderen Institutionen verwaltete Schulbibliotheken und Schulbibliotheken, deren Stücke verschollen sind.)
Aachen, Kaiser-Karls-Gymnasium 2
Ansbach, Gymnasium Carolinum 4
Augsburg, Humanistisches Gymnasium bei St. Anna 16
Bielefeld, Ratsgymnasium 6
Burghausen, Kurfürst-Maximilian-Gymnasium 3
Burgsteinfurt, Gymnasium Arnoldinum 3
Freiberg, Geschwister-Scholl-Gymnasium 109
Freiburg i. Br., Berthold-Gymnasium 3
Hamburg-Altona, Christianeum 39
Höxter, Städtisches König-Wilhelm-Gymnasium 3
Hof, Jean-Paul-Gymnasium 2
Jever, Mariengymnasium 1
Koblenz, Görresgymnasium 58
Konstanz, Heinrich-Suso-Gymnasium 206
Lingen, Georgianum 2
Meldorf, Gelehrtenschule 1
München, Wilhelmsgymnasium 2
Münnerstadt, Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium 1
Münstereifel, St. Michael-Gymnasium 12
Norden, Ulrichsgymnasium 1
Nürnberg, Melanchthon-Gymnasium 1
Osnabrück, Gymnasium Carolinum 29
Rastatt, Ludwig-Wilhelm-Gymnasium 159
Rottweil, Albertus-Magnus-Gymnasium 2
Schulpforte, Landesschule Pforta 227
Speyer, Gymnasium am Kaiserdom 3
Straubing, Johannes Turmair-Gymnasium 14
Wiesbaden, Dilthey-Schule 1
Zerbst, Gymnasium Francisceum 69
Nur ein Teil der vorhandenen Inkunabeln ist vom GW erfasst. So gibt etwa das Nürnberger Melanchthon-Gymnasium an, es verfüge über 27 Inkunabeln
http://www.melgym.de/index.php?id=68
Auswertung:
http://log.netbib.de/archives/2006/03/08/inkunabeln-in-deutschen-schulbibliotheken
Aus 29 Gymnasien wurden 979 Inkunabeln in Berlin registriert. Mehr als 30 Inkunabeln besitzen Schulen in Altona, Freiberg, Koblenz, Konstanz, Rastatt, Schulpforte (227!) und Zerbst.
Update 4.11.2011 Wiesbaden ist nicht mehr selbständig. Inzwischen gibt es im GW auch zusätzliche Nachweise für
Bonn
Brühl
Eichstätt
Hadamar
Emmerich
Frankfurt/Oder
HH Johanneum
Herford
Hersfeld
Husum
Kempten
Kleve
Lahr
Landshut
Meppen
Steinfurt
Wertheim
Worms
Insgesamt zähle ich 43 Bibliotheken, nicht alle im Handbuch der Hist. Buchbestände vertreten (z.B. Emmerich, Frankfurt/Oder).
 Inkunabel aus der Christianeumsbibliothek in Altona
Inkunabel aus der Christianeumsbibliothek in AltonaKlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 19:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Alle Einträge sind abrufbar unter:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
 http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0078564hjld
http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0078564hjld
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
 http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0078564hjld
http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0078564hjldKlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 18:24 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
J. Kemper - am Freitag, 3. Dezember 2010, 15:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33771/1.html
Die "Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht", kurz "IGEL" , wird heute ab 8 Uhr auf http://leistungsschutzrecht.info eine Website online gehen lassen, welche die "wichtigsten Wegmarken" aus der Debatte sammeln will.
Update 15 Uhr 18: Die Website ist noch nicht online. Ich hasse Ankündigungen von Websites. Wieso muss man Menschen auf die Folter spannen, wenn in allzu vielen Fällen der geplante Starttermin eh nicht eingehalten werden kann?
Update: Am 9. Dezember ist immer noch nichts online.
Die "Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht", kurz "IGEL" , wird heute ab 8 Uhr auf http://leistungsschutzrecht.info eine Website online gehen lassen, welche die "wichtigsten Wegmarken" aus der Debatte sammeln will.
Update 15 Uhr 18: Die Website ist noch nicht online. Ich hasse Ankündigungen von Websites. Wieso muss man Menschen auf die Folter spannen, wenn in allzu vielen Fällen der geplante Starttermin eh nicht eingehalten werden kann?
Update: Am 9. Dezember ist immer noch nichts online.
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 02:23 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine amüsante Fälle unter dem Titel "Die Hexenprozesse der Neuzeit" lässt Revue passieren:
http://www.focus.de/finanzen/recht/tid-20627/wahrsagerei-die-hexenprozesse-der-neuzeit_aid_577930.html
http://www.focus.de/finanzen/recht/tid-20627/wahrsagerei-die-hexenprozesse-der-neuzeit_aid_577930.html
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 02:21 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.enssib.fr/breves/2010/12/02/de-la-folksonomie-dans-les-archives
"Le site internet des archives départementales du Cantal vient de recevoir le prix Territoria d'or "Valorisation du patrimoine" décerné par l'Observatoire de l'innovation publique pour l'indexation collaborative des archives d'état civil.
Ce système permet à chaque internaute d'indexer les pages de l'état civil avec un nom, un prénom ou une date."
"Le site internet des archives départementales du Cantal vient de recevoir le prix Territoria d'or "Valorisation du patrimoine" décerné par l'Observatoire de l'innovation publique pour l'indexation collaborative des archives d'état civil.
Ce système permet à chaque internaute d'indexer les pages de l'état civil avec un nom, un prénom ou une date."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die seit 1945 verschollene (ehemals Inzigkofener) Handschrift, die zuletzt in der Privatsammlung Friedrich Katzer in Reichenberg (Böhmen) als Deutsche Hs. 12 aufbewahrt wurde, konnte wiederentdeckt werden; der wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts geschriebene Codex, der das 'Buch der Liebkosung' Johanns von Neumarkt, den 'Hiob-Traktat' Marquards von Lindau sowie eine Predigt über Io 8,59 enthält, befindet sich in der Prager Nationalbibliothek und trägt dort die Signatur Cod. XVI.F.73. "
http://www.handschriftencensus.de/8417
Wer wiederentdeckt hat, verschweigt der Handschriftencensus, dem wir obige Notiz entnahmen.
 Nonnenempore Inzigkofen
Nonnenempore Inzigkofen
http://www.handschriftencensus.de/8417
Wer wiederentdeckt hat, verschweigt der Handschriftencensus, dem wir obige Notiz entnahmen.
 Nonnenempore Inzigkofen
Nonnenempore InzigkofenKlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 02:03 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
When Monica Gaudio noticed that the online Magazine, Cooks Source, copied one of her articles from her website and published it without her permission, she asked for an apology and a $130 donation to the Columbia Journalism School. The magazine editor, Judith Griggs, explained that "the web is considered 'public domain' and you should be happy we just didn't 'lift' your whole article and put someone else's name on it!"
http://gawker.com/5681770/magazine-editor-steals-article-tells-writer-you-should-compensate-me
http://www.fastcompany.com/1700763/3-steps-to-avoid-being-the-next-cooks-source
http://www.npr.org/blogs/monkeysee/2010/11/05/131091599/the-day-the-internet-threw-a-righteous-hissyfit-about-copyright-and-pie?ps=cprs
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooks_Source_infringement_controversy
Via
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/12-02-10.htm
http://gawker.com/5681770/magazine-editor-steals-article-tells-writer-you-should-compensate-me
http://www.fastcompany.com/1700763/3-steps-to-avoid-being-the-next-cooks-source
http://www.npr.org/blogs/monkeysee/2010/11/05/131091599/the-day-the-internet-threw-a-righteous-hissyfit-about-copyright-and-pie?ps=cprs
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooks_Source_infringement_controversy
Via
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/12-02-10.htm
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 01:57 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt Wimbauer in einem großen autobiographischen Interview:
http://www.umblaetterer.de/2010/12/03/verrat-an-ernst-juenger/
http://www.umblaetterer.de/2010/12/03/verrat-an-ernst-juenger/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 lt ist das Medium Buch, neu das transportable Notebook. Eine faszinierende Video-Etüde, die alt und neu verbindet, stammt von der niederländischen Künstlerin Evelien Lohbeck aus Tilburg.
lt ist das Medium Buch, neu das transportable Notebook. Eine faszinierende Video-Etüde, die alt und neu verbindet, stammt von der niederländischen Künstlerin Evelien Lohbeck aus Tilburg.Falls es jemand noch nicht kennt: Introducing the Book.
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Freitag, 3. Dezember 2010, 00:34 - Rubrik: Unterhaltung
Zusammenfassung
Als Mitarbeiterinnen von STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung in Wien, das eine umfangreiche Sammlung feministischer Zeitschriften betreut, wollen wir einen Überblick über feministische Bewegungsmedien in Österreich geben und auf die Bedeutung feministischer Archive innerhalb der Wissens- und Geschichtsbildungsprozesse feministischer Bewegungen eingehen, insbesondere auf ihre Rolle im Sichtbarmachen und Bewahren feministischer Medien.
Feministische Medien, besonders Zeitschriften, sind ein wichtiger Bestandteil feministischer Archive und Bibliotheken. Aus der Sicht von Frauenarchiven sind feministische Medien eine reichhaltige und lebendige Quelle zu aktuellen Themen, politischen Praxen und theoretischen Diskussionen. Sie spiegeln die Ausdifferenzierungen und Entwicklungen feministischer Bewegungen, Strategien und Konzepte wie die verschiedenen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen wider. Wir werden Strukturen und Entwicklungen innerhalb der feministischen Medienlandschaft in Österreich von den Anfängen in den 1970er Jahren bis heute analysieren und einen Einblick in Diskussionen und thematische Entwicklungen in den ersten zwei Jahrzehnten der Neuen Frauenbewegung in Österreich geben. Wir legen außerdem einen speziellen Fokus auf lesbische Medien. Da in Österreich im Laufe der Jahre nur wenige explizit lesbische Zeitschriften erschienen sind, beziehen wir hier auch lesbische Zeitschriften aus anderen deutschsprachigen Ländern mit ein.
Volltext des Artikels hier als PDF
Als Mitarbeiterinnen von STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung in Wien, das eine umfangreiche Sammlung feministischer Zeitschriften betreut, wollen wir einen Überblick über feministische Bewegungsmedien in Österreich geben und auf die Bedeutung feministischer Archive innerhalb der Wissens- und Geschichtsbildungsprozesse feministischer Bewegungen eingehen, insbesondere auf ihre Rolle im Sichtbarmachen und Bewahren feministischer Medien.
Feministische Medien, besonders Zeitschriften, sind ein wichtiger Bestandteil feministischer Archive und Bibliotheken. Aus der Sicht von Frauenarchiven sind feministische Medien eine reichhaltige und lebendige Quelle zu aktuellen Themen, politischen Praxen und theoretischen Diskussionen. Sie spiegeln die Ausdifferenzierungen und Entwicklungen feministischer Bewegungen, Strategien und Konzepte wie die verschiedenen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen wider. Wir werden Strukturen und Entwicklungen innerhalb der feministischen Medienlandschaft in Österreich von den Anfängen in den 1970er Jahren bis heute analysieren und einen Einblick in Diskussionen und thematische Entwicklungen in den ersten zwei Jahrzehnten der Neuen Frauenbewegung in Österreich geben. Wir legen außerdem einen speziellen Fokus auf lesbische Medien. Da in Österreich im Laufe der Jahre nur wenige explizit lesbische Zeitschriften erschienen sind, beziehen wir hier auch lesbische Zeitschriften aus anderen deutschsprachigen Ländern mit ein.
Volltext des Artikels hier als PDF
Bernd Hüttner - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 20:46 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jan Hodels Überlegungen http://weblog.histnet.ch/archives/4873 sollen nicht unkommentiert bleiben:
Das Thema Weblog und seine Potentiale für die Geschichtswissenschaften – und vor allem die Frage, warum diese Potentiale nicht genutzt werden – beschäftigt uns in den letzten Wochen, im Kontext des Workshops in Basel am 12. November, wieder etwas intensiver – nachdem die Vorstellung des Nachrichtendienst für Historiker als Weblog des Monats Juni schon zu einer kurzen Auseinandersetzung über die Frage geführt hat, was ein Weblog überhaupt sei.
Hier soll ein erster Versuch gemacht werden, einige grundlegende Funktionen von Weblogs zu benennen, die für die Geschichtswissenschaften und damit für Historikerinnen und Historiker von Bedeutung sein könnten. Vielleicht kann dieser Versuch beim Ansinnen hilfreich sein, den Nutzen von Weblogs und deren Einsatzmöglichkeiten in geschichtswissenschaftlichen Arbeitszusammenhängen besser zu verstehen und entsprechende Initiativen zu entwickeln.
Kern dieser Überlegungen ist die Eigenschaft von Weblogs als “Selbstverlags-Tool”, zur persönlichen oder gruppenspezifischen Profilbildung in der Scientific Community dienen zu können. Dabei lassen sich die verschiedenen Ausprägungen dieser Profilbildung mit den Kategorien Information, Reflexion und Publikation fassen. Dabei müssen Weblogs keinesfalls nur eine oder alle dieser Kategorien abdecken; Mischformen mit Beiträgen, die mal zur einen oder anderen der genannten Kategorien gezählt werden können, sind die Regel.
Information
Die naheliegendste und am meisten genutzte Funktion von Weblogs ist die der Information: Hinweise auf interessante Fundstücke im Netz, auf kommende Veranstaltungen, auf eigene und fremde Publikationen, auf bildungspolitische Entscheidungen, auf Resolutionen, neue Projekte, Ausstellungen, Angebote. Die Profilbildung kann dabei durch konsequente Darstellung eigener Tätigkeiten oder durch die erfolgreiche Besetzung eines Themenfeldes erreicht werden, das die entsprechenden Blogger/innen so gut kennen, dass das Blog für die Leser/innen einen Mehrwert darstellt. Aufmachung und Stil lassen hier noch etwas Gestaltungsmöglichkeit für die Profilbildung, doch grundsätzlich haben es hier neue Weblogs immer schwer, sich gegen etablierte Weblogs durchzusetzen – auch gegenüber anderen Anbieter von solchen Informationen, wie beispielsweise Newsletter von Institutionen oder Fachgesellschaften oder (in unserem Fach) dem fast schon monopolistischen H-Soz-Kult.
Ganz grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob diese Funktion der Information, der Hinweise und Mitteilungen nicht auch oder sogar besser in anderen aufkommenden Mediendiensten wie Twitter oder Facebook geleistet werden kann. Möglicherweise sind Weblogs für diese Funktionalität zu schwerfällig und (im Endeffekt) zu isoliert.
Diese Informationsfunktion betrifft die meisten Beiträge in Archivalia, das ja primär als facharchivisches Gemeinschaftsblog gedacht ist. Und für die Archive gibt es kein H-SOZ-U-KULT.
H-SOZ-U-KULT ist so prickelnd wie ein Paar eingeschlafene Füße. Es finden kaum Debatten statt; wer sich über Digitales informieren will, wird in Archivalia und nicht dort zeitnah unterrichtet. Das AGFNZ-Weblog ist ja ausdrücklich als Ergänzung zu H-SOZ-U-KULT gestartet, und es ist unendlich viel bunter und lebendiger als die Mailingliste.
Weder Facebook noch Twitter bieten hinreichend Raum für Kommentare zu Links. Natürlich überlege ich mir, was ich im Blog, was ich in Twitter oder gelegentlich auch auf FB mitteile. Was ich als wichtig empfinde, nehme ich, wenn es inhaltlich passt, immer in Archivalia auf, schon weil es weder auf Twitter noch auf FB etwas gibt, was mit der gut funktionierenden Suchfunktion von Archivalia vergleichbar ist.
Bei vielen Themen, die uns hier wichtig sind, genügen kurze Linkhinweise nicht. Auch weil manche tagesaktuellen Links rasch wieder verschwinden, bedarf die Dokumentation eines Themas wie des Kölner Archiveinsturzes ausführlicher Zitate.
Zu bestimmten Themen wie Köln oder Kulturgut oder Open Access oder Street View oder Rüxner bietet Archivalia ein einzigartiges Informationssystem im Sinne eines Blogarchivs, das im wesentlichen von der Suchfunktion, teilweise auch von der Kategorisierung lebt.
Wer die Rezeption des Kölner Archiveinsturzes nachvollziehen will, muss sich zwar durch unendlich viele Archivalia-Beiträge quälen, aber in Twitter oder Facebook würde er kaum fündig.
Reflexion
Weblogs können auch dazu dienen, öffentlich über Probleme oder offen Fragen nachzudenken (wie beispielsweise dieser Beitrag) oder neue Themen und Fragestellungen zu lancieren. Diese Beiträge könnten sich in einen Diskurs einbinden, der im Gegensatz zu den “die Zeit reicht noch für eine kurze Frage”-Diskussionen und den kurzlebigen “Ich meld mich dann bei Ihnen”-Konversationen an Tagungen kontinuierlich sich entwickeln könnte, gleichsam das Ideal des “literarischen Salons” aus der Zeit der Aufklärung in die virtuelle Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts zu transportieren. Wer wäre nicht gern Mitglied eines “digitalen akademischen Salons”? Doch das distinguierte (oder elitäre) Gehabe des 18. Jahrhunderts wirkt in der Wirklichkeit der digitalen Massengesellschaft etwas deplatziert. Es wäre noch zu zeigen, ob der Medienwandel zum Ideal eines herrschaftsfreien bürgerlichen und hier wissenschaftlichen Diskurses führen kann – auch wenn Habermas den durch das Web 2.0 eingeleiteten Strukturwandel die Möglichkeit dazu attestiert (worauf Kollega Haber vor langer Zeit hin diesem Blog schon hingewiesen hat). Denn im Alltag stellt sich die Frage, wer sich die Reflexionen von Herrn X und von Frau Y zu Gemüte führen will. Reicht diese Funktion aus, um die Blogosphäre so zu verdichten, dass tatsächlich ein interessanter Diskurs akademischer Reflexion entsteht?
Aus der Sicht blasierter Flaneure kann man es Reflexion nennen - als Blogger mit einem Sendungsbewusstsein, einer "Mission" bevorzuge ich den Begriff Meinung. Ich werbe hier für die Nutzung von Web 2.0, für Open Access und freie Inhalte, für Benutzerfreundlichkeit und für den Schutz von bedrohtem Kulturgut. Dabei ist es mir zunächst einmal wurscht, ob ein "interessanter Diskurs akademischer Reflexion entsteht". Ich bin dankbar, dass ich z.B. die Möglichkeit habe, chronikalisch festzuhalten, was im Bereich adeliger Sammlungen verscherbelt wird.
Natürlich gibt es immer wieder Ansätze zu Debatten, und ich schätze diese (auch wenn es oft nicht den Anschein hat). Bei diskussionsgeladenen Themen wie Open Access oder Juristischem gab es ja durchaus in anderen Blogs niveauvolle und vor allem weiterführende Diskussionen. Die alpenländischen Blogger sollten mal die Nase über den Tellerrand heben und beispielsweise die Diskussionen im Beck-Blog zu juristischen Fragen verfolgen, bei denen nicht selten Substantielles traktiert wird. Als Beispiel kann vielleicht die Recherche im Duisburger Loveparade-Casus dienen, wo in den Kommentaren sehr wichtige Hinweise kamen.
Web 2.0 heißt: Zusammenarbeit, gemeinsam Wissen schaffen.
Meine These: Die extrem verschnarchte deutschsprachige geschichtswissenschaftliche Szene kann nicht die Maßstäbe vorgeben. Man sieht ja auch in H-SOZ-U-KULT, dass fachliche Debatten nicht geführt werden.
Vernetzung der Blogosphäre und die Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren, hätten das Potential, eine neue Debattenkultur zu fördern.
Aber auch ohne solches Feedback bieten Blogs große Chancen für Menschen, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen.
Publikation
Doch der wissenschaftliche Diskurs findet – trotz allem – nicht so sehr im Austausch bedenkenswerter Überlegungen und Reflexionen statt, sondern primär in wissenschaftlichen Publikationen, seien dies Bücher, wissenschaftliche Aufsätze oder digitale Publikationen in verschiedenen Formaten. Publikationen sind zentraler Bestandteil des wissenschaftlichen Leistungsausweises. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass auch in Weblogs wissenschaftliche Abhandlungen publiziert werden können. Weblogs bieten sogar eine Reihe von Vorteilen für wissenschaftliche Beiträge: sie können Links enthalten, in kleinere, besser überschaubare Untereinheiten aufgeteilt werden und vor allem Rückmeldungen in den Kommentarspalten generieren und sogar in die Publikation aufnehmen.
Weblogs sind aber keine anerkannten wissenschaftlichen Publikationen – und das ist nicht nur in den Geschichtswissenschaften so. Das liegt sicherlich auch an der mangelnden Zertifizierung und Qualitätssicherung: Jeder und jede kann selbst publizieren und nicht genehme Einwände ignorieren. Erst wenn sich neue Formen der kollegialen Beurteilung von Beiträgen zum wissenschaftlichen Diskurs etabliert haben, die auch Weblogs umfassen, wird sich dies wohl ändern: Stichwort Open Peer Review. Hierzu gibt es allerdings verschiedene Vorstellungen und Varianten: von der Bekanntgabe der Begutachter/innen gegenüber den Autor/innen bis hin zur offenen Begutachtung des Beitrags durch jedermann/jedefrau (siehe die “Reflexion” von Bonnie Wheeler im Blog “In the Middle“, via archivalia). In diesem Bereich werden vermutlich die massgeblichen Entscheidungen fallen, ob sich Weblogs als wissenschaftliche Instrumente etablieren können – sei dies als etablierte Kanäle für Publikationen, oder als Watch-Blogs, die auf Unstimmigkeiten und Unregelmässigkeiten hinweisen. Auch das ist eine Möglichkeit der Profilbildung.
Diese ständige Rede von Qualitätssicherung kann ich nicht mehr hören. Sie ist einfach nur Schwachsinn. Ich habe seit ca. 1975, als ich begann, wissenschaftlich zu arbeiten, nie danach gefragt, ob eine Publikation qualitätsgesichert ist. Es gab Schwachsinn, den ich in renommierten Zeitschriften oder von angesehenen Autoren fand (Bayer-Aufsatz im letzten Archiv für Diplomatik, Lehmann-Aufsätze in landeskundlichen Periodika) und den ich dann ignoriert oder zurückgewiesen habe. Überspitzt gesagt: Qualitätssicherung (oder Peer Review) ist in der Geschichtswissenschaft etwas für Undergraduates, für Bachelor-Studierende, denen man keine solide quellenkritische Ausbildung vermitteln konnte. In den Naturwissenschaften mag es anders sein, aber für mich steht die eigenständige Prüfung der Qualität von Studien, mit denen ich arbeite, an erster Stelle. Wo diese erschienen sind, in den Beiträgen des Heimatvereins von Liestal oder in den Mitteilungen der Geleerten Gesellschaft des südöstlichen Teils des Kantons Basel-Land, ist mir ziemlich wurscht. Wenn etwas inhaltlich relevant ist, muss ich mich damit auseinandersetzen, unabhängig davon, ob irgendwelche Hohepriester der Wissenschaft es als "zitierfähig" erachten.
Nicht nur verschiedene Beiträge in Archivalia, auch zwei jüngst von Frank Pohle im AGFNZ-Weblog publizierte Einträge (Ergänzungen zum Nordrheinischen Klosterbuch) zeigen, was Blogs im Bereich von "original research" leisten können.
Blogs eignen sich ausgezeichnet für Miszellen, für kleine Beiträge, bei denen man nicht ein Thema lückenlos totrecherchiert. Sie sind unendlich viel schneller als die gedruckten Zeitschriften und ermöglichen die Beigabe von Abbildungen (oder Links zu solchen). Die Wissenschaft besteht nicht nur aus Meistererzählungen, sondern auch aus vielen kleinen Mosaiksteinen.
Das Thema Weblog und seine Potentiale für die Geschichtswissenschaften – und vor allem die Frage, warum diese Potentiale nicht genutzt werden – beschäftigt uns in den letzten Wochen, im Kontext des Workshops in Basel am 12. November, wieder etwas intensiver – nachdem die Vorstellung des Nachrichtendienst für Historiker als Weblog des Monats Juni schon zu einer kurzen Auseinandersetzung über die Frage geführt hat, was ein Weblog überhaupt sei.
Hier soll ein erster Versuch gemacht werden, einige grundlegende Funktionen von Weblogs zu benennen, die für die Geschichtswissenschaften und damit für Historikerinnen und Historiker von Bedeutung sein könnten. Vielleicht kann dieser Versuch beim Ansinnen hilfreich sein, den Nutzen von Weblogs und deren Einsatzmöglichkeiten in geschichtswissenschaftlichen Arbeitszusammenhängen besser zu verstehen und entsprechende Initiativen zu entwickeln.
Kern dieser Überlegungen ist die Eigenschaft von Weblogs als “Selbstverlags-Tool”, zur persönlichen oder gruppenspezifischen Profilbildung in der Scientific Community dienen zu können. Dabei lassen sich die verschiedenen Ausprägungen dieser Profilbildung mit den Kategorien Information, Reflexion und Publikation fassen. Dabei müssen Weblogs keinesfalls nur eine oder alle dieser Kategorien abdecken; Mischformen mit Beiträgen, die mal zur einen oder anderen der genannten Kategorien gezählt werden können, sind die Regel.
Information
Die naheliegendste und am meisten genutzte Funktion von Weblogs ist die der Information: Hinweise auf interessante Fundstücke im Netz, auf kommende Veranstaltungen, auf eigene und fremde Publikationen, auf bildungspolitische Entscheidungen, auf Resolutionen, neue Projekte, Ausstellungen, Angebote. Die Profilbildung kann dabei durch konsequente Darstellung eigener Tätigkeiten oder durch die erfolgreiche Besetzung eines Themenfeldes erreicht werden, das die entsprechenden Blogger/innen so gut kennen, dass das Blog für die Leser/innen einen Mehrwert darstellt. Aufmachung und Stil lassen hier noch etwas Gestaltungsmöglichkeit für die Profilbildung, doch grundsätzlich haben es hier neue Weblogs immer schwer, sich gegen etablierte Weblogs durchzusetzen – auch gegenüber anderen Anbieter von solchen Informationen, wie beispielsweise Newsletter von Institutionen oder Fachgesellschaften oder (in unserem Fach) dem fast schon monopolistischen H-Soz-Kult.
Ganz grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob diese Funktion der Information, der Hinweise und Mitteilungen nicht auch oder sogar besser in anderen aufkommenden Mediendiensten wie Twitter oder Facebook geleistet werden kann. Möglicherweise sind Weblogs für diese Funktionalität zu schwerfällig und (im Endeffekt) zu isoliert.
Diese Informationsfunktion betrifft die meisten Beiträge in Archivalia, das ja primär als facharchivisches Gemeinschaftsblog gedacht ist. Und für die Archive gibt es kein H-SOZ-U-KULT.
H-SOZ-U-KULT ist so prickelnd wie ein Paar eingeschlafene Füße. Es finden kaum Debatten statt; wer sich über Digitales informieren will, wird in Archivalia und nicht dort zeitnah unterrichtet. Das AGFNZ-Weblog ist ja ausdrücklich als Ergänzung zu H-SOZ-U-KULT gestartet, und es ist unendlich viel bunter und lebendiger als die Mailingliste.
Weder Facebook noch Twitter bieten hinreichend Raum für Kommentare zu Links. Natürlich überlege ich mir, was ich im Blog, was ich in Twitter oder gelegentlich auch auf FB mitteile. Was ich als wichtig empfinde, nehme ich, wenn es inhaltlich passt, immer in Archivalia auf, schon weil es weder auf Twitter noch auf FB etwas gibt, was mit der gut funktionierenden Suchfunktion von Archivalia vergleichbar ist.
Bei vielen Themen, die uns hier wichtig sind, genügen kurze Linkhinweise nicht. Auch weil manche tagesaktuellen Links rasch wieder verschwinden, bedarf die Dokumentation eines Themas wie des Kölner Archiveinsturzes ausführlicher Zitate.
Zu bestimmten Themen wie Köln oder Kulturgut oder Open Access oder Street View oder Rüxner bietet Archivalia ein einzigartiges Informationssystem im Sinne eines Blogarchivs, das im wesentlichen von der Suchfunktion, teilweise auch von der Kategorisierung lebt.
Wer die Rezeption des Kölner Archiveinsturzes nachvollziehen will, muss sich zwar durch unendlich viele Archivalia-Beiträge quälen, aber in Twitter oder Facebook würde er kaum fündig.
Reflexion
Weblogs können auch dazu dienen, öffentlich über Probleme oder offen Fragen nachzudenken (wie beispielsweise dieser Beitrag) oder neue Themen und Fragestellungen zu lancieren. Diese Beiträge könnten sich in einen Diskurs einbinden, der im Gegensatz zu den “die Zeit reicht noch für eine kurze Frage”-Diskussionen und den kurzlebigen “Ich meld mich dann bei Ihnen”-Konversationen an Tagungen kontinuierlich sich entwickeln könnte, gleichsam das Ideal des “literarischen Salons” aus der Zeit der Aufklärung in die virtuelle Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts zu transportieren. Wer wäre nicht gern Mitglied eines “digitalen akademischen Salons”? Doch das distinguierte (oder elitäre) Gehabe des 18. Jahrhunderts wirkt in der Wirklichkeit der digitalen Massengesellschaft etwas deplatziert. Es wäre noch zu zeigen, ob der Medienwandel zum Ideal eines herrschaftsfreien bürgerlichen und hier wissenschaftlichen Diskurses führen kann – auch wenn Habermas den durch das Web 2.0 eingeleiteten Strukturwandel die Möglichkeit dazu attestiert (worauf Kollega Haber vor langer Zeit hin diesem Blog schon hingewiesen hat). Denn im Alltag stellt sich die Frage, wer sich die Reflexionen von Herrn X und von Frau Y zu Gemüte führen will. Reicht diese Funktion aus, um die Blogosphäre so zu verdichten, dass tatsächlich ein interessanter Diskurs akademischer Reflexion entsteht?
Aus der Sicht blasierter Flaneure kann man es Reflexion nennen - als Blogger mit einem Sendungsbewusstsein, einer "Mission" bevorzuge ich den Begriff Meinung. Ich werbe hier für die Nutzung von Web 2.0, für Open Access und freie Inhalte, für Benutzerfreundlichkeit und für den Schutz von bedrohtem Kulturgut. Dabei ist es mir zunächst einmal wurscht, ob ein "interessanter Diskurs akademischer Reflexion entsteht". Ich bin dankbar, dass ich z.B. die Möglichkeit habe, chronikalisch festzuhalten, was im Bereich adeliger Sammlungen verscherbelt wird.
Natürlich gibt es immer wieder Ansätze zu Debatten, und ich schätze diese (auch wenn es oft nicht den Anschein hat). Bei diskussionsgeladenen Themen wie Open Access oder Juristischem gab es ja durchaus in anderen Blogs niveauvolle und vor allem weiterführende Diskussionen. Die alpenländischen Blogger sollten mal die Nase über den Tellerrand heben und beispielsweise die Diskussionen im Beck-Blog zu juristischen Fragen verfolgen, bei denen nicht selten Substantielles traktiert wird. Als Beispiel kann vielleicht die Recherche im Duisburger Loveparade-Casus dienen, wo in den Kommentaren sehr wichtige Hinweise kamen.
Web 2.0 heißt: Zusammenarbeit, gemeinsam Wissen schaffen.
Meine These: Die extrem verschnarchte deutschsprachige geschichtswissenschaftliche Szene kann nicht die Maßstäbe vorgeben. Man sieht ja auch in H-SOZ-U-KULT, dass fachliche Debatten nicht geführt werden.
Vernetzung der Blogosphäre und die Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren, hätten das Potential, eine neue Debattenkultur zu fördern.
Aber auch ohne solches Feedback bieten Blogs große Chancen für Menschen, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen.
Publikation
Doch der wissenschaftliche Diskurs findet – trotz allem – nicht so sehr im Austausch bedenkenswerter Überlegungen und Reflexionen statt, sondern primär in wissenschaftlichen Publikationen, seien dies Bücher, wissenschaftliche Aufsätze oder digitale Publikationen in verschiedenen Formaten. Publikationen sind zentraler Bestandteil des wissenschaftlichen Leistungsausweises. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass auch in Weblogs wissenschaftliche Abhandlungen publiziert werden können. Weblogs bieten sogar eine Reihe von Vorteilen für wissenschaftliche Beiträge: sie können Links enthalten, in kleinere, besser überschaubare Untereinheiten aufgeteilt werden und vor allem Rückmeldungen in den Kommentarspalten generieren und sogar in die Publikation aufnehmen.
Weblogs sind aber keine anerkannten wissenschaftlichen Publikationen – und das ist nicht nur in den Geschichtswissenschaften so. Das liegt sicherlich auch an der mangelnden Zertifizierung und Qualitätssicherung: Jeder und jede kann selbst publizieren und nicht genehme Einwände ignorieren. Erst wenn sich neue Formen der kollegialen Beurteilung von Beiträgen zum wissenschaftlichen Diskurs etabliert haben, die auch Weblogs umfassen, wird sich dies wohl ändern: Stichwort Open Peer Review. Hierzu gibt es allerdings verschiedene Vorstellungen und Varianten: von der Bekanntgabe der Begutachter/innen gegenüber den Autor/innen bis hin zur offenen Begutachtung des Beitrags durch jedermann/jedefrau (siehe die “Reflexion” von Bonnie Wheeler im Blog “In the Middle“, via archivalia). In diesem Bereich werden vermutlich die massgeblichen Entscheidungen fallen, ob sich Weblogs als wissenschaftliche Instrumente etablieren können – sei dies als etablierte Kanäle für Publikationen, oder als Watch-Blogs, die auf Unstimmigkeiten und Unregelmässigkeiten hinweisen. Auch das ist eine Möglichkeit der Profilbildung.
Diese ständige Rede von Qualitätssicherung kann ich nicht mehr hören. Sie ist einfach nur Schwachsinn. Ich habe seit ca. 1975, als ich begann, wissenschaftlich zu arbeiten, nie danach gefragt, ob eine Publikation qualitätsgesichert ist. Es gab Schwachsinn, den ich in renommierten Zeitschriften oder von angesehenen Autoren fand (Bayer-Aufsatz im letzten Archiv für Diplomatik, Lehmann-Aufsätze in landeskundlichen Periodika) und den ich dann ignoriert oder zurückgewiesen habe. Überspitzt gesagt: Qualitätssicherung (oder Peer Review) ist in der Geschichtswissenschaft etwas für Undergraduates, für Bachelor-Studierende, denen man keine solide quellenkritische Ausbildung vermitteln konnte. In den Naturwissenschaften mag es anders sein, aber für mich steht die eigenständige Prüfung der Qualität von Studien, mit denen ich arbeite, an erster Stelle. Wo diese erschienen sind, in den Beiträgen des Heimatvereins von Liestal oder in den Mitteilungen der Geleerten Gesellschaft des südöstlichen Teils des Kantons Basel-Land, ist mir ziemlich wurscht. Wenn etwas inhaltlich relevant ist, muss ich mich damit auseinandersetzen, unabhängig davon, ob irgendwelche Hohepriester der Wissenschaft es als "zitierfähig" erachten.
Nicht nur verschiedene Beiträge in Archivalia, auch zwei jüngst von Frank Pohle im AGFNZ-Weblog publizierte Einträge (Ergänzungen zum Nordrheinischen Klosterbuch) zeigen, was Blogs im Bereich von "original research" leisten können.
Blogs eignen sich ausgezeichnet für Miszellen, für kleine Beiträge, bei denen man nicht ein Thema lückenlos totrecherchiert. Sie sind unendlich viel schneller als die gedruckten Zeitschriften und ermöglichen die Beigabe von Abbildungen (oder Links zu solchen). Die Wissenschaft besteht nicht nur aus Meistererzählungen, sondern auch aus vielen kleinen Mosaiksteinen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Works that are in the Public Domain in analogue form should continue to be in the Public Domain once they have been digitised. Yet this does not, as far as I can see, necessarily have to imply that users are granted a free-for-all licence to take what they please from cultural heritage organisations without acknowledgement.
http://80gb.wordpress.com/2010/12/01/digital-culture-heresy-musings-after-glamwiki/
Da hat Alexandra Eveleigh aber etwas missverstanden. Public Domain meint: Jeder kann damit machen, was er will und nichts anderes. Es geht nicht um einen Kostenersatz für Reproduktionen, es geht darum, dass das Konzept Public Domain nicht vorsieht, dass man eine Quelle angibt oder für die Verwendung zahlt. Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/6164988/
http://80gb.wordpress.com/2010/12/01/digital-culture-heresy-musings-after-glamwiki/
Da hat Alexandra Eveleigh aber etwas missverstanden. Public Domain meint: Jeder kann damit machen, was er will und nichts anderes. Es geht nicht um einen Kostenersatz für Reproduktionen, es geht darum, dass das Konzept Public Domain nicht vorsieht, dass man eine Quelle angibt oder für die Verwendung zahlt. Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/6164988/
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 20:06 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archivauskunft.de/
Gefragt wird nach Darstellungen aus der griechischen Mythologie in Berlin.

Gefragt wird nach Darstellungen aus der griechischen Mythologie in Berlin.

KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 19:16 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/blogs/6/148854
Die Deutschen sind noch immer nicht in der digitalen Gesellschaft angekommen, sagt die 1999 gegründete Initiative D21 erneut, der das alles viel zu langsam geht. Die Entwicklung sei zwar erfreulich, heißt es zur Veröffentlichung des zweiten Teils der Studie Die digitale Gesellschaft - sechs Nutzertypen im Vergleich, aber eigentlich sollen gerade erst 37 Prozent in der digitalen Gesellschaft angekommen sein. Genannt werden diese Menschen die "digitalen Souveränen", zu denen wir alle werden sollen.
Die Deutschen sind noch immer nicht in der digitalen Gesellschaft angekommen, sagt die 1999 gegründete Initiative D21 erneut, der das alles viel zu langsam geht. Die Entwicklung sei zwar erfreulich, heißt es zur Veröffentlichung des zweiten Teils der Studie Die digitale Gesellschaft - sechs Nutzertypen im Vergleich, aber eigentlich sollen gerade erst 37 Prozent in der digitalen Gesellschaft angekommen sein. Genannt werden diese Menschen die "digitalen Souveränen", zu denen wir alle werden sollen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://yeswescan.org/
Ein hübsches Motto, aber es handelt sich leider nicht um ein breit aufgestelltes Scanprojekt, sondern man kann für 1000 Dollar die Patenschaft für das doppelte Abschreiben eines Bandes des federal Reporter mit ca. 1000 Seiten übernehmen. Blödsinn, dass man das zündende Motto für einen solchen Unsinn verschenkt, denn mittels Wikisource oder eines eigenen Wikis hätte man für einen Bruchteil des Geldes in absehbarer Zeit ebenso brauchbare Ergebnisse erzielt, denke ich.
Ein hübsches Motto, aber es handelt sich leider nicht um ein breit aufgestelltes Scanprojekt, sondern man kann für 1000 Dollar die Patenschaft für das doppelte Abschreiben eines Bandes des federal Reporter mit ca. 1000 Seiten übernehmen. Blödsinn, dass man das zündende Motto für einen solchen Unsinn verschenkt, denn mittels Wikisource oder eines eigenen Wikis hätte man für einen Bruchteil des Geldes in absehbarer Zeit ebenso brauchbare Ergebnisse erzielt, denke ich.
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 18:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bibliographie von Max Bär (1920) ist in Düsseldorf online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-27788
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-27788
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 18:02 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
BSB verstümmelt geschichtswissenschaftliche Metasuche Chronicon nach Eingliederung in historicum.net
Nur ein kleiner Teil der bisher durchsuchten Datenbanken steht unter
http://www.historicum.net/chronicon/start.do?View=hist
zur Verfügung. Damit ist Chronicon als Konkurrenzangebot zu CLIO Online wertlos geworden. Zum früheren Stand:
http://de.wikiversity.org/w/index.php?title=Aufsatzrecherche&oldid=209037
http://www.historicum.net/chronicon/start.do?View=hist
zur Verfügung. Damit ist Chronicon als Konkurrenzangebot zu CLIO Online wertlos geworden. Zum früheren Stand:
http://de.wikiversity.org/w/index.php?title=Aufsatzrecherche&oldid=209037
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Netzwerk umfasst einige Historiker der Uni Saarbrücken, die digitale Projekte durchführen. Die Ergebnisse der Projekte sucht man allerdings auf der Seite vergeblich.
http://www.ndg.uni-saarland.de/
http://www.ndg.uni-saarland.de/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1644&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=fr
Viele Worte, aber bereits die Überschrift ist unpräzise. Es geht nicht um "Forschungsunterlagen", sondern um Forschungspublikationen.
Unter
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=browse&id=213&Itemid=29&lang=de
entdecke ich gerade mal 210 Dokumente.
Viele Worte, aber bereits die Überschrift ist unpräzise. Es geht nicht um "Forschungsunterlagen", sondern um Forschungspublikationen.
Unter
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=browse&id=213&Itemid=29&lang=de
entdecke ich gerade mal 210 Dokumente.
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 16:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Berliner Georg-Kolbe-Museum hat seine Nachlässe mit KALLIOPE erschlossen und eine Auswahl von ca. 100 Briefen digitalisiert ins Netz gestellt. Leider weisen die PDFs der Digitalisate ekelhafte Wasserzeichen auf.
http://www.georg-kolbe-museum.de/archiv/digitale_sammlung.htm

http://www.georg-kolbe-museum.de/archiv/digitale_sammlung.htm

KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 14:56 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 01:46 - Rubrik: Unterhaltung
http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/journal_546.xml
Die Digitalisierung, Erschließung und Online-Präsentation der Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde ist ein Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) und des Vereins für Thüringische Geschichte e.V.
Bislang liegen die Bände bis 1943 vor.
Die Digitalisierung, Erschließung und Online-Präsentation der Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde ist ein Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) und des Vereins für Thüringische Geschichte e.V.
Bislang liegen die Bände bis 1943 vor.
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 01:34 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ausgabe Leipzig 1737 ist in Göttingen online:
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN637981901
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN637981901
KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 01:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.histnet.ch/archives/4846
Glückwunsch an das AGFNZ-Weblog!
http://agfnz.historikerverband.de/

Glückwunsch an das AGFNZ-Weblog!
http://agfnz.historikerverband.de/

 uch schon im 18. Jahrhundert gab es Orthographiereformer. Unlängst stellte das Göttinger Digitalisierungszentrum ins Netz: Der Deüdschen Buchschdaben, und Schreibzeichen Rächdschreibung, wälche in anseung der Buchschdaben, nach der uralden Deüdschen Mutterschbrache und denen fon Ir ausgegangenen Drei Haubd Mundarden, der Aldalgemeinen, Schwäbischen, und Blatdeüdschen, gewisen und apgeschilderd insonderheid aber, nach der fon alders her im Schreiben fon allen Deüdschen gebrauchden aldalgemeinen Mundard, und fornämlich nach dersälben jetzichen waren Ausschbrache, grundmäsich eingerichded, auch so dan in bedrachd der Schreibzeichen, nach Dersälben Inen gehörenden Schdällen, apgemässen, und zum Druk beförderd wird.
uch schon im 18. Jahrhundert gab es Orthographiereformer. Unlängst stellte das Göttinger Digitalisierungszentrum ins Netz: Der Deüdschen Buchschdaben, und Schreibzeichen Rächdschreibung, wälche in anseung der Buchschdaben, nach der uralden Deüdschen Mutterschbrache und denen fon Ir ausgegangenen Drei Haubd Mundarden, der Aldalgemeinen, Schwäbischen, und Blatdeüdschen, gewisen und apgeschilderd insonderheid aber, nach der fon alders her im Schreiben fon allen Deüdschen gebrauchden aldalgemeinen Mundard, und fornämlich nach dersälben jetzichen waren Ausschbrache, grundmäsich eingerichded, auch so dan in bedrachd der Schreibzeichen, nach Dersälben Inen gehörenden Schdällen, apgemässen, und zum Druk beförderd wird. In der Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 7. Mai 1803 lesen wir: Ein Buch, wovon im J. 1753 der Abdruck zu Potsdam angefangen wurde, aber bey der 704ten Quartseite unvollendet blieb. Der Verfasser, Philipp Samuel Rosa, war Anhalt-Köthenscher Consistorialrath und Hofprediger, der seine Stelle niedergelegt, und nachher im [!] Potsdam, oder wenigstens in dortiger Gegend privatisirt haben soll. Sein Buch gehört wirklich zu den abentheuerlichsten Verwirrungen des menschlichen Gehirns. (Man beachte auch die handschriftliche Notiz am Ende des Göttinger Exemplars!)
Rosa (1702-?) hat auch eine gewisse Bedeutung - möglicherweise nur als dubioser Scharlatan - für das Freimaurertum des 18. Jahrhunderts. Ein verlässliches Todesdatum fand ich nicht, am ehesten kann von den vielen Google-Treffern auf Magdalene Heusers Ausgabe der Lebensbeschreibung seiner Tochter Angelika in dem Buch "Ich wünschte so gar gelehrt zu werden" 1994 verwiesen werden, die im Auszug bei Google Book Search einsehbar ist.
Das Buch wurde von Göttingen im Rahmen des VD 18 bereitgestellt. Zu diesem sehe man das AGFNZ-Weblog.
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Donnerstag, 2. Dezember 2010, 00:03 - Rubrik: Unterhaltung
Die elektronische Veröffentlichungsreihe “Habsburg Digital” der Österreichischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts beabsichtigt, monographisch angelegte Studien langfristig elektronisch im Internet zur Verfügung zu stellen. Die langfristige Verfügbarkeit sowie Zitierbarkeit der Publikation wird über die Kooperation mit dem Langzeitarchivierungssystem der Universität Wien “Phaidra” gewährleistet.
Der erste Band darin:
Schembor, Friedrich Wilhelm: Meinungsbeeinflussung durch Zensur und Druckförderung in der Napoleonischen Zeit. Eine Dokumentation auf Grund der Akten der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle (= Habsburg Digital. Elektronische Publikationsreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bd. 1) Wien 2010
Online: http://phaidra.univie.ac.at/o:62678
http://www.oege18.org/publikation/habsburg_digital.html
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=10557
Der erste Band darin:
Schembor, Friedrich Wilhelm: Meinungsbeeinflussung durch Zensur und Druckförderung in der Napoleonischen Zeit. Eine Dokumentation auf Grund der Akten der Obersten Polizei- und Zensurhofstelle (= Habsburg Digital. Elektronische Publikationsreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bd. 1) Wien 2010
Online: http://phaidra.univie.ac.at/o:62678
http://www.oege18.org/publikation/habsburg_digital.html
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=10557
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 23:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 23:52 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hongkiat.com/blog/55-interesting-social-media-infographics/
Daraus: How People Share Content on the Web

Daraus: How People Share Content on the Web

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Deutsche Musikarchiv ist von Berlin nach Leipzig umgezogen. Die 30 Mitarbeiter hatten am Mittwoch in dem Neubau an der Deutschen Nationalbibliothek ihren ersten offiziellen Arbeitstag. Mit den neuen Kollegen zogen auch rund 1,5 Millionen Musik-Medien von der Spree an die Pleiße um, wie eine Sprecherin der Bibliothek sagte. Darunter seien rund 900.000 Tonträger wie CDs und Musikkassetten, aber auch Vinyl- und historische Schellackplatten.
Das Musikarchiv gehört zu einem umfangreichen Neubau der Bibliothek. Hauptbestandteil ist ein Erweiterungsbau, um die ständig wachsende Büchersammlung aufnehmen zu können, sowie ein eigener Lesesaal für das Musikarchiv. Zudem wurden die Büchertürme, in denen ein Großteil der momentan rund 15 Millionen Medien lagert, renoviert. Die Deutsche Nationalbibliothek hat sich den Anbau rund 59 Millionen Euro kosten lassen, wie ein Sprecher sagte. Die offizielle Eröffnung ist für den 9. Mai geplant. Das Musikarchiv soll bereits im Frühjahr den Besuchern offenstehen.
Die Deutsche Nationalbibliothek war 1912 gegründet worden. Seitdem müssen alle deutschsprachigen Verlage Belegexemplare abgeben, die dann eingelagert werden. Da die Bibliothek einmal aufgenommene Bücher nicht wieder aussortiert, wächst der Bestand kontinuierlich, ein Erweiterungsbau ist etwa alle 30 Jahre notwendig. In Leipzig wird derzeit an der vierten Erweiterung seit Bestehen gearbeitet.
Einen zweiten Standort hat die Bibliothek in Frankfurt am Main, dies ist eine Folge der deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik und DDR sammelten damals getrennt. Seit der Wiedervereinigung gehören beide Häuser wieder zusammen, ihr gemeinsamer Bestand beträgt rund 25 Millionen Bücher, Zeitschriften und andere Medien."
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 1.12.2010
Das Musikarchiv gehört zu einem umfangreichen Neubau der Bibliothek. Hauptbestandteil ist ein Erweiterungsbau, um die ständig wachsende Büchersammlung aufnehmen zu können, sowie ein eigener Lesesaal für das Musikarchiv. Zudem wurden die Büchertürme, in denen ein Großteil der momentan rund 15 Millionen Medien lagert, renoviert. Die Deutsche Nationalbibliothek hat sich den Anbau rund 59 Millionen Euro kosten lassen, wie ein Sprecher sagte. Die offizielle Eröffnung ist für den 9. Mai geplant. Das Musikarchiv soll bereits im Frühjahr den Besuchern offenstehen.
Die Deutsche Nationalbibliothek war 1912 gegründet worden. Seitdem müssen alle deutschsprachigen Verlage Belegexemplare abgeben, die dann eingelagert werden. Da die Bibliothek einmal aufgenommene Bücher nicht wieder aussortiert, wächst der Bestand kontinuierlich, ein Erweiterungsbau ist etwa alle 30 Jahre notwendig. In Leipzig wird derzeit an der vierten Erweiterung seit Bestehen gearbeitet.
Einen zweiten Standort hat die Bibliothek in Frankfurt am Main, dies ist eine Folge der deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik und DDR sammelten damals getrennt. Seit der Wiedervereinigung gehören beide Häuser wieder zusammen, ihr gemeinsamer Bestand beträgt rund 25 Millionen Bücher, Zeitschriften und andere Medien."
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 1.12.2010
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 21:16 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Michael F. Suarez, "The Codex, the Digital Image, and the Problems of Presence," is available (as audio file) on the Bridwell Library website at:
http://www.smu.edu/Bridwell/About/NewsandEvents/Previous%20Lectures.aspx
"Originally delivered on October 28, 2010 at Southern Methodist University, the lecture considered how digital surrogates are changing the ways we think about books and what the implications of these changes might be. In turn, the lecture asked how books and bibliographical reflection might usefully change the ways we think about 'books' delivered to us as digital images. Insights from art history, philosophy, and anthropology were adduced to enrich our thinking about this timely subject.
Michael F. Suarez, S.J. is Director of Rare Book School and Professor of English and University Professor at the University of Virginia."
http://www.smu.edu/Bridwell/About/NewsandEvents/Previous%20Lectures.aspx
"Originally delivered on October 28, 2010 at Southern Methodist University, the lecture considered how digital surrogates are changing the ways we think about books and what the implications of these changes might be. In turn, the lecture asked how books and bibliographical reflection might usefully change the ways we think about 'books' delivered to us as digital images. Insights from art history, philosophy, and anthropology were adduced to enrich our thinking about this timely subject.
Michael F. Suarez, S.J. is Director of Rare Book School and Professor of English and University Professor at the University of Virginia."
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 19:43 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich schließe mich RA Stadler an:
http://www.internet-law.de/2010/12/mein-blog-bleibt-online.html
Siehe auch
http://log.netbib.de/archives/2010/12/01/netbib-ab-2011-mit-offnungszeiten/
http://infobib.de/blog/2010/11/30/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv/
Archivalia beeinträchtigt nicht die Entwicklung Jugendlicher!
Update:
http://blog.beck.de/2010/11/30/jugendmedienstaatsvertrag-und-altersfreigabe-im-internet
http://www.internet-law.de/2010/12/mein-blog-bleibt-online.html
Siehe auch
http://log.netbib.de/archives/2010/12/01/netbib-ab-2011-mit-offnungszeiten/
http://infobib.de/blog/2010/11/30/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv/
Archivalia beeinträchtigt nicht die Entwicklung Jugendlicher!
Update:
http://blog.beck.de/2010/11/30/jugendmedienstaatsvertrag-und-altersfreigabe-im-internet
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 18:37 - Rubrik: Archivrecht
Ohne alberne Gewinnspiele:
Brickfilme
http://www.steinerei.de/
E-Learning
http://www.e-teaching.org/community/adventskalender/index_html
Erzgebirge
http://www.tu-chemnitz.de/advent/2010/
Gesprochenes
http://www.senioren-lernen-online.de/advent/adventskalender001.html
Literarisches
http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/
Viele weitere Links:
http://bibliothekarisch.de/blog/2010/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2010/
PS: der Archivalia Adventskalender ist eindeutig aufrufbar unter
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
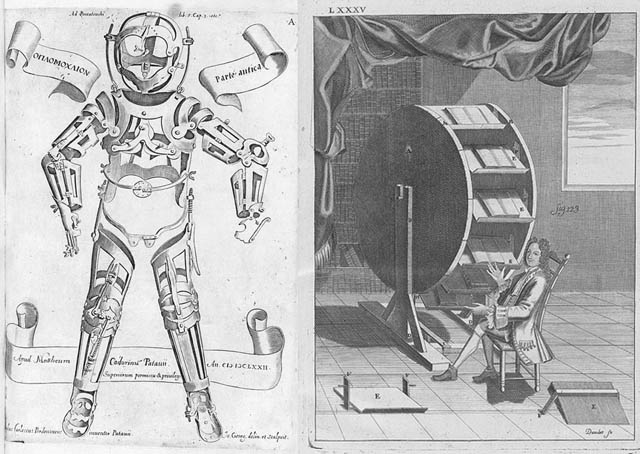 Aus dem Archivalia Adventskalender 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5401727/
Aus dem Archivalia Adventskalender 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5401727/
Brickfilme
http://www.steinerei.de/
E-Learning
http://www.e-teaching.org/community/adventskalender/index_html
Erzgebirge
http://www.tu-chemnitz.de/advent/2010/
Gesprochenes
http://www.senioren-lernen-online.de/advent/adventskalender001.html
Literarisches
http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/
Viele weitere Links:
http://bibliothekarisch.de/blog/2010/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2010/
PS: der Archivalia Adventskalender ist eindeutig aufrufbar unter
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
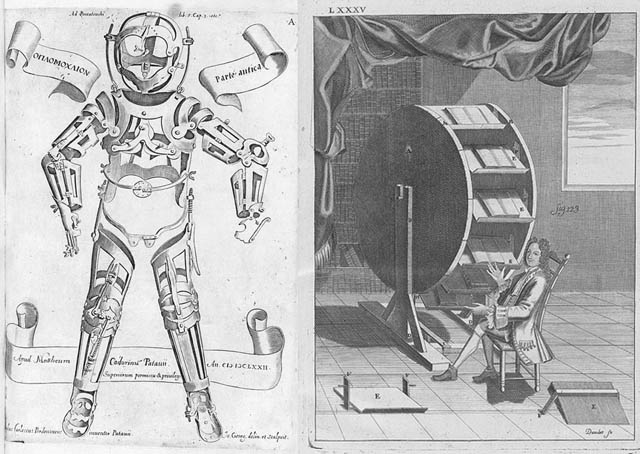 Aus dem Archivalia Adventskalender 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5401727/
Aus dem Archivalia Adventskalender 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5401727/KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 17:38 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=4569&cHash=22e28073b1
Via Archivliste
Die Findbücher sind einsehbar unter:
http://www.its-arolsen.org/de/das_archiv/findbuecher/index.html
Der ITS ist keine Behörde, er nimmt für sich in Anspruch, nach Willkür Entscheidungen über den dauerhaften Ausschluss von benutzern zu treffen: "Demjenigen, der sich laut innerstaatlichem oder internationalem Recht des Missbrauchs von Daten schuldig macht, die er vom Internationalen Suchdienst erhalten hat, kann der Direktor des Internationalen Suchdienstes den weiteren Zugang zu den Archiven und Unterlagen nach freiem Ermessen verweigern." Das deutsche Verwaltungsrecht kennt kein freies Ermessen. Freies Ermessen bedeutet nichts anderes als Willkür, vermutlich ohne Möglichkeit eines Rechtsschutzes.
Via Archivliste
Die Findbücher sind einsehbar unter:
http://www.its-arolsen.org/de/das_archiv/findbuecher/index.html
Der ITS ist keine Behörde, er nimmt für sich in Anspruch, nach Willkür Entscheidungen über den dauerhaften Ausschluss von benutzern zu treffen: "Demjenigen, der sich laut innerstaatlichem oder internationalem Recht des Missbrauchs von Daten schuldig macht, die er vom Internationalen Suchdienst erhalten hat, kann der Direktor des Internationalen Suchdienstes den weiteren Zugang zu den Archiven und Unterlagen nach freiem Ermessen verweigern." Das deutsche Verwaltungsrecht kennt kein freies Ermessen. Freies Ermessen bedeutet nichts anderes als Willkür, vermutlich ohne Möglichkeit eines Rechtsschutzes.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:51 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Robert Kretzschmar äußert sich in der Welt zu folgenden Fragestellungen: Archive und die digitalen Herausforderungen, Nachbesetzung der Stelle des Bundesarchivpräsidenten, Archive und Wikileaks, Buindesarchiv und Politisches Archv des Auswärigen Amtes und Bundesarchiv und Birthler/Jahn-Behörde.
Wiewohl Kretzschmar Ambitionen auf die Bundesarchivpräsidentenstelle zurückweist, liest sich das Interview wie ein Bewerbungsgespräch.
Wiewohl Kretzschmar Ambitionen auf die Bundesarchivpräsidentenstelle zurückweist, liest sich das Interview wie ein Bewerbungsgespräch.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 14:46 - Rubrik: Personalia
 rchivalia bietet - getreu seinem Motto "prodesse ac delectare" und wie schon 2008 - dieses Jahr erneut einen Adventskalender an. Wir fliehen als erstes das Wintergrau mit Schnee und Eis und begeben uns an der Hand des wunderbaren Bibliodyssey in die sonnige Karibik.
rchivalia bietet - getreu seinem Motto "prodesse ac delectare" und wie schon 2008 - dieses Jahr erneut einen Adventskalender an. Wir fliehen als erstes das Wintergrau mit Schnee und Eis und begeben uns an der Hand des wunderbaren Bibliodyssey in die sonnige Karibik.Die um 1840 entstandenen ersten drei Lithographien entstammen einem Album, das von der Cuban Heritage Collection der University of Miami ins Netz gestellt wurde.
Die vierte ist einem Album mit Ansichten von Havanna um 1850 entnommen, das die Digital Library of the Carribean anbietet.
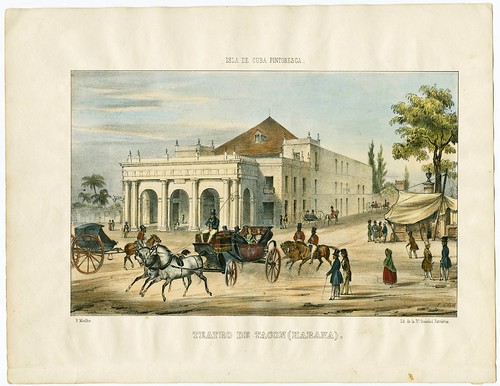
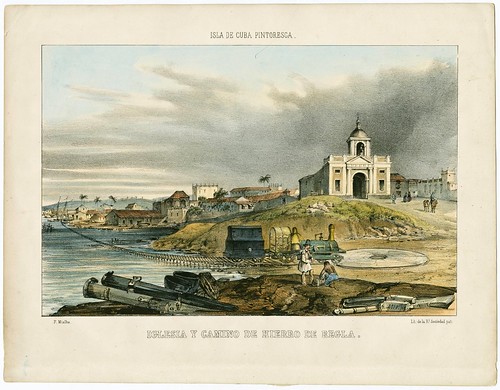
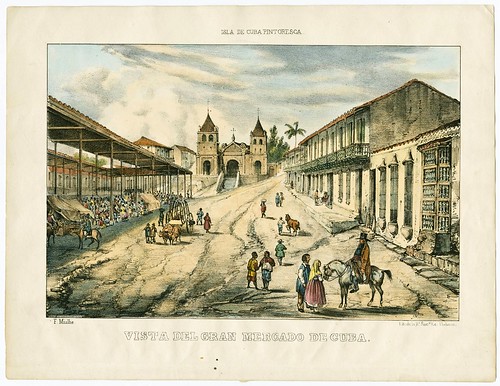

Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 00:20 - Rubrik: Unterhaltung
"To destroy psychiatric records with the human and scientific value they hold for us and future generations is unconscionable." Ein australischer Psychiater und Buchautor wendet sich gegen die Vernichtung von Patientenunterlagen:
http://www.smh.com.au/opinion/politics/destroying-records-is-an-act-of-vandalism-20101129-18dta.html
http://www.smh.com.au/opinion/politics/destroying-records-is-an-act-of-vandalism-20101129-18dta.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Open data in the arts and humanities
View more presentations from jwyg.
Wolf Thomas - am Dienstag, 30. November 2010, 21:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Text: F.A.Z., 01.12.2010, Nr. 280 / Seite N5
Digitaler Tod oder digitale Freiheit?
Wer vermisst Skriptorien? Die Stärkung der Autoren durch "Open Access" in der Wissenschaft / Von Olaf Gefeller
Unter der Überschrift "Vom digitalen Tod des freien Forschers" (F.A.Z. vom 3. November) hat der Konstanzer Bibliothekar uns Bibliothekshistoriker Uwe Jochum ein apokalyptisches Bild vom Niedergang der freien Wissenschaft, der "Demolierung der Autorenschaft" und dem "Tod der Wissenschaftsverlage" gezeichnet. Wie in ähnlichen Beiträgen aus seiner
Feder in den letzten zwei Jahren sieht er die deutsche Wissenschaft auf dem Weg in die "staatskapitalistische Planwirtschaft . . . in der Verbandsfunktionäre das Sagen haben", sofern bei der Reform des wissenschaftlichen Urheberrechts die Vorschläge der "Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen" - ein Zusammenschluss von zehn
deutschen Wissenschaftsorganisationen von der DFG über Max-Planck-, Frauenhofer-, Helmholtz- und Leibniz-Gesellschaft bis hin zum Wissenschaftsrat und der Hochschulrektorenkonferenz - in geltendes Recht umgesetzt würden.
Siehe http://archiv.twoday.net/search?q=jochum
Olaf Gefeller, Direktor des Instituts für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, begrüßt dagegen die Vorschläge der Allianz.
Ich erhalte die Chance, eine von mir verfasste Arbeit nach der Veröffentlichung in einer angesehenen Zeitschrift, welche mich regelmäßig vor Annahme der Publikation zwingt, all meine Urheberrechte an den Verlag zu übertragen, da sonst die Arbeit in der Zeitschrift nicht erscheinen kann, nach meinen Vorstellungen einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ich hätte endlich eine rechtlich abgesicherte Möglichkeit, über die Homepage meines Lehrstuhls auch meine Forschungspublikationen und die meiner Mitarbeiter zum Download anzubieten oder ich könnte mich an einem entsprechenden Volltextserver meiner Universität beteiligen. All dies kann ich aktuell nicht.
Selbst wenn die Materialien einer von mir zu haltenden Lehrveranstaltung aus von mir selbst verfassten Publikationen bestehen, darf ich diese den Studenten nicht zum Download auf die Homepage stellen. Auch beim elektronischen Versand meiner Publikationen in Form der originalen Zeitschriften-pdfs an nachfragende Interessenten betrete ich offensichtlich ein urheberrechtlich vermintes Gebiet, wie der lange Streit über die Zulässigkeit der elektronischen Dokumentenlieferung von
Bibliotheken im Rahmen von Fernleihbestellungen gezeigt hat.
Für mich ist ein wesentliches Element der freien Wissenschaft die freie Wissenschaftskommunikation. Dazu gehört auch die Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher Information und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Jede Initiative, die hier Verbesserungen im Sinne eines Abbaus von Hemmnissen des Zugangs schafft, findet daher meine Zustimmung. Ich sehe in den Vorschlägen der Allianzinitiative das aufrichtige Bemühen um Verbesserungen und vernünftige Schritte in die richtige Richtung.
Meine Sorge um das ökonomische Überleben der Wissenschaftsverlage ist dabei gering. Ich bin sicher, dass hier neue Geschäftsmodelle entstehen werden, die innovativen Verlagen ein auskömmliches Wirtschaften ermöglichen werden. Wissenschaftsverlage, die mit Unterstützung von Jochum und einigen anderen jetzt das Ende der freien Wissenschaft, den
kulturellen Untergang des Abendlandes durch die fortschreitende
Digitalisierung und ähnliche Schreckensszenarien an die Wand malen, um diese Entwicklung mit allen Mitteln zu stoppen, anstatt sich zum konstruktiven Begleiter der sich anbahnenden Umwälzungen zu machen, könnten tatsächlich Probleme bekommen. Doch warum soll es diesen Verlagen besser ergehen als den klösterlichen Skriptorien des Spätmittelalters, die sich gegen die Einführung des Gutenbergschen Buchdruckverfahrens stemmten?
Die Vorteile der digitalen Verfügbarkeit wissenschaftlicher Information sind derart evident, dass es - zumindest außerhalb der
Geisteswissenschaften - darüber keine Kontroverse mehr gibt. Die
Organisation des Zugriffs auf die digitalisierte Information ist die
Herausforderung der kommenden Jahre. Hierbei müssen
Wissenschaftsverlage, Anbieter von Open Access-Plattformen, Bibliotheken und natürlich die Wissenschaftler selbst mit Unterstützung der Wissenschaftsorganisationen ein für alle Seiten akzeptables Modell für die digitale Zukunft entwickeln. Die "freie Wissenschaft", da bin ich unerschütterlich optimistisch, wird daran nicht versterben.
Digitaler Tod oder digitale Freiheit?
Wer vermisst Skriptorien? Die Stärkung der Autoren durch "Open Access" in der Wissenschaft / Von Olaf Gefeller
Unter der Überschrift "Vom digitalen Tod des freien Forschers" (F.A.Z. vom 3. November) hat der Konstanzer Bibliothekar uns Bibliothekshistoriker Uwe Jochum ein apokalyptisches Bild vom Niedergang der freien Wissenschaft, der "Demolierung der Autorenschaft" und dem "Tod der Wissenschaftsverlage" gezeichnet. Wie in ähnlichen Beiträgen aus seiner
Feder in den letzten zwei Jahren sieht er die deutsche Wissenschaft auf dem Weg in die "staatskapitalistische Planwirtschaft . . . in der Verbandsfunktionäre das Sagen haben", sofern bei der Reform des wissenschaftlichen Urheberrechts die Vorschläge der "Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen" - ein Zusammenschluss von zehn
deutschen Wissenschaftsorganisationen von der DFG über Max-Planck-, Frauenhofer-, Helmholtz- und Leibniz-Gesellschaft bis hin zum Wissenschaftsrat und der Hochschulrektorenkonferenz - in geltendes Recht umgesetzt würden.
Siehe http://archiv.twoday.net/search?q=jochum
Olaf Gefeller, Direktor des Instituts für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, begrüßt dagegen die Vorschläge der Allianz.
Ich erhalte die Chance, eine von mir verfasste Arbeit nach der Veröffentlichung in einer angesehenen Zeitschrift, welche mich regelmäßig vor Annahme der Publikation zwingt, all meine Urheberrechte an den Verlag zu übertragen, da sonst die Arbeit in der Zeitschrift nicht erscheinen kann, nach meinen Vorstellungen einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ich hätte endlich eine rechtlich abgesicherte Möglichkeit, über die Homepage meines Lehrstuhls auch meine Forschungspublikationen und die meiner Mitarbeiter zum Download anzubieten oder ich könnte mich an einem entsprechenden Volltextserver meiner Universität beteiligen. All dies kann ich aktuell nicht.
Selbst wenn die Materialien einer von mir zu haltenden Lehrveranstaltung aus von mir selbst verfassten Publikationen bestehen, darf ich diese den Studenten nicht zum Download auf die Homepage stellen. Auch beim elektronischen Versand meiner Publikationen in Form der originalen Zeitschriften-pdfs an nachfragende Interessenten betrete ich offensichtlich ein urheberrechtlich vermintes Gebiet, wie der lange Streit über die Zulässigkeit der elektronischen Dokumentenlieferung von
Bibliotheken im Rahmen von Fernleihbestellungen gezeigt hat.
Für mich ist ein wesentliches Element der freien Wissenschaft die freie Wissenschaftskommunikation. Dazu gehört auch die Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher Information und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Jede Initiative, die hier Verbesserungen im Sinne eines Abbaus von Hemmnissen des Zugangs schafft, findet daher meine Zustimmung. Ich sehe in den Vorschlägen der Allianzinitiative das aufrichtige Bemühen um Verbesserungen und vernünftige Schritte in die richtige Richtung.
Meine Sorge um das ökonomische Überleben der Wissenschaftsverlage ist dabei gering. Ich bin sicher, dass hier neue Geschäftsmodelle entstehen werden, die innovativen Verlagen ein auskömmliches Wirtschaften ermöglichen werden. Wissenschaftsverlage, die mit Unterstützung von Jochum und einigen anderen jetzt das Ende der freien Wissenschaft, den
kulturellen Untergang des Abendlandes durch die fortschreitende
Digitalisierung und ähnliche Schreckensszenarien an die Wand malen, um diese Entwicklung mit allen Mitteln zu stoppen, anstatt sich zum konstruktiven Begleiter der sich anbahnenden Umwälzungen zu machen, könnten tatsächlich Probleme bekommen. Doch warum soll es diesen Verlagen besser ergehen als den klösterlichen Skriptorien des Spätmittelalters, die sich gegen die Einführung des Gutenbergschen Buchdruckverfahrens stemmten?
Die Vorteile der digitalen Verfügbarkeit wissenschaftlicher Information sind derart evident, dass es - zumindest außerhalb der
Geisteswissenschaften - darüber keine Kontroverse mehr gibt. Die
Organisation des Zugriffs auf die digitalisierte Information ist die
Herausforderung der kommenden Jahre. Hierbei müssen
Wissenschaftsverlage, Anbieter von Open Access-Plattformen, Bibliotheken und natürlich die Wissenschaftler selbst mit Unterstützung der Wissenschaftsorganisationen ein für alle Seiten akzeptables Modell für die digitale Zukunft entwickeln. Die "freie Wissenschaft", da bin ich unerschütterlich optimistisch, wird daran nicht versterben.
KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 19:37 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nun ist erstmal Schluss mit dem Umfrage-Marathon, denn der Adventskalender soll ja nicht zu kurz kommen. (Das erste Türlein geht kurz nach Mitternacht auf.)
Hier die Links zu den Auswertungen der einzelnen Umfragen:
Allgemeine Bewertung
http://archiv.twoday.net/stories/8420389/
Soll die Rubrik Sportarchive entfallen?
http://archiv.twoday.net/stories/8439073/
Wer liest Archivalia?
http://archiv.twoday.net/stories/8445496/
Räumliche Herkunft
http://archiv.twoday.net/stories/8452812/
Lesefrequenz
http://archiv.twoday.net/stories/11422523/
Themenbewertung
http://archiv.twoday.net/stories/11424930/
Hier die Links zu den Auswertungen der einzelnen Umfragen:
Allgemeine Bewertung
http://archiv.twoday.net/stories/8420389/
Soll die Rubrik Sportarchive entfallen?
http://archiv.twoday.net/stories/8439073/
Wer liest Archivalia?
http://archiv.twoday.net/stories/8445496/
Räumliche Herkunft
http://archiv.twoday.net/stories/8452812/
Lesefrequenz
http://archiv.twoday.net/stories/11422523/
Themenbewertung
http://archiv.twoday.net/stories/11424930/
KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 19:01 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu: http://archiv.twoday.net/stories/8460699/
Umfragestart:
22.11.2010 19:22 Uhr
Archive von unten 9 8,57%
Facharchivisches 20 19,05%
Digitale Bibliotheken, Internetrecherche, Web 2.0 34 32,38%
Genealogie 6 5,71%
Hilfswissenschaften, Kodikologie 6 5,71%
Geschichtswissenschaftliches (weit gefasst) 13 12,38%
Juristisches 5 4,76%
Open Access 6 5,71%
Records Management, E-Government 3 2,86%
Unterhaltung, Wahrnehmung 3 2,86%
Summe 105 100.00% letzte Stimme: 30.11.2010 18:38 Uhr
* Obwohl Archivalia ein archivisches Fachblog ist, haben die Digitalen Bibliotheken usw. die Nase vorn. Etwa ein Drittel der LeserInnen schätzt diesen Themenbereich am meisten.
* Nur knapp ein Fünftel präferiert Facharchivisches.
* Gut 12 % bevorzugen Geschichtswissenschaftliches.
* Nicht ganz abgeschlagen: mit etwa 9 Prozent die "Archive von unten"
* Aber auch die anderen Themen fanden Liebhaber, wenngleich das Records Management nur 3 Leser von 105 primär interessiert.
Möglicherweise hätten sich viele für die Option "Die Mischung machts" entschieden, wäre diese vorgegeben gewesen.
Umfragestart:
22.11.2010 19:22 Uhr
Archive von unten 9 8,57%
Facharchivisches 20 19,05%
Digitale Bibliotheken, Internetrecherche, Web 2.0 34 32,38%
Genealogie 6 5,71%
Hilfswissenschaften, Kodikologie 6 5,71%
Geschichtswissenschaftliches (weit gefasst) 13 12,38%
Juristisches 5 4,76%
Open Access 6 5,71%
Records Management, E-Government 3 2,86%
Unterhaltung, Wahrnehmung 3 2,86%
Summe 105 100.00% letzte Stimme: 30.11.2010 18:38 Uhr
* Obwohl Archivalia ein archivisches Fachblog ist, haben die Digitalen Bibliotheken usw. die Nase vorn. Etwa ein Drittel der LeserInnen schätzt diesen Themenbereich am meisten.
* Nur knapp ein Fünftel präferiert Facharchivisches.
* Gut 12 % bevorzugen Geschichtswissenschaftliches.
* Nicht ganz abgeschlagen: mit etwa 9 Prozent die "Archive von unten"
* Aber auch die anderen Themen fanden Liebhaber, wenngleich das Records Management nur 3 Leser von 105 primär interessiert.
Möglicherweise hätten sich viele für die Option "Die Mischung machts" entschieden, wäre diese vorgegeben gewesen.
KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 18:50 - Rubrik: Allgemeines
"Die dramatische Schädigung vieler wertvoller Bestände des schriftlichen Kulturguts in deutschen Bibliotheken und Archiven durch Papierzerfall, Säure- und Tintenfraß, durch unsachgemäße Lagerung oder andere Einflüsse stellt zahlreiche, besonders kleinere Einrichtungen vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung bei der Restaurierung und Konservierung. Deshalb unterstützen Bund und Länder jetzt gemeinsam in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr Projekte zur Restaurierung und zum Schutz des national bedeutsamen schriftlichen Kulturgutes. Die Bundesländer beteiligen sich über die Kulturstiftung der Länder mit 100.000 Euro, im Haushalt des Kulturstaatsministers sind hierfür 500.000 Euro vorgesehen. Zunächst wurden kleinere Einrichtungen in den Ländern aufgefordert, dringende Restaurierungsprojekte mit verschiedenen Schadensursachen als Projekte mit Modellcharakter für den Erhalt des schriftlichen Kulturguts zu melden.
In 31 Bibliotheken und Archiven werden Vorhaben finanziert, durch die Schäden etwa durch saures Papier oder Schimmel beseitigt bzw. vermieden werden. Zunehmend im Blick sind auch Fragen der Lagerung von Beständen sowie der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur präventiven Bestandserhaltung. Auch solche Projekte sowie Restaurierungen von besonders wertvollen Objekten werden jetzt in den überwiegend kleineren Einrichtungen gefördert.
Einige Beispiele von geförderten Projekten:
Maßnahmen und Untersuchungen zur Massenentsäuerung
Im ehrenamtlich geführten Deutschen Tagebucharchiv Emmendingen ist eine einzigartige Sammlung von Original-Tagebüchern des 17. bis 20. Jahrhunderts in hohem Maß von Säureschäden bedroht. Die konservatorische Maßnahme umfasst die Massenentsäuerung des Papiers und eine Neuverpackung der Tagebücher, die von hohem personen-, sozial- und kulturgeschichtlichen Wert sind.
Bekämpfung und Untersuchung von Schimmelschäden
Im Klosterstift St. Marienthal in Ostritz ist die Bibliothek mit u. a. fast 3.000 historischen Bänden mit wertvollen Inkunabeln und weiteren Beständen des 16. bis 19. Jahrhunderts nach dem Hochwasser der Neiße im Sommer 2010 durch Schimmelpilz bedroht, der mit konservatorischen Maßnahmen jetzt bekämpft werden kann.
Analyse und Restaurierung unterschiedlicher Lagerschäden
Im Goethehaus Frankfurt am Main werden 20 wertvolle Bände der „Faust“-Sammlung restauriert, die sich in besonders schlechtem Erhaltungszustand befinden. In der Universitäts- und Landesbibliothek Münster werden Werke der Bibliothek des Kapuzinerklosters Werne – eine der wenigen erhaltenen Klosterbibliotheken des norddeutschen Raums – aus der Zeit von vor 1800 restauriert und mit Schutzverpackung versehen.
Präventive Maßnahmen
Im Robert-Schumann-Haus in Zwickau werden für die weltweit umfangreichste Schumann-Sammlung mit u. a. dessen autobiographischem, literarischem und musikliterarischem Nachlass Schutzverpackungen für die wertvollen Bestände angekauft. In der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha wird die Korrespondenz des Reformators Paul Eber (16. Jhdt., lehrte in Wittenberg, Schüler von Melanchthon) präventiv restauriert, um sie anschließend bis 2012 digital zu edieren.
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagte in Berlin: „Ich freue mich, dass vor dem Hintergrund der dramatischen Schädigung zahlreicher wertvoller Bestände in deutschen Bibliotheken und Archiven nun die ersten Restaurierungen für besonders dringende Projekte in kleineren Einrichtungen starten können. Diese Modellprojekte retten national wertvolles Kulturgut, insofern ist gerade das konzertierte Handeln von Ländern und Bund ein wichtiges Signal für die kommenden Jahre: Nur gemeinsam können wir die kostbaren schriftlichen Zeugnisse vor dem endgültigen Zerfall bewahren.“
Schon die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ hatte 2007 Bund und Ländern empfohlen, eine „nationale Bestandserhaltungskonzeption“ zum Schutz des gefährdeten schriftlichen Kulturguts zu erarbeiten. Auf Einladung des Kulturstaatsministers Bernd Neumann hatten sich im Juli dieses Jahres Bibliothekare und Archivare bedeutender Einrichtungen sowie Vertreter von Ländern, Städten und Gemeinden zu einem „Runden Tisch“ im Bundeskanzleramt getroffen und sich darauf verständigt, die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturguts vorzubereiten.
Gemeinsam getragen von Bund und Ländern soll die Koordinierungsstelle bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtet werden und Modellprojekte zur Entwicklung eines Programms zur Erhaltung des national bedeutsamen schriftlichen Kulturerbes initiieren und betreuen. Sie soll Bestandserhaltungsmaßnahmen koordinieren, bereits vorliegende Forschungsergebnisse und erfolgversprechende Techniken evaluieren sowie ein nationales Bestandserhaltungskonzept erarbeiten."
Quelle: Mitteilung der Kulturstiftung der Länder v. 5.11.2010
Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern:
"Vier Archive und Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern können mit Hilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder wertvolle Stücke retten.
So bekommt das Rostocker Stadtarchiv mehr als 10.000 Euro Fördermittel, wie Direktor Karsten Schröder am Dienstag
mitteilte. Mehr als 20 hanseatische Urkunden könnten so restauriert werden.
Fördergelder gehen auch an das Landeshauptarchiv in Schwerin, an die Uni-Bibliothek Rostock und an das Stadtarchiv Schwerin. ...."
Quelle: NDRText, Seite 152, v. 30.11.2010
Welche Archive sind noch "betroffen"?
In 31 Bibliotheken und Archiven werden Vorhaben finanziert, durch die Schäden etwa durch saures Papier oder Schimmel beseitigt bzw. vermieden werden. Zunehmend im Blick sind auch Fragen der Lagerung von Beständen sowie der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur präventiven Bestandserhaltung. Auch solche Projekte sowie Restaurierungen von besonders wertvollen Objekten werden jetzt in den überwiegend kleineren Einrichtungen gefördert.
Einige Beispiele von geförderten Projekten:
Maßnahmen und Untersuchungen zur Massenentsäuerung
Im ehrenamtlich geführten Deutschen Tagebucharchiv Emmendingen ist eine einzigartige Sammlung von Original-Tagebüchern des 17. bis 20. Jahrhunderts in hohem Maß von Säureschäden bedroht. Die konservatorische Maßnahme umfasst die Massenentsäuerung des Papiers und eine Neuverpackung der Tagebücher, die von hohem personen-, sozial- und kulturgeschichtlichen Wert sind.
Bekämpfung und Untersuchung von Schimmelschäden
Im Klosterstift St. Marienthal in Ostritz ist die Bibliothek mit u. a. fast 3.000 historischen Bänden mit wertvollen Inkunabeln und weiteren Beständen des 16. bis 19. Jahrhunderts nach dem Hochwasser der Neiße im Sommer 2010 durch Schimmelpilz bedroht, der mit konservatorischen Maßnahmen jetzt bekämpft werden kann.
Analyse und Restaurierung unterschiedlicher Lagerschäden
Im Goethehaus Frankfurt am Main werden 20 wertvolle Bände der „Faust“-Sammlung restauriert, die sich in besonders schlechtem Erhaltungszustand befinden. In der Universitäts- und Landesbibliothek Münster werden Werke der Bibliothek des Kapuzinerklosters Werne – eine der wenigen erhaltenen Klosterbibliotheken des norddeutschen Raums – aus der Zeit von vor 1800 restauriert und mit Schutzverpackung versehen.
Präventive Maßnahmen
Im Robert-Schumann-Haus in Zwickau werden für die weltweit umfangreichste Schumann-Sammlung mit u. a. dessen autobiographischem, literarischem und musikliterarischem Nachlass Schutzverpackungen für die wertvollen Bestände angekauft. In der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha wird die Korrespondenz des Reformators Paul Eber (16. Jhdt., lehrte in Wittenberg, Schüler von Melanchthon) präventiv restauriert, um sie anschließend bis 2012 digital zu edieren.
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagte in Berlin: „Ich freue mich, dass vor dem Hintergrund der dramatischen Schädigung zahlreicher wertvoller Bestände in deutschen Bibliotheken und Archiven nun die ersten Restaurierungen für besonders dringende Projekte in kleineren Einrichtungen starten können. Diese Modellprojekte retten national wertvolles Kulturgut, insofern ist gerade das konzertierte Handeln von Ländern und Bund ein wichtiges Signal für die kommenden Jahre: Nur gemeinsam können wir die kostbaren schriftlichen Zeugnisse vor dem endgültigen Zerfall bewahren.“
Schon die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ hatte 2007 Bund und Ländern empfohlen, eine „nationale Bestandserhaltungskonzeption“ zum Schutz des gefährdeten schriftlichen Kulturguts zu erarbeiten. Auf Einladung des Kulturstaatsministers Bernd Neumann hatten sich im Juli dieses Jahres Bibliothekare und Archivare bedeutender Einrichtungen sowie Vertreter von Ländern, Städten und Gemeinden zu einem „Runden Tisch“ im Bundeskanzleramt getroffen und sich darauf verständigt, die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturguts vorzubereiten.
Gemeinsam getragen von Bund und Ländern soll die Koordinierungsstelle bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtet werden und Modellprojekte zur Entwicklung eines Programms zur Erhaltung des national bedeutsamen schriftlichen Kulturerbes initiieren und betreuen. Sie soll Bestandserhaltungsmaßnahmen koordinieren, bereits vorliegende Forschungsergebnisse und erfolgversprechende Techniken evaluieren sowie ein nationales Bestandserhaltungskonzept erarbeiten."
Quelle: Mitteilung der Kulturstiftung der Länder v. 5.11.2010
Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern:
"Vier Archive und Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern können mit Hilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder wertvolle Stücke retten.
So bekommt das Rostocker Stadtarchiv mehr als 10.000 Euro Fördermittel, wie Direktor Karsten Schröder am Dienstag
mitteilte. Mehr als 20 hanseatische Urkunden könnten so restauriert werden.
Fördergelder gehen auch an das Landeshauptarchiv in Schwerin, an die Uni-Bibliothek Rostock und an das Stadtarchiv Schwerin. ...."
Quelle: NDRText, Seite 152, v. 30.11.2010
Welche Archive sind noch "betroffen"?
Wolf Thomas - am Dienstag, 30. November 2010, 18:43 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am (heutigen) Dienstag beschlossen, Roland Jahn dem Deutschen Bundestag zur Wahl als Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) vorzuschlagen.
Kulturstaatsminister Bernd Neumann betonte: "Mit dem Bürgerrechtler und Journalisten Roland Jahn ist es uns gelungen, eine überzeugende Persönlichkeit mit hohem Ansehen und breiter Akzeptanz für die Nachfolge von Marianne Birthler zu gewinnen. Herr Jahn hat sich in der DDR mutig gegen die Diktatur und gegen das Unrecht gestellt und sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt. Er hat sich aber auch nach seiner gewaltsamen Ausbürgerung aus der DDR bis heute kompetent und engagiert der Aufarbeitung der SED-Diktatur gewidmet und ist allen Verharmlosungen dieser Diktatur überzeugend entgegengetreten.
Ich habe heute allen Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag vorgeschlagen, Roland Jahn zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Ich gehe davon aus, dass Roland Jahn im Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit als Nachfolger von Marianne Birthler gewählt werden kann und dass er die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren inhaltlich und strukturell auf die BStU zukommen werden, mit großer Sachkenntnis und Professionalität meistern wird."
Mit Ablauf des 14. März 2011 endet die zweite Amtszeit von Marianne Birthler als Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Gem. § 35 Abs. 2 StUG wird der Bundesbeauftragte auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Deutschen Bundestag gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre; eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Der Bürgerrechtler Roland Jahn (Jahrgang 1953) gehörte in der DDR zur Opposition. Er war 1983 Mitbegründer der oppositionellen Friedensgemeinschaft Jena und wurde noch im gleichen Jahr unter Anwendung von Gewalt und Zwang ausgebürgert. In der Bundesrepublik produzierte Roland Jahn als Journalist für das ARD-Politikmagazin Kontraste des Senders Freies Berlin zahlreiche Beiträge zu Opposition, Menschenrechtsverletzungen und Alltag im SED-Staat der 80er Jahre. Die Friedliche Revolution begleitete er journalistisch mit Reportagen über Demonstrationen, Besetzungen der Stasi-Zentralen und den Machterhaltungskampf von SED-Funktionären, später widmete er sich dem Thema Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Roland Jahn arbeitet seit 1991 beim Rundfunk Berlin-Brandenburg als festangestellter Redakteur für das Politikmagazin Kontraste. Seit 1996 ist Roland Jahn im Beirat der Robert-Havemann-Gesellschaft und seit 1999 im Fachbeirat der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur tätig. Er war auch Mitglied der von BKM im Mai 2005 eingesetzten "Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbundes Aufarbeitung der SED-Diktatur" (sog. Sabrow-Kommission) und ist Mitherausgeber der Dokumentation "Wohin treibt die DDR-Erinnerung?". ...."
Quelle: PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG
PRESSEMITTEILUNG NR.: 456 v. 30.11.2010
Kulturstaatsminister Bernd Neumann betonte: "Mit dem Bürgerrechtler und Journalisten Roland Jahn ist es uns gelungen, eine überzeugende Persönlichkeit mit hohem Ansehen und breiter Akzeptanz für die Nachfolge von Marianne Birthler zu gewinnen. Herr Jahn hat sich in der DDR mutig gegen die Diktatur und gegen das Unrecht gestellt und sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt. Er hat sich aber auch nach seiner gewaltsamen Ausbürgerung aus der DDR bis heute kompetent und engagiert der Aufarbeitung der SED-Diktatur gewidmet und ist allen Verharmlosungen dieser Diktatur überzeugend entgegengetreten.
Ich habe heute allen Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag vorgeschlagen, Roland Jahn zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Ich gehe davon aus, dass Roland Jahn im Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit als Nachfolger von Marianne Birthler gewählt werden kann und dass er die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren inhaltlich und strukturell auf die BStU zukommen werden, mit großer Sachkenntnis und Professionalität meistern wird."
Mit Ablauf des 14. März 2011 endet die zweite Amtszeit von Marianne Birthler als Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Gem. § 35 Abs. 2 StUG wird der Bundesbeauftragte auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Deutschen Bundestag gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre; eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Der Bürgerrechtler Roland Jahn (Jahrgang 1953) gehörte in der DDR zur Opposition. Er war 1983 Mitbegründer der oppositionellen Friedensgemeinschaft Jena und wurde noch im gleichen Jahr unter Anwendung von Gewalt und Zwang ausgebürgert. In der Bundesrepublik produzierte Roland Jahn als Journalist für das ARD-Politikmagazin Kontraste des Senders Freies Berlin zahlreiche Beiträge zu Opposition, Menschenrechtsverletzungen und Alltag im SED-Staat der 80er Jahre. Die Friedliche Revolution begleitete er journalistisch mit Reportagen über Demonstrationen, Besetzungen der Stasi-Zentralen und den Machterhaltungskampf von SED-Funktionären, später widmete er sich dem Thema Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Roland Jahn arbeitet seit 1991 beim Rundfunk Berlin-Brandenburg als festangestellter Redakteur für das Politikmagazin Kontraste. Seit 1996 ist Roland Jahn im Beirat der Robert-Havemann-Gesellschaft und seit 1999 im Fachbeirat der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur tätig. Er war auch Mitglied der von BKM im Mai 2005 eingesetzten "Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbundes Aufarbeitung der SED-Diktatur" (sog. Sabrow-Kommission) und ist Mitherausgeber der Dokumentation "Wohin treibt die DDR-Erinnerung?". ...."
Quelle: PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG
PRESSEMITTEILUNG NR.: 456 v. 30.11.2010
Wolf Thomas - am Dienstag, 30. November 2010, 18:28 - Rubrik: Staatsarchive
KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 17:18 - Rubrik: Bestandserhaltung
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45794
Der Artikel über Kirchenburgen und Wehrkirchen weist keine einzige Illustration auf! Gut bebildert und sehr ausführlich (mit Einzelnachweisen) dagegen der Wikipedia-Artikel zur Kirchenburg in Ostheim vor der Rhön:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenburg_Ostheim
Solange das Historische Lexikon Bayerns einem verfehlten, am Druck orientierten Konzept huldigt (und sich einer Zusammenarbeit mit oder auch nur der Verlinkung von der Wikipedia verweigert) sehe ich keinen Anlass, dieses Projekt sonderlich positiv zu sehen.

Der Artikel über Kirchenburgen und Wehrkirchen weist keine einzige Illustration auf! Gut bebildert und sehr ausführlich (mit Einzelnachweisen) dagegen der Wikipedia-Artikel zur Kirchenburg in Ostheim vor der Rhön:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenburg_Ostheim
Solange das Historische Lexikon Bayerns einem verfehlten, am Druck orientierten Konzept huldigt (und sich einer Zusammenarbeit mit oder auch nur der Verlinkung von der Wikipedia verweigert) sehe ich keinen Anlass, dieses Projekt sonderlich positiv zu sehen.

KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 17:09 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zisch.ch/navigation/top_main_nav/nachrichten/zentralschweiz/luzern/detail.htm?client_request_className=NewsItem&client_request_contentOID=344208
"Kein Feiertag mehr für den Stadtpatron: 64 Prozent der Mitglieder des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern (WVL) wollen die Abschaffung des Sankt-Leodegar-Tags. "

"Kein Feiertag mehr für den Stadtpatron: 64 Prozent der Mitglieder des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern (WVL) wollen die Abschaffung des Sankt-Leodegar-Tags. "

KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 16:29 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Für die Kostenexplosion beim NRW-Landesarchiv in Duisburg von ursprünglich 30 auf rund 90 Millionen Euro sei die frühere CDU/FDP-Landesregierung verantwortlich, so der "Spiegel" in seiner jüngsten Ausgabe. Die Fraktion "DIE LINKE" möchte darüber in der Plenarsitzung am Freitag, 3. Dezember 2010, im Rahmen einer Aktuellen Stunde debattieren."
Quelle: Landtag NRW, Pressemitteilung v. 29.11.2010
Ausweislich der Einladung zur Sitzung beginnt die Aktuelle Stunde um 11:45 Uhr.

Özlem Alev Demirel, baupolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Landtag von NRW
"Anlässlich der immer weiter um sich greifenden Vorwürfe und Verdächtigungen rund um den Bau des Landesarchivs in Duisburg zeigt sich die baupolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Landtag von NRW, Özlem Alev Demirel, überrascht:
"Eine Landesregierung, die sich von einem Bauunternehmen über den Tisch ziehen lässt und bereit ist Fantasiepreise für ein Grundstück zu zahlen ist schon sehr kurios. Ein Oberbürgermeister, der möglicherweise Geheimnisverrat beging, indem er jenes Bauunternehmen informierte, dass das Land bald ein bestimmtes Grundstück kaufen will, ist noch merkwürdiger. Und ein Staatssekretär, der lustig immer teurere Wolkenkuckucksheime bauen will, obwohl eigentlich nur ein Zweckbau geplant war. Das sind viele Fehlverhalten auf einmal. Ob an diesen Vorwürfen, die der Presse zu entnehmen sind, tatsächlich etwas dran ist, das möchten wir bitteschön ganz genau wissen."
Aus diesem Grund hat die Linksfraktion eine Aktuelle Stunde im Landtag von NRW am Freitag, 3.12.2010 beantragt.
Demirel weiter: "An dieser Stelle kann die neue Landesregierung mal zeigen, ob sie wirklich so sauber mit ihren Vorgängern abrechnet. Wir fordern Ministerpräsidentin Kraft und die Landesregierung auf die Vorwürfe aufzuklären." ..."
Quelle: Pressemitteilung der Landtagsfraktion der "linken" v. 30.11.2010
s. a. rp-online.de, 30.11.2010
Quelle: Landtag NRW, Pressemitteilung v. 29.11.2010
Ausweislich der Einladung zur Sitzung beginnt die Aktuelle Stunde um 11:45 Uhr.

Özlem Alev Demirel, baupolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Landtag von NRW
"Anlässlich der immer weiter um sich greifenden Vorwürfe und Verdächtigungen rund um den Bau des Landesarchivs in Duisburg zeigt sich die baupolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Landtag von NRW, Özlem Alev Demirel, überrascht:
"Eine Landesregierung, die sich von einem Bauunternehmen über den Tisch ziehen lässt und bereit ist Fantasiepreise für ein Grundstück zu zahlen ist schon sehr kurios. Ein Oberbürgermeister, der möglicherweise Geheimnisverrat beging, indem er jenes Bauunternehmen informierte, dass das Land bald ein bestimmtes Grundstück kaufen will, ist noch merkwürdiger. Und ein Staatssekretär, der lustig immer teurere Wolkenkuckucksheime bauen will, obwohl eigentlich nur ein Zweckbau geplant war. Das sind viele Fehlverhalten auf einmal. Ob an diesen Vorwürfen, die der Presse zu entnehmen sind, tatsächlich etwas dran ist, das möchten wir bitteschön ganz genau wissen."
Aus diesem Grund hat die Linksfraktion eine Aktuelle Stunde im Landtag von NRW am Freitag, 3.12.2010 beantragt.
Demirel weiter: "An dieser Stelle kann die neue Landesregierung mal zeigen, ob sie wirklich so sauber mit ihren Vorgängern abrechnet. Wir fordern Ministerpräsidentin Kraft und die Landesregierung auf die Vorwürfe aufzuklären." ..."
Quelle: Pressemitteilung der Landtagsfraktion der "linken" v. 30.11.2010
s. a. rp-online.de, 30.11.2010
Wolf Thomas - am Dienstag, 30. November 2010, 12:21 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 23:24 - Rubrik: Archivrecht
http://blog.fefe.de/?ts=b20d29ba
Via http://www.kanzleikompa.de/2010/11/29/der-grose-leak/
Zu Wikileaks hier
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks
Weil Advent ist, bin ich bereit, eine neue Kategorie Informationsfreiheit (bisher unter Datenschutz) oder so zu spendieren. Es geht um (Verwaltungs)Transparenz und so. Nein, ich werde sie nicht Vier Prinzen nennen ... oder Vom Hofiana. Andere Vorschläge gern.
Via http://www.kanzleikompa.de/2010/11/29/der-grose-leak/
Zu Wikileaks hier
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks
Weil Advent ist, bin ich bereit, eine neue Kategorie Informationsfreiheit (bisher unter Datenschutz) oder so zu spendieren. Es geht um (Verwaltungs)Transparenz und so. Nein, ich werde sie nicht Vier Prinzen nennen ... oder Vom Hofiana. Andere Vorschläge gern.
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 23:12 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie schon 2008 wird es dieses Jahr wieder einen Archivalia-Adventskalender geben. Die geschätzten Damen und Herren Contributoren werden gebeten, Vorschläge bei mir per Mail einzureichen, falls sie eine nette Idee dazu haben.
Zur Einstimmung etwas Besinnliches.
Zur Einstimmung etwas Besinnliches.
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 22:29 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Visualisierte Kommunikation im Mittelalter - Legitimation und Repräsentation. Hrsg. von Steffen Arndt und Andrea Hedwig (Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg 23). Marburg 2010. 150 S. mit zahlreichen farbigen Abbildungen. 28 Euro.
Hinter dem etwas zu breit geratenen Titel verbirgt sich ein etwas zu teuer geratener Sammelband, der sich vor allem mittelalterlichen Archivalien widmet, die mit Bildern illustriert wurden. Er dokumentiert eine Marburger Tagung vom 20. November 2009, die an die Ausstellung "Schätze des Staatsarchiv Marburg" anknüpfte. Eine virtuelle Ausstellung unter diesem Titel ist online:
http://pdf.digam.net/?str=224
Theo Kölzer verbindet in seinem Beitrag "Farbiges Mittelalter?" die Frage nach Realität und Klischees des Mittelalters mit Beobachtungen zum Gebrauch von Farben in der mittelalterlichen Kultur. Dass das Mittelalter nur für eine dünne Elite farbig gewesen sei, wie Kölzer meint, ist sicher übertrieben. Wo bleibt das Performative? Vermutlich wird die Dokumentation der Bamberger Mediävistenverband-Tagung http://farbiges-mittelalter.de/sektionen.html zu einem anderen Ergebnis gelangen als der Urkundenforscher.
"Kommunikation als Instrument der Macht in der Geschichte" lautet der Titel des Aufsatzes von Steffen Arndt, der einige Beispiele für illuminierte Archivalien und Bücher vorstellt. Eine hinreichende theoretische Fundierung ist freilich nicht auszumachen.
Der "gewaltige Bilderschatz" (S. 64) des im 12. Jahrhundert von dem Fuldaer Mönch Eberhard geschaffenen Codex Eberhardi hat es Heinrich Meyer zu Ermgassen angetan. Er widmet sich aber auch der Wahrnehmung mittelalterlicher Farbigkeit anhand Marburger Beispiele. Es wäre schön, wenn man wenigstens eine Auswahl der Bilder in guter Qualität auch online zu sehen bekäme.
Der nächste Beitrag bleibt in Fulda. Albert Kopp behandelt die Visualisierung der Ungültigmachung spätmittelalterlicher Privaturkunden am Beispiel des Stiftsarchiv Fulda, ein höchst selten erforschtes Thema. Es geht ihm aber weniger um die Visualisierung (Durchstreichen, Siegelentfernung usw.) als um das Phänomen an sich.
Die bildlichen Darstellungen von Herrschern in den Chroniken des hessischen Landeschronisten Wigand Gerstenberg (um 1500) hat sich Steffen Krieb vorgenommen.
Die letzten drei Beiträge gelten illuminierten Urkunden. Alexander Seibold sieht vorreformatorische Ablassurkunden als "frühe Plakate". Auch wenn er 2001 ein Buch Sammelindulgenzen geschrieben hat, wäre es angemessen gewesen, den bahnbrechenden Aufsatz von Hartmut Boockmann zu zitieren: Über Ablaß-“Medien“, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 34 (1983), S. 709–721.
Ergänzend sei auf die schönen Digitalisate des Landesarchivs Baden-Württemberg von Ablassurkunden (im Selekt H 52 bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart) hingewiesen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147
Mit 123 Fußnoten etwas aus dem Rahmen fällt der sehr spezielle Beitrag von Otfried Krafft: Illuminierte Unionsbullen. Burgund, das Konzil von Florenz und die Urkunden Letentur celi und Cantate domini von 1439 und 1442. Die für den Burgunderherzog bestimmten Prunkurkunden des Papstes stellten eine besondere Auszeichnung dar.
Für Hans K. Schulze ist die von ihm vorgestellte Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu vom 14. April 972 die "schönste Urkunde des europäischen Mittelalters" (S. 137).
Seit vielen Jahren frage ich mich, aus welchen Gründen bestimmte Archivalien (insbesondere Geschäftsbücher) illuminiert sind und andere nicht. Eine zusammenfassende Darstellung dazu ist mir nicht bekannt. Nicht nur, dass die in dem vorliegenden Band versammelten Studien eher beliebig zusammengestellt erscheinen - sie lassen meist auch methodische Reflexion und Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungsansätzen (z.B. zahlreichen Studien Boockmanns zu Bild-Medien) vermissen.
 Widmungsbild des Codex Eberhardi
Widmungsbild des Codex Eberhardi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Codex_Eberhardi
Hinter dem etwas zu breit geratenen Titel verbirgt sich ein etwas zu teuer geratener Sammelband, der sich vor allem mittelalterlichen Archivalien widmet, die mit Bildern illustriert wurden. Er dokumentiert eine Marburger Tagung vom 20. November 2009, die an die Ausstellung "Schätze des Staatsarchiv Marburg" anknüpfte. Eine virtuelle Ausstellung unter diesem Titel ist online:
http://pdf.digam.net/?str=224
Theo Kölzer verbindet in seinem Beitrag "Farbiges Mittelalter?" die Frage nach Realität und Klischees des Mittelalters mit Beobachtungen zum Gebrauch von Farben in der mittelalterlichen Kultur. Dass das Mittelalter nur für eine dünne Elite farbig gewesen sei, wie Kölzer meint, ist sicher übertrieben. Wo bleibt das Performative? Vermutlich wird die Dokumentation der Bamberger Mediävistenverband-Tagung http://farbiges-mittelalter.de/sektionen.html zu einem anderen Ergebnis gelangen als der Urkundenforscher.
"Kommunikation als Instrument der Macht in der Geschichte" lautet der Titel des Aufsatzes von Steffen Arndt, der einige Beispiele für illuminierte Archivalien und Bücher vorstellt. Eine hinreichende theoretische Fundierung ist freilich nicht auszumachen.
Der "gewaltige Bilderschatz" (S. 64) des im 12. Jahrhundert von dem Fuldaer Mönch Eberhard geschaffenen Codex Eberhardi hat es Heinrich Meyer zu Ermgassen angetan. Er widmet sich aber auch der Wahrnehmung mittelalterlicher Farbigkeit anhand Marburger Beispiele. Es wäre schön, wenn man wenigstens eine Auswahl der Bilder in guter Qualität auch online zu sehen bekäme.
Der nächste Beitrag bleibt in Fulda. Albert Kopp behandelt die Visualisierung der Ungültigmachung spätmittelalterlicher Privaturkunden am Beispiel des Stiftsarchiv Fulda, ein höchst selten erforschtes Thema. Es geht ihm aber weniger um die Visualisierung (Durchstreichen, Siegelentfernung usw.) als um das Phänomen an sich.
Die bildlichen Darstellungen von Herrschern in den Chroniken des hessischen Landeschronisten Wigand Gerstenberg (um 1500) hat sich Steffen Krieb vorgenommen.
Die letzten drei Beiträge gelten illuminierten Urkunden. Alexander Seibold sieht vorreformatorische Ablassurkunden als "frühe Plakate". Auch wenn er 2001 ein Buch Sammelindulgenzen geschrieben hat, wäre es angemessen gewesen, den bahnbrechenden Aufsatz von Hartmut Boockmann zu zitieren: Über Ablaß-“Medien“, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 34 (1983), S. 709–721.
Ergänzend sei auf die schönen Digitalisate des Landesarchivs Baden-Württemberg von Ablassurkunden (im Selekt H 52 bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart) hingewiesen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147
Mit 123 Fußnoten etwas aus dem Rahmen fällt der sehr spezielle Beitrag von Otfried Krafft: Illuminierte Unionsbullen. Burgund, das Konzil von Florenz und die Urkunden Letentur celi und Cantate domini von 1439 und 1442. Die für den Burgunderherzog bestimmten Prunkurkunden des Papstes stellten eine besondere Auszeichnung dar.
Für Hans K. Schulze ist die von ihm vorgestellte Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu vom 14. April 972 die "schönste Urkunde des europäischen Mittelalters" (S. 137).
Seit vielen Jahren frage ich mich, aus welchen Gründen bestimmte Archivalien (insbesondere Geschäftsbücher) illuminiert sind und andere nicht. Eine zusammenfassende Darstellung dazu ist mir nicht bekannt. Nicht nur, dass die in dem vorliegenden Band versammelten Studien eher beliebig zusammengestellt erscheinen - sie lassen meist auch methodische Reflexion und Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungsansätzen (z.B. zahlreichen Studien Boockmanns zu Bild-Medien) vermissen.
 Widmungsbild des Codex Eberhardi
Widmungsbild des Codex Eberhardihttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Codex_Eberhardi
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 20:56 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2010/11/27/bin-jetzt-bei-panoramio/
Man hätte das ja mal besprechen können. So wie die Eigentümer ja auch darüber sprechen, ob das Treppenhaus saniert oder das Dach erneuert wird. Alles Aktionen der letzten Jahre. Bei denen saßen wir auch mit der Verwaltung an einem Tisch. Es gab durchaus Meinungsverschiedenheiten (und Abstimmungen). Aber nichts hat dazu geführt, dass man sich bei einer Begegnung im Treppenhaus nicht mehr grüßt…
Wie das heute so ist, kenne ich meine Nachbarn nicht näher. Jedoch würde ich von keinem annehmen, dass er so bräsig ist, vor dem Absenden des Widerspruchs nicht mal einen Gedanken daran zu verschwenden, was wohl seine Nachbarn von der Aktion halten. Statt aber kurz Bescheid zu sagen und sich vielleicht sogar einer Diskussion zu stellen, werden vollendete Tatsachen geschaffen. Aus dem Hinterhalt. Und anonym. Das ist zwar formal nicht zu beanstanden. Aber trotzdem feige.
Das verstimmt mich nicht nur diffus, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Mir gehört nicht nur eine Wohnung in dem Haus. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Vermietungschancen durch die Verpixelung des Objekts sinken. Weil Mietinteressenten natürlich Street View nutzen, wenn sie nach Düsseldorf ziehen wollen. Aber auch weil die vermummte Fassade jedenfalls für mich als Wohnungssuchenden ein Warnsignal wäre: Vorsicht, da leben empfindliche Gestalten; Ärger programmiert?
Im Augenblick: 346 Kommentare
 Das ist das Haus, in dem dem Düsseldorfer Rechtsanwalt mehr als eine Wohnung gehört.
Das ist das Haus, in dem dem Düsseldorfer Rechtsanwalt mehr als eine Wohnung gehört.
Man hätte das ja mal besprechen können. So wie die Eigentümer ja auch darüber sprechen, ob das Treppenhaus saniert oder das Dach erneuert wird. Alles Aktionen der letzten Jahre. Bei denen saßen wir auch mit der Verwaltung an einem Tisch. Es gab durchaus Meinungsverschiedenheiten (und Abstimmungen). Aber nichts hat dazu geführt, dass man sich bei einer Begegnung im Treppenhaus nicht mehr grüßt…
Wie das heute so ist, kenne ich meine Nachbarn nicht näher. Jedoch würde ich von keinem annehmen, dass er so bräsig ist, vor dem Absenden des Widerspruchs nicht mal einen Gedanken daran zu verschwenden, was wohl seine Nachbarn von der Aktion halten. Statt aber kurz Bescheid zu sagen und sich vielleicht sogar einer Diskussion zu stellen, werden vollendete Tatsachen geschaffen. Aus dem Hinterhalt. Und anonym. Das ist zwar formal nicht zu beanstanden. Aber trotzdem feige.
Das verstimmt mich nicht nur diffus, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Mir gehört nicht nur eine Wohnung in dem Haus. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Vermietungschancen durch die Verpixelung des Objekts sinken. Weil Mietinteressenten natürlich Street View nutzen, wenn sie nach Düsseldorf ziehen wollen. Aber auch weil die vermummte Fassade jedenfalls für mich als Wohnungssuchenden ein Warnsignal wäre: Vorsicht, da leben empfindliche Gestalten; Ärger programmiert?
Im Augenblick: 346 Kommentare
 Das ist das Haus, in dem dem Düsseldorfer Rechtsanwalt mehr als eine Wohnung gehört.
Das ist das Haus, in dem dem Düsseldorfer Rechtsanwalt mehr als eine Wohnung gehört.KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 18:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Telemedicus findet es ganz in Ordnung, dass die Einbindung fremder RSS-Feeds als Urheberrechtsverletzung verfolgt werden kann. Ich nicht.
http://www.telemedicus.info/article/1902-AG-Hamburg-zu-Urheberrechtsverletzungen-durch-RSS-Feeds.html
Update: http://archiv.twoday.net/stories/14634058/
http://www.telemedicus.info/article/1902-AG-Hamburg-zu-Urheberrechtsverletzungen-durch-RSS-Feeds.html
Update: http://archiv.twoday.net/stories/14634058/
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 18:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 17:50 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aachener Weihnachtsmarkt jault auf: GEMA-Kosten sind explodiert. Aber Veranstalter und GEMA sind auf einem guten Wege, damit es bald wieder dudelt.
http://www.kanzlei-hoenig.info/gema-sorgt-fuer-stille-nacht
http://www.gulli.com/news/danke-gema-weihnachtsmarkt-ohne-weihnachtsmusik-2010-11-25
http://www.an-online.de/lokales/aachen-detail-an/1472855?_link=&skip=&_g=Weihnachtsmarkt-Bald-wird-die-Musik-wieder-aufgedreht.html
Zum Thema GEMA
http://archiv.twoday.net/stories/8461038/
http://archiv.twoday.net/stories/8442381/
http://archiv.twoday.net/stories/8400222/
Update:
Passend dazu eine Meldung aus dem rheinischen Monheim, wo eine gierige Autorin einen Martinsumzug abmahnen lässt. Recht so, werft diese Deppen, die einfach geschützte Werke benutzen, alle in den Knast! (Wer Ironie findet, darf sie behalten.)
http://www.derwesten.de/staedte/kreis-mettmann/Martins-Umzug-in-Monheim-hat-teures-Nachspiel-id3987473.html
Wegen einer Urheberrechtsverletzung auf seiner Internetseite muss das St. Martin Komitee Monheim fast 500 Euro Schadensersatz und Anwaltskosten zahlen. Dies schrieben dem überraschten Vorsitzenden Holger Höhn die Anwälte der Autorin Elke Bräunling. Deren geschützten Text „Ein bisschen so wie Martin“ hatte das Komitee ohne vorherige Absprache auf seiner Internetseite veröffentlicht, dabei fehlte auch der Verweis auf die Urheberin.
Was war genau geschehen? Das Komitee organisierte Mitte November wie in den Jahren zuvor den zentralen St.Martins-Umzug in Monheim, zu dem 3500 Kindern – 32 Schulklassen und elf Kindergartengruppen -- strömten. „Wir haben dazu ein Programmheft erstellt, in dem Treffpunkte, Uhrzeiten und auch Liedtexte aufgeführt waren“, erklärt Höhn. Das Programmheft wurde zwar nicht gedruckt, war aber auf der Internetseite herunterladbar.
„Zeichen einer kranken Entwicklung“
„Wir hatten uns zuvor bei den Einrichtungen erkundigt, welche Lieder von den Kindern gern gesungen werden“, berichtet Höhn. Dass die Veröffentlichung des Bräunling-Textes einen Lizenzierungsvertrag mit der Rechteverwertungsgesellschaft Gema bedurft hätte, wusste offenbar niemand. Bei Texten, deren Urheber seit mehr als 70 Jahren Tod sind, erlischt das Urheberrecht. Bei der im Leben weilenden Autorin Elke Bräunling verhält es sich jedoch anders.
Für Höhn ist der Sachverhalt Zeichen einer „kranken Entwicklung“: „Ich finde es schade, dass manche Lieder nur ‘aus dem Kopf’ gesungen werden dürfen wie in einer Minnesänger-Gesellschaft.“ Dennoch hat sich das Komitee gefügt, einen Unterlassungsvertrag unterzeichnet, den Text von der Seite entfernt. Auch die 500 Euro wurden bereits überwiesen.
So geraten aber die Komitee-Finanzen in Schieflage. Zwar ist der St.Martins-Umzug 2011 nicht in Gefahr, wohl aber die Wiederauflage des Malwettbewerbs, der für 2010 am Samstag zu Ende geht. Das Komitee muss Spenden nun sammeln.Informationen unter: www.smkm.de
Und zur Erinnerung für Frau Bräunling die ersten drei Zeilen des Textes:
Ein bisschen so wie Martin möchte´ ich manchmal sein,
und ich will an andre denken,
etwas geben, etwas schenken.
http://elkeskindergeschichten.blog.de/2008/11/06/bisschen-martin-6896410/
#gema
http://www.kanzlei-hoenig.info/gema-sorgt-fuer-stille-nacht
http://www.gulli.com/news/danke-gema-weihnachtsmarkt-ohne-weihnachtsmusik-2010-11-25
http://www.an-online.de/lokales/aachen-detail-an/1472855?_link=&skip=&_g=Weihnachtsmarkt-Bald-wird-die-Musik-wieder-aufgedreht.html
Zum Thema GEMA
http://archiv.twoday.net/stories/8461038/
http://archiv.twoday.net/stories/8442381/
http://archiv.twoday.net/stories/8400222/
Update:
Passend dazu eine Meldung aus dem rheinischen Monheim, wo eine gierige Autorin einen Martinsumzug abmahnen lässt. Recht so, werft diese Deppen, die einfach geschützte Werke benutzen, alle in den Knast! (Wer Ironie findet, darf sie behalten.)
http://www.derwesten.de/staedte/kreis-mettmann/Martins-Umzug-in-Monheim-hat-teures-Nachspiel-id3987473.html
Wegen einer Urheberrechtsverletzung auf seiner Internetseite muss das St. Martin Komitee Monheim fast 500 Euro Schadensersatz und Anwaltskosten zahlen. Dies schrieben dem überraschten Vorsitzenden Holger Höhn die Anwälte der Autorin Elke Bräunling. Deren geschützten Text „Ein bisschen so wie Martin“ hatte das Komitee ohne vorherige Absprache auf seiner Internetseite veröffentlicht, dabei fehlte auch der Verweis auf die Urheberin.
Was war genau geschehen? Das Komitee organisierte Mitte November wie in den Jahren zuvor den zentralen St.Martins-Umzug in Monheim, zu dem 3500 Kindern – 32 Schulklassen und elf Kindergartengruppen -- strömten. „Wir haben dazu ein Programmheft erstellt, in dem Treffpunkte, Uhrzeiten und auch Liedtexte aufgeführt waren“, erklärt Höhn. Das Programmheft wurde zwar nicht gedruckt, war aber auf der Internetseite herunterladbar.
„Zeichen einer kranken Entwicklung“
„Wir hatten uns zuvor bei den Einrichtungen erkundigt, welche Lieder von den Kindern gern gesungen werden“, berichtet Höhn. Dass die Veröffentlichung des Bräunling-Textes einen Lizenzierungsvertrag mit der Rechteverwertungsgesellschaft Gema bedurft hätte, wusste offenbar niemand. Bei Texten, deren Urheber seit mehr als 70 Jahren Tod sind, erlischt das Urheberrecht. Bei der im Leben weilenden Autorin Elke Bräunling verhält es sich jedoch anders.
Für Höhn ist der Sachverhalt Zeichen einer „kranken Entwicklung“: „Ich finde es schade, dass manche Lieder nur ‘aus dem Kopf’ gesungen werden dürfen wie in einer Minnesänger-Gesellschaft.“ Dennoch hat sich das Komitee gefügt, einen Unterlassungsvertrag unterzeichnet, den Text von der Seite entfernt. Auch die 500 Euro wurden bereits überwiesen.
So geraten aber die Komitee-Finanzen in Schieflage. Zwar ist der St.Martins-Umzug 2011 nicht in Gefahr, wohl aber die Wiederauflage des Malwettbewerbs, der für 2010 am Samstag zu Ende geht. Das Komitee muss Spenden nun sammeln.Informationen unter: www.smkm.de
Und zur Erinnerung für Frau Bräunling die ersten drei Zeilen des Textes:
Ein bisschen so wie Martin möchte´ ich manchmal sein,
und ich will an andre denken,
etwas geben, etwas schenken.
http://elkeskindergeschichten.blog.de/2008/11/06/bisschen-martin-6896410/
#gema
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 17:11 - Rubrik: Archivrecht
http://www.africaportal.org/
"A key feature to the Africa Portal is the online library collection holding over 2,500 books, journals, and digital documents related to African policy issues. The entire online repository is open access and available for free full-text download. A portion of the digital documents housed in the library have been digitized for the first time as an undertaking of the Africa Portal project. "
"A key feature to the Africa Portal is the online library collection holding over 2,500 books, journals, and digital documents related to African policy issues. The entire online repository is open access and available for free full-text download. A portion of the digital documents housed in the library have been digitized for the first time as an undertaking of the Africa Portal project. "
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 16:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In der Affäre um das NRW-Landesarchiv haben Korruptionsermittler am Montag dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) in Düsseldorf einen Besuch abgestattet. «Wir prüfen verschiedene BLB-Projekte und holen dazu die Unterlagen ab», sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal der Nachrichtenagentur dpa. Mehrere Polizisten und die ermittelnde Staatsanwältin waren dazu ausgerückt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Landesarchiv auf weitere Bauprojekte des BLB ausgeweitet."
Quelle: Bild.de, Regional Ruhrgebiet, 29.11.2010
Quelle: Bild.de, Regional Ruhrgebiet, 29.11.2010
Wolf Thomas - am Montag, 29. November 2010, 16:15 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu: http://archiv.twoday.net/stories/8448228/
Umfragestart:
18.11.2010 20:02 Uhr
Ich lese Archivalia via RSS-Feed 24 32,43%
(Alle folgenden: Nicht Richt-RSS'ler) Mindestens einmal täglich 17 22,97%
Alle 2-6 Tage 23 31,08%
Etwa einmal wöchentlich 6 8,11%
Noch seltener 4 5,41%
Summe 74 100.00% letzte Stimme: 22.11.2010 16:22 Uhr
* Nur ein Drittel der Leser liest Archivalia via RSS.
* Etwa die Hälfte der Leser liest Archivalia täglich (wenn man voraussetzt, dass die RSS-Leser täglich den Feed lesen).
* Eine vergleichsweise kleine Gruppe (ca. 14 Prozent) liest Archivalia seltener als alle paar Tage.
Umfragestart:
18.11.2010 20:02 Uhr
Ich lese Archivalia via RSS-Feed 24 32,43%
(Alle folgenden: Nicht Richt-RSS'ler) Mindestens einmal täglich 17 22,97%
Alle 2-6 Tage 23 31,08%
Etwa einmal wöchentlich 6 8,11%
Noch seltener 4 5,41%
Summe 74 100.00% letzte Stimme: 22.11.2010 16:22 Uhr
* Nur ein Drittel der Leser liest Archivalia via RSS.
* Etwa die Hälfte der Leser liest Archivalia täglich (wenn man voraussetzt, dass die RSS-Leser täglich den Feed lesen).
* Eine vergleichsweise kleine Gruppe (ca. 14 Prozent) liest Archivalia seltener als alle paar Tage.
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 16:14 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/801513/#11422258
2005 war der erste Band von Stumpfs Reichskanzlern in Vorbereitung, nun liegt er schon vor!
2005 war der erste Band von Stumpfs Reichskanzlern in Vorbereitung, nun liegt er schon vor!
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 14:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Stadt Olpe feiert im Jahr 2011 ihr 700-jähriges
Stadtjubiläum. Am 26. April 1311 verlieh der damalige Kölner
Erzbischof Heinrich II., Graf von Virneburg, dem Dorf Olpe die
Stadtrechte. Zu diesem Jubiläum gibt die Stadt Olpe eine
mehrbändige Stadtgeschichte heraus.
Als Beiheft zu dieser wissenschaftlichen Darstellung der
Geschichte der Stadt Olpe erscheint jetzt eine kurzgefasste
Stadtgeschichte für Kinder unter dem Titel "Olpe - unsere
Stadt. Geschichte und Geschichten für junge Forscher und
Entdecker".
Diese besteht aus einem so genannten "Stadtporträt", in dem auf
48 Seiten die Geschichte der Kreisstadt Olpe seit der Gründung
von Hof, Kirche und Dorf Olpe im 9. Jahrhundert über die
Stadterhebung 1311 bis ins Jubiläumsjahr 2011 kindgerecht
beschrieben und mit zahlreichen Zeichnungen und Fotos
illustriert wird. Daneben gibt es eine so genannte
"Forschermappe" mit 26 Arbeitsblättern, die Rechen- und
Rechtschreibaufgaben, Malarbeiten, Namenergänzungen,
Begriffszuordnungen, Rätsel, Fragespiele, Bastelanleitungen und
vieles mehr zum Inhalt haben.
"Olpe - unsere Stadt" richtet sich aber nicht nur an Kinder,
sondern auch an ihre Eltern und Lehrer und jeden, der sich für
die Stadt Olpe interessiert.
Bearbeitet wurde die Stadtgeschichte für Kinder durch eine vom
Stadtarchiv Olpe geleitete Projektgruppe, in der neben der
Autorin Gretel Kemper und der Graphikerin Jutta
Berger-Grünewald auch vier Pädagogen (Joachim Behme, Johannes
Haarmann, Christina Horn, Matthias Schrage) unterschiedlicher
Olper Schulformen mitwirkten.
INFO
Olpe - unsere Stadt.
Geschichte und Geschichten für junge Forscher und Entdecker.
Stadtporträt und Forschermappe für den Sachunterricht.
Texte: Gretel Kemper -
und Joachim Behme, Johannes Haarmann, Christina Horn,
Matthias Schrage und Josef Wermert.
Graphische Gestaltung und Illustrationen: Jutta Berger-Grünewald.
Red.: Günther Becker und Josef Wermert.
Olpe: Selbstverlag der Kreisstadt Olpe 2011.
(=Olpe. Geschichte von Stadt und Land. Beiheft 1).
Stadtporträt 48 S., Forschermappen 26 Arbeitsblätter.
ISBN 3-9808598-3-5
Verkaufspreis:
12,- Euro (einzeln: Stadtporträt 10,- Euro, Forschermappe 3,- Euro)
via Mailingliste Westfälische Geschichte
Stadtjubiläum. Am 26. April 1311 verlieh der damalige Kölner
Erzbischof Heinrich II., Graf von Virneburg, dem Dorf Olpe die
Stadtrechte. Zu diesem Jubiläum gibt die Stadt Olpe eine
mehrbändige Stadtgeschichte heraus.
Als Beiheft zu dieser wissenschaftlichen Darstellung der
Geschichte der Stadt Olpe erscheint jetzt eine kurzgefasste
Stadtgeschichte für Kinder unter dem Titel "Olpe - unsere
Stadt. Geschichte und Geschichten für junge Forscher und
Entdecker".
Diese besteht aus einem so genannten "Stadtporträt", in dem auf
48 Seiten die Geschichte der Kreisstadt Olpe seit der Gründung
von Hof, Kirche und Dorf Olpe im 9. Jahrhundert über die
Stadterhebung 1311 bis ins Jubiläumsjahr 2011 kindgerecht
beschrieben und mit zahlreichen Zeichnungen und Fotos
illustriert wird. Daneben gibt es eine so genannte
"Forschermappe" mit 26 Arbeitsblättern, die Rechen- und
Rechtschreibaufgaben, Malarbeiten, Namenergänzungen,
Begriffszuordnungen, Rätsel, Fragespiele, Bastelanleitungen und
vieles mehr zum Inhalt haben.
"Olpe - unsere Stadt" richtet sich aber nicht nur an Kinder,
sondern auch an ihre Eltern und Lehrer und jeden, der sich für
die Stadt Olpe interessiert.
Bearbeitet wurde die Stadtgeschichte für Kinder durch eine vom
Stadtarchiv Olpe geleitete Projektgruppe, in der neben der
Autorin Gretel Kemper und der Graphikerin Jutta
Berger-Grünewald auch vier Pädagogen (Joachim Behme, Johannes
Haarmann, Christina Horn, Matthias Schrage) unterschiedlicher
Olper Schulformen mitwirkten.
INFO
Olpe - unsere Stadt.
Geschichte und Geschichten für junge Forscher und Entdecker.
Stadtporträt und Forschermappe für den Sachunterricht.
Texte: Gretel Kemper -
und Joachim Behme, Johannes Haarmann, Christina Horn,
Matthias Schrage und Josef Wermert.
Graphische Gestaltung und Illustrationen: Jutta Berger-Grünewald.
Red.: Günther Becker und Josef Wermert.
Olpe: Selbstverlag der Kreisstadt Olpe 2011.
(=Olpe. Geschichte von Stadt und Land. Beiheft 1).
Stadtporträt 48 S., Forschermappen 26 Arbeitsblätter.
ISBN 3-9808598-3-5
Verkaufspreis:
12,- Euro (einzeln: Stadtporträt 10,- Euro, Forschermappe 3,- Euro)
via Mailingliste Westfälische Geschichte
Wolf Thomas - am Montag, 29. November 2010, 12:16 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/11/28/antwort-an-bodo-ramelow/
Zumindest was den Bereich der schreibenden Zunft angeht, verdient im bisherigen System (ganz ohne das böse Internet) der Autor — von einigen Bestseller-Produzenten wie Dan Brown einmal abgesehen — gar nichts oder so wenig, daß er auf gar keinen Fall davon leben kann.
Das heißt einmal: Das derzeitige Gejammere darüber, daß das Internet den Autoren (aber auch anderen Künstlern) die Möglichkeit des Broterwerbs nehmen würde, ist verlogen und nur von den Vertretern der Medienindustrie angezettelt, um ihre Pfründe zu schützen. Sie ist so verlogen, daß es sich eigentlich gar nicht lohnt, darauf einzugehen.
Und das heißt zum Zweiten: Das World Wide Web bietet die Chance für Autoren und auch andere kulturell tätige Menschen, wieder wahrgenommen und gelesen zu werden und mehr Geld einzunehmen, als ohne das Internet. Und das, ohne das überhaupt irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden müssten. Wenn überhaupt, dann höchstens die, daß das Urheberrecht zugunsten der Urheber und zu ungunsten der Verlage und anderer Vertreter der Medienindustrie umgeschrieben wird.
Zumindest was den Bereich der schreibenden Zunft angeht, verdient im bisherigen System (ganz ohne das böse Internet) der Autor — von einigen Bestseller-Produzenten wie Dan Brown einmal abgesehen — gar nichts oder so wenig, daß er auf gar keinen Fall davon leben kann.
Das heißt einmal: Das derzeitige Gejammere darüber, daß das Internet den Autoren (aber auch anderen Künstlern) die Möglichkeit des Broterwerbs nehmen würde, ist verlogen und nur von den Vertretern der Medienindustrie angezettelt, um ihre Pfründe zu schützen. Sie ist so verlogen, daß es sich eigentlich gar nicht lohnt, darauf einzugehen.
Und das heißt zum Zweiten: Das World Wide Web bietet die Chance für Autoren und auch andere kulturell tätige Menschen, wieder wahrgenommen und gelesen zu werden und mehr Geld einzunehmen, als ohne das Internet. Und das, ohne das überhaupt irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden müssten. Wenn überhaupt, dann höchstens die, daß das Urheberrecht zugunsten der Urheber und zu ungunsten der Verlage und anderer Vertreter der Medienindustrie umgeschrieben wird.
KlausGraf - am Montag, 29. November 2010, 01:16 - Rubrik: Open Access

