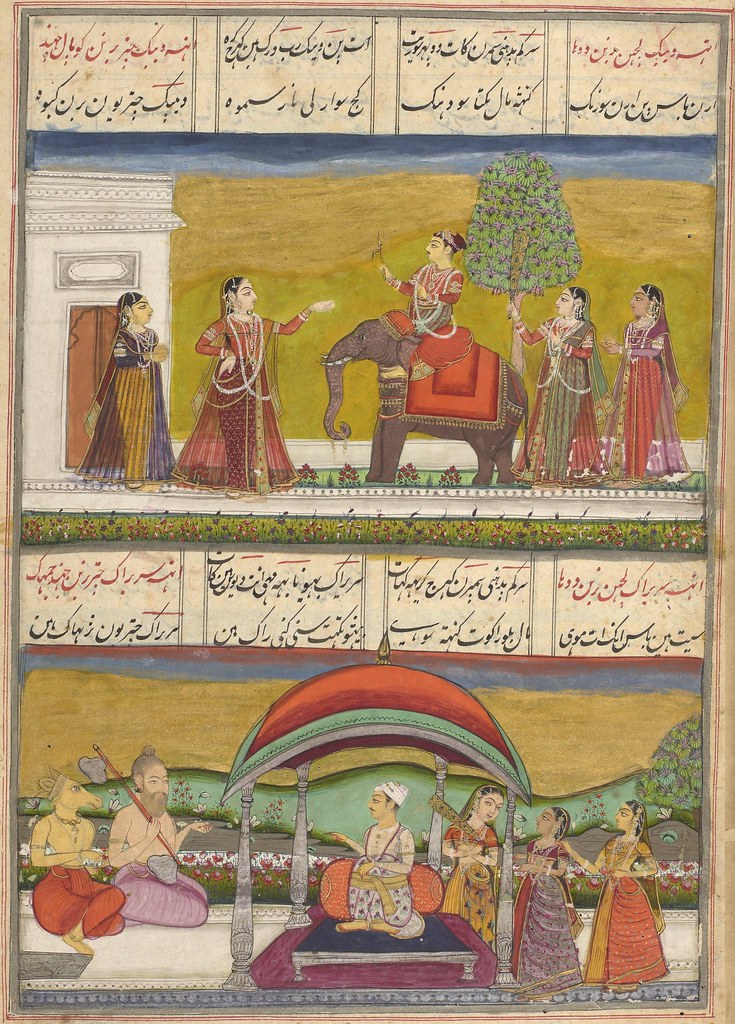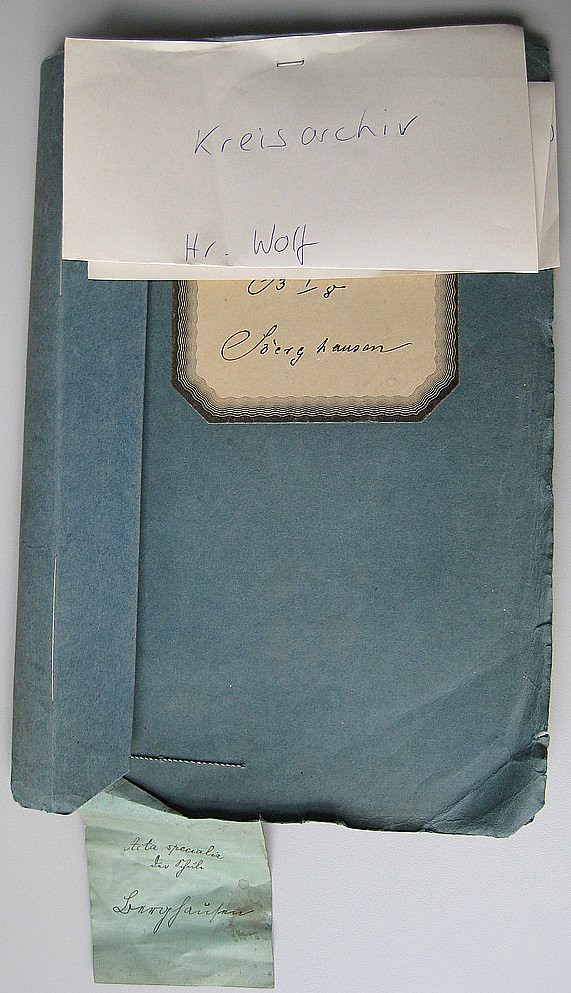Meint
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734178,00.html
Das ist der Grund, warum viele Medien ein ambivalentes Verhältnis zum Thema WikiLeaks haben: Man erkennt an, dass sich WikiLeaks in vielerlei Hinsicht verantwortungslos gezeigt hat, aber auch, dass die Aktivitäten von WikiLeaks viele Medienschaffende an ihre Aufgaben erinnert haben - und nicht selten selbst Informationen von höchster Relevanz öffentlich machten. Denn die Website kann echte Verdienste für sich verbuchen:
2007 veröffentlichte sie die "Standard Operating Procedures for Camp Delta" zum Umgang mit Gefangenen im US-Lager Guantanamo - und machte bedenkliche Praktiken öffentlich, die teils deutlich dem Völkerrecht und der Genfer Konvention widersprachen;
Scientology: 2008 veröffentlichte WikiLeaks die kruden internen Glaubensdokumente der Sci-Fi-Sekte und munitionierte damit deren Gegner;
British National Party: 2008 dokumentierte WikiLeaks die Mitgliederliste der faschistischen britischen National Party und zeigte unter anderem die Durchdringung der Polizei mit BNP-Mitgliedern - illegal in Großbritannien;
Palins E-Mails: Im US-Wahlkampf 2008 hackte die Anonymous-Gruppierung den privaten E-Mail-Account der republikanischen Vize-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin - und zeigte, dass die ihren Privat-Account für Dienstgeschäfte nutzte, um die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten für Amtsträger zu umgehen. Der Veröffentlichungskanal: WikiLeaks;
Der Minton-Report: 2009 veröffentlichte WikiLeaks eine interne Studie des Rohstoffhandelsunternehmens Trafigura über die schädlichen Gesundheitsauswirkungen seiner Müllentsorgung in Afrika (17 Tote, ca. 100.000 Behandlungsbedürftige). Trafigura hatte die britische Zeitung "The Guardian" mit juristischen Mitteln erfolgreich an der Publizierung gehindert, WikiLeaks war dagegen nicht zu stoppen;
Climate-Gate: WikiLeaks veröffentlichte die E-Mail-Korrespondenz führender Klimaforscher, der man entnehmen konnte, dass keine Seite in diesem Meinungsstreit über die globale Erwärmung mit ganz astreinen Methoden arbeitete.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734178,00.html
Das ist der Grund, warum viele Medien ein ambivalentes Verhältnis zum Thema WikiLeaks haben: Man erkennt an, dass sich WikiLeaks in vielerlei Hinsicht verantwortungslos gezeigt hat, aber auch, dass die Aktivitäten von WikiLeaks viele Medienschaffende an ihre Aufgaben erinnert haben - und nicht selten selbst Informationen von höchster Relevanz öffentlich machten. Denn die Website kann echte Verdienste für sich verbuchen:
2007 veröffentlichte sie die "Standard Operating Procedures for Camp Delta" zum Umgang mit Gefangenen im US-Lager Guantanamo - und machte bedenkliche Praktiken öffentlich, die teils deutlich dem Völkerrecht und der Genfer Konvention widersprachen;
Scientology: 2008 veröffentlichte WikiLeaks die kruden internen Glaubensdokumente der Sci-Fi-Sekte und munitionierte damit deren Gegner;
British National Party: 2008 dokumentierte WikiLeaks die Mitgliederliste der faschistischen britischen National Party und zeigte unter anderem die Durchdringung der Polizei mit BNP-Mitgliedern - illegal in Großbritannien;
Palins E-Mails: Im US-Wahlkampf 2008 hackte die Anonymous-Gruppierung den privaten E-Mail-Account der republikanischen Vize-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin - und zeigte, dass die ihren Privat-Account für Dienstgeschäfte nutzte, um die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten für Amtsträger zu umgehen. Der Veröffentlichungskanal: WikiLeaks;
Der Minton-Report: 2009 veröffentlichte WikiLeaks eine interne Studie des Rohstoffhandelsunternehmens Trafigura über die schädlichen Gesundheitsauswirkungen seiner Müllentsorgung in Afrika (17 Tote, ca. 100.000 Behandlungsbedürftige). Trafigura hatte die britische Zeitung "The Guardian" mit juristischen Mitteln erfolgreich an der Publizierung gehindert, WikiLeaks war dagegen nicht zu stoppen;
Climate-Gate: WikiLeaks veröffentlichte die E-Mail-Korrespondenz führender Klimaforscher, der man entnehmen konnte, dass keine Seite in diesem Meinungsstreit über die globale Erwärmung mit ganz astreinen Methoden arbeitete.
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 21:03 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Verein der Freunde und Förderer des Jan-von-Werth-Hauses in Köln, die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Büttgen sowie die Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Jan von Werth haben ein Zeichen bürgerschaftlichen Engagements für die beschädigten Dokumente des Historischen Archivs der Stadt Köln gesetzt. Sie taten sich zusammen, um den Archivbestand des Reitergenerals und Reichsfreiherrn mit Hilfe einer Sammelpatenschaft wieder herzustellen. Der Bestand mit der Nummer 1106 wurde en bloc geborgen und muss nun restauriert werden.
Für eine Person alleine wäre die benötigte Summe zu hoch. Daher hat die Familie von Hoensbroech sich in einem Schreiben an die Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Reichsfreiherrn gewandt und um Unterstützung gebeten. Viele rheinische Adelsfamilien gehören zur direkten oder mittelbaren Nachkommenschaft des berühmten Reitergenerals aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs.
Am heutigen 7. Dezember 2010 trafen sich zahlreiche der angeschriebenen Personen in der Kommende Ehreshoven. Sie erhielten vom stellvertretenden Leiter des Historischen Archivs, Dr. Ulrich Fischer, und der Diplom-Restauratorin Anke Blickwedel-Smith einen Einblick in den "Bestand von Werth", die Schäden und den Restaurierungsaufwand.
Lothar Graf von Hoensbroech, der zusammen mit seinem Neffen aus Köln unter den Nachfahrinnen, Nachfahren und Verwandten des Jan von Werth um Spenden gebeten hatte, erklärte:
Wir freuen uns sehr, dass wir bei dieser kulturellen Katastrophe gezielt und konkret einen Beitrag zur Wiederherstellung leisten können. Die Zugänglichkeit von Archiven und den darin befindlichen Dokumenten und Zeugnissen muss dringend gesichert werden, weil ihnen für das historische und kulturelle Verständnis von Geschichte und Identität eine überragende Bedeutung zukommt.
In Werths Geburtsort Büttgen pflegt die St. Sebastianus-Bruderschaft das alljährliche Gedenken, wie es der Reitergeneral in seinem Testament verfügt hat. Ludger Heintz, Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen führt zu den Beweggründen aus, die Restaurierung des Archivbestands zu unterstützen:
Wer die Heimat in die Zukunft führen und schützen will, muss die Vergangenheit bewahren.
An dem Spendenaufruf beteiligt sich auch der Verein der Freunde und Förderer des Jan-von-Werth-Hauses in Köln mit wohlwollender Unterstützung des Reiterkorps Jan von Werth. Der Erlös soll dazu dienen, aus der Restaurierungspatenschaft des Vereins für den Bestand 1106 (Jan von Werth) eine Sammelpatenschaft zu machen, um so die benötigte Summe schneller aufbringen zu können."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln, 7.12.2010
Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 20:06 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christiane Schulzki-Haddouti begründet diese schlüssig:
http://blog.kooptech.de/2010/12/presserat-beschwerde-in-der-sache-wikileaks/
Wikileaks hat übrigens nichts mit einem Wiki oder gemeinsamem Aufarbeiten zu tun, obwohl es sinnvoll wäre, Dokumentmassen mittels Crowdsourcing anzugehen.
Update: wurde abgeschmettert
http://www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/beschwerde-gegen-den-spiegel-abgelehnt/11.html
http://blog.kooptech.de/2010/12/presserat-beschwerde-in-der-sache-wikileaks/
Wikileaks hat übrigens nichts mit einem Wiki oder gemeinsamem Aufarbeiten zu tun, obwohl es sinnvoll wäre, Dokumentmassen mittels Crowdsourcing anzugehen.
Update: wurde abgeschmettert
http://www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/beschwerde-gegen-den-spiegel-abgelehnt/11.html
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:58 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit großer Freude nehmen die Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek Köln (KMB) wahr, dass Oberbürgermeister Jürgen Roters anläßlich der Trauerfeier für Frau Professorin Irene Ludwig am 8. Dezember im Museum Ludwig Köln und als posthume Ehrung ihrer überragenden kulturellen und mäzenatischen Tätigkeit bekannt gegeben hat, dass die KMB im bisherigen Umfang bestehen bleibt. Damit enden monatelange Spekulationen über die mögliche Schließung der einmaligen Wissenschafts- und Kunstbibliothek.
http://freundekmb.de/
http://freundekmb.de/
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:41 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Titel: Sind Sie der ideale Leser, Signore Eco?
Interview von Felicitas von Lovenberg
Faz online 12 Dezember 2010
Vierprinzen
Interview von Felicitas von Lovenberg
Faz online 12 Dezember 2010
Vierprinzen
vom hofe - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 19:06 - Rubrik: Miscellanea
Mir ist innerhalb der letzten vier Monate aufgefallen, das viele Werke aus der Bayerischen Staatsbibliothek, welche durch Google Books digtalisiert worden sind, nicht bei Google online sind. Dagegen findet man sie Online auf dem Server der Staatsbibliothek.
Beispiel 1
Genealogische Adels-Historie Oder Geschlechts-Beschreibung Derer Im Chur-Sächsischen und angräntzenden Landen zum Theil ehemahls, allermeist aber noch ietzo in guten Flor stehenden ältesten und ansehnlichsten Adelichen Geschlechter Und aus selbigen entsprungenen verschiedenen Freyherrlichen und Hoch-Gräflichen Häuser
Googlelink: Bd. 1 http://books.google.de/books?id=aN1DAAAAcAAJ
Link der Staatsbibliothek:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10328201-9
Beispiel 2
Wittenbergsches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des ökonomischen Gewerbes
Bd. 4
Googlelink http://books.google.de/books?id=P5VEAAAAcAAJ
Link der Staatsbibliothek:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10532348-7
Ich könnte viele weitere Beispiele anführen. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Wird jetzt von Google nur noch darauf hingewiesen, ja das Werk ist digitalisiert, da aber eine digitale Kopie des Werkes in der Bayerischen Staatsbibliothek online ist wird es hier nicht mehr als Onlinewerk eingestellt.
Ich jedenfalls schaue immer auf beiden Seiten nach ob das jeweilige Werk online ist.
Beispiel 1
Genealogische Adels-Historie Oder Geschlechts-Beschreibung Derer Im Chur-Sächsischen und angräntzenden Landen zum Theil ehemahls, allermeist aber noch ietzo in guten Flor stehenden ältesten und ansehnlichsten Adelichen Geschlechter Und aus selbigen entsprungenen verschiedenen Freyherrlichen und Hoch-Gräflichen Häuser
Googlelink: Bd. 1 http://books.google.de/books?id=aN1DAAAAcAAJ
Link der Staatsbibliothek:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10328201-9
Beispiel 2
Wittenbergsches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des ökonomischen Gewerbes
Bd. 4
Googlelink http://books.google.de/books?id=P5VEAAAAcAAJ
Link der Staatsbibliothek:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10532348-7
Ich könnte viele weitere Beispiele anführen. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Wird jetzt von Google nur noch darauf hingewiesen, ja das Werk ist digitalisiert, da aber eine digitale Kopie des Werkes in der Bayerischen Staatsbibliothek online ist wird es hier nicht mehr als Onlinewerk eingestellt.
Ich jedenfalls schaue immer auf beiden Seiten nach ob das jeweilige Werk online ist.
FredLo - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Über 15.000 Bilder auf Flickr (aber nicht PD)
http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/
Via
http://www.bookpatrol.net/2010/12/in-stacks-boston-public-library.html

http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/
Via
http://www.bookpatrol.net/2010/12/in-stacks-boston-public-library.html

KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Jahresendversion von Heather Morrisons Zusammenstellung:
http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/dramatic-growth-of-open-access-december.html
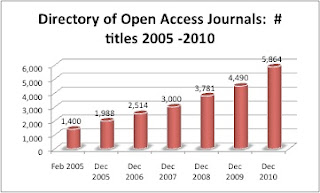
http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/dramatic-growth-of-open-access-december.html
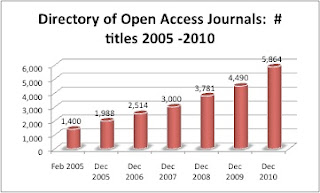
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:12 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:11 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Auf seiner gestrigen Sitzung beschloss der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes unter Vorsitz von Staatsminister Bernd Neumann folgende Maßnahmen und Projekte:
.....
SICHERUNG UND VERMITTLUNG DES NACHLASSES VON PINA BAUSCH: Pina Bauschs künstlerischer Nachlass besteht aus einer umfänglichen Materialsammlung, die sie über ihre gesamte Karriere als Tänzerin und Choreografin hinweg erstellt und eigenhändig gepflegt hat. Mit der systematischen Erfassung sämtlicher Archivalien, mit Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zu deren Erhalt sowie einer videobasierten Kommentierung von Bauschs Werken durch Mitglieder des Tanztheater Wuppertal sollen der Nachlass gesichert und die Voraussetzungen für eine internationale Vermittlung an Fachleute und Interessierte, an Tänzer/innen und Choreograf/innen geschaffen werden. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Sicherung und Vermittlung des künstlerischen Nachlasses von Pina Bausch mit insgesamt 450.000 Euro. ...."
Quelle: Pressemitteilung der Kulturstiftung des Bundes, Halle an der Saale, 10. Dezember 2010
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=pina+bausch
.....
SICHERUNG UND VERMITTLUNG DES NACHLASSES VON PINA BAUSCH: Pina Bauschs künstlerischer Nachlass besteht aus einer umfänglichen Materialsammlung, die sie über ihre gesamte Karriere als Tänzerin und Choreografin hinweg erstellt und eigenhändig gepflegt hat. Mit der systematischen Erfassung sämtlicher Archivalien, mit Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zu deren Erhalt sowie einer videobasierten Kommentierung von Bauschs Werken durch Mitglieder des Tanztheater Wuppertal sollen der Nachlass gesichert und die Voraussetzungen für eine internationale Vermittlung an Fachleute und Interessierte, an Tänzer/innen und Choreograf/innen geschaffen werden. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Sicherung und Vermittlung des künstlerischen Nachlasses von Pina Bausch mit insgesamt 450.000 Euro. ...."
Quelle: Pressemitteilung der Kulturstiftung des Bundes, Halle an der Saale, 10. Dezember 2010
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=pina+bausch
Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 16:02 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... In Wiesbaden ist ein weiterer Fall von sexuellem Missbrauch von Schülern aufgetaucht. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung entdeckte jetzt im dortigen Stadtarchiv kinderpornographische Bilder aus den siebziger und achtziger Jahren. Sie zeigen nackte Schüler. Es handelt sich dabei um Fotos aus dem Nachlass eines pädokriminellen Lehrers, der seinerzeit an der Wiesbadener Helene-Lange-Schule unterrichtete. Der Fund wurde der Kriminalpolizei übergeben.
Der mittlerweile verstorbene Kunstlehrer Hajo Weber brachte die Jungen dazu, nackt in den Duschräumen der Schule, auf Klassenfahrten und in seinem Atelier zu posieren. Dort hatte er eine Sauna und eine Dunkelkammer, in der er Dutzende von Jungen fotografierte. Zudem hatte Weber in den Jahren 1988 und 1989 fünf Schüler aus der sechsten Klasse der Helene-Lange-Schule in seiner Wohnung und in seinem Atelier mehrfach missbraucht. Der Fall wurde damals bekannt, die damalige Schulleiterin Enja Riegel brachte ihn jedoch nicht zur Anzeige, sondern veranlasste nur Webers Abordnung an das Hessische Institut für Lehrerfortbildung. Nach wenigen Jahren war Weber wieder in der Helene-Lange-Schule aktiv und begleitete mindestens eine Klassenfahrt. Zeitweilig unterrichtete er auch an der Deutschen Schule in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und wirkte an pädagogischen Projekten in Nepal mit.
Insgesamt lagerten im Wiesbadener Stadtarchiv Bilder von mehr als vierzig verschiedenen Jungen. Nach Webers Tod im Jahr 2008 sichtete auch Enja Riegel zumindest Teile seines Nachlasses. Sie gibt an, nur in seiner Wohnung, nicht jedoch in seinem Atelier gewesen zu sein. Kollegen von Weber brachten die Negative in das Stadtarchiv von Wiesbaden. Seither lagerten sie dort in zwei Holzkisten. Das Depositum umfasst Tausende von Negativen. Zu großen Teilen handelt es sich um stadt- und kulturhistorische Fotos.
Ein Mitarbeiter des Archivs zeigte sich am Freitag gegenüber dieser Zeitung überrascht, dass die Sammlung noch Nacktfotos enthält. Er hatte nach eigenem Bekunden angenommen, dass ein Kollege sie schon allesamt „rausgefilzt“ habe. Die Stadt Wiesbaden teilte mit, dass der Inhalt der Behälter bislang „nur oberflächlich gesichtet worden“ sei."
Quelle: FAZ.net, 12.12.2010
Auch die TAZ und der Spiegel berichten.
Ist dies die richtige Vorgehensweise bei möglicherweise strafrechtlich relevantem Archivgut?
Der mittlerweile verstorbene Kunstlehrer Hajo Weber brachte die Jungen dazu, nackt in den Duschräumen der Schule, auf Klassenfahrten und in seinem Atelier zu posieren. Dort hatte er eine Sauna und eine Dunkelkammer, in der er Dutzende von Jungen fotografierte. Zudem hatte Weber in den Jahren 1988 und 1989 fünf Schüler aus der sechsten Klasse der Helene-Lange-Schule in seiner Wohnung und in seinem Atelier mehrfach missbraucht. Der Fall wurde damals bekannt, die damalige Schulleiterin Enja Riegel brachte ihn jedoch nicht zur Anzeige, sondern veranlasste nur Webers Abordnung an das Hessische Institut für Lehrerfortbildung. Nach wenigen Jahren war Weber wieder in der Helene-Lange-Schule aktiv und begleitete mindestens eine Klassenfahrt. Zeitweilig unterrichtete er auch an der Deutschen Schule in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und wirkte an pädagogischen Projekten in Nepal mit.
Insgesamt lagerten im Wiesbadener Stadtarchiv Bilder von mehr als vierzig verschiedenen Jungen. Nach Webers Tod im Jahr 2008 sichtete auch Enja Riegel zumindest Teile seines Nachlasses. Sie gibt an, nur in seiner Wohnung, nicht jedoch in seinem Atelier gewesen zu sein. Kollegen von Weber brachten die Negative in das Stadtarchiv von Wiesbaden. Seither lagerten sie dort in zwei Holzkisten. Das Depositum umfasst Tausende von Negativen. Zu großen Teilen handelt es sich um stadt- und kulturhistorische Fotos.
Ein Mitarbeiter des Archivs zeigte sich am Freitag gegenüber dieser Zeitung überrascht, dass die Sammlung noch Nacktfotos enthält. Er hatte nach eigenem Bekunden angenommen, dass ein Kollege sie schon allesamt „rausgefilzt“ habe. Die Stadt Wiesbaden teilte mit, dass der Inhalt der Behälter bislang „nur oberflächlich gesichtet worden“ sei."
Quelle: FAZ.net, 12.12.2010
Auch die TAZ und der Spiegel berichten.
Ist dies die richtige Vorgehensweise bei möglicherweise strafrechtlich relevantem Archivgut?
Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 15:33 - Rubrik: Archivrecht
"Der ehemalige Staatssekretär des NRW-Schulministeriums, Günter Winands (CDU), hat keine Chancen, neuer Präsident des Bundesarchivs zu werden. Dies geht aus der jetzt veröffentlichten Ausschreibung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hervor, in der ausdrücklich die "Befähigung für den höheren Archivdienst" gefordert wird. Winands ist Jurist. Im Vorfeld der Neubesetzung hatte es Befürchtungen gegeben, die hochdotierte Stelle könnte als Versorgungsposten für einen verdienten Parteigänger benutzt werden.
Im Vorfeld der Ausschreibung war Winands als heißer Kandidat für den Präsidentenstuhl gehandelt worden. Dagegen hatte sich Widerstand geregt, weil der Ex-Staatssekretär nicht über den üblichen fachlichen Hintergrund verfügt hätte. Winands war 1990 bis 1998 in der Ära von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt tätig. Später übte er verschiedene Funktionen beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Berlin aus.
In der Geschichte des Bundesarchivs hat es noch keinen Präsidenten gegeben, der keine archivfachliche Ausbildung für den höheren Dienst absolviert hat. Zumeist sind die Leiter dieser Behörde, die als zeitgeschichtliches Gedächtnis der Bundesrepublik gilt, zudem promovierte Historiker. Der jetzige Präsident Hartmut Weber geht im März 2011 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird am 1. April seinen Dienst antreten. Zum Bundesarchiv gehören 750 Bedienstete, die sich auf elf Dienststellen an neun Orten verteilen. Der zentrale Sitz ist Koblenz. Das Archiv verfügt über einen enormen Aktenbestand."
Quelle: Rheinische Post, 10.12.2010 (Print)
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/8470466/
Im Vorfeld der Ausschreibung war Winands als heißer Kandidat für den Präsidentenstuhl gehandelt worden. Dagegen hatte sich Widerstand geregt, weil der Ex-Staatssekretär nicht über den üblichen fachlichen Hintergrund verfügt hätte. Winands war 1990 bis 1998 in der Ära von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt tätig. Später übte er verschiedene Funktionen beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Berlin aus.
In der Geschichte des Bundesarchivs hat es noch keinen Präsidenten gegeben, der keine archivfachliche Ausbildung für den höheren Dienst absolviert hat. Zumeist sind die Leiter dieser Behörde, die als zeitgeschichtliches Gedächtnis der Bundesrepublik gilt, zudem promovierte Historiker. Der jetzige Präsident Hartmut Weber geht im März 2011 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird am 1. April seinen Dienst antreten. Zum Bundesarchiv gehören 750 Bedienstete, die sich auf elf Dienststellen an neun Orten verteilen. Der zentrale Sitz ist Koblenz. Das Archiv verfügt über einen enormen Aktenbestand."
Quelle: Rheinische Post, 10.12.2010 (Print)
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/8470466/
Wolf Thomas - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Herausgegeben von Staatsarchivar Jules Robbi 1914:
http://www.archive.org/details/dieurkundenreges00robb
http://www.archive.org/details/dieurkundenreges00robb
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 02:39 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 dvektionsdominierter Akkretionsfluss - was war das noch gleich? Richtig, zur Halbzeit des Adventskalenders gibt es als Kontrastprogramm zum bisherigen Inhalt etwas Naturwissenschaftliches. Es geht um die Physik.
dvektionsdominierter Akkretionsfluss - was war das noch gleich? Richtig, zur Halbzeit des Adventskalenders gibt es als Kontrastprogramm zum bisherigen Inhalt etwas Naturwissenschaftliches. Es geht um die Physik. Als ich auf Twitter nach tollen deutschsprachigen Physik-Websites fragte, nannte Lars Fischer Andreas Müllers Lexikon der Astrophysik (hier kann man obigen Begriff nachschlagen) und Einstein-Online.
The 2010 Physics.org Web awards honor the best sites dedicated to physics education and news. Die Liste der natürlich englischsprachigen Angebote gibt es unter
http://www.boingboing.net/2010/11/15/the-best-physics-web.html
Als bestes Blog wurde ein astrophysikalisches Angebot im Rahmen der Scienceblogs.com gewertet: Starts with a Bang!
http://scienceblogs.com/startswithabang/

Das Schöne an astrophysikalischen Illustrationen ist ja, dass sie oft so ästhetisch sind, dass man sie als Kunstwerke ohne ein Gran Physikverständnis genießen kann.
Als beste Fragen-und-Antworten-Seite erwies sich:
http://www.last-word.com/
Den Publikumspreis auf diesem Feld erhielt:
http://www.physicsforums.com/
Dieses Angebot legt nun gar keinen Wert auf Ästhetik, es präsentiert sich mit dem üblichen kargen Foren-Design.
Physik zum Mitmachen bietet der Gewinner des Präsidenten-Preises (und des Publikumspreises):
http://www.zooniverse.org
The Zooniverse is home to the internet's largest, most popular and most successful citizen science projects.
Bei oldweather.org kann man beispielsweise englischsprachige Schiffslogbücher transkribieren, um Wissenschaftlern zu helfen.
The art of crowdsourcing from National Maritime Museum on Vimeo.
Bestes Online-Magazin:http://www.popsci.com/
Für das Publikum war es:
http://www.cosmosmagazine.com/
(Nur eine Spur weniger mit Werbung überladen als Popsci.)
Einig waren sich Jury und Publikum wieder beim besten Podcast: Science weekly vom Guardian:
http://www.guardian.co.uk/science/series/science
Beste Seite für Kinder: NASA's Kids Club
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
Das Publikum entschied sich für: CERNland
https://project-cernland.web.cern.ch/project-CERNland/
Diese Seite ist auch in einer deutschen Sprachversion zugänglich!
Beste Lernseite:
http://www.s-cool.co.uk/
Für das Publikum:
http://www.cyberphysics.co.uk/
Würde man Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Physik forschen, nach der besten Website fragen, so würden viele wohl das folgende Angebot nennen:
http://arxiv.org/
Open access to 645,461 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. Der größte Preprint-Server für wissenschaftliche Publikationen weltweit. Wer mehr über ihn wissen will, kann z.B. in der Wikipedia nachschauen.
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Sonntag, 12. Dezember 2010, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung
Ist schon online:
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe4/ARCHIVAR_04-10_internet.pdf
Allerdings ohne den Anzeigenteil, aus dem wir wieder die Jobs vermelden:
S. 488 Stadtarchivleiter Iserlohn (gehobener Dienst)
FH Potsdam, Professur für Archivwissenschaft [was ist das??]
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe4/ARCHIVAR_04-10_internet.pdf
Allerdings ohne den Anzeigenteil, aus dem wir wieder die Jobs vermelden:
S. 488 Stadtarchivleiter Iserlohn (gehobener Dienst)
FH Potsdam, Professur für Archivwissenschaft [was ist das??]
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 23:05 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schwachsinn: Neben der Findmitteldatenbank mit etlichen, aber noch nicht sehr vielen Beständen
http://www.gda.bayern.de/findmittel/ead/
sind nach wie vor die einzelnen (also nicht insgesamt durchsuchbaren) Findbuch-PDFs zu konsultieren (die allermeisten Bestände sind aber eh nicht online).
Ebenso daneben: "alle Begriffe werden mit ODER verknüpft." Hallo? Die Generation Google und ich erwarten hier das genaue Gegenteil.
Und was soll eine Findbuchdatenbank ohne die Möglichkeit der Laufzeit-Eingrenzung?
Es gibt ja nun genügend Archivdatenbanken, an denen man sich hätte orientieren können - wieso muss Bayern die denkbar schlechteste Möglichkeit realisieren?
http://www.gda.bayern.de/findmittel/ead/
sind nach wie vor die einzelnen (also nicht insgesamt durchsuchbaren) Findbuch-PDFs zu konsultieren (die allermeisten Bestände sind aber eh nicht online).
Ebenso daneben: "alle Begriffe werden mit ODER verknüpft." Hallo? Die Generation Google und ich erwarten hier das genaue Gegenteil.
Und was soll eine Findbuchdatenbank ohne die Möglichkeit der Laufzeit-Eingrenzung?
Es gibt ja nun genügend Archivdatenbanken, an denen man sich hätte orientieren können - wieso muss Bayern die denkbar schlechteste Möglichkeit realisieren?
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:41 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:40 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mijnadres.org
Das Portal soll Bauakten aus den Niederlanden und Flandern nachweisen. Der Server ist extrem langsam, wenn es Scans gibt, sind diese nicht online, sondern nur beim Archiv bestellbar. Kein wirklicher Fortschritt!
Das Portal soll Bauakten aus den Niederlanden und Flandern nachweisen. Der Server ist extrem langsam, wenn es Scans gibt, sind diese nicht online, sondern nur beim Archiv bestellbar. Kein wirklicher Fortschritt!
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 22:18 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.netzpolitik.org/2010/aus-fehlern-lernen-openleaks/
Unser Ansatz ist, nur die elektronischen Briefkästen zur Verfügung zu stellen und sonst im Hintergrund zu bleiben. Der Fokus soll wieder auf den Inhalten liegen. Wir wollen sicherstellen, dass Dokumente möglichst einfach bei Partnern platziert werden können – seien es Medien, Gewerkschaften oder NGOs. Dabei werden nicht wir entscheiden, wer das Dokument für eine gewisse Zeit vorab bekommt, sondern die Quelle. Wenn dann zum Beispiel der Freitag das Material nicht verwertet, bekommen es andere zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand etwas dazu veröffentlicht, geht der Datensatz für alle online.
http://openleaks.org/ ist noch nicht freigeschaltet.
Unser Ansatz ist, nur die elektronischen Briefkästen zur Verfügung zu stellen und sonst im Hintergrund zu bleiben. Der Fokus soll wieder auf den Inhalten liegen. Wir wollen sicherstellen, dass Dokumente möglichst einfach bei Partnern platziert werden können – seien es Medien, Gewerkschaften oder NGOs. Dabei werden nicht wir entscheiden, wer das Dokument für eine gewisse Zeit vorab bekommt, sondern die Quelle. Wenn dann zum Beispiel der Freitag das Material nicht verwertet, bekommen es andere zur Verfügung gestellt. Und wenn jemand etwas dazu veröffentlicht, geht der Datensatz für alle online.
http://openleaks.org/ ist noch nicht freigeschaltet.
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:39 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:32 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Danke an Herrn Buchhändler Praefcke in R. für das nette Adventsgeschenk
http://twitter.com/AndreasPraefcke/status/13354134153461760

Mehr:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Wilgefortis
http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis
http://twitter.com/AndreasPraefcke/status/13354134153461760

Mehr:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Wilgefortis
http://de.wikisource.org/wiki/K%C3%BCmmernis
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 21:29 - Rubrik: Unterhaltung
http://www.oralliterature.org/
An urgent global initiative to document and make accessible endangered oral literatures before they disappear without record.
An urgent global initiative to document and make accessible endangered oral literatures before they disappear without record.
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Warum die angeführten Kämpfer für die Freiheit von Ideen und Meinungen Vorgänger von Wikileaks sein sollen, sagt Don Alphonso nicht:
http://faz-community.faz.net/blogs/stuetzen/archive/2010/12/08/sieben-jahrhunderte-wikileaks.aspx
http://faz-community.faz.net/blogs/stuetzen/archive/2010/12/08/sieben-jahrhunderte-wikileaks.aspx
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:56 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
Ein weiterer Überblick zur englischsprachigen Resonanz:
http://philobiblos.blogspot.com/2010/12/new-elephant-google-ebooks.html
http://philobiblos.blogspot.com/2010/12/new-elephant-google-ebooks.html
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.archive.org/2010/12/10/2685/
Lustig die Vorlesefunktion bei deutschen Texten!
http://www.archive.org/stream/VerzeichnisuumlberPsychoanalytischeLiteratur/Verzeichnis_ueber_psychoanalytische_Literatur#page/n9/mode/2up
Ungenügend ist der Umgang mit den Seitenzählungen, hier ist Google Books trotz vieler Mängel immer noch besser. Ein direktes Ansteuern einer Seite ist nicht möglich.

Lustig die Vorlesefunktion bei deutschen Texten!
http://www.archive.org/stream/VerzeichnisuumlberPsychoanalytischeLiteratur/Verzeichnis_ueber_psychoanalytische_Literatur#page/n9/mode/2up
Ungenügend ist der Umgang mit den Seitenzählungen, hier ist Google Books trotz vieler Mängel immer noch besser. Ein direktes Ansteuern einer Seite ist nicht möglich.

KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 19:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Unter der Überschrift "Streit um Münzkabinett" berichtete die Neue Presse Hannover über die Plenumsdebatte am 7. Dezember 2010 im Niedersächsischen Landtag.
Beschlossen wurde die Vorlage der Regierungspartei
Vorgeschichte: http://archiv.twoday.net/stories/7916185/
Beschlossen wurde die Vorlage der Regierungspartei
Vorgeschichte: http://archiv.twoday.net/stories/7916185/
Dagobert Duck - am Samstag, 11. Dezember 2010, 13:51 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 nnähernd vollständig dürfte die folgende Linkliste zu komplett im Netz digital einsehbaren islamischen Handschriften keinesfalls sein. Schon allein Sprachbarrieren sind dafür verantwortlich. Aber ich habe keine andere Linkliste gefunden, die annähernd so umfangreich ist wie die hier Präsentierte (weitergehende Links zu islamischen Handschriften allgemein bietet etwa die kanadische McGill-University, einige Link zu Museen mit islamischer Kunst hier). Man trifft meist nur die "üblichen Verdächtigen", nämlich bekannte und seit Jahren im Netz befindliche Angebote an. Es mag ja sein, dass ich für Islamwissenschaftler Eulen nach Athen trage, aber dann sollen sie doch gefälligst eine Linkliste ins Netz stellen und sei es nur in delicious. Ergänzungen sind also willkommen.
nnähernd vollständig dürfte die folgende Linkliste zu komplett im Netz digital einsehbaren islamischen Handschriften keinesfalls sein. Schon allein Sprachbarrieren sind dafür verantwortlich. Aber ich habe keine andere Linkliste gefunden, die annähernd so umfangreich ist wie die hier Präsentierte (weitergehende Links zu islamischen Handschriften allgemein bietet etwa die kanadische McGill-University, einige Link zu Museen mit islamischer Kunst hier). Man trifft meist nur die "üblichen Verdächtigen", nämlich bekannte und seit Jahren im Netz befindliche Angebote an. Es mag ja sein, dass ich für Islamwissenschaftler Eulen nach Athen trage, aber dann sollen sie doch gefälligst eine Linkliste ins Netz stellen und sei es nur in delicious. Ergänzungen sind also willkommen.Viele der digitalisierten Handschriften bieten sehenswerte Kalligraphie oder Illustrationen, die man genießen kann, auch wenn man keine Silbe Arabisch versteht (wie ich)!
Ärgerlich: Beirut, American University, aber
ACCESS RESTRICTED TO FIRST AND LAST 5 PAGES
http://ddc.aub.edu.lb/projects/jafet/manuscripts/
Bei http://www.manuscriptcenter.org habe ich nichts online gefunden.
Das tunesische Angebot, auf das ich 2005 in netbib hinwies, scheint nicht mehr online zu sein (Archive.org).
Und nun tauchen Sie mit mir ein in die faszinierende Welt orientalischer Handschriftenkultur.
***
LINKS
Baltimore, Walters Art Museum
http://art.thewalters.org/viewgallery.aspx?id=1254
Berlin, Staatsbibliothek, wissenschaftliche Manuskripte via ECHO (erst 7)
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/mpiwglib/islam
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (Spanien), arabische Handschriften: 8
http://bvpb.mcu.es
Birmingham, Uni, Mingana-Collection
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/
Bratislawa, Universitätsbibliothek, Sammlung Bašagić
http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=basagic&l=sk&w=utf-8
Nachtrag. Auf http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/535 wies mich Farley Katz hin.
Harvard University, Islamic Heritage Project
http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/manuscripts.html
Heidelberg, UB (erst 2)
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/codheidor.html
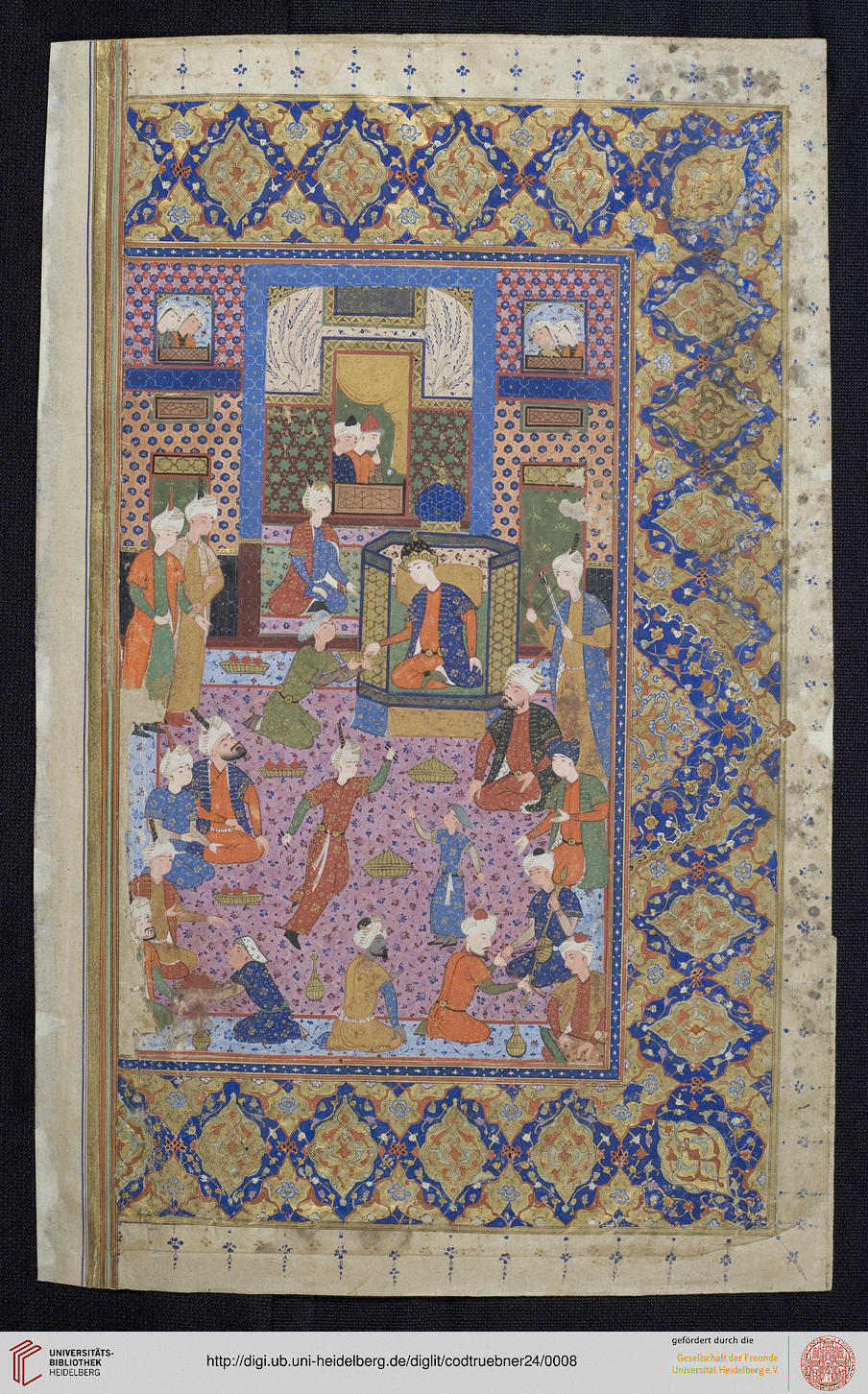 UB Heidelberg Cod. Trübner 24, Persien (?), Ende 10. Jh.
UB Heidelberg Cod. Trübner 24, Persien (?), Ende 10. Jh.Indiana University, 2 ganze
http://www.iub.edu/~iuwebdev/projects/islamic_book_arts/production/explore/index.html
(Nachtrag, Danke an Antony Tedeschi)
Kopenhagen, Königliche Bibliothek
http://www.kb.dk/en/nb/samling/os/osdigit.html
(Nachtrag, Danke an Eva-Maria Jansson)
Leipzig, Uni, mehrere Projekte, unter anderem Islamische Handschriften der UB Leipzig
http://wwwurz.uni-leipzig.de/islamhs.html
Michigan Islamic Manuscripts
http://www.lib.umich.edu/islamic/ bzw.
http://babel.hathitrust.org/cgi/mb?a=listis;c=1961411403
München, Staatsbibliothek, arabische Handschriften
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/gesamt_ausgabe.html?projekt=1237542282&recherche=ja&ordnung=sig
 Cod. arab. 616: Syrien ca. 1310
Cod. arab. 616: Syrien ca. 1310München, Universitätsbibliothek
http://epub.ub.uni-muenchen.de/view/cim/cim.html
(Nachtrag)
Oxford, Bodleian, ein herausragendes Ms.: Book of Curiosities
http://cosmos.bodley.ox.ac.uk
Paris, BN, arabische Handschriften
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=EN&f_typedoc=manuscrits&q=arabe
Penn Libraries, arabische Handschriften
http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/search.html?fq=language_facet:%22Arabic%22
Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts
http://library.princeton.edu/projects/islamic/index.html
Bildbeispiel
Tokio, Daiber Collection
http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db_index_eng.html
University of Utah, Marriott Library, The Arabic Papyrus, Parchment & Paper Collection
http://content.lib.utah.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/uuappp
(Nachtrag, Danke an Farley Katz)
Virtual Library of the Mediterranean Sea
http://data.manumed.org
Washington, Library of Congress, Islamic Manuscripts from Mali
http://memory.loc.gov/intldl/malihtml/malihome.html
Word Digital Library, Mittlerer Osten und Nordafrika
http://www.wdl.org/en/search/gallery?ql=eng&a=-8000&b=2010&r=MiddleEastNorthAfrica&ty=Manuscripts
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Samstag, 11. Dezember 2010, 00:40 - Rubrik: Kodikologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Simplicius/Diderot-Club_II#Wikimedia_Deutschland:_Es_ist_Zeit_f.C3.BCr_eine_Bilanz
So wurde dann aus der Non-Profit-Veranstaltung „Freies Wissen für alle eine“ Goldmine für einige wenige
So wurde dann aus der Non-Profit-Veranstaltung „Freies Wissen für alle eine“ Goldmine für einige wenige
Digitalisierte Fotos von Bauten und Kunstwerken:
http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/view.php
http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/view.php
KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 19:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 19:36 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 m Beginn von Büchern pflegen sich viele Sammler mit gedruckten Bucheignerzeichen oder "Exlibris" zu verewigen. Da es sich um ein Sammlerthema handelt, gibt es dazu viele Internetangebote.
m Beginn von Büchern pflegen sich viele Sammler mit gedruckten Bucheignerzeichen oder "Exlibris" zu verewigen. Da es sich um ein Sammlerthema handelt, gibt es dazu viele Internetangebote.Eine Linksammlung:
http://forum.heraldik-und-kunst.de/index.php/topic,771.0.html
An Buchdigitalisaten greife ich wenige heraus:
Friedrich Warnecke: Die deutschen Bücherzeichen (Ex-Libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart. Berlin 1890
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004657/images/
Karl Emich Graf zu Leiningen-Westerburg: Deutsche und Oesterreichische Bibliothekzeichen. Stuttgart 1901
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-20591
Ludwig Gerster: Die Schweizerischen Bibliothekzeichen (Ex-Libris). Kappelen 1898
http://www.archive.org/details/dieschweizerisc00gersgoog
"Wäre es nicht eine gute Idee, wenn Bibliotheken weltweit ein gemeinsames Register von Bucheignerzeichen und Stempeln unterhalten?" Fragte ich im August 2003. Das gilt nach wie vor.
An Bibliotheksdatenbanken und Sammlungen mit Digitalisaten sind mir bekannt (natürlich gibt es keine Metasuche!):
U. of Delaware Library
http://cdm.lib.udel.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/wab
"The William Augustus Brewer Digital Bookplate Collection currently includes about 3,000 bookplates, with the remaining bookplates to be added in 2011."
Hinweis: http://archiv.twoday.net/stories/6501259/
UB Neuchatêl
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=ex_libr&sous_menu2=0
Hinweis: http://archiv.twoday.net/stories/4987565/
McGill U. Library
http://digital.library.mcgill.ca/bookplates/
Notre Dame U. Library
http://www.rarebooks.nd.edu/digital/bookplates/registry_search.html
UB Salzburg (Liste mit Links zum OPAC, wo ggf. Digitalisate verlinkt sind)
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/exlibris/exlibrisliste.htm
Die Pratt Library bietet über 1200 Abbildungen auf Flickr an:
http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/
Ein "Best of" davon bildete Bibliodyssey ab:
http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/06/pratt-ex-libris.html
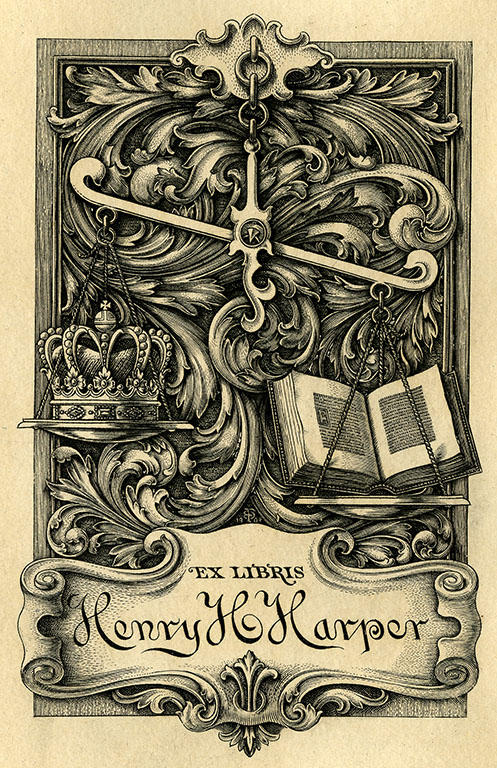 Aus der Pratt Library (Näheres nicht bekannt)
Aus der Pratt Library (Näheres nicht bekannt)Peacay hatte schon früher Exlibris thematisiert:
http://bibliodyssey.blogspot.com/2006/07/assorted-ex-libris.html
Exlibris kann man natürlich auch in Bibliotheksdigitalisaten entdecken, siehe etwa:
http://archiv.twoday.net/stories/6428052/#6428610
Zu dürftige Scans einer Bibliothekszeitschrift:
http://www.gslis.utexas.edu/~landc/bookplateindex.htm
Abbildungen auf Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ex_libris
Weblogs:
http://bookplatejunkie.blogspot.com/
http://pocketsizeprints.blogspot.com/
http://bookplate-jvarnoso.blogspot.com/ (bis 2009)
 Als ältestes gedrucktes Exlibris gilt das des Buxheimer Kartäusers Hilprand Brandenburg, hier abgebildet nach der Prints Database des British Museum. Ein ausführlicher Beitrag zum Exlibris findet sich im Blog der Brandeis Special Collections.
Als ältestes gedrucktes Exlibris gilt das des Buxheimer Kartäusers Hilprand Brandenburg, hier abgebildet nach der Prints Database des British Museum. Ein ausführlicher Beitrag zum Exlibris findet sich im Blog der Brandeis Special Collections. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exlibris_tuempling.jpg Meine eigene Exlibris-Sammlung besteht im wesentlichen aus zwei Exemplaren in einem einzigen Buch. Das obere wurde 1895 von dem Berner Exlibriskünstler Christian Bühler (1825-1898) gestaltet. Er hatte schon 1882 für Wolf Wilhelm von Tümpling aus der mitteldeutschen Adelsfamilie ein Buchzeichen gestaltet (abgebildet bei Bernhard Peter).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exlibris_tuempling.jpg Meine eigene Exlibris-Sammlung besteht im wesentlichen aus zwei Exemplaren in einem einzigen Buch. Das obere wurde 1895 von dem Berner Exlibriskünstler Christian Bühler (1825-1898) gestaltet. Er hatte schon 1882 für Wolf Wilhelm von Tümpling aus der mitteldeutschen Adelsfamilie ein Buchzeichen gestaltet (abgebildet bei Bernhard Peter).Wer kennt das untere Exlibris?
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Freitag, 10. Dezember 2010, 00:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Architekturmuseum der TU Berlin
Architekt: Otto Kohtz
Inhalt: Archiv, Filmtresor: Grundriss, Ansichten, Querschnitt, Detailschnitt
Datierung (Blatt oder Bauwerk): 1935
Gattung: Lichtpause
Material/Technik: Lichtpause auf Papier
Maße (h x b): 47,80 x 76,50 cm
Inv. Nr.: 9514
URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=90964
Wikipedia-Artikel Otto Kohtz
Architekt: Otto Kohtz
Inhalt: Archiv, Filmtresor: Grundriss, Ansichten, Querschnitt, Detailschnitt
Datierung (Blatt oder Bauwerk): 1935
Gattung: Lichtpause
Material/Technik: Lichtpause auf Papier
Maße (h x b): 47,80 x 76,50 cm
Inv. Nr.: 9514
URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=90964
Wikipedia-Artikel Otto Kohtz
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:43 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Architekturmuseum TU Berlin: Planungsunterlage von Hermann Mattern: Schnitt Verwaltungstrakt Magazingebäude 1:100
Datierung (des Blattes): 20.08.1958
Gattung: Lichtpause Einzeichnung
Material/Technik: Bleistift über Lichtpause auf Papier
Maße (h x b): 35,00 x 90,00 cm
Inv. Nr.: 24287
URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=109419
Wikipedia-Artikel: Hermann Mattern
Datierung (des Blattes): 20.08.1958
Gattung: Lichtpause Einzeichnung
Material/Technik: Bleistift über Lichtpause auf Papier
Maße (h x b): 35,00 x 90,00 cm
Inv. Nr.: 24287
URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=109419
Wikipedia-Artikel: Hermann Mattern
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:30 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ... „Ein Original ist unersetzlich – gut gesichert und versichert zum Schutz Ihres Archivs“, so lautet der Titel der Infobroschüre der Westfälischen Provinzial Versicherung zum Thema Archivalienversicherung, die im Oktober in Zusammenarbeit mit dem LWL-Archivamt erschienen ist. Das Versicherungskonzept zielt darauf ab, die möglichen Wiederherstellungskosten nach einem Schadensfall zu versichern, aus Sicht des Versicherers und des LWL-Archivamtes der einzig mögliche Weg, da es sich bei Archivgut in den meisten Fällen um Unikate handelt, die nicht wiederbeschafft werden können. Viele Schäden könnten verhindert werden, wenn bereits bei der Einrichtung von Archiven der Schadensprävention mehr Beachtung beigemessen würde. Tipps zu Schadensverhütung nehmen daher in der Broschüre neben konkreten Versicherungsbeispielen viel Raum ein.
Die Druckversion (PDF)kann unter Angabe der Bestellnummern 492/57 u. 492/57a (Anlage) bei der Westfälischen Provinzial Versicherung, Abt. Firmenkunden Kommunen – Sach, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster bestellt werden."
Quelle: LWL-Archivamt für Westfalen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:19 - Rubrik: Bestandserhaltung
Das OLG Köln hat mit heute (09.12.2010) verkündeten Beschlüssen drei Berufungsverfahren ausgesetzt, die Schadensersatzforderungen gegen die Stadt Köln wegen des Einsturzes des Stadtarchivs am 03.03.2009 zum Gegenstand haben.
Hintergrund:
Grund für die Aussetzung der Verfahren ist die in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln laufende Beweisaufnahme zu den Ursachen des Einsturzes des Historischen Stadtarchivs. Das OLG hält in den Schadensersatzverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens für erforderlich. Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln sollen für die Begutachtungen in den Verfahren vor dem OLG genutzt werden. Nach Fertigstellung des in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens werden die Berufungsverfahren fortgesetzt.
Die Kläger machen im Wege der Feststellungsklage Schadensersatz wegen der Zerstörung von Gegenständen geltend, die sie dem Historischen Stadtarchiv in Verwahrung gegeben haben. In allen drei Verfahren handelt es sich um wertvolle Archivgüter aus Privatbesitz: Schriften aus dem Nachlass eines Soziologen, historisch bedeutsame Urkunden zur Kölner Stadtgeschichte und Originaldokumente aus der Hinterlassenschaft eines Musikers. Das LG Köln hatte die Klagen durch Urteile vom 16.03.2010 abgewiesen und dabei eine Pflichtverletzung der Stadt verneint. Die Kläger haben gegen diese Entscheidungen Berufung eingelegt, über die nunmehr das OLG Köln zu entscheiden hat.
Die Entscheidungen:
Der 18. Zivilsenat des OLG Köln hat in den Beschlüssen vom heutigen Tag auf Folgendes hingewiesen: Für die Frage einer Pflichtverletzung der Stadt Köln könne es entscheidend darauf ankommen, ob die Stadt aufgrund der im November 2008 aufgetretenen Anzeichen am Gebäude selbst (Risse im Mauerwerk, Abplatzungen von Mörtel, schleifende Türen) verpflichtet war, weitere Untersuchungen zur Standsicherheit des Gebäudes vorzunehmen oder vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem könne nach derzeitigem Sach- und Streitstand eine Pflichtverletzung darin liegen, dass Mitarbeiter der Stadt das Messergebnis vom 05.02.2009 angesichts der festgestellten Veränderungen der Gebäudehöhe nicht unverzüglich an die für die Verwaltung des Gebäudes des Stadtarchivs zuständige Stelle weitergeleitet haben.
Mit der Aussetzung der Verfahren wartet das OLG auch mit Rücksicht auf die im Zuge der Beweiserhebung entstehenden, ganz erheblichen Kosten zunächst das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Frage der Kausalität ab. Dabei hat das Gericht in den Beschlüssen vom heutigen Tag darauf hingewiesen, dass, wenn danach das Beweisergebnis zur Einsturzursache im Sinne der Kläger ausfiele, es der Fortsetzung der Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zu einer eventuellen Pflichtverletzung der Beklagten bedürfte. Ferner wäre gegebenenfalls zu klären, welche Maßnahmen die Beklagte bzw. die bei ihr zuständigen Stellen bei pflichtgemäßem Verhalten hätten ergreifen müssen und ob diese den Schaden abgewendet hätten.
Aktenzeichen:
OLG Köln 18 U 56/10, 18 U 59/10 und 18 U 60/10
LG Köln 5 O 257/09, 5 O 299/09 und 5 O 300/09
Quelle: OLG Köln/WB-Online-Redaktion
Hintergrund:
Grund für die Aussetzung der Verfahren ist die in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln laufende Beweisaufnahme zu den Ursachen des Einsturzes des Historischen Stadtarchivs. Das OLG hält in den Schadensersatzverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens für erforderlich. Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln sollen für die Begutachtungen in den Verfahren vor dem OLG genutzt werden. Nach Fertigstellung des in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens werden die Berufungsverfahren fortgesetzt.
Die Kläger machen im Wege der Feststellungsklage Schadensersatz wegen der Zerstörung von Gegenständen geltend, die sie dem Historischen Stadtarchiv in Verwahrung gegeben haben. In allen drei Verfahren handelt es sich um wertvolle Archivgüter aus Privatbesitz: Schriften aus dem Nachlass eines Soziologen, historisch bedeutsame Urkunden zur Kölner Stadtgeschichte und Originaldokumente aus der Hinterlassenschaft eines Musikers. Das LG Köln hatte die Klagen durch Urteile vom 16.03.2010 abgewiesen und dabei eine Pflichtverletzung der Stadt verneint. Die Kläger haben gegen diese Entscheidungen Berufung eingelegt, über die nunmehr das OLG Köln zu entscheiden hat.
Die Entscheidungen:
Der 18. Zivilsenat des OLG Köln hat in den Beschlüssen vom heutigen Tag auf Folgendes hingewiesen: Für die Frage einer Pflichtverletzung der Stadt Köln könne es entscheidend darauf ankommen, ob die Stadt aufgrund der im November 2008 aufgetretenen Anzeichen am Gebäude selbst (Risse im Mauerwerk, Abplatzungen von Mörtel, schleifende Türen) verpflichtet war, weitere Untersuchungen zur Standsicherheit des Gebäudes vorzunehmen oder vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem könne nach derzeitigem Sach- und Streitstand eine Pflichtverletzung darin liegen, dass Mitarbeiter der Stadt das Messergebnis vom 05.02.2009 angesichts der festgestellten Veränderungen der Gebäudehöhe nicht unverzüglich an die für die Verwaltung des Gebäudes des Stadtarchivs zuständige Stelle weitergeleitet haben.
Mit der Aussetzung der Verfahren wartet das OLG auch mit Rücksicht auf die im Zuge der Beweiserhebung entstehenden, ganz erheblichen Kosten zunächst das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Frage der Kausalität ab. Dabei hat das Gericht in den Beschlüssen vom heutigen Tag darauf hingewiesen, dass, wenn danach das Beweisergebnis zur Einsturzursache im Sinne der Kläger ausfiele, es der Fortsetzung der Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zu einer eventuellen Pflichtverletzung der Beklagten bedürfte. Ferner wäre gegebenenfalls zu klären, welche Maßnahmen die Beklagte bzw. die bei ihr zuständigen Stellen bei pflichtgemäßem Verhalten hätten ergreifen müssen und ob diese den Schaden abgewendet hätten.
Aktenzeichen:
OLG Köln 18 U 56/10, 18 U 59/10 und 18 U 60/10
LG Köln 5 O 257/09, 5 O 299/09 und 5 O 300/09
Quelle: OLG Köln/WB-Online-Redaktion
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:15 - Rubrik: Kommunalarchive

"Computerspiele mit historischen Inhalten sind nicht nur ein wesentlicher Teil der heutigen Unterhaltungs- und Medienlandschaft, sondern auch der Geschichtskultur. Sie unterscheiden sich von anderen populären Repräsentationsformen von Geschichte vor allem durch ihre Interaktivität. Welche Erkenntnisse bietet die Untersuchung des Mediums für die Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Computerspiel bislang kaum befasst hat? Der vorliegende Sammelband gibt darauf vielfältige Antworten, denn die historisch-fachwissenschaftlichen Analysen der einzelnen Beiträge decken die wesentlichen Spielegenres ebenso wie die verschiedenen historischen Epochen ab. Er belegt damit nicht nur die Vielfalt der Geschichtspopularisierung im Computerspiel, sondern zugleich die Notwendigkeit, sie zu erfassen, einzuordnen und zu interpretieren. "
Angela Schwarz (Hg.)
"Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?"
Eine fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel
Reihe: Medien'welten. Braunschweiger Schriften zur Medienkultur
Bd. 13, 2010, 240 S., 19.90 EUR, br., ISBN 978-3-643-10267-6
Quelle: Verlagsangaben
"Am 24. November 2010 ist die neue Monographie von Daniela Fleiß mit dem Titel Auf dem Weg zum "starken Stück Deutschland". Image und Identität im Ruhrgebiet in Zeiten von Kohle- und Stahlkrise beim Universitätsverlag Rhein-Ruhr erschienen. Die Autorin zeichnet den Weg zum "starken Stück Deutschland" nach, indem sie exemplarisch eine Fülle von Werbematerialien aus den Städten Essen, Duisburg und Bottrop analysiert. Die Ergebnisse ihrer historischen Studie liefern einen spannenden Einblick in den vielfältigen Imagewandel des Ruhrgebiets und sind nicht nur für Historikerinnen und Historiker interessant. Nicht zuletzt bieten sie den Menschen des Ruhrgebiets Einsichten über die unterschiedlichen Bilder und Vorstellungen, die über das Ruhrgebiet transportiert wurden und werden – Vorstellungen, die auch die eigene Identität beeinflusst haben. Das 186 Seiten umfassende Buch mit der ISBN 978-3-940251-87-9 kostet 29,80 € und ist ab sofort über den Verlag oder den Buchhandel erhältlich.
Am 18. Oktober 2010 erschien der Sammelband mit den Ergebnissen des Workshops über Geschichte im Computerspiel vom Dezember 2008. Unter dem Titel "Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegener werfen?" Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel präsentiert die Herausgeberin Angela Schwarz erstmals einen Band, der sich allein der geschichtswissenschaftlichen Erforschung eines der jüngsten und am stärksten wachsenden Medien der Popularisierung von Geschichte widmet. In insgesamt neun Beiträgen werden verschiedene Facetten des Umgangs mit Geschichte in einem ebenso intensiv genutzen wie umstrittenen Produkt der Freizeitgestaltung viele Menschen auf:
Computerspiele mit historischen Inhalten sind nicht nur ein wesentlicher Teil der heutigen Unterhaltungs- und Medienlandschaft, sondern auch der Geschichtskultur. Sie unterscheiden sich von anderen populären Repräsentationsformen von Geschichte vor allem durch ihre Interaktivität. Welche Erkenntnisse bietet die Untersuchung des Mediums für die Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Computerspiel bislang kaum befasst hat? Mit dem Band, der zahlreiche historische Zeiten, Orte und Themen abdeckt, belegen die Autorinnen und Autoren nicht nur die Vielfalt der Geschichtspopularisierung im Computerspiel, sondern zugleich die Notwendigkeit, sie zu erfassen, einzuordnen und zu interpretieren.
Das Buch ist unter der ISBN 978-3-643-10267-6 als 13. Band im Rahmen der Reihe Medien'Welten des LIT Verlags in Münster erschienen, umfasst mitsamt des Spieleregisters 240 Seiten und kostet im Buchhandel 19,90 €.
Das Thema Geschichte im Computerspiel wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls in einem größeren Projekt verfolgt. Weitere Informationen zum Sammelband und zur Erforschung von Geschichte im Computerspiel finden Sie auch in diesem ZEIT Online Artikel , der zugleich beim IT-Fachportal Golem.de zu finden ist."
Quelle: Uni Siegen, Fach Geschichte, Publikationen des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte
Zu Angela Schwarz und "Computerspiele und Geschichte" s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8445399/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:11 - Rubrik: Archivpaedagogik

"Der Stasi-Experte Hubertus Knabe hat die geplante Veröffentlichung des umstrittenen Computerspiels "1378 (km)" erneut scharf kritisiert. Der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen appelliere an die Verantwortlichen, das Spiel über den Schießbefehl an der früheren innerdeutsche Grenze "aus Respekt vor den Opfern" nicht ins Internet zu stellen.
Knabe erklärte am 7. Dezember 2010, offenbar habe die Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe aus der Debatte vom Herbst nichts gelernt. Die ursprünglich für den 3. Oktober 2010 geplante Premiere war von den Verantwortlichen auf den 10. Dezember verschoben worden. Als Grund hatten sie die teils emotional aufgeladene Berichterstattung genannt. Kritiker wie Knabe hatten unter anderem bemängelt, durch das Spiel würden sich die Opfer der Todesgrenze oder deren Angehörige verletzt fühlen.
Das Spiel mit dem Titel "1378 (km)" ist angesiedelt im Jahr 1976, als es noch die DDR und die etwa 1378 Kilometer lange innerdeutsche Grenze mit Patrouillen und Selbstschussanlagen gab. Die Spieler teilen sich vor Spielbeginn in zwei Teams auf, spielen "Republikflüchtlinge" oder Grenzsoldaten. Die Grenzsoldaten sollen die Flüchtlinge stoppen - mit oder ohne Waffengewalt."
Quelle: 3sat, Kulturzeit-Nachrichten v. 8.12.2010
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8374726/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Hinweise bei:
http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/2010/12/08/kostenlose-weihnachtliche-hoerbuecher/
http://literaturblog-duftender-doppelpunkt.at/2010/12/08/kostenlose-weihnachtliche-hoerbuecher/
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:30 - Rubrik: Unterhaltung
Ein frühes hilfswissenschaftliches Standardwerk wurde vom GDZ ins Netz gestellt, wo auch sehr viele andere Bücher zur Göttinger Universitätsgeschichte derzeit digitalisiert werden:
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN638227089

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN638227089

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:01 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nicht dass ich Connotea sonderlich schätze, aber wer sich am OATP beteiligt, muss dort neue Open-Access-Informationen melden, weil Peter Subers Wahl auf Connotea gefallen ist. Immer wieder ist der Dienst nicht erreichbar, was mir bei dem von mir favorisierten delicious meiner Erinnerung noch nicht passiert ist. Wieso man nicht die Bookmarks bei beiden Anbietern spiegeln kann und beim Ausfall von Connotea dann delicious benützt und anschließend die Links in Connotae nachträgt erschließt sich mir nicht. Wenn man delicious umgehen möchte, könnte man auf einem anderen Server eine simple Textdatei mit den Links samt Kommentaren und Tags für den Fall, dass Connotea ausfällt, deponieren. Auf einer weiteren Seite könnte man neue Links eintragen (z.B. im OA-Wiki), die dann in Connotea übertragen werden können.
Subers Entscheidung für Connotea war für mich eine klare Fehlentscheidung.
Subers Entscheidung für Connotea war für mich eine klare Fehlentscheidung.
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:50 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link
Update: Danke für den Hinweis auf
http://lartdesmets.e-monsite.com/rubrique,-le-pontifical-du-maitre-d-aut,577931.html

Update: Danke für den Hinweis auf
http://lartdesmets.e-monsite.com/rubrique,-le-pontifical-du-maitre-d-aut,577931.html

KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:46 - Rubrik: Kodikologie
http://www.fotostoria.de/?p=1392
Der Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V. (BVPA) hat in seinem Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten dazu aufgerufen die in den IPTC-Headern unterbrachten Angaben zum Bild nicht zu löschen.
Text
Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten (Metadatenmanifest)
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. (§13 UrhG)
Diese Bestimmung des Urheberrechtes gilt selbstverständlich auch für digitale Bilder.
Im Gegensatz zum physisch verbreiteten Foto, kann ein Urhebervermerk am digitalen Werk nur in Form von Metadaten erfolgen. Wer diese entfernt, nimmt dem Urheber das Recht auf Namensnennung.
Dennoch finden sich schon jetzt im Internet Millionen von Bilddateien, deren Metadaten keinen Rückschluss mehr auf den Urheber zulassen.
Der BVPA verurteilt die elektronische Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Bilder, aus denen die Metadaten und insbesondere die Informationen zur Urheberschaft, vor der Veröffentlichung entfernt wurden.
Wir fordern jeden, der digitale Bilder elektronisch veröffentlicht und / oder verbreitet, auf, die vom Urheber oder dessen Vertreter in den Bilddaten hinterlegten Informationen zu bewahren und ausschließlich Bilder zu veröffentlichen, die diese Metadaten vollständig enthalten.
Ein außerhalb einer Bilddatei, z.B. im dazu gestellten Text, angebrachter Urheberhinweis kann den Erhalt der Metadaten nicht ersetzen, da die digitalen Bilder jederzeit aus diesem Kontext herausgelöst werden können.
Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die bereits existierenden Rechtsvorschriften des §95c UrhG hin, die eine unberechtigte Entfernung der Metadaten untersagen.
http://www.bvpa.org/Home/Metadatenmanifest.php
Der Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V. (BVPA) hat in seinem Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten dazu aufgerufen die in den IPTC-Headern unterbrachten Angaben zum Bild nicht zu löschen.
Text
Manifest zum Erhalt digitaler Metadaten (Metadatenmanifest)
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. (§13 UrhG)
Diese Bestimmung des Urheberrechtes gilt selbstverständlich auch für digitale Bilder.
Im Gegensatz zum physisch verbreiteten Foto, kann ein Urhebervermerk am digitalen Werk nur in Form von Metadaten erfolgen. Wer diese entfernt, nimmt dem Urheber das Recht auf Namensnennung.
Dennoch finden sich schon jetzt im Internet Millionen von Bilddateien, deren Metadaten keinen Rückschluss mehr auf den Urheber zulassen.
Der BVPA verurteilt die elektronische Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Bilder, aus denen die Metadaten und insbesondere die Informationen zur Urheberschaft, vor der Veröffentlichung entfernt wurden.
Wir fordern jeden, der digitale Bilder elektronisch veröffentlicht und / oder verbreitet, auf, die vom Urheber oder dessen Vertreter in den Bilddaten hinterlegten Informationen zu bewahren und ausschließlich Bilder zu veröffentlichen, die diese Metadaten vollständig enthalten.
Ein außerhalb einer Bilddatei, z.B. im dazu gestellten Text, angebrachter Urheberhinweis kann den Erhalt der Metadaten nicht ersetzen, da die digitalen Bilder jederzeit aus diesem Kontext herausgelöst werden können.
Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die bereits existierenden Rechtsvorschriften des §95c UrhG hin, die eine unberechtigte Entfernung der Metadaten untersagen.
http://www.bvpa.org/Home/Metadatenmanifest.php
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://cartanciennes.free.fr/
Unter anderem mit Nachweisen zur Cassini-Karte von Frankreich in sehr guter Auflösung.
Unter anderem mit Nachweisen zur Cassini-Karte von Frankreich in sehr guter Auflösung.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit ihr hatte sich das Bundesverfassungsgericht zu befassen:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101104_1bvr338908.html
Es wurden erhebliche Verfahrensfehler begangen. Bei interdisziplinären Arbeiten muss für jedes Fachgebiet mindestens ein Gutachter bestellt werden.
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101104_1bvr338908.html
Es wurden erhebliche Verfahrensfehler begangen. Bei interdisziplinären Arbeiten muss für jedes Fachgebiet mindestens ein Gutachter bestellt werden.
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 18:34 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bibliothek der knapp 1200 Jahre alten Reichsabtei Corvey in Höxter geht in Kürze online. Im Rahmen einer Fachtagung soll am 10. Dezember 2010 die Internetplattform "Nova Corbeia - Die virtuelle Bibliothek Corvey" erstmals präsentiert werden.
Das teilte die Universität Paderborn am 8. Dezember 2010 mit. Für das Online-Angebot seien die kostbarsten und wichtigsten Schriften und Bücher digitalisiert worden, um den weltweiten Zugriff für Forschungsvorhaben möglich zu machen. Das Schloss Corvey steht auf der Unesco-Liste der nominierten Welterbestätten. Die Internet-Plattform ist den Angaben nach Teil des Projektes "Kulturerbe - Sakralbauten" am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe Unesco der Universität Paderborn. Dabei wurde die Historie der ehemaligen Reichsabtei für die Öffentlichkeit in Buch-, Bild- und digitalisierter Form neu aufbereitet. So wurde in Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn die ehemalige Klosterbibliothek für den Internetauftritt rekonstruiert.
Corvey war den Angaben nach eines der bedeutendsten karolingischen Klöster, es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes mit herausragenden Objekten der Buch- und Schreibkunst seit der Antike. Zahlreiche Bischöfe gingen aus der Abtei hervor. Auf einer Fachtagung am 10. Dezember 2010 in Paderborn wollen Historiker, Archäologen und Denkmalpfleger die bauhistorische Bedeutung der Klosteranlage mit Blick auf eine Eintragung in die Liste des Weltkulturerbes erörtern.
Quelle: 3sat, Kulturzeit-News vom Donnerstag, 09.12.2010
Update KG: Am Abend des 10.12. ist das Angebot immer noch nicht online, aber immerhin gabs die URL via Twitter
http://www.nova-corbeia.uni-paderborn.de/
Update KG: Dort steht jetzt: Online ab 3. Juni 2011.
Das teilte die Universität Paderborn am 8. Dezember 2010 mit. Für das Online-Angebot seien die kostbarsten und wichtigsten Schriften und Bücher digitalisiert worden, um den weltweiten Zugriff für Forschungsvorhaben möglich zu machen. Das Schloss Corvey steht auf der Unesco-Liste der nominierten Welterbestätten. Die Internet-Plattform ist den Angaben nach Teil des Projektes "Kulturerbe - Sakralbauten" am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe Unesco der Universität Paderborn. Dabei wurde die Historie der ehemaligen Reichsabtei für die Öffentlichkeit in Buch-, Bild- und digitalisierter Form neu aufbereitet. So wurde in Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn die ehemalige Klosterbibliothek für den Internetauftritt rekonstruiert.
Corvey war den Angaben nach eines der bedeutendsten karolingischen Klöster, es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes mit herausragenden Objekten der Buch- und Schreibkunst seit der Antike. Zahlreiche Bischöfe gingen aus der Abtei hervor. Auf einer Fachtagung am 10. Dezember 2010 in Paderborn wollen Historiker, Archäologen und Denkmalpfleger die bauhistorische Bedeutung der Klosteranlage mit Blick auf eine Eintragung in die Liste des Weltkulturerbes erörtern.
Quelle: 3sat, Kulturzeit-News vom Donnerstag, 09.12.2010
Update KG: Am Abend des 10.12. ist das Angebot immer noch nicht online, aber immerhin gabs die URL via Twitter
http://www.nova-corbeia.uni-paderborn.de/
Update KG: Dort steht jetzt: Online ab 3. Juni 2011.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 15:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
"Das Leipziger Bach-Archiv erhält eine wertvolle Privatsammlung zum Schaffen der Söhne Johann Sebastian Bachs. Die Sammlung gehört einem New Yorker Reedereibesitzer und Musikforscher, der sich seit fast 50 Jahren mit den Bach-Söhnen befasst. Er gibt sein Archiv zunächst für zehn Jahre nach Leipzig. Es umfasst zahlreiche Originaldokumente, darunter Noten und Briefe. Eines der wertvollsten Stücke ist die Original-Partitur einer Oper des jüngsten Bach-Sohns, Johann Christian Bach. Sein Werk "Zanaida" galt lange Zeit als verschollen und wurde seit der Uraufführung im Jahr 1763 nicht mehr gespielt."
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 08.12.2010
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 08.12.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 15:31 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Florian Schober aus Bayern gewann in diesem Jahr den Bundeswettbewerb "Jugend forscht" und erhielt zusätzlich eine Reise zu den Feierlichkeiten in Stockholm. Die "Jugend forscht"-Jury hat den 19-Jährigen für sein Biologie-Projekt ausgezeichnet. Er konnte anhand von Flechten nachweisen, wie sich das Klima in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat. Flechten kommen in fast allen Regionen der Erde vor und können sehr alt werden. Sie als Klima-Archiv zu nutzen, könnte die derzeit verbreiteten Analysen ergänzen.
Quelle: WDR, Radio-Nachrichten, 9.12.2010
Quelle: WDR, Radio-Nachrichten, 9.12.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 14:03 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 12:24 - Rubrik: Bestandserhaltung
"Der Einsturz des Historischen Stadtarchivs hat nach Angaben der Stadt Köln bisher Kosten in Höhe von 35 Millionen Euro verursacht. Darin enthalten seien Schadenersatzansprüche, Zahlungen an die Kölner Verkehrsbetriebe und Personalkosten für Überstunden der Archivmitarbeiter. Vier Millionen Euro gingen an die Stiftung Stadtgedächtnis."
Quelle: WDR.de, Studio Köln, NAchrichten, 9.12.2010
Quelle: WDR.de, Studio Köln, NAchrichten, 9.12.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 08:45 - Rubrik: Kommunalarchive
Die französische École National Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) hat im Rahmen ihrer digitalen Bibliothek vor kurzem das Projekt "Les classiques de la bibliothéconomie" online gestellt. Hierbei wurden Referenzwerke der Bibliothekswissenschaften aus dem 17.-20. Jahrhundert digitalisiert und per Volltext durchsuchbar gemacht. Die Digitalisate im PDF-Format finden Sie unter:
http://www.enssib.fr/classiques-bibliotheconomie
Natürlich handelt es sich hierbei überwiegend um französische Texte, es gibt aber auch vereizelte anderssprachige Werke:
"Die Grossen Bibliophilen : Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen" von Gustav Adolph Erich Bogeng (1922, Band 1-3)
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48790
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48791
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48792
"Free Town Libraries : their Formation, Management, and History ; in Britain, France, Germany & America" von Edward Edwards (1869)
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48794
Bernard Linster in INETBIB
http://www.enssib.fr/classiques-bibliotheconomie
Natürlich handelt es sich hierbei überwiegend um französische Texte, es gibt aber auch vereizelte anderssprachige Werke:
"Die Grossen Bibliophilen : Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen" von Gustav Adolph Erich Bogeng (1922, Band 1-3)
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48790
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48791
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48792
"Free Town Libraries : their Formation, Management, and History ; in Britain, France, Germany & America" von Edward Edwards (1869)
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48794
Bernard Linster in INETBIB
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 03:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/dec/23/library-three-jeremiads/?pagination=false
Auszüge aus den drei "Jeremiaden":
[T]he escalation in the price of periodicals forces libraries to cut back on their purchase of monographs; the drop in the demand for monographs makes university presses reduce their publication of them; and the difficulty in getting them published creates barriers to careers among graduate students. [...]
If the monopolies of price-gouging publishers are to be broken, we need more than open-access repositories. We need open-access journals that will be self-sustaining. [...]
Would a Digital Public Library of America solve all the other problems—the inflation of journal prices, the economics of scholarly publishing, the unbalanced budgets of libraries, and the barriers to the careers of young scholars? No. Instead, it would open the way to a general transformation of the landscape in what we now call the information society. Rather than better business plans (not that they don’t matter), we need a new ecology, one based on the public good instead of private gain.
Siehe auch
http://scientopia.org/blogs/bookoftrogool/2010/12/07/the-fourth-jeremiad/
Hier wird zurecht darauf verwiesen, dass eine nationale digitale Bibliothek angesichts des globalen Internets alles andere als eine zukunftsweisende Lösung ist.
Auszüge aus den drei "Jeremiaden":
[T]he escalation in the price of periodicals forces libraries to cut back on their purchase of monographs; the drop in the demand for monographs makes university presses reduce their publication of them; and the difficulty in getting them published creates barriers to careers among graduate students. [...]
If the monopolies of price-gouging publishers are to be broken, we need more than open-access repositories. We need open-access journals that will be self-sustaining. [...]
Would a Digital Public Library of America solve all the other problems—the inflation of journal prices, the economics of scholarly publishing, the unbalanced budgets of libraries, and the barriers to the careers of young scholars? No. Instead, it would open the way to a general transformation of the landscape in what we now call the information society. Rather than better business plans (not that they don’t matter), we need a new ecology, one based on the public good instead of private gain.
Siehe auch
http://scientopia.org/blogs/bookoftrogool/2010/12/07/the-fourth-jeremiad/
Hier wird zurecht darauf verwiesen, dass eine nationale digitale Bibliothek angesichts des globalen Internets alles andere als eine zukunftsweisende Lösung ist.
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 02:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 rabel ist der heute übliche Name des früher als 'Willehalm' bezeichneten Werks des Ulrich von dem Türlin (ja, ich gestehe es, ein Kalauer stand Pate bei der Aufnahme ins Kalenderprogramm).
rabel ist der heute übliche Name des früher als 'Willehalm' bezeichneten Werks des Ulrich von dem Türlin (ja, ich gestehe es, ein Kalauer stand Pate bei der Aufnahme ins Kalenderprogramm). MEISTER VLRICH VON DEM TVRLIN HAT MIH GEMACHET DEM EDELN CVNICH VON BEHEIM - in einem Akrostichon nennt sich der Autor, über den wir nichts weiter wissen, denn die Beziehung zu Heinrich von dem Türlin und zur Familie de Portula in St. Veit an der Glan ist völlig ungesichert (so Werner Schröder im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 10, die betreffende Lieferung erschien 1996). Die Regierungszeit des Böhmenkönigs Ottokar II. (1253-1278) liefert den zeitlichen Rahmen für die Datierung.
Die Arabel liefert die Vorgeschichte zum 'Willehalm' des Wolfram von Eschenbach (das neue Buch von Christoph Gerhardt: Der "Willehalm"-Zyklus, 2010 habe ich ebensowenig in der Hand gehabt wie die Arabel-Ausgabe Werner Schröders von 1999). In den meisten vollständigen Willehalm-Handschriften ist der Text umgeben von der Vorgeschichte (Arabel) und der Fortsetzung (Ulrich von Türheim:Rennewart).
Die alte kritische Ausgabe von Samuel Singer ist online:
http://www.archive.org/details/willehalmeinritt04ulriuoft
Der Handschriftencensus listet 27 Arabel-Textzeugen und behauptet, das sei die gesamte bekannte Überlieferung. Durch einen simplen Blick in eine höchst obskure und entlegene Quelle - das Internet - kann ich eine weitere Handschrift ergänzen (ob es Textzeuge 28 ist, wird man erst sagen können, wenn man ausschließen konnte, dass das hier vorzustellende Fragment zu einer anderen Handschrift gehörte - mit dergleichen Geduldspielen beschäftigt sich aber am liebsten Klaus Klein ...). Zwar ist der Handschriftencensus selbst ein Internetangebot, doch nimmt er nicht sonderlich viel Notiz von anderen Internetangeboten und zeigt auch an Kleinigkeiten (beispielsweise der suchmaschinenunfreundlichen Abkürzung von Bibliothek mit Bibl.), dass er vom WESEN DES INTERNETS kaum etwas begriffen hat.
Das Fragment des Stadtarchivs Feldkirch hätte eigentlich bereits seit 1985, als es in Burmeisters Kulturgeschichte der Stadt Feldkirch abgebildet worden war, bekannt sein können.
Auf den Seiten des Stadtarchivs Feldkirch findet sich die folgende Beschreibung als PDF (Frau Knoll leitet derzeit die Handschriftenabteilung der UB Salzburg):
Fragm. 5.1.2
ULRICH VON DEM TÜRLIN
Pergament · 1 Bl. · ca. (222-228) x (175-178) · Süddeutschland (?), 14. Jh.
Buchblock: Pergamentfragment, als Einband verwendet und abgelöst. Pergament nachgedunkelt, abgestoßen und zerknittert, Textverlust durch Kleber; unregelmäßig beschnitten. Trägercodex unbekannt.
Schrift: Schriftraum zweispaltig: Schriftraumbreite 144, Länge nicht mehr feststellbar; Schriftraum mit Tinte gerahmt; 47 Zeilen auf Tintenlinierung erhalten.
Textualis aus dem 14. Jh. von 1 Hand.
Ausstattung: Rote Auszeichnungsstriche, 4zeilige Lombarden mit kleinen Ornamenten und Rankenausläufern; 4zeilige blaue Lombarden mit roten Ornamenten und Rankenausläufern. Am oberen Blattrand rot ausgezeichnete Satzmajuskeln mit
Masken in schwarzer Tinte.
Geschichte: Der Trägercodex des Fragmentes ist unbekannt.
Literatur: Abgebildet ist das Fragment in: Karl Heinz Burmeister, Geschichte der Stadt Feldkirch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, 1985. S. 84, Abb. 5.
Text: ULRICH VON DEM TÜRLIN: Willehalm (Fragm.) (Ed.: Meister Ulrich von dem Türlîn: Willehalm. Hrsg. v. S. Singer. Prag 1893. Bibliothek der mhd. Litteratur in Böhmen, Bd. 4).
Inc.mut.: … Manig herze wart da wunt / Der gal[...] einú niht genaz ... Expl.mut.: ...
kunegin al die wile slief//
Recto: Abs. 241, letzte Zeile, Abs. 242, Zeile 1 bis Abs. 244, Zeile 31. – Verso: Abs.
245, Zeile 2 bis. Abs. 248, Zeile 1.
© Beatrix Koll, Mai 2006
Auch dieses Pergamentblatt wurde als Einband zweckentfremdet. Das Blatt ist außerdem am unteren Rand vom Buchbinder beschnitten worden, so dass ein Teil des Textes verloren ging. Trotz der Kleberspuren ist aber die Lesbarkeit erhalten geblieben, wir erkennen eine für das 14. Jh. charakteristische Schrift, die sogenannte „Textualis“. Verziert war der ursprüngliche Codex mit roten und blauen Initialen, besonders reizvoll sind die am oberen Blattrand mit Tinte gezeichneten grotesken Gesichter, die
die Anfangsbuchstaben schmücken.
Einer der berühmtesten Dichter des Mittelalters war Wolfram von
Eschenbach, der neben seinem „Parzival“ auch noch den „Willehalm“ verfasste. Dieses Werk beeinflusste auch die Dichter der folgenden Jahrhunderte, darunter Ulrich von dem Türlîn, der zwischen 1252 und 1278 ein gleichnamiges Werk verfasste, das die Vorgeschichte zu Wolframs „Willehalm“ erzählt. Kreuzzugsthematik, Toleranz gegenüber Andersgläubigen und Freude-Leid-Thematik sind die zentralen Aspekte dieses Textes.
Vom Autor Ulrich von dem Türlîn selbst weiß man nicht viel. Man vermutet, dass er aus der Gegend um St. Veit (Kärnten) stammte, es ist aber ungesichert, ob er zu der in St. Veit beurkundeten Familie de Portula gehört. Der Name kommt im 13. Jh. aber auch außerhalb Kärntens vor. Auf Grund von Bemerkungen in seinen Werken hatte er zumindest enge Beziehungen zum Prager Hof, stand vielleicht dort sogar in Diensten.
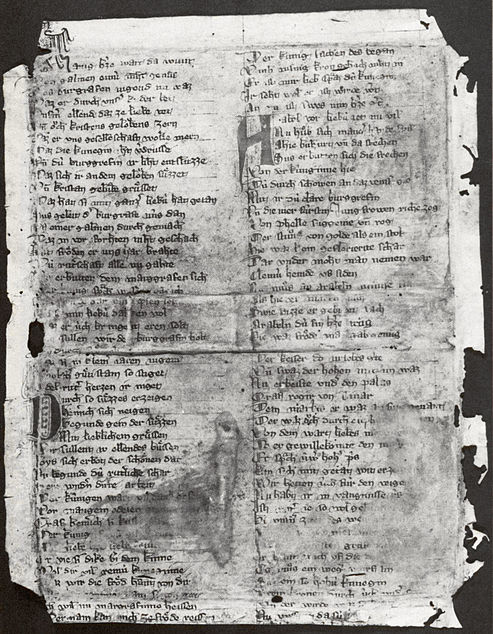 Feldkircher Fragment (aus Burmeister), vergrößerbar unter
Feldkircher Fragment (aus Burmeister), vergrößerbar unterhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arabel_feldkirch.jpg
Weitere Abbildungen zur Arabel-Überlieferung auf Wikimedia-Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ulrich_von_dem_T%C3%BCrlin (Quelle für die Farbabbildungen am Schluss des Beitrags)
Unbrauchbar ist die (im Handschriftencensus wohl zu Recht übergangene) Abbildung in der Objektdatenbank des Deutschen Historischen Museums:
Von den kompletten Handschriften des Werks sind vier online:
Heidelberg, UB, Cpg 395
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg395
Ebenda, Cpg 404
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg404
Kassel, UB, 2° Ms. poet. et roman. 1, der berühmte Willehalm-Codex der Landgrafen von Hessen
http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-02008091949471
Beharrlich weigert sich der Handschriftencensus, die im Digitalen Historischen Archiv Köln digitalisierten Mikrofilme der Sammlung Wallraf (hier angezeigt am 25. April 2010: http://archiv.twoday.net/stories/6308795/ ) zu verlinken - ein erbärmlicher Service für die Wissenschaft!
Die Kölner Handschrift aus der berühmten Blankenheimer Adelsbibliothek ( http://www.handschriftencensus.de/5227 ) vertritt die Mischredaktion *C. Sie ist online einsehbar unter:
http://www.historischesarchivkoeln.de/struktur.php?modus=show&a=4&b=5&c=985&d=4865
 Blankenheimer Handschrift aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv (online: Mikrofilm vor dem Einsturz)
Blankenheimer Handschrift aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv (online: Mikrofilm vor dem Einsturz)An Fragment-Abbildungen sind online:
Berlin, SB, mgf 746
http://www.handschriftencensus.de/1131
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN61754865X&PHYSID=PHYS_0008
Prag, Strahov-Kloster, Zl. 475
http://www.handschriftencensus.de/2112
Wie nicht anders zu erwarten, hat der Handschriftencensus nichts davon mitbekommen, dass dieses Fragment online ist
http://www.manuscriptorium.com (Suche nach: Willehalm)
Yale, Beinecke Library, MS. 486
http://www.mr1314.de/2056
Wie nicht anders zu erwarten, hat der Handschriftencensus nichts davon mitbekommen, dass dieses Fragment online ist
http://beinecke.library.yale.edu/digitallibrary/ (Suche nach: Willehalm)
Nicht verzeichnet ist im Handschriftencensus ( http://www.handschriftencensus.de/6489 ) zu Wien, ÖNB, Cod. 2670 die über http://manuscripta.at/?ID=6917 zugängliche Abbildung aus dem Inventar der datierten Handschriften.
Update: Wie nicht anders zu erwarten, ist dem Handschriftencensus auch das Digitalisat zu http://www.handschriftencensus.de/2056 entgangen:
http://epub.ub.uni-muenchen.de/11787/

Wien, ÖNB, Cod. s.n. 4643 (Wenzels-Werkstatt), Beginn der Arabel (die ganze Seite in Schwarzweiß)
 Heidelberg, UB, Cpg 404, Beginn der Arabel
Heidelberg, UB, Cpg 404, Beginn der Arabel Kasseler Willehalm, Beginn der Arabel
Kasseler Willehalm, Beginn der ArabelAlle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 00:15 - Rubrik: Kodikologie
Viel Material dazu:
http://wynkendeworde.blogspot.com/2010/12/exploring-google-ebook-pricing.html
Besprechungen von Google eBooks sammelt:
http://kindleworld.blogspot.com/2010/12/google-ebooks-and-amazon-kindle-for-web.html
http://wynkendeworde.blogspot.com/2010/12/exploring-google-ebook-pricing.html
Besprechungen von Google eBooks sammelt:
http://kindleworld.blogspot.com/2010/12/google-ebooks-and-amazon-kindle-for-web.html
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 00:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 00:05 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 00:01 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der BGH hatte wegen Übernahme von Markenheftchen-Identitätsnummern zu entscheiden:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=54149&pos=6&anz=66874
Die Entscheidung betrifft auch den Datenbankschutz.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=54149&pos=6&anz=66874
Die Entscheidung betrifft auch den Datenbankschutz.
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 23:57 - Rubrik: Archivrecht
Die FAZ greift den Protest schwedischer Chemiker gegen die Open-Access-Policy des dortigen Wissenschaftsrats auf. Ben Kaden referiert und kommentiert:
http://iuwis.de/blog/das-edukt-zum-edikt-schwedische-wissenschaftler-reagieren-auf-oa-vorgaben-des-vetenskapr%C3%A5det
http://iuwis.de/blog/das-edukt-zum-edikt-schwedische-wissenschaftler-reagieren-auf-oa-vorgaben-des-vetenskapr%C3%A5det
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 23:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://agfnz.historikerverband.de/?p=516 verweist auf
http://lehavre.fr/cartesetplans/
Ärgerlich ist, dass nur ein winziger Streifen mit hoher Auflösung betrachtbar ist. Bleibt zu hoffen, dass es jemandem bald gelingt, dieses Angebot zu "knacken".
Update:
http://toolserver.org/~kolossos/image/zoomify.php?path=http://lehavre.fr/cartesetplans/_images/PFF/CPCH/B763516101_CPCH001&zoom=5
Wie man die Einzelteile zusammensetzt, erklärt
http://de.wikisource.org/wiki/Benutzer:Paulis/Zoomify
http://lehavre.fr/cartesetplans/
Ärgerlich ist, dass nur ein winziger Streifen mit hoher Auflösung betrachtbar ist. Bleibt zu hoffen, dass es jemandem bald gelingt, dieses Angebot zu "knacken".
Update:
http://toolserver.org/~kolossos/image/zoomify.php?path=http://lehavre.fr/cartesetplans/_images/PFF/CPCH/B763516101_CPCH001&zoom=5
Wie man die Einzelteile zusammensetzt, erklärt
http://de.wikisource.org/wiki/Benutzer:Paulis/Zoomify
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Berufungsgericht hatte noch Prüfungspflichten des Archivunternehmens bejaht: Bildagenturen müssten sich ebenso wie Werbeagenturen und Verlage vor der Vervielfältigung und Verbreitung eines Bildnisses darüber informieren, ob eine Einwilligung des Abgebildeten erforderlich ist und ob und in welchem Umfang sie erteilt wurde. Diese Sorgfaltspflicht bestehe auch dann, wenn eine nachträgliche Recherche schwierig und unüblich ist.
Die Frankfurter Richter legten ihrem Urteil einen weiten, sich vom UrhG unterscheidenden Verbreitungsbegriff des § 22 KunstUrhG zugrunde. Eine Verbreitung liege nicht erst vor, wenn Bildnisse an die Öffentlichkeit gelangen, sondern bereits, wenn sie an Dritte weitergegeben oder diesen zugänglich gemacht werden. Diese Auslegung beanstandete der BGH. Der Begriff der Verbreitung nach § 22 KunstUrhG sei vor dem Hintergrund der Pressefreiheit auszulegen. Diese schütze den »gesamten Bereich publizistischer Vorbereitungstätigkeit«. Eine Weitergabe im »quasi presseinternen Bereich« wirke sich nur schwach auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen aus.
http://www.urheberrecht.org/news/4127/
Bislang liegt nur PM vor:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=54280&linked=pm&Blank=1
Anwendung auf Archive liegt nahe: Das Archiv muss bei der Weitergabe von Personenbildnissen an Presseorganen nicht prüfen, ob deren Veröffentlichung rechtmäßig wäre.
Ich sehe keinen Grund, das Ergebnis nicht auch auf das Urheberrecht zu übertragen. Wird zum Zweck der Veröffentlichung ein urheberrechtlich geschütztes Bild verlangt, ist ist die Rechteklärung Sache des Benutzers. Mit Blick auf § 51 UrhG und Art. 5 GG vertrete ich die Ansicht, dass eine Versagung der Kopie unter Berufung auf die Kasuistik des § 53 UrhG nicht erforderlich ist. Da viele Archive das anders sehen (und vor allem die meisten Rechteinhaber) ein Tipp an Benutzer: Veröffentlichungsabsicht verschweigen, ggf. auf Privatkopie § 53 I UrhG berufen. Wer mag kann ja nachträglich die angeblichen "Bildrechte-Gebühren" des Archivs zahlen, aber er hat dann schon mal die Kopie.
Die Frankfurter Richter legten ihrem Urteil einen weiten, sich vom UrhG unterscheidenden Verbreitungsbegriff des § 22 KunstUrhG zugrunde. Eine Verbreitung liege nicht erst vor, wenn Bildnisse an die Öffentlichkeit gelangen, sondern bereits, wenn sie an Dritte weitergegeben oder diesen zugänglich gemacht werden. Diese Auslegung beanstandete der BGH. Der Begriff der Verbreitung nach § 22 KunstUrhG sei vor dem Hintergrund der Pressefreiheit auszulegen. Diese schütze den »gesamten Bereich publizistischer Vorbereitungstätigkeit«. Eine Weitergabe im »quasi presseinternen Bereich« wirke sich nur schwach auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen aus.
http://www.urheberrecht.org/news/4127/
Bislang liegt nur PM vor:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=54280&linked=pm&Blank=1
Anwendung auf Archive liegt nahe: Das Archiv muss bei der Weitergabe von Personenbildnissen an Presseorganen nicht prüfen, ob deren Veröffentlichung rechtmäßig wäre.
Ich sehe keinen Grund, das Ergebnis nicht auch auf das Urheberrecht zu übertragen. Wird zum Zweck der Veröffentlichung ein urheberrechtlich geschütztes Bild verlangt, ist ist die Rechteklärung Sache des Benutzers. Mit Blick auf § 51 UrhG und Art. 5 GG vertrete ich die Ansicht, dass eine Versagung der Kopie unter Berufung auf die Kasuistik des § 53 UrhG nicht erforderlich ist. Da viele Archive das anders sehen (und vor allem die meisten Rechteinhaber) ein Tipp an Benutzer: Veröffentlichungsabsicht verschweigen, ggf. auf Privatkopie § 53 I UrhG berufen. Wer mag kann ja nachträglich die angeblichen "Bildrechte-Gebühren" des Archivs zahlen, aber er hat dann schon mal die Kopie.
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 22:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Debatte unter
http://archiv.twoday.net/stories/11442313/#11445324
Der Strafrechtsprofessor Henning Müller hat sich zum Haftbefehl im Beck-Blog zu Wort gemeldet:
http://blog.beck.de/2010/12/08/europaeischer-haftbefehl-missbrauch-im-fall-assange
In der Tat wäre es wohl eine Illusion anzunehmen, demokratische Staaten würden untereinander jederzeit die Unabhängigkeit ihrer jeweiligen Justizorgane respektieren.
Ob aber im konkreten Fall diplomatischer Druck auf die schwedische Regierung ausgeübt wurde, die Ermittlungen gegen Assange wieder aufzunehmen und einen Europäischen Haftbefehl zu erlassen, ist derzeit noch Spekulation. Deren zukünftige mögliche Bestätigung oder Widerlegung muss wikileaks oder anderen leakern vorbehalten bleiben, der schwedische Außenminister hat entsprechende Vermutungen selbstverständlich zurückgewiesen (Quelle). Aber es ist schon "merkwürdig", dass das aufgrund der Strafanzeigen der beiden Frauen in Schweden aufgenommene Ermittlungsverfahren zunächst noch innerhalb eines Tages eingestellt wurde, um sodann wieder aufgenommen zu werden (Spiegel Online Anfang September).
Die bislang bekannt gewordenen Anschuldigungen [...] würden wohl in den meisten europäischen Ländern den Vorwurf der Vergewaltigung nicht erfüllen; von einer Gewaltanwendung oder -drohung ist jedenfalls bisher nicht die Rede.
Damit kann die hier in den Kommentaren geübte Kritik an Herrn RA vom Hofe zurückgewiesen werden, denn aufgrund meiner bisherigen Kenntnis seiner Beiträge habe ich keinen Zweifel an der Integrität von Professor Müller. Ich denke, die Kritiker von Herrn RA vom Hofe haben ein etwas zu naives Verständnis der konkreten rechtsstaatlichen Praxis in Schweden, das z.B. Prostitution verbietet. Mein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit wendet sich gegen eine Praxis, die die fragwürdigen Maßstäbe eines Landes zur Voraussetzung einer Auslieferung in einem anderen EU-Land macht.
Eine deutschsprachige Darstellung der Vorgänge in Schweden liest sich für mich so, dass die zwei Frauen, mit denen Assange Sex hatten, ihn aus Enttäuschung angezeigt haben:
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Die-Schwedinnen-die-Assange-belasten/story/11722023
Die Frage ist (sie stellt sich ja auch im Fall Kachelmann), wo die Grenze zwischen persönlich extrem abstoßendem und strafbarem Verhalten bei sexuellen Beziehungen verläuft. Für mich steht ebenso wie für RA vom Hofe fest, dass die Kriminalisierung von Assange nach dem Motto erfolgt: "Den Sack schlagen und den Esel meinen", sich also gegen Wikileaks richtet.
Update:
Zum Thema "Chef ausschalten" bietet sich ein alter Vergewaltigungsvorwurf an, den Kachelmann so auch gerne hätte. In Schweden existiert ein internationaler Haftbefehl, weil Julian Assange mit einem defekten Kondom Beischlaf ausübte, was dort auch als Vergewaltigung zählen kann. Dieser Haftbefehl führt nun dazu, dass er in London in Gewahrsam genommen wird, wo er bisher in einem Journalistenclub unterkam. Assange kommt nicht gegen Kaution frei.
Fassen wir zusammen: Wenn es jemand wagen sollte, in der westlichen, freien Welt diplomatische Depechen öffentlich zu machen, dann knipst man ihm den Server aus und nimmt ihm die Gelder und seine Freiheit weg, denn in irgendeinem Land wird er vorher schon strafbaren Sex gehabt haben.
Harald Taglinger in http://www.heise.de/tp/blogs/4/148900
http://archiv.twoday.net/stories/11442313/#11445324
Der Strafrechtsprofessor Henning Müller hat sich zum Haftbefehl im Beck-Blog zu Wort gemeldet:
http://blog.beck.de/2010/12/08/europaeischer-haftbefehl-missbrauch-im-fall-assange
In der Tat wäre es wohl eine Illusion anzunehmen, demokratische Staaten würden untereinander jederzeit die Unabhängigkeit ihrer jeweiligen Justizorgane respektieren.
Ob aber im konkreten Fall diplomatischer Druck auf die schwedische Regierung ausgeübt wurde, die Ermittlungen gegen Assange wieder aufzunehmen und einen Europäischen Haftbefehl zu erlassen, ist derzeit noch Spekulation. Deren zukünftige mögliche Bestätigung oder Widerlegung muss wikileaks oder anderen leakern vorbehalten bleiben, der schwedische Außenminister hat entsprechende Vermutungen selbstverständlich zurückgewiesen (Quelle). Aber es ist schon "merkwürdig", dass das aufgrund der Strafanzeigen der beiden Frauen in Schweden aufgenommene Ermittlungsverfahren zunächst noch innerhalb eines Tages eingestellt wurde, um sodann wieder aufgenommen zu werden (Spiegel Online Anfang September).
Die bislang bekannt gewordenen Anschuldigungen [...] würden wohl in den meisten europäischen Ländern den Vorwurf der Vergewaltigung nicht erfüllen; von einer Gewaltanwendung oder -drohung ist jedenfalls bisher nicht die Rede.
Damit kann die hier in den Kommentaren geübte Kritik an Herrn RA vom Hofe zurückgewiesen werden, denn aufgrund meiner bisherigen Kenntnis seiner Beiträge habe ich keinen Zweifel an der Integrität von Professor Müller. Ich denke, die Kritiker von Herrn RA vom Hofe haben ein etwas zu naives Verständnis der konkreten rechtsstaatlichen Praxis in Schweden, das z.B. Prostitution verbietet. Mein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit wendet sich gegen eine Praxis, die die fragwürdigen Maßstäbe eines Landes zur Voraussetzung einer Auslieferung in einem anderen EU-Land macht.
Eine deutschsprachige Darstellung der Vorgänge in Schweden liest sich für mich so, dass die zwei Frauen, mit denen Assange Sex hatten, ihn aus Enttäuschung angezeigt haben:
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Die-Schwedinnen-die-Assange-belasten/story/11722023
Die Frage ist (sie stellt sich ja auch im Fall Kachelmann), wo die Grenze zwischen persönlich extrem abstoßendem und strafbarem Verhalten bei sexuellen Beziehungen verläuft. Für mich steht ebenso wie für RA vom Hofe fest, dass die Kriminalisierung von Assange nach dem Motto erfolgt: "Den Sack schlagen und den Esel meinen", sich also gegen Wikileaks richtet.
Update:
Zum Thema "Chef ausschalten" bietet sich ein alter Vergewaltigungsvorwurf an, den Kachelmann so auch gerne hätte. In Schweden existiert ein internationaler Haftbefehl, weil Julian Assange mit einem defekten Kondom Beischlaf ausübte, was dort auch als Vergewaltigung zählen kann. Dieser Haftbefehl führt nun dazu, dass er in London in Gewahrsam genommen wird, wo er bisher in einem Journalistenclub unterkam. Assange kommt nicht gegen Kaution frei.
Fassen wir zusammen: Wenn es jemand wagen sollte, in der westlichen, freien Welt diplomatische Depechen öffentlich zu machen, dann knipst man ihm den Server aus und nimmt ihm die Gelder und seine Freiheit weg, denn in irgendeinem Land wird er vorher schon strafbaren Sex gehabt haben.
Harald Taglinger in http://www.heise.de/tp/blogs/4/148900
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 22:15 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Debatte mit Johann Spischak findet hier statt:
http://archiv.twoday.net/stories/8421990/#11445014
http://archiv.twoday.net/stories/8421990/#11445014
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 20:45 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Insbesondere für die Pfalz ist (zusätzlich) ein gedrucktes Klosterbuch mit ausführlicheren Artikeln geplant (Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern). http://www.klosterlexikon-rlp.de/startseite.html
J. Kemper - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 16:21 - Rubrik: Landesgeschichte
"Nach den schweren Schäden an Archivgut durch das Elbehochwasser im Jahr 2002 fand zwei Jahre später eine erste, sensibilisierende Fortbildung zur Notfallprävention und -bewältigung für Archive in Siegen statt. Eine Konsequenz daraus war, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein archivische Notfallboxen für das Kreisarchiv in Siegen und das Stadtarchiv in Bad Berleburg ankaufte. Jetzt veranstalteten Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, und Birgit Geller, Leiterin der Restaurierungswerkstatt des Archivamtes, die zweite Fortbildung dieser Art in Siegen. Inhaltliche Schwerpunkte waren die Bildung von Notfallverbünden sowie praktische Notfallmaßnahmen.

19 Archivare aus Siegen-Wittgenstein und den Nachbarkreisen Olpe bzw. Märkischer Kreis nahmen an dem Seminar teil. Als „Exoten" durfte Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner den Universitätsarchivar aus Köln im Medien- und Kulturhaus Lÿz begrüßen. „Nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln stellt sich für Archive nicht mehr die Frage, ob Notfallvorsorge nötig ist. Es geht vielmehr für jedes einzelne Archiv darum, so rasch wie möglich ein für das eigene Haus maßgeschneidertes Notfallkonzept zu erarbeiten und sich mit anderen in regionalen Notfallverbünden zusammenzuschließen", so Dr. Marcus Stumpf.


Das Seminar führte in die wesentlichen Aspekte der Notfallplanung ein: Dr. Stumpf stellte Methoden der Risikoanalyse und Maßnahmen der Risikominimierung vor. Musteralarmierungs- und Ablaufpläne wurden diskutiert. Ein zweiter Block nahm organisatorische und rechtliche Aspekte bei der Bildung von Notfallverbünden in den Blick. Die bereits bestehenden Notfallverbünde in der Stadt Münster und im Hochtaunuskreis wurden beispielgebend besprochen. Im dritten Teil demonstrierte Birgit Geller konkrete Notfallmaßnahmen aus jüngster Zeit (z. B. Wasserschaden im Stadtarchiv Blomberg im Februar 2010). Zuletzt übten die Teilnehmer das richtige Verpacken von nassem Archivgut. Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmer für die eigene Notfallvorsorge und -planung und für die Mitarbeit in den hier noch zu bildenden, regionalen Notfallverbünden zu rüsten."
Quelle: Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein, 7.12.2010

19 Archivare aus Siegen-Wittgenstein und den Nachbarkreisen Olpe bzw. Märkischer Kreis nahmen an dem Seminar teil. Als „Exoten" durfte Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner den Universitätsarchivar aus Köln im Medien- und Kulturhaus Lÿz begrüßen. „Nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln stellt sich für Archive nicht mehr die Frage, ob Notfallvorsorge nötig ist. Es geht vielmehr für jedes einzelne Archiv darum, so rasch wie möglich ein für das eigene Haus maßgeschneidertes Notfallkonzept zu erarbeiten und sich mit anderen in regionalen Notfallverbünden zusammenzuschließen", so Dr. Marcus Stumpf.


Das Seminar führte in die wesentlichen Aspekte der Notfallplanung ein: Dr. Stumpf stellte Methoden der Risikoanalyse und Maßnahmen der Risikominimierung vor. Musteralarmierungs- und Ablaufpläne wurden diskutiert. Ein zweiter Block nahm organisatorische und rechtliche Aspekte bei der Bildung von Notfallverbünden in den Blick. Die bereits bestehenden Notfallverbünde in der Stadt Münster und im Hochtaunuskreis wurden beispielgebend besprochen. Im dritten Teil demonstrierte Birgit Geller konkrete Notfallmaßnahmen aus jüngster Zeit (z. B. Wasserschaden im Stadtarchiv Blomberg im Februar 2010). Zuletzt übten die Teilnehmer das richtige Verpacken von nassem Archivgut. Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmer für die eigene Notfallvorsorge und -planung und für die Mitarbeit in den hier noch zu bildenden, regionalen Notfallverbünden zu rüsten."
Quelle: Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein, 7.12.2010
Wolf Thomas - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 16:18 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archivistes.blogspot.com/
Nouveau venu dans l'archivoblogosphère, le blog des étudiants du Master Professionnel "Histoire, Patrimoine, Support Virtuel" de l'Université Paris 13.
Nouveau venu dans l'archivoblogosphère, le blog des étudiants du Master Professionnel "Histoire, Patrimoine, Support Virtuel" de l'Université Paris 13.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bilder stehen unter CC-BY-SA
http://www.nai.nl/collectie/bekijk_de_collectie/item/_pid/kolom2-1/_rp_kolom2-1_elementId/1_847089
http://www.digitalearchivaris.nl/2010/12/architectuur-op-flickr.html
http://www.flickr.com/photos/nai_collection/

http://www.nai.nl/collectie/bekijk_de_collectie/item/_pid/kolom2-1/_rp_kolom2-1_elementId/1_847089
http://www.digitalearchivaris.nl/2010/12/architectuur-op-flickr.html
http://www.flickr.com/photos/nai_collection/

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 01:29 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kriegs-recht.de/street-view-entpixelung/
Meine Position zu Streetview ist bekannt: es gibt keinen Anspruch von Hauseigentümern, dass in geobasierten Internetdiensten ihre Häuser nicht gezeigt werden dürfen. Für wissenschaftliche Projekte ergibt sich dies aus der Wissenschaftsfreiheit, für sonstige aus der Meinungs- und Pressefreiheit, unter deren Schutz gerade auch Dokumentationen stehen. Über diese Grundrechte dürfte auch der Gesetzgeber nicht hinweggehen.
Meine Position zu Streetview ist bekannt: es gibt keinen Anspruch von Hauseigentümern, dass in geobasierten Internetdiensten ihre Häuser nicht gezeigt werden dürfen. Für wissenschaftliche Projekte ergibt sich dies aus der Wissenschaftsfreiheit, für sonstige aus der Meinungs- und Pressefreiheit, unter deren Schutz gerade auch Dokumentationen stehen. Über diese Grundrechte dürfte auch der Gesetzgeber nicht hinweggehen.
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 01:20 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 01:17 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 01:06 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 dventskalender ohne Naschwerk ist wie Weihnachten ohne Weihnachtsbaum.
dventskalender ohne Naschwerk ist wie Weihnachten ohne Weihnachtsbaum.2008 gab es Lebkuchen und viele Kochbuch-Links (hervorgehoben sei die auch 2010 erweiterte Seite von Wikisource). 2010 wenden wir uns dem Christstollen zu. Ein Rezept für Dresdner Christstollen gibt es beispielsweise im Adventskalender der EKD, uns interessiert hier aber die Geschichte. Natürlich gibt es im Netz dazu zahlreiche unbelegte Informationen, beispielsweise:
http://petrafoede.de/blog/2010/11/30/kein-weihnachtsfest-ohne-christstollen/
Über die Naumburger Urkunde von 1329 unterrichtet ausführlich das dortige Museum:
In der Werbung und in den Trivialmedien wird oft davon gesprochen, dass der erste "Weihnachtsstollen" aus Naumburg gekommen sei. Was hat es damit auf sich?
Im Jahre 1329 verlieh der Naumburger Bischof den städtischen Bäckern das Innungsprivileg, d.h. das Recht, sich in einer Innung zu organisieren. In diesem Privileg wurde auch festgelegt, dass die Bäcker als Gegenleistung jährliche Geldabgaben zu leisten hatten und darüber hinaus am Christabend dem Bischof zwei große Weizenbrote abliefern sollten: "in vigilia nativitatis Christi duos panes triticeos longos, qui stollen dicuntur, factos ex dimidio scephile tritici – am Heiligen Abend zwei lange Weizenbrote, die man Stollen nennt, aus einem halben Scheffel Weizen hergestellt."
Offenbar ist die lateinische Ausfertigung verschollen, daher muss das Museum eine deutschsprachige Kopie aus dem Stadtarchiv Naumburg abbilden.

Das von Lepsius zitierte Naumburger Kreisblatt 1833 Nr. 46 ist mir leider nicht zugänglich. Die lateinische Stollen-Stelle zitierte übrigens bereits das Glossar von Haltaus 1758.

Foto: Lothar Wilhelm CC-BY-SA
Stollen wurden zu den sogenannten Gebildbroten gezählt. Mit ihnen hat sich die ältere volkskundliche Forschung intensiv befasst - allen voran der Bad Tölzer Arzt Max Höfler (1848-1914). Sein bei Google Book Search digitalisiertes Buch über weihnachtliche Gebildbrote von 1905 ist jetzt auch für Nicht-US-Bürger zu lesen unter:
http://www.archive.org/details/Weihnachtsgebaumlcke
Ecksteins Artikel "Stollen" im HDA ist (derzeit) komplett einsehbar bei Google:
http://books.google.de/books?id=QXxcyXa2_xYC&pg=PA489
Höflers Deutung des Stollens als Phallus wird dort zurecht zurückgewiesen, aber eine moderne unvoreingenommene Untersuchung der Gebildbrote bleibt ein Desiderat der Forschung.
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
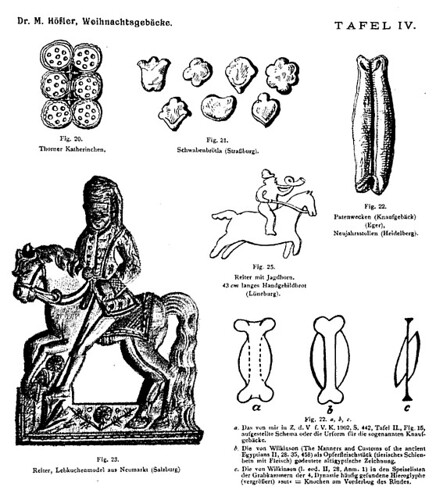
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 00:33 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 00:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wir freuen uns, Sie über unser neues eBook Produkt informieren zu dürfen, welches seit Montag in den USA zugänglich ist. Sie kannten es bisher unter dem Namen Google Editions; der neue Name lautet ab sofort Google eBooks. Zum Starttermin stehen hunderttausende eBooks zum Kauf in den USA bereit.
Ab 2011 wird unsere internetbasierte Verkaufsplattform auch in in Ihrem Land verfügbar sein. Sie können Ihre Bücher allerdings schon jetzt für die Teilnahme vorbereiten.
Um Partner bei Google eBooks zu werden, sollten Sie einer Ergänzung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrem Bücher Konto zustimmen. Diese wird in Kürze in Ihrer Sprache verfügbar sein.
Nachfolgend finden Sie alle erforderlichen Schritte, um eine Teilnahme Ihrer Bücher sicherzustellen.
1. Erstellen Sie eine Liste von Titeln, für welche Sie die digitalen Vertriebsrechte besitzen.
2. Erstellen Sie eine Excel-Tabelle, welche die relevanten Einstellungen für Ihre Bücher abbildet. Hierzu zählen der Katalogpreis (mit oder ohne MwSt), die Gebietsrechte und Einstellungen wie Download mit oder ohne Kopierschutz und welche Kopier-und Druckoptionen präferiert werden.
Sollten Sie nicht über elektronische ISBNs (eISBN) für Ihre Bücher verfügen, wird Google eISBNs für Ihre Bücher bereitstellen können.
3. Erstellen Sie qualitative PDFs und ePubs (offene Standarddatei für digitale Bücher) Ihrer Bücher. Um Ihre Bücher ordnungsgemäß verarbeiten zu können, befolgen Sie bitte unsere Formatierungsrichtlinien unter http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=20028.
Mithilfe von Anwendungen wie InDesign können Sie vorhandene Bücherdateien in das ePub Format konvertieren.
Benennen Sie Ihre ePub Dateien bitte wie folgt: PrintISBN.epub
Sollten Sie die entsprechenden Dateien bereits anders benannt haben, senden Sie uns bitte die Dateinamen zu.
In Kürze werden Sie diese Informationen in Ihrem Bücher-Konto aktualisieren können, sowie weitere Details zur Vorgehensweise erhalten.
In der Zwischenzeit laden wir Sie dazu ein, Ihren Bücherbestand zu aktualisieren und Ihre neuen Titel zur Vorschau auf Google Bücher zu übermitteln. Befolgen Sie hierzu bitte den Schritten unter http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=106169.
Wir freuen uns , Ihnen dieses neue Verkaufsmodell anzubieten und mit Ihnen im nächsten Jahr zusammenzuarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Google Bücher Team
Ab 2011 wird unsere internetbasierte Verkaufsplattform auch in in Ihrem Land verfügbar sein. Sie können Ihre Bücher allerdings schon jetzt für die Teilnahme vorbereiten.
Um Partner bei Google eBooks zu werden, sollten Sie einer Ergänzung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrem Bücher Konto zustimmen. Diese wird in Kürze in Ihrer Sprache verfügbar sein.
Nachfolgend finden Sie alle erforderlichen Schritte, um eine Teilnahme Ihrer Bücher sicherzustellen.
1. Erstellen Sie eine Liste von Titeln, für welche Sie die digitalen Vertriebsrechte besitzen.
2. Erstellen Sie eine Excel-Tabelle, welche die relevanten Einstellungen für Ihre Bücher abbildet. Hierzu zählen der Katalogpreis (mit oder ohne MwSt), die Gebietsrechte und Einstellungen wie Download mit oder ohne Kopierschutz und welche Kopier-und Druckoptionen präferiert werden.
Sollten Sie nicht über elektronische ISBNs (eISBN) für Ihre Bücher verfügen, wird Google eISBNs für Ihre Bücher bereitstellen können.
3. Erstellen Sie qualitative PDFs und ePubs (offene Standarddatei für digitale Bücher) Ihrer Bücher. Um Ihre Bücher ordnungsgemäß verarbeiten zu können, befolgen Sie bitte unsere Formatierungsrichtlinien unter http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=20028.
Mithilfe von Anwendungen wie InDesign können Sie vorhandene Bücherdateien in das ePub Format konvertieren.
Benennen Sie Ihre ePub Dateien bitte wie folgt: PrintISBN.epub
Sollten Sie die entsprechenden Dateien bereits anders benannt haben, senden Sie uns bitte die Dateinamen zu.
In Kürze werden Sie diese Informationen in Ihrem Bücher-Konto aktualisieren können, sowie weitere Details zur Vorgehensweise erhalten.
In der Zwischenzeit laden wir Sie dazu ein, Ihren Bücherbestand zu aktualisieren und Ihre neuen Titel zur Vorschau auf Google Bücher zu übermitteln. Befolgen Sie hierzu bitte den Schritten unter http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=106169.
Wir freuen uns , Ihnen dieses neue Verkaufsmodell anzubieten und mit Ihnen im nächsten Jahr zusammenzuarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Google Bücher Team
KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 00:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am Schluss eines sehr guten und umfangreichen Beitrags zu Wikileaks kommt Star-Blawger Udo Vetter auch auf das Urheberrecht zu sprechen:
Bleibt als Unsicherheitsfaktor noch das Urheberrecht. Zumindest fürs nichtbetroffene Publikum wäre es natürlich eine reizvolle Vorstellung, dass Hillary Clinton am Landgericht Hamburg klagt. Es dürften aber noch erhebliche Rückschläge für die US-Administration nötig sein, bevor sie sich auf dieses glatte Terrain begibt. Rutschgefahr deswegen, weil Behördendokumente in den USA und Deutschland urheberrechtlich viel weniger geschützt sind, sagen wir, das Drehbuch für die Fernsehserie “24″.
Das ist natürlich sehr ungenau. Wie aus den Kommentaren zu ersehen, sind ALLE Berichte von Botschaftsangestellten in den USA urheberrechtlich nicht geschützt, also Public Domain.
Wenn http://www.quantenblog.net/free-software/us-copyright-international feststellt, dass diese Werke, sofern sie denn die nötige Schöpfungshöhe erreichen, was nur bei ausführlicheren Berichten vorausgesetzt werden kann, im Ausland nach dem jeweiligen Inhaltsurheberrecht geschützt sind, also in Deutschland dem normalen Urheberrecht unterliegen, so ist das zutreffend. Nicht folgen möchte ich dem rat, dass freie Projekte auf die Nutzung verzichten sollten. Die Wikimedia-Projekte vertrauen bislang darauf, dass die US-Bundesregierung außerhalb der USA das Urheberrecht nicht beansprucht.
Siehe dazu
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2004/09/copyright_in_go.html
Bleibt als Unsicherheitsfaktor noch das Urheberrecht. Zumindest fürs nichtbetroffene Publikum wäre es natürlich eine reizvolle Vorstellung, dass Hillary Clinton am Landgericht Hamburg klagt. Es dürften aber noch erhebliche Rückschläge für die US-Administration nötig sein, bevor sie sich auf dieses glatte Terrain begibt. Rutschgefahr deswegen, weil Behördendokumente in den USA und Deutschland urheberrechtlich viel weniger geschützt sind, sagen wir, das Drehbuch für die Fernsehserie “24″.
Das ist natürlich sehr ungenau. Wie aus den Kommentaren zu ersehen, sind ALLE Berichte von Botschaftsangestellten in den USA urheberrechtlich nicht geschützt, also Public Domain.
Wenn http://www.quantenblog.net/free-software/us-copyright-international feststellt, dass diese Werke, sofern sie denn die nötige Schöpfungshöhe erreichen, was nur bei ausführlicheren Berichten vorausgesetzt werden kann, im Ausland nach dem jeweiligen Inhaltsurheberrecht geschützt sind, also in Deutschland dem normalen Urheberrecht unterliegen, so ist das zutreffend. Nicht folgen möchte ich dem rat, dass freie Projekte auf die Nutzung verzichten sollten. Die Wikimedia-Projekte vertrauen bislang darauf, dass die US-Bundesregierung außerhalb der USA das Urheberrecht nicht beansprucht.
Siehe dazu
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2004/09/copyright_in_go.html
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 23:55 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In collaboration with the Senate
House Library at the University of London, the Schoenberg Center for Electronic
Text & Image at the University of Pennsylvania is pleased to announce the
creation of the Seymour de Ricci Bibliotheca Britannica Manuscripta Digitized
Archive, a corollary project to the Schoenberg Database of Manuscripts.
The archive is a searchable database
containing the digitized notes of the historian and bibliographer Seymour
Montefiore Robert Rosso de Ricci (1881-1942) made for the compilation of his
unfinished census of pre-1800 manuscripts in Great Britain and Northern Ireland. De Ricci's notes, compiled in thirty-four
boxes containing over 60,000 index cards are currently housed in the Senate
House Library. The first cards are now available online in downloadable pdf
format. More will become available as they are scanned and processed. New cards
will be added daily until the project is completed in the Summer of 2011.
http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/index.html
http://sceti.library.upenn.edu/dericci/browse.cfm
Der Wert dieser Notizen erscheint mir nach einigen Stichproben doch als äußerst begrenzt.
House Library at the University of London, the Schoenberg Center for Electronic
Text & Image at the University of Pennsylvania is pleased to announce the
creation of the Seymour de Ricci Bibliotheca Britannica Manuscripta Digitized
Archive, a corollary project to the Schoenberg Database of Manuscripts.
The archive is a searchable database
containing the digitized notes of the historian and bibliographer Seymour
Montefiore Robert Rosso de Ricci (1881-1942) made for the compilation of his
unfinished census of pre-1800 manuscripts in Great Britain and Northern Ireland. De Ricci's notes, compiled in thirty-four
boxes containing over 60,000 index cards are currently housed in the Senate
House Library. The first cards are now available online in downloadable pdf
format. More will become available as they are scanned and processed. New cards
will be added daily until the project is completed in the Summer of 2011.
http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/index.html
http://sceti.library.upenn.edu/dericci/browse.cfm
Der Wert dieser Notizen erscheint mir nach einigen Stichproben doch als äußerst begrenzt.
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 18:13 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine sehr praktische Handreichung, ausgehend von den Erfahrungen mit den Katalogen von Herzogenburg und Stams:
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/low-budget-konzept-zur-online-inventarisierung-von-kleinsammlungen.pdf
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/low-budget-konzept-zur-online-inventarisierung-von-kleinsammlungen.pdf
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 18:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige Fragmente zu Handschriftenbeständen auf dem Stand von 2008:
http://www.handschriftencensus-rlp.mediaevistik.uni-mainz.de/
Für die Erarbeitung dieser spärlichen Mustereinträge wurden vermutlich Unsummen an öffentlichen Geldern ausgegeben!
http://www.handschriftencensus-rlp.mediaevistik.uni-mainz.de/
Für die Erarbeitung dieser spärlichen Mustereinträge wurden vermutlich Unsummen an öffentlichen Geldern ausgegeben!
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 16:55 - Rubrik: Kodikologie
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 12:36 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Archive sind eine Fundgrube für Forscher, können aber auch Kindern und Jugendlichen einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte eröffnen. Wie die Zusammenarbeit von Schulen und Archiven erfolgreich gestaltet werden kann, darüber haben sich jetzt rund 40 Fachleute in Borken informiert. Im Stadtmuseum Borken diskutierten sie, wie sich Materialien und Knowhow von Archiven, Museen und Heimatvereinen für den Unterricht oder Projekte in Grund- und weiterführenden Schulen nutzen lassen. Das Bildungsbüro des Kreises Borken hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts "Lernen vor Ort" will es mehr Schulen für die Kooperation mit Archiven begeistern.
Unterstützung kommt dazu von der Körber-Stiftung aus Hamburg. Sven Tetzlaff und Jula Pötter skizzierten, was zur Verbesserung der Zusammenarbeit nötig ist. Schulen müssten klar formulieren, wie sie sich eine Integration der Angebote in ihren Lehrplan vorstellen können. Und Archiven, Museen und Gedenkstätten seien gefordert, sich stärker ins Blickfeld der Schulen zu rücken. Die Körber-Stiftung unterstützt die Entwicklung von "Historischen ernlandschaften". Chancen sieht sie vor allem darin, dass in den ommunen "Dreiklänge" in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Schulen und Lernorten entstehen.
Referenten stellten beim Treffen in Borken eine ganze Reihe gelungener Beispiele aus der Praxis vor. Roswitha Link vom Stadtarchiv Münster gab Hinweise, wie Archive sich auf den Besuch von Schülerinnen und Schülern vorbereiten sollten und wie sie auf ihre Angebote aufmerksam machen können. "Die Zusammenarbeit fängt klein an und muss dann weiter wachsen", so Link. "Wir entwickeln unsere Angebote in enger Abstimmung mit den Lehrern."
Wie das Stadtarchiv Zutphen junge Nutzer gewinnt, erklärte Femia Siero, heute Leiterin des "Streekarchief Regio Achterhoek". Ihre Empfehlung: Lehrer müssen klar benennen, welche Angebote benötigt werden. Wie sich alte Schriften entziffern lassen, das lernen Schülerinnen und Schüler im Stadtarchiv Gescher. Andreas Froning nutzt die Kalligraphie, um Kinder und Jugendliche für die historische Entwicklung der Schrift zu interessieren. Er möchte erreichen, dass bereits jeder Grundschüler einmal ein Archiv besucht hat.
Einen Blick über die Grenze wagten die Teilnehmer mit Sixtina Harris, Vorsitzende der niederländischen "Stichting Vrienden van Kolle Kaal". Sie erläuterte, wie sie in Winterswijk gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Spuren jüdischen Lebens nachgeht. Für den Leiter des Gymnasiums Georgianum in Vreden, Bernd Telgmann, ist unabdingbar, dass Schüler in den Archiven neue Kompetenzen hinzugewinnen. Eine frühzeitige Abstimmung mit den schulinternen Lernplänen sei deshalb unerlässlich.
Das Treffen in Borken war Auftakt für den Ausbau der Kooperationen von Schulen und Einrichtungen, die das historische Gedächtnis der Region wach halten. Das Bildungsbüro des Kreises wird nun die Informationen zu den bereits bestehenden Angeboten zusammentragen. "Die Auftaktveranstaltung hat gezeigt, dass es vor allem an der gegenseitigen Information mangelt", erklärt Projektleiterin Nicole Brögmann. "Transparenz auf beiden Seiten und das zukünftige Miteinander sollen nun in einzelnen Modellprojekten erprobt werden." Die Körber-Stiftung wird den Prozess weiter begleiten."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Unterstützung kommt dazu von der Körber-Stiftung aus Hamburg. Sven Tetzlaff und Jula Pötter skizzierten, was zur Verbesserung der Zusammenarbeit nötig ist. Schulen müssten klar formulieren, wie sie sich eine Integration der Angebote in ihren Lehrplan vorstellen können. Und Archiven, Museen und Gedenkstätten seien gefordert, sich stärker ins Blickfeld der Schulen zu rücken. Die Körber-Stiftung unterstützt die Entwicklung von "Historischen ernlandschaften". Chancen sieht sie vor allem darin, dass in den ommunen "Dreiklänge" in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Schulen und Lernorten entstehen.
Referenten stellten beim Treffen in Borken eine ganze Reihe gelungener Beispiele aus der Praxis vor. Roswitha Link vom Stadtarchiv Münster gab Hinweise, wie Archive sich auf den Besuch von Schülerinnen und Schülern vorbereiten sollten und wie sie auf ihre Angebote aufmerksam machen können. "Die Zusammenarbeit fängt klein an und muss dann weiter wachsen", so Link. "Wir entwickeln unsere Angebote in enger Abstimmung mit den Lehrern."
Wie das Stadtarchiv Zutphen junge Nutzer gewinnt, erklärte Femia Siero, heute Leiterin des "Streekarchief Regio Achterhoek". Ihre Empfehlung: Lehrer müssen klar benennen, welche Angebote benötigt werden. Wie sich alte Schriften entziffern lassen, das lernen Schülerinnen und Schüler im Stadtarchiv Gescher. Andreas Froning nutzt die Kalligraphie, um Kinder und Jugendliche für die historische Entwicklung der Schrift zu interessieren. Er möchte erreichen, dass bereits jeder Grundschüler einmal ein Archiv besucht hat.
Einen Blick über die Grenze wagten die Teilnehmer mit Sixtina Harris, Vorsitzende der niederländischen "Stichting Vrienden van Kolle Kaal". Sie erläuterte, wie sie in Winterswijk gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Spuren jüdischen Lebens nachgeht. Für den Leiter des Gymnasiums Georgianum in Vreden, Bernd Telgmann, ist unabdingbar, dass Schüler in den Archiven neue Kompetenzen hinzugewinnen. Eine frühzeitige Abstimmung mit den schulinternen Lernplänen sei deshalb unerlässlich.
Das Treffen in Borken war Auftakt für den Ausbau der Kooperationen von Schulen und Einrichtungen, die das historische Gedächtnis der Region wach halten. Das Bildungsbüro des Kreises wird nun die Informationen zu den bereits bestehenden Angeboten zusammentragen. "Die Auftaktveranstaltung hat gezeigt, dass es vor allem an der gegenseitigen Information mangelt", erklärt Projektleiterin Nicole Brögmann. "Transparenz auf beiden Seiten und das zukünftige Miteinander sollen nun in einzelnen Modellprojekten erprobt werden." Die Körber-Stiftung wird den Prozess weiter begleiten."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 12:18 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/8470466/ und Kommentare.
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 03:27 - Rubrik: Staatsarchive
http://www.japanairraids.org/
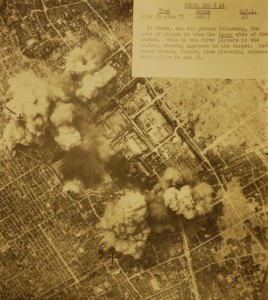
Via
http://mdn.mainichi.jp/features/news/20101206p2a00m0na020000c.html
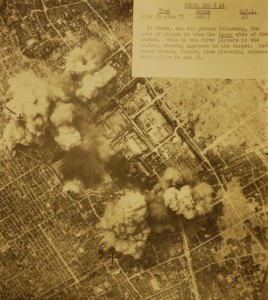
Via
http://mdn.mainichi.jp/features/news/20101206p2a00m0na020000c.html
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 01:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 rchivbauten können durchaus fesseln, wie wir aus der vor allem von Thomas Wolf betreuten Rubrik mit eindrucksvollen Fotos von Archivbauten aus aller Zeit wissen:
rchivbauten können durchaus fesseln, wie wir aus der vor allem von Thomas Wolf betreuten Rubrik mit eindrucksvollen Fotos von Archivbauten aus aller Zeit wissen:http://archiv.twoday.net/topics/Archivbau/
Heute möchte ich auf eine kaum bekannte historische visuelle Quelle für Archivbauten aufmerksam machen, die online vorliegt. Sucht man im Online-Katalog des Architekturmuseums der TU Berlin nach dem Stichwort Staatsarchiv, erhält man 106 Treffer. Es handelt sich um Digitalisate von Grund- und Aufrissen, manchmal auch von Fotos der preußischen Staatsarchive aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie ermöglichen eine spannende archivbaugeschichtliche Entdeckungsreise. Die einzelnen Zeichnungen sind mit Zoomify genau in Augenschein zu nehmen.
Antikisch: Wie sich Johannes Baltzer (1862-1940) 1885 den Eingangsbereich eines Staatsarchivs vorstellte.
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=84410
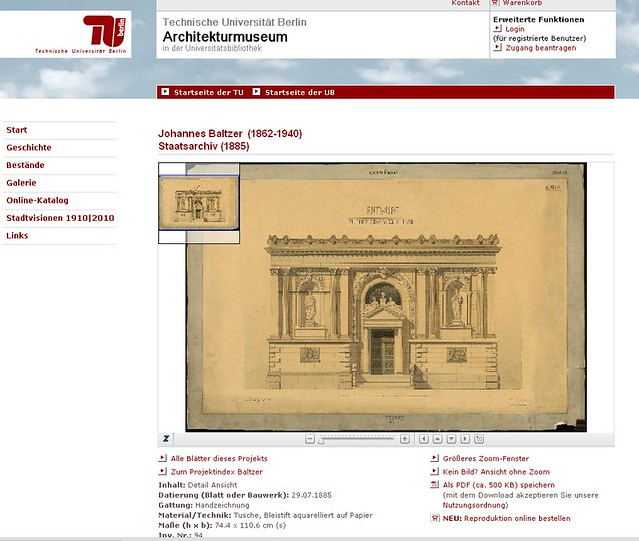
Erhaben: Eduard August Wilhelm Fürstenau (1862-1938): Preußisches Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem. Verwaltungsgebäude (1914-1924)
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=126307

Feudal: Das Staatsarchiv Koblenz war im ehemaligen Deutschordenshaus (seit 1992 Ludwigmuseum) untergebracht. Feudal auch die Wohnung des Archivdieners (1898):
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=123941 (hier ein Ausschnitt daraus)
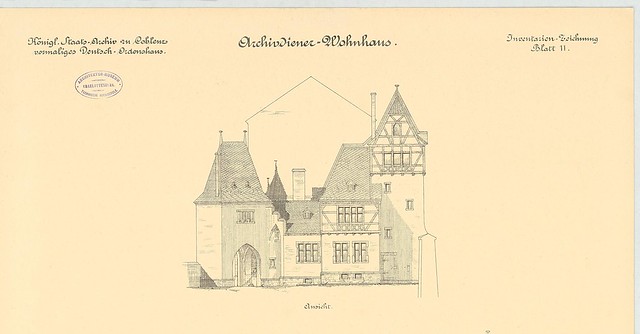
Pittoresk: Moselansicht des Staatsarchivs:
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=123940
Rheinansicht:
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=123939
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gs.uni-hd.de/md/neuphil/gs/personen/klingner_geborgene_schaetze_2008.pdf
Mein Dank gilt Herrn Klingner, dass er die unter http://archiv.twoday.net/stories/8474674/ angezeigte Publikation in der ARX 2008 online verfügbar gemacht hat!
Mein Dank gilt Herrn Klingner, dass er die unter http://archiv.twoday.net/stories/8474674/ angezeigte Publikation in der ARX 2008 online verfügbar gemacht hat!
KlausGraf - am Dienstag, 7. Dezember 2010, 00:57 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.emeraldinsight.com/promo/xmas.html
Es gibt ein paar englischsprachige Zeitschriftenartikel zu Weihnachten im Dezember kostenlos zu lesen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es ganze 8 (in Worten: acht).
Es gibt ein paar englischsprachige Zeitschriftenartikel zu Weihnachten im Dezember kostenlos zu lesen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es ganze 8 (in Worten: acht).
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 23:01 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitalbevaring.dk/
Eine dänische Seite zur Bestandserhaltung digitaler Daten (digital preservation).
Eine dänische Seite zur Bestandserhaltung digitaler Daten (digital preservation).
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 22:57 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=10631 mit zahlreichen weiteren Links.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Googles-E-Book-Plattform-geht-online-1148182.html
http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/62401
Wer etwas über die Preise wissen will, muss einen US-Proxy benützen z.B. http://uethelp.us
Mark Twains Autobiographie Bd. 1 kostet bei Amazon 19,72 $, bei Google 9,72 $.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Googles-E-Book-Plattform-geht-online-1148182.html
http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/62401
Wer etwas über die Preise wissen will, muss einen US-Proxy benützen z.B. http://uethelp.us
Mark Twains Autobiographie Bd. 1 kostet bei Amazon 19,72 $, bei Google 9,72 $.
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 22:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Macht der Bilder gelingt es zuweilen, aus einem Menschen, der aufklären und aufhellen möchte, einen Verbrechertypus zu destillieren. Dabei verunziert man das Konterfei des Kriminalisierten mit Verschlagenheit, macht aus ihm eine nebulöse Erscheinung, gibt ihm den Anstrich lichtscheuen Gesindels. Julian Assange wird mit getönten Brillengläsern ausgestattet, just in dem Augenblick, da Interpol mit einem internationalen Haftbefehl wedelt.
http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/12/facie-prima.html

http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/12/facie-prima.html

KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 22:28 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
Ein neues Buch dazu bespricht:
iuwis.de/blog/aus-der-literatur-winfried-bullingermarkus-bretzel-j%C3%B6rg-schmalfu%C3%9F-hrsg-urheberrechte-museen-und
[Mai 2011: nicht mehr erreichbar]
iuwis.de/blog/aus-der-literatur-winfried-bullingermarkus-bretzel-j%C3%B6rg-schmalfu%C3%9F-hrsg-urheberrechte-museen-und
[Mai 2011: nicht mehr erreichbar]
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 22:20 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einen liebevollen Blogeintrag bei
http://historikerkraus.de/blog/?p=565
möchte ich nicht unverlinkt lassen.

http://historikerkraus.de/blog/?p=565
möchte ich nicht unverlinkt lassen.

KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 22:13 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliothekarisch.de/blog/2010/12/06/es-gilt-noch-viele-probleme-bei-der-deutschen-digitalen-bilbliothek-zu-loesen/
Kritisch äußerte sich z.B. der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Prof. Hermann Parzinger zu dem Gedanken, alles kostenfrei zugänglich zu machen. Er benötigt eine Refinanzierung der Angebote, um seine Objekte zugänglich und erhalten zu können.
Kritisch äußerte sich z.B. der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Prof. Hermann Parzinger zu dem Gedanken, alles kostenfrei zugänglich zu machen. Er benötigt eine Refinanzierung der Angebote, um seine Objekte zugänglich und erhalten zu können.
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 21:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fotostoria.de/?p=1391 macht auf die niederländische Daguerrobase aufmerksam, ein Katalogisierungs-Tool für registrierte Mitglieder, das teilweise auch brauchbare Abbildungen enthält:
http://www.daguerreobase.org

http://www.daguerreobase.org/component/nfmdag_daguerreobase/?view=show&layout=detail&limit=10&id=492&start=10 (dauerhafte URL fehlt!)
http://www.daguerreobase.org

http://www.daguerreobase.org/component/nfmdag_daguerreobase/?view=show&layout=detail&limit=10&id=492&start=10 (dauerhafte URL fehlt!)
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 21:35 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erfahrungen mit einem Ebook der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft:
http://blog.arthistoricum.net/ebook/
http://blog.arthistoricum.net/ebook/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.provinz.bz.it/katalog-kulturgueter
Was diese winzigen briefmarkengroßen Abbildungen (vor allem aus Museumsbeständen, als ob es in Archiven und Bibliotheken keine Kulturgüter geben würde) wohl sollen? Sagen sie etwa: Ätsch, komm doch selbst nach Südtirol, Teil eines immer faschistoideren Italien?
 Originalgröße
Originalgröße
Was diese winzigen briefmarkengroßen Abbildungen (vor allem aus Museumsbeständen, als ob es in Archiven und Bibliotheken keine Kulturgüter geben würde) wohl sollen? Sagen sie etwa: Ätsch, komm doch selbst nach Südtirol, Teil eines immer faschistoideren Italien?
 Originalgröße
OriginalgrößeKlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 21:22 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.neunetz.com/2010/12/04/wikileaks-dokumente-bestaetigen-dass-usa-das-geplante-spanische-urheberrechtsgesetz-geschrieben-haben/
http://www.boingboing.net/2010/12/03/wikileaks-cables-rev.html
"Spain's Congress is about to vote on a new and extremely harsh copyright/Internet law. It's an open secret that the law was essentially drafted by American industry groups working with the US trade representative."
http://www.boingboing.net/2010/12/03/wikileaks-cables-rev.html
"Spain's Congress is about to vote on a new and extremely harsh copyright/Internet law. It's an open secret that the law was essentially drafted by American industry groups working with the US trade representative."
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 18:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://relevant.at/kultur/musik/54696/singende-moenche-vom-lavanttal.story
Die Erlöse der CD-Verkäufe sollen der maroden elektropneumatischen Mathis-Orgel zugutekommen. Nichts hingegen habe das CD-Projekt mit den vermeintlichen Finanzproblemen der Benediktiner aus St. Paul zu tun, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen sorgten. Das Stift - Heimat zahlreicher wertvoller Handschriften und Gemälde - möchte neun Handschriften versteigern lassen, was einen Millionenerlös bringen könnte. Dagegen regte sich Protest des Bundesdenkmalamts und des Kärntens Bischof Alois Schwarz.
Es gehe hierbei um grundsätzliche Fragen, unterstrich Dekan Stattmann am Freitag. Man wolle als "Eigentümer von Ressourcen" die Möglichkeit, mit diesen umzugehen wie jeder andere auch: "Es ist unser grundsätzlicher Entschluss: Wir möchten in Zukunft wirtschaftlich verantwortlich arbeiten - unabhängig davon, ständig als Bittsteller vor Bürotüren zu stehen und von der Gunst mancher Leute abhängig zu sein." Dies sei in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und im hintersten Kärnten einfach ein Gebot der Stunde. Die Handschriften gingen schließlich nicht verloren: "Wir werfen das ja nicht in den Müll - sie kommen in ein großes Museum, wo sie jeder sehen kann."
Vielleicht sollte man den Dekan darauf hinweisen, dass "Du sollst nicht lügen" auch im Advent gilt, wenn schon in erbärmlicher Weise die Verantwortung für kirchliches Kulturgut mit Füßen getreten wird. Bei Versteigerungen kann man nie sagen, wer das Stück erhält, ob ein großes Museum (denkbar) oder ein Privatsammler (wahrscheinlich), der es in seinem Safe für nicht absehbare Zeit verschwinden lässt.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/8426
Die Erlöse der CD-Verkäufe sollen der maroden elektropneumatischen Mathis-Orgel zugutekommen. Nichts hingegen habe das CD-Projekt mit den vermeintlichen Finanzproblemen der Benediktiner aus St. Paul zu tun, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen sorgten. Das Stift - Heimat zahlreicher wertvoller Handschriften und Gemälde - möchte neun Handschriften versteigern lassen, was einen Millionenerlös bringen könnte. Dagegen regte sich Protest des Bundesdenkmalamts und des Kärntens Bischof Alois Schwarz.
Es gehe hierbei um grundsätzliche Fragen, unterstrich Dekan Stattmann am Freitag. Man wolle als "Eigentümer von Ressourcen" die Möglichkeit, mit diesen umzugehen wie jeder andere auch: "Es ist unser grundsätzlicher Entschluss: Wir möchten in Zukunft wirtschaftlich verantwortlich arbeiten - unabhängig davon, ständig als Bittsteller vor Bürotüren zu stehen und von der Gunst mancher Leute abhängig zu sein." Dies sei in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und im hintersten Kärnten einfach ein Gebot der Stunde. Die Handschriften gingen schließlich nicht verloren: "Wir werfen das ja nicht in den Müll - sie kommen in ein großes Museum, wo sie jeder sehen kann."
Vielleicht sollte man den Dekan darauf hinweisen, dass "Du sollst nicht lügen" auch im Advent gilt, wenn schon in erbärmlicher Weise die Verantwortung für kirchliches Kulturgut mit Füßen getreten wird. Bei Versteigerungen kann man nie sagen, wer das Stück erhält, ob ein großes Museum (denkbar) oder ein Privatsammler (wahrscheinlich), der es in seinem Safe für nicht absehbare Zeit verschwinden lässt.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/8426
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich habe zwar schon wiederholt die Frage gestellt, wie man auf die Idee kommen kann, einen Archivzweckbau in einer klassischen Gefahrenlage, nämlich in unmittelbarer Nähe des Rheins, zu planen, aber ich bin anscheinend ziemlich der einzige, der sich diese Frage stellt. Kuschen alle vor Reininghaus und der NRW-Regierung?
Thomas Wolf, hier bekannt als Wolf Thomas, verwies gerade in Twitter auf einen Wikipedia-Artikel:
Bei der Lage eines Gebäudes sollten folgende Aspekte beachtet werden:
keine Gefahr durch Überschwemmungen, Erdrutsche oder anderen Naturkatastrophen
keine feuer- und explosionsgefährlichen Anlagen im Umfeld (z.B. auch Tankstellen)
keine Fabriken und Industrieeinrichtungen in der Nähe, die schädliche Gase, Rauch oder Staub ausstoßen
keine möglichen militärischen Ziele in der Umgebung
schnelle Erreichbarkeit des Geländes für die Feuerwehr
Ausrichtung der Räume nach Norden zur Reduzierung der Sonneneinwirkung
Zufahrtsmöglichkeit für LKW zum Gebäude und ausreichend Transportwege auf dem Gelände
Angrenzende Reserveflächen für spätere Erweiterungsbauten
[Update: Abgeschrieben aus: http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/Archivmagazin_Glauert.pdf ]
http://de.wikipedia.org/wiki/Archivzweckbau
Bedenklich ist schon die generelle Entscheidung für Duisburg statt Düsseldorf. Es entstehen bei Transporten aus den Ministerien erhöhte Kosten, beeinträchtigt wird auch die rasche Erreichbarkeit der Düsseldorfer Ministerien durch Mitarbeiter des Landesarchivs.
An die Nutzer, die nun auf die gute Düsseldorfer Archiv- und Bibliotheksinfrastruktur verzichten müssen, hat auch niemand gedacht.
Anschrift für den Routenplaner:
Schifferstraße 30-32 (? http://www.kulturkanal.net/sehenswuerdigkeiten nennt Schifferstraße 100 als Anschrift)
StreetView:
Größere Kartenansicht

Quelle: http://www.rp-online.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Landesarchiv-Ruettgers-setzt-Spatenstich_aid_843278.html
Thomas Wolf, hier bekannt als Wolf Thomas, verwies gerade in Twitter auf einen Wikipedia-Artikel:
Bei der Lage eines Gebäudes sollten folgende Aspekte beachtet werden:
keine Gefahr durch Überschwemmungen, Erdrutsche oder anderen Naturkatastrophen
keine feuer- und explosionsgefährlichen Anlagen im Umfeld (z.B. auch Tankstellen)
keine Fabriken und Industrieeinrichtungen in der Nähe, die schädliche Gase, Rauch oder Staub ausstoßen
keine möglichen militärischen Ziele in der Umgebung
schnelle Erreichbarkeit des Geländes für die Feuerwehr
Ausrichtung der Räume nach Norden zur Reduzierung der Sonneneinwirkung
Zufahrtsmöglichkeit für LKW zum Gebäude und ausreichend Transportwege auf dem Gelände
Angrenzende Reserveflächen für spätere Erweiterungsbauten
[Update: Abgeschrieben aus: http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/Archivmagazin_Glauert.pdf ]
http://de.wikipedia.org/wiki/Archivzweckbau
Bedenklich ist schon die generelle Entscheidung für Duisburg statt Düsseldorf. Es entstehen bei Transporten aus den Ministerien erhöhte Kosten, beeinträchtigt wird auch die rasche Erreichbarkeit der Düsseldorfer Ministerien durch Mitarbeiter des Landesarchivs.
An die Nutzer, die nun auf die gute Düsseldorfer Archiv- und Bibliotheksinfrastruktur verzichten müssen, hat auch niemand gedacht.
Anschrift für den Routenplaner:
Schifferstraße 30-32 (? http://www.kulturkanal.net/sehenswuerdigkeiten nennt Schifferstraße 100 als Anschrift)
StreetView:
Größere Kartenansicht

Quelle: http://www.rp-online.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Landesarchiv-Ruettgers-setzt-Spatenstich_aid_843278.html
http://blog.wikimedia.de/2010/12/06/wissenswert-ergebnis-wir-unterstuetzen-acht-mutige-projekte/
Die acht Gewinner:
*WikiStories – Einblicke von Zeitzeugen von Werner Jansen und Ahmet Emre Acar
*Luftbilder für OpenStreetMap von OSM-Stammtisch Dortmund (Marc Gehling, Olaf Kotzte)
* Links to free and open – das Verzeichnis freier Projekte von Jan-Christoph Borchardt
* Motivationsfilm für Creative Commons von Amadeus Wittwer
* WikiQuest – kooperatives Lernen mit freien Inhalten von Andreas Bietenbeck
* Freies Wissen als hörbarer Podcast von Tabitha Hammer
* Barrierefreies Onlineportal für Karten- und Routing-Services von Annette Thurow
* Public Domain Projekt von Carl Fisch und Philippe Perreaux
Die acht Gewinner:
*WikiStories – Einblicke von Zeitzeugen von Werner Jansen und Ahmet Emre Acar
*Luftbilder für OpenStreetMap von OSM-Stammtisch Dortmund (Marc Gehling, Olaf Kotzte)
* Links to free and open – das Verzeichnis freier Projekte von Jan-Christoph Borchardt
* Motivationsfilm für Creative Commons von Amadeus Wittwer
* WikiQuest – kooperatives Lernen mit freien Inhalten von Andreas Bietenbeck
* Freies Wissen als hörbarer Podcast von Tabitha Hammer
* Barrierefreies Onlineportal für Karten- und Routing-Services von Annette Thurow
* Public Domain Projekt von Carl Fisch und Philippe Perreaux
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 dvent 2010 absurd: Wer mit Kindern Nikolaus- oder Adventslieder singt, überlegt sich inzwischen womöglich, ob er nicht gegen das Urheberrecht verstößt.
dvent 2010 absurd: Wer mit Kindern Nikolaus- oder Adventslieder singt, überlegt sich inzwischen womöglich, ob er nicht gegen das Urheberrecht verstößt.Sobald in Kindergärten oder Schulklassen nach Noten gesungen wird, hält die GEMA (stellvertretend für die VG Musikedition) die Hand auf, denn die meisten Notenblätter werden aufgrund minimaler Abweichungen von traditionellen ungeschützten Vorlagen von der GEMA als urheberrechtlich geschützt angesehen und unterliegen einem strikten Kopierverbot. Da kann sich die VG Musikedition noch so wortreich verteidigen: Das ist einfach Abzocke.
Und im rheinischen Monheim hielt sich Autorin Elke Bräunling nicht lange mit den von ihr stammenden Zeilen "Ein bisschen so wie Martin möchte´ ich manchmal sein, / und ich will an andre denken, / etwas geben, etwas schenken" auf und ließ durch ihren Rechtsanwalt den Martinsumzug mit 500 Euro abmahnen, der rechtswidrig den Text ihres Gedichts ins Internet gestellt hatte, damit die Teilnehmer mitsingen konnten.
Und auf Wikimedia Commons wird ein traditioneller Liedtext gelöscht, weil ein triviales Arrangement als geschützt angesehen wurde.
Erfreulicherweise hat jetzt der Verein Musikpiraten ein Liederbuch mit rund 30 Liedern publiziert, mit dem in Kindergärten ohne Angst vor GEMA und Anwälten gesungen werden kann:
http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder.pdf
Auch wenn es sich bei vielen Neu-"Arrangements" um Copyfraud handelt, weil die Gestaltungshöhe nicht erreicht ist (und Lizenzen außer CC0 widersinnig sind), geht diese Initiative in die richtige Richtung.
Hilfreich sind im Netz vorhandene gemeinfreie Notendrucke, etwa in der inzwischen 79.000 Partituren umfassenden Petrucci-Bibliothek.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man intensiv volkstümliche Kinderreime und -lieder aufgezeichnet. Einen Überblick auf dem Stand von 1909 gab Karl Wehrhan:
http://www.archive.org/details/kinderliedundkin00wehruoft
Auch das Standardwerk von Franz Magnus Böhme "Deutsches Kinderlied und Kinderspiel" (1897), eine Zusammenfassung regionaler Sammlungen, ist im Internet Archive (gespiegelt aus Google Book Search, Danke an P.) abrufbar:
http://www.archive.org/details/DeutschesKinderliedUndKinderspiel
Sobald ich von der Existenz der Initiative http://kinder-wollen-singen.de/ erfuhr, schaute ich im Katalog der ULB Düsseldorf nach Digitalisierbarem. Es liegen inzwischen online vor:
Johannes Friedrich Ranke: Lieder und Spiele für Kleinkinderschulen und Kinderstuben. Gütersloh 1879
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1818359
Johannes Friedrich Ranke: Kinderlieder mit leichter Klavierbegleitung und vollständiger Bezeichnung des Fingersatzes. Elberfeld 1885
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1818222
Karl Wehrhan: Frankfurter Kinderleben in Sitte und Brauch, Kinderlied und Kinderspiel. Wiesbaden 1929
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1821119
Eine Seite "Kinderlieder" gibt es auf Wikisource noch nicht, aber hier sind einige weitere Links (nochmals Danke an P.):
Wandervögelein: das ist: sechszig feine Lieder mit Tonweisen für sang- und reiselustige Knaben. Nürnberg 1821 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000632
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Vierzig Kinderlieder: Nach Original- und Volks-Weisen, mit Clavierbegleitung. Leipzig 1847
http://books.google.com/books?id=38sSJXd_aAoC
Georg Scherer: Alte und neue Kinderlieder, Fabeln, Sprüche und Räthsel. Leipzig 1849
http://books.google.com/books?id=b9gqAAAAYAAJ
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Die Kinderwelt in Liedern. Mainz 1853
http://books.google.com/books?id=yZQ6AAAAcAAJ
Ludovica Brentano von La Roche Des Bordes: Kinderlieder. Regensburg 1853
http://books.google.com/books?id=xkg7AAAAYAAJ
Ernst Ludwig Rochholz: Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz. Leipzig 1857
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10117261-1
Krell und Hermann [Componist]: Die Kinderstube: Lieder für Mutter und Kinder. Mit Begleitung des Pianoforte versehen von Nicolaus Hermann. Hildburghausen 1864
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00031681
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Kinderlieder'. Berlin 1878 (2. Auflage) http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kinderlieder_Fallersleben
Viktor Paul Mohn: Kinder-Lieder und Reime: Auswahl und Zeichnungen. Berlin [1881]
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000445
Mathilde Wesendonck: Alte und neue Kinder-Lieder und Reime. Berlin 1890
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000541
Gertrud Züricher: Kinderlied und Kinderspiel im Kanton Bern. Bern 1903
http://www.archive.org/details/kinderliedundki00zrgoog
#gema

 Beide Bilder aus: http://www.bbf.dipf.de/VirtuellesBildarchiv/
Beide Bilder aus: http://www.bbf.dipf.de/VirtuellesBildarchiv/Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Montag, 6. Dezember 2010, 00:38 - Rubrik: Archivrecht