"Im Berliner Verfassungsschutz sind Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus vernichtet worden.
Innenpolitiker von Grünen und Piraten sagten dem rbb am Dienstag, darüber seien sie am Mittag vom Senat informiert worden.
Die Akten waren eigentlich für das Landesarchiv bestimmt, sie kamen jedoch Ende Juni in den Reißwolf. Der Verfassungsschutz bestätigte den Vorfall und sprach von einem "Büro-Versehen". Eine Sprecherin beteuerte jedoch, unter den vernichteten Akten seien keine Unterlagen zur Terrorzelle NSU gewesen."
Quelle: rbbtext S. 120, 6.11.2012
Ist Verwahrungsbruch öffentlich-rechtlicher Volkssport?
Medienreaktionen:
TAZ, 6.11.2012, Neues Deutschland, 7.11.2012, Berliner Morgenpost, 6.11.2012, Welt, 6.11.2012
Nachtrag:
Welt, 6.11.2012 (erweiterte Fassung), Spiegel, 6.11.2012
Innenpolitiker von Grünen und Piraten sagten dem rbb am Dienstag, darüber seien sie am Mittag vom Senat informiert worden.
Die Akten waren eigentlich für das Landesarchiv bestimmt, sie kamen jedoch Ende Juni in den Reißwolf. Der Verfassungsschutz bestätigte den Vorfall und sprach von einem "Büro-Versehen". Eine Sprecherin beteuerte jedoch, unter den vernichteten Akten seien keine Unterlagen zur Terrorzelle NSU gewesen."
Quelle: rbbtext S. 120, 6.11.2012
Ist Verwahrungsbruch öffentlich-rechtlicher Volkssport?
Medienreaktionen:
TAZ, 6.11.2012, Neues Deutschland, 7.11.2012, Berliner Morgenpost, 6.11.2012, Welt, 6.11.2012
Nachtrag:
Welt, 6.11.2012 (erweiterte Fassung), Spiegel, 6.11.2012
Wolf Thomas - am Dienstag, 6. November 2012, 22:40 - Rubrik: Archivrecht
Die Stadt Stralsund hat im Sommer 2012 einen Teil ihrer historischen Archivbibliothek - diese gehört in Mecklenburg-Vorpommern zu den vier größten Altbestandsbibliotheken - an einen Antiquar zu einem nicht genannten Betrag veräussert. Dies betraf nach Angaben der Stadt den Großteil der historischen Gymnasialbibliothek, deren Umfang im "Handbuch der historischen Buchbestände" 1995 mit 2630 Titeln angegeben wurde. Behalten wurden nur wenige regionalgeschichtliche Titel. Dem Antiquar seien ca. 2500 Titel in 6210 Bänden angeboten worden, erworben habe er 5926 Bände. Neben der Gymnasialbibliothek sind auch eine nicht genannte Zahl von Büchern aus anderen wertvollen Teilbeständen der Archivbibliothek, unter anderem auch der bedeutenden Löwenschen Sammlung, in den Handel gegeben worden, wie Online-Angebote (Abebooks, ZVAB, Ebay) vor allem von Antiquariaten des Raums Augsburg (Peter Hassold, Augusta-Antiquariat, Ebay-Verkäufer Robert Hassold) beweisen. Es sind dabei auch zahlreiche Pomeranica festzustellen, darunter auch äußerst seltene oder derzeit nicht außerhalb von Stralsund nachgewiesene Stücke.
Beschlossen wurde der Teilverkauf am 5. Juni 2012 im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft.
Nachdem am 22. Oktober 2012 Falk Eisermann in einem Archivalia-Kommentar
http://archiv.twoday.net/stories/172009568/#172069128
auf eine Stelle in einer Presseerklärung der Stadt Stralsund zur Schließung des Stadtarchivs aufgrund eines Schimmelbefalls aufmerksam gemacht hatte, ging am 30. Oktober eine knappe Bestätigung der Stadt ein, dass die Gymnasialbibliothek verkauft worden sei:
http://archiv.twoday.net/stories/197331274/
In Archivalia und auch in der bibliothekarischen Mailingliste INETBIB wurden in der Folgezeit eine Fülle von Beiträgen und Kommentaren veröffentlicht.
Beiträge in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Thread-Darstellung in INETBIB:
http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib
Deutlich äußerte sich der Leiter der UB Köln, Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, zugleich ein anerkannter Buchhistoriker: "die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in langer Zeit gewachsenen Bibliothek habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so, als ob 40 Jahre bibliothekarische Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind."
http://archiv.twoday.net/stories/197331951/
Die Ostsee-Zeitung und die Schweriner Volkszeitung griffen das Thema und die Proteste gegen den Verkauf am 3. November 2012 auf, nachdem ihnen eine etwas detailliertere Antwort der Stadt zugegangen war.
Artikel der SVZ
http://www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/archivare-erzuernt-ueber-buecherverkauf.html
[Zitate: http://archiv.twoday.net/stories/197335310/ ]
Artikel der Ostsee-Zeitung
https://www.ostsee-zeitung.de/ozdigital/archiv.phtml?SID=563ed07bb264241a42f80207a22cf398¶m=news&id=3596920
Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) zeigte sich am 5. November 2012 "schockiert". Eine öffentliche Stellungnahme ist angekündigt.
http://archiv.twoday.net/stories/197335944/
[erfolgte am 8. November:
http://archiv.twoday.net/stories/202635163/ ]
Am 6. November 2012 wurde veröffentlicht: "Offener Brief der AG für pommersche Kirchengeschichte". Diese ist eng mit der evangelischen Landeskirche verbunden. Oberkirchenrat Dr. Christoph Ehricht schrieb unter anderem:
"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat."
http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte
In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." (PDF). Während die Stadt Stralsund die Anwendbarkeit bestreitet, haben sich die Bibliotheksjuristen Dr. jur. Eric Steinhauer und Dr. Harald Müller dahingehend geäußert, dass die Übereignung aufgrund eines gesetzlichen Verbots nach § 134 BGB nichtig sei.
http://archiv.twoday.net/stories/197331951/
Eine ausführliche zusammenfassende Darstellung legte Klaus Graf in Form eines offenen Briefs an den Bürgermeister der Welterbe-Partnerstadt von Stralsund, Wismar, am 6. November 2012 vor, in dem er die Verkäufe vehement kritisierte und als "geschichtsvergessene Barbarei" geißelte:
http://archiv.twoday.net/stories/197336228/
Am gleichen Tag gab der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund Dr. Alexander Badrow bekannt, er nähme die Vorwürfe "sehr ernst" und kündigte die Einsetzung eines externen Fachgutachters an.
http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument
... wird fortgesetzt.
Fortsetzung:
Am Abend des 7. November 2012 wurde eine Petition bei Open Petition "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" von Philipp Maaß eingestellt
https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-stralsunder-archivbibliothek
und auch eine Facebook-Seite eingerichtet:
http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund
Artikel des NDR vom 7. November 2012:
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz101.html
Die FAZ brachte das Thema am 10. November 2012 im Politikteil:
http://archiv.twoday.net/stories/202637191/
Bilder und Links, gesammelt von Margret Ott bei Pinterest:
http://pinterest.com/pommern/rettet-die-archivbibliothek-stralsund-save-the-arc/
Nach weiteren kritischen Stellungnahmen und Presseberichten kam es am 20. November 2011 zu einer Presseerklärung des Stralsunder Oberbürgermeisters, der nach Vorliegen eines Expertengutachtens von Jürgen Wolf und Nigel Palmer den Verkauf als Fehler bewertete und die Suspendierung der Archivleiterin sowie die Rückabwicklung des Verkaufs bekanntgab.
http://archiv.twoday.net/stories/219022682/
Beschlossen wurde der Teilverkauf am 5. Juni 2012 im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft.
Nachdem am 22. Oktober 2012 Falk Eisermann in einem Archivalia-Kommentar
http://archiv.twoday.net/stories/172009568/#172069128
auf eine Stelle in einer Presseerklärung der Stadt Stralsund zur Schließung des Stadtarchivs aufgrund eines Schimmelbefalls aufmerksam gemacht hatte, ging am 30. Oktober eine knappe Bestätigung der Stadt ein, dass die Gymnasialbibliothek verkauft worden sei:
http://archiv.twoday.net/stories/197331274/
In Archivalia und auch in der bibliothekarischen Mailingliste INETBIB wurden in der Folgezeit eine Fülle von Beiträgen und Kommentaren veröffentlicht.
Beiträge in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Thread-Darstellung in INETBIB:
http://news.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib
Deutlich äußerte sich der Leiter der UB Köln, Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, zugleich ein anerkannter Buchhistoriker: "die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in langer Zeit gewachsenen Bibliothek habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so, als ob 40 Jahre bibliothekarische Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind."
http://archiv.twoday.net/stories/197331951/
Die Ostsee-Zeitung und die Schweriner Volkszeitung griffen das Thema und die Proteste gegen den Verkauf am 3. November 2012 auf, nachdem ihnen eine etwas detailliertere Antwort der Stadt zugegangen war.
Artikel der SVZ
[Zitate: http://archiv.twoday.net/stories/197335310/ ]
Artikel der Ostsee-Zeitung
https://www.ostsee-zeitung.de/ozdigital/archiv.phtml?SID=563ed07bb264241a42f80207a22cf398¶m=news&id=3596920
Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) zeigte sich am 5. November 2012 "schockiert". Eine öffentliche Stellungnahme ist angekündigt.
http://archiv.twoday.net/stories/197335944/
[erfolgte am 8. November:
http://archiv.twoday.net/stories/202635163/ ]
Am 6. November 2012 wurde veröffentlicht: "Offener Brief der AG für pommersche Kirchengeschichte". Diese ist eng mit der evangelischen Landeskirche verbunden. Oberkirchenrat Dr. Christoph Ehricht schrieb unter anderem:
"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat."
http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte
In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." (PDF). Während die Stadt Stralsund die Anwendbarkeit bestreitet, haben sich die Bibliotheksjuristen Dr. jur. Eric Steinhauer und Dr. Harald Müller dahingehend geäußert, dass die Übereignung aufgrund eines gesetzlichen Verbots nach § 134 BGB nichtig sei.
http://archiv.twoday.net/stories/197331951/
Eine ausführliche zusammenfassende Darstellung legte Klaus Graf in Form eines offenen Briefs an den Bürgermeister der Welterbe-Partnerstadt von Stralsund, Wismar, am 6. November 2012 vor, in dem er die Verkäufe vehement kritisierte und als "geschichtsvergessene Barbarei" geißelte:
http://archiv.twoday.net/stories/197336228/
Am gleichen Tag gab der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund Dr. Alexander Badrow bekannt, er nähme die Vorwürfe "sehr ernst" und kündigte die Einsetzung eines externen Fachgutachters an.
http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument
... wird fortgesetzt.
Fortsetzung:
Am Abend des 7. November 2012 wurde eine Petition bei Open Petition "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" von Philipp Maaß eingestellt
https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-stralsunder-archivbibliothek
und auch eine Facebook-Seite eingerichtet:
http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund
Artikel des NDR vom 7. November 2012:
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/stralsundbuchschatz101.html
Die FAZ brachte das Thema am 10. November 2012 im Politikteil:
http://archiv.twoday.net/stories/202637191/
Bilder und Links, gesammelt von Margret Ott bei Pinterest:
http://pinterest.com/pommern/rettet-die-archivbibliothek-stralsund-save-the-arc/
Nach weiteren kritischen Stellungnahmen und Presseberichten kam es am 20. November 2011 zu einer Presseerklärung des Stralsunder Oberbürgermeisters, der nach Vorliegen eines Expertengutachtens von Jürgen Wolf und Nigel Palmer den Verkauf als Fehler bewertete und die Suspendierung der Archivleiterin sowie die Rückabwicklung des Verkaufs bekanntgab.
http://archiv.twoday.net/stories/219022682/
"Ulrike Bauer-Eberhardt
Die illuminierten Handschriften italienischer Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek
Teil 1: Vom 10. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts
(= Katalog der illuminierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München, Bd. 6/1: Text- und Tafelband).
Wiesbaden: Reichert, 2011.
Der Band enthält detaillierte kunsthistorische Beschreibungen von mehr als 250 Handschriften. Die Katalogisate sind nun auch im Volltext über die Handschriftendatenbank Manuscripta mediaevalia zugänglich und über die Projektseite aufrufbar:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/info/projectinfo/muenchen-italien.html
Handschriften, die bereits vollständig digitalisiert sind, können von den Beschreibungen aus über ein Thumbnail-Image aufgerufen werden, darunter z.B. Clm 6116, das aufgrund starker Schädigung nicht mehr benutzbare Gebetbuch der Taddea Visconti, das aus dem von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründeten Kloster Ettal nach München gelangte." Bettina Wagner in Diskus
Die illuminierten Handschriften italienischer Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek
Teil 1: Vom 10. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts
(= Katalog der illuminierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München, Bd. 6/1: Text- und Tafelband).
Wiesbaden: Reichert, 2011.
Der Band enthält detaillierte kunsthistorische Beschreibungen von mehr als 250 Handschriften. Die Katalogisate sind nun auch im Volltext über die Handschriftendatenbank Manuscripta mediaevalia zugänglich und über die Projektseite aufrufbar:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/info/projectinfo/muenchen-italien.html
Handschriften, die bereits vollständig digitalisiert sind, können von den Beschreibungen aus über ein Thumbnail-Image aufgerufen werden, darunter z.B. Clm 6116, das aufgrund starker Schädigung nicht mehr benutzbare Gebetbuch der Taddea Visconti, das aus dem von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründeten Kloster Ettal nach München gelangte." Bettina Wagner in Diskus
KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 17:44 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In den letzten Tagen gab es zur Veräußerung eines Teils der ehemaligen Gymnasialbibliothek aus dem Stralsunder Stadtarchiv eine kontroverse öffentliche Diskussion.
Die im Zusammenhang mit der Verkaufsentscheidung von den Fachleuten unserer Einrichtung vertretene Auffassung wurde dabei teilweise in Frage gestellt.
Diese Einschätzungen und Aussagen, die über die Medien, insbesondere über das Internet, publiziert worden sind, nehme ich sehr ernst.
Ich meine, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die Stralsunder Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen, wie diese Aussagen zu werten sind. Da ich eine fachliche Beurteilung hinsichtlich des betreffenden Buchbestandes nicht selbst vornehmen kann, hole ich eine unabhängige Fachmeinung von außen ein.
Es wird für den Gutachter darum gehen, zu prüfen und zu bewerten, ob die getroffene Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanten Bestimmungen fachlich zu vertreten war.
Dr. Alexander Badrow
Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund"
http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument
Zur Causa:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Zusammenfassung:
http://archiv.twoday.net/stories/197336228/
Die im Zusammenhang mit der Verkaufsentscheidung von den Fachleuten unserer Einrichtung vertretene Auffassung wurde dabei teilweise in Frage gestellt.
Diese Einschätzungen und Aussagen, die über die Medien, insbesondere über das Internet, publiziert worden sind, nehme ich sehr ernst.
Ich meine, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die Stralsunder Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen, wie diese Aussagen zu werten sind. Da ich eine fachliche Beurteilung hinsichtlich des betreffenden Buchbestandes nicht selbst vornehmen kann, hole ich eine unabhängige Fachmeinung von außen ein.
Es wird für den Gutachter darum gehen, zu prüfen und zu bewerten, ob die getroffene Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanten Bestimmungen fachlich zu vertreten war.
Dr. Alexander Badrow
Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund"
http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/Webseite_2AEE7AC26602D09EC1257AAE0043301C?OpenDocument
Zur Causa:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Zusammenfassung:
http://archiv.twoday.net/stories/197336228/
http://www.aknw.de/aktuell/meldungen/detailansicht/artikel/baukunstarchiv-in-dortmund/
15.10.2012
"Ein Baukunstarchiv für Nordrhein-Westfalen – dieses baukulturell wichtige Ziel nimmt konkrete Formen an. Die Stiftung Deutscher Architekten hatte das Vorhaben mit der Architektenkammer NRW, der Ingenieurkammer-Bau, dem NRW-Bauministerium und weiteren Partnern vor gut drei Jahren initiiert und seitdem Sponsoren und Unterstützer geworben, um die dauerhafte Finanzierung eines landesweit tätigen Archivs zur Sicherung und Aufarbeitung der Nachlässe nordrhein-westfälischer Architekten und Stadtplaner sicher zu stellen. Nun zeichnet sich ab, dass das Architekturarchiv möglicherweise in das Gebäude des früheren „Museum am Ostwall“ in Dortmund ziehen kann. Für die Stadt Dortmund hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau ein lebhaftes Interesse bekundet, und auch ein neuer Förderverein will das Projekt unterstützen."
Nett, wenn es mal voranginge, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6035038/
Grüße
J. Paul
15.10.2012
"Ein Baukunstarchiv für Nordrhein-Westfalen – dieses baukulturell wichtige Ziel nimmt konkrete Formen an. Die Stiftung Deutscher Architekten hatte das Vorhaben mit der Architektenkammer NRW, der Ingenieurkammer-Bau, dem NRW-Bauministerium und weiteren Partnern vor gut drei Jahren initiiert und seitdem Sponsoren und Unterstützer geworben, um die dauerhafte Finanzierung eines landesweit tätigen Archivs zur Sicherung und Aufarbeitung der Nachlässe nordrhein-westfälischer Architekten und Stadtplaner sicher zu stellen. Nun zeichnet sich ab, dass das Architekturarchiv möglicherweise in das Gebäude des früheren „Museum am Ostwall“ in Dortmund ziehen kann. Für die Stadt Dortmund hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau ein lebhaftes Interesse bekundet, und auch ein neuer Förderverein will das Projekt unterstützen."
Nett, wenn es mal voranginge, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6035038/
Grüße
J. Paul
J. Paul - am Dienstag, 6. November 2012, 15:35 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
aus dem Inhalt:
"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat. "
Volltext auf http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte/
"Um so bestürzter sind wir über die Pressemeldungen der vergangenen Wochen, denen wir entnehmen mußten, daß die Hansestadt Stralsund den bisher im Stadtarchiv verwahrten Bestand ihrer traditionsreichen Gymnasialbibliothek an einen Antiquar veräußert hat. Lassen Sie mich Ihnen sehr persönlich und in aller Offenheit sagen, dass mich diese Meldung zutiefst deprimiert und fassungslos gemacht hat. "
Volltext auf http://www.blog.pommerscher-greif.de/stralsund-offener-brief-der-ag-fur-pommersche-kirchengeschichte/
MOtt - am Dienstag, 6. November 2012, 10:01 - Rubrik: Kulturgut
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beyer,
ein schönes und erfolgreiches Bündnis hat Ihre traditionsreiche Stadt Wismar mit der nicht weniger traditionsreichen Hansestadt Stralsund geschmiedet. Die Altstädte von Wismar und Stralsund zählen seit 2002 zum UNESCO-Welterbe. Ich selbst war bei eigenen Besuchen außerordentlich beeindruckt von der architektonischen Hinterlassenschaft in beiden Städten. Doch Architektur ist nicht das einzige kulturelle Erbe, das beide Städte betreuen. In Archiven, Bibliotheken und Museen sind unschätzbare Kulturgüter überliefert, ein Dokumentenerbe, das zwar nicht in die entsprechende UNESCO-Liste eingetragen ist, das aber aus meiner Sicht ebenso gepflegt werden muss wie das jeweilige Stadtbild und die Baudenkmale.
Doch im Augenblick würde ich mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen, mit der Stadt Stadt Stralsund in einem Boot zu sitzen. Die jetzt bekannt gewordenen Verkäufe aus der Bibliothek des dortigen Stadtarchivs halte ich für einen der größten Kulturgut-Skandale der letzten Jahrzehnte. Archivare und Bibliothekare sind zu Recht entsetzt und schockiert über einen Kulturfrevel ohnegleichen, der mit dem Image einer Welterbe-Stadt schlichtweg nicht zu vereinen ist.
In der frühen Neuzeit entstandene Bibliotheken sind nicht einfach Büchersammlungen, aus der man nach Belieben Stücke herauslösen kann, wenn diese aktuell wenig nachgefragt werden und man Geld braucht. Über Bücher in Adelsbibliotheken schrieb ich 2006, sie seien "Elemente eines Netzwerks voller Querbezüge, das als beziehungsvolle Gesamtheit weit mehr ist als die bloße Summe der Einzelstücke. Ihre historische Bedeutung als Ensembles entsteht durch Provenienz, durch Herkunft. Um die Provenienzgeschichte zu
rekonstruieren, muss man sorgsam Spuren sichern: das Aussehen des Einbands, die Einträge früherer Besitzer, Marginalien und andere Hinweise auf einstige Lektüre". Das gilt genauso für die frühneuzeitlichen städtischen Bibliotheken.
Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass in den protestantischen Städten Ratsbibliotheken, Kirchenbibliotheken und Schulbibliotheken seit dem 16. Jahrhundert als Einheit, als Ganzes verstanden werden können, als Bibliothek der urbanen "Societas christiana", die nach Schwerpunkten auf drei Standorte verteilt war: Fand man in der Ratsbibliothek eher juristische und Verwaltungsschriften, so war in den Kirchenbibliotheken naturgemäß die Theologie stark und in den Bibliotheken der oftmals berühmten städtischen Lateinschulen die Philologie. Zugleich waren aber alle drei Typen im Ansatz immer auch universale Wissenssammlungen. Diese Büchersammlungen, soweit sie - meist nur in Resten - auf uns gekommen sind, sind nichts weniger als kostbare und einzigartige Geschichtsquellen, denen seltene Aufschlüsse über die geistige Kultur des frühneuzeitlichen Bürgertums entnommen werden können. Sie dokumentieren die literarische Produktion in den Städten, aber auch die Rezeption auswärts gedruckter Werke und spiegeln insofern die Lese-Interessen des gebildeten Bürgertums. Gelehrte und gebildete Bürger hatten üblicherweise Zugang zu den Ratsbibliotheken, den Kirchen- und Schulbibliotheken. Bücherschenkungen aus ihrem Kreis waren für den Bestandsaufbau außerordentlich wichtig.
Es wäre eine gute Idee (wenngleich derzeit utopisch), die gesammelten Bestände der bundesdeutschen historischen Gymnasialbibliotheken, die aus den frühneuzeitlichen Lateinschulbibliotheken hervorgegangen sind, für die Eintragung im UNESCO-Dokumentenerbe anzumelden. Denn kein anderes Land der Erde weist diesen - bislang so gut wie nicht erschlossenen - Reichtum auf an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden. Es sind wahre Schatzkammern der Kultur- und Bildungsgeschichte, in denen man neben grandiosen Einzelstücken viel zur jeweiligen Schulgeschichte und zur Geschichte der gelehrten Bildung in der frühen Neuzeit findet. Geht man nach dem Bestand von Inkunabeln (also der vor 1501 gedruckten BÜcher), so gibt es 2012 noch über 40 deutsche Schulbibliotheken, die über solche bibliophilen Stücke verfügen. Diese sind freilich überwiegend im Westen anzutreffen, denn in der DDR waren historische Schulbibliotheken ebenso wie andere kleinere Bibliotheken allzu oft das Opfer gewissenloser Dezimierungsaktionen, bei denen gewachsene Sammlungen zerschlagen und als Geschichtsquellen vernichtet wurden, indem man die Bestände als unbrauchbar wegwarf, sie in größere Bibliotheken eingliederte oder gegen Devisen in den Westen verkaufte.
Um so erfreulicher war es, dass die Bibliothek der Stralsunder Lateinschule, in der frühen Neuzeit eine Schule von hohem Rang, in der 1937 gegründeten Archivbibliothek, die die Tradition der jahrhundertealten Stadtbibliothek fortführte, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen scheinbar sicheren Hort gefunden hatte. Im maßgeblichen "Handbuch der historischen Buchbestände" wurde sie 1995 als hochgeschätzter Sonderbestand von 2630 Titeln vergleichsweise ausführlich charakterisiert. Die DDR hatte die Stralsunder Gymnasialbibliothek unbeschadet überstanden, doch gegen die geschichtsvergessene Barbarei der derzeitigen Stadtverwaltung hatte sie keine Chance. Im Sommer 2012 wurde sie - bis auf einen kleinen Restbestand - an einen bayerischen Antiquar aus dem Raum Augsburg, der befreundete bzw. familiär verbundene weitere Antiquariate belieferte, zu einem geheimgehaltenen Betrag verscherbelt - anders kann man diesen vandalischen Akt nicht nennen.
Die Stralsunder Stadtverwaltung, die in der Bürgerschaft in geheimer Sitzung im Juni 2012 den Verkauf absegnen ließ, spielt den von mir aufgedeckten ungeheuerlichen Vorgang herunter, sie will ihn offenkundig vertuschen und schreckt auch vor dreisten Lügen nicht zurück.
Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter. (SVZ).
Für den Quellenwert der Gymnasialbibliothek als kulturgeschichtliches Ensemble, der natürlich von den Bestandsgruppen der Theologie und Philologie und fremdsprachigen Büchern geprägt wurde, darf die regionalgeschichtlich orientierte aktuelle Nachfrage keine Rolle spielen. Die Stralsunder Archivbibliothek gehört zu den großen vier Altbestandsbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist als ehemalige gelehrt-wissenschaftliche Stadtbibliothek eine Universalbibliothek und nicht nur eine Sammelstelle von Regionalia. Wie sollte ein größeres Interesse an ihren Schätzen entstehen, wenn man sie im Dornröschenschlaf vor sich hindämmern ließ und sie ohne elektronischen Katalog vom Netz der wissenschaftlichen Literaturversorgung fernhielt?
Zu den Schätzen der Archivbibliothek gehörte die weitgehend geschlossen erhaltene Gymnasialbibliothek, die nun als Geschichtsquelle vernichtet wurde. Ihre Preisgabe an einen privaten Händler und damit einhergehende Zerstreuung möchte ich durchaus mit dem Abbruch eines hochbedeutenden Backsteinbaus in einer Ihrer Welterbe-Städte vergleichen.
Der vielleicht kostbarste Teil der Gymnasialbibliothek dürfte wohl ebenfalls verloren sein, die Bibliothek des Zacharias Orth, über die man im bereits erwähnten Handbuch liest: "Eine besondere Zuwendung erhielt sie [die Gymnasialbibliothek] im Jahre 1644 vom Magistrat der Stadt: eine Sammlung von 112 Bdn philologischen, historischen, philosophischen und theologischen Inhalts, die schon 1579 von den Erben des Stralsunder Poeten Zacharias Orthus (um 1530-1579) angekauft worden war. In seiner Bibliothek hatte Orthus, der in Wittenberg und Greifswald Poesie und Geschichte gelehrt hatte, sowohl die eigenen als auch die Werke namhafter Zeitgenossen, wie Bugenhagens und seines Freundes Melanchthon, vereint. Auch damals bedeutende Dichterkollegen gehören dazu. Viele Bände tragen seinen eigenhändigen Namenszug und auf dem Deckel die Buchstaben ZOPL (" Zach. Orth. poeta laureatus")."
Die Angebote der Antiquariate bei Abebooks, im ZVAB und - ja auch bei Ebay sind für den Kenner erschreckend, auch wenn ich noch nicht auf ein Buch von Orth gestoßen bin. Man findet ohne weiteres Stücke mit Unikatcharakter, etwa die Widmungsexemplare des Stralsunder Lehrers und Stadthistorikers Zober an seine Anstalt oder ein Dossier lokalhistorischer Druckschriften über einen ihrer Rektoren.
Das Kulturerbe der Stadt Stralsund bei Ebay!
Aus der Zeit vor 1850 kann es keine "Dubletten" (Doppelstücke) geben, legt man die maßgeblichen Standards der Kulturerbe-Allianz zugrunde. Nicht wenige der aktuell im Handel angebotenen Stralsunder Bücher weisen handschriftliche Besonderheiten, wie Schenkungs- oder Widmungseinträge, Randnotizen usw. auf, die nun undokumentiert der lokalhistorischen wie der überregionalen Forschung - mutmaßlich für immer - durch den Übergang in private Hände entzogen sind. Die Zerstreuung einer solchen historischen Sammlung ist nicht reversibel. Eine Backsteinfassade kann man aber originalgetreu wieder aufbauen.
In der Archivsatzung der Stadt Stralsund aus dem Jahr 2002 heißt es unmissverständlich: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." Wie das erwähnte Handbuch der historischen Buchbestände beweist, galt die Gymnasialbibliothek als integraler Bestandteil der Archivbibliothek, auch wenn sie gesondert aufgestellt war und nur in einem alten Bandkatalog katalogisiert war. Daher ist die Argumentation der Stadt Stralsund, die Archivsatzung habe keine Gültigkeit für die wertvolle Schulbibliothek, eine reine Ausflucht. Namhafte Bibliotheksjuristen teilen meine Einschätzung, dass die Veräußerung rechtswidrig war und die Übereignung daher als Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot daher nach § 134 BGB nichtig. Die an den Händler übergebenen (und womöglich weiterverkauften) Stücke stehen also nach wie vor im Eigentum der Stadt Stralsund.
Die widerwärtige Plünderei der Archivbibliothek erfasste aber nicht nur die Gymnasialbibliothek. Abgestoßen wurden auch - in unbekanntem Umfang - wertvolle Stücke aus der Stadtbibliothek, die man - mit engstirniger regionaler Perspektive - als entbehrlich ansah. Sogar Bücher aus der im 18. Jahrhundert der Stadt geschenkten Gräflich Löwen'schen Sammlung, auf die man in Stralsund sonst doch so stolz ist, erscheinen in den Angeboten der Antiquariate. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um unkatalogisierte Bücher, wenn man dieses Kriterium bei der Bestimmung des unveräußerlichen Bestandes zugrundelegen wollte.
Die Unveräußerlichkeit des Archivguts in den Kommunalarchiven wurde auch im Archivgesetz des Landes festgeschrieben. Man kann solche normativen Klauseln getrost als Makulatur betrachten, wenn die Stadt Stralsund mit ihrer eklatanten Verdrehung der Rechtslage durchkommt.
Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass sich eine Kommune ratzfatz von einer jahrhundertealten bibliothekarischen Tradition verabschiedet, ohne sich im mindesten um die Rechtslage und die Interessenlage der regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken zu kümmern. Denn externer Sachverstand aus dem Bibliotheks- oder Archivbereich konnte im Vorfeld das Zerstörungswerk nicht verhindern - weil niemand informiert war.
Jeder Kenner weiß, dass Archivbibliotheken oft wichtige Ergänzungen zu den Pflichtexemplar- und Regionalbibliotheken darstellen, da sie das lokale Schrifttum in größerer Vollständigkeit dokumentieren. Es ist eine glatte Lüge, dass man keine Pomeranica verkauft habe. Unzählige höchst seltene Pommern-Drucke wurden in den Handel gegeben, auch die so seltenen barocken Gelegenheitsschriften, von denen einige in den elektronischen Bibliographien und Verbundkatalogen gar nicht nachweisbar sind.
Bei Zisska kommt ein Stettiner Türkendruck aus dem Jahr 1537 unter den Hammer. Es ist das einzige bekannte Exemplar aus dem Stadtarchiv Stralsund!
Glücklicherweise sind im deutschen Museumsbereich Verkäufe ein Tabu. Ein wichtiges Argument gegen die insbesondere in den USA weit verbreitete Deaccessioning-Mentalität ist der Hinweis auf die Absichten der Schenker, die ihr Kulturgut bewusst einer geschützten, dauerhaften Sammlung gestiftet haben. Was würde Graf von Löwen oder der Stadthistoriker Zober sagen, wenn sie von dem Stralsunder Vernichtungsakt erführen? Nochmals ein Zitat aus dem "Handbuch": "Besonderes bibliothekarisches Feingefühl bewies der Rektor Christian Heinrich Groskurd (1747-1806), der von jedem Schüler bei dessen Abschied wünschte, daß er der Bibliothek ein Buch schenke. Unter seiner Leitung wurde die Gymnasialbibliothek auch für außenstehende Liebhaber der Literatur geöffnet und entwickelte sich zu einem kulturellen städtischen Treffpunkt." Etliche handschriftliche Einträge Groskurds sind in den Beschreibungen der Antiquariate angezeigt (aber nicht wiedergegeben).
Wie kann man Bürgerinnen und Bürger motivieren, kulturgutverwahrende Institutionen zu bedenken, wenn der kommunale Träger sich kaltschnäuzig über jede moralische Verpflichtung, den Ewigkeitscharakter des Prinzips "Stiftung" zu respektieren, hinwegsetzt?
Schon das glimpflich ausgegangene Karlsruher Kulturgut-Debakel von 2006 hat deutlich gemacht, dass wir wirksame Sicherungen für Kulturgüter der öffentlichen Hand in Archiven, Bibliotheken und Museen brauchen. Die auf Bau- und Bodendenkmäler konzentrierte amtliche Denkmalpflege kümmert sich leider nicht um Sammlungen wie die Stralsunder Archivbibliothek.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bitte Sie:
- Distanzieren Sie sich von dem einer Welterbe-Stadt unwürdigen Vorgehen der Stadt Stralsund und setzen Sie jegliche Zusammenarbeit bis zur umfassenden Klärung der Angelegenheit aus!
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre eigene Ratsbibliothek im Stadtarchiv mit elektronischem Katalog auch der Altbestände in das Netz der wissenschaftlichen Bibliotheken einbezogen wird, damit das Bewusstsein für ihren besonderen Wert zunimmt und sie vor einem vergleichbaren kulturellen Vernichtungsfeldzug wie in Stralsund schützt. Wie wichtig Archive (und auch Archivbibliotheken) sind, hat der Kölner Archiveinsturz wohl hinreichend demonstriert.
- Setzen Sie sich dafür ein, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern das ihnen anvertraute Kulturgut treuhänderisch für die Öffentlichkeit dauerhaft bewahren und nicht kurzsichtig zum Stopfen von Haushaltslöchern verwenden!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Klaus Graf
ein schönes und erfolgreiches Bündnis hat Ihre traditionsreiche Stadt Wismar mit der nicht weniger traditionsreichen Hansestadt Stralsund geschmiedet. Die Altstädte von Wismar und Stralsund zählen seit 2002 zum UNESCO-Welterbe. Ich selbst war bei eigenen Besuchen außerordentlich beeindruckt von der architektonischen Hinterlassenschaft in beiden Städten. Doch Architektur ist nicht das einzige kulturelle Erbe, das beide Städte betreuen. In Archiven, Bibliotheken und Museen sind unschätzbare Kulturgüter überliefert, ein Dokumentenerbe, das zwar nicht in die entsprechende UNESCO-Liste eingetragen ist, das aber aus meiner Sicht ebenso gepflegt werden muss wie das jeweilige Stadtbild und die Baudenkmale.
Doch im Augenblick würde ich mich an Ihrer Stelle in Grund und Boden schämen, mit der Stadt Stadt Stralsund in einem Boot zu sitzen. Die jetzt bekannt gewordenen Verkäufe aus der Bibliothek des dortigen Stadtarchivs halte ich für einen der größten Kulturgut-Skandale der letzten Jahrzehnte. Archivare und Bibliothekare sind zu Recht entsetzt und schockiert über einen Kulturfrevel ohnegleichen, der mit dem Image einer Welterbe-Stadt schlichtweg nicht zu vereinen ist.
In der frühen Neuzeit entstandene Bibliotheken sind nicht einfach Büchersammlungen, aus der man nach Belieben Stücke herauslösen kann, wenn diese aktuell wenig nachgefragt werden und man Geld braucht. Über Bücher in Adelsbibliotheken schrieb ich 2006, sie seien "Elemente eines Netzwerks voller Querbezüge, das als beziehungsvolle Gesamtheit weit mehr ist als die bloße Summe der Einzelstücke. Ihre historische Bedeutung als Ensembles entsteht durch Provenienz, durch Herkunft. Um die Provenienzgeschichte zu
rekonstruieren, muss man sorgsam Spuren sichern: das Aussehen des Einbands, die Einträge früherer Besitzer, Marginalien und andere Hinweise auf einstige Lektüre". Das gilt genauso für die frühneuzeitlichen städtischen Bibliotheken.
Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass in den protestantischen Städten Ratsbibliotheken, Kirchenbibliotheken und Schulbibliotheken seit dem 16. Jahrhundert als Einheit, als Ganzes verstanden werden können, als Bibliothek der urbanen "Societas christiana", die nach Schwerpunkten auf drei Standorte verteilt war: Fand man in der Ratsbibliothek eher juristische und Verwaltungsschriften, so war in den Kirchenbibliotheken naturgemäß die Theologie stark und in den Bibliotheken der oftmals berühmten städtischen Lateinschulen die Philologie. Zugleich waren aber alle drei Typen im Ansatz immer auch universale Wissenssammlungen. Diese Büchersammlungen, soweit sie - meist nur in Resten - auf uns gekommen sind, sind nichts weniger als kostbare und einzigartige Geschichtsquellen, denen seltene Aufschlüsse über die geistige Kultur des frühneuzeitlichen Bürgertums entnommen werden können. Sie dokumentieren die literarische Produktion in den Städten, aber auch die Rezeption auswärts gedruckter Werke und spiegeln insofern die Lese-Interessen des gebildeten Bürgertums. Gelehrte und gebildete Bürger hatten üblicherweise Zugang zu den Ratsbibliotheken, den Kirchen- und Schulbibliotheken. Bücherschenkungen aus ihrem Kreis waren für den Bestandsaufbau außerordentlich wichtig.
Es wäre eine gute Idee (wenngleich derzeit utopisch), die gesammelten Bestände der bundesdeutschen historischen Gymnasialbibliotheken, die aus den frühneuzeitlichen Lateinschulbibliotheken hervorgegangen sind, für die Eintragung im UNESCO-Dokumentenerbe anzumelden. Denn kein anderes Land der Erde weist diesen - bislang so gut wie nicht erschlossenen - Reichtum auf an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden. Es sind wahre Schatzkammern der Kultur- und Bildungsgeschichte, in denen man neben grandiosen Einzelstücken viel zur jeweiligen Schulgeschichte und zur Geschichte der gelehrten Bildung in der frühen Neuzeit findet. Geht man nach dem Bestand von Inkunabeln (also der vor 1501 gedruckten BÜcher), so gibt es 2012 noch über 40 deutsche Schulbibliotheken, die über solche bibliophilen Stücke verfügen. Diese sind freilich überwiegend im Westen anzutreffen, denn in der DDR waren historische Schulbibliotheken ebenso wie andere kleinere Bibliotheken allzu oft das Opfer gewissenloser Dezimierungsaktionen, bei denen gewachsene Sammlungen zerschlagen und als Geschichtsquellen vernichtet wurden, indem man die Bestände als unbrauchbar wegwarf, sie in größere Bibliotheken eingliederte oder gegen Devisen in den Westen verkaufte.
Um so erfreulicher war es, dass die Bibliothek der Stralsunder Lateinschule, in der frühen Neuzeit eine Schule von hohem Rang, in der 1937 gegründeten Archivbibliothek, die die Tradition der jahrhundertealten Stadtbibliothek fortführte, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen scheinbar sicheren Hort gefunden hatte. Im maßgeblichen "Handbuch der historischen Buchbestände" wurde sie 1995 als hochgeschätzter Sonderbestand von 2630 Titeln vergleichsweise ausführlich charakterisiert. Die DDR hatte die Stralsunder Gymnasialbibliothek unbeschadet überstanden, doch gegen die geschichtsvergessene Barbarei der derzeitigen Stadtverwaltung hatte sie keine Chance. Im Sommer 2012 wurde sie - bis auf einen kleinen Restbestand - an einen bayerischen Antiquar aus dem Raum Augsburg, der befreundete bzw. familiär verbundene weitere Antiquariate belieferte, zu einem geheimgehaltenen Betrag verscherbelt - anders kann man diesen vandalischen Akt nicht nennen.
Die Stralsunder Stadtverwaltung, die in der Bürgerschaft in geheimer Sitzung im Juni 2012 den Verkauf absegnen ließ, spielt den von mir aufgedeckten ungeheuerlichen Vorgang herunter, sie will ihn offenkundig vertuschen und schreckt auch vor dreisten Lügen nicht zurück.
Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter. (SVZ).
Für den Quellenwert der Gymnasialbibliothek als kulturgeschichtliches Ensemble, der natürlich von den Bestandsgruppen der Theologie und Philologie und fremdsprachigen Büchern geprägt wurde, darf die regionalgeschichtlich orientierte aktuelle Nachfrage keine Rolle spielen. Die Stralsunder Archivbibliothek gehört zu den großen vier Altbestandsbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist als ehemalige gelehrt-wissenschaftliche Stadtbibliothek eine Universalbibliothek und nicht nur eine Sammelstelle von Regionalia. Wie sollte ein größeres Interesse an ihren Schätzen entstehen, wenn man sie im Dornröschenschlaf vor sich hindämmern ließ und sie ohne elektronischen Katalog vom Netz der wissenschaftlichen Literaturversorgung fernhielt?
Zu den Schätzen der Archivbibliothek gehörte die weitgehend geschlossen erhaltene Gymnasialbibliothek, die nun als Geschichtsquelle vernichtet wurde. Ihre Preisgabe an einen privaten Händler und damit einhergehende Zerstreuung möchte ich durchaus mit dem Abbruch eines hochbedeutenden Backsteinbaus in einer Ihrer Welterbe-Städte vergleichen.
Der vielleicht kostbarste Teil der Gymnasialbibliothek dürfte wohl ebenfalls verloren sein, die Bibliothek des Zacharias Orth, über die man im bereits erwähnten Handbuch liest: "Eine besondere Zuwendung erhielt sie [die Gymnasialbibliothek] im Jahre 1644 vom Magistrat der Stadt: eine Sammlung von 112 Bdn philologischen, historischen, philosophischen und theologischen Inhalts, die schon 1579 von den Erben des Stralsunder Poeten Zacharias Orthus (um 1530-1579) angekauft worden war. In seiner Bibliothek hatte Orthus, der in Wittenberg und Greifswald Poesie und Geschichte gelehrt hatte, sowohl die eigenen als auch die Werke namhafter Zeitgenossen, wie Bugenhagens und seines Freundes Melanchthon, vereint. Auch damals bedeutende Dichterkollegen gehören dazu. Viele Bände tragen seinen eigenhändigen Namenszug und auf dem Deckel die Buchstaben ZOPL (" Zach. Orth. poeta laureatus")."
Die Angebote der Antiquariate bei Abebooks, im ZVAB und - ja auch bei Ebay sind für den Kenner erschreckend, auch wenn ich noch nicht auf ein Buch von Orth gestoßen bin. Man findet ohne weiteres Stücke mit Unikatcharakter, etwa die Widmungsexemplare des Stralsunder Lehrers und Stadthistorikers Zober an seine Anstalt oder ein Dossier lokalhistorischer Druckschriften über einen ihrer Rektoren.
Das Kulturerbe der Stadt Stralsund bei Ebay!
Aus der Zeit vor 1850 kann es keine "Dubletten" (Doppelstücke) geben, legt man die maßgeblichen Standards der Kulturerbe-Allianz zugrunde. Nicht wenige der aktuell im Handel angebotenen Stralsunder Bücher weisen handschriftliche Besonderheiten, wie Schenkungs- oder Widmungseinträge, Randnotizen usw. auf, die nun undokumentiert der lokalhistorischen wie der überregionalen Forschung - mutmaßlich für immer - durch den Übergang in private Hände entzogen sind. Die Zerstreuung einer solchen historischen Sammlung ist nicht reversibel. Eine Backsteinfassade kann man aber originalgetreu wieder aufbauen.
In der Archivsatzung der Stadt Stralsund aus dem Jahr 2002 heißt es unmissverständlich: "Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich." Wie das erwähnte Handbuch der historischen Buchbestände beweist, galt die Gymnasialbibliothek als integraler Bestandteil der Archivbibliothek, auch wenn sie gesondert aufgestellt war und nur in einem alten Bandkatalog katalogisiert war. Daher ist die Argumentation der Stadt Stralsund, die Archivsatzung habe keine Gültigkeit für die wertvolle Schulbibliothek, eine reine Ausflucht. Namhafte Bibliotheksjuristen teilen meine Einschätzung, dass die Veräußerung rechtswidrig war und die Übereignung daher als Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot daher nach § 134 BGB nichtig. Die an den Händler übergebenen (und womöglich weiterverkauften) Stücke stehen also nach wie vor im Eigentum der Stadt Stralsund.
Die widerwärtige Plünderei der Archivbibliothek erfasste aber nicht nur die Gymnasialbibliothek. Abgestoßen wurden auch - in unbekanntem Umfang - wertvolle Stücke aus der Stadtbibliothek, die man - mit engstirniger regionaler Perspektive - als entbehrlich ansah. Sogar Bücher aus der im 18. Jahrhundert der Stadt geschenkten Gräflich Löwen'schen Sammlung, auf die man in Stralsund sonst doch so stolz ist, erscheinen in den Angeboten der Antiquariate. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um unkatalogisierte Bücher, wenn man dieses Kriterium bei der Bestimmung des unveräußerlichen Bestandes zugrundelegen wollte.
Die Unveräußerlichkeit des Archivguts in den Kommunalarchiven wurde auch im Archivgesetz des Landes festgeschrieben. Man kann solche normativen Klauseln getrost als Makulatur betrachten, wenn die Stadt Stralsund mit ihrer eklatanten Verdrehung der Rechtslage durchkommt.
Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass sich eine Kommune ratzfatz von einer jahrhundertealten bibliothekarischen Tradition verabschiedet, ohne sich im mindesten um die Rechtslage und die Interessenlage der regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken zu kümmern. Denn externer Sachverstand aus dem Bibliotheks- oder Archivbereich konnte im Vorfeld das Zerstörungswerk nicht verhindern - weil niemand informiert war.
Jeder Kenner weiß, dass Archivbibliotheken oft wichtige Ergänzungen zu den Pflichtexemplar- und Regionalbibliotheken darstellen, da sie das lokale Schrifttum in größerer Vollständigkeit dokumentieren. Es ist eine glatte Lüge, dass man keine Pomeranica verkauft habe. Unzählige höchst seltene Pommern-Drucke wurden in den Handel gegeben, auch die so seltenen barocken Gelegenheitsschriften, von denen einige in den elektronischen Bibliographien und Verbundkatalogen gar nicht nachweisbar sind.
Bei Zisska kommt ein Stettiner Türkendruck aus dem Jahr 1537 unter den Hammer. Es ist das einzige bekannte Exemplar aus dem Stadtarchiv Stralsund!
Glücklicherweise sind im deutschen Museumsbereich Verkäufe ein Tabu. Ein wichtiges Argument gegen die insbesondere in den USA weit verbreitete Deaccessioning-Mentalität ist der Hinweis auf die Absichten der Schenker, die ihr Kulturgut bewusst einer geschützten, dauerhaften Sammlung gestiftet haben. Was würde Graf von Löwen oder der Stadthistoriker Zober sagen, wenn sie von dem Stralsunder Vernichtungsakt erführen? Nochmals ein Zitat aus dem "Handbuch": "Besonderes bibliothekarisches Feingefühl bewies der Rektor Christian Heinrich Groskurd (1747-1806), der von jedem Schüler bei dessen Abschied wünschte, daß er der Bibliothek ein Buch schenke. Unter seiner Leitung wurde die Gymnasialbibliothek auch für außenstehende Liebhaber der Literatur geöffnet und entwickelte sich zu einem kulturellen städtischen Treffpunkt." Etliche handschriftliche Einträge Groskurds sind in den Beschreibungen der Antiquariate angezeigt (aber nicht wiedergegeben).
Wie kann man Bürgerinnen und Bürger motivieren, kulturgutverwahrende Institutionen zu bedenken, wenn der kommunale Träger sich kaltschnäuzig über jede moralische Verpflichtung, den Ewigkeitscharakter des Prinzips "Stiftung" zu respektieren, hinwegsetzt?
Schon das glimpflich ausgegangene Karlsruher Kulturgut-Debakel von 2006 hat deutlich gemacht, dass wir wirksame Sicherungen für Kulturgüter der öffentlichen Hand in Archiven, Bibliotheken und Museen brauchen. Die auf Bau- und Bodendenkmäler konzentrierte amtliche Denkmalpflege kümmert sich leider nicht um Sammlungen wie die Stralsunder Archivbibliothek.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bitte Sie:
- Distanzieren Sie sich von dem einer Welterbe-Stadt unwürdigen Vorgehen der Stadt Stralsund und setzen Sie jegliche Zusammenarbeit bis zur umfassenden Klärung der Angelegenheit aus!
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre eigene Ratsbibliothek im Stadtarchiv mit elektronischem Katalog auch der Altbestände in das Netz der wissenschaftlichen Bibliotheken einbezogen wird, damit das Bewusstsein für ihren besonderen Wert zunimmt und sie vor einem vergleichbaren kulturellen Vernichtungsfeldzug wie in Stralsund schützt. Wie wichtig Archive (und auch Archivbibliotheken) sind, hat der Kölner Archiveinsturz wohl hinreichend demonstriert.
- Setzen Sie sich dafür ein, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern das ihnen anvertraute Kulturgut treuhänderisch für die Öffentlichkeit dauerhaft bewahren und nicht kurzsichtig zum Stopfen von Haushaltslöchern verwenden!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Klaus Graf
http://www.heise.de/tp/blogs/8/153122
Derzeit 77 GEMA-kritische Links:
http://www.diigo.com/user/klausgraf/GEMA
Derzeit 77 GEMA-kritische Links:
http://www.diigo.com/user/klausgraf/GEMA
KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:14 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
November 2012, The Royal Library opens an experimental service, which will be available until the end of 2014. The offer is primarily directed at scholars, but is open to everybody. Books from the National Collection of Danish books, is normally only available for use in The Royal Library's reading room. But now, a digital copy can be ordered with just a few clicks, and at no charge. The project has to purposes:
- to make older Danish prints available for everybody;
- to minimize wear and tear on the original.
Books, that have been digitized, is available online for everybody, so that everyone can have access to their own digital copy of Danish classics, such as the printed works H. C. Andersen or Søren Kierkegaard.
And it is easy: you find the title in REX (the OPAC of The Royal Library), ask for it to be digitized, and when it is ready for use, you will receive an e-mail with a link. Note that only monographs are included in the offer, not periodicals or newspapers.
http://www.kb.dk/en/nb/samling/dod/index.html
- to make older Danish prints available for everybody;
- to minimize wear and tear on the original.
Books, that have been digitized, is available online for everybody, so that everyone can have access to their own digital copy of Danish classics, such as the printed works H. C. Andersen or Søren Kierkegaard.
And it is easy: you find the title in REX (the OPAC of The Royal Library), ask for it to be digitized, and when it is ready for use, you will receive an e-mail with a link. Note that only monographs are included in the offer, not periodicals or newspapers.
http://www.kb.dk/en/nb/samling/dod/index.html
KlausGraf - am Dienstag, 6. November 2012, 00:07 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pascale Hugues schreibt eine Eloge auf die Archivarbeit:
Ich hatte keine Ahnung. Nur durch Zufall habe ich es entdeckt: Berlin führt ein Doppelleben. Und zwar in Reinickendorf, gleich am Ende der Autobahn, nach dem Tunnel, ein unsichtbarer geheimer Ort, in dem das zweite Leben unserer Stadt brodelt. Denken Sie nur nicht, das Landesarchiv Berlin würde über eine verkrustete, tote, von unserer Welt völlig abgetrennte Vergangenheit wachen. Lassen Sie sich von der Oberfläche der Dinge nicht täuschen. Sie dürfen Berlin nicht als eine Stadt sehen, die nur in ihrem Jahrhundert existiert. Das da ist ein anderes Berlin, üppig, spannend, es lebt in den kilometerlangen Regalen und Gängen einer einstigen Waffen- und Munitionsfabrik.
Etwa 20 von uns teilen jeden Tag diese unerlaubte Existenz. Im Lesesaal, über Türme von Akten gebeugt, empfinden wir eine einzigartige Freude daran, wie Marder zu wühlen, in unserer Besessenheit die verstreichenden Stunden und die in der Außenwelt hereinbrechende Nacht zu vergessen. Ohne Rücksicht auf unsere Kräfte stürzen wir uns in die dichte Vergangenheit aus Manuskripten, Karteikarten und Listen, Plänen, Fotos, trockenen Berichten aus Hunderten von Ämtern und Behörden, die unsere Stadt von je her zu erzeugen scheint. Wir schwenken um. Wir wechseln das Zeitalter. Im Lesesaal bleibt die Zeit stehen, während sie draußen weitergaloppiert.
http://www.tagesspiegel.de/meinung/mon-berlin-das-zerbrechliche-gedaechtnis/7340150.html
Ich hatte keine Ahnung. Nur durch Zufall habe ich es entdeckt: Berlin führt ein Doppelleben. Und zwar in Reinickendorf, gleich am Ende der Autobahn, nach dem Tunnel, ein unsichtbarer geheimer Ort, in dem das zweite Leben unserer Stadt brodelt. Denken Sie nur nicht, das Landesarchiv Berlin würde über eine verkrustete, tote, von unserer Welt völlig abgetrennte Vergangenheit wachen. Lassen Sie sich von der Oberfläche der Dinge nicht täuschen. Sie dürfen Berlin nicht als eine Stadt sehen, die nur in ihrem Jahrhundert existiert. Das da ist ein anderes Berlin, üppig, spannend, es lebt in den kilometerlangen Regalen und Gängen einer einstigen Waffen- und Munitionsfabrik.
Etwa 20 von uns teilen jeden Tag diese unerlaubte Existenz. Im Lesesaal, über Türme von Akten gebeugt, empfinden wir eine einzigartige Freude daran, wie Marder zu wühlen, in unserer Besessenheit die verstreichenden Stunden und die in der Außenwelt hereinbrechende Nacht zu vergessen. Ohne Rücksicht auf unsere Kräfte stürzen wir uns in die dichte Vergangenheit aus Manuskripten, Karteikarten und Listen, Plänen, Fotos, trockenen Berichten aus Hunderten von Ämtern und Behörden, die unsere Stadt von je her zu erzeugen scheint. Wir schwenken um. Wir wechseln das Zeitalter. Im Lesesaal bleibt die Zeit stehen, während sie draußen weitergaloppiert.
http://www.tagesspiegel.de/meinung/mon-berlin-das-zerbrechliche-gedaechtnis/7340150.html
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 23:20 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.internet-law.de/2012/11/schleichwerbung-bei-wikipedia.html
Das OLG München hat mit Urteil vom 10.05.2012 (Az.: 29 U 515/12) den Inhalt eines Wikipedia-Artikels als getarnte Werbung i.S.v. § 4 Nr. 3 UWG und damit als wettbewerbswidrig bewertet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Weihrauchpr%C3%A4parat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weihrauchpr%C3%A4parat&diff=92662432&oldid=91178902
Das OLG München hat mit Urteil vom 10.05.2012 (Az.: 29 U 515/12) den Inhalt eines Wikipedia-Artikels als getarnte Werbung i.S.v. § 4 Nr. 3 UWG und damit als wettbewerbswidrig bewertet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Weihrauchpr%C3%A4parat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weihrauchpr%C3%A4parat&diff=92662432&oldid=91178902
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da kommt es mir wirklich hoch.
Am 24. Mai 2012 wurde im Donaukurier gemeldet:
Angelika Reich, die mittlerweile bereits wieder in Regensburg wohnt, ihren Aufgaben in Eichstätt allerdings noch nachgeht und sich erst in einigen Wochen in Altersteilzeit verabschiedet, leitete sieben Jahre lang die hiesige Uni-Bibliothek.
Vier Jahre lang stand Reich im Mittelpunkt eines nicht allzu erquicklichen Kapitels: Gegen sie war der Vorwurf erhoben worden, Bücher aus der von der hiesigen Bibliothek übernommenen Kapuzinerbibliothek zum Teil ungesehen vernichtet zu haben. „Die Diskussionen in den Zeitungen haben Sie und haben das Bibliothekswesen an sich tief getroffen“, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa.
Anfang 2007 wurden Vorwürfe laut, Reich hätte rund 83 Tonnen Bücher vernichtet. Neben einer internen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek hatte auch die Ingolstädter Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. Weder die fachliche noch die strafrechtliche Untersuchung konnte schließlich ein Vergehen feststellen. 2011 wurde die 62-Jährige rechtskräftig freigesprochen. „Heute sind Sie voll rehabilitiert“, betonte Ceynowa.
http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Streiterin-fuer-das-Buch;art575,2609607
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
Am 24. Mai 2012 wurde im Donaukurier gemeldet:
Angelika Reich, die mittlerweile bereits wieder in Regensburg wohnt, ihren Aufgaben in Eichstätt allerdings noch nachgeht und sich erst in einigen Wochen in Altersteilzeit verabschiedet, leitete sieben Jahre lang die hiesige Uni-Bibliothek.
Vier Jahre lang stand Reich im Mittelpunkt eines nicht allzu erquicklichen Kapitels: Gegen sie war der Vorwurf erhoben worden, Bücher aus der von der hiesigen Bibliothek übernommenen Kapuzinerbibliothek zum Teil ungesehen vernichtet zu haben. „Die Diskussionen in den Zeitungen haben Sie und haben das Bibliothekswesen an sich tief getroffen“, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa.
Anfang 2007 wurden Vorwürfe laut, Reich hätte rund 83 Tonnen Bücher vernichtet. Neben einer internen Untersuchung in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek hatte auch die Ingolstädter Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. Weder die fachliche noch die strafrechtliche Untersuchung konnte schließlich ein Vergehen feststellen. 2011 wurde die 62-Jährige rechtskräftig freigesprochen. „Heute sind Sie voll rehabilitiert“, betonte Ceynowa.
http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Streiterin-fuer-das-Buch;art575,2609607
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 23:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schmalenstroer kommentiert zutreffend
"Um zu verhindern, dass diese Werke kommentarlos in den Regalen liegen, wurde bereits vor einiger Zeit nach langen Querelen das Projekt einer historisch-kritischen Edition unter Federführung des Instituts für Zeitgeschichte in München in Angriff genommen. Doch auch dieses viel zu spät begonnene Projekt scheint jetzt in Gefahr zu geraten – sowohl die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch als auch der bayrische Kultusminister Ludwig Spaenle fordern, dass auch eine historisch-kritische Edition strafrechtliche Konsequenzen wegen der enthaltenen Volksverhetzung haben müsse. Nachdem bereits die Nutzung des Urheberrechtes zur Verhinderung einer Publikation zumindest problematisch war, sind auch solche juristischen Tricks nicht angebracht."
http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-debatte-um-mein-kampf-geht-weiter/
http://www.sueddeutsche.de/Y5N38C/939597/Debatte-um-Mein-Kampf.html
"Um zu verhindern, dass diese Werke kommentarlos in den Regalen liegen, wurde bereits vor einiger Zeit nach langen Querelen das Projekt einer historisch-kritischen Edition unter Federführung des Instituts für Zeitgeschichte in München in Angriff genommen. Doch auch dieses viel zu spät begonnene Projekt scheint jetzt in Gefahr zu geraten – sowohl die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch als auch der bayrische Kultusminister Ludwig Spaenle fordern, dass auch eine historisch-kritische Edition strafrechtliche Konsequenzen wegen der enthaltenen Volksverhetzung haben müsse. Nachdem bereits die Nutzung des Urheberrechtes zur Verhinderung einer Publikation zumindest problematisch war, sind auch solche juristischen Tricks nicht angebracht."
http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-debatte-um-mein-kampf-geht-weiter/
http://www.sueddeutsche.de/Y5N38C/939597/Debatte-um-Mein-Kampf.html
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:59 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie immer recht reichhaltig sind auch diesmal die Hinweise in:
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/11
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2012/11
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:58 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es spricht nicht für den Geschichtssinn der ehemals herrschenden Feudalherren und Ausbeuter, wenn wir in der hagiografischen Schrift von Haarmann, Haus Waldeck ..., 2011, S. 46 lesen, auf Wunsch der "Fürstenfamilie" werde auf die Rolle von Josias zu Waldeck und Pyrmont nicht eingegangen. Er war zuletzt General der Waffen-SS, wie man der Wikipedia entnimmt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Josias_zu_Waldeck_und_Pyrmont
Zur Nazi-Affinität des deutschen Hochadels vergleiche man auch die unzähligen Beiträge von Herrrn Contributor RA vom Hofe hier.

http://de.wikipedia.org/wiki/Josias_zu_Waldeck_und_Pyrmont
Zur Nazi-Affinität des deutschen Hochadels vergleiche man auch die unzähligen Beiträge von Herrrn Contributor RA vom Hofe hier.

KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 22:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://monumenta.ch
Die experimentelle Seite ermöglicht die synoptische Ansicht von Handschriftenabbildungen aus e-codices.ch und (lateinischen) E-Texten.
Die experimentelle Seite ermöglicht die synoptische Ansicht von Handschriftenabbildungen aus e-codices.ch und (lateinischen) E-Texten.
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 21:39 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibt Martin Strebel:
http://www.atelierstrebel.ch/ctrb_daten/1_buechertransport.pdf
Via
http://www.e-codices.unifr.ch/newsletter/archive/issue-07.htm
Die Position zu Handschuhen entspricht der in diesem Blog mehrfach vertretenen:
Gloves may impress outsiders because they signal that an object of inestimable value is being handled. In fact, however, gloves very much impair sensitivity. Much more important are clean, dry hands, avoidance of direct contact with script and miniatures, and very careful turning of pages.
http://www.atelierstrebel.ch/ctrb_daten/1_buechertransport.pdf
Via
http://www.e-codices.unifr.ch/newsletter/archive/issue-07.htm
Die Position zu Handschuhen entspricht der in diesem Blog mehrfach vertretenen:
Gloves may impress outsiders because they signal that an object of inestimable value is being handled. In fact, however, gloves very much impair sensitivity. Much more important are clean, dry hands, avoidance of direct contact with script and miniatures, and very careful turning of pages.
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 21:35 - Rubrik: Bestandserhaltung
Endlich digitalisiert:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/veesenmeyer1896
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/verzeichnis/f/fischer/index.html
(Die Selbstzeugnisse-Datenbank http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch/ zieht um und ist bis auf weiteres OFFLINE!!)
Autograph: Cgm 3091
Einige Zeilen Faksimile:
http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/VVB-1-7-4.pdf
Causa scribendi:
„daselb fleyssig zu beschreyben, vff welchen tag vnd zeyt sich ain ding hab verloffen, mir zu ainer gedechtnus, Deselbigen gleychen denen nach mir, welchem dan nach meim absterben, diß buch, als mein gschryfft zu kumpt“ (158/Bl. 343)
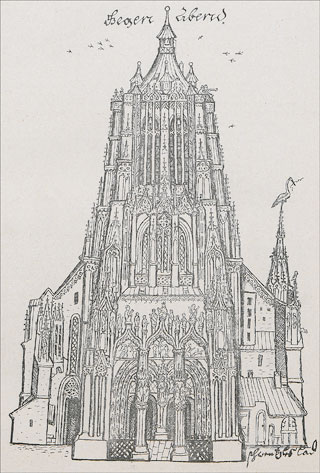
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/veesenmeyer1896
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/verzeichnis/f/fischer/index.html
(Die Selbstzeugnisse-Datenbank http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch/ zieht um und ist bis auf weiteres OFFLINE!!)
Autograph: Cgm 3091
Einige Zeilen Faksimile:
http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/VVB-1-7-4.pdf
Causa scribendi:
„daselb fleyssig zu beschreyben, vff welchen tag vnd zeyt sich ain ding hab verloffen, mir zu ainer gedechtnus, Deselbigen gleychen denen nach mir, welchem dan nach meim absterben, diß buch, als mein gschryfft zu kumpt“ (158/Bl. 343)
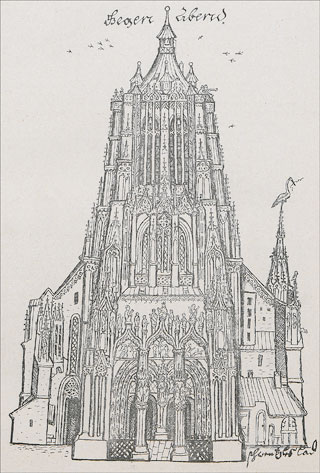
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 19:05 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei einem Telefonat mit dem Vorsitzenden Dr. Michael Diefenbacher äußerte sich dieser "schockiert" über die Verkäufe aus dem Stadtarchiv Stralsund. Katharina Tiemann (Fachgruppenvorsitzende Kommunale Archive) kündigte für die nächsten Tage eine öffentliche Stellungnahme an.
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
Update: http://archiv.twoday.net/stories/202635163/
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
Update: http://archiv.twoday.net/stories/202635163/
http://www.historici.nl/retroboeken/archiefgids_overheid/#page=0&size=800&accessor=toc_1&source=1
Via
http://vifabenelux.wordpress.com/2012/11/05/niederlande-archivfuhrer-fur-ministerien-1813-1940-jetzt-online/
Via
http://vifabenelux.wordpress.com/2012/11/05/niederlande-archivfuhrer-fur-ministerien-1813-1940-jetzt-online/
KlausGraf - am Montag, 5. November 2012, 15:16 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben offensichtlich gedruckten Presseorganen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern Auskünfte gegeben, die Sie mir verweigert
haben. Sie sind jedoch verpflichtet, alle Pressevertreter gleich zu
behandeln.
Ich füge vorsorglich ein Legitimationsschreiben der Kunstchronik bei,
mache jedoch darauf aufmerksam, dass sich Ihre Auskunftspflicht
gegenüber meinem Weblog Archivalia auch aus dem Landespressegesetz und
dem Rundfunkstaatsvertrag (§ 55 i. V. mit § 9a) ergibt. Außer dem
Grundrecht der Pressefreiheit ist bei der Abwägung auch das Grundrecht
der Wissenschaftsfreiheit zu berücksichtigen, da meine Publikationen
seit 1994 zu Fragen des Kulturgutschutzes wissenschaftlichen Charakter
haben.
An der Aufdeckung der Hintergründe der skandalösen Verkäufe aus dem
Stadtarchiv - ich verweise dazu auf die Berichterstattung der
Ostsee-Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und der - nicht nur von
mir stammenden - Beiträge und Kommentare in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
- besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Private Interessen
der Käufer müssen daher zurücktreten.
Ich darf Sie bitten, die folgenden Fragen umfassend und wahrheitsgemäß
bis zum 7.Oktober November 2012 23 Uhr zu beantworten. Aus Aktualitätsgründen
erscheint diese Frist angemessen, zumal letzte Woche die gedruckten
Organe rasch Antworten der Stadt bekamen. Sollte die Antwort nicht
fristgerecht eintreffen oder unzureichend sein, werde ich eine
einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Greifswald beantragen.
Ich empfehle die Lektüre des in
http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1
besprochenen Urteils zu Auskünften aus nicht-öffentlicher Sitzung.
1. Welcher Kaufpreis wurde mit dem Käufer vereinbart?
2. Ich ersuche um Mitteilung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Käufer.
3. Mit welcher Begründung genau wurde in nicht-öffentlicher Sitzung
der Bürgerschaft (oder eines Ausschusses) die Genehmigung des Verkaufs
beantragt?
4. Welche Liste verkaufter Bücher wurde damals dem Gremium vorgelegt
(Mitteilung des Textes)?
5. Wurde bei den Verkäufen aus dem Bestand Gymnasialbibliothek
geprüft, ob Bücher von Zacharias Orth darunter waren?
6. Befinden sich die Handbuch der historischen Buchbestände erwähnten
"Zwei Postinkunabeln von 1511 und 1513 (Gy B und C)" unter den in
Stralsund zurückbehaltenen Drucken?
7. Welche Titel genau wurden aus der Gymnasialbibliothek nicht verkauft?
8. Den Nachweis, dass auch 1829 katalogisierte Bestände der ehemaligen
Stadtbibliothek, sogar aus der Löwen'schen Sammlung, unter den im
Handel angebotenen Büchern auftauchen, konnte ich führen (siehe
Archivalia). Wieviele Drucke aus der ehemaligen Stadtbibliothek (ohne
Gymnasialbibliothek) und wieviele Drucke aus der Löwen'schen
Bibliothek wurden veräußert und welches waren die Gründe bzw.
Kriterien der Auswahl?
9. Trifft die Angabe von Zisska zu, dass
http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692 das einzige
Exemplar darstellt und daher nicht mehr in Stralsund in einem anderen
Abdruck vorhanden ist? Aus welchem Grund wurde dieses Stück verkauft?
10. Aus welchem Grund wurde darauf verzichtet, regionale und
überregionale Altbestandsbibliotheken bzw. Archive oder externe
Fachleute in die Planungen der Veräußerung einzubinden?
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Graf
Sie haben offensichtlich gedruckten Presseorganen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern Auskünfte gegeben, die Sie mir verweigert
haben. Sie sind jedoch verpflichtet, alle Pressevertreter gleich zu
behandeln.
Ich füge vorsorglich ein Legitimationsschreiben der Kunstchronik bei,
mache jedoch darauf aufmerksam, dass sich Ihre Auskunftspflicht
gegenüber meinem Weblog Archivalia auch aus dem Landespressegesetz und
dem Rundfunkstaatsvertrag (§ 55 i. V. mit § 9a) ergibt. Außer dem
Grundrecht der Pressefreiheit ist bei der Abwägung auch das Grundrecht
der Wissenschaftsfreiheit zu berücksichtigen, da meine Publikationen
seit 1994 zu Fragen des Kulturgutschutzes wissenschaftlichen Charakter
haben.
An der Aufdeckung der Hintergründe der skandalösen Verkäufe aus dem
Stadtarchiv - ich verweise dazu auf die Berichterstattung der
Ostsee-Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und der - nicht nur von
mir stammenden - Beiträge und Kommentare in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
- besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Private Interessen
der Käufer müssen daher zurücktreten.
Ich darf Sie bitten, die folgenden Fragen umfassend und wahrheitsgemäß
bis zum 7.
erscheint diese Frist angemessen, zumal letzte Woche die gedruckten
Organe rasch Antworten der Stadt bekamen. Sollte die Antwort nicht
fristgerecht eintreffen oder unzureichend sein, werde ich eine
einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Greifswald beantragen.
Ich empfehle die Lektüre des in
http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1
besprochenen Urteils zu Auskünften aus nicht-öffentlicher Sitzung.
1. Welcher Kaufpreis wurde mit dem Käufer vereinbart?
2. Ich ersuche um Mitteilung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Käufer.
3. Mit welcher Begründung genau wurde in nicht-öffentlicher Sitzung
der Bürgerschaft (oder eines Ausschusses) die Genehmigung des Verkaufs
beantragt?
4. Welche Liste verkaufter Bücher wurde damals dem Gremium vorgelegt
(Mitteilung des Textes)?
5. Wurde bei den Verkäufen aus dem Bestand Gymnasialbibliothek
geprüft, ob Bücher von Zacharias Orth darunter waren?
6. Befinden sich die Handbuch der historischen Buchbestände erwähnten
"Zwei Postinkunabeln von 1511 und 1513 (Gy B und C)" unter den in
Stralsund zurückbehaltenen Drucken?
7. Welche Titel genau wurden aus der Gymnasialbibliothek nicht verkauft?
8. Den Nachweis, dass auch 1829 katalogisierte Bestände der ehemaligen
Stadtbibliothek, sogar aus der Löwen'schen Sammlung, unter den im
Handel angebotenen Büchern auftauchen, konnte ich führen (siehe
Archivalia). Wieviele Drucke aus der ehemaligen Stadtbibliothek (ohne
Gymnasialbibliothek) und wieviele Drucke aus der Löwen'schen
Bibliothek wurden veräußert und welches waren die Gründe bzw.
Kriterien der Auswahl?
9. Trifft die Angabe von Zisska zu, dass
http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692 das einzige
Exemplar darstellt und daher nicht mehr in Stralsund in einem anderen
Abdruck vorhanden ist? Aus welchem Grund wurde dieses Stück verkauft?
10. Aus welchem Grund wurde darauf verzichtet, regionale und
überregionale Altbestandsbibliotheken bzw. Archive oder externe
Fachleute in die Planungen der Veräußerung einzubinden?
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Graf
Kein anderes Land weist einen solchen Reichtum an historischen Schulbibliotheken, die noch in den Schulen selbst betreut werden, auf wie Deutschland. Geht man vom Inkunabelbesitz aus, so verzeichnet der Gesamtkatalog der Wiegendrucke 2012 über 40 Gymnasialbibliotheken mit mindestens einer Inkunabel:
http://archiv.twoday.net/stories/11435879/
Allerdings gibt es selbstständige, nicht von anderen Institutionen betreute Altbestandsbibliotheken in Schulen vor allem in Westen. In der DDR gehörten diese Bibliotheken üblicherweise zu den historischen Buchbeständen, die man vernichtet, in größere Bibliotheken eingegliedert oder ins Ausland verscherbelt hat.
Die Studien von Dirk Sangmeister zu diesem Thema hat dieser leider nur in einem NZZ-Artikel zusammengefasst:
"Ein Akt der grossen Kulturbarbarei"
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article81CWS-1.385648
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264433/
Mit Björn Biesters Darstellung des Themas war ich sehr unzufrieden:
http://archiv.twoday.net/stories/3657871/
Nur in Thüringen listet das Handbuch der historischen Buchbestände etliche Schulbibliotheken auf (ich zähle 8 mit der privaten Ausfeld-Bibliothek). In Sachsen wird nur die - allerdings herausragende - Freiberger Bibliothek angeführt, eine Studie zur Geschichte der Volksschulen hält lapidar fest: "Die zahlreichen Schubibliotheken Sachsens sind in der DDR-Zeit durch Säuberungen, Nachlässigkeit und Verkauf weitgehend vernichtet worden" (Moderow 2007 S. 39). In Sachsen-Anhalt gibt es nur zwei, wenngleich sehr stattliche Sammlungen (Schulpforte und Zerbst).
In Mecklenburg-Vorpommern behandelt das Handbuch nur zwei Gymnasialbibliotheken: in Bad Doberan mit 2000 Bänden, davon nur einzelne aus dem 18. Jahrhundert, und in Waren (1391 Titel, davon nur 2 aus dem 16., 12 aus dem 17. Jahrhundert).
Die in die Stadtarchivbibliothek Stralsund eingegangene Gymnasialbibliothek war als geschlossener, gesondert aufgestellter und katalogisierter Bestand von daher eine große Ausnahme. Von den barbarischen DDR-Verkäufen blieb die Archivbibliothek in Stralsund, die zu den großen vier Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gehört, glücklicherweise verschont.
Nun hat sich die Stadt Stralsund entschieden nachzuholen, was damals versäumt worden war: ein hochrangiges Bücherensemble zu verramschen und damit als Geschichtsquelle zu vernichten.
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
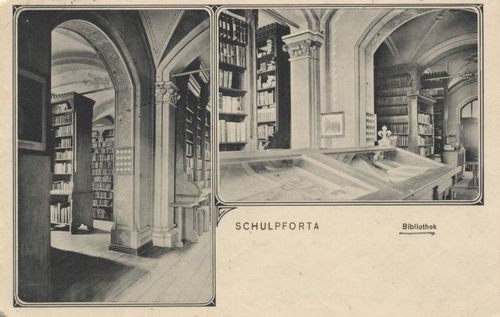 Schulbibliothek Schulpforta
Schulbibliothek Schulpforta
http://archiv.twoday.net/stories/11435879/
Allerdings gibt es selbstständige, nicht von anderen Institutionen betreute Altbestandsbibliotheken in Schulen vor allem in Westen. In der DDR gehörten diese Bibliotheken üblicherweise zu den historischen Buchbeständen, die man vernichtet, in größere Bibliotheken eingegliedert oder ins Ausland verscherbelt hat.
Die Studien von Dirk Sangmeister zu diesem Thema hat dieser leider nur in einem NZZ-Artikel zusammengefasst:
"Ein Akt der grossen Kulturbarbarei"
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article81CWS-1.385648
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264433/
Mit Björn Biesters Darstellung des Themas war ich sehr unzufrieden:
http://archiv.twoday.net/stories/3657871/
Nur in Thüringen listet das Handbuch der historischen Buchbestände etliche Schulbibliotheken auf (ich zähle 8 mit der privaten Ausfeld-Bibliothek). In Sachsen wird nur die - allerdings herausragende - Freiberger Bibliothek angeführt, eine Studie zur Geschichte der Volksschulen hält lapidar fest: "Die zahlreichen Schubibliotheken Sachsens sind in der DDR-Zeit durch Säuberungen, Nachlässigkeit und Verkauf weitgehend vernichtet worden" (Moderow 2007 S. 39). In Sachsen-Anhalt gibt es nur zwei, wenngleich sehr stattliche Sammlungen (Schulpforte und Zerbst).
In Mecklenburg-Vorpommern behandelt das Handbuch nur zwei Gymnasialbibliotheken: in Bad Doberan mit 2000 Bänden, davon nur einzelne aus dem 18. Jahrhundert, und in Waren (1391 Titel, davon nur 2 aus dem 16., 12 aus dem 17. Jahrhundert).
Die in die Stadtarchivbibliothek Stralsund eingegangene Gymnasialbibliothek war als geschlossener, gesondert aufgestellter und katalogisierter Bestand von daher eine große Ausnahme. Von den barbarischen DDR-Verkäufen blieb die Archivbibliothek in Stralsund, die zu den großen vier Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gehört, glücklicherweise verschont.
Nun hat sich die Stadt Stralsund entschieden nachzuholen, was damals versäumt worden war: ein hochrangiges Bücherensemble zu verramschen und damit als Geschichtsquelle zu vernichten.
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund
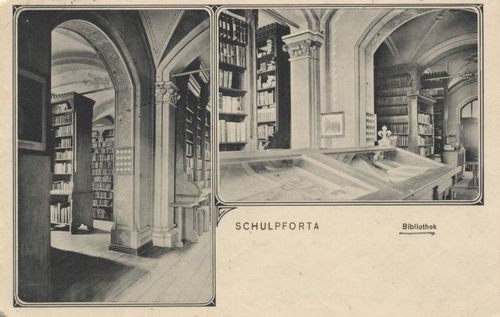 Schulbibliothek Schulpforta
Schulbibliothek Schulpfortanoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Schlüssel ist der gedruckte Katalog von 1829, den ich in
http://archiv.twoday.net/stories/197335310/
erwähnte und der in München digitalisiert vorliegt. Den neuen Katalog der gesondert aufgestellten Löwen'schen Bibliothek von Dietmar Gohlisch habe ich nicht zur Hand:
http://www.scheunenverlag.de/books/3-929370-86-7.html
Die im gedruckten Katalog von 1829 genannte Signatur wurde auf dem Exlibris mit Bleistift eingetragen (so S. 21 des Katalogs von 1829).
Die Smith-Übersetzung, die ich unter
http://archiv.twoday.net/stories/197333288/
erwähnte, erscheint S. 368 als B 8. 577.a-b
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10537046.html?pageNo=410
Auf dem Bild zum Angebot kann man die Bleistiftsignatur auf dem Exlibris lesen: B 8° 577
Zur Causa Stralsund
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

http://archiv.twoday.net/stories/197335310/
erwähnte und der in München digitalisiert vorliegt. Den neuen Katalog der gesondert aufgestellten Löwen'schen Bibliothek von Dietmar Gohlisch habe ich nicht zur Hand:
http://www.scheunenverlag.de/books/3-929370-86-7.html
Die im gedruckten Katalog von 1829 genannte Signatur wurde auf dem Exlibris mit Bleistift eingetragen (so S. 21 des Katalogs von 1829).
Die Smith-Übersetzung, die ich unter
http://archiv.twoday.net/stories/197333288/
erwähnte, erscheint S. 368 als B 8. 577.a-b
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10537046.html?pageNo=410
Auf dem Bild zum Angebot kann man die Bleistiftsignatur auf dem Exlibris lesen: B 8° 577
Zur Causa Stralsund
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

Als die soeben bestallte neue Leiterin des Stralsunder Stadtarchivs 2009 mit der Ostseezeitung sprach, erwähnte sie als ein geplantes Projekt die Zusammenarbeit ihres Archivs mit dem Kulturhistorischen Museum: "eine Schau zum 450. Jubiläum des Humanistischen Gymnasiums im Katharinenkloster" - diese Schule war eben die Anstalt, deren verbliebener Bibliotheksbestand im Stadtarchiv bis 2012 überdauerte und nunmehr durch Verkauf an ein Internetantiquariat in alle Winde zerstreut werden wird.
Die als "nie schole" oder "grote schole" am 20. April 1560 gegründete erste öffentliche Lehranstalt der Stadt, hernach "S.Katharinen-Schule" genannt, bezeichnete sich erst mit ausgehendem 16. Jahrhundert als "Gymnasium"; sie blieb dann für die weiteren Jahrhunderte als einzige höhere Bildungsanstalt das "Stralsunder Gymnasium", etwas edler auch "Gymnasium zu Stralsund". (nach: Ernst Heinrich Zober: Urkundliche Geschichte des Stralsunder Gymnasiums von seiner Stiftung 1560 bis 1860. Stralsund 1860) Das Stralsunder Gymnasium existierte durchgehend bis 1951, als es im Zuge der DDR-Schulreformen geschlossen wurde; in sein Schulgebäude am Katharinenkloster zog das Ozeaneum ein.
Die von der der neuen Chefin für das "Gedächtnis der Stadt" (so die Ostseezeitung) avisierte Ausstellung hat allem Anschein nach - einen Hinweis fand ich nicht - nie stattgefunden; eine Notiz in der Ostsee-Zeitung erinnerte 2010 an das Gründungsdatum der vor 60 Jahren geschlossenen Anstalt.
Keine Ahnung, ob die Frage gestattet ist: aber könnte es vielleicht sein, dass eine Archivleitung, zumal eine eventuell erhellende Ausstellung nicht stattfand, drei Jahre später ihrem Chef, dem Bürgermeister, nicht genau erklären konnte, was zu verkaufen sich die Stadt tatsächlich anschickte? Kein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der den oben erwähnten Zober aus dem eigenen Bestand, unterdessen bei Ebay angeboten, zur Hand gereicht hätte?
Wie wird man dies den Stralsunder Bürgern, die sich vielleicht in 48 Jahren einer 500-jährigen städtischen Bildungsgeschichte freuen wollen, dermaleinst wohl erklären?
Die als "nie schole" oder "grote schole" am 20. April 1560 gegründete erste öffentliche Lehranstalt der Stadt, hernach "S.Katharinen-Schule" genannt, bezeichnete sich erst mit ausgehendem 16. Jahrhundert als "Gymnasium"; sie blieb dann für die weiteren Jahrhunderte als einzige höhere Bildungsanstalt das "Stralsunder Gymnasium", etwas edler auch "Gymnasium zu Stralsund". (nach: Ernst Heinrich Zober: Urkundliche Geschichte des Stralsunder Gymnasiums von seiner Stiftung 1560 bis 1860. Stralsund 1860) Das Stralsunder Gymnasium existierte durchgehend bis 1951, als es im Zuge der DDR-Schulreformen geschlossen wurde; in sein Schulgebäude am Katharinenkloster zog das Ozeaneum ein.
Die von der der neuen Chefin für das "Gedächtnis der Stadt" (so die Ostseezeitung) avisierte Ausstellung hat allem Anschein nach - einen Hinweis fand ich nicht - nie stattgefunden; eine Notiz in der Ostsee-Zeitung erinnerte 2010 an das Gründungsdatum der vor 60 Jahren geschlossenen Anstalt.
Keine Ahnung, ob die Frage gestattet ist: aber könnte es vielleicht sein, dass eine Archivleitung, zumal eine eventuell erhellende Ausstellung nicht stattfand, drei Jahre später ihrem Chef, dem Bürgermeister, nicht genau erklären konnte, was zu verkaufen sich die Stadt tatsächlich anschickte? Kein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der den oben erwähnten Zober aus dem eigenen Bestand, unterdessen bei Ebay angeboten, zur Hand gereicht hätte?
Wie wird man dies den Stralsunder Bürgern, die sich vielleicht in 48 Jahren einer 500-jährigen städtischen Bildungsgeschichte freuen wollen, dermaleinst wohl erklären?
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In
http://www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/archivare-erzuernt-ueber-buecherverkauf.html
heißt es:
Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter.
Dazu zutreffend Margret Ott:
http://www.blog.pommerscher-greif.de/die-zerschlagung-der-stralsunder-gymnasialbibliothek/
Besonders dreist finde ich die Aussage des Stadtprechers Peter Koslik gegenüber der Schweriner Volkszeitung, 3.11.2012 : „Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. “Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde”, sagte Koslik weiter. ”
Und was bitteschön sind reihenweise gebundene Jahrgänge der “Stralsundischen Zeitung” zwischen 1802 und 1845 sowie des “Amts Blatt der königlichen Regierung zu Stralsund” die der Antiquar bei ebay anbietet? Und was sind Pomeraneidum von Johannes Seckerwitz (- In gebundener Rede verfasste Seckerwitz auf Latein Lieder, die sich mit Pommerschen Themen befassen) und die Veröffentlichungen des Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins?
Zahllose weitere Beispiele finden Sie bei Archivalia unter dem Stichwort Stralsund.
Dieser Seite und allem voran dem Historiker Dr. Klaus Graf ist die Aufdeckung dieses Skandals zu danken, der bekannt wurde, als das Stadtarchiv wegen Schimmel geschlossen werden musste. (wir berichteten hier)
Ich bin kein Historiker, kein Archivar und auch kein Jurist. Daher kann ich auch nicht beurteilen, ob der Verkauf legal gewesen ist oder nicht. Aber ich bin ein an Pommern und pommerschem Kulturgut interessierter Mensch und als solchen ärgert mich diese Verscherbelung und Zerschlagung dieser Bibliothek ungemein. Es muss doch auch für eine finanziell angeschlagene Kommune eine andere Möglichkeit geben, als das historische Tafelsilber zu verkaufen?
Ich kann nur hoffen, dass der Sturm der Entrüstung , den diese Nachricht ausgelöst hat, nicht nur bei den Mitgliedern des Hauptausschusses der Bürgerschaft, die am 5.6.2012 in nichtöffentlicher Sitzung den Verkauf der Bibliothek beschlossen hatten sondern auch bei vielen anderen einflussreichen Personen ein Umdenken bewirkt, vielleicht lässt sich ja wenigstens noch ein Teilbestand retten.
Schauen wir uns einige ausgewählte Stücke bei Ebay (Anbieter Robert Hassold) an.
http://www.ebay.de/itm/Original-Schrift-z-Andenken-v-Gregorius-Langemak-St-Nikolai-Kirch-Stralsund-1780-/300792310342
"Original Schrift z.Andenken v.Gregorius
Langemak,St.Nikolai Kirch.Stralsund 1780"
Ich finde keinen Nachweis im KVK (DE, CH, AT)!
http://www.ebay.de/itm/Stralsund-Schrift-zur-feierlichen-Einfuhrung-des-Lehrers-E-C-Schulz-1787-/290787637060
Schrift zur feierlichen Einführung des Lehrers E.C. Schulz 1787
Nicht im KVK.
http://www.ebay.de/itm/Stralsund-Statut-des-Hypotheken-Vereins-zu-Stralsund-Von-1899-/290773346341
Statut des Hypotheken-Vereins zu Stralsund. Von 1899
Nicht im KVK.
http://www.ebay.de/itm/Zwo-Reden-Einfuhrung-e-General-Superintendanten-u-Pommern-Rugen-1746-/290787668903
Laut KVK nur in Greifswald.
http://www.ebay.de/itm/Geschichte-Reichsbankstelle-Stralsund-Broschur-v-Bankdir-Knaack1927-/290756485435
Zur Geschichte der Reichsbankstelle in Stralsund, 1927.
Laut KVK nur in der DNB Leipzig und in der SB Berlin.
http://www.ebay.de/itm/Stralsundische-Zeitung-Original-Ausgabe-1802-gebunden-/300787928738
Stralsundische Zeitung 1802.
Jg. laut ZDB nur in Greifswald, Rostock und Dortmund
vorhanden. Also nicht in Berlin!
Die Beispiele dafür, dass seltenste Regionalia verhökert wurden, ließen sich unschwer vermehren.
Besonders pikant: Verkauft wird auch
"Alphabetisches Verzeichnis d. in der Rathsbibliothek zu Stralsund ..Bücher 1829"
http://www.ebay.de/itm/Alphabetisches-Verzeichnis-d-Rathsbibliothek-Stralsund-Bucher-1829-/300797385257
Einer der ältesten gedruckten Bibliothekskataloge einer deutschen Stadtbibliothek (im GBV nur 6 Nachweise). In München digitalisiert:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10537046-6
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

http://www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/archivare-erzuernt-ueber-buecherverkauf.html
heißt es:
Bei den verkauften Bänden handelt es sich nach Angaben von Sprecher Peter Koslik überwiegend um unterrichtsbegleitende Literatur für Schüler und Lehrer auf den Gebieten Philologie und Theologie aus den vergangenen Jahrhunderten. Ihre regionalgeschichtliche Bedeutung sei eher minimal. Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. "Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde", sagte Koslik weiter.
Dazu zutreffend Margret Ott:
http://www.blog.pommerscher-greif.de/die-zerschlagung-der-stralsunder-gymnasialbibliothek/
Besonders dreist finde ich die Aussage des Stadtprechers Peter Koslik gegenüber der Schweriner Volkszeitung, 3.11.2012 : „Pomeranica, also Literatur mit Bezug zur historischen Region Pommern, sei nicht verkauft worden. “Das würden wir niemals machen. Das wäre eine Todsünde”, sagte Koslik weiter. ”
Und was bitteschön sind reihenweise gebundene Jahrgänge der “Stralsundischen Zeitung” zwischen 1802 und 1845 sowie des “Amts Blatt der königlichen Regierung zu Stralsund” die der Antiquar bei ebay anbietet? Und was sind Pomeraneidum von Johannes Seckerwitz (- In gebundener Rede verfasste Seckerwitz auf Latein Lieder, die sich mit Pommerschen Themen befassen) und die Veröffentlichungen des Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins?
Zahllose weitere Beispiele finden Sie bei Archivalia unter dem Stichwort Stralsund.
Dieser Seite und allem voran dem Historiker Dr. Klaus Graf ist die Aufdeckung dieses Skandals zu danken, der bekannt wurde, als das Stadtarchiv wegen Schimmel geschlossen werden musste. (wir berichteten hier)
Ich bin kein Historiker, kein Archivar und auch kein Jurist. Daher kann ich auch nicht beurteilen, ob der Verkauf legal gewesen ist oder nicht. Aber ich bin ein an Pommern und pommerschem Kulturgut interessierter Mensch und als solchen ärgert mich diese Verscherbelung und Zerschlagung dieser Bibliothek ungemein. Es muss doch auch für eine finanziell angeschlagene Kommune eine andere Möglichkeit geben, als das historische Tafelsilber zu verkaufen?
Ich kann nur hoffen, dass der Sturm der Entrüstung , den diese Nachricht ausgelöst hat, nicht nur bei den Mitgliedern des Hauptausschusses der Bürgerschaft, die am 5.6.2012 in nichtöffentlicher Sitzung den Verkauf der Bibliothek beschlossen hatten sondern auch bei vielen anderen einflussreichen Personen ein Umdenken bewirkt, vielleicht lässt sich ja wenigstens noch ein Teilbestand retten.
Schauen wir uns einige ausgewählte Stücke bei Ebay (Anbieter Robert Hassold) an.
http://www.ebay.de/itm/Original-Schrift-z-Andenken-v-Gregorius-Langemak-St-Nikolai-Kirch-Stralsund-1780-/300792310342
"Original Schrift z.Andenken v.Gregorius
Langemak,St.Nikolai Kirch.Stralsund 1780"
Ich finde keinen Nachweis im KVK (DE, CH, AT)!
http://www.ebay.de/itm/Stralsund-Schrift-zur-feierlichen-Einfuhrung-des-Lehrers-E-C-Schulz-1787-/290787637060
Schrift zur feierlichen Einführung des Lehrers E.C. Schulz 1787
Nicht im KVK.
http://www.ebay.de/itm/Stralsund-Statut-des-Hypotheken-Vereins-zu-Stralsund-Von-1899-/290773346341
Statut des Hypotheken-Vereins zu Stralsund. Von 1899
Nicht im KVK.
http://www.ebay.de/itm/Zwo-Reden-Einfuhrung-e-General-Superintendanten-u-Pommern-Rugen-1746-/290787668903
Laut KVK nur in Greifswald.
http://www.ebay.de/itm/Geschichte-Reichsbankstelle-Stralsund-Broschur-v-Bankdir-Knaack1927-/290756485435
Zur Geschichte der Reichsbankstelle in Stralsund, 1927.
Laut KVK nur in der DNB Leipzig und in der SB Berlin.
http://www.ebay.de/itm/Stralsundische-Zeitung-Original-Ausgabe-1802-gebunden-/300787928738
Stralsundische Zeitung 1802.
Jg. laut ZDB nur in Greifswald, Rostock und Dortmund
vorhanden. Also nicht in Berlin!
Die Beispiele dafür, dass seltenste Regionalia verhökert wurden, ließen sich unschwer vermehren.
Besonders pikant: Verkauft wird auch
"Alphabetisches Verzeichnis d. in der Rathsbibliothek zu Stralsund ..Bücher 1829"
http://www.ebay.de/itm/Alphabetisches-Verzeichnis-d-Rathsbibliothek-Stralsund-Bucher-1829-/300797385257
Einer der ältesten gedruckten Bibliothekskataloge einer deutschen Stadtbibliothek (im GBV nur 6 Nachweise). In München digitalisiert:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10537046-6
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/search?q=Stralsund

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg
Eröffnung: 8.11.2012, 18:30

"Was geschieht mit den Hinterlassenschaften eines berühmten Künstlers? Wer kümmert sich um den Nachlass einer Person des öffentlichen Interesses? Wer entscheidet, was für die Nachwelt aufgehoben wird? Welche Rolle können Institutionen des Kunst- und Kulturbetriebs dabei spielen? Wie aktiv sind Künstler selbst daran beteiligt, ein Bild von sich für die Nachwelt zu formen? Wird die Bedeutung eines Werkes – aber auch der Alltagsobjekte eines Nachla
sses – von den Erben und öffentlichen Einrichtungen erkannt und respektiert, oder verfolgen diese auch ihre ganz eigenen Absichten? Was kann uns ein Nachlass über das Leben und Werk eines Künstlers sagen?
Diesen und anderen Fragen geht die Sonderausstellung "Special Delivery" nach, indem sie Nachlässe aus den Bereichen Literatur, bildender Kunst, Musik und Film präsentiert. Gezeigt werden schriftliche Dokumente, Fotos und Objekte aus den Nachlässen von Bertolt Brecht, Mascha Kaléko, Walter Höllerer, Richard Oelze, Ronald Searle, Max Reger und Marlene Dietrich.
Zur Eröffnung gibt Prof. Ulrich Ott, ehemaliger Direktor des Schiller Nationalmuseums, eine Einführung in die Ausstellung. Anschließend wird Werner Sudendorf, Leiter der Sammlungen der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen in Berlin, den Nachlass Marlene Dietrichs präsentieren.
Mehr Informationen zum Projekt gibt's hier: http://www.kuenstlernachlaesse.info
via Facebook-Seite des Sulzbacher Literaturarchivs
Eröffnung: 8.11.2012, 18:30

"Was geschieht mit den Hinterlassenschaften eines berühmten Künstlers? Wer kümmert sich um den Nachlass einer Person des öffentlichen Interesses? Wer entscheidet, was für die Nachwelt aufgehoben wird? Welche Rolle können Institutionen des Kunst- und Kulturbetriebs dabei spielen? Wie aktiv sind Künstler selbst daran beteiligt, ein Bild von sich für die Nachwelt zu formen? Wird die Bedeutung eines Werkes – aber auch der Alltagsobjekte eines Nachla
sses – von den Erben und öffentlichen Einrichtungen erkannt und respektiert, oder verfolgen diese auch ihre ganz eigenen Absichten? Was kann uns ein Nachlass über das Leben und Werk eines Künstlers sagen?
Diesen und anderen Fragen geht die Sonderausstellung "Special Delivery" nach, indem sie Nachlässe aus den Bereichen Literatur, bildender Kunst, Musik und Film präsentiert. Gezeigt werden schriftliche Dokumente, Fotos und Objekte aus den Nachlässen von Bertolt Brecht, Mascha Kaléko, Walter Höllerer, Richard Oelze, Ronald Searle, Max Reger und Marlene Dietrich.
Zur Eröffnung gibt Prof. Ulrich Ott, ehemaliger Direktor des Schiller Nationalmuseums, eine Einführung in die Ausstellung. Anschließend wird Werner Sudendorf, Leiter der Sammlungen der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen in Berlin, den Nachlass Marlene Dietrichs präsentieren.
Mehr Informationen zum Projekt gibt's hier: http://www.kuenstlernachlaesse.info
via Facebook-Seite des Sulzbacher Literaturarchivs
Wolf Thomas - am Sonntag, 4. November 2012, 16:30 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hymne auf Privatarchive? ;-)
Wolf Thomas - am Sonntag, 4. November 2012, 13:28 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es ist schon viel über den Verkauf von Büchern aus der Gynasialbibliothek Stralsund geschrieben worden. Auf rechtliche Aspekte wurde hier bis jetzt nur vereinzelt eingegangen.
Es stellt sich die Frage ob der Verkauf der Bücher in einem nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetensitzung hätte erfolgen dürfen.
In der Hauptsatzung der Stadt Stralsund steht zum nichtöffentlichen Teil der Sitzungen folgendes:
§ 7 - Sitzungen der Bürgerschaft
(§ 29 KV M-V)
(1) Die Bürgerschaftssitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen
2. Steuer-, Abgabe- und Entgeltangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Vergabe von Aufträgen
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschlussbericht.
(3) Die Bürgerschaft kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten entsprechend Nummern 1. bis 4. in öffentlicher Sitzung behandeln.
(4) Unbeschadet Abs. 2 und 3 ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.
Gemäß dem § 7 der Hauptsatzung der Stadt Stralsund, ist dieser Verkauf kein schutzwürdiger Tatbestand und hätte öffentlich behandet werden müssen.
Schutzwürdige Angelegenheiten sind Personalverhandlungen, private Verkäufe sowie Steuerangelegenheiten. Der Verkauf der Bücher erfolgte aus den städtischen Besitz und fällt so nicht unter dem § 7 Nr. 2.
War dieses Verfahren ein Verstoss gegen die Hauptsatzung der Stadt Stralsund ?
Es stellt sich die Frage ob der Verkauf der Bücher in einem nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetensitzung hätte erfolgen dürfen.
In der Hauptsatzung der Stadt Stralsund steht zum nichtöffentlichen Teil der Sitzungen folgendes:
§ 7 - Sitzungen der Bürgerschaft
(§ 29 KV M-V)
(1) Die Bürgerschaftssitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen
2. Steuer-, Abgabe- und Entgeltangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Vergabe von Aufträgen
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschlussbericht.
(3) Die Bürgerschaft kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten entsprechend Nummern 1. bis 4. in öffentlicher Sitzung behandeln.
(4) Unbeschadet Abs. 2 und 3 ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.
Gemäß dem § 7 der Hauptsatzung der Stadt Stralsund, ist dieser Verkauf kein schutzwürdiger Tatbestand und hätte öffentlich behandet werden müssen.
Schutzwürdige Angelegenheiten sind Personalverhandlungen, private Verkäufe sowie Steuerangelegenheiten. Der Verkauf der Bücher erfolgte aus den städtischen Besitz und fällt so nicht unter dem § 7 Nr. 2.
War dieses Verfahren ein Verstoss gegen die Hauptsatzung der Stadt Stralsund ?
FredLo - am Sonntag, 4. November 2012, 09:55
Jackie Dooley blogged: " .... Shades of Katrina, Rita, Irene, and the other [un]natural disasters that have struck the U.S. over the past decade. We all undoubtedly have friends and colleagues in New Jersey and New York who are struggling to dig their archives out from under water, mud, and garbage, after which they’ll begin recovery procedures for materials that aren’t beyond hope. No doubt some of you will be on the front lines with them as the archival community pulls together once again to help each other out.
I’m here with a plea: please find it in your hearts to help build SAA’s Disaster Recovery Fund for Archives. Even the smallest amounts will be gratefully welcomed. We do have some funds, but they’ll be depleted quickly once grant requests begin to flow in. Donate here.
We stand ready to award initial grants of $2,000 to those who complete the simple application process. It’s not much, but every bit helps. One option is to have the funds sent directly to a vendor once the institution has an invoice in hand. Go here to learn more about the grants.
I’ve been communicating with lots of colleagues in the affected areas and learned today that the New York State Archives Disaster Response Team already has mobilized in a big way. They’re reaching out to a wide range of institutions, many of which haven’t yet been able to assess conditions because they can’t gain access to their collections–nor do some have electrical power, which means they can’t even make telephone or email contact. The waiting must be excruciating. ....."
I’m here with a plea: please find it in your hearts to help build SAA’s Disaster Recovery Fund for Archives. Even the smallest amounts will be gratefully welcomed. We do have some funds, but they’ll be depleted quickly once grant requests begin to flow in. Donate here.
We stand ready to award initial grants of $2,000 to those who complete the simple application process. It’s not much, but every bit helps. One option is to have the funds sent directly to a vendor once the institution has an invoice in hand. Go here to learn more about the grants.
I’ve been communicating with lots of colleagues in the affected areas and learned today that the New York State Archives Disaster Response Team already has mobilized in a big way. They’re reaching out to a wide range of institutions, many of which haven’t yet been able to assess conditions because they can’t gain access to their collections–nor do some have electrical power, which means they can’t even make telephone or email contact. The waiting must be excruciating. ....."
Wolf Thomas - am Samstag, 3. November 2012, 18:20 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"INTENSIVSTATIONEN
Ein Abend für Christoph Schlingensief
Sonnabend, 3. November 2012, 19 Uhr
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin-Tiergarten
Lesung, Gespräche, Filme, Musik
mit Till Briegleb, Harald Falckenberg, Jürgen Flimm, Wolfgang Höbel, Friedrich Küppersbusch, Aino Laberenz, Helge Malchow, Werner Nekes, Frieder Schlaich, Klaus Staeck und Wim Wenders. Ehrengast Patti Smith
>> Restkarten 12/7 Euro an der Abendkasse
>> Pressekarten Tel. 030 20057-1514, presse@adk.de
Noch zu seinen Lebzeiten hat Christoph Schlingensief (1960-2010) sein Archiv der Akademie übergeben. Es umfasst über 40 Regalmeter, der umfangreichste Teil des Bestandes besteht aus audiovisuellen Medien. Anlässlich der Eröffnung des Archivs für die interessierte Öffentlichkeit und Wissenschaft stellt Aino Laberenz im Gespräch mit Helge Malchow das von ihr herausgegebene Buch „Ich weiß, ich war's“ vor. Wegbegleiter und Kollegen berichten über ihre Begegnung und Arbeit mit Christoph Schlingensief. Ehrengast ist Patti Smith. Begleitend zur Veranstaltung wird in Vitrinen Originalmaterial aus dem Archiv präsentiert.
Der Archivbestand beinhaltet neben Plakaten, Korrespondenz, Programmheften und Fotos die Produktionsunterlagen zu einigen Filmen und Inszenierungen Schlingensiefs, von der Konzeptionsskizze bis zur Presse-Resonanz und Fan-Post, darunter auch diverse Requisiten sowie Werbe-Artikel zu einzelnen Aktionen (Chance 2000, Aktion 18). Der große Bestand an audiovisuellen Medien gibt Einblick in seine Arbeitsweise und über seine Interessen. Seine umfassende „Filmbibliothek“ verweist nicht nur auf Filme anderer Regisseure, die ihm wichtig waren, sondern zeigt außerdem, welche Themen und Textpassagen Schlingensief in sein eigenes Werk integrierte und weiter verarbeitete.
Christoph Schlingensiefs genreübergreifendes Werk umfasst die unterschiedlichsten Spielarten. Die künstlerischen Bereiche, in denen Schlingensief zu Hause war – Film, Theater, Oper und Aktionskunst – stehen keineswegs separat nebeneinander, sondern sind miteinander verwoben durch zentrale Themen und Motive, die beständig aufgegriffen, neu durchdacht und weiterentwickelt wurden. "
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste v. 2.11.2012
Ein Abend für Christoph Schlingensief
Sonnabend, 3. November 2012, 19 Uhr
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin-Tiergarten
Lesung, Gespräche, Filme, Musik
mit Till Briegleb, Harald Falckenberg, Jürgen Flimm, Wolfgang Höbel, Friedrich Küppersbusch, Aino Laberenz, Helge Malchow, Werner Nekes, Frieder Schlaich, Klaus Staeck und Wim Wenders. Ehrengast Patti Smith
>> Restkarten 12/7 Euro an der Abendkasse
>> Pressekarten Tel. 030 20057-1514, presse@adk.de
Noch zu seinen Lebzeiten hat Christoph Schlingensief (1960-2010) sein Archiv der Akademie übergeben. Es umfasst über 40 Regalmeter, der umfangreichste Teil des Bestandes besteht aus audiovisuellen Medien. Anlässlich der Eröffnung des Archivs für die interessierte Öffentlichkeit und Wissenschaft stellt Aino Laberenz im Gespräch mit Helge Malchow das von ihr herausgegebene Buch „Ich weiß, ich war's“ vor. Wegbegleiter und Kollegen berichten über ihre Begegnung und Arbeit mit Christoph Schlingensief. Ehrengast ist Patti Smith. Begleitend zur Veranstaltung wird in Vitrinen Originalmaterial aus dem Archiv präsentiert.
Der Archivbestand beinhaltet neben Plakaten, Korrespondenz, Programmheften und Fotos die Produktionsunterlagen zu einigen Filmen und Inszenierungen Schlingensiefs, von der Konzeptionsskizze bis zur Presse-Resonanz und Fan-Post, darunter auch diverse Requisiten sowie Werbe-Artikel zu einzelnen Aktionen (Chance 2000, Aktion 18). Der große Bestand an audiovisuellen Medien gibt Einblick in seine Arbeitsweise und über seine Interessen. Seine umfassende „Filmbibliothek“ verweist nicht nur auf Filme anderer Regisseure, die ihm wichtig waren, sondern zeigt außerdem, welche Themen und Textpassagen Schlingensief in sein eigenes Werk integrierte und weiter verarbeitete.
Christoph Schlingensiefs genreübergreifendes Werk umfasst die unterschiedlichsten Spielarten. Die künstlerischen Bereiche, in denen Schlingensief zu Hause war – Film, Theater, Oper und Aktionskunst – stehen keineswegs separat nebeneinander, sondern sind miteinander verwoben durch zentrale Themen und Motive, die beständig aufgegriffen, neu durchdacht und weiterentwickelt wurden. "
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste v. 2.11.2012
Wolf Thomas - am Samstag, 3. November 2012, 14:20 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ostsee-Zeitung.de 3. November 2012:
"Von Kulturfrevel ist die Rede. Der Aufschrei unter Wissenschaftlern, Historikern, Archivaren und Bibliothekaren ist groß. Deutschlandweit. Die Vorwürfe wiegen schwer. Der Verkauf von Teilen der Stralsunder Gymnasialbibliothek, der im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall des Stralsunder Stadtarchivs öffentlich wurde, löst jetzt im Internet eine Welle der Empörung aus. [...] Losgetreten wurde die Debatte auf dem Internetblog „Archivalia“ des Historikers Dr. Klaus Graf aus Neuss am Rhein. [...]"
Zur Causa siehe in "Archivalia":
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
"Von Kulturfrevel ist die Rede. Der Aufschrei unter Wissenschaftlern, Historikern, Archivaren und Bibliothekaren ist groß. Deutschlandweit. Die Vorwürfe wiegen schwer. Der Verkauf von Teilen der Stralsunder Gymnasialbibliothek, der im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall des Stralsunder Stadtarchivs öffentlich wurde, löst jetzt im Internet eine Welle der Empörung aus. [...] Losgetreten wurde die Debatte auf dem Internetblog „Archivalia“ des Historikers Dr. Klaus Graf aus Neuss am Rhein. [...]"
Zur Causa siehe in "Archivalia":
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
http://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Hauptseite
"Wer allerdings eine riesige Datenbank sucht, wird erstmal enttäuscht sein: Wie angekündigt soll Wikidata in der ersten Phase nur für Links zwischen den Sprachprojekten (Interwikis) eingesetzt werden und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, beschränken sich damit auch erstmal auf das Abtippen ebendieser Interwiki-Listen (bsp. Toronto). Das Team möchte damit jedem erstmal die Möglichkeit geben, ein Gefühl für die Datensätze zu entwickeln. Zugleich ruft das Team dazu auf, Fehler und Probleme zu melden."
Zitat aus: Wikipedia Kurier
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier
"Wer allerdings eine riesige Datenbank sucht, wird erstmal enttäuscht sein: Wie angekündigt soll Wikidata in der ersten Phase nur für Links zwischen den Sprachprojekten (Interwikis) eingesetzt werden und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, beschränken sich damit auch erstmal auf das Abtippen ebendieser Interwiki-Listen (bsp. Toronto). Das Team möchte damit jedem erstmal die Möglichkeit geben, ein Gefühl für die Datensätze zu entwickeln. Zugleich ruft das Team dazu auf, Fehler und Probleme zu melden."
Zitat aus: Wikipedia Kurier
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier
SW - am Freitag, 2. November 2012, 20:37 - Rubrik: Wikis
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8419575710 (Hassold)
Mechanica sive Motus Scientia Analytice. Exposita Auctore Leonhardo Eulero, St. Petersburg 1736.
Angeboten für 7800 EUR.
"Titel mit den üblichen Bibliotheksstempeln. Handschr. Eintrag der Bibliothek Stralsund auf der Vorsatzseite des ersten Bandes. Sonst innen in sehr gutem, sauberem Zustand. [...] Mit sehr schönen gestochenen Abbildungen, Vignetten und Zierleisten. Tomus I.: Randanmerkungen von alter Hand mit Tusche auf den Seiten 10, 13-15 und 19. "
***
Ebenfalls vergleichsweise teuer (2200 EURO):
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8361158183 (Hassold)
Karsten, Wenceslaus Johann Gustav: Anfangsgründe der Mathematischen Wissenschaften, Greifswald 1780
"Kl. Schildchen des Stralsundischen Gymnasiums im Innendeckel. Zwei Bibliotheksstempel auf den Titelseiten. [...] Band 1 mit einer handschritflichen Widmung Großkurd's an das Gymnasium Stralsund von 1782."
***
Ebenfalls 2200 Euro soll (bei Hassold) kosten eine Übersetzung: Adam Smith: "Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern."
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7905647934
"Exlibris der Bibliothek der Stadt Stralsund"
***
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8524712911 (Hassold)
Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, Stockholm 1730
"Titelseite mit den üblichen Bibliotheksstempeln. Handschriftliche Randanmerkungen, winzig geschrieben von alter Hand auf ca. 13 Seiten und selten einzelne Anmerkungen im Text. S. 18 mit kl. seitl. Einriss. Die Vorsatzseite vorne ist im Bug stärker knittrig und mit handschr. Eintragung von Großkurd, sehr wahrscheinlich Christian Heinrich (1747-1806) ehem. Gymnasialdirektor in Stralsund."
***
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8603394169 (Hassold)
Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst für die Deutschen, 1737
1750 EURO.
"Eintrag des stralsundischen Direktors Großkurd auf der Vorsatzs. Innendeckel mit Exlibris des Gymnasiums Stralsund. "
***
880 EURO will Hassold für Seckervitz: Pomeraneidum. Libri quinque, 1582
Ein neulateinisches Gedicht - VD16 S 5233 - auf Pommersche Persönlichkeiten, online beim MDZ
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00019578/image_1
Wenige Nachweise im KVK/VD 16.
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7742276901
***
650 EURO will Hassold für eine Schrift von Jacob Grimm (mit Exlibris der Stadt Greifswald, erkennbare Signatur auf dem Foto: G 265)
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7309001880
***
495 EURO soll kosten ein Sammelband mit theologischen Drucken aus dem 17. Jahrhundert
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7742276910
"Vorsatzseite vorne mit Loch, im Innendeckel Ex libris der Kirchen Bibliothek der Nicolaikirche in Stralsund."
***
"¡No pasarán!"
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Mechanica sive Motus Scientia Analytice. Exposita Auctore Leonhardo Eulero, St. Petersburg 1736.
Angeboten für 7800 EUR.
"Titel mit den üblichen Bibliotheksstempeln. Handschr. Eintrag der Bibliothek Stralsund auf der Vorsatzseite des ersten Bandes. Sonst innen in sehr gutem, sauberem Zustand. [...] Mit sehr schönen gestochenen Abbildungen, Vignetten und Zierleisten. Tomus I.: Randanmerkungen von alter Hand mit Tusche auf den Seiten 10, 13-15 und 19. "
***
Ebenfalls vergleichsweise teuer (2200 EURO):
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8361158183 (Hassold)
Karsten, Wenceslaus Johann Gustav: Anfangsgründe der Mathematischen Wissenschaften, Greifswald 1780
"Kl. Schildchen des Stralsundischen Gymnasiums im Innendeckel. Zwei Bibliotheksstempel auf den Titelseiten. [...] Band 1 mit einer handschritflichen Widmung Großkurd's an das Gymnasium Stralsund von 1782."
***
Ebenfalls 2200 Euro soll (bei Hassold) kosten eine Übersetzung: Adam Smith: "Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern."
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7905647934
"Exlibris der Bibliothek der Stadt Stralsund"
***
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8524712911 (Hassold)
Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, Stockholm 1730
"Titelseite mit den üblichen Bibliotheksstempeln. Handschriftliche Randanmerkungen, winzig geschrieben von alter Hand auf ca. 13 Seiten und selten einzelne Anmerkungen im Text. S. 18 mit kl. seitl. Einriss. Die Vorsatzseite vorne ist im Bug stärker knittrig und mit handschr. Eintragung von Großkurd, sehr wahrscheinlich Christian Heinrich (1747-1806) ehem. Gymnasialdirektor in Stralsund."
***
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8603394169 (Hassold)
Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst für die Deutschen, 1737
1750 EURO.
"Eintrag des stralsundischen Direktors Großkurd auf der Vorsatzs. Innendeckel mit Exlibris des Gymnasiums Stralsund. "
***
880 EURO will Hassold für Seckervitz: Pomeraneidum. Libri quinque, 1582
Ein neulateinisches Gedicht - VD16 S 5233 - auf Pommersche Persönlichkeiten, online beim MDZ
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00019578/image_1
Wenige Nachweise im KVK/VD 16.
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7742276901
***
650 EURO will Hassold für eine Schrift von Jacob Grimm (mit Exlibris der Stadt Greifswald, erkennbare Signatur auf dem Foto: G 265)
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7309001880
***
495 EURO soll kosten ein Sammelband mit theologischen Drucken aus dem 17. Jahrhundert
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7742276910
"Vorsatzseite vorne mit Loch, im Innendeckel Ex libris der Kirchen Bibliothek der Nicolaikirche in Stralsund."
***
"¡No pasarán!"
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Das Stück steht einem handschriftlichen Dossier gleich:
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8530274497 (Augusta)
Konvolut von und über Friedrich Koch, Direktor des Gymnasiums Stralsund u. a. 12 Schriften und ein Nachrichtenblatt.
Buchbeschreibung: Stralsund u. a. 1839., 1839. 26,5x22 cm. Halblederband, wasserrandig, etwas fleckig. Lederrücken schmucklos, stark berieben. Kanten und Ecken aufgestoßen. Zustand der einzelnen Schriften siehe Einzelauflistung. Einbandzustand innen: Mit Exlibris der Bibl. d. Stadt Stralsund im Innendeckel und mit handschr. Inhaltsverz. auf der Vorsatzseite. Frontispizportrait vorne mit großem Wasserrand. Innendeckel und Vorsatzs. gilbfleckig. Im Konvolut enthalten: 1. Frontispizportrait: Lithographie von Dr. Friedrich Koch, Königl. Consistorial- und Schulrath. Folgend mehrf. gefaltetes "Plakat": Quod Felix Faustuque sit Auctoritate et summis auspiciis Sacre Regiae Maiestatis Friderici Guilelmi III. Malte Putbus. Fasces Academicos Tenente Viro Magnifico Ioanne Augusto Grunert ego Ioannes Christianus Frid. Finelius.Summa cum Graulatione et Laetitia .Fridericum Koch etc. (Re. untere Ecke des Blattes fehlt ohne Textverl., links am Falzrand mit Einriss. etwas gilbfl.) 2. Schoemann, Georg. Frid.: Specimen Observationum in Theophrasti Oeconomicum et Philodemi Librum IX de Virtutibus et Vitiis. 37 S. Greifswald, C. A. Koch, 1839. Leicht wasserrandig. 3. Viro Doctissimo Gravissimo Summe Verabili Friderico Kochio. Sollemnia Munerum Gloriose Administratorum Semisecularia idibus Maiis 1839. Celebranti Pio ac Devoto animo gragulantur gymnasii Gryphisvaldensis Praeceptores interprete Hermanno Paldamus. Indes Narratio de Carolo Reisigio Thuringo. Typis Frid. Guil. Kunike. 30 S. komplett mit grünem Papierbroschürumschlag eingebunden. Guter Zustand. 4. Viro Summe Reverendo Atque Illustri Friderico Kochio. XV. Maii a 1839, die Semisaeculari. gratulantur Director et Magistri Gymnasii Coeslinensis. Festschrift, gedichtete Verse, 4 Bll. auf Pergament gedruckt. Rand mit schwarzer Zierleiste, angestaubt, leicht gilbfleckig. 5. Viro Amplissimo doctissimo summe venerando de re publica meritissimo Friderico Kochio. die SV. Maii 1839 per quinquaginta annos munere scholastico. Padagogii Regii Putbusiensis. Putbus, Typis Fridel, 1839. 22 S., 1 großer mehrf. gefalteter Plan: Ansicht und Grundriss des königl. Pädagogiums zu Putbus. Blauer Papiereinband mit eingebunden. Plan in gutem Zustand. Handschr. Eintrag von alter Hand im Innendeckblatt. 6. Viro Doctissimo Illustrissimo Amplissimo Friderico Kochio. Idibus Maiis 1839 Per Decem Lustra . Hoc Carmine semsaeculari ea qua par est observantia piisque votis gratulatur F. hasenbalg. Putbus, Fridelianis, 1839. 2 Bll, gefaltet, wenig fleckig. 7. Viro Summe Reverendo Senatus Ecclesiastici et Scholastici Consiliario . Frid. Koch. Idus Maias quo die abhinc quinquaginta annos docendi munus suscepit. Pie congratulantur Praeceptores Gymnasii Stargardiensis. Stargard, 1839. 2 Bll., gefaltet, leicht gefärbt mit Festgedicht. 8. Dr. C. Freese: Die pädagogische Bildung der künftigen Gymnasiallehrer. Gewidmet, Dr. Friedrich Koch zum 15. mai, dem jubelfeste seines 50-jährigen Wirkens für das Wohl der pommerschen Jugend. Stargard, Ferdinand Hendeß, 1839. 32 S., sauber. 9. Friderico Kochio, .quinquaginta annos in re scholastica cum insigni laude decursos. Rector et Praeceptores Gymnasii Nedvigiani Neosedinensis. 1 Bl., 18 S., 1 Bl. am Rand leicht knittrig. 10. Viro Summe Reverendo Friderico Koch. Muneris Sacra Semisaecularia die XV Maji 1839 celebranda ea qua par est pietate congratulatur Gymnasium Palaeo-Sedinense. 2 Blatt, Festgedicht, am Rand etwas fleckig. 11. Dem Herrn Friedrich Koch, Doctot der Philosophie, königl. Consistorial- und Schulrathe, Ritter des rothen Adler-ordens 3. Kl. mit der Schleife am Tage seines 50jährigen Amts-Jubiläums. gewidmet von dem hiesigen geistlichen Ministerium. Stettin, den 15. Mai 1839. 3 Bll., Festgedicht. 12. Zur Geschichte des Stralsunder Gymnasiums. Erster Beitrag: Die Zeit der drei ersten Rectoren (1560 bis 1569). Mit dem Grundrisse des Gymnasiums (etwas wasserrandig, davor eingebunden) und einigen Fac-simile (1 Bl. danach eingebunden). Stralsund, Verlag der Löffler'schen Buchhandlung, 1839. Grundrisstafel, 3 Bll., 46 S., Faksimile. Buchnummer des Verkäufers 5626AB
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/219045446/
http://kulturgut.hypotheses.org/225
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8530274497 (Augusta)
Konvolut von und über Friedrich Koch, Direktor des Gymnasiums Stralsund u. a. 12 Schriften und ein Nachrichtenblatt.
Buchbeschreibung: Stralsund u. a. 1839., 1839. 26,5x22 cm. Halblederband, wasserrandig, etwas fleckig. Lederrücken schmucklos, stark berieben. Kanten und Ecken aufgestoßen. Zustand der einzelnen Schriften siehe Einzelauflistung. Einbandzustand innen: Mit Exlibris der Bibl. d. Stadt Stralsund im Innendeckel und mit handschr. Inhaltsverz. auf der Vorsatzseite. Frontispizportrait vorne mit großem Wasserrand. Innendeckel und Vorsatzs. gilbfleckig. Im Konvolut enthalten: 1. Frontispizportrait: Lithographie von Dr. Friedrich Koch, Königl. Consistorial- und Schulrath. Folgend mehrf. gefaltetes "Plakat": Quod Felix Faustuque sit Auctoritate et summis auspiciis Sacre Regiae Maiestatis Friderici Guilelmi III. Malte Putbus. Fasces Academicos Tenente Viro Magnifico Ioanne Augusto Grunert ego Ioannes Christianus Frid. Finelius.Summa cum Graulatione et Laetitia .Fridericum Koch etc. (Re. untere Ecke des Blattes fehlt ohne Textverl., links am Falzrand mit Einriss. etwas gilbfl.) 2. Schoemann, Georg. Frid.: Specimen Observationum in Theophrasti Oeconomicum et Philodemi Librum IX de Virtutibus et Vitiis. 37 S. Greifswald, C. A. Koch, 1839. Leicht wasserrandig. 3. Viro Doctissimo Gravissimo Summe Verabili Friderico Kochio. Sollemnia Munerum Gloriose Administratorum Semisecularia idibus Maiis 1839. Celebranti Pio ac Devoto animo gragulantur gymnasii Gryphisvaldensis Praeceptores interprete Hermanno Paldamus. Indes Narratio de Carolo Reisigio Thuringo. Typis Frid. Guil. Kunike. 30 S. komplett mit grünem Papierbroschürumschlag eingebunden. Guter Zustand. 4. Viro Summe Reverendo Atque Illustri Friderico Kochio. XV. Maii a 1839, die Semisaeculari. gratulantur Director et Magistri Gymnasii Coeslinensis. Festschrift, gedichtete Verse, 4 Bll. auf Pergament gedruckt. Rand mit schwarzer Zierleiste, angestaubt, leicht gilbfleckig. 5. Viro Amplissimo doctissimo summe venerando de re publica meritissimo Friderico Kochio. die SV. Maii 1839 per quinquaginta annos munere scholastico. Padagogii Regii Putbusiensis. Putbus, Typis Fridel, 1839. 22 S., 1 großer mehrf. gefalteter Plan: Ansicht und Grundriss des königl. Pädagogiums zu Putbus. Blauer Papiereinband mit eingebunden. Plan in gutem Zustand. Handschr. Eintrag von alter Hand im Innendeckblatt. 6. Viro Doctissimo Illustrissimo Amplissimo Friderico Kochio. Idibus Maiis 1839 Per Decem Lustra . Hoc Carmine semsaeculari ea qua par est observantia piisque votis gratulatur F. hasenbalg. Putbus, Fridelianis, 1839. 2 Bll, gefaltet, wenig fleckig. 7. Viro Summe Reverendo Senatus Ecclesiastici et Scholastici Consiliario . Frid. Koch. Idus Maias quo die abhinc quinquaginta annos docendi munus suscepit. Pie congratulantur Praeceptores Gymnasii Stargardiensis. Stargard, 1839. 2 Bll., gefaltet, leicht gefärbt mit Festgedicht. 8. Dr. C. Freese: Die pädagogische Bildung der künftigen Gymnasiallehrer. Gewidmet, Dr. Friedrich Koch zum 15. mai, dem jubelfeste seines 50-jährigen Wirkens für das Wohl der pommerschen Jugend. Stargard, Ferdinand Hendeß, 1839. 32 S., sauber. 9. Friderico Kochio, .quinquaginta annos in re scholastica cum insigni laude decursos. Rector et Praeceptores Gymnasii Nedvigiani Neosedinensis. 1 Bl., 18 S., 1 Bl. am Rand leicht knittrig. 10. Viro Summe Reverendo Friderico Koch. Muneris Sacra Semisaecularia die XV Maji 1839 celebranda ea qua par est pietate congratulatur Gymnasium Palaeo-Sedinense. 2 Blatt, Festgedicht, am Rand etwas fleckig. 11. Dem Herrn Friedrich Koch, Doctot der Philosophie, königl. Consistorial- und Schulrathe, Ritter des rothen Adler-ordens 3. Kl. mit der Schleife am Tage seines 50jährigen Amts-Jubiläums. gewidmet von dem hiesigen geistlichen Ministerium. Stettin, den 15. Mai 1839. 3 Bll., Festgedicht. 12. Zur Geschichte des Stralsunder Gymnasiums. Erster Beitrag: Die Zeit der drei ersten Rectoren (1560 bis 1569). Mit dem Grundrisse des Gymnasiums (etwas wasserrandig, davor eingebunden) und einigen Fac-simile (1 Bl. danach eingebunden). Stralsund, Verlag der Löffler'schen Buchhandlung, 1839. Grundrisstafel, 3 Bll., 46 S., Faksimile. Buchnummer des Verkäufers 5626AB
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/219045446/
http://kulturgut.hypotheses.org/225
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=7533419164
Schöttgen, Christian: Jesus Der Wahre Meßias (Messias), aus der alten und reinen Jüdischen Theologie dargethan und erläutert. Leipzig 1748
Anbieter: Augusta-Antiquariat (Biburg, BAY, Germany)
" Wenige Reste des ledernen Einbandrückens noch vorhanden. Zu Beginn Seiten etwas eselsohrig, farbies Vorsatzpapier vorne mit Exlibris der "Bibliothek der Stadt Stralsund - Gräfl. Löwensche Sammlung". Bis auf sehr wenige dezente Gilbflecke in gutem Zustand. Die letzten zwei Registerseiten mit Längsknick im Bug und etwas angestaubt, die letzte stärker. Verso der Titelseite befindet sich ein etwas rissiges altes Siegel. "
Das ist eigentlich unglaublich:
Axel von Löwen (* 1. November 1686 auf Gut Öbysholm, Frötuna; † 25. Juli 1772 in Stralsund) war ein schwedischer Freiherr, Ritter des Serafinenordens und Generalgouverneur in Schwedisch-Vorpommern. [...]
Löwen trat 1747 die Nachfolge von Johann August Meyerfeldt an und blieb Generalgouverneur bis zu seiner Suspendierung vom Dienst im Jahr 1766. Seine Residenz, das Löwensche Palais, wurde beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 zerstört.
Er widmete sich in Stralsund der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Dabei legte er mit einer großen Ernsthaftigkeit und sehr systematisch eine Privatbibliothek an, zu der auch die vom König Carl XII. als Freundschaftsgeschenk erhaltene Prachtbibel zählte. Im Rathaus Stralsund stellte er seine Sammlungen in einem Saal einer breiten Öffentlichkeit vor. Dieser Saal wird heute Löwenscher Saal genannt.
Im Stadtarchiv Stralsund, in dem seine Sammlung aufbewahrt und gepflegt wird, sind zahlreiche Quittungen seiner Literaturkäufe erhalten. Danach kaufte er für mindestens 3.636,36 Reichstaler von deutschen Buchhändlern und für mindestens 2.747,64 Reichstaler von schwedischen Händlern Bücher. Er unterhielt zudem Geschäftsbeziehungen zu Carl Ludwig Dähnert aus Greifswald, Carl Urban Hjärne und Graf Olof Törnflycht.
Seine Sammlung vermachte er per Testament der Stadt Stralsund, wobei er darauf bestand, die Sammlung öffentlich zugänglich zu machen. Die Löwen'sche Sammlung gehört mit 1.669 Titeln (1.978 Einzelbände) zu den umfangreichsten Beständen des Stadtarchivs in Stralsund, welches im Johanniskloster untergebracht ist. Graf Löwen starb 1772 in Stralsund und wurde in der Kirche in Frötuna begraben.
Sagt die Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Axel_von_L%C3%B6wen
und gibt als Literatur an:
Dietmar Gohlisch: Catalogus Bibliothecae Praetoris Axel von Löwen. Scheunen-Verlag, Kückenshagen 2000. (Veröffentlichung des Stadtarchivs Stralsund Band 13)
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Archivbibliothek_Stralsund
2.72 Die aus dem 18. Jh stammende Löwensche Bibliothek (Signatur LB), die seit 1973 im Johanniskloster untergebracht ist, ist eine der wertvollsten Sammlungen, die die Ratsbibliothek erhielt. Der Schwede Axel Graf von Löwen (1686-1772), der seine militärische Laufbahn als Sechzehnjähriger in Stralsund begonnen und Jahrzehnte im Ausland unter Karl XII. gedient hatte, kehrte 1748 als Generalgouverneur von Schwedisch-Pommern nach Stralsund zurück. Nach Beendigung seiner Amtszeit im Jahre 1766 widmete er sich seiner umfangreichen Buch- und Kunstsammlung, die er in seinem Testament von 1761 dem Magistrat vermachte. Die Gemälde und andere Kunstschätze bildeten 1858 den Grundstock für das städtische Museum. Für seine rund 2500 Bde umfassende Bibliothek bestimmte er, daß sie den " Herren Curatoribus der hiesigen Bibliothèque allein überlassen werden solle und zur bequemen Jahreszeit dem Publico zu öffnen sei".
2.73 Im Bestand der Ratsbibliothek ist diese Stiftung eine der wenigen, die separat nach vier Formaten und Numerus currens - aufgestellt und katalogisiert wurde. Die Bände sind mit dem Exlibris der Ratsbibliothek, der aufgetragenen Signatur LB und oft auch mit dem Löwenschen Siegel gekennzeichnet. Nach dem bisher nur handschriftlich existierenden Standortkatalog und durch Autopsie entsteht ein erster Sachkatalog. Die Bibliothek, die durch Kriegsauslagerung Verluste verzeichnet, umfaßt heute 1216 Titel, die sich mit 70 Prozent (852 Titel) im 18. Jh konzentrieren. 21 Titel entstammen dem 16. Jh und 295 dem 17. Jh.
Nie und nimmer hätte die Stadt Stralsund etwas aus dieser Schenkung verkaufen dürfen, selbst wenn es sich um eine sogenannte Dublette handeln sollte!
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update: Im gedruckten Katalog von 1829 Teil der Löwen'schen Bibliothek (= L. B. )
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10537046_00394.html
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8811130142
Die Rittergeschichte Selinde (anonym erschienen, Verfasser: Stetten) trägt ein rotes Siegel, das sie der Löwen'schen Bibliothek zuweist, sie wird im gedruckten Katalog angeführt:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10537046.html?pageNo=404

Schöttgen, Christian: Jesus Der Wahre Meßias (Messias), aus der alten und reinen Jüdischen Theologie dargethan und erläutert. Leipzig 1748
Anbieter: Augusta-Antiquariat (Biburg, BAY, Germany)
" Wenige Reste des ledernen Einbandrückens noch vorhanden. Zu Beginn Seiten etwas eselsohrig, farbies Vorsatzpapier vorne mit Exlibris der "Bibliothek der Stadt Stralsund - Gräfl. Löwensche Sammlung". Bis auf sehr wenige dezente Gilbflecke in gutem Zustand. Die letzten zwei Registerseiten mit Längsknick im Bug und etwas angestaubt, die letzte stärker. Verso der Titelseite befindet sich ein etwas rissiges altes Siegel. "
Das ist eigentlich unglaublich:
Axel von Löwen (* 1. November 1686 auf Gut Öbysholm, Frötuna; † 25. Juli 1772 in Stralsund) war ein schwedischer Freiherr, Ritter des Serafinenordens und Generalgouverneur in Schwedisch-Vorpommern. [...]
Löwen trat 1747 die Nachfolge von Johann August Meyerfeldt an und blieb Generalgouverneur bis zu seiner Suspendierung vom Dienst im Jahr 1766. Seine Residenz, das Löwensche Palais, wurde beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 zerstört.
Er widmete sich in Stralsund der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Dabei legte er mit einer großen Ernsthaftigkeit und sehr systematisch eine Privatbibliothek an, zu der auch die vom König Carl XII. als Freundschaftsgeschenk erhaltene Prachtbibel zählte. Im Rathaus Stralsund stellte er seine Sammlungen in einem Saal einer breiten Öffentlichkeit vor. Dieser Saal wird heute Löwenscher Saal genannt.
Im Stadtarchiv Stralsund, in dem seine Sammlung aufbewahrt und gepflegt wird, sind zahlreiche Quittungen seiner Literaturkäufe erhalten. Danach kaufte er für mindestens 3.636,36 Reichstaler von deutschen Buchhändlern und für mindestens 2.747,64 Reichstaler von schwedischen Händlern Bücher. Er unterhielt zudem Geschäftsbeziehungen zu Carl Ludwig Dähnert aus Greifswald, Carl Urban Hjärne und Graf Olof Törnflycht.
Seine Sammlung vermachte er per Testament der Stadt Stralsund, wobei er darauf bestand, die Sammlung öffentlich zugänglich zu machen. Die Löwen'sche Sammlung gehört mit 1.669 Titeln (1.978 Einzelbände) zu den umfangreichsten Beständen des Stadtarchivs in Stralsund, welches im Johanniskloster untergebracht ist. Graf Löwen starb 1772 in Stralsund und wurde in der Kirche in Frötuna begraben.
Sagt die Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Axel_von_L%C3%B6wen
und gibt als Literatur an:
Dietmar Gohlisch: Catalogus Bibliothecae Praetoris Axel von Löwen. Scheunen-Verlag, Kückenshagen 2000. (Veröffentlichung des Stadtarchivs Stralsund Band 13)
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Archivbibliothek_Stralsund
2.72 Die aus dem 18. Jh stammende Löwensche Bibliothek (Signatur LB), die seit 1973 im Johanniskloster untergebracht ist, ist eine der wertvollsten Sammlungen, die die Ratsbibliothek erhielt. Der Schwede Axel Graf von Löwen (1686-1772), der seine militärische Laufbahn als Sechzehnjähriger in Stralsund begonnen und Jahrzehnte im Ausland unter Karl XII. gedient hatte, kehrte 1748 als Generalgouverneur von Schwedisch-Pommern nach Stralsund zurück. Nach Beendigung seiner Amtszeit im Jahre 1766 widmete er sich seiner umfangreichen Buch- und Kunstsammlung, die er in seinem Testament von 1761 dem Magistrat vermachte. Die Gemälde und andere Kunstschätze bildeten 1858 den Grundstock für das städtische Museum. Für seine rund 2500 Bde umfassende Bibliothek bestimmte er, daß sie den " Herren Curatoribus der hiesigen Bibliothèque allein überlassen werden solle und zur bequemen Jahreszeit dem Publico zu öffnen sei".
2.73 Im Bestand der Ratsbibliothek ist diese Stiftung eine der wenigen, die separat nach vier Formaten und Numerus currens - aufgestellt und katalogisiert wurde. Die Bände sind mit dem Exlibris der Ratsbibliothek, der aufgetragenen Signatur LB und oft auch mit dem Löwenschen Siegel gekennzeichnet. Nach dem bisher nur handschriftlich existierenden Standortkatalog und durch Autopsie entsteht ein erster Sachkatalog. Die Bibliothek, die durch Kriegsauslagerung Verluste verzeichnet, umfaßt heute 1216 Titel, die sich mit 70 Prozent (852 Titel) im 18. Jh konzentrieren. 21 Titel entstammen dem 16. Jh und 295 dem 17. Jh.
Nie und nimmer hätte die Stadt Stralsund etwas aus dieser Schenkung verkaufen dürfen, selbst wenn es sich um eine sogenannte Dublette handeln sollte!
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update: Im gedruckten Katalog von 1829 Teil der Löwen'schen Bibliothek (= L. B. )
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10537046_00394.html
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8811130142
Die Rittergeschichte Selinde (anonym erschienen, Verfasser: Stetten) trägt ein rotes Siegel, das sie der Löwen'schen Bibliothek zuweist, sie wird im gedruckten Katalog angeführt:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10537046.html?pageNo=404

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Rügisch-Pommersche Geschichtsverein zu Greifswald und Stralsund war ein regionaler Geschichtsverein in Nordostdeutschland. Er bestand von 1899 bis kurz nach 1945.
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgisch-Pommerscher_Geschichtsverein
Das Augusta-Antiquariat bietet an:
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8887900350
Der Kirchenbau in Mecklenburg und Neuvorpommern zur Zeit der deutschen Kolonisation. Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein zu Greifswald und Stralsund. Hrsg. 1910.
Reifferscheid, Dr. Heinrich.
" Innen sauber, erste und letzte Seiten stockfleckig. Stempel Geschichtsverein und Bibl.-Stempel der Stadt Stralsund."
Demzufolge werden auch Buchbestände dieses aufgelösten Geschichtsvereins von der Stadt Stralsund verhökert.
Weitere mit Stempel Geschichtsverein
http://www.abebooks.de/servlet/SearchResults?kn=stempel+geschichtsverein&sortby=0&vci=7555168
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgisch-Pommerscher_Geschichtsverein
Das Augusta-Antiquariat bietet an:
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=8887900350
Der Kirchenbau in Mecklenburg und Neuvorpommern zur Zeit der deutschen Kolonisation. Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein zu Greifswald und Stralsund. Hrsg. 1910.
Reifferscheid, Dr. Heinrich.
" Innen sauber, erste und letzte Seiten stockfleckig. Stempel Geschichtsverein und Bibl.-Stempel der Stadt Stralsund."
Demzufolge werden auch Buchbestände dieses aufgelösten Geschichtsvereins von der Stadt Stralsund verhökert.
Weitere mit Stempel Geschichtsverein
http://www.abebooks.de/servlet/SearchResults?kn=stempel+geschichtsverein&sortby=0&vci=7555168
Zur Causa
http://archiv.twoday.net/stories/197333243/
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kritik an Verkauf von Gymnasialbibliothek
Stralsund (OZ) - Der im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall und der Schließung des Stralsunder Stadtarchvis bekannt gewordene Verkauf von Teilen der historischen Gymnasialbibliothek an einen privaten Antiquar sorgt jetzt deutschlandweit für Empörung unter Wissenschaftlern und Bibliothekaren. Die Stadt würde wertvolles Kulturgut verscherbeln, heißt es.
Vor allem im Internetblog „Archivalia“, betrieben von dem Historiker Dr. Klaus Graf, regt sich Widerspruch von verschiedenen Seiten. Graf selbst, der seit Jahren für den Schutz historischer Buchsammlungen kämpft, nennt den Verkauf eine Ungeheuerlichkeit, eine Katastrophe.
Die Hansestadt weist die Vorwürfe zurück und begründet den Verkauf damit, dass die insgesamt knapp 6000 Bände wegen ihrer „minimalen regionalgeschichtlichen Bedeutung“ und ihres schlechten Zustandes keine Aufnahme in den Bibliotheksbestand des Stadtarchivs gefunden hätten und auch nicht katalogisiert wurden. Es handele sich um Literatur für Schüler und Lehrer in Philologie und Theologie.
Lesen Sie mehr zum Thema in der Wochenendausgabe der OSTSEE-ZEITUNG (Stralsunder Zeitung).
http://www.ostsee-zeitung.de/index_artikel_komplett.phtml?SID=4e602ad41f01da5101a259f97830c64a¶m=news&id=3596221
Die Presse (Ostsee-Zeitung und Schweriner Volkszeitung) bekam offenbar heute - anders als ich - weitergehende Informationen der Stadtverwaltung. Schäbig genug: Die Journalisten ließen sich ausführlichst von mir telefonisch mit Hintergrundinfos versorgen, haben aber in beiden Fällen mir die Stellungnahme der Stadt bis jetzt nicht zugänglich gemacht. Wer als Blogger mit diesen Herrschaften "kooperiert", darf nicht auf einen Dialog auf Augenhöhe hoffen - man wird schlicht und einfach ausgenutzt. Immerhin ist durch den mich entfachten Wirbel jetzt etwas mehr über die Verkäufe bekannt.
Nach wie vor bleibe ich bei meiner Auffassung, dass die Verkäufe rechtswidrig waren und auch nicht katalogisierte Literatur aus den Bereichen Philologie und Theologie einen wichtigen Teil des Gesamtensembles Gymnasialbibliothek darstellt. Von Dubletten ist in obiger Meldung nicht die Rede.
Die Welterbe-Stadt Stralsund hat einen ungeheuerlichen Anschlag auf das kulturelle Erbe des Ostseeraums unternommen.
Zur Causa:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Stralsund (OZ) - Der im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall und der Schließung des Stralsunder Stadtarchvis bekannt gewordene Verkauf von Teilen der historischen Gymnasialbibliothek an einen privaten Antiquar sorgt jetzt deutschlandweit für Empörung unter Wissenschaftlern und Bibliothekaren. Die Stadt würde wertvolles Kulturgut verscherbeln, heißt es.
Vor allem im Internetblog „Archivalia“, betrieben von dem Historiker Dr. Klaus Graf, regt sich Widerspruch von verschiedenen Seiten. Graf selbst, der seit Jahren für den Schutz historischer Buchsammlungen kämpft, nennt den Verkauf eine Ungeheuerlichkeit, eine Katastrophe.
Die Hansestadt weist die Vorwürfe zurück und begründet den Verkauf damit, dass die insgesamt knapp 6000 Bände wegen ihrer „minimalen regionalgeschichtlichen Bedeutung“ und ihres schlechten Zustandes keine Aufnahme in den Bibliotheksbestand des Stadtarchivs gefunden hätten und auch nicht katalogisiert wurden. Es handele sich um Literatur für Schüler und Lehrer in Philologie und Theologie.
Lesen Sie mehr zum Thema in der Wochenendausgabe der OSTSEE-ZEITUNG (Stralsunder Zeitung).
http://www.ostsee-zeitung.de/index_artikel_komplett.phtml?SID=4e602ad41f01da5101a259f97830c64a¶m=news&id=3596221
Die Presse (Ostsee-Zeitung und Schweriner Volkszeitung) bekam offenbar heute - anders als ich - weitergehende Informationen der Stadtverwaltung. Schäbig genug: Die Journalisten ließen sich ausführlichst von mir telefonisch mit Hintergrundinfos versorgen, haben aber in beiden Fällen mir die Stellungnahme der Stadt bis jetzt nicht zugänglich gemacht. Wer als Blogger mit diesen Herrschaften "kooperiert", darf nicht auf einen Dialog auf Augenhöhe hoffen - man wird schlicht und einfach ausgenutzt. Immerhin ist durch den mich entfachten Wirbel jetzt etwas mehr über die Verkäufe bekannt.
Nach wie vor bleibe ich bei meiner Auffassung, dass die Verkäufe rechtswidrig waren und auch nicht katalogisierte Literatur aus den Bereichen Philologie und Theologie einen wichtigen Teil des Gesamtensembles Gymnasialbibliothek darstellt. Von Dubletten ist in obiger Meldung nicht die Rede.
Die Welterbe-Stadt Stralsund hat einen ungeheuerlichen Anschlag auf das kulturelle Erbe des Ostseeraums unternommen.
Zur Causa:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Copies of archival and audio-visual items from the anti-apartheid and southern Africa solidarity collection of the IISH will be transferred to South Africa. The archival transfer project is funded by the Dutch embassy in Pretoria and runs from October 2012 until April 2013. The main recipients will be the Archives of the African National Congress, the South African History Archives (SAHA) and the Nelson Mandela Centre of Memory, both in Johannesburg.
The ANC archives will mostly receive digital copies of photographs, slides, video's etc. relating to the work of the ANC in exile - especially in The Netherlands, but also on Mazimbu and the ANC's Solomon Mahlangu Freedom College in Tanzania. Besides, spare copy books, brochures, periodicals, posters, etc. will be sent to SAHA and redistributed by them to various archives and research institutions in South Africa.
The project is coordinated by IISH staff member Kier Schuringa.
More information on this project: ksc@iisg.nl
The ANC archives will mostly receive digital copies of photographs, slides, video's etc. relating to the work of the ANC in exile - especially in The Netherlands, but also on Mazimbu and the ANC's Solomon Mahlangu Freedom College in Tanzania. Besides, spare copy books, brochures, periodicals, posters, etc. will be sent to SAHA and redistributed by them to various archives and research institutions in South Africa.
The project is coordinated by IISH staff member Kier Schuringa.
More information on this project: ksc@iisg.nl
Bernd Hüttner - am Freitag, 2. November 2012, 10:29 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 12. November 2012 findet um 17 Uhr die nächste Sitzung der Fachgruppe
"Historische Hilfswissenschaften" mit zwei Vorträgen statt.
Es sprechen
Dr.jur. Martin Richau (Vorsitzender des HEROLD, Berlin): "Ahnenforschung und Ariernachweis aus Betroffenensicht"
sowie
Dr.phil. Lorenz Beck (Direktor des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin): "Fotografien als historische Quelle. Grundzüge einer hilfswissenschaftlichen Betrachtung am Beispiel. Mit einer
Kabinettsausstellung".
Die Fachgruppe "Historische Hilfswissenschaften" innerhalb des HEROLD, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, lädt zu regelmäßigen thematischen Vortragsveranstaltungen ein. Anliegen der Reihe ist es, sich in Vorträgen und Einzelprojekten der Pflege und weiteren Entwicklung hilfswissenschaftlicher Fächer im Raum von Berlin und Brandenburg zu widmen. Neben der Familiengeschichtsforschung und Wappenkunde sollen als "verwandte Wissenschaften" auch Disziplinen wie die Urkundenlehre und Aktenkunde, Schriftkunde, Namenforschung und Historische Geographie, die Siegel-, Münz- und Medaillenkunde, die Fahnen- und Flaggenkunde, die Insignologie oder das Ordenswesen einbezogen werden.
Veranstaltungsort ist das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
(Boltzmannstraße 14, 14195 Berlin-Dahlem).
Um telefonische Voranmeldung wird wegen der begrenzten Zahl der
verfügbaren Plätze herzlich und dringend gebeten!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat: Simone Pelzer
Tel. (030) 8413-3701 oder: E-Mail: mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de
via MArbuger Archivliste
"Historische Hilfswissenschaften" mit zwei Vorträgen statt.
Es sprechen
Dr.jur. Martin Richau (Vorsitzender des HEROLD, Berlin): "Ahnenforschung und Ariernachweis aus Betroffenensicht"
sowie
Dr.phil. Lorenz Beck (Direktor des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin): "Fotografien als historische Quelle. Grundzüge einer hilfswissenschaftlichen Betrachtung am Beispiel. Mit einer
Kabinettsausstellung".
Die Fachgruppe "Historische Hilfswissenschaften" innerhalb des HEROLD, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, lädt zu regelmäßigen thematischen Vortragsveranstaltungen ein. Anliegen der Reihe ist es, sich in Vorträgen und Einzelprojekten der Pflege und weiteren Entwicklung hilfswissenschaftlicher Fächer im Raum von Berlin und Brandenburg zu widmen. Neben der Familiengeschichtsforschung und Wappenkunde sollen als "verwandte Wissenschaften" auch Disziplinen wie die Urkundenlehre und Aktenkunde, Schriftkunde, Namenforschung und Historische Geographie, die Siegel-, Münz- und Medaillenkunde, die Fahnen- und Flaggenkunde, die Insignologie oder das Ordenswesen einbezogen werden.
Veranstaltungsort ist das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
(Boltzmannstraße 14, 14195 Berlin-Dahlem).
Um telefonische Voranmeldung wird wegen der begrenzten Zahl der
verfügbaren Plätze herzlich und dringend gebeten!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat: Simone Pelzer
Tel. (030) 8413-3701 oder: E-Mail: mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de
via MArbuger Archivliste
Wolf Thomas - am Freitag, 2. November 2012, 08:41 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://e-book.fwf.ac.at/
"Die FWF-E-Book-Library ist das Repositorium des FWF zur Archivierung von vom FWF geförderten Selbstständigen Publikationen. Sie unterstützt im Sinne der Open Access-Policy des FWF den freien und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen im Internet und dient der besseren Sichtbarkeit und der weiteren Verbreitung der Publikationen."
Bisher 116 Bücher.
"Die FWF-E-Book-Library ist das Repositorium des FWF zur Archivierung von vom FWF geförderten Selbstständigen Publikationen. Sie unterstützt im Sinne der Open Access-Policy des FWF den freien und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen im Internet und dient der besseren Sichtbarkeit und der weiteren Verbreitung der Publikationen."
Bisher 116 Bücher.
KlausGraf - am Freitag, 2. November 2012, 01:09 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Stiftung Stadtgedächtnis sammelt Spenden für die Wiederherstellung der zerstörten Dokumente des eingestürzten Stadtarchivs. Doch sie will ihre Finanzen nicht offenlegen. Ratspolitiker fordern Transparenz im Umgang mit Steuergeldern ....." - ein Artikel von Andreas Damm im Kölner Stadt-Anzeiger v. 30.10.2012
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. November 2012, 17:42 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Angeboten wird bei Hassold die in Stralsund erschienene Zeitschrift
Sundine. Neu-Vorpommersches Unterhaltungsblatt nebst Literatur- und Intelligenz-Blatt für Neu-Vorpommern und Rügen.
1838
1834
Vom Augusta-Antiquariat
Sundine. Wochenschrift für Neu-Vorpommern.
1829
Der SB Berlin verdanke ich den Eintrag bei Heinz Gittig: Mecklenburgische Zeitungen und Wochenblätter (1994), S. 256 Nr. 922
Dort nachgewiesener Bestand
1 = Staatsbibliothek zu Berlin, Zeitungsabteilung
1827-34. 1838-47
9 = Universitätsbibliothek Greifswald
1827-1848
120 = Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund
Pz 4° 6, H 4° 230
1827-48
Gr 105 = Vorpommersches Landesarchiv Greifswald
1835,10
DM/M = Kreisheimatmuseum Demmin
1833. 1835. 1844. 1845
HGW/AS = Stadtarchiv Hansestadt Greifswald
1827. 1833-37. 1839-48
Zur Causa Stralsund
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Sundine. Neu-Vorpommersches Unterhaltungsblatt nebst Literatur- und Intelligenz-Blatt für Neu-Vorpommern und Rügen.
1838
1834
Vom Augusta-Antiquariat
Sundine. Wochenschrift für Neu-Vorpommern.
1829
Der SB Berlin verdanke ich den Eintrag bei Heinz Gittig: Mecklenburgische Zeitungen und Wochenblätter (1994), S. 256 Nr. 922
Dort nachgewiesener Bestand
1 = Staatsbibliothek zu Berlin, Zeitungsabteilung
1827-34. 1838-47
9 = Universitätsbibliothek Greifswald
1827-1848
120 = Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund
Pz 4° 6, H 4° 230
1827-48
Gr 105 = Vorpommersches Landesarchiv Greifswald
1835,10
DM/M = Kreisheimatmuseum Demmin
1833. 1835. 1844. 1845
HGW/AS = Stadtarchiv Hansestadt Greifswald
1827. 1833-37. 1839-48
Zur Causa Stralsund
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Mit der Landtagsdrucksache 16/1259 (PDF) vom 30.10.2012 beantragen die Piraten im NRW-Landtag die (Wieder-)Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Affäre um den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW. Gewichtiger Bestandteil dieser Affäre ist die enorme Kostensteigerung des Neubaus des Landesarchivs in Duisburg.
Zu den Erfolgsausschichten des Antrages schreibt Thomas Reisener in der Rheinischen Post vom 31.10.2012: " .... Um den Widerstand anderer Parteien gegen den Untersuchungsausschuss zu erschweren, bedienen die Piraten sich eines Schachzuges: In der vorausgegangenen Legislatur gab es bereits einen BLB-Untersuchungsausschuss, der wegen der Neuwahlen aufgelöst wurde. Er war damals Ergebnis eines gemeinsamen Antrages sämtlicher Parteien. Die Piraten haben diesen Antrag jetzt fast wortgleich übernommen. Damit wird es für die übrigen Parteien schwer, ihn abzulehnen. "
Übrigens: ein Grund für die Kostensteigerung beim Neubau ist die statitsche Ertüchtigung des Baugrundes: " ..... 19 000 Tonnen Beton und Archivmaterial muss das Fundament des 77 Meter hohen Betonturmes tragen können. Das ist zu viel für den Boden, auf dem das Speichergebäude aus den 30er Jahren steht. Mit anschaulichem Bildmaterial erklärten die Projektleiter des BLB mit einer Fotogalerie die umfangreichen Gründungsarbeiten zu Beginn der Bauarbeiten Mitte 2010. ....." (lt. WAZ v. 29.10.2012)
Auch das eher unkritische Innenhafen-Portal berichtete am 29.10.2012 über den Baufortschritt. In der Bildergalerie zum Artikel befindet sich ein Fehler. Wer findet ihn?
Zur Geschichte des Landesarchivneubaus in Duisburg s.a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+nrw+duisburg
Zu den Erfolgsausschichten des Antrages schreibt Thomas Reisener in der Rheinischen Post vom 31.10.2012: " .... Um den Widerstand anderer Parteien gegen den Untersuchungsausschuss zu erschweren, bedienen die Piraten sich eines Schachzuges: In der vorausgegangenen Legislatur gab es bereits einen BLB-Untersuchungsausschuss, der wegen der Neuwahlen aufgelöst wurde. Er war damals Ergebnis eines gemeinsamen Antrages sämtlicher Parteien. Die Piraten haben diesen Antrag jetzt fast wortgleich übernommen. Damit wird es für die übrigen Parteien schwer, ihn abzulehnen. "
Übrigens: ein Grund für die Kostensteigerung beim Neubau ist die statitsche Ertüchtigung des Baugrundes: " ..... 19 000 Tonnen Beton und Archivmaterial muss das Fundament des 77 Meter hohen Betonturmes tragen können. Das ist zu viel für den Boden, auf dem das Speichergebäude aus den 30er Jahren steht. Mit anschaulichem Bildmaterial erklärten die Projektleiter des BLB mit einer Fotogalerie die umfangreichen Gründungsarbeiten zu Beginn der Bauarbeiten Mitte 2010. ....." (lt. WAZ v. 29.10.2012)
Auch das eher unkritische Innenhafen-Portal berichtete am 29.10.2012 über den Baufortschritt. In der Bildergalerie zum Artikel befindet sich ein Fehler. Wer findet ihn?
Zur Geschichte des Landesarchivneubaus in Duisburg s.a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+nrw+duisburg
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. November 2012, 14:54 - Rubrik: Staatsarchive
Ernst Heinrich Zober (* 25. April 1799 in Königsberg in der Neumark; † 6. November 1869 in Stralsund) war ein deutscher evangelischer Theologe, Historiker, Pädagoge und Bibliothekar.
"Von ihm verfasste Schriften aus dem Bestand der im Stadtarchiv Stralsund verwahrten Gymnasialbibliothek, darunter Sonderdrucke, waren vom Verkauf der Gymnasialbibliothek an einen Antiquar betroffen und erschienen 2012 auf dem Antiquariatsmarkt"
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinrich_Zober
Beispielsweise vom Augusta-Antiquariat
http://goo.gl/nBluF
Beiträge zur Geschichte der Schützengesellschaft und des Vogelschießens zu Stralsund. Nach größtentheils handschriftlichen Aufzeichnungen mitgetheilt von Prof. Zober, 1853
"Mit handschriftlicher Widmung für "Die Büchersammung des Stralsunder Gymnasiums" von Prof. Dr. Ernst Zober."
Unabhängig davon, ob diese Schrift noch einmal in der Archivbibliothek Stralsund vorhanden ist, ist es eine Schande, dass das persönliche Widmungsexemplar des verdienstvollen Erforschers der Stralsunder Geschichte an sein Gymnasium verscherbelt wurde.
Ein weiteres Widmungsexemplar bei Hassold:
http://goo.gl/OVSp4
Zur Causa Stralsund:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

"Von ihm verfasste Schriften aus dem Bestand der im Stadtarchiv Stralsund verwahrten Gymnasialbibliothek, darunter Sonderdrucke, waren vom Verkauf der Gymnasialbibliothek an einen Antiquar betroffen und erschienen 2012 auf dem Antiquariatsmarkt"
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinrich_Zober
Beispielsweise vom Augusta-Antiquariat
http://goo.gl/nBluF
Beiträge zur Geschichte der Schützengesellschaft und des Vogelschießens zu Stralsund. Nach größtentheils handschriftlichen Aufzeichnungen mitgetheilt von Prof. Zober, 1853
"Mit handschriftlicher Widmung für "Die Büchersammung des Stralsunder Gymnasiums" von Prof. Dr. Ernst Zober."
Unabhängig davon, ob diese Schrift noch einmal in der Archivbibliothek Stralsund vorhanden ist, ist es eine Schande, dass das persönliche Widmungsexemplar des verdienstvollen Erforschers der Stralsunder Geschichte an sein Gymnasium verscherbelt wurde.
Ein weiteres Widmungsexemplar bei Hassold:
http://goo.gl/OVSp4
Zur Causa Stralsund:
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

"Archiveröffnung und Lesung am 15. November
Die Akademie der Künste eröffnet das Archiv des Schriftstellers, Nobelpreisträgers und Akademie-Mitglieds Imre Kertész. Unterstützt durch Mittel des Beauftragten für Kultur und Medien, der Kulturstiftung der Länder und der Friede-Springer-Stiftung, konnte die Akademie den künstlerischen Vorlass im Mai 2012 erwerben. Nach der Erschließung stehen rund 35.000 Blatt Archivmaterial Wissenschaft und Forschung zur Verfügung.
Zur Eröffnung des Archivs liest Hermann Beil – in Anwesenheit des Autors – am 15. November in der Akademie der Künste am Pariser Platz aus den unveröffentlichten Kertész-Tagebüchern der Jahre 2001-2003. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der Akademie, Klaus Staeck, sprechen der Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, und die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Grußworte. Der Direktor des Archivs, Wolfgang Trautwein, führt ins Archiv und die Tagebücher ein. Eine Vitrinenpräsentation von Manuskripten und Dokumenten gibt Einblick in das Archiv zu Lebzeiten.
Ein erster Teil des Imre-Kertész-Archivs gelangte bereits Ende 2001 als Depositum ins Archiv der Akademie der Künste und wurde inzwischen auf Mikrofilm gesichert und elektronisch verzeichnet. Der weitaus größere Teil wurde im Jahr 2011 aus Budapest und Berlin übernommen und – unterstützt von Fachübersetzern – geordnet und erfasst. So befinden sich nunmehr die Manuskripte zu Kertész' Werken "Roman eines Schicksallosen", "Galeerentagebuch", "Kaddisch für ein nicht geborenes Kind", "Dossier K.: eine Ermittlung", "Fiasko", "Ich – ein anderer" samt ihrer umfangreichen Vorarbeiten und Varianten im Archiv. Darüber hinaus liegen Manuskripte und Druckbelege zahlreicher seiner Essays und Reden vor, u.a. "Wem gehört Auschwitz?", "Die exilierte Sprache", "Bekenntnis zu einem Bürger. Notizen über Sándor Márai", "Wird Europa auferstehen?", "Budapest. Ein überflüssiges Bekenntnis", "Jerusalem, Jerusalem". Schriftwechsel ab 1988, insbesondere Korrespondenzen mit Verlagen, Redaktionen und Institutionen sowie Leserzuschriften, vermitteln einen Eindruck von Kertész' Weg zum berühmten Autor. Umfangreiches Material zur Rezeption spiegelt die weltweite Wirkung seiner Werke wider. Als besonderer Schatz des Imre-Kertész-Archivs sind seine Tagebücher, geführt ab 1961, zu nennen mit außerordentlich eindrücklichen Beobachtungen und Reflexionen.
Imre Kertész, der am 9. November 83 Jahre alt wird, Überlebender von Auschwitz und Buchenwald, hat 1975 mit seinem "Roman eines Schicksallosen" eine neue künstlerische Sichtweise in die Literatur und die Darstellung des Holocaust gebracht. Das Buch über das Überleben eines Jugendlichen in den Lagern erlangte – vermittelt durch die deutsche Übersetzung – erst nach der europäischen Wende Weltruhm.
2002 erhielt Imre Kertész den Nobelpreis für Literatur.
Veranstaltungsdaten
Imre-Kertész-Archiveröffnung und Lesung
Donnerstag, 15. November 2012, 18 Uhr
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin-Mitte, Eintritt € 5/3
Kartenreservierung: Tel. 030 20057-1000, ticket@adk.de"
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste, Berlin, 31.10.2012
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5174925/
Die Akademie der Künste eröffnet das Archiv des Schriftstellers, Nobelpreisträgers und Akademie-Mitglieds Imre Kertész. Unterstützt durch Mittel des Beauftragten für Kultur und Medien, der Kulturstiftung der Länder und der Friede-Springer-Stiftung, konnte die Akademie den künstlerischen Vorlass im Mai 2012 erwerben. Nach der Erschließung stehen rund 35.000 Blatt Archivmaterial Wissenschaft und Forschung zur Verfügung.
Zur Eröffnung des Archivs liest Hermann Beil – in Anwesenheit des Autors – am 15. November in der Akademie der Künste am Pariser Platz aus den unveröffentlichten Kertész-Tagebüchern der Jahre 2001-2003. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der Akademie, Klaus Staeck, sprechen der Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, und die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Grußworte. Der Direktor des Archivs, Wolfgang Trautwein, führt ins Archiv und die Tagebücher ein. Eine Vitrinenpräsentation von Manuskripten und Dokumenten gibt Einblick in das Archiv zu Lebzeiten.
Ein erster Teil des Imre-Kertész-Archivs gelangte bereits Ende 2001 als Depositum ins Archiv der Akademie der Künste und wurde inzwischen auf Mikrofilm gesichert und elektronisch verzeichnet. Der weitaus größere Teil wurde im Jahr 2011 aus Budapest und Berlin übernommen und – unterstützt von Fachübersetzern – geordnet und erfasst. So befinden sich nunmehr die Manuskripte zu Kertész' Werken "Roman eines Schicksallosen", "Galeerentagebuch", "Kaddisch für ein nicht geborenes Kind", "Dossier K.: eine Ermittlung", "Fiasko", "Ich – ein anderer" samt ihrer umfangreichen Vorarbeiten und Varianten im Archiv. Darüber hinaus liegen Manuskripte und Druckbelege zahlreicher seiner Essays und Reden vor, u.a. "Wem gehört Auschwitz?", "Die exilierte Sprache", "Bekenntnis zu einem Bürger. Notizen über Sándor Márai", "Wird Europa auferstehen?", "Budapest. Ein überflüssiges Bekenntnis", "Jerusalem, Jerusalem". Schriftwechsel ab 1988, insbesondere Korrespondenzen mit Verlagen, Redaktionen und Institutionen sowie Leserzuschriften, vermitteln einen Eindruck von Kertész' Weg zum berühmten Autor. Umfangreiches Material zur Rezeption spiegelt die weltweite Wirkung seiner Werke wider. Als besonderer Schatz des Imre-Kertész-Archivs sind seine Tagebücher, geführt ab 1961, zu nennen mit außerordentlich eindrücklichen Beobachtungen und Reflexionen.
Imre Kertész, der am 9. November 83 Jahre alt wird, Überlebender von Auschwitz und Buchenwald, hat 1975 mit seinem "Roman eines Schicksallosen" eine neue künstlerische Sichtweise in die Literatur und die Darstellung des Holocaust gebracht. Das Buch über das Überleben eines Jugendlichen in den Lagern erlangte – vermittelt durch die deutsche Übersetzung – erst nach der europäischen Wende Weltruhm.
2002 erhielt Imre Kertész den Nobelpreis für Literatur.
Veranstaltungsdaten
Imre-Kertész-Archiveröffnung und Lesung
Donnerstag, 15. November 2012, 18 Uhr
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin-Mitte, Eintritt € 5/3
Kartenreservierung: Tel. 030 20057-1000, ticket@adk.de"
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste, Berlin, 31.10.2012
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5174925/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. November 2012, 14:38 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zvab.com/profile/86424h.jsp
Der Antiquar war sehr kurz angebunden und verwies mich an den OB von Stralsund. Er habe einen Vertrag mit der Stadt Stralsund. Von den juristischen Problemen wollte er nichts hören und beendete das Gespräch.
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update: Die Mitinhaberin des Augusta-Antiquariats
http://www.abebooks.de/augusta-antiquariat-biburg/7555168/sf
bestätigte nur, dass sie die Bücher von Hassold hat und verweigerte zu weiteren Fragen die Auskunft.
Der Antiquar war sehr kurz angebunden und verwies mich an den OB von Stralsund. Er habe einen Vertrag mit der Stadt Stralsund. Von den juristischen Problemen wollte er nichts hören und beendete das Gespräch.
http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund
Update: Die Mitinhaberin des Augusta-Antiquariats
http://www.abebooks.de/augusta-antiquariat-biburg/7555168/sf
bestätigte nur, dass sie die Bücher von Hassold hat und verweigerte zu weiteren Fragen die Auskunft.
Als kleine Nachlese zu dieser sehr interessanten Tagung in Bad Kissingen: Das Programm. Tagungsberichte sind in Arbeit.
Drittes Mitteleuropäisches Archivars- und Archivarinnentreffen aus Einrichtungen mit Quellensammlungen zur deutschen Geschichte im östlichen Europa vom 29. bis 31. Oktober 2012Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen
Programm Montag, 29. Oktober
14.00 Uhr Dr. Stefanie Jost/ Simon Heßdörfer: Bundesarchiv/ Lastenausgleichsarchiv Bayreuth: Aufgaben, Bestände und Benutzung des Lastenausgleichsarchivs
15.00 Uhr Dr. Ulrich Schmilewski, Kulturwerk Schlesien, Würzburg: Die Stiftung Kulturwerk Schlesien. Aufgaben, Tätigkeiten, Sammlungen
16.00 Uhr Sonja Anžič-Kemper, Landesarchiv Speyer: Quellen zu ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten im heutigen Slowenien.
Die Beispiele Gottschee und Krainburg/Kranj
19.00 Uhr Christian Rother, Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim: Das Archiv der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim
20.00 Uhr Réka Gyimesi, Fünfkirchen/Pecs: Die Minderheiten in den historisch-demographischen Quellen
Dienstag, 30. Oktober
09.00 Uhr Dr. Eleonore Géra, Budapest: Wiederbelebung des multikulturellen Stadtlebens in Buda und Pest nach der Türkenära
10.00 Uhr Thomas Şindilariu, Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt/Braşov: Die deutsche Minderheit in Rumänien im Archiv der Securitate. Eine Rekonstruktion der Beobachtung
11.00 Uhr Martina Wermes, Sächsisches Staatsarchiv Leipzig: Genealogische Unterlagen aus den Familiengeschichtlichen Sammlungen des früheren Reichssippenamtes zu Slowenien, Gottschee, Siebenbürgen, der Bukowina und Bessarabien
13.00 Uhr Dr. Ligia-Maria Fodor, Nationalarchiv Rumäniens, Bukarest: Zur Geschichte des Schulwesens in der habsburgischen Bukowina im Bestand „Bukowiner k.k. Landesregierung“
14.00 Uhr Dr. Livia Ardelean, Klausenburg/Cluj-Napoca: Die deutsche Bevölkerung aus Klausenburg und Umgebung in den archivarischen Quellen
15.00 Uhr Jakub Grudniewski, Kattowitz: Dokumentation der preußischen Staatsverwaltung im Bestand des Staatsarchivs Katowice
16.00 Uhr Dr. Zdenek Kravar, Landesarchiv Troppau/Opava: Das Hultschiner Ländchen – schlesische Region zwischen den Grenzen. Gesichtspunkte eines Archivars
17.00 Uhr Dr. Bronislav Dorko, Bezirksarchiv Jägerndorf/ Krnov:
Die Ausweisung der Deutschen aus der Sicht eines tschechischen Neusiedlers. Das Zusammenleben der Tschechen und Deutschen im Dorf Janušov bei Johnsdorf/Rýmařov bei Römerstadt in den Jahren 1945-1946
19.00 Uhr Mirosław Węcki, Kattowitz/Katowice: Kattowitzer NS-Bestand
(1933-1945) u.a. Partei, Staats- uns Wirtschaftsverwaltung
20.00 Uhr Dr. Otfrid Pustejovsky, Waakirchen: Josef Tippelt, deutscher Kolpingsenior in der ČSR, hingerichtet in Plötzensee 1943. Archivalien aus dem Bundesarchiv
Mittwoch, 31. Oktober
09.00 Uhr Beate Márkus, Pecs/Fünfkirchen: Melenkij Robot im Komitat Baranya in Ungarn
10.00 Uhr Krisztina Slacha, Historisches Institut der Universität Pecs/Fünfkirchen:
Die Ungarndeutschen im Ungarischen Archiv der Staatssicherheitsdienste (ÁBTL), bzw. die staatssicherheitliche Kontrolle und Beobachtung der Ungarndeutschen in der UVR
11.00 Uhr Dr. Martin Armgart, Speyer: Das Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen online. Neue Arbeits- und Präsentationsformen eines Langzeiteditionsprojektes
13.00 Uhr Dr. Jürgen Warmbrunn, Herder-Institut Marburg: Was trennt uns, Was verbindet uns? Über die Möglichkeiten vermehrter Zusammenarbeit zwischen Archiven und Bibliotheken zu Ostmitteleuropa
Die Veranstaltung wird gefördert vom
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Drittes Mitteleuropäisches Archivars- und Archivarinnentreffen aus Einrichtungen mit Quellensammlungen zur deutschen Geschichte im östlichen Europa vom 29. bis 31. Oktober 2012Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen
Programm Montag, 29. Oktober
14.00 Uhr Dr. Stefanie Jost/ Simon Heßdörfer: Bundesarchiv/ Lastenausgleichsarchiv Bayreuth: Aufgaben, Bestände und Benutzung des Lastenausgleichsarchivs
15.00 Uhr Dr. Ulrich Schmilewski, Kulturwerk Schlesien, Würzburg: Die Stiftung Kulturwerk Schlesien. Aufgaben, Tätigkeiten, Sammlungen
16.00 Uhr Sonja Anžič-Kemper, Landesarchiv Speyer: Quellen zu ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten im heutigen Slowenien.
Die Beispiele Gottschee und Krainburg/Kranj
19.00 Uhr Christian Rother, Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim: Das Archiv der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim
20.00 Uhr Réka Gyimesi, Fünfkirchen/Pecs: Die Minderheiten in den historisch-demographischen Quellen
Dienstag, 30. Oktober
09.00 Uhr Dr. Eleonore Géra, Budapest: Wiederbelebung des multikulturellen Stadtlebens in Buda und Pest nach der Türkenära
10.00 Uhr Thomas Şindilariu, Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt/Braşov: Die deutsche Minderheit in Rumänien im Archiv der Securitate. Eine Rekonstruktion der Beobachtung
11.00 Uhr Martina Wermes, Sächsisches Staatsarchiv Leipzig: Genealogische Unterlagen aus den Familiengeschichtlichen Sammlungen des früheren Reichssippenamtes zu Slowenien, Gottschee, Siebenbürgen, der Bukowina und Bessarabien
13.00 Uhr Dr. Ligia-Maria Fodor, Nationalarchiv Rumäniens, Bukarest: Zur Geschichte des Schulwesens in der habsburgischen Bukowina im Bestand „Bukowiner k.k. Landesregierung“
14.00 Uhr Dr. Livia Ardelean, Klausenburg/Cluj-Napoca: Die deutsche Bevölkerung aus Klausenburg und Umgebung in den archivarischen Quellen
15.00 Uhr Jakub Grudniewski, Kattowitz: Dokumentation der preußischen Staatsverwaltung im Bestand des Staatsarchivs Katowice
16.00 Uhr Dr. Zdenek Kravar, Landesarchiv Troppau/Opava: Das Hultschiner Ländchen – schlesische Region zwischen den Grenzen. Gesichtspunkte eines Archivars
17.00 Uhr Dr. Bronislav Dorko, Bezirksarchiv Jägerndorf/ Krnov:
Die Ausweisung der Deutschen aus der Sicht eines tschechischen Neusiedlers. Das Zusammenleben der Tschechen und Deutschen im Dorf Janušov bei Johnsdorf/Rýmařov bei Römerstadt in den Jahren 1945-1946
19.00 Uhr Mirosław Węcki, Kattowitz/Katowice: Kattowitzer NS-Bestand
(1933-1945) u.a. Partei, Staats- uns Wirtschaftsverwaltung
20.00 Uhr Dr. Otfrid Pustejovsky, Waakirchen: Josef Tippelt, deutscher Kolpingsenior in der ČSR, hingerichtet in Plötzensee 1943. Archivalien aus dem Bundesarchiv
Mittwoch, 31. Oktober
09.00 Uhr Beate Márkus, Pecs/Fünfkirchen: Melenkij Robot im Komitat Baranya in Ungarn
10.00 Uhr Krisztina Slacha, Historisches Institut der Universität Pecs/Fünfkirchen:
Die Ungarndeutschen im Ungarischen Archiv der Staatssicherheitsdienste (ÁBTL), bzw. die staatssicherheitliche Kontrolle und Beobachtung der Ungarndeutschen in der UVR
11.00 Uhr Dr. Martin Armgart, Speyer: Das Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen online. Neue Arbeits- und Präsentationsformen eines Langzeiteditionsprojektes
13.00 Uhr Dr. Jürgen Warmbrunn, Herder-Institut Marburg: Was trennt uns, Was verbindet uns? Über die Möglichkeiten vermehrter Zusammenarbeit zwischen Archiven und Bibliotheken zu Ostmitteleuropa
Die Veranstaltung wird gefördert vom
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
J. Kemper - am Donnerstag, 1. November 2012, 11:51 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Und gut sortiert ist das Online-Lexikon gelegentlich auch, so zum Beispiel mit interessantem Material zur Causa Stralsund: Der Benutzer "Kresspahl" stellte eine Liste der Rektoren des Stralsunder Gymnasiums, des heutigen Hansa-Gymnasiums in Stralsund, zusammen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hansa-Gymnasium_Hansestadt_Stralsund#Bekannte_Rektoren_des_Stralsunder_Gymnasiums
Über eine ganze Reihe dieser Rektoren, allesamt Gelehrte, kann man in eigenen Artikeln etwas erfahren. In der ehemaligen Bibliothek der Anstalt, deren verbliebene Bestände seit 1945 im Stralsunder Stadtarchiv verwahrt und kürzlich dem Handel überlassen wurden, waren diese Persönlichkeiten präsent, ihre Namen finden sich nunmehr zuhauf im umfangreichen Angebot eines Antiquars:
https://www.abebooks.de/servlet/SearchResults?sortby=0&vci=4323596
In der jetzt leider durch zerstreuende Veräußerung nicht mehr existierenden Bibliothek des Stralsunder Gymnasiums waren sie für einige Jahrhunderte als Ensemble in ihren Publikationen gegenwärtig am Ort ihres längst vergangenen Wirkens; mit der Auflösung dieser Sammlung wurden sie zu Buchstaben, zu Fliegenbeinen auf Papier. In den blauen Wikipedia-Links werden sie zur Gaukelei virtueller Klicks und zerfallen in einzelne Schaufenster. Erledigtes Kulturgut ist nicht recyclebar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hansa-Gymnasium_Hansestadt_Stralsund#Bekannte_Rektoren_des_Stralsunder_Gymnasiums
Über eine ganze Reihe dieser Rektoren, allesamt Gelehrte, kann man in eigenen Artikeln etwas erfahren. In der ehemaligen Bibliothek der Anstalt, deren verbliebene Bestände seit 1945 im Stralsunder Stadtarchiv verwahrt und kürzlich dem Handel überlassen wurden, waren diese Persönlichkeiten präsent, ihre Namen finden sich nunmehr zuhauf im umfangreichen Angebot eines Antiquars:
https://www.abebooks.de/servlet/SearchResults?sortby=0&vci=4323596
In der jetzt leider durch zerstreuende Veräußerung nicht mehr existierenden Bibliothek des Stralsunder Gymnasiums waren sie für einige Jahrhunderte als Ensemble in ihren Publikationen gegenwärtig am Ort ihres längst vergangenen Wirkens; mit der Auflösung dieser Sammlung wurden sie zu Buchstaben, zu Fliegenbeinen auf Papier. In den blauen Wikipedia-Links werden sie zur Gaukelei virtueller Klicks und zerfallen in einzelne Schaufenster. Erledigtes Kulturgut ist nicht recyclebar.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein befreundeter Theologe und Geisteswissenschaftler aus den USA hat in der Causa Stralsund dem Bürgermeister von Stralsund Alexander Badrow einen Brief geschrieben, den ich hier veröffentlichen darf.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am Reformationstag ist es gut, daran zu erinnern, welche kulturellen und gesellschaftlichen Errungenschaften die Reformation mit sich brachte. Dazu gehörten nicht zuletzt gute, allen zugängliche öffentliche Schulen und Bibliotheken.
Umso mehr muss es befremden, in diesen Tagen lesen zu müssen, dass die Hansestadt Stralsund auf Beschluss des Hauptausschusses vom 5. Juni 2012 den ''Teilbestand Gymnasialbibliothek" antiquarisch veräusserte.
Es ist völlig unverständlich, wie eine kommunale Körperschaft der
Zerschlagung einer in Jahrhunderten gewachsenen Sammlung wertvollen Kulturguts, die sie seit 1945 als Archivgut verwahrte, zustimmen kann. Gerade eine Hansestadt wie Stralsund, die sich des Titels Weltkulturerbe rühmt, sollte verantwortungsvoller mit ihrer Überlieferung umgehen. Ihre Geschichte und ihre unbeweglichen und beweglichen Zeugnisse sind doch ein
wesentlicher Teil dessen, was das Besondere gerade Ihrer Stadt ausmacht.
Einen Nutzen des Verkaufs, ausser dass das Archiv den Teilbestand
los ist (was ein trauriger Nutzen ist), kann ich nicht erkennen, schon gar nicht beim Verscherbeln an einen privaten, profitorientierten Antiquar. Finanziell kann der Verkauf (relativ gesehen) nicht viel gebracht haben und wird zur Schimmelsanierung kaum reichen - der Schaden ist jedoch immens, weil die Sammlung zerstört ist. Hat überhaupt eine wissenschaftliche Inventarisierung stattgefunden? Gab es
Kommunikation und Abstimmung mit der Landesbibliothek und den
Universitätsbibliotheken im Land? Wurde der Vorgang archivrechtlich geprüft - nach Ansicht einiger Experten hat die Stadt gegen ihre eigene Archivsatzung verstossen, die die Unveräusserlichkeit des Archiv- und Bibliotheksguts festschreibt.
Ich bitte Sie, Herr Oberbürgermeister, den Vorfall nicht auf sich
beruhen zu lassen, sondern Ihre Verantwortung dem Kulturerbe gegenüber wahrzunehmen und alles daran zu setzen, dass dieses Geschäft annulliert wird und der Teilbestand Gymnasialbibliothek wieder nach Stralsund zurückkommt und der Nachwelt und Forschung erhalten bleibt.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr
Dr. H... R...
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am Reformationstag ist es gut, daran zu erinnern, welche kulturellen und gesellschaftlichen Errungenschaften die Reformation mit sich brachte. Dazu gehörten nicht zuletzt gute, allen zugängliche öffentliche Schulen und Bibliotheken.
Umso mehr muss es befremden, in diesen Tagen lesen zu müssen, dass die Hansestadt Stralsund auf Beschluss des Hauptausschusses vom 5. Juni 2012 den ''Teilbestand Gymnasialbibliothek" antiquarisch veräusserte.
Es ist völlig unverständlich, wie eine kommunale Körperschaft der
Zerschlagung einer in Jahrhunderten gewachsenen Sammlung wertvollen Kulturguts, die sie seit 1945 als Archivgut verwahrte, zustimmen kann. Gerade eine Hansestadt wie Stralsund, die sich des Titels Weltkulturerbe rühmt, sollte verantwortungsvoller mit ihrer Überlieferung umgehen. Ihre Geschichte und ihre unbeweglichen und beweglichen Zeugnisse sind doch ein
wesentlicher Teil dessen, was das Besondere gerade Ihrer Stadt ausmacht.
Einen Nutzen des Verkaufs, ausser dass das Archiv den Teilbestand
los ist (was ein trauriger Nutzen ist), kann ich nicht erkennen, schon gar nicht beim Verscherbeln an einen privaten, profitorientierten Antiquar. Finanziell kann der Verkauf (relativ gesehen) nicht viel gebracht haben und wird zur Schimmelsanierung kaum reichen - der Schaden ist jedoch immens, weil die Sammlung zerstört ist. Hat überhaupt eine wissenschaftliche Inventarisierung stattgefunden? Gab es
Kommunikation und Abstimmung mit der Landesbibliothek und den
Universitätsbibliotheken im Land? Wurde der Vorgang archivrechtlich geprüft - nach Ansicht einiger Experten hat die Stadt gegen ihre eigene Archivsatzung verstossen, die die Unveräusserlichkeit des Archiv- und Bibliotheksguts festschreibt.
Ich bitte Sie, Herr Oberbürgermeister, den Vorfall nicht auf sich
beruhen zu lassen, sondern Ihre Verantwortung dem Kulturerbe gegenüber wahrzunehmen und alles daran zu setzen, dass dieses Geschäft annulliert wird und der Teilbestand Gymnasialbibliothek wieder nach Stralsund zurückkommt und der Nachwelt und Forschung erhalten bleibt.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr
Dr. H... R...
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die ZEIT befragte Dr. jur. Steinhauer zu seiner Halloween-Vorlesung:
http://www.zeit.de/2012/44/Bibliotheksmumien-Kulturwissenschaft-des-Morbiden-Steinhauer

http://www.zeit.de/2012/44/Bibliotheksmumien-Kulturwissenschaft-des-Morbiden-Steinhauer

KlausGraf - am Mittwoch, 31. Oktober 2012, 22:05 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kollege Dr. Peter Blum hat uns freundlicherweise den folgenden Bericht zur Verfügung gestellt. Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/97058539/
„Es ist nicht schwer, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Nur mit dem Entziffern hapert es fürchterlich.“
(Bericht über den 75. VdW-Lehrgang, 10.-13. Juni 2012 in Wiesbaden, Frankfurt, Hanau und Essen) Ein Jubiläumskurs – eine Tagung – ein mühevoller und doch lohnender Schritt auf dem Weg der Annäherung
Der Sinnspruch des österreichischen Dichters und Aphoristikers Ernst Ferstl ist vieldeutig. Und er mag auch für die zunehmend globalisierte Welt der Wirtschaftsarchivare sowie das Zustandekommen derartiger Fortbildungsveranstaltungen gelten.
Am Fallbeispiel China, das mittlerweile zum wichtigsten Handelspartner der BRD aufgerückt ist, erweist sich eindrücklich, vor welch neuen Herausforderungen Wirtschaftsarchivare (Anm.: Allein zur besseren Lesbarkeit wurde durchgängig die männliche Schreibweise verwendet. Gemeint ist jedoch ausdrücklich sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise) stehen: Globales Wirtschaften lässt Schrift- und Dokumentationsgut zunehmend dezentral heranwachsen. Was der Unternehmensarchivar bislang in der Regel noch für und in das heimische Konzernarchiv „kanalisieren“ konnte, droht längst fernab allzu oft und unwiederbringlich, seinem unmittelbaren Blick und Zugriff verborgen, in anderen Kanälen zu versickern … Zudem fehlen die zusätzlich benötigten Ressourcen. Auch grenzüberschreitend Auszusonderndes und Archivwürdiges zu erfassen, zu sichern, einem unternehmensinternen Wissensmanagement, der Historischen Wissenschaft und als kulturelles Erbe zu erhalten und zugänglich zu machen, setzt zudem Fähigkeiten und Kenntnisse des Archivars voraus, auf die er bislang meist gar nicht vorbereitet war. Weder in der Aus- noch in der Weiterbildung. Denn es gilt, sprachliche und interkulturelle Hürden zu überwinden, um letztlich funktionierende Archivstrukturen auch auf Auslandsmärkten aufzubauen. Und um dezentral generiertes und allein schon sprachlich heterogenes Archivmaterial körperlich oder virtuell (im Sinne einer übergreifenden Archivplattform) zusammenzuführen bzw. zu integrieren …
Die Vorbereitung einer derartigen Fortbildungsveranstaltung erwies sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht minder problematisch: Zur Einbindung chinesischer Kollegen als aktive Veranstaltungsteilnehmer waren teils in enger Abstimmung mit diesen eine Reihe von komplizierten bürokratischen Hürden und Abstimmungsarbeiten zu meistern (und ebenso bereits manch interkulturelle Barrieren zu überspringen). Das bedingte, sich auch der Unterstützung offizieller chinesischer Stellen zu versichern, um zumindest ansatzweise Planungssicherheit herzustellen.
Gleichwohl konnte die Teilnahme der einen chinesischen Delegation erst drei Tage vor Veranstaltungsbeginn definitiv bestätigt werden … (die Gefühlslage des Organisierenden mag damit angedeutet sein). Insofern konnten auch die Themenabgrenzung und Ablaufplanung (Referenten, Vorträge) erst wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. Budgetbedingt scheiterte in zwei Fällen die Verpflichtung von weiteren kompetenten chinesischen Kollegen. Den bis zuletzt betriebenen Bemühungen, unter Einschaltung des chinesischen Generalkonsulats zwei Free Tickets einer chinesischen Airline zu erhalten, war leider ebenso wenig Erfolg beschieden. Immerhin lieferte dennoch einer der beiden an der persönlichen Teilnahme verhinderten Kollegen Vortragsskript und Präsentation. Und da die Mehrzahl der chinesischen Referenten ebenfalls ihre Präsentationen und Redetexte kurz vor der Tagung einlieferten, konnten im Vorfeld fast alle chinesischen Texte übersetzt, vorsichtig (weil die Zeit zur Abstimmung mit den Verfassern fehlte) redigiert und letztlich in der Veranstaltung den Teilnehmern zum leichteren Verständnis an die Hand gegeben werden.
Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, adäquatem Catering sowie stimmigen Sponsoren offenbarte weitere gravierende Realisierungsprobleme: Das Museum für Kommunikation war Hauptaustragungsort und zugleich Programm. In bevorzugter Lage am Frankfurter Museumsufer sollte es zur Brücke der Verständigung werden. Noch dazu in Sichtweite eines an den Blick vom legendären Bund nach dem mondänen Pudong in Shanghai erinnernden „Mainhattan“ (auch wenn dieser Vergleich hier nur en miniature gelten konnte). Als weitere interessante Begegnungsorte boten sich dank der Unterstützung der Kollegen in Frankfurt und Hanau der so genannte BrandSpace der Deutsche Bank AG und das Konzernarchiv von Evonik Industries AG in Hanau an. Die Gastfreundschaft der Kollegen in diesen drei Einrichtungen bildete eine erste verlässliche Planungsgrundlage.
Geradezu beängstigende Finanzierungslücken taten sich dennoch überraschend auf, als ein Caterer seinen nahezu konkurrenzlosen Standortvorteil sozusagen über Gebühr geltend zu machen versuchte. Robert CAO und dem von ihm begründeten Düsseldorf China Center DCC sowie kollegialer Hilfestellung vor Ort ist es zu verdanken, dass die Kostenexplosion letztlich auf das finanzierbare und vertretbare Maß reduziert werden konnte. So glänzte das alternative Catering im 8. Stock der nahe gelegenen Landesversicherungsanstalt Hessen nicht allein mit Kostenvorteilen, sondern mit ansprechender Verpflegung bei herausragendem Blick auf die Frankfurter Skyline.
Wer in China einmal zu Gast war, weiß, in welchem nicht allein protokollarisch ausgestalteten Rahmen dortige Auftaktveranstaltungen inszeniert werden. Ähnliches in Frankfurt aufzubieten, erwies sich ungeachtet starker Einbindung der Archivkollegen vor Ort und zahlreicher anderer angefragter Projektpartner (Firmen wie öffentlicher Einrichtungen) als (insbesondere finanziell) nicht realisierbar. Verschiedene auswärtige Optionen schieden aus aufgrund von Kosten- oder Handling-Handicaps. So ebenfalls die mit der Kollegin der in Wiesbaden ansässigen Henkell & Co Sektkellerei KG durchgespielten Szenarien. Gleichwohl erwuchs aus dieser Zusammenarbeit der Kontakt zur Wiesbadener Casino-Gesellschaft. Und für Anmietung und Catering im festlichen Foyer und Spiegelsaal des im Stil des strengen Historismus errichteten Casino-Gebäudes ließen sich schließlich noch moderate Kosten aushandeln. Wobei für den Sektempfang (sowie für die Bereitstellung der Gastgeschenke an Referenten und Teilnehmer) die Sektkellerei und das feierliche Abendessen die SAP AG, Walldorf als Sponsoren gewonnen werden konnten.
Dessen ungeachtet trugen die Kostenplanungen für die Gesamtveranstaltung über lange Wochen hinweg absolut defizitären Charakter. Erschwerend kam hinzu, dass spätestens ab dem Moment, zu dem die chinesischen KollegInnen signalisiert hatten, offiziell ihre Anreise zu betreiben und teils auch Vortragsverpflichtungen zu übernehmen, es längst kein Zurück mehr gab …
Um die finanziellen Ressourcen der VdW als verantwortlichem Ausrichter nicht überzustrapazieren, war somit ein – über Monate hin zermürbendes, weil lange Zeit weitgehend erfolgloses – Fundraising notwendig. Herausgehobene Personen, öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen, Unternehmer und Unternehmen hieß es nunmehr individuell zu kontaktieren, zu überzeugen, zu Spenden oder zum Sponsoring zu bewegen. Dass Archiv(ar)e weitgehend ohne Lobby dastehen, wurde selten schmerzlicher bewusst.
In dieser Zeit füllten sich vier Stehordner mit Korrespondenz. Wobei auf eine Antwort seitens der angefragten Stellen in der Regel erst nach schriftlicher oder mündlicher Wiederholung der Anfrage gerechnet werden durfte. Verzichtet sei hier auf die Wiedergabe der teils erbärmlich fadenscheinig begründeten Absagen. – Dass es sich bei den angefragten Stellen ganz überwiegend um solche mit ausgeprägtem China-Bezug oder konkret um Firmen handelte, deren Umsätze/Erlöse im Chinageschäft derzeit nachweislich boomen, sei dagegen nicht verschwiegen.
Leider ist es nicht gelungen, – trotz der Unterstützung durch das Chinesische Generalkonsulat, die Chinese Enterprises Association in NRW, durch einen Aufruf in der Chinesischen Handelszeitung und diverse deutsch-chinesische Netzwerke – über Robert CAO und das DCC hinaus chinesische oder deutsch-chinesische Unternehmen zur Unterstützung zu bewegen. Dass letztendlich der „finanzielle Gau“ vermieden werden konnte, ist – wiederum von Archivkollegen bewirkten – beträchtlichen Einzelleistungen wie zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung und der Robert Bosch GmbH sowie einer langen Reihe von Archivausstattern sowie einzelnen Unternehmen mit China-Bezug zu danken!
Zu den organisatorisch-technischen und den finanziellen Problemen gesellte sich unversehens ein weiteres: Die mangelnde Nachfrage unter potentiellen Teilnehmern. Während die Rekrutierung deutschsprachiger wie chinesischer Referenten, abgesehen von landesspezifischen formalen Problemen, planmäßig lief, stagnierten lange die Anmeldezahlen. Mit Erstankündigung des 75. VdW-Kurses im Dezember 2011 hatten sich spontan einige wenige Unternehmensarchivare angemeldet. Diesen Kreis zu wirtschaftlich tragfähiger Größe auszubauen, wurde unvermittelt ein weiteres Arbeitsfeld, auf dem Überzeugungsarbeit zu leisten war.
Als Grund für die zunächst vermissten Anmeldungen wurde auf Befragen die mangelnde Akzeptanz innerhalb des Unternehmens für die Teilnahme von Archivmitarbeitern an Veranstaltungen internationalen Zuschnitts benannt. Daneben waren es jedoch oft „andere Baustellen“, weshalb sich der Unternehmensarchivar für „unabkömmlich“ erklärte. Andere Kollegen, verwiesen darauf, die aus der Globalisierung erwachsenden Probleme in vielleicht zwei Jahren energischer angehen zu wollen; aktuell jedoch könne man sich diesen Problemen noch nicht stellen. Man erwartete sozusagen entsprechende Fortbildungsangebote „zu gegebener Zeit“. Unternehmensarchivare anderer ausgewiesener Global Player gestanden den akuten Handlungsbedarf uneingeschränkt ein, verwiesen allerdings auf die latente Arbeitsüberlastung und darauf, dass glücklicherweise noch niemand im Unternehmen erkannt habe, dass dem Unternehmensarchivar hier akuter Handlungsbedarf erwachse, der zum Handeln dränge … – Die im Fall des Sponsoring bei zahlreichen Ansprechpartnern mit aktueller wie starker China-Affinität wahrzunehmende Verdrängung, auf einen durchaus nicht in Abrede gestellten akuten Handlungsbedarf jedoch bestenfalls zukünftig reagieren zu wollen, zeigte sich somit in ähnlicher Form auch unter Wirtschaftsarchivaren.
Kein Wunder, dass die vom VdW-Vorstand ausgesprochene Reduzierung der Kursgebühr von 500€ auf eine „Schutzgebühr“ von 75€ das Anmeldeverhalten kaum nennenswert beeinflusste. Dabei wurde die Attraktivität von Kursprogramm und -gebühren, ergänzt um überaus günstige Raten (von 57-74€ pro Nacht inkl. Frühstück) im Rahmen des ausgehandelten Hotelkontingents zu keinem Zeitpunkt bestritten. Allzu hohe finanzielle Hürden standen einer Teilnahme somit nicht entgegen.
Für die am Buchungsverhalten ablesbare eher verhaltene Leidenschaft dürften insbesondere zwei Faktoren maßgeblich gewesen sein: Zum einen die Einschätzung, mit einer stärkeren Fokussierung auf die im Ausland generierte Überlieferung des Unternehmens eine in der Tat „größere Baustelle aufzumachen“, die nicht zuletzt unternehmensintern auch das Einfordern zusätzlicher Ressourcen bedingt. Zum anderen dürfte auch in den meisten international tätigen Unternehmen die Vorstellung „archivists going global“ noch gewöhnungsbedürftig sein; auch und gerade vor dem Hintergrund der meist nicht eben herausgehobenen unternehmensinternen Stellung der Archiv(ar)e.
So blieb am Ende nur der wiederholte Griff zum Telefonhörer. Es galt, Überzeugungsarbeit im Blick auf eine Kursteilnahme zu leisten, um so zumindest einmal programmatisch ein neues Arbeitsfeld abzustecken und damit einen Anspruch an sich und an das eigene Unternehmen zu formulieren. Das erwies sich als zeitaufwendig, aber durchaus erfolgreich. Die Teilnehmerliste umfasste zum Kursauftakt über 55 Personen, womit sich der Kurs zur kleinen Tagung entwickelt hatte.
Nebeneffekt: Selbstredend sind den anreisenden chinesischen Archivkollegen die für den deutschen Sprachraum namhaften Global Player bekannt. Hätten z.B. BMW, Porsche und andere auf der Teilnehmerliste gefehlt, wäre das ein erstes irritierendes Signal an die chinesische Adresse gewesen, darüber nachzudenken, inwieweit die involvierten Archive überhaupt für die im China so geschätzte deutsche Wirtschaft stehen können. Gut, dass es anders gekommen ist!
Der Impuls zu der Veranstaltung im Juni 2012 ging zurück auf eine Delegationsreise vom April 2011. Damals reiste eine kleine Delegation von Wirtschaftsarchivaren aus Deutschland und der Schweiz nach China, um an einer international besetzten Tagung in Shanghai zum Thema „Green Archives“ teilzunehmen sowie an einer weiteren, gemeinsam mit den chinesischen Kollegen organisierten Veranstaltung in Wuxi. Letztere bestand aus einer Vortragsveranstaltung nebst mehreren Archivbesichtigungen. Der Austausch entwickelte sich für beide Seiten überaus anregend und in einer – für die meisten „Langnasen“ unerwartet – sehr freundschaftlichen Atmosphäre. Dabei keimte die Idee, diesen Dialog bei nächster sich bietender Gelegenheit fortzusetzen. Doch sollten dann die Zeitanteile der Vorträge (= Monologe) zugunsten von kurzen Impulsreferaten und offenen Frage- und Diskussionsrunden stärker begrenzt werden. Diese Idee und vor allem die freundschaftliche Atmosphäre sollten im 75. VdW-Lehrgang aufgegriffen und vertieft werden. Das Moment des auch menschlich verbindenden fachlichen Austausches sollte dabei bewusst mitverfolgt werden, um ggfs. die chinesischen Kollegen auch einmal als Vermittler einschalten zu können, wenn es beispielsweise „Verständigungsprobleme“ beim Aufbau von Archivstrukturen in den ausländischen Unternehmensniederlassungen geben sollte. Gerade die herzliche Aufnahme in Wuxi hatte dazu geführt, in den chinesischen Kollegen auch den „Freund und Helfer“ zu erkennen wie auch das Potential freundschaftlicher Verbundenheit für die Lösung archivfachlicher Fragestellungen und Probleme.
Entsprechend diesem Ansatz und im Blick darauf, dass Archivare überall auf der Welt die Arbeit für das gemeinsame kulturelle Erbe verbindet, leistete der Kurs auch einen Beitrag zur Völkerverständigung. Konsequenterweise kamen bei der festlichen Auftaktveranstaltung in den Räumen der Wiesbadener Casino-Gesellschaft der stellvertretende Generalkonsul WANG Xiting und der Vertreter des Initiators und Geschäftsführers des (nicht-staatlichen!) Düsseldorf China Centers (DCC) Robert CAO, nämlich der Marketing Direktor Walter Schuhen zu Wort. Während WANG die völkerverbindenden Aspekte und die wachsende Bedeutung eines grenzüberschreitenden Zusammenwirkens der Archivare hervorhob, betonte Schuhen, dass das DCC explizit gegenseitiges Verständnis, die Kenntnis interkultureller Unterschiede und freundschaftliche Beziehungen sozusagen zur Plattform nachhaltiger wirtschaftlicher Zusammenarbeit mache. Genau dieses gemeinsame Verständnis vom Umgang miteinander sei denn auch maßgeblich gewesen für die Förderung unserer Veranstaltung.
Der Vorsitzende der VdW Michael Jurk, der Präsident des Bundesarchivs Dr. Michael Hollmann und Dr. Daniel Nerlich als Vertreter des VSA begrüßten in ihren Statements eine stärkere Vernetzung über die nationalen und europäischen Netzwerke hinaus. Chinesische Archivdelegationen auf Informationsreise im Westen, das sei längst Normalität. Ein stärkerer Blick umgekehrt auf die Arbeit der chinesischen Kollegen und eine Intensivierung der Zusammenarbeit seien dagegen überfällig und für alle Beteiligten lohnend!
Als Vice-President im Bereich SAP Labs Network Management der SAP AG erinnerte Dr. Clemens Däschle an das langjährige Engagement seines Hauses in Asien und speziell in China. Diese starke China-Affinität – zumal im Rückblick auf 40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen BRD und VCR, in denen sich der chinesische Markt stetig geöffnet habe – und die Affinität verschiedener SAP-Produkte zur elektronischen Archivierung habe die SAP AG dazu bewegt, die Tagung als Hauptsponsor zu unterstützen.
Im Anschluss an das folgende Abendessen kam es zu einer großen Vorstellungsrunde, in deren Verlauf sich – beginnend bei den beiden jeweils 6köpfigen Delegationen aus Beijing und Wuxi – alle Teilnehmer mit wenigen Worten dem größeren Kreis vorzustellen hatten. Dies diente dem schnelleren Kennenlernen und der Kommunikation untereinander.
À propos Kommunikation: Tagungssprachen waren bewusst allein Chinesisch und Deutsch. Das Risiko zweifacher Übersetzung über die Brücke des Englischen sollte konsequent vermieden werden; zumal bestimmte Begriffe in allen drei Sprachen nicht durchweg auf synonyme eindeutige Worte oder Zeichen rechnen können. Für die Übersetzungen ins Chinesische/Deutsche waren zwei in China geborene Dolmetscher engagiert worden, die ihre wissenschaftliche Ausbildung an der Heidelberger Universität absolviert haben und die sich teils auch beruflich nach wie vor regelmäßig in beiden Ländern aufhalten. Um es vorweg zu nehmen: Beide Dolmetscher haben maßgeblich zum gegenseitigen Verständnis und Gelingen der Tagung beigetragen.
Unter der Überschrift „Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis“ begann der Montagmorgen im Museum für Kommunikation mit zwei „interkulturellen Annäherungen“. Zunächst stellte Frau MAO Zuhui (Geschäftsführerin Sinalingua, Heidelberg/Shanghai) Deutschland und die auf Chinesen lauernden interkulturellen Barrieren und „Fettnäpfchen“ vor. Unmittelbar danach wechselte Dr. Sabine Hieronymus (die kurzfristig für den ursprünglich vorgesehenen, aber erkrankten Referenten eingesprungen war) die Perspektive, um Brücken zu bauen zum chinesischen Selbstverständnis usw. Besonders anregend dabei war der unmittelbare Perspektivwechsel, der nicht allein zunächst fremd anmutende kulturelle Besonderheiten vorstellte, sondern jeweils einem Teil des Publikums zugleich den Spiegel vorhielt, wie man von der anderen Seite wahrgenommen wird.
In der Sektion 2 „Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland“ lieferte die Generaldirektorin der Beijing Municipal Archives CHEN Leren eine „Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen Beijings“. Die Referentin stellte eine Reihe von teils erloschenen, teils noch tätigen Wirtschaftsbetrieben anhand einschlägiger Quellen vor und berichtete über die archivfachliche Betreuung durch das Archiv der chinesischen Kapitale. Aufsehen erregte insbesondere die ausgedehnte Öffentlichkeits-, d.h. insbesondere Publikationstätigkeit: So entstanden 2011 allein an den Beijing Municipal Archives über 400 Bücher zur Stadtgeschichte.
Auf ein Beispiel für chinesische Quellen in deutschen Wirtschaftsarchiven, nämlich aus den Beständen des ehemaligen historischen Archivs der Dresdner Bank konnte Michael Jurk verweisen: Dort nämlich fand sich die Gründung der China-Studien-Gesellschaft durch den Reichsverband der deutschen Industrie aus dem Jahr 1931 abgebildet.
Zu einem Plädoyer für eine stärkere Rolle öffentlicher Archive bei der Wirtschaftsarchivarbeit betrat darauf SHENG Xiaoqi de Bühne: SHENG „ist ein unscheinbarer Mann, klein und von chinesischer Höflichkeit. Er passt in das Bild, das Europäer von China haben. Und er prägt es selbst mit. Als Generaldirektor des Stadtarchivs von Wuxi, einer Stadt vor den Toren Shanghais, hält er die Erinnerung wach an ein China, das sich ständig neu erfindet. Beim 75. Lehrgang … erfuhren Shengs deutsche Kollegen, welchen Auftrag China im kollektiven Erinnern sieht. China pflegt demnach eine lebendige Erinnerungskultur, die die Archive nah an den Alltag der Menschen heranrückt. Auch werde in China mit nationalen Gesetzen geregelt, wie private und staatliche Unternehmensarchive zu führen seien … Die wirtschaftlichen Entwicklungen werden in chinesischen Archiven minutiös protokolliert. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern müssen in China ein Archiv führen, die kleineren Betriebe bittet Sheng darum. Unternehmen, die im Strudel der Entwicklung verschwinden, geben ihre Archivsammlungen an die staatlichen Einrichtungen ab. Nichts soll vergessen werden, wenn China seine fünftausendjährige Geschichte fortschreibt. – Die deutschen Wirtschaftsarchivare staunten über die Berichte …“
Der in der F.A.Z. am 13. Juni (S. 38) unter der Headline „Die Pflicht zur Aufbewahrung. Wirtschaftsarchive in China und Deutschland – eine Tagung“ abgedrückte Bericht gibt auch atmosphärisch durchaus stimmigen Einblick in den Tagungsverlauf. Vielleicht war es gleichwohl eher ein Raunen, denn ein Staunen. Denn bereits im vergangenen Jahr keimte während des Aufenthalts in Wuxi der jedoch nicht expressis verbis von den chinesischen Kollegen bestätigte Verdacht, dass der während einer Führung so ganz nebenbei erwähnte optionale virtuelle Zugriff vom Lesesaal des Stadtarchivs auf die Daten des (privaten) Unternehmensarchivs keineswegs allein auf eine zufällig identische Archivsoftware zurückgeht …
SHENGS eindeutiges Statement verwandelte den zunächst als „Vermittler“ bei dem Aufbau archivischer Strukturen an den chinesischen Unternehmensstandorten erhofften staatlichen Kollegen in den formal zuständigen Archivkollegen und Partner. Bei ihm liegen Kontroll- und Instruktionsrechte bezüglich der Einrichtung und Unterhaltung des Unternehmensarchivs sowie der Aus- und Weiterbildung von Unternehmensarchivaren. Ein Gutteil der Unternehmensarchivbestände wird denn sogar in den staatlichen Archiven verwahrt. Und: Es gibt gegenwärtig sogar Überlegungen, die geltenden Bestimmungen auf die in China tätigen ausländischen Unternehmen zu übertragen … Ohne Frage waren dieses Referat und die anschließende Diskussion ein wesentlicher Schlüssel zum besseren Verständnis des chinesischen Archivwesens.
Dr. Andrea Hohmeyer vermittelte im Anschluss aktuelle Beispiele einer „History Communication“ innerhalb des von ihr geleiteten Konzernarchivs der Evonik Industries AG. Ein ähnliches ansprüchliches Selbstverständnis von der Dienstleistungsfunktion und dem Anspruch archivarischer Tätigkeit im Rahmen eines unternehmensintern wie -extern ausstrahlenden Wissensmanagements offenbarte der Vortrag von Dr. Sabine Bernschneider-Reif unter dem Titel „Neue Strategien für Corporate History in einem sich verändernden Unternehmen“ (Merck KGaA). – Wer erwartet hatte, dass ein derartiges Selbstverständnis und Handeln in China möglicherweise weniger stark ausgeprägt wäre, der staunte dann in der Tat, als der Direktor der Xishan District Archives SONG Yonming in seiner Präsentation die Arbeit seines Archivs mit einem „Thinktank“ verglich. Keine Spur also von im Sozialismus erstarrter „Beamtendenke“, sondern modernes kundenorientiertes Denken, ausgeprägte Servicementalität, vielfältige Ansätze, neben dem eigenen Archiv auch motivationsfördernd auf die Einrichtung von so genannten „Dorf- und Gemeinschaftsarchiven“ hinzuwirken, ein „praktisches Handbuch für die Verwaltung von Unternehmensarchiven“ herauszugeben … Denn: „Wir, als Archivare, arbeiten dort, wo die wirtschaftliche und soziale Entwicklung staatfindet!“
Auch wenn Anspruch und Wirklichkeit in der Praxis nicht immer zu 100% übereinstimmen mögen (was zweifellos nicht minder für die von „Langnasen“ betreuten Archive gilt), Veränderung beginnt im Kopf! Und hier sind die chinesischen Archivare absolut auf Augenhöhe ihrer westlichen Kollegen. Der in westlichen Kreisen in den vergangenen Jahren oft kolportierte Hinweis auf die allein hervorragende technische Ausstattung der in den reicheren Provinzen an der chinesischen Ostküste gelegenen Archive, kennzeichnet des Zustand des chinesischen Archivwesens jedenfalls nur unvollkommen.
Szenenwechsel: Die Abendveranstaltung führte alle Teilnehmer im so genannten BrandSpace der Deutsche Bank AG zusammen. Ähnlich wie es einzelne Automobilhersteller vorexerzierten, ist dies der Ort, in dem das größte deutsche Kreditinstitut anhand unterschiedlichster kreativer Installationen Markenkommunikation betreibt und nicht zuletzt das eigene Markenbewusstsein demonstriert. Vor dem geführten Rundgang und dem gebotenen Abendessen stand jedoch ein archivischer „Apéro“: Denn der Leiter des Historischen Instituts der Deutsche Bank AG Dr. Martin L. Müller begrüßte nicht allein die Gäste, sondern lieferte mit einem kurzen Abriss der „Geschichte der Deutschen Bank in China“ den kurzweiligen wie treffenden Bezug zur Tagung.
Im Anschluss hielt der Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs und ICA-Vice-President Andreas Kellerhals einen Kurzvortrag mit dem Titel „Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …“ Darin verwies der Referent auf die unterschiedlichen grenzüberschreitenden Netzwerke des Internationalen Archivrates. Vor allem aber betonte er den Aspekt der Freundschaft: Einerseits im Rückbezug auf Aristoteles als Grundlage des Zusammenwirkens kraft verbindender Ideale und gemeinsamen Nutzens. Andererseits machte er jedoch deutlich, dass es daneben eine „Freundschaft um der Freunde willen“ gibt, die auch dann noch fortdauert, sollte der gemeinsame Nutzen einmal wegfallen. Denn Freundschaft, nicht allein als eine Zugewinngemeinschaft definiert, stärkt die Gemeinschaft der Archivare und jeden einzelnen, lässt die Gemeinschaft wie den einzelnen wachsen, wird erst dadurch nachhaltig!
Von den Veränderungen im Bereich des Unternehmensarchivwesens seit Einführung des marktwirtschaftlichen Systems in China handelte am Dienstagmorgen der Vortrag von WANG Lan, Director of the Supervision Department on Economic, Scientific and Technological Records and Archives der Staatlichen Chinesischen Archivverwaltung und Vorstandsmitglied der ICA-Sektion der Wirtschaftsarchivare. Infolge der Abwesenheit des Referenten konnte der Vortrag zur Präsentation nur verlesen werden. Was doppelt schade war, denn über zahlreiche interessante wie anregende Einzelaspekte dieses Vortrags hätte sich trefflich diskutieren lassen. Dabei ging es nicht allein um neue Technologien und z.B. die Erfahrungen bei der Etablierung eines Records Managements gemäß ISO 15489. Auch hier standen u.a. Innovationsprozesse sowie Fragen des Wissensmanagements und des modernen Archivmanagements im Fokus. Einige der programmatischen Kernsätze lauteten: „Auf die positive Vorstellung eigenen Handelns kommt es an!“ Und: „Die geistige Einstellung ist der Motor des Innovationsmanagements – Archivarbeit ist eine Managementtätigkeit!“ WANG blieb auch Beispiele für seine Aussagen nicht schuldig: „Wir können uns auch drei Archivare vorstellen: Der erste Archivar sagt: „Ich habe gerade die ausgesonderten Dokumente archiviert." Der Zweite sagt: „Ich kenne mich sehr gut im Archivmanagement aus.“ Der Dritte sagt: „Ich verwalte die für Unternehmen unverzichtbaren Informationsressourcen und historischen Schätze." Ergo müsste ein guter Archivar aus der Sicht des Managements „nach Idealen streben und so über die konkrete Arbeit hinausdenken“. – Ergo: Interkulturelle Unterschiede lassen sich nicht wegdiskutieren. Aber derartige Aussagen verdeutlichen, wie bemerkenswert nah Unternehmensarchivare in unseren so weit auseinander liegenden Ländern in so manchen Einzelaspekten einander sind.
„Das Eigene in den Augen des Fremden“ suchte und fand Dr. Daniel Nerlich vom Archiv für Zeitgeschichte (ETH Zürich) bei einem von ihm vorangetriebenen chinesisch-schweizerischen Ausstellungsprojekt. “Chinese Communists in Foreign Journalists’ View” ist dieses Ausstellungsprojekt betitelt. Es wird nicht allein den historischen Bildungsauftrag des Archivs mit Leben erfüllen. Nicht nur Quellen inszenieren, die bis dato im Verborgenen schlummerten und die im Zuge von Internationalisierung/Globalisierung erst jetzt zunehmend auch vor Ort auf ein interessiertes Publikum rechnen dürfen. Sondern den beteiligten Archiv(ar)en wird dies unstrittig vor heimischer wie fremder Kulisse Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung eintragen.
Das Ausstellungsprojekt lässt sich zurückführen auf die Delegationsreise nach China vom vergangenen Jahr, an der auch der Referent teilgenommen hatte. Derart sensibilisiert wurde u.a. der Fotografennachlass Bosshard im eigenen Archiv „gehoben“. Das stieß auf chinesischer Seite auf Interesse. Es erfolgten Gegenbesuche in Zürich. Rasch nahm in der Folge ein gemeinsames Ausstellungsprojekt Fahrt auf, mit dem sich die Archivare in der Schweiz wie in China im kommenden Jahr unter anderem auch als international vernetzte Weltbürger präsentieren werden. Nach der Devise: From Local to Global!
Die nächsten beiden Einzelbeiträge steuerten die Vize-Direktorin des Unternehmensarchivs der Citic Bank (Wuxi) ZHOU Yanyan und die Direktorin der New District Archives (Wuxi) JIANG Lifang bei. Im Fall des Unternehmensarchivs wurde einmal mehr der ausgeprägte (interne) Dienstleistungscharakter herausgestellt. Die auch wirtschaftliche Daseinsberechtigung untermauerten nicht weniger als 32 mithilfe des Archivs gewonnene Prozesse mit einem Streitwert von umgerechnet annähernd 20 Millionen Euro. – Das Beispiel des 1998 erst eingerichteten Archivs des Neuen Bezirks verdeutlichte, wie rasch und flexibel neue Archivstrukturen bisweilen errichtet werden können. Gehen die Anfänge des Neuen Distrikts doch auf das Jahr 1992 zurück. Aus naheliegenden Gründen werden die Archivbestände in diesem Fall noch überwiegend von der Verwaltung selbst nachgefragt.
Obschon auch dieses Archiv seine Daseinsberechtigung wirtschaftlich unter Beweis stellen konnte (durch die Wiederverwendung vorliegender Daten aus dem Baubereich wurden Kosten in Höhe von umgerechnet 4 Millionen Euro bei Messungen und Planungen erspart), vermittelte dieser Vortrag zugleich einen Hinweis auf berufsständische Imageprobleme: „Die Archivarbeit gilt als monoton und langweilig. Aber die Archivare arbeiten unauffällig und bieten aufgrund ihres Eifers trotzdem einen dienstleistungsorientierten Service“. ChiNah: Welche „Langnase“ könnte das nicht schmerzlich nachvollziehen?
In Sektion 3 „Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen“ thematisierte der Vortrag von Dr. Klaus Graf (Weblog Archivalia/Hochschularchiv Aachen) „Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern: Social Media“. Es war ein leidenschaftliches Plädoyer, Social Media als virtuelles Schaufenster in die Archive zu nutzen, als Plattform eines fachlichen Austauschs sowie als Option, um neue Zielgruppen und insbesondere auch Jüngere für das Archiv anzusprechen. Bedauerlicherweise fand dieser Appell, Neues und auch ein Stück weit Transparenz in einer Unternehmenskultur zu wagen, keine rechte Rückmeldung. Weder bei „Langnasen“ noch bei Chinesen. Das verwundert; wo doch gerade in China gemeinhin eine starke Affinität der meist jungen Internet-Community zu den Social Media herrscht. Eine Studie vom April 2012 ist betitelt: „China’s Social-Media Boom“ ( http://www.mckinseychina.com/wp-content/uploads/2012/04/McKinsey-Chinas-Social-Media-Boom.pdf ) und diese verweist gerade auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung im Blick auf Marken- und Produktentscheidungen (Kaufverhalten).
Unter deutschen Wirtschaftsarchivaren finden sich bislang wenige Befürworter eines verstärkten Einsatzes der Social Media. Wobei die Kollegen häufig pragmatisch auf den zusätzlichen und kaum mehr zu leistenden Arbeitsaufwand abheben. Erstaunlicherweise zeigen in letzter Zeit aber auch und gerade jene Unternehmen Social Media-Aktivitäten, von denen man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte. Jüngstes Beispiel die Commerzbank AG, wie unter folgendem Internetlink verifizierbar: https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/karriere/social_media_/social_media.html.
Über „Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit“ hätte im Anschluss die Sinologin Dr. Vivian Wagner sprechen sollen. Was ein Sterbefall im Umfeld der Referentin jedoch kurzfristig vereitelte. Der Hinweis auf „Entfallenes“ im Rahmen dieses Berichts ist keineswegs müßig, wie man zunächst annehmen könnte. Denn umso mehr ist hier auf die bisher seitens der Archivwelt fast gänzlich unreflektierte Dissertation der verhinderten Referentin zu verweisen: „Erinnerungsverwaltung in China. Staatsarchive und Politik in der Volksrepublik (Köln – Weimar – Wien 2006 (=Beiträge zur Geschichtskultur, 31)). Eine grundlegende Arbeit über die Geschichtsschreibung und Archivwesen in China. Erarbeitet anhand der chinesischen Fachliteratur, vertraulicher Materialien und auf Basis zahlreicher Interviews mit Archivaren, Historikern und Funktionären. Ein knapp 750 Seiten umfassender Zugang zu Geschichte, Rolle und Selbstverständnis des chinesischen Archivwesens mit zahllosen erhellenden Details.
Standortwechsel: Am Dienstagnachmittag ging es per Bus zum Konzernarchiv der Evonik Industries AG nach Hanau. Hier standen neben einer Archivführung unter dem besonderen vor Ort zu besichtigenden Aspekt „Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm“ eine thematisch offene Diskussionsrunde auf dem Programm. Hierbei beeindruckte einmal mehr SHENG Xiaoqi, der alle an ihn herangetragenen Fragen souverän beantwortete und ebenso eigene Fragen an das Publikum richtete. Es folgten die beiden letzten Vorträge: Doris Eitzenhöher stellte den von ihr geleiteten VdW-Arbeitskreis Globalisierung und das ICA-SBL-Vorstandsmitglied Dr. Karl-Peter Ellerbrock Funktion, Tätigkeit und die Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen dieses Gremiums auf internationaler Ebene vor.
Nach dem gemeinsamen Abendessen, das mit chinesischen Speisen verwöhnte, folgten die Abschlussbesprechung und Verabschiedung. Die vom Kurs zur Tagung entwickelte Veranstaltung hat den Teilnehmern wie den angereisten chinesischen Kollegen viele neue Eindrücke, Informationen und Anregungen verschafft. Es liegt nunmehr bei jedem einzelnen, ob sich derart allein der berufliche wie persönliche Horizont erweitern ließ, was gleichwohl nicht eben wenig wäre. Über eine weitere Vertiefung dieser Erfahrungen und der geknüpften Kontakte lassen sich ohne Frage weitere „Realien abrufen“, die für das eigene Archiv/Unternehmen und die tägliche Arbeit sehr von Nutzen sein können. Respekt und Verständnis für den Umgang und für die von unseren chinesischen Kollegen geleistete Arbeit dürften nun vorauszusetzen sein. Die Offenheit und Herzlichkeit, mit der die chinesischen Kollegen uns gegenüber aufgetreten sind, erinnern den ein oder anderen möglicherweise an das Plädoyer von Andreas Kellerhals sowie an den Titel der Veranstaltung: „Zeit was zu ändern!“: Die Herausforderungen der Globalisierung und die Rolle der Wirtschaftsarchiv(ar)e. Archivare aus China und deutschsprachigen Ländern: One step together!“
Nachzutragen ist an dieser Stelle die im Wesentlichen den verbliebenen chinesischen Gästen vorbehaltene Tagesexkursion zum Historischen Archiv Krupp bzw. zur Villa Hügel am Mittwoch. Unter fachkundiger Leitung von Prof. Dr. Ralf Stremmel erhielt die Gruppe eine kombinierte Führung durch das „älteste deutsche Unternehmensarchiv moderner Prägung“ (1905) und das ehemalige Wohn- und Repräsentationshaus der Industriellenfamilie Krupp. Es bot sich dabei an, auch das „China-Zimmer“ zu besichtigen und eine Reihe von Sammlungsstücken aus China zu zeigen, wozu u.a. die Tagebücher und Briefe des Krupp-Ingenieurs Georg Bauer gehörten (1890-93, 1911-13), die das frühe Engagement der Firma Krupp in China beleuchten.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen machte sich die Delegation aus Wuxi auf den Weg nach Zürich, wo für Freitag ein Gegenbesuch im dortigen Archiv für Zeitgeschichte abgestimmt war. Zuvor äußerte sich Delegationsleiter SHENG Xiaoqi bei der Verabschiedung in Essen perspektivisch wie sinngemäß: 2011 haben fünf Archivare aus Deutschland und der Schweiz sich in Wuxi getroffen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. 2012 haben sechs Archivare aus Wuxi am 75. VdW-Lehrgang in Frankfurt teilgenommen. Er würde sich wünschen – und das solle gern als Einladung verstanden werden – 2013 mindestens sieben Archivare zur Fortsetzung des archivfachlichen Austauschs wiederum in Wuxi begrüßen zu können. – Dazu eine Anmerkung: Während der Vorbereitung des 75. VdW-Kurses hatten die Kollegen in Wuxi auch von den Finanzierungsproblemen erfahren, mit denen die VdW-Veranstaltung zu kämpfen hatte. Daraufhin hatte SHENG bei seinen Kollegen in Wuxi um Unterstützung geworben. Am 23. Mai 2012 erreichte mich eine E-Mail des Stadtarchivs Wuxi folgenden Inhalts: „Sehr geehrter Herr Dr. Blum! Um den 75. VdW-Lehrgang zu unterstützen, hat die Vereinigung der Archivare in Wuxi entschieden, 1.000€ dafür zu spenden. Möge der 75. VdW-Lehrgang viel Erfolg haben! – (Gez.) Die Vereinigung der Archivare in Wuxi.“ Dieser Betrag wurde am Dienstag, den 12. Juni im Museum für Kommunikation coram publico feierlich dem VdW-Vorsitzenden überreicht. In seinen Dankesworten erklärte der VdW-Vorsitzende, diesen Betrag – aufgrund des besonderen Charakters dieser Spende – zielgerichtet gemeinsamen Aktivitäten mit den Archivkollegen in Wuxi zuzuwenden. – Es bleibt also spannend, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden …
Dr. Peter Blum, Neidenstein


http://archiv.twoday.net/stories/97058539/
„Es ist nicht schwer, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Nur mit dem Entziffern hapert es fürchterlich.“
(Bericht über den 75. VdW-Lehrgang, 10.-13. Juni 2012 in Wiesbaden, Frankfurt, Hanau und Essen) Ein Jubiläumskurs – eine Tagung – ein mühevoller und doch lohnender Schritt auf dem Weg der Annäherung
Der Sinnspruch des österreichischen Dichters und Aphoristikers Ernst Ferstl ist vieldeutig. Und er mag auch für die zunehmend globalisierte Welt der Wirtschaftsarchivare sowie das Zustandekommen derartiger Fortbildungsveranstaltungen gelten.
Am Fallbeispiel China, das mittlerweile zum wichtigsten Handelspartner der BRD aufgerückt ist, erweist sich eindrücklich, vor welch neuen Herausforderungen Wirtschaftsarchivare (Anm.: Allein zur besseren Lesbarkeit wurde durchgängig die männliche Schreibweise verwendet. Gemeint ist jedoch ausdrücklich sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise) stehen: Globales Wirtschaften lässt Schrift- und Dokumentationsgut zunehmend dezentral heranwachsen. Was der Unternehmensarchivar bislang in der Regel noch für und in das heimische Konzernarchiv „kanalisieren“ konnte, droht längst fernab allzu oft und unwiederbringlich, seinem unmittelbaren Blick und Zugriff verborgen, in anderen Kanälen zu versickern … Zudem fehlen die zusätzlich benötigten Ressourcen. Auch grenzüberschreitend Auszusonderndes und Archivwürdiges zu erfassen, zu sichern, einem unternehmensinternen Wissensmanagement, der Historischen Wissenschaft und als kulturelles Erbe zu erhalten und zugänglich zu machen, setzt zudem Fähigkeiten und Kenntnisse des Archivars voraus, auf die er bislang meist gar nicht vorbereitet war. Weder in der Aus- noch in der Weiterbildung. Denn es gilt, sprachliche und interkulturelle Hürden zu überwinden, um letztlich funktionierende Archivstrukturen auch auf Auslandsmärkten aufzubauen. Und um dezentral generiertes und allein schon sprachlich heterogenes Archivmaterial körperlich oder virtuell (im Sinne einer übergreifenden Archivplattform) zusammenzuführen bzw. zu integrieren …
Die Vorbereitung einer derartigen Fortbildungsveranstaltung erwies sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht minder problematisch: Zur Einbindung chinesischer Kollegen als aktive Veranstaltungsteilnehmer waren teils in enger Abstimmung mit diesen eine Reihe von komplizierten bürokratischen Hürden und Abstimmungsarbeiten zu meistern (und ebenso bereits manch interkulturelle Barrieren zu überspringen). Das bedingte, sich auch der Unterstützung offizieller chinesischer Stellen zu versichern, um zumindest ansatzweise Planungssicherheit herzustellen.
Gleichwohl konnte die Teilnahme der einen chinesischen Delegation erst drei Tage vor Veranstaltungsbeginn definitiv bestätigt werden … (die Gefühlslage des Organisierenden mag damit angedeutet sein). Insofern konnten auch die Themenabgrenzung und Ablaufplanung (Referenten, Vorträge) erst wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. Budgetbedingt scheiterte in zwei Fällen die Verpflichtung von weiteren kompetenten chinesischen Kollegen. Den bis zuletzt betriebenen Bemühungen, unter Einschaltung des chinesischen Generalkonsulats zwei Free Tickets einer chinesischen Airline zu erhalten, war leider ebenso wenig Erfolg beschieden. Immerhin lieferte dennoch einer der beiden an der persönlichen Teilnahme verhinderten Kollegen Vortragsskript und Präsentation. Und da die Mehrzahl der chinesischen Referenten ebenfalls ihre Präsentationen und Redetexte kurz vor der Tagung einlieferten, konnten im Vorfeld fast alle chinesischen Texte übersetzt, vorsichtig (weil die Zeit zur Abstimmung mit den Verfassern fehlte) redigiert und letztlich in der Veranstaltung den Teilnehmern zum leichteren Verständnis an die Hand gegeben werden.
Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, adäquatem Catering sowie stimmigen Sponsoren offenbarte weitere gravierende Realisierungsprobleme: Das Museum für Kommunikation war Hauptaustragungsort und zugleich Programm. In bevorzugter Lage am Frankfurter Museumsufer sollte es zur Brücke der Verständigung werden. Noch dazu in Sichtweite eines an den Blick vom legendären Bund nach dem mondänen Pudong in Shanghai erinnernden „Mainhattan“ (auch wenn dieser Vergleich hier nur en miniature gelten konnte). Als weitere interessante Begegnungsorte boten sich dank der Unterstützung der Kollegen in Frankfurt und Hanau der so genannte BrandSpace der Deutsche Bank AG und das Konzernarchiv von Evonik Industries AG in Hanau an. Die Gastfreundschaft der Kollegen in diesen drei Einrichtungen bildete eine erste verlässliche Planungsgrundlage.
Geradezu beängstigende Finanzierungslücken taten sich dennoch überraschend auf, als ein Caterer seinen nahezu konkurrenzlosen Standortvorteil sozusagen über Gebühr geltend zu machen versuchte. Robert CAO und dem von ihm begründeten Düsseldorf China Center DCC sowie kollegialer Hilfestellung vor Ort ist es zu verdanken, dass die Kostenexplosion letztlich auf das finanzierbare und vertretbare Maß reduziert werden konnte. So glänzte das alternative Catering im 8. Stock der nahe gelegenen Landesversicherungsanstalt Hessen nicht allein mit Kostenvorteilen, sondern mit ansprechender Verpflegung bei herausragendem Blick auf die Frankfurter Skyline.
Wer in China einmal zu Gast war, weiß, in welchem nicht allein protokollarisch ausgestalteten Rahmen dortige Auftaktveranstaltungen inszeniert werden. Ähnliches in Frankfurt aufzubieten, erwies sich ungeachtet starker Einbindung der Archivkollegen vor Ort und zahlreicher anderer angefragter Projektpartner (Firmen wie öffentlicher Einrichtungen) als (insbesondere finanziell) nicht realisierbar. Verschiedene auswärtige Optionen schieden aus aufgrund von Kosten- oder Handling-Handicaps. So ebenfalls die mit der Kollegin der in Wiesbaden ansässigen Henkell & Co Sektkellerei KG durchgespielten Szenarien. Gleichwohl erwuchs aus dieser Zusammenarbeit der Kontakt zur Wiesbadener Casino-Gesellschaft. Und für Anmietung und Catering im festlichen Foyer und Spiegelsaal des im Stil des strengen Historismus errichteten Casino-Gebäudes ließen sich schließlich noch moderate Kosten aushandeln. Wobei für den Sektempfang (sowie für die Bereitstellung der Gastgeschenke an Referenten und Teilnehmer) die Sektkellerei und das feierliche Abendessen die SAP AG, Walldorf als Sponsoren gewonnen werden konnten.
Dessen ungeachtet trugen die Kostenplanungen für die Gesamtveranstaltung über lange Wochen hinweg absolut defizitären Charakter. Erschwerend kam hinzu, dass spätestens ab dem Moment, zu dem die chinesischen KollegInnen signalisiert hatten, offiziell ihre Anreise zu betreiben und teils auch Vortragsverpflichtungen zu übernehmen, es längst kein Zurück mehr gab …
Um die finanziellen Ressourcen der VdW als verantwortlichem Ausrichter nicht überzustrapazieren, war somit ein – über Monate hin zermürbendes, weil lange Zeit weitgehend erfolgloses – Fundraising notwendig. Herausgehobene Personen, öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen, Unternehmer und Unternehmen hieß es nunmehr individuell zu kontaktieren, zu überzeugen, zu Spenden oder zum Sponsoring zu bewegen. Dass Archiv(ar)e weitgehend ohne Lobby dastehen, wurde selten schmerzlicher bewusst.
In dieser Zeit füllten sich vier Stehordner mit Korrespondenz. Wobei auf eine Antwort seitens der angefragten Stellen in der Regel erst nach schriftlicher oder mündlicher Wiederholung der Anfrage gerechnet werden durfte. Verzichtet sei hier auf die Wiedergabe der teils erbärmlich fadenscheinig begründeten Absagen. – Dass es sich bei den angefragten Stellen ganz überwiegend um solche mit ausgeprägtem China-Bezug oder konkret um Firmen handelte, deren Umsätze/Erlöse im Chinageschäft derzeit nachweislich boomen, sei dagegen nicht verschwiegen.
Leider ist es nicht gelungen, – trotz der Unterstützung durch das Chinesische Generalkonsulat, die Chinese Enterprises Association in NRW, durch einen Aufruf in der Chinesischen Handelszeitung und diverse deutsch-chinesische Netzwerke – über Robert CAO und das DCC hinaus chinesische oder deutsch-chinesische Unternehmen zur Unterstützung zu bewegen. Dass letztendlich der „finanzielle Gau“ vermieden werden konnte, ist – wiederum von Archivkollegen bewirkten – beträchtlichen Einzelleistungen wie zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung und der Robert Bosch GmbH sowie einer langen Reihe von Archivausstattern sowie einzelnen Unternehmen mit China-Bezug zu danken!
Zu den organisatorisch-technischen und den finanziellen Problemen gesellte sich unversehens ein weiteres: Die mangelnde Nachfrage unter potentiellen Teilnehmern. Während die Rekrutierung deutschsprachiger wie chinesischer Referenten, abgesehen von landesspezifischen formalen Problemen, planmäßig lief, stagnierten lange die Anmeldezahlen. Mit Erstankündigung des 75. VdW-Kurses im Dezember 2011 hatten sich spontan einige wenige Unternehmensarchivare angemeldet. Diesen Kreis zu wirtschaftlich tragfähiger Größe auszubauen, wurde unvermittelt ein weiteres Arbeitsfeld, auf dem Überzeugungsarbeit zu leisten war.
Als Grund für die zunächst vermissten Anmeldungen wurde auf Befragen die mangelnde Akzeptanz innerhalb des Unternehmens für die Teilnahme von Archivmitarbeitern an Veranstaltungen internationalen Zuschnitts benannt. Daneben waren es jedoch oft „andere Baustellen“, weshalb sich der Unternehmensarchivar für „unabkömmlich“ erklärte. Andere Kollegen, verwiesen darauf, die aus der Globalisierung erwachsenden Probleme in vielleicht zwei Jahren energischer angehen zu wollen; aktuell jedoch könne man sich diesen Problemen noch nicht stellen. Man erwartete sozusagen entsprechende Fortbildungsangebote „zu gegebener Zeit“. Unternehmensarchivare anderer ausgewiesener Global Player gestanden den akuten Handlungsbedarf uneingeschränkt ein, verwiesen allerdings auf die latente Arbeitsüberlastung und darauf, dass glücklicherweise noch niemand im Unternehmen erkannt habe, dass dem Unternehmensarchivar hier akuter Handlungsbedarf erwachse, der zum Handeln dränge … – Die im Fall des Sponsoring bei zahlreichen Ansprechpartnern mit aktueller wie starker China-Affinität wahrzunehmende Verdrängung, auf einen durchaus nicht in Abrede gestellten akuten Handlungsbedarf jedoch bestenfalls zukünftig reagieren zu wollen, zeigte sich somit in ähnlicher Form auch unter Wirtschaftsarchivaren.
Kein Wunder, dass die vom VdW-Vorstand ausgesprochene Reduzierung der Kursgebühr von 500€ auf eine „Schutzgebühr“ von 75€ das Anmeldeverhalten kaum nennenswert beeinflusste. Dabei wurde die Attraktivität von Kursprogramm und -gebühren, ergänzt um überaus günstige Raten (von 57-74€ pro Nacht inkl. Frühstück) im Rahmen des ausgehandelten Hotelkontingents zu keinem Zeitpunkt bestritten. Allzu hohe finanzielle Hürden standen einer Teilnahme somit nicht entgegen.
Für die am Buchungsverhalten ablesbare eher verhaltene Leidenschaft dürften insbesondere zwei Faktoren maßgeblich gewesen sein: Zum einen die Einschätzung, mit einer stärkeren Fokussierung auf die im Ausland generierte Überlieferung des Unternehmens eine in der Tat „größere Baustelle aufzumachen“, die nicht zuletzt unternehmensintern auch das Einfordern zusätzlicher Ressourcen bedingt. Zum anderen dürfte auch in den meisten international tätigen Unternehmen die Vorstellung „archivists going global“ noch gewöhnungsbedürftig sein; auch und gerade vor dem Hintergrund der meist nicht eben herausgehobenen unternehmensinternen Stellung der Archiv(ar)e.
So blieb am Ende nur der wiederholte Griff zum Telefonhörer. Es galt, Überzeugungsarbeit im Blick auf eine Kursteilnahme zu leisten, um so zumindest einmal programmatisch ein neues Arbeitsfeld abzustecken und damit einen Anspruch an sich und an das eigene Unternehmen zu formulieren. Das erwies sich als zeitaufwendig, aber durchaus erfolgreich. Die Teilnehmerliste umfasste zum Kursauftakt über 55 Personen, womit sich der Kurs zur kleinen Tagung entwickelt hatte.
Nebeneffekt: Selbstredend sind den anreisenden chinesischen Archivkollegen die für den deutschen Sprachraum namhaften Global Player bekannt. Hätten z.B. BMW, Porsche und andere auf der Teilnehmerliste gefehlt, wäre das ein erstes irritierendes Signal an die chinesische Adresse gewesen, darüber nachzudenken, inwieweit die involvierten Archive überhaupt für die im China so geschätzte deutsche Wirtschaft stehen können. Gut, dass es anders gekommen ist!
Der Impuls zu der Veranstaltung im Juni 2012 ging zurück auf eine Delegationsreise vom April 2011. Damals reiste eine kleine Delegation von Wirtschaftsarchivaren aus Deutschland und der Schweiz nach China, um an einer international besetzten Tagung in Shanghai zum Thema „Green Archives“ teilzunehmen sowie an einer weiteren, gemeinsam mit den chinesischen Kollegen organisierten Veranstaltung in Wuxi. Letztere bestand aus einer Vortragsveranstaltung nebst mehreren Archivbesichtigungen. Der Austausch entwickelte sich für beide Seiten überaus anregend und in einer – für die meisten „Langnasen“ unerwartet – sehr freundschaftlichen Atmosphäre. Dabei keimte die Idee, diesen Dialog bei nächster sich bietender Gelegenheit fortzusetzen. Doch sollten dann die Zeitanteile der Vorträge (= Monologe) zugunsten von kurzen Impulsreferaten und offenen Frage- und Diskussionsrunden stärker begrenzt werden. Diese Idee und vor allem die freundschaftliche Atmosphäre sollten im 75. VdW-Lehrgang aufgegriffen und vertieft werden. Das Moment des auch menschlich verbindenden fachlichen Austausches sollte dabei bewusst mitverfolgt werden, um ggfs. die chinesischen Kollegen auch einmal als Vermittler einschalten zu können, wenn es beispielsweise „Verständigungsprobleme“ beim Aufbau von Archivstrukturen in den ausländischen Unternehmensniederlassungen geben sollte. Gerade die herzliche Aufnahme in Wuxi hatte dazu geführt, in den chinesischen Kollegen auch den „Freund und Helfer“ zu erkennen wie auch das Potential freundschaftlicher Verbundenheit für die Lösung archivfachlicher Fragestellungen und Probleme.
Entsprechend diesem Ansatz und im Blick darauf, dass Archivare überall auf der Welt die Arbeit für das gemeinsame kulturelle Erbe verbindet, leistete der Kurs auch einen Beitrag zur Völkerverständigung. Konsequenterweise kamen bei der festlichen Auftaktveranstaltung in den Räumen der Wiesbadener Casino-Gesellschaft der stellvertretende Generalkonsul WANG Xiting und der Vertreter des Initiators und Geschäftsführers des (nicht-staatlichen!) Düsseldorf China Centers (DCC) Robert CAO, nämlich der Marketing Direktor Walter Schuhen zu Wort. Während WANG die völkerverbindenden Aspekte und die wachsende Bedeutung eines grenzüberschreitenden Zusammenwirkens der Archivare hervorhob, betonte Schuhen, dass das DCC explizit gegenseitiges Verständnis, die Kenntnis interkultureller Unterschiede und freundschaftliche Beziehungen sozusagen zur Plattform nachhaltiger wirtschaftlicher Zusammenarbeit mache. Genau dieses gemeinsame Verständnis vom Umgang miteinander sei denn auch maßgeblich gewesen für die Förderung unserer Veranstaltung.
Der Vorsitzende der VdW Michael Jurk, der Präsident des Bundesarchivs Dr. Michael Hollmann und Dr. Daniel Nerlich als Vertreter des VSA begrüßten in ihren Statements eine stärkere Vernetzung über die nationalen und europäischen Netzwerke hinaus. Chinesische Archivdelegationen auf Informationsreise im Westen, das sei längst Normalität. Ein stärkerer Blick umgekehrt auf die Arbeit der chinesischen Kollegen und eine Intensivierung der Zusammenarbeit seien dagegen überfällig und für alle Beteiligten lohnend!
Als Vice-President im Bereich SAP Labs Network Management der SAP AG erinnerte Dr. Clemens Däschle an das langjährige Engagement seines Hauses in Asien und speziell in China. Diese starke China-Affinität – zumal im Rückblick auf 40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen BRD und VCR, in denen sich der chinesische Markt stetig geöffnet habe – und die Affinität verschiedener SAP-Produkte zur elektronischen Archivierung habe die SAP AG dazu bewegt, die Tagung als Hauptsponsor zu unterstützen.
Im Anschluss an das folgende Abendessen kam es zu einer großen Vorstellungsrunde, in deren Verlauf sich – beginnend bei den beiden jeweils 6köpfigen Delegationen aus Beijing und Wuxi – alle Teilnehmer mit wenigen Worten dem größeren Kreis vorzustellen hatten. Dies diente dem schnelleren Kennenlernen und der Kommunikation untereinander.
À propos Kommunikation: Tagungssprachen waren bewusst allein Chinesisch und Deutsch. Das Risiko zweifacher Übersetzung über die Brücke des Englischen sollte konsequent vermieden werden; zumal bestimmte Begriffe in allen drei Sprachen nicht durchweg auf synonyme eindeutige Worte oder Zeichen rechnen können. Für die Übersetzungen ins Chinesische/Deutsche waren zwei in China geborene Dolmetscher engagiert worden, die ihre wissenschaftliche Ausbildung an der Heidelberger Universität absolviert haben und die sich teils auch beruflich nach wie vor regelmäßig in beiden Ländern aufhalten. Um es vorweg zu nehmen: Beide Dolmetscher haben maßgeblich zum gegenseitigen Verständnis und Gelingen der Tagung beigetragen.
Unter der Überschrift „Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis“ begann der Montagmorgen im Museum für Kommunikation mit zwei „interkulturellen Annäherungen“. Zunächst stellte Frau MAO Zuhui (Geschäftsführerin Sinalingua, Heidelberg/Shanghai) Deutschland und die auf Chinesen lauernden interkulturellen Barrieren und „Fettnäpfchen“ vor. Unmittelbar danach wechselte Dr. Sabine Hieronymus (die kurzfristig für den ursprünglich vorgesehenen, aber erkrankten Referenten eingesprungen war) die Perspektive, um Brücken zu bauen zum chinesischen Selbstverständnis usw. Besonders anregend dabei war der unmittelbare Perspektivwechsel, der nicht allein zunächst fremd anmutende kulturelle Besonderheiten vorstellte, sondern jeweils einem Teil des Publikums zugleich den Spiegel vorhielt, wie man von der anderen Seite wahrgenommen wird.
In der Sektion 2 „Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland“ lieferte die Generaldirektorin der Beijing Municipal Archives CHEN Leren eine „Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen Beijings“. Die Referentin stellte eine Reihe von teils erloschenen, teils noch tätigen Wirtschaftsbetrieben anhand einschlägiger Quellen vor und berichtete über die archivfachliche Betreuung durch das Archiv der chinesischen Kapitale. Aufsehen erregte insbesondere die ausgedehnte Öffentlichkeits-, d.h. insbesondere Publikationstätigkeit: So entstanden 2011 allein an den Beijing Municipal Archives über 400 Bücher zur Stadtgeschichte.
Auf ein Beispiel für chinesische Quellen in deutschen Wirtschaftsarchiven, nämlich aus den Beständen des ehemaligen historischen Archivs der Dresdner Bank konnte Michael Jurk verweisen: Dort nämlich fand sich die Gründung der China-Studien-Gesellschaft durch den Reichsverband der deutschen Industrie aus dem Jahr 1931 abgebildet.
Zu einem Plädoyer für eine stärkere Rolle öffentlicher Archive bei der Wirtschaftsarchivarbeit betrat darauf SHENG Xiaoqi de Bühne: SHENG „ist ein unscheinbarer Mann, klein und von chinesischer Höflichkeit. Er passt in das Bild, das Europäer von China haben. Und er prägt es selbst mit. Als Generaldirektor des Stadtarchivs von Wuxi, einer Stadt vor den Toren Shanghais, hält er die Erinnerung wach an ein China, das sich ständig neu erfindet. Beim 75. Lehrgang … erfuhren Shengs deutsche Kollegen, welchen Auftrag China im kollektiven Erinnern sieht. China pflegt demnach eine lebendige Erinnerungskultur, die die Archive nah an den Alltag der Menschen heranrückt. Auch werde in China mit nationalen Gesetzen geregelt, wie private und staatliche Unternehmensarchive zu führen seien … Die wirtschaftlichen Entwicklungen werden in chinesischen Archiven minutiös protokolliert. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern müssen in China ein Archiv führen, die kleineren Betriebe bittet Sheng darum. Unternehmen, die im Strudel der Entwicklung verschwinden, geben ihre Archivsammlungen an die staatlichen Einrichtungen ab. Nichts soll vergessen werden, wenn China seine fünftausendjährige Geschichte fortschreibt. – Die deutschen Wirtschaftsarchivare staunten über die Berichte …“
Der in der F.A.Z. am 13. Juni (S. 38) unter der Headline „Die Pflicht zur Aufbewahrung. Wirtschaftsarchive in China und Deutschland – eine Tagung“ abgedrückte Bericht gibt auch atmosphärisch durchaus stimmigen Einblick in den Tagungsverlauf. Vielleicht war es gleichwohl eher ein Raunen, denn ein Staunen. Denn bereits im vergangenen Jahr keimte während des Aufenthalts in Wuxi der jedoch nicht expressis verbis von den chinesischen Kollegen bestätigte Verdacht, dass der während einer Führung so ganz nebenbei erwähnte optionale virtuelle Zugriff vom Lesesaal des Stadtarchivs auf die Daten des (privaten) Unternehmensarchivs keineswegs allein auf eine zufällig identische Archivsoftware zurückgeht …
SHENGS eindeutiges Statement verwandelte den zunächst als „Vermittler“ bei dem Aufbau archivischer Strukturen an den chinesischen Unternehmensstandorten erhofften staatlichen Kollegen in den formal zuständigen Archivkollegen und Partner. Bei ihm liegen Kontroll- und Instruktionsrechte bezüglich der Einrichtung und Unterhaltung des Unternehmensarchivs sowie der Aus- und Weiterbildung von Unternehmensarchivaren. Ein Gutteil der Unternehmensarchivbestände wird denn sogar in den staatlichen Archiven verwahrt. Und: Es gibt gegenwärtig sogar Überlegungen, die geltenden Bestimmungen auf die in China tätigen ausländischen Unternehmen zu übertragen … Ohne Frage waren dieses Referat und die anschließende Diskussion ein wesentlicher Schlüssel zum besseren Verständnis des chinesischen Archivwesens.
Dr. Andrea Hohmeyer vermittelte im Anschluss aktuelle Beispiele einer „History Communication“ innerhalb des von ihr geleiteten Konzernarchivs der Evonik Industries AG. Ein ähnliches ansprüchliches Selbstverständnis von der Dienstleistungsfunktion und dem Anspruch archivarischer Tätigkeit im Rahmen eines unternehmensintern wie -extern ausstrahlenden Wissensmanagements offenbarte der Vortrag von Dr. Sabine Bernschneider-Reif unter dem Titel „Neue Strategien für Corporate History in einem sich verändernden Unternehmen“ (Merck KGaA). – Wer erwartet hatte, dass ein derartiges Selbstverständnis und Handeln in China möglicherweise weniger stark ausgeprägt wäre, der staunte dann in der Tat, als der Direktor der Xishan District Archives SONG Yonming in seiner Präsentation die Arbeit seines Archivs mit einem „Thinktank“ verglich. Keine Spur also von im Sozialismus erstarrter „Beamtendenke“, sondern modernes kundenorientiertes Denken, ausgeprägte Servicementalität, vielfältige Ansätze, neben dem eigenen Archiv auch motivationsfördernd auf die Einrichtung von so genannten „Dorf- und Gemeinschaftsarchiven“ hinzuwirken, ein „praktisches Handbuch für die Verwaltung von Unternehmensarchiven“ herauszugeben … Denn: „Wir, als Archivare, arbeiten dort, wo die wirtschaftliche und soziale Entwicklung staatfindet!“
Auch wenn Anspruch und Wirklichkeit in der Praxis nicht immer zu 100% übereinstimmen mögen (was zweifellos nicht minder für die von „Langnasen“ betreuten Archive gilt), Veränderung beginnt im Kopf! Und hier sind die chinesischen Archivare absolut auf Augenhöhe ihrer westlichen Kollegen. Der in westlichen Kreisen in den vergangenen Jahren oft kolportierte Hinweis auf die allein hervorragende technische Ausstattung der in den reicheren Provinzen an der chinesischen Ostküste gelegenen Archive, kennzeichnet des Zustand des chinesischen Archivwesens jedenfalls nur unvollkommen.
Szenenwechsel: Die Abendveranstaltung führte alle Teilnehmer im so genannten BrandSpace der Deutsche Bank AG zusammen. Ähnlich wie es einzelne Automobilhersteller vorexerzierten, ist dies der Ort, in dem das größte deutsche Kreditinstitut anhand unterschiedlichster kreativer Installationen Markenkommunikation betreibt und nicht zuletzt das eigene Markenbewusstsein demonstriert. Vor dem geführten Rundgang und dem gebotenen Abendessen stand jedoch ein archivischer „Apéro“: Denn der Leiter des Historischen Instituts der Deutsche Bank AG Dr. Martin L. Müller begrüßte nicht allein die Gäste, sondern lieferte mit einem kurzen Abriss der „Geschichte der Deutschen Bank in China“ den kurzweiligen wie treffenden Bezug zur Tagung.
Im Anschluss hielt der Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs und ICA-Vice-President Andreas Kellerhals einen Kurzvortrag mit dem Titel „Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …“ Darin verwies der Referent auf die unterschiedlichen grenzüberschreitenden Netzwerke des Internationalen Archivrates. Vor allem aber betonte er den Aspekt der Freundschaft: Einerseits im Rückbezug auf Aristoteles als Grundlage des Zusammenwirkens kraft verbindender Ideale und gemeinsamen Nutzens. Andererseits machte er jedoch deutlich, dass es daneben eine „Freundschaft um der Freunde willen“ gibt, die auch dann noch fortdauert, sollte der gemeinsame Nutzen einmal wegfallen. Denn Freundschaft, nicht allein als eine Zugewinngemeinschaft definiert, stärkt die Gemeinschaft der Archivare und jeden einzelnen, lässt die Gemeinschaft wie den einzelnen wachsen, wird erst dadurch nachhaltig!
Von den Veränderungen im Bereich des Unternehmensarchivwesens seit Einführung des marktwirtschaftlichen Systems in China handelte am Dienstagmorgen der Vortrag von WANG Lan, Director of the Supervision Department on Economic, Scientific and Technological Records and Archives der Staatlichen Chinesischen Archivverwaltung und Vorstandsmitglied der ICA-Sektion der Wirtschaftsarchivare. Infolge der Abwesenheit des Referenten konnte der Vortrag zur Präsentation nur verlesen werden. Was doppelt schade war, denn über zahlreiche interessante wie anregende Einzelaspekte dieses Vortrags hätte sich trefflich diskutieren lassen. Dabei ging es nicht allein um neue Technologien und z.B. die Erfahrungen bei der Etablierung eines Records Managements gemäß ISO 15489. Auch hier standen u.a. Innovationsprozesse sowie Fragen des Wissensmanagements und des modernen Archivmanagements im Fokus. Einige der programmatischen Kernsätze lauteten: „Auf die positive Vorstellung eigenen Handelns kommt es an!“ Und: „Die geistige Einstellung ist der Motor des Innovationsmanagements – Archivarbeit ist eine Managementtätigkeit!“ WANG blieb auch Beispiele für seine Aussagen nicht schuldig: „Wir können uns auch drei Archivare vorstellen: Der erste Archivar sagt: „Ich habe gerade die ausgesonderten Dokumente archiviert." Der Zweite sagt: „Ich kenne mich sehr gut im Archivmanagement aus.“ Der Dritte sagt: „Ich verwalte die für Unternehmen unverzichtbaren Informationsressourcen und historischen Schätze." Ergo müsste ein guter Archivar aus der Sicht des Managements „nach Idealen streben und so über die konkrete Arbeit hinausdenken“. – Ergo: Interkulturelle Unterschiede lassen sich nicht wegdiskutieren. Aber derartige Aussagen verdeutlichen, wie bemerkenswert nah Unternehmensarchivare in unseren so weit auseinander liegenden Ländern in so manchen Einzelaspekten einander sind.
„Das Eigene in den Augen des Fremden“ suchte und fand Dr. Daniel Nerlich vom Archiv für Zeitgeschichte (ETH Zürich) bei einem von ihm vorangetriebenen chinesisch-schweizerischen Ausstellungsprojekt. “Chinese Communists in Foreign Journalists’ View” ist dieses Ausstellungsprojekt betitelt. Es wird nicht allein den historischen Bildungsauftrag des Archivs mit Leben erfüllen. Nicht nur Quellen inszenieren, die bis dato im Verborgenen schlummerten und die im Zuge von Internationalisierung/Globalisierung erst jetzt zunehmend auch vor Ort auf ein interessiertes Publikum rechnen dürfen. Sondern den beteiligten Archiv(ar)en wird dies unstrittig vor heimischer wie fremder Kulisse Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung eintragen.
Das Ausstellungsprojekt lässt sich zurückführen auf die Delegationsreise nach China vom vergangenen Jahr, an der auch der Referent teilgenommen hatte. Derart sensibilisiert wurde u.a. der Fotografennachlass Bosshard im eigenen Archiv „gehoben“. Das stieß auf chinesischer Seite auf Interesse. Es erfolgten Gegenbesuche in Zürich. Rasch nahm in der Folge ein gemeinsames Ausstellungsprojekt Fahrt auf, mit dem sich die Archivare in der Schweiz wie in China im kommenden Jahr unter anderem auch als international vernetzte Weltbürger präsentieren werden. Nach der Devise: From Local to Global!
Die nächsten beiden Einzelbeiträge steuerten die Vize-Direktorin des Unternehmensarchivs der Citic Bank (Wuxi) ZHOU Yanyan und die Direktorin der New District Archives (Wuxi) JIANG Lifang bei. Im Fall des Unternehmensarchivs wurde einmal mehr der ausgeprägte (interne) Dienstleistungscharakter herausgestellt. Die auch wirtschaftliche Daseinsberechtigung untermauerten nicht weniger als 32 mithilfe des Archivs gewonnene Prozesse mit einem Streitwert von umgerechnet annähernd 20 Millionen Euro. – Das Beispiel des 1998 erst eingerichteten Archivs des Neuen Bezirks verdeutlichte, wie rasch und flexibel neue Archivstrukturen bisweilen errichtet werden können. Gehen die Anfänge des Neuen Distrikts doch auf das Jahr 1992 zurück. Aus naheliegenden Gründen werden die Archivbestände in diesem Fall noch überwiegend von der Verwaltung selbst nachgefragt.
Obschon auch dieses Archiv seine Daseinsberechtigung wirtschaftlich unter Beweis stellen konnte (durch die Wiederverwendung vorliegender Daten aus dem Baubereich wurden Kosten in Höhe von umgerechnet 4 Millionen Euro bei Messungen und Planungen erspart), vermittelte dieser Vortrag zugleich einen Hinweis auf berufsständische Imageprobleme: „Die Archivarbeit gilt als monoton und langweilig. Aber die Archivare arbeiten unauffällig und bieten aufgrund ihres Eifers trotzdem einen dienstleistungsorientierten Service“. ChiNah: Welche „Langnase“ könnte das nicht schmerzlich nachvollziehen?
In Sektion 3 „Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen“ thematisierte der Vortrag von Dr. Klaus Graf (Weblog Archivalia/Hochschularchiv Aachen) „Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern: Social Media“. Es war ein leidenschaftliches Plädoyer, Social Media als virtuelles Schaufenster in die Archive zu nutzen, als Plattform eines fachlichen Austauschs sowie als Option, um neue Zielgruppen und insbesondere auch Jüngere für das Archiv anzusprechen. Bedauerlicherweise fand dieser Appell, Neues und auch ein Stück weit Transparenz in einer Unternehmenskultur zu wagen, keine rechte Rückmeldung. Weder bei „Langnasen“ noch bei Chinesen. Das verwundert; wo doch gerade in China gemeinhin eine starke Affinität der meist jungen Internet-Community zu den Social Media herrscht. Eine Studie vom April 2012 ist betitelt: „China’s Social-Media Boom“ ( http://www.mckinseychina.com/wp-content/uploads/2012/04/McKinsey-Chinas-Social-Media-Boom.pdf ) und diese verweist gerade auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung im Blick auf Marken- und Produktentscheidungen (Kaufverhalten).
Unter deutschen Wirtschaftsarchivaren finden sich bislang wenige Befürworter eines verstärkten Einsatzes der Social Media. Wobei die Kollegen häufig pragmatisch auf den zusätzlichen und kaum mehr zu leistenden Arbeitsaufwand abheben. Erstaunlicherweise zeigen in letzter Zeit aber auch und gerade jene Unternehmen Social Media-Aktivitäten, von denen man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte. Jüngstes Beispiel die Commerzbank AG, wie unter folgendem Internetlink verifizierbar: https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/karriere/social_media_/social_media.html.
Über „Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit“ hätte im Anschluss die Sinologin Dr. Vivian Wagner sprechen sollen. Was ein Sterbefall im Umfeld der Referentin jedoch kurzfristig vereitelte. Der Hinweis auf „Entfallenes“ im Rahmen dieses Berichts ist keineswegs müßig, wie man zunächst annehmen könnte. Denn umso mehr ist hier auf die bisher seitens der Archivwelt fast gänzlich unreflektierte Dissertation der verhinderten Referentin zu verweisen: „Erinnerungsverwaltung in China. Staatsarchive und Politik in der Volksrepublik (Köln – Weimar – Wien 2006 (=Beiträge zur Geschichtskultur, 31)). Eine grundlegende Arbeit über die Geschichtsschreibung und Archivwesen in China. Erarbeitet anhand der chinesischen Fachliteratur, vertraulicher Materialien und auf Basis zahlreicher Interviews mit Archivaren, Historikern und Funktionären. Ein knapp 750 Seiten umfassender Zugang zu Geschichte, Rolle und Selbstverständnis des chinesischen Archivwesens mit zahllosen erhellenden Details.
Standortwechsel: Am Dienstagnachmittag ging es per Bus zum Konzernarchiv der Evonik Industries AG nach Hanau. Hier standen neben einer Archivführung unter dem besonderen vor Ort zu besichtigenden Aspekt „Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm“ eine thematisch offene Diskussionsrunde auf dem Programm. Hierbei beeindruckte einmal mehr SHENG Xiaoqi, der alle an ihn herangetragenen Fragen souverän beantwortete und ebenso eigene Fragen an das Publikum richtete. Es folgten die beiden letzten Vorträge: Doris Eitzenhöher stellte den von ihr geleiteten VdW-Arbeitskreis Globalisierung und das ICA-SBL-Vorstandsmitglied Dr. Karl-Peter Ellerbrock Funktion, Tätigkeit und die Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen dieses Gremiums auf internationaler Ebene vor.
Nach dem gemeinsamen Abendessen, das mit chinesischen Speisen verwöhnte, folgten die Abschlussbesprechung und Verabschiedung. Die vom Kurs zur Tagung entwickelte Veranstaltung hat den Teilnehmern wie den angereisten chinesischen Kollegen viele neue Eindrücke, Informationen und Anregungen verschafft. Es liegt nunmehr bei jedem einzelnen, ob sich derart allein der berufliche wie persönliche Horizont erweitern ließ, was gleichwohl nicht eben wenig wäre. Über eine weitere Vertiefung dieser Erfahrungen und der geknüpften Kontakte lassen sich ohne Frage weitere „Realien abrufen“, die für das eigene Archiv/Unternehmen und die tägliche Arbeit sehr von Nutzen sein können. Respekt und Verständnis für den Umgang und für die von unseren chinesischen Kollegen geleistete Arbeit dürften nun vorauszusetzen sein. Die Offenheit und Herzlichkeit, mit der die chinesischen Kollegen uns gegenüber aufgetreten sind, erinnern den ein oder anderen möglicherweise an das Plädoyer von Andreas Kellerhals sowie an den Titel der Veranstaltung: „Zeit was zu ändern!“: Die Herausforderungen der Globalisierung und die Rolle der Wirtschaftsarchiv(ar)e. Archivare aus China und deutschsprachigen Ländern: One step together!“
Nachzutragen ist an dieser Stelle die im Wesentlichen den verbliebenen chinesischen Gästen vorbehaltene Tagesexkursion zum Historischen Archiv Krupp bzw. zur Villa Hügel am Mittwoch. Unter fachkundiger Leitung von Prof. Dr. Ralf Stremmel erhielt die Gruppe eine kombinierte Führung durch das „älteste deutsche Unternehmensarchiv moderner Prägung“ (1905) und das ehemalige Wohn- und Repräsentationshaus der Industriellenfamilie Krupp. Es bot sich dabei an, auch das „China-Zimmer“ zu besichtigen und eine Reihe von Sammlungsstücken aus China zu zeigen, wozu u.a. die Tagebücher und Briefe des Krupp-Ingenieurs Georg Bauer gehörten (1890-93, 1911-13), die das frühe Engagement der Firma Krupp in China beleuchten.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen machte sich die Delegation aus Wuxi auf den Weg nach Zürich, wo für Freitag ein Gegenbesuch im dortigen Archiv für Zeitgeschichte abgestimmt war. Zuvor äußerte sich Delegationsleiter SHENG Xiaoqi bei der Verabschiedung in Essen perspektivisch wie sinngemäß: 2011 haben fünf Archivare aus Deutschland und der Schweiz sich in Wuxi getroffen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. 2012 haben sechs Archivare aus Wuxi am 75. VdW-Lehrgang in Frankfurt teilgenommen. Er würde sich wünschen – und das solle gern als Einladung verstanden werden – 2013 mindestens sieben Archivare zur Fortsetzung des archivfachlichen Austauschs wiederum in Wuxi begrüßen zu können. – Dazu eine Anmerkung: Während der Vorbereitung des 75. VdW-Kurses hatten die Kollegen in Wuxi auch von den Finanzierungsproblemen erfahren, mit denen die VdW-Veranstaltung zu kämpfen hatte. Daraufhin hatte SHENG bei seinen Kollegen in Wuxi um Unterstützung geworben. Am 23. Mai 2012 erreichte mich eine E-Mail des Stadtarchivs Wuxi folgenden Inhalts: „Sehr geehrter Herr Dr. Blum! Um den 75. VdW-Lehrgang zu unterstützen, hat die Vereinigung der Archivare in Wuxi entschieden, 1.000€ dafür zu spenden. Möge der 75. VdW-Lehrgang viel Erfolg haben! – (Gez.) Die Vereinigung der Archivare in Wuxi.“ Dieser Betrag wurde am Dienstag, den 12. Juni im Museum für Kommunikation coram publico feierlich dem VdW-Vorsitzenden überreicht. In seinen Dankesworten erklärte der VdW-Vorsitzende, diesen Betrag – aufgrund des besonderen Charakters dieser Spende – zielgerichtet gemeinsamen Aktivitäten mit den Archivkollegen in Wuxi zuzuwenden. – Es bleibt also spannend, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden …
Dr. Peter Blum, Neidenstein


KlausGraf - am Mittwoch, 31. Oktober 2012, 20:51 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.zisska.de/nr-12-freiburg-im-breisgau-wolleber-chronik/600022
12 FREIBURG IM BREISGAU – WOLLEBER – CHRONIK
des Hauses Zähringen. Deutsche Handschrift auf Papier. Freiburg i. Br. um 1625/30. Fol. (32,5 x 20,2 cm). Mit 16 Wappenminiaturen in Deckfarben, 180 Portrs. (Halb – und Standfiguren) mit Wappen in Deckfarben (1 unausgeführt in Vorzeichnung) sowie 3 (statt 8?) Stammbäumen in Deckfarben und Tinte auf gefalt. Tafeln. 252 (8 weiße) tls. pag. Bl. Tls. regliert. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. (Schließbänder fehlen, Bezug an den Kanten aufgeplatzt, stärker fleckig, beschabt und bestoßen). (40)
Schätzpreis / Estimate: 30.000,- €
Umfangreiche, der Stadt Freiburg dedizierte Chronik, prachtvoll illuminiert in der Art der Wappen – und Geschlechterbücher des 16. Jahrhunderts. In gleichmäßiger Kanzleikursive und Kalligraphie angefertigte Abschrift der Geschichte der Zähringer von David Wolleber, der sich "Württembergischer Historicus" und "kayserlicher Publicus Notarius" nannte. Die heute im Freiburger Stadtarchiv (B1, Nr. 11) aufbewahrte Urschrift wurde zwischen dem 10. August 1597 alten Kalenders (d. i. 20. August gregorianischen Kalenders) und dem 6. September 1597 neuen Kalenders niedergeschrieben. – Wolleber, geboren um 1555 in Grunbach im Remstal, ist kurz nach Abfassung der Chronik am 8. September 1597 einem Raubmord zum Opfer gefallen (zusammenfassend zu Wollebers Leben und Wirken: P. P. Albert, Geschichtsschreibung der Stadt Freiburg in alter und neuer Zeit, Sonderabdruck, Karlsruhe 1901, S. 51-60, und K. Graf, Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert, Schwäbisch Gmünd 1984, S. 77-94).
Die niemals gedruckte Chronik wurde vom frühen 17. bis zum späten 18. Jahrhundert in Kopien verbreitet (darunter Exemplare in der Hofbibliothek von Donaueschingen und der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, in der Kollation und Illuminiation mit dem Original weitgehend übereinstimmend). Meist wurden derartige Abschriften vom Adel oder Patriziat in Auftrag gegeben oder als Geschenke angefertigt (vgl. Albert S. 54, Anm. 1). Entsprechend sorgfältig und qualitätvoll fallen Illumination und Kalligraphie gewöhnlich aus, in unserem Fall dem von dem Freiburger Maler David Schmidlin ausgemalten Original kaum nachstehend. Bei unserer Abschrift dürfte es sich zudem um eine der frühesten handeln: nach den Wasserzeichen zu schließen, ist von einer Datierung um 1625/30 auszugehen (siehe unten).
Wie im Original und in der früheren der beiden Karlsruher Abschriften (Signatur: Hinterlegung 7, datiert "17. Jahrhundert") setzt die Paginierung mit Seite 201 ein, "da Wolleber die Zählung der am 12. 2. 1593 der Stadt Freiburg überreichten mappam und genealogiam der graven von Habspurg, herzogen von Zehringen und graven von Freyburg als stifter diser statt berücksichtigt hat" (Katalog der Handschriften in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, Bd. XIII, Wiesbaden 2000, S. 494 ff., und Albert S. 56). Auch der Paginierungssprung von S. 439 auf 486 findet sich in unserer Abschrift.
Kollation: 2 weiße Bl. (ein weiteres ohne Wasserzeichen = Buchbindervorsatz, daher nicht gezählt), 13 nn. Bl., S. 201-228, 1 Bl. mit dem Porträt des Würzburger Bischofs Echter von Mespelbrunn zwischengebunden, S. (229)-254, Stammbaum, ausgehend von Herzogin Agnes von Rheinfelden (= S. 255-258), S. 259-276, Stammbaum, ausgehend von Gräfin Margarethe von Zähringen, Gattin Hartmanns von Kyburg (= S. 277-280), S. 281-296, Stammbaum, ausgehend von Gräfin Mechthild von Rheinfelden (= S. 297-300), S. 301-414 (S. 415-417 fehlt, wohl ein Stammbau, Paginierung geht auf recto gerade weiter:) S. 418-425, (S. 426/27 fehlt, wohl Stammbaum), S. 428-433, 1 weißes Bl., 2 nn. Bl. (entsprechend S. 434-439, dann Paginierungssprung:) 486-618, 16 nn. Bl., 2 weiße Bl., 40 nn. Bl., 3 weiße Bl. mit Wasserzeichen (und ein Bl. ohne Wasserzeichen = Vorsatz). Die Größe des Freiburger Originals ist mit 215 x 320 mm (Buchblock) angegeben, entspricht also fast der vorliegenden Kopie.
Inhalt: Titelseite ("Weilannd der durchleuchtigen Hoch – unnd Wolgebornen Grave[n], Marggraffen und Hertzogen des hochlöblichen Hauß zue Zäringen Stiffter und Anfanger der auch hochloblichen und Weitbergeruempten Statt Fryburg im Preyßgaw ...", fol. 3r), der Brief Wollebers an den Bürgermeister der Stadt Freiburg (fol. 4/5, datiert, Stuttgart, 10. August 1597), "Register der Vornembsten Handlungen" (fol. 6-15), "Von der Nutzbarkait der Historien" (fol. 16-25 = S. 201-220), das Wappen der Zähringer (fol. 26), die Vorrede (fol. 27-29 = 223-228), das Porträt des Würzburger Bischofs Julius Echter (fol. 30) und die Abschrift von dessen Dankschreiben an Wolleber für die Übersendung der Würzburger Chronik (fol. 31), die Historie der Herzöge von Zähringen (fol. 32-125, letztes weiß, entspricht S. 231-435), "Der Andere Thaill Ordenliche Unnd Gründtliche Beschreibung aller Hertzogen von Teeckh in Schwabe[n]" (fol. 126-194 = S. 486-618), "Warhafftiger Bericht welchermassen Der Alte Marckat Fleeckh Heiningen Im Fürstenthumb Teeckh Und Württemberg gelegen, Von Kayser Rudolpho dem Ersten ... Privilegiert, befreyet Und begabet worden" (fol. 195-212, letzte beide weiß), "Histori und Legent von allerhandt vor etlich hundert Jaren geschehenen Geschichten, Als nämlich von den Hertzoge Zue Zeringen, Graven von Freyburgg undt andern seltsamen Sachen" (fol. 213-252, auf Papier mit anderem Wasserzeichen). – Die Geschichte der Gründung Freiburgs ist auf S. 327 ff. abgehandelt.
Der "Historicus" Wolleber besserte sein karges Gehalt als Winkeladvokat damit auf, Herrschaften selbstverfaßte Chroniken zu widmen und ihnen entsprechend, teils auch über Gebühr, zu schmeicheln. "Infolge der Art, wie Wolleber seine Werke zusammenschweisste und ausstattete, um sie möglichst gut an den Mann zu bringen, stand er in keinem guten Rufe; er galt als Schmarotzer und Bettelliterat" (Albert, S. 56 f.). Die Besonderheit dieser Dedikationen ist Wollebers Zusammenarbeit mit den Illustratoren: "Zum Erfolg von Wollebers Werken trug auch ihre aufwendige Ausstattung mit farbigen Illustrationen, hauptsächlich Wappenmalereien, bei, für die er ausgebildete Maler heranzog" (Graf, S. 80). – In der vorliegenden Abschrift sind die Wappenmalereien und Herrscherporträts von einem handwerklich sehr versierten Maler sauber und gekonnt nach den Originalen gearbeitet, in frischen und leuchtenden Farben, die der Vorlage nicht nachstehen, teils auch unter Verwendung von Eiweißhöhung. Von den Stammbäumen sind nur die drei kleineren der Nebenlinien vorhanden, die fünf großen Hauptstammbäume fehlen dagegen. Auch einzelne Wappenminiaturen wurden trotz ausgesparter Räume nicht ausgeführt (so auf. S. 325, Kloster St. Peter im Schwarzwald).
Auf die Entstehung der Handschrift in Freiburg i. Br. und eine Datierung in die Zeit um 1630 deuten die Wasserzeichen hin: Der erste Teil weist ein im südwestdeutschen Raum am Beginn des 17. Jahrhunderts in zahlreichen Varianten nachweisbares Wasserzeichen auf (Vogelkopf im Wappenschild, darüber die Buchstaben S und R, an der unteren Spitze F), das seine engste Übereinstimmung in dem bei Piccard unter der Nummer 42034 verzeichneten Wasserzeichen findet, dieses datiert Freiburg 1637. Das Papier des letzten Abschnitts zeigt einen Adler über Dreiberg (Kleeblatt) und die Buchstaben F und B (Piccard 152629, datiert Freiburg 1625). Wahrscheinlich ist die Abschrift der Chronik noch vor 1632 entstanden, dem Beginn der schwedischen Besatzung.
Innengelenke gebrochen, einzelne Spuren alter Restaurierung, geringe Randläsuren, etw. fingerfl. und gebräunt, der letzte Abschnitt papierbedingt etw. mehr. – Auf dem vorderen Spiegel das gestoch. Exlibris der Reichsgrafen von Sonnenberg in Luzern (Gerster, Schweizer Exlibris, 2123 und 2680), wohl 17. Jhdt., im oberen Teil (Spruchband) ausgekratzt, sowie Exlibris von Oswald Carl Friedrich, Graf von Seilern und Aspang (1900-1967); ferner Spuren eines entfernten großen Exlibris. – Einbanddeckel mit kleinem, gepr. Supralibros zweier Eichhörnchen am Fuße eines Kelchs mit Rosen und Vögeln.
2003 ging das Stück für gut 10.000 britische Pfund bei Christie's weg:
http://www.christies.com/Lotfinder/lot_details.aspx?sid=&intObjectID=4068824
Two days after Wolleber dated the conclusion of the Chronik der Zäringer, 8 September 1597, he was robbed and murdered. The presentation of the work to Freiburg must have been handled by his long-suffering widow. It would seem that the Chronicle's illumination was largely complete at Wolleber's death. In his dedicatory letter to the town council of Freiburg, Wolleber says that he has had all the portraits and coats of arms newly done and illuminated by a painter. Wolleber had already presented large single-sheet Zähringer family trees to Freiburg im Breisgau in 1593, Bern and Zürich in 1594 (although Zürich responded with a very small payment since they did not recognise the Zähringer as their founders) and Freiburg im Üchtland (see Die Zähringer, nos 280.1-2). The Freiburg im Breisgau genealogy survives in the Augustinermuseum there, Inv.260, and its half-length figures relate so closely to those in the bound chronicle that they have been attributed to the same artist, David Schmidlin. Schmidlin signed the second page of the Chronicle, illuminated with the arms of Freiburg and Austria and dated 1605, which is not repeated in this copy. Otherwise, these pictures appear to follow Schmidlin's, which were also incomplete. Schmidlin drew on earlier portraits to clothe his imaginary figures but in an erratic and unchronological way. No costume is earlier than the 15th century and much dates only from the first decades of the 16th century; some fantastic elements derive from the standard repertoire for exotic costume intended to signal bygone ages.
Like all Wolleber's works, the Chronik der Zäringer was never printed, perhaps because the necessary illustration would have been prohibitively expensive, but it did achieve some circulation in manuscript. The place of the Zähringer as ancestors of the Habsburgs may have added to its appeal. This manuscript would seem earlier than the copy formerly in the Fürstliche Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen, 607a, dated to the second half of the 17th century, which retains all the family trees; a second copy formerly in the same collection, 607b, dating from the early 18th century, has none of the prefatory material and has lost all the trees. These manuscripts are now in the Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, Donaueschingen Hs 607a and b (F. Heinzer in Scriptorium, 1995, pp.312-319). A complete 18th-century copy is in the Archiv Benediktinerabtei St. Paul im Lavantal, Hs 73/2, and a partial copy was made by Joseph Felizian Geissingen at the end of that century, Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, Hs 497/2+4. All these approximate to the dimensions of the original, 305 x 200mm (see Die Zähringer, p.324).
Die Geissinger-Abschrift der UB Freiburg liegt digitalisiert vor:
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs497-2
Zu Wolleber
http://archiv.twoday.net/search?q=wolleber
Update: Ging für 18.000 Euro weg.
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:David_Wolleber
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:David_Wolleber
12 FREIBURG IM BREISGAU – WOLLEBER – CHRONIK
des Hauses Zähringen. Deutsche Handschrift auf Papier. Freiburg i. Br. um 1625/30. Fol. (32,5 x 20,2 cm). Mit 16 Wappenminiaturen in Deckfarben, 180 Portrs. (Halb – und Standfiguren) mit Wappen in Deckfarben (1 unausgeführt in Vorzeichnung) sowie 3 (statt 8?) Stammbäumen in Deckfarben und Tinte auf gefalt. Tafeln. 252 (8 weiße) tls. pag. Bl. Tls. regliert. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. (Schließbänder fehlen, Bezug an den Kanten aufgeplatzt, stärker fleckig, beschabt und bestoßen). (40)
Schätzpreis / Estimate: 30.000,- €
Umfangreiche, der Stadt Freiburg dedizierte Chronik, prachtvoll illuminiert in der Art der Wappen – und Geschlechterbücher des 16. Jahrhunderts. In gleichmäßiger Kanzleikursive und Kalligraphie angefertigte Abschrift der Geschichte der Zähringer von David Wolleber, der sich "Württembergischer Historicus" und "kayserlicher Publicus Notarius" nannte. Die heute im Freiburger Stadtarchiv (B1, Nr. 11) aufbewahrte Urschrift wurde zwischen dem 10. August 1597 alten Kalenders (d. i. 20. August gregorianischen Kalenders) und dem 6. September 1597 neuen Kalenders niedergeschrieben. – Wolleber, geboren um 1555 in Grunbach im Remstal, ist kurz nach Abfassung der Chronik am 8. September 1597 einem Raubmord zum Opfer gefallen (zusammenfassend zu Wollebers Leben und Wirken: P. P. Albert, Geschichtsschreibung der Stadt Freiburg in alter und neuer Zeit, Sonderabdruck, Karlsruhe 1901, S. 51-60, und K. Graf, Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert, Schwäbisch Gmünd 1984, S. 77-94).
Die niemals gedruckte Chronik wurde vom frühen 17. bis zum späten 18. Jahrhundert in Kopien verbreitet (darunter Exemplare in der Hofbibliothek von Donaueschingen und der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, in der Kollation und Illuminiation mit dem Original weitgehend übereinstimmend). Meist wurden derartige Abschriften vom Adel oder Patriziat in Auftrag gegeben oder als Geschenke angefertigt (vgl. Albert S. 54, Anm. 1). Entsprechend sorgfältig und qualitätvoll fallen Illumination und Kalligraphie gewöhnlich aus, in unserem Fall dem von dem Freiburger Maler David Schmidlin ausgemalten Original kaum nachstehend. Bei unserer Abschrift dürfte es sich zudem um eine der frühesten handeln: nach den Wasserzeichen zu schließen, ist von einer Datierung um 1625/30 auszugehen (siehe unten).
Wie im Original und in der früheren der beiden Karlsruher Abschriften (Signatur: Hinterlegung 7, datiert "17. Jahrhundert") setzt die Paginierung mit Seite 201 ein, "da Wolleber die Zählung der am 12. 2. 1593 der Stadt Freiburg überreichten mappam und genealogiam der graven von Habspurg, herzogen von Zehringen und graven von Freyburg als stifter diser statt berücksichtigt hat" (Katalog der Handschriften in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, Bd. XIII, Wiesbaden 2000, S. 494 ff., und Albert S. 56). Auch der Paginierungssprung von S. 439 auf 486 findet sich in unserer Abschrift.
Kollation: 2 weiße Bl. (ein weiteres ohne Wasserzeichen = Buchbindervorsatz, daher nicht gezählt), 13 nn. Bl., S. 201-228, 1 Bl. mit dem Porträt des Würzburger Bischofs Echter von Mespelbrunn zwischengebunden, S. (229)-254, Stammbaum, ausgehend von Herzogin Agnes von Rheinfelden (= S. 255-258), S. 259-276, Stammbaum, ausgehend von Gräfin Margarethe von Zähringen, Gattin Hartmanns von Kyburg (= S. 277-280), S. 281-296, Stammbaum, ausgehend von Gräfin Mechthild von Rheinfelden (= S. 297-300), S. 301-414 (S. 415-417 fehlt, wohl ein Stammbau, Paginierung geht auf recto gerade weiter:) S. 418-425, (S. 426/27 fehlt, wohl Stammbaum), S. 428-433, 1 weißes Bl., 2 nn. Bl. (entsprechend S. 434-439, dann Paginierungssprung:) 486-618, 16 nn. Bl., 2 weiße Bl., 40 nn. Bl., 3 weiße Bl. mit Wasserzeichen (und ein Bl. ohne Wasserzeichen = Vorsatz). Die Größe des Freiburger Originals ist mit 215 x 320 mm (Buchblock) angegeben, entspricht also fast der vorliegenden Kopie.
Inhalt: Titelseite ("Weilannd der durchleuchtigen Hoch – unnd Wolgebornen Grave[n], Marggraffen und Hertzogen des hochlöblichen Hauß zue Zäringen Stiffter und Anfanger der auch hochloblichen und Weitbergeruempten Statt Fryburg im Preyßgaw ...", fol. 3r), der Brief Wollebers an den Bürgermeister der Stadt Freiburg (fol. 4/5, datiert, Stuttgart, 10. August 1597), "Register der Vornembsten Handlungen" (fol. 6-15), "Von der Nutzbarkait der Historien" (fol. 16-25 = S. 201-220), das Wappen der Zähringer (fol. 26), die Vorrede (fol. 27-29 = 223-228), das Porträt des Würzburger Bischofs Julius Echter (fol. 30) und die Abschrift von dessen Dankschreiben an Wolleber für die Übersendung der Würzburger Chronik (fol. 31), die Historie der Herzöge von Zähringen (fol. 32-125, letztes weiß, entspricht S. 231-435), "Der Andere Thaill Ordenliche Unnd Gründtliche Beschreibung aller Hertzogen von Teeckh in Schwabe[n]" (fol. 126-194 = S. 486-618), "Warhafftiger Bericht welchermassen Der Alte Marckat Fleeckh Heiningen Im Fürstenthumb Teeckh Und Württemberg gelegen, Von Kayser Rudolpho dem Ersten ... Privilegiert, befreyet Und begabet worden" (fol. 195-212, letzte beide weiß), "Histori und Legent von allerhandt vor etlich hundert Jaren geschehenen Geschichten, Als nämlich von den Hertzoge Zue Zeringen, Graven von Freyburgg undt andern seltsamen Sachen" (fol. 213-252, auf Papier mit anderem Wasserzeichen). – Die Geschichte der Gründung Freiburgs ist auf S. 327 ff. abgehandelt.
Der "Historicus" Wolleber besserte sein karges Gehalt als Winkeladvokat damit auf, Herrschaften selbstverfaßte Chroniken zu widmen und ihnen entsprechend, teils auch über Gebühr, zu schmeicheln. "Infolge der Art, wie Wolleber seine Werke zusammenschweisste und ausstattete, um sie möglichst gut an den Mann zu bringen, stand er in keinem guten Rufe; er galt als Schmarotzer und Bettelliterat" (Albert, S. 56 f.). Die Besonderheit dieser Dedikationen ist Wollebers Zusammenarbeit mit den Illustratoren: "Zum Erfolg von Wollebers Werken trug auch ihre aufwendige Ausstattung mit farbigen Illustrationen, hauptsächlich Wappenmalereien, bei, für die er ausgebildete Maler heranzog" (Graf, S. 80). – In der vorliegenden Abschrift sind die Wappenmalereien und Herrscherporträts von einem handwerklich sehr versierten Maler sauber und gekonnt nach den Originalen gearbeitet, in frischen und leuchtenden Farben, die der Vorlage nicht nachstehen, teils auch unter Verwendung von Eiweißhöhung. Von den Stammbäumen sind nur die drei kleineren der Nebenlinien vorhanden, die fünf großen Hauptstammbäume fehlen dagegen. Auch einzelne Wappenminiaturen wurden trotz ausgesparter Räume nicht ausgeführt (so auf. S. 325, Kloster St. Peter im Schwarzwald).
Auf die Entstehung der Handschrift in Freiburg i. Br. und eine Datierung in die Zeit um 1630 deuten die Wasserzeichen hin: Der erste Teil weist ein im südwestdeutschen Raum am Beginn des 17. Jahrhunderts in zahlreichen Varianten nachweisbares Wasserzeichen auf (Vogelkopf im Wappenschild, darüber die Buchstaben S und R, an der unteren Spitze F), das seine engste Übereinstimmung in dem bei Piccard unter der Nummer 42034 verzeichneten Wasserzeichen findet, dieses datiert Freiburg 1637. Das Papier des letzten Abschnitts zeigt einen Adler über Dreiberg (Kleeblatt) und die Buchstaben F und B (Piccard 152629, datiert Freiburg 1625). Wahrscheinlich ist die Abschrift der Chronik noch vor 1632 entstanden, dem Beginn der schwedischen Besatzung.
Innengelenke gebrochen, einzelne Spuren alter Restaurierung, geringe Randläsuren, etw. fingerfl. und gebräunt, der letzte Abschnitt papierbedingt etw. mehr. – Auf dem vorderen Spiegel das gestoch. Exlibris der Reichsgrafen von Sonnenberg in Luzern (Gerster, Schweizer Exlibris, 2123 und 2680), wohl 17. Jhdt., im oberen Teil (Spruchband) ausgekratzt, sowie Exlibris von Oswald Carl Friedrich, Graf von Seilern und Aspang (1900-1967); ferner Spuren eines entfernten großen Exlibris. – Einbanddeckel mit kleinem, gepr. Supralibros zweier Eichhörnchen am Fuße eines Kelchs mit Rosen und Vögeln.
2003 ging das Stück für gut 10.000 britische Pfund bei Christie's weg:
http://www.christies.com/Lotfinder/lot_details.aspx?sid=&intObjectID=4068824
Two days after Wolleber dated the conclusion of the Chronik der Zäringer, 8 September 1597, he was robbed and murdered. The presentation of the work to Freiburg must have been handled by his long-suffering widow. It would seem that the Chronicle's illumination was largely complete at Wolleber's death. In his dedicatory letter to the town council of Freiburg, Wolleber says that he has had all the portraits and coats of arms newly done and illuminated by a painter. Wolleber had already presented large single-sheet Zähringer family trees to Freiburg im Breisgau in 1593, Bern and Zürich in 1594 (although Zürich responded with a very small payment since they did not recognise the Zähringer as their founders) and Freiburg im Üchtland (see Die Zähringer, nos 280.1-2). The Freiburg im Breisgau genealogy survives in the Augustinermuseum there, Inv.260, and its half-length figures relate so closely to those in the bound chronicle that they have been attributed to the same artist, David Schmidlin. Schmidlin signed the second page of the Chronicle, illuminated with the arms of Freiburg and Austria and dated 1605, which is not repeated in this copy. Otherwise, these pictures appear to follow Schmidlin's, which were also incomplete. Schmidlin drew on earlier portraits to clothe his imaginary figures but in an erratic and unchronological way. No costume is earlier than the 15th century and much dates only from the first decades of the 16th century; some fantastic elements derive from the standard repertoire for exotic costume intended to signal bygone ages.
Like all Wolleber's works, the Chronik der Zäringer was never printed, perhaps because the necessary illustration would have been prohibitively expensive, but it did achieve some circulation in manuscript. The place of the Zähringer as ancestors of the Habsburgs may have added to its appeal. This manuscript would seem earlier than the copy formerly in the Fürstliche Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen, 607a, dated to the second half of the 17th century, which retains all the family trees; a second copy formerly in the same collection, 607b, dating from the early 18th century, has none of the prefatory material and has lost all the trees. These manuscripts are now in the Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, Donaueschingen Hs 607a and b (F. Heinzer in Scriptorium, 1995, pp.312-319). A complete 18th-century copy is in the Archiv Benediktinerabtei St. Paul im Lavantal, Hs 73/2, and a partial copy was made by Joseph Felizian Geissingen at the end of that century, Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, Hs 497/2+4. All these approximate to the dimensions of the original, 305 x 200mm (see Die Zähringer, p.324).
Die Geissinger-Abschrift der UB Freiburg liegt digitalisiert vor:
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs497-2
Zu Wolleber
http://archiv.twoday.net/search?q=wolleber
Update: Ging für 18.000 Euro weg.
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:David_Wolleber
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:David_WolleberKlausGraf - am Mittwoch, 31. Oktober 2012, 18:07 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus aktuellem Anlass - siehe http://archiv.twoday.net/stories/197331951/ zum Stadtarchiv Stralsund - sei (nach freundlichem Hinweis von Dr. jur. Steinhauer) darauf aufmerksam gemacht, dass die breit aufgestellte Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, an der auch Archive beteiligt sind, 2009 einen insoweit maßgeblichen Hinweis zu Exemplaren von Drucken vor 1850 gegeben hat.
"Für die älteren Buchbestände müssen andere Kriterien als das Territorialprinzip herangezogen
werden. Hier greifen buch- und sammlungsgeschichtliche Aspekte. In der Periode der Handdruckpresse, der Hadernpapiere und des individuell in Auftrag gegebenen Einbands (bis etwa 1850)
unterscheiden sich Bücher prinzipiell voneinander. Je älter ein Buch ist, um so individueller ist es
in seiner äußeren Gestalt (z. B. in Einband, Kolorierung), abgesehen von seiner oft noch erkennbaren Gebrauchsgeschichte (z. B. durch Marginalien eines Vorbesitzers, Provenienzvermerke). Es
besitzt einen eigenen Exemplarwert. Daraus folgt: Bücher aus der Zeit vor 1850 sind in jedem
noch vorhandenen Exemplar, unabhängig von ihrer Sprache, ihrem Druck- oder Aufbewahrungsort, zu erhalten."
http://www.allianz-kulturgut.de/fileadmin/user_upload/Allianz_Kulturgut/dokumente/2009_Allianz_Denkschrift_gedruckt.pdf
Daraus folgt: Werden aus Archivbibliotheken oder anderen Bibliotheken sogenannte Dubletten aus der Zeit vor 1850 veräußert, so verstößt das gegen die maßgeblichen Standards.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3337360/
http://archiv.twoday.net/stories/3486988/
"Für die älteren Buchbestände müssen andere Kriterien als das Territorialprinzip herangezogen
werden. Hier greifen buch- und sammlungsgeschichtliche Aspekte. In der Periode der Handdruckpresse, der Hadernpapiere und des individuell in Auftrag gegebenen Einbands (bis etwa 1850)
unterscheiden sich Bücher prinzipiell voneinander. Je älter ein Buch ist, um so individueller ist es
in seiner äußeren Gestalt (z. B. in Einband, Kolorierung), abgesehen von seiner oft noch erkennbaren Gebrauchsgeschichte (z. B. durch Marginalien eines Vorbesitzers, Provenienzvermerke). Es
besitzt einen eigenen Exemplarwert. Daraus folgt: Bücher aus der Zeit vor 1850 sind in jedem
noch vorhandenen Exemplar, unabhängig von ihrer Sprache, ihrem Druck- oder Aufbewahrungsort, zu erhalten."
http://www.allianz-kulturgut.de/fileadmin/user_upload/Allianz_Kulturgut/dokumente/2009_Allianz_Denkschrift_gedruckt.pdf
Daraus folgt: Werden aus Archivbibliotheken oder anderen Bibliotheken sogenannte Dubletten aus der Zeit vor 1850 veräußert, so verstößt das gegen die maßgeblichen Standards.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3337360/
http://archiv.twoday.net/stories/3486988/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem mich neulich schon Dr. Kasten vom Stadtarchiv Schwerin (Vorsitzender des VdA MV) beschied, er surfe kaum im Internet, hatte ich soeben eine denkwürdige Unterhaltung mit Ludwig Biewer (Berlin), den ich aufgrund seiner Funktionen in der Gesellschaft für pommersche Geschichte und in der Historischen Kommission für Pommern auf die Vorgänge in Stralsund aufmerksam machen wollte. Das Gespräch lief nicht gut. Biewer erwähnte übliche Dublettenverkäufe und als ich ihn darauf hinwies, er könne sich ja in meinem Weblog Archivalia informieren, sagte er: Ich informiere mich grundsätzlich nicht in Weblogs, da die unseriös sind. Ich benutze das Internet nicht. Ich bin auch nicht auf Facebook. So Leute gibts.
Leider auf Leitungsposten.
Leider auf Leitungsposten.
Aus INETBIB:
From: "Klaus Graf"
Sender: "Inetbib"
Subject: Re: [InetBib] Unglaublich: Historische Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund an Antiquar verkauft
Date: Wed, 31 Oct 2012 12:54:21 +0100
To: "Internet in Bibliotheken"
On Tue, 30 Oct 2012 20:13:36 +0100
"Klaus Graf"
wrote:
> Hofbibliothek Donaueschingen, Nordelbische
> Kirchenbibliothek, Kapuzinerbibliothek Eichstaett - seit
> vielen Jahren kaempfe ich fuer den Schutz historischer
> Buchsammlungen. Der jetzt bekannt gewordene Verkauf der
> traditionsreichen Bibliothek des Stralsunder Gymnasiums
> im
> Stadtarchiv Stralsund steht fuer mich auf einer Stufe mit
> den genannten Katastrophen.
>
> Wie man sich im Handbuch der historischen Buchbestaende
> unschwer ueberzeugen kann, ist die 1937 begruendete
> Archivbibliothek in Stralsund als Nachfolgerin der
> Ratsbibliothek eine der bedeutenden
> Altbestandsbibliotheken
> in Mecklenburg-Vorpommern. 1995 betrug der Buchbestand
> ca.
> 100.000 Baende, davon etwa 75 Prozent Altbestand. Die
> gesondert aufgestellte Gymnasialbibliothek kam 1945 in
> die
> Archivbibliothek:
>
>
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Archivbibliothek_Stralsund
Frau Noeske von der Christianeums-Bibliothek hat fuer mich
Online-Antiquariatsangebote gesichtet und bei Peter Hassold
in Dinkelscherben bei Augsburg tausende Drucke mit
Stralsunder Aussonderungsstempeln entdeckt. Der Anbieter
ist heute nicht erreichbar.
Im November kommt bei Zisska unter den Hammer:
http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692
"TÜRKENKRIEGE – AUSSCHREIBEN
so die Romische Konigliche Maiestat. An den obersechsischen
kreys des Türckischen anzugs halben gethan. Stettin, F.
Schlosser, (1537). 4º. Mit Holzschnitt-Titelbordüre und 2
ganzseit. wdh. Textholzschnitten. 4 nn. Bl. Mod. Hlwd.
(leicht bestoßen). (38)
Schätzpreis / Estimate: 3.000,- €
Einziges nachweisbares Exemplar. – VD 16 D 1192 (kein
Standortnachweis, Eintrag nach Sekundärliteratur). –
Sendschreiben des römisch-deutschen Königs (späteren
Kaisers) Ferdinand I. an die Fürsten des obersächsischen
Kreises, Johann Friedrich I. von Sachsen, Markgraf Joachim
II. von Brandenburg und Herzog Georg von Sachsen, wegen der
Abhaltung eines Reichstags zur Türkenfrage. Erwähnt werden
die vorangegangenen Reichstage der Jahre 1530 in Augsburg
und 1532 in Regensburg sowie ein Tag der bayerischen
Kreisfürsten in Passau. – Die Schrift ist als
Faksimile-Nachdruck wiedergegeben in: Werner Bake, Die
Frühzeit des pommerschen Buchdrucks im Lichte neuerer
Forschung, Pyritz 1934.
Bake berichet über die Auffindung des Exemplars – das hier
vorliegende – im Zuge seiner Forschungen zu dem bis dato
weitgehend unbekannten Drucker: "Über den Drucker Franz
Schlosser, den Mohnike ablehnte und Krause mit einem
Beweisstück belegte, wußte man aber im Pommernland und in
den Druckgeschichten anderer Länder bisher weiter noch
nichts! Erst systematische Suche nach ihm und seinen
Arbeiten hatte jetzt das Ergebnis, daß im Mai 1930 in der
Ratsbibliothek zu Stralsund zunächst zwei weitere Drucke
von ihm gefunden wurden, die, wenn auch nicht ausgiebig, so
doch etwas mehr Kenntnis von und über den bisher
unbeachteten Drucker brachten und zu eingehender
Beschäftigung mit ihm Anlaß boten." Von diesen beiden die
Türkenhilfe betreffenden Drucken, die sich als
Besonderheiten im Schrank des Bibliotheksdirektors fanden
und in den gedruckten Inventaren der Ratsbibliothek nicht
aufgeführt sind, konnten keine weiteren Exemplare ausfindig
gemacht werden. Auf Grund ihrer frühen Datierung und den
aus ihnen gewonnenen typographischen Erkenntnissen zu den
Anfängen des Buchdrucks in Stettin sind sie "für die
pommersche Druckgeschichte von außerordentlichem Werte"
(Bake). Alle Ergebnisse der Forschungen über Schlosser hat
Bake in einem biographischen Kapitel zusammengetragen (S.
95 ff.; unser Druck ist in der Bibliographie auf S. 168 –
Stettin/Schlosser, Nr. I A 3 – verzeichnet). Zu dem aus
Wittenberg stammenden Drucker, der 1533-39 in Stettin
nachweisbar ist, siehe weiterhin Reske 860.
Schlosser hat in seinen Werken meist alte Titeleinfassungen
des Wittenberger Druckers Johann Rhau-Grunenberg
übernommen. Die vorliegende Titelbordüre mit musizierenden
Putten zwischen Blumenranken hatte Rhau-Grunenberg bereits
in mehreren Drucken verwendet (Bake S. 89). Der zweifach
abgedruckte Holzschnitt zeigt einen stehenden Ritter mit
Kreuzesfahne und Schild, darauf den Doppeladler als
Reichssymbol. Nach Bake (S. 90) wurde er wohl aus einer
Magdeburger Druckerei übernommen und stellt den hl.
Mauritius dar. Die Datierungsfrage klärt Bake im Vergleich
mit einem anderen, im Text weitgehend übereinstimmenden
Druck des "Ausschreibens", das sich im Stadtarchiv
Frankfurt/Main befindet und das Datum 1537 trägt (S. 91).
Faltspur, etw. wasserrandig und gebräunt, letztes Bl. etw.
angeschmutzt, Titel und letztes Bl. mit zeitgenössischen
Vermerken "Pro gratia deo" und "Turken hir belangendes"
sowie dem Datum 1531 (?) auf dem letzten Bl., weiterhin der
tls. ausgekratzte Stempel der ehemaligen Stralsunder
Ratsbibliothek."
Herr Schauer vom Auktionshaus sagte nur, als er meinen
Namen hoerte, kurz und unfreundlich: "Da gibt es eine
Verkaufsquittung und die Sache ist in Ordnung". Aufgelegt.
Das ist durchaus verstaendlich, wenn man sich ansieht, was
ich ueber Zisska bisher meldete:
http://archiv.twoday.net/search?q=zisska
Dr. jur. Steinhauer vertrat in einem Kommentar in
Archivalia die Ansicht, dass tatsaechlich ein Fall fuer die
Kommunalaufsicht vorliegt, da die Archivsatzung
Veraeusserungen verhindere.
Der Jurist Dieter Strauch geht in seinem Buch "Das
Archivalieneigentum" (1998), S. 298f. kurz auf
archivgesetzliche Klauseln ein, die das Archivgut fuer
unveraeusserlich erklaeren. Das seien absolute
Verfuegungsverbote im Sinne von § 134 BGB "Ein
Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt,
ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt". Werden sie verletzt, so ist die Verfuegung
gegenueber jedermann unwirksam. Das verfuegende Archiv
verliere sein Eigentum nicht.
Die Kommunalaufsicht habe ich informiert, es schadet aber
nichts, wenn man sich mit Protestchreiben an den OB von
Greifswald oder das zustaendige Archiv wendet.
Wolfgang Schmitz (UB Koeln) hat mir erlaubt, seine Mail an
mich wiederzugeben:
"Lieber Herr Dr. Graf,
die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in
langer Zeit gewachsenen Bibliothek
habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so,
als ob 40 Jahre bibliothekarische
Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer
historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen
Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind.
Als Bibliothekar, der als Leiter einer der großen deutschen
Universitätsbibliotheken mit historischem Altbestand und
als Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahren mit der
Geschichte
der Buchwesens beschäftigt, halte ich kritische Nachfragen
zum Casus für dringend geboten: Gab es eine Abstimmung mit
regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken?
Wurde vor dem
Verkauf eine wissenschaftliche Dokumentation vorgenommen?
Wieso erfährt man nicht, was genau und an wen veräußert
wurde, um eine Rekonstruktion des verkauften Bestands zu
Forschungszwecken zu
unterstützen? Wieso hat man eine so alte und durch
Teilbestände, etwa die Bücherschenkung des Zacharias Orth,
herausragende Schulbibliothek nicht als schützenswertes
Ensemble und unveräußerliches Kulturdenkmal behandelt?
Das sind Fragen, bei denen sich die wissenschaftliche und
bibliothekarische Öffentlichkeit nicht
mit Informationsbrocken abspeisen lassen sollte. Gefordert
ist rückhaltlose Aufklärung.
Mit besten Grüßen
Ihr Wolfgang Schmitz"
Klaus Graf
--
http://www.inetbib.de
Siehe zuvor:
http://archiv.twoday.net/stories/197331488/
http://archiv.twoday.net/stories/197331274/
Update:
Aus INETBIB:
Lieber Herr Graf!
Vielen Dank für Ihre Information! Ein absolut ungeheuerlicher Vorgang. Haben Sie schon daran gedacht bzw. überprüft, den Fall an die Ostsee-Zeitung (http://www.ostsee-zeitung.de) und den NDR weiterzuleiten? Oder haben diese Medien bereits berichtet?
Ich teile die rechtliche Einschätzung von Herrn Steinhauer: hier ist § 134 BGB anwendbar.
Beste Grüße
Dr. Harald Müller
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht / Bibliothek
31.10.2012 14:37 Wolfgang Meyer von der Bürgerschaft in Stralsund teilt telefonisch mit:
http://www.stralsund.de/sitzung/sm_sourc.nsf/IDsWeb/040616-57519-GB-99999?OpenDocument
Die Archivarin hatte eine Liste vorgelegt, wobei es sich um unbedeutende Dubletten gehandelt habe.
***
Hassold bietet bei Abebooks z.B. an: "Lectionsplan für die Sechste Klasse des Stralsundschen Gymnasiums" 1783. Ich finde keinen Nachweis im KVK.
Auf dem Angebot http://goo.gl/ZcO0T des Augusta-Antiquariats prangt auf der Titelseite ein Stempel der Stadt Stralsund. Den Druck finde ich nicht in deutschen Bibliotheken laut KVK und auch nicht im VD 17: "Hochzeit-Gedicht. Dem Edlen/Wol-Ehrenfesten und Rechtsgelahrten Herrn Michael Veithen J. U. C. auch wolverordneten Protonotario allhie in Strasund Und der Wol-Edlen/ Viel-Ehr-und Tungendreichen Jungf. margareta Halleninn Bey deo den 18. Nov. des 1660. jahres/vollenzogenen Ehren-Tage."
Stempel-Abbildungen: "Ratsarchiv zu Stralsund": http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=206333265&b=1, http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=206333264&b=1
"Bibliothek des Gymnasiums zu Stralsund", "Als Eigentum des Stadtarchivs Stralsund gelöscht" http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=203740769&b=1
Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332570/
1.11.2012 Habe eine kurze Meldung für den Leserbereich des Ostsee-Anzeigers geschrieben:
http://www.ostsee-anzeiger.de/index.php?lg=&m1=10&m2=3&gebiet=&thm=7
Infobib schreibt über den "Ausverkauf der Gymnasialbibliothek Stralsund"
http://infobib.de/blog/2012/10/31/ausverkauf-der-stralsunder-gymnasialbibliothek/

 Erinnerung zum Friede. Das ist Kurtzer und trewlicher Bericht zu den lieben beständigen Fried, 1640
Erinnerung zum Friede. Das ist Kurtzer und trewlicher Bericht zu den lieben beständigen Fried, 1640
From: "Klaus Graf"
Sender: "Inetbib"
Subject: Re: [InetBib] Unglaublich: Historische Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund an Antiquar verkauft
Date: Wed, 31 Oct 2012 12:54:21 +0100
To: "Internet in Bibliotheken"
On Tue, 30 Oct 2012 20:13:36 +0100
"Klaus Graf"
wrote:
> Hofbibliothek Donaueschingen, Nordelbische
> Kirchenbibliothek, Kapuzinerbibliothek Eichstaett - seit
> vielen Jahren kaempfe ich fuer den Schutz historischer
> Buchsammlungen. Der jetzt bekannt gewordene Verkauf der
> traditionsreichen Bibliothek des Stralsunder Gymnasiums
> im
> Stadtarchiv Stralsund steht fuer mich auf einer Stufe mit
> den genannten Katastrophen.
>
> Wie man sich im Handbuch der historischen Buchbestaende
> unschwer ueberzeugen kann, ist die 1937 begruendete
> Archivbibliothek in Stralsund als Nachfolgerin der
> Ratsbibliothek eine der bedeutenden
> Altbestandsbibliotheken
> in Mecklenburg-Vorpommern. 1995 betrug der Buchbestand
> ca.
> 100.000 Baende, davon etwa 75 Prozent Altbestand. Die
> gesondert aufgestellte Gymnasialbibliothek kam 1945 in
> die
> Archivbibliothek:
>
>
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Archivbibliothek_Stralsund
Frau Noeske von der Christianeums-Bibliothek hat fuer mich
Online-Antiquariatsangebote gesichtet und bei Peter Hassold
in Dinkelscherben bei Augsburg tausende Drucke mit
Stralsunder Aussonderungsstempeln entdeckt. Der Anbieter
ist heute nicht erreichbar.
Im November kommt bei Zisska unter den Hammer:
http://de.zisska.de/nr-327-trkenkriege-ausschreiben/600692
"TÜRKENKRIEGE – AUSSCHREIBEN
so die Romische Konigliche Maiestat. An den obersechsischen
kreys des Türckischen anzugs halben gethan. Stettin, F.
Schlosser, (1537). 4º. Mit Holzschnitt-Titelbordüre und 2
ganzseit. wdh. Textholzschnitten. 4 nn. Bl. Mod. Hlwd.
(leicht bestoßen). (38)
Schätzpreis / Estimate: 3.000,- €
Einziges nachweisbares Exemplar. – VD 16 D 1192 (kein
Standortnachweis, Eintrag nach Sekundärliteratur). –
Sendschreiben des römisch-deutschen Königs (späteren
Kaisers) Ferdinand I. an die Fürsten des obersächsischen
Kreises, Johann Friedrich I. von Sachsen, Markgraf Joachim
II. von Brandenburg und Herzog Georg von Sachsen, wegen der
Abhaltung eines Reichstags zur Türkenfrage. Erwähnt werden
die vorangegangenen Reichstage der Jahre 1530 in Augsburg
und 1532 in Regensburg sowie ein Tag der bayerischen
Kreisfürsten in Passau. – Die Schrift ist als
Faksimile-Nachdruck wiedergegeben in: Werner Bake, Die
Frühzeit des pommerschen Buchdrucks im Lichte neuerer
Forschung, Pyritz 1934.
Bake berichet über die Auffindung des Exemplars – das hier
vorliegende – im Zuge seiner Forschungen zu dem bis dato
weitgehend unbekannten Drucker: "Über den Drucker Franz
Schlosser, den Mohnike ablehnte und Krause mit einem
Beweisstück belegte, wußte man aber im Pommernland und in
den Druckgeschichten anderer Länder bisher weiter noch
nichts! Erst systematische Suche nach ihm und seinen
Arbeiten hatte jetzt das Ergebnis, daß im Mai 1930 in der
Ratsbibliothek zu Stralsund zunächst zwei weitere Drucke
von ihm gefunden wurden, die, wenn auch nicht ausgiebig, so
doch etwas mehr Kenntnis von und über den bisher
unbeachteten Drucker brachten und zu eingehender
Beschäftigung mit ihm Anlaß boten." Von diesen beiden die
Türkenhilfe betreffenden Drucken, die sich als
Besonderheiten im Schrank des Bibliotheksdirektors fanden
und in den gedruckten Inventaren der Ratsbibliothek nicht
aufgeführt sind, konnten keine weiteren Exemplare ausfindig
gemacht werden. Auf Grund ihrer frühen Datierung und den
aus ihnen gewonnenen typographischen Erkenntnissen zu den
Anfängen des Buchdrucks in Stettin sind sie "für die
pommersche Druckgeschichte von außerordentlichem Werte"
(Bake). Alle Ergebnisse der Forschungen über Schlosser hat
Bake in einem biographischen Kapitel zusammengetragen (S.
95 ff.; unser Druck ist in der Bibliographie auf S. 168 –
Stettin/Schlosser, Nr. I A 3 – verzeichnet). Zu dem aus
Wittenberg stammenden Drucker, der 1533-39 in Stettin
nachweisbar ist, siehe weiterhin Reske 860.
Schlosser hat in seinen Werken meist alte Titeleinfassungen
des Wittenberger Druckers Johann Rhau-Grunenberg
übernommen. Die vorliegende Titelbordüre mit musizierenden
Putten zwischen Blumenranken hatte Rhau-Grunenberg bereits
in mehreren Drucken verwendet (Bake S. 89). Der zweifach
abgedruckte Holzschnitt zeigt einen stehenden Ritter mit
Kreuzesfahne und Schild, darauf den Doppeladler als
Reichssymbol. Nach Bake (S. 90) wurde er wohl aus einer
Magdeburger Druckerei übernommen und stellt den hl.
Mauritius dar. Die Datierungsfrage klärt Bake im Vergleich
mit einem anderen, im Text weitgehend übereinstimmenden
Druck des "Ausschreibens", das sich im Stadtarchiv
Frankfurt/Main befindet und das Datum 1537 trägt (S. 91).
Faltspur, etw. wasserrandig und gebräunt, letztes Bl. etw.
angeschmutzt, Titel und letztes Bl. mit zeitgenössischen
Vermerken "Pro gratia deo" und "Turken hir belangendes"
sowie dem Datum 1531 (?) auf dem letzten Bl., weiterhin der
tls. ausgekratzte Stempel der ehemaligen Stralsunder
Ratsbibliothek."
Herr Schauer vom Auktionshaus sagte nur, als er meinen
Namen hoerte, kurz und unfreundlich: "Da gibt es eine
Verkaufsquittung und die Sache ist in Ordnung". Aufgelegt.
Das ist durchaus verstaendlich, wenn man sich ansieht, was
ich ueber Zisska bisher meldete:
http://archiv.twoday.net/search?q=zisska
Dr. jur. Steinhauer vertrat in einem Kommentar in
Archivalia die Ansicht, dass tatsaechlich ein Fall fuer die
Kommunalaufsicht vorliegt, da die Archivsatzung
Veraeusserungen verhindere.
Der Jurist Dieter Strauch geht in seinem Buch "Das
Archivalieneigentum" (1998), S. 298f. kurz auf
archivgesetzliche Klauseln ein, die das Archivgut fuer
unveraeusserlich erklaeren. Das seien absolute
Verfuegungsverbote im Sinne von § 134 BGB "Ein
Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt,
ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt". Werden sie verletzt, so ist die Verfuegung
gegenueber jedermann unwirksam. Das verfuegende Archiv
verliere sein Eigentum nicht.
Die Kommunalaufsicht habe ich informiert, es schadet aber
nichts, wenn man sich mit Protestchreiben an den OB von
Greifswald oder das zustaendige Archiv wendet.
Wolfgang Schmitz (UB Koeln) hat mir erlaubt, seine Mail an
mich wiederzugeben:
"Lieber Herr Dr. Graf,
die Aktion in Stralsund mit dem Verkauf einer alten in
langer Zeit gewachsenen Bibliothek
habe ich mit hohem Befremden registriert. Es scheint so,
als ob 40 Jahre bibliothekarische
Aktivitäten zur Erhaltung und Belebung kleinerer
historischer Bestände (Paul Raabe) an manchen
Entscheidungsträgern völlig vorbeigegangen sind.
Als Bibliothekar, der als Leiter einer der großen deutschen
Universitätsbibliotheken mit historischem Altbestand und
als Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahren mit der
Geschichte
der Buchwesens beschäftigt, halte ich kritische Nachfragen
zum Casus für dringend geboten: Gab es eine Abstimmung mit
regionalen und überregionalen Altbestandsbibliotheken?
Wurde vor dem
Verkauf eine wissenschaftliche Dokumentation vorgenommen?
Wieso erfährt man nicht, was genau und an wen veräußert
wurde, um eine Rekonstruktion des verkauften Bestands zu
Forschungszwecken zu
unterstützen? Wieso hat man eine so alte und durch
Teilbestände, etwa die Bücherschenkung des Zacharias Orth,
herausragende Schulbibliothek nicht als schützenswertes
Ensemble und unveräußerliches Kulturdenkmal behandelt?
Das sind Fragen, bei denen sich die wissenschaftliche und
bibliothekarische Öffentlichkeit nicht
mit Informationsbrocken abspeisen lassen sollte. Gefordert
ist rückhaltlose Aufklärung.
Mit besten Grüßen
Ihr Wolfgang Schmitz"
Klaus Graf
--
http://www.inetbib.de
Siehe zuvor:
http://archiv.twoday.net/stories/197331488/
http://archiv.twoday.net/stories/197331274/
Update:
Aus INETBIB:
Lieber Herr Graf!
Vielen Dank für Ihre Information! Ein absolut ungeheuerlicher Vorgang. Haben Sie schon daran gedacht bzw. überprüft, den Fall an die Ostsee-Zeitung (http://www.ostsee-zeitung.de) und den NDR weiterzuleiten? Oder haben diese Medien bereits berichtet?
Ich teile die rechtliche Einschätzung von Herrn Steinhauer: hier ist § 134 BGB anwendbar.
Beste Grüße
Dr. Harald Müller
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht / Bibliothek
31.10.2012 14:37 Wolfgang Meyer von der Bürgerschaft in Stralsund teilt telefonisch mit:
http://www.stralsund.de/sitzung/sm_sourc.nsf/IDsWeb/040616-57519-GB-99999?OpenDocument
Die Archivarin hatte eine Liste vorgelegt, wobei es sich um unbedeutende Dubletten gehandelt habe.
***
Hassold bietet bei Abebooks z.B. an: "Lectionsplan für die Sechste Klasse des Stralsundschen Gymnasiums" 1783. Ich finde keinen Nachweis im KVK.
Auf dem Angebot http://goo.gl/ZcO0T des Augusta-Antiquariats prangt auf der Titelseite ein Stempel der Stadt Stralsund. Den Druck finde ich nicht in deutschen Bibliotheken laut KVK und auch nicht im VD 17: "Hochzeit-Gedicht. Dem Edlen/Wol-Ehrenfesten und Rechtsgelahrten Herrn Michael Veithen J. U. C. auch wolverordneten Protonotario allhie in Strasund Und der Wol-Edlen/ Viel-Ehr-und Tungendreichen Jungf. margareta Halleninn Bey deo den 18. Nov. des 1660. jahres/vollenzogenen Ehren-Tage."
Stempel-Abbildungen: "Ratsarchiv zu Stralsund": http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=206333265&b=1, http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=206333264&b=1
"Bibliothek des Gymnasiums zu Stralsund", "Als Eigentum des Stadtarchivs Stralsund gelöscht" http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=203740769&b=1
Update: http://archiv.twoday.net/stories/197332570/
1.11.2012 Habe eine kurze Meldung für den Leserbereich des Ostsee-Anzeigers geschrieben:
http://www.ostsee-anzeiger.de/index.php?lg=&m1=10&m2=3&gebiet=&thm=7
Infobib schreibt über den "Ausverkauf der Gymnasialbibliothek Stralsund"
http://infobib.de/blog/2012/10/31/ausverkauf-der-stralsunder-gymnasialbibliothek/

 Erinnerung zum Friede. Das ist Kurtzer und trewlicher Bericht zu den lieben beständigen Fried, 1640
Erinnerung zum Friede. Das ist Kurtzer und trewlicher Bericht zu den lieben beständigen Fried, 1640