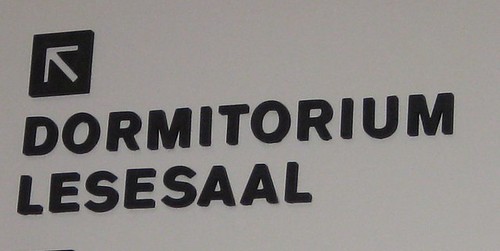KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 23:15 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Folgt man dem derzeit noch angegebenen Link im http://www.handschriftencensus.de/5292 zu einer Speculum salvationis-Handschrift in Kopenhagen, so trifft man auf eine nahezu unbrauchbare alte Präsentation
http://www2.kb.dk/elib/mss/gks80/index.htm
mit viel zu kleinen Bildern, auf denen man den Text nicht lesen kann. Natürlich ist dem Handschriftencensus seit langem mitgeteilt worden, dass die Königliche Bibliothek inzwischen die digitalisierten Handschriften in guter Qualität, also vergrößer- und vor allem lesbar anbietet:
http://www.kb.dk/en/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/mdr.html

http://www2.kb.dk/elib/mss/gks80/index.htm
mit viel zu kleinen Bildern, auf denen man den Text nicht lesen kann. Natürlich ist dem Handschriftencensus seit langem mitgeteilt worden, dass die Königliche Bibliothek inzwischen die digitalisierten Handschriften in guter Qualität, also vergrößer- und vor allem lesbar anbietet:
http://www.kb.dk/en/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/mdr.html

KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 21:46 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 21:36 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
NRW-Kultusministerin in der Kulturausschusssitzung vom 22.9.2010:
" ..... Ansprechen möchte ich auch den Wert schriftlicher Überlieferung unserer Kultur. Denn das ist uns seit dem Einsturz des Kölner Archivs im letzten Jahr schmerzlich bewusst geworden. Es ist uns drastisch vor Augen geführt worden, was es heißen kann, wenn man die kostbaren Bestände nicht abgesichert hat. Wir unterstützen die Stadt Köln bei der Sicherung dieser Bestände, soweit sie noch gesichert werden können, arbeiten aktiv daran mit. Aber auch andere Kulturgüter sind in ihrer Substanz gefährdet: Bücher, Bilder, Filme, Tondokumente und in ganz besonderer Weise sogar die Inhalte auf modernen Speichermedien, auf CD-Roms, auf DVDs und im Internet. All das ist Teil unseres kulturellen Erbes und damit Teil der Identität unseres Landes. Man muss eine Strategie finden und überlegen, welche Maßnahmen zum Bestandserhalt notwendig sind. Mit dem Projekt „Digitales Archiv
NRW“ schaffen wir die Voraussetzungen für die Sicherung dieses kulturellen Erbes. ....."
aus: Ausschussprotokoll, S. 12 (PDF)
" ..... Ansprechen möchte ich auch den Wert schriftlicher Überlieferung unserer Kultur. Denn das ist uns seit dem Einsturz des Kölner Archivs im letzten Jahr schmerzlich bewusst geworden. Es ist uns drastisch vor Augen geführt worden, was es heißen kann, wenn man die kostbaren Bestände nicht abgesichert hat. Wir unterstützen die Stadt Köln bei der Sicherung dieser Bestände, soweit sie noch gesichert werden können, arbeiten aktiv daran mit. Aber auch andere Kulturgüter sind in ihrer Substanz gefährdet: Bücher, Bilder, Filme, Tondokumente und in ganz besonderer Weise sogar die Inhalte auf modernen Speichermedien, auf CD-Roms, auf DVDs und im Internet. All das ist Teil unseres kulturellen Erbes und damit Teil der Identität unseres Landes. Man muss eine Strategie finden und überlegen, welche Maßnahmen zum Bestandserhalt notwendig sind. Mit dem Projekt „Digitales Archiv
NRW“ schaffen wir die Voraussetzungen für die Sicherung dieses kulturellen Erbes. ....."
aus: Ausschussprotokoll, S. 12 (PDF)
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 21:25 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vorwelten und Vorzeiten (Wolfenbütteler Forschungen 124), Wiesbaden 2010 kann jetzt bereits als Standardwerk zur Archäologie in der Frühen Neuzeit betrachtet werden, ein wunderschöner, gut illustrierter Band, zu dem ich einen Beitrag über "Archäologisches in populären Erzählungen der frühen Neuzeit" beigesteuert habe. Am 17. April 2009 mailte ich dem für mich zuständigen Herausgeber: "druckfreigabe aus gruenden der eilbeduerfigkeit erteilt. bitte beachte, dass ich ein PDF mit dem endgültigen layout für freidok benötige." Das hätte ich mir sparen können, denn die Herausgeber haben diesen Wunsch bzw. diese Bedingung einfach ignoriert. Nun, nach Erscheinen des Bandes, heißt es, sie hätten kein PDF und ich könnte doch den Aufsatz selber scannen oder einen Sonderdruck bei der UB Freiburg für Freidok abgeben. Auf mein Insistieren ergab sich, dass die HAB Wolfenbüttel aufgrund von Vereinbarungen mit dem Verlag das PDF nicht herausgeben will. Notabene: Ich bin der Urheber und habe keinen schriftlichen Verlagsvertrag abgeschlossen und auch kein Honorar für meinen Artikel erhalten (1 Freiexemplar und ein paar Sonderdrucke kann man nicht als solches zählen). Solange wissenschaftliche Herausgeber die berechtigten Wünsche ihrer Autoren nach angemessenem Open Access - weder meine Preprint-Version noch ein Scan mit OCR ist so geeignet wie das PDF der endgültigen Version - mit Füßen treten, wird sich der Open-Access-Gedanke in den Geisteswissenschaften viel zu langsam durchsetzen.
KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 20:20 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Archiv der Jugendkulturen in Berlin sichert seit 1998 mit überwiegend ehrenamtlichem Engagement und wenig öffentlicher Förderung die Überlieferung der Jugendkulturen. Diese wichtige Arbeit wird in keinem anderen Archiv geleistet. Der Überlebenskampf des Hauses zur Fortführung dieses Teils der Identitätsbewahrung erfährt seit einiger Zeit zu Recht große Beachtung.
Der VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivaren e.V. unterstützt das Anliegen einer dauerhaften Sicherung des Archivs der Jugendkulturen ausdrücklich. Wir nehmen diese Situation zum Anlass darauf hinzuweisen, dass es sich bei der prekären Situation des Archivs der Jugendkulturen keineswegs um einen Einzelfall handelt. Nahezu alle Archive, die sich der Aufgabe gestellt haben, die Unterlagen der Neuen Sozialen Bewegungen zu sichern, sind in mehr oder weniger bedrohlichen Situationen. Sie archivieren seit
Jahrzehnten Dokumente, Plakate, Ton- und Bildaufzeichnungen der Frauenbewegung, von Umweltschutz- und Friedensbewegung, von Bürgerrechtsbewegung und Stadtteilinitiativen oder von Dritte-Welt-Gruppen. Einige haben sich geradezu als Kompetenzzentren für diese Archivsparte profiliert. Diese Archive werden im Wesentlichen durch privates Engagement unterhalten, durch Spendensammlungen, Stiftungsgründungen oder Fundraising. Nur wenige dieser Archive werden durch einzelne Bundesländer oder Kommunen gefördert. Um diesen Archive dauerhaft zu sichern und damit kulturelle Identität für kommende Generationen zu bewahren, ist dringend eine zuverlässige und dauerhafte Förderung durch die öffentliche Hand auf kommunaler, Landes- und Bundesebene vonnöten.
Der VdA weist daher auf diese drohende Überlieferungslücke hin, die entstehen wird, wenn Bewegungsarchive wie das Archiv der Jugendkulturen in Berlin ihre Arbeit einstellen müssen. Der Verband selber hat den Kontakt seit einigen Jahren ausgebaut und wirkt z.B. durch einen Arbeitskreis für die Überlieferungen der Neuen Sozialen Bewegungen, aber auch durch Fortbildungen und Fachaustausch auf Tagungen auf eine weitere Professionalisierung dieser Archive hin. Das kann allerdings nur in Zusammenarbeit mit den zuständigen politischen Stellen und durch Bereitstellung entsprechender Mittel erfolgreich sein. Der VdA bietet den politisch Verantwortlichen Gespräche an."
Quelle: Pressemitteilung des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, 8.10.2010
Der VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivaren e.V. unterstützt das Anliegen einer dauerhaften Sicherung des Archivs der Jugendkulturen ausdrücklich. Wir nehmen diese Situation zum Anlass darauf hinzuweisen, dass es sich bei der prekären Situation des Archivs der Jugendkulturen keineswegs um einen Einzelfall handelt. Nahezu alle Archive, die sich der Aufgabe gestellt haben, die Unterlagen der Neuen Sozialen Bewegungen zu sichern, sind in mehr oder weniger bedrohlichen Situationen. Sie archivieren seit
Jahrzehnten Dokumente, Plakate, Ton- und Bildaufzeichnungen der Frauenbewegung, von Umweltschutz- und Friedensbewegung, von Bürgerrechtsbewegung und Stadtteilinitiativen oder von Dritte-Welt-Gruppen. Einige haben sich geradezu als Kompetenzzentren für diese Archivsparte profiliert. Diese Archive werden im Wesentlichen durch privates Engagement unterhalten, durch Spendensammlungen, Stiftungsgründungen oder Fundraising. Nur wenige dieser Archive werden durch einzelne Bundesländer oder Kommunen gefördert. Um diesen Archive dauerhaft zu sichern und damit kulturelle Identität für kommende Generationen zu bewahren, ist dringend eine zuverlässige und dauerhafte Förderung durch die öffentliche Hand auf kommunaler, Landes- und Bundesebene vonnöten.
Der VdA weist daher auf diese drohende Überlieferungslücke hin, die entstehen wird, wenn Bewegungsarchive wie das Archiv der Jugendkulturen in Berlin ihre Arbeit einstellen müssen. Der Verband selber hat den Kontakt seit einigen Jahren ausgebaut und wirkt z.B. durch einen Arbeitskreis für die Überlieferungen der Neuen Sozialen Bewegungen, aber auch durch Fortbildungen und Fachaustausch auf Tagungen auf eine weitere Professionalisierung dieser Archive hin. Das kann allerdings nur in Zusammenarbeit mit den zuständigen politischen Stellen und durch Bereitstellung entsprechender Mittel erfolgreich sein. Der VdA bietet den politisch Verantwortlichen Gespräche an."
Quelle: Pressemitteilung des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, 8.10.2010
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 19:35 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/BGV-zahlt-eine-Million-Euro-fuer-historisches-Dokument;art6066,486826
http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Wertvolle-Handschrift;art21526,5764844
Die Handschrift wird Dauerleihgabe der Badischen Versicherungen. Laut dpa betrug der Kaufpreis 1 Million Euro.
Auf der Seite der BLB gibt es leider (noch?) kein Faksimile, auch wenn der Begleitband online ist:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/besondere-bestaende/handschriften/heilsspiegel.pdf
Laut Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums soll aber das Digitalisat ins Internet gestellt werden:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/heilsspiegel.php
Nach http://archiv.twoday.net/stories/5595847/ sollte der vom gierigen Haus Baden beanspruchte ostmitteldeutsche Codex aus der Mitte des 14. Jahrhunderts eigentlich von Land erworben werden. "Zu den Kunstgütern, die nach dem Gutachten der Expertenkommission bislang unstreitig Eigentum des Hauses Baden sind und vom Land erworben werden sollen, gehören vier Skulpturen aus der Kunsthalle Karlsruhe, sowie Handschriften aus der Badischen Landesbibliothek. Darunter zwei Tulpenbücher, das Werk "Speculum Humanae Salvationis" sowie der Teilnachlass Hebel." So http://archiv.twoday.net/stories/5584479/
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/2009/presse-archiv-handschriften-20.php von 2009 erweckt bei der Mitteilung der Vergabe der Signaturen den Eindruck, als sei H 78 vom Land gekauft worden.
Es kann aber keine Rede davon sein, dass die Handschrift "eindeutig" dem Haus Baden gehörte.
Nach meiner Ansicht hat sich die Expertenkommission geirrt, ein Ankauf wäre nicht nötig gewesen:
Nach wie vor sehe ich im Jahr 1830 ein Schlüsseljahr für die badischen Kulturgüter. Die Kommission hat meine Beweisführung nicht aufgegriffen und kommt daher mindestens hinsichtlich des "Speculum humanae salvationis" zu einem meines Erachtens völlig unzutreffenden und das Land Baden-Württemberg schädigenden Resultat. Wenn die gesamte Privathinterlassenschaft Ludwigs 1830 an die Langensteiner fiel, muss das nach 1830 in den Sammlungen vorhandene Kulturgut grossherzoglicher Provenienz aus der Zeit vor 1830 zwingend zum Hausfideikommiss gehören. Damit ergibt sich, dass das vor 1827 im Kupferstichkabinett befindliche Speculum anders als die Kommission angibt, heute dem Land Baden-Württemberg gehört. http://archiv.twoday.net/stories/4567789/
Höchstwahrscheinlich gehörte die Handschrift dem Kloster St. Märgen und kam bei der Säkularisation in grossherzoglich badischen Besitz, aber eben nicht in die Landesbibliothek, sondern ins Kupferstichkabinett. Nach den Grundsätzen der Expertenkommission ist Säkularisationsgut aber eindeutig Landeseigentum!
Dauerhaft für Baden gesichert ist durch den Deal des BVG die Handschrift keineswegs. Eine Dauerleihgabe kann immer aus wichtigem Grund (wenn z.B. eine Verwertung im Insolvenzverfahren nötig ist) gekündigt werden und ist ohnehin eine juristisch fragwürdige Vertragsform: http://archiv.twoday.net/stories/6266965/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/2918302/
Beschreibung der Handschrift Cod. K 3378:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b525_jpg.htm
http://www.handschriftencensus.de/5061
Update: http://archiv.twoday.net/stories/55775123/

http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Wertvolle-Handschrift;art21526,5764844
Die Handschrift wird Dauerleihgabe der Badischen Versicherungen. Laut dpa betrug der Kaufpreis 1 Million Euro.
Auf der Seite der BLB gibt es leider (noch?) kein Faksimile, auch wenn der Begleitband online ist:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/besondere-bestaende/handschriften/heilsspiegel.pdf
Laut Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums soll aber das Digitalisat ins Internet gestellt werden:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/heilsspiegel.php
Nach http://archiv.twoday.net/stories/5595847/ sollte der vom gierigen Haus Baden beanspruchte ostmitteldeutsche Codex aus der Mitte des 14. Jahrhunderts eigentlich von Land erworben werden. "Zu den Kunstgütern, die nach dem Gutachten der Expertenkommission bislang unstreitig Eigentum des Hauses Baden sind und vom Land erworben werden sollen, gehören vier Skulpturen aus der Kunsthalle Karlsruhe, sowie Handschriften aus der Badischen Landesbibliothek. Darunter zwei Tulpenbücher, das Werk "Speculum Humanae Salvationis" sowie der Teilnachlass Hebel." So http://archiv.twoday.net/stories/5584479/
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/2009/presse-archiv-handschriften-20.php von 2009 erweckt bei der Mitteilung der Vergabe der Signaturen den Eindruck, als sei H 78 vom Land gekauft worden.
Es kann aber keine Rede davon sein, dass die Handschrift "eindeutig" dem Haus Baden gehörte.
Nach meiner Ansicht hat sich die Expertenkommission geirrt, ein Ankauf wäre nicht nötig gewesen:
Nach wie vor sehe ich im Jahr 1830 ein Schlüsseljahr für die badischen Kulturgüter. Die Kommission hat meine Beweisführung nicht aufgegriffen und kommt daher mindestens hinsichtlich des "Speculum humanae salvationis" zu einem meines Erachtens völlig unzutreffenden und das Land Baden-Württemberg schädigenden Resultat. Wenn die gesamte Privathinterlassenschaft Ludwigs 1830 an die Langensteiner fiel, muss das nach 1830 in den Sammlungen vorhandene Kulturgut grossherzoglicher Provenienz aus der Zeit vor 1830 zwingend zum Hausfideikommiss gehören. Damit ergibt sich, dass das vor 1827 im Kupferstichkabinett befindliche Speculum anders als die Kommission angibt, heute dem Land Baden-Württemberg gehört. http://archiv.twoday.net/stories/4567789/
Höchstwahrscheinlich gehörte die Handschrift dem Kloster St. Märgen und kam bei der Säkularisation in grossherzoglich badischen Besitz, aber eben nicht in die Landesbibliothek, sondern ins Kupferstichkabinett. Nach den Grundsätzen der Expertenkommission ist Säkularisationsgut aber eindeutig Landeseigentum!
Dauerhaft für Baden gesichert ist durch den Deal des BVG die Handschrift keineswegs. Eine Dauerleihgabe kann immer aus wichtigem Grund (wenn z.B. eine Verwertung im Insolvenzverfahren nötig ist) gekündigt werden und ist ohnehin eine juristisch fragwürdige Vertragsform: http://archiv.twoday.net/stories/6266965/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/2918302/
Beschreibung der Handschrift Cod. K 3378:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b525_jpg.htm
http://www.handschriftencensus.de/5061
Update: http://archiv.twoday.net/stories/55775123/

KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 19:13 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nathalie Larradet, *architecte, résidant à Pau. Elle a conçu le bâtiment des archives départementales des Landes. Son œuvre alliant ancien et contemporain est la représentation même de la mission des Archives : conserver lhéritage du passé et le présenter au public contemporain."
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 18:45 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bundespräsident Christian Wulff bei der Eröffnung
Foto: Dr. Oliver Hirsch
"Über 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus fast allen Ländern Europas wurden als »Fremdarbeiter«, Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge in das nationalsozialistische Deutschland verschleppt oder mussten in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten Zwangsarbeit leisten. Spätestens seit 1942 gehörten Zwangsarbeiter zum Alltag im nationalsozialistischen Deutschland. Die aus allen Teilen Europas, vor allem aus den östlichen Ländern, deportierten Arbeitskräfte wurden überall eingesetzt: in Rüstungsbetrieben ebenso wie auf Baustellen, in der landwirtschaft, im Handwerk, in öffentlichen Einrichtungen und in Privathaushalten. Ob als Besatzungssoldat in Polen oder als Bäuerin in Thüringen – alle Deutschen begegneten Zwangsarbeitern, viele profitierten davon. Zwangsarbeit war kein Geheimnis, sie war ein weitgehend öffentlich stattfindendes Verbrechen.
Die Ausstellung »Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg« erzählt erstmals die gesamte Geschichte dieses Verbrechens und seiner Folgen nach 1945. Kuratiert wurde sie von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, initiiert und gefördert von der Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«. Die Schirmherrschaft für die Ausstellung hat Bundespräsident Christian Wulff übernommen. Erste Station der internationalen Ausstellungstournee ist das Jüdische Museum Berlin, weitere Stationen in europäischen Hauptstädten sowie in Nordamerika sind geplant."
Quelle: Homepage der Ausstellung

Gästebucheinträge der Webseite "Flick ist kein Vorbild" sind Museumsgut!
Foto: Dr. Oliver Hirsch
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 18:15 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 17:31 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 16:49 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum Denkmalschutz des Stuttgarter Hauptbahnhofs:
http://s21irrtum.blogspot.com/2010/09/denkmalschutz-die-kleinen-hangt-man-die.html
Siehe auch:
FAZ Zitat: Dass der denkmalgeschützte Bau trotz nationaler Bedeutung von den eigenen Denkmalpflegern nicht geschützt werden darf, ist eine düstere Seite der Medaille und zeigt die politische Brisanz des Falls. Dass er jedoch seit zwei Jahrzehnten seitens seiner Betreiber dem langsamen Zerfall preisgegeben war, ist ein weiteres Skandalon von „Stuttgart21“.
Umnutzung über Abbruch und Tabula rasa stellen
Der Respekt vor dem Wahrzeichen der Stadt, der Würde und Zeitlosigkeit des Gebäudes geht der Stadtverwaltung ebenso ab wie den Betreibern, die nicht in der Lage sind, einen Plan B unter Wahrung der historischen Bausubstanz zu entwickeln. Die Sachwalter des so geschundenen Stuttgart ständen in der Pflicht, ihre herausragenden öffentlichen Baudenkmäler zu pflegen und Konzepte voranzutreiben, die Nutzung und Umnutzung über Abbruch und Tabula rasa stellen. Die bereits begonnene Amputation ist hilfloses Herumdoktern an einem ungeliebten, schon beinahe aufgegebenen Patienten. Damit ramponiert die Stadt nicht nur ihr bedeutendstes Denkmal der beginnenden Moderne, sondern auch sich selbst.
Weiteres:
http://archiv.twoday.net/stories/6345687/
http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof
Update: OLG Stuttgart wies Urheberrechtsklage ebenfalls zurück
http://www.dr-bahr.com/news/urheber-unterliegen-deutscher-bahn-im-urheberrechtsstreit-des-stuttgarter-bahnhofs.html

http://s21irrtum.blogspot.com/2010/09/denkmalschutz-die-kleinen-hangt-man-die.html
Siehe auch:
FAZ Zitat: Dass der denkmalgeschützte Bau trotz nationaler Bedeutung von den eigenen Denkmalpflegern nicht geschützt werden darf, ist eine düstere Seite der Medaille und zeigt die politische Brisanz des Falls. Dass er jedoch seit zwei Jahrzehnten seitens seiner Betreiber dem langsamen Zerfall preisgegeben war, ist ein weiteres Skandalon von „Stuttgart21“.
Umnutzung über Abbruch und Tabula rasa stellen
Der Respekt vor dem Wahrzeichen der Stadt, der Würde und Zeitlosigkeit des Gebäudes geht der Stadtverwaltung ebenso ab wie den Betreibern, die nicht in der Lage sind, einen Plan B unter Wahrung der historischen Bausubstanz zu entwickeln. Die Sachwalter des so geschundenen Stuttgart ständen in der Pflicht, ihre herausragenden öffentlichen Baudenkmäler zu pflegen und Konzepte voranzutreiben, die Nutzung und Umnutzung über Abbruch und Tabula rasa stellen. Die bereits begonnene Amputation ist hilfloses Herumdoktern an einem ungeliebten, schon beinahe aufgegebenen Patienten. Damit ramponiert die Stadt nicht nur ihr bedeutendstes Denkmal der beginnenden Moderne, sondern auch sich selbst.
Weiteres:
http://archiv.twoday.net/stories/6345687/
http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof
Update: OLG Stuttgart wies Urheberrechtsklage ebenfalls zurück
http://www.dr-bahr.com/news/urheber-unterliegen-deutscher-bahn-im-urheberrechtsstreit-des-stuttgarter-bahnhofs.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Den allgemeinen Sparmaßnahmen des Landes Schleswig-Holstein soll nun auch die
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek zum Opfer fallen.
Siehe auch:
http://www.shz.de/nachrichten/top-thema/article/111/steht-die-landesbibliothek-vor-ihrer-aufloesung-1.html
 Q: www.shlb.de
Q: www.shlb.de
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek zum Opfer fallen.
Siehe auch:
http://www.shz.de/nachrichten/top-thema/article/111/steht-die-landesbibliothek-vor-ihrer-aufloesung-1.html
 Q: www.shlb.de
Q: www.shlb.deIm Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes am Lehrstuhl für Judaistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz suchen wir in alten Buch- und Aktenbeständen nach hebräischen Makulatur- und Einbandfragmenten. Solche Fragmente konnten von uns bereits in größerer Zahl in verschiedenen deutschen Bibliotheken und Archiven gefunden werden. Sie stellen eine wichtige Quelle für die Erforschung der Geschichte und Literatur des Judentums seit dem Mittelalter dar.
Ich möchte daher anfragen, ob sich in ihrem Archiv bzw. in ihrer Bibliothek, soweit sie Altbestände enthält, einmal solche Reste von hebräischen Schriften in alten Einbänden von Akten oder Büchern gefunden haben? Ließen sich bei einer Suche eventuell solche Fragmente finden? Oder sind bislang nicht einmal Makulaturen mit lateinischen Schriftzeichen aufgetaucht?
Selbstverständlich geht es im Rahmen des Forschungsprojekts nicht darum, Einbände zu beschädigen oder Fragmente aus den Deckeln oder Akteneinbänden zu entnehmen. Die Bewahrung der Funde ist stets oberstes Ziel unserer Forschungen. Durch eine Identifizierung und genaue Altersbestimmung von Fragmenten können sich jedoch wichtige Rückschlüsse auf die jüdische Geschichte ziehen lassen, so dass sich auch die Untersuchung kleiner Funde lohnen könnte. Falls sich Fragmente in ihren Beständen finden sollten, wäre ich für eine Nachricht dankbar. Auch die Nachricht *Fehlanzeige“ würde mir bei der mühsamen Suche weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Lehnardt
______________________________________________________________________________________________
Prof. Dr. Andreas Lehnardt
FB 01 - Judaistik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel. 0049 [0]6131/39-20312
Fax 0049 [0]6131/39-26700
Ich möchte daher anfragen, ob sich in ihrem Archiv bzw. in ihrer Bibliothek, soweit sie Altbestände enthält, einmal solche Reste von hebräischen Schriften in alten Einbänden von Akten oder Büchern gefunden haben? Ließen sich bei einer Suche eventuell solche Fragmente finden? Oder sind bislang nicht einmal Makulaturen mit lateinischen Schriftzeichen aufgetaucht?
Selbstverständlich geht es im Rahmen des Forschungsprojekts nicht darum, Einbände zu beschädigen oder Fragmente aus den Deckeln oder Akteneinbänden zu entnehmen. Die Bewahrung der Funde ist stets oberstes Ziel unserer Forschungen. Durch eine Identifizierung und genaue Altersbestimmung von Fragmenten können sich jedoch wichtige Rückschlüsse auf die jüdische Geschichte ziehen lassen, so dass sich auch die Untersuchung kleiner Funde lohnen könnte. Falls sich Fragmente in ihren Beständen finden sollten, wäre ich für eine Nachricht dankbar. Auch die Nachricht *Fehlanzeige“ würde mir bei der mühsamen Suche weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Lehnardt
______________________________________________________________________________________________
Prof. Dr. Andreas Lehnardt
FB 01 - Judaistik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel. 0049 [0]6131/39-20312
Fax 0049 [0]6131/39-26700
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 10:23 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 09:00 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erweiterungsbau KUBUS/Titan, Nordfassade des Büroturms
v.l.n.r.: Eingang, Empfang, Lesesaal
Quelle: Homepage des Stadtarchivs Bern
Wolf Thomas - am Samstag, 9. Oktober 2010, 08:47 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitalcommons.mcmaster.ca/mcmastercollection/
Wir empörten uns über diese kanadische Sammlung anno 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5072333/
Nun sieht es so aus, dass der Zugriff auf alle PDFs offenkundig für weltweite Nutzer möglich ist. Ich sah auch ein deutsches Buch: "Vorlesunger uËber geschichte der mathematik".
Wir empörten uns über diese kanadische Sammlung anno 2008: http://archiv.twoday.net/stories/5072333/
Nun sieht es so aus, dass der Zugriff auf alle PDFs offenkundig für weltweite Nutzer möglich ist. Ich sah auch ein deutsches Buch: "Vorlesunger uËber geschichte der mathematik".
KlausGraf - am Samstag, 9. Oktober 2010, 02:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Over the past week I have started to catalogue project EAP012 Salvage and preservation of Dongjing archives in Yunnan, China: transcript, score, ritual and performance.
Dongjing refers to a body of Daoist and Confucian texts and traditional music scores. The songs can be performed unaccompanied or with instruments. As a practice it is thought to date back to the 15th century. Social, political and cultural factors have endangered the practice which is now mostly performed by communities in Yunnan province.
The collections copied by the EAP012 project contain a wealth of material including ritual texts, music scores and audio-visual recordings of Dongjing performances as well as oral history interviews. The following images are taken from Sanguan donging juan zhong, a sutra used during Dongjing activities, inscribed in 1911."
Link
Dongjing refers to a body of Daoist and Confucian texts and traditional music scores. The songs can be performed unaccompanied or with instruments. As a practice it is thought to date back to the 15th century. Social, political and cultural factors have endangered the practice which is now mostly performed by communities in Yunnan province.
The collections copied by the EAP012 project contain a wealth of material including ritual texts, music scores and audio-visual recordings of Dongjing performances as well as oral history interviews. The following images are taken from Sanguan donging juan zhong, a sutra used during Dongjing activities, inscribed in 1911."
Link
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 23:08 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 23:00 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Denkt man an den Klang von Chemnitz- da fallen einem spontan Oper, Schauspielhaus, Orchester und viele, gute unbekannte Bands ein.
Es sind aber vor allem auch die unmusikalisch – fast unspektakulären Laute und Geräusche, die das Leben und Klangbild der Stadt prägen: das Surren der Straßenbahn, das Rauschen der Autos, das Arbeitsgeräusch der Handwerker, das Reden oder Gelächter der Passanten oder einfach lediglich das simple Klirren von Tassen in den Cafés.
Jeder Ort hat seinen eigenen Sound und erhält somit seinen eigenen Charme. Mit dem Projekt „Klang von Chemnitz“ wird unsere Stadt hörbar, denn seit knapp einem Jahr sind die Macher mit dem Mikrophon kreuz und quer in der Stadt unterwegs, haben aus dem Internet recherchiert und bekommen auch die verschiedensten Geräusche zugesandt.
Link
"Die Idee, die Geräusche einer Stadt aufzunehmen, ist nicht neu. 'Yukio Van Maren King' macht dies bereits mit Berlin. Seine Tonaufnahmen können unter http://www.berlincast.com angehört werden. Nach diesem Vorbild wollen wir das auch für unser heißgeliebtes Chemnitz machen. Die vielfältigen Geräuschkulissen unserer Stadt sind ebenso unterschiedlich wie unterhaltsam.
Dementsprechend werden auf dieser Seite mit der Zeit immer neue Tonaufnahmen veröffentlicht. Über Kommentare würden wir uns Löcher in den Bauch freuen."
Quelle: Homepage
Es sind aber vor allem auch die unmusikalisch – fast unspektakulären Laute und Geräusche, die das Leben und Klangbild der Stadt prägen: das Surren der Straßenbahn, das Rauschen der Autos, das Arbeitsgeräusch der Handwerker, das Reden oder Gelächter der Passanten oder einfach lediglich das simple Klirren von Tassen in den Cafés.
Jeder Ort hat seinen eigenen Sound und erhält somit seinen eigenen Charme. Mit dem Projekt „Klang von Chemnitz“ wird unsere Stadt hörbar, denn seit knapp einem Jahr sind die Macher mit dem Mikrophon kreuz und quer in der Stadt unterwegs, haben aus dem Internet recherchiert und bekommen auch die verschiedensten Geräusche zugesandt.
Link
"Die Idee, die Geräusche einer Stadt aufzunehmen, ist nicht neu. 'Yukio Van Maren King' macht dies bereits mit Berlin. Seine Tonaufnahmen können unter http://www.berlincast.com angehört werden. Nach diesem Vorbild wollen wir das auch für unser heißgeliebtes Chemnitz machen. Die vielfältigen Geräuschkulissen unserer Stadt sind ebenso unterschiedlich wie unterhaltsam.
Dementsprechend werden auf dieser Seite mit der Zeit immer neue Tonaufnahmen veröffentlicht. Über Kommentare würden wir uns Löcher in den Bauch freuen."
Quelle: Homepage
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 22:55 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein längerer Beitrag mit Recherchetipps für das Ermitteln frühneuzeitlicher deutscher Drucke im Frühneuzeit-Weblog:
http://www.histinst.rwth-aachen.de/ext/agfnz/?p=362
http://www.histinst.rwth-aachen.de/ext/agfnz/?p=362
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 22:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 21:56 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
National Archives Video for PF.org from Center for Innovative Media on Vimeo.
"The National Archives just won a GreenGov Presidential Awards for Leadership in Environmental, Energy, and Economic Performance. What are we doing to make our DC-area buildings greener? "Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 21:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Eine Vogelschau des Archivmodells führt uns deutlich die funktionalen Zusammenhänge vor Augen und illustriert eindrucksvoll die Klarheit des architektonischen Konzeptes: Als Aufbewahrungsort der Schrift- und Bildquellen und somit als ideelles Herzstück des Archivs dominiert im Außenbau an Größe und Wucht der zentrale viergeschoßige Block mit den Magazinen. Daran schließt nördlich der Öffentlichkeitsbereich mit dem effektvoll zur Straßenflucht und gegen das Stadtzentrum vortretenden gläsernen Oval des Saales der Landesgeschichte an, in den der schwarze Würfel des Vortragssaales tw. integriert ist. An den langen gläsernen Verbindungsgang sind gleichsam wie die Finger einer Hand drei unterschiedlich große Trakte für die mannigfachen Arbeitsbereiche eines Archives angefügt: Anlieferung, Ordnung, Restaurierung und Verfilmung im größten, Lesesaal und Wissenschaftlicher Dienst im mittleren sowie Direktion, Kanzlei und Bibliothek im kleinsten nördlichen."

Außenansicht des Saales der Landesgeschichte in Abendbeleuchtung, Foto: Mag. G. Erlacher
"Schon am Außenbau finden sich mannigfache Symbolikbezüge zu den Aufgaben und zur Bedeutung des Gebäudes: Das gläserne Oval des Saales der Landesgeschichte und der in diesen einschneidende, durch die schwarze Serpentinverkleidung hervorgehobene Vortragssaal sind gleichsam eine Visitenkarte der Öffentlichkeitsarbeit des Archivs und sind ein demonstrativer Blickfang für den sich von der Innenstadt Nähernden. Im Außenbau allseitig dominant ist nicht nur durch seine Höhe der Magazinblock, wobei die Verkleidung mit Krastaler Marmorplatten nicht nur den Wert der einliegenden Archivalien betont, sondern auch eine wichtige Funktion im Klimatisierungskonzept erfüllt. Der Schriftzug UNVERGESSEN an den Stufen vor dem Magazintrakt ist ein Teil der Installation Cornelius Koligs und suggeriert die Memorialfunktion eines Archivs. Demgegenüber fügt sich die gartenseitige Front in eine gewisse Ruhe und Behaglichkeit der umgebenden, in Grün gebetteten Liegenschaften ein. Das Wasserbecken mit seiner spiegelglatten Wasserfläche, innerhalb der sich eine "Insel" mit Tischen und Sitzgelegenheiten als Stätte der Rekreation und Diskussion befindet, entfaltet seine stärkste Wirkung von der Aula aus. "
Quelle: Homepage des Landesarhivs Kärnten

Johann Jaritz, Wikipedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 19:21 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bei Bohrungen an der Einsturzstelle des Kölner Stadtarchivs sind neue Archivalien gefunden worden. Die Bohrungen waren im Zusammenhang mit der Errichtung des so genannten Bergungsbauwerks notwendig geworden. Der Fund bestätige, dass sich an der Einsturzstelle und im Grundwasser noch Archivalien befinden, die sich restaurieren lassen, so ein Sprecher der Stadt. Mitte November wolle die Stadt die Einsturzstelle großflächig ausbaggern."
Quelle: WDR.de, Lokalzeit-Nachrichten Köln, 8.10.2010
Quelle: WDR.de, Lokalzeit-Nachrichten Köln, 8.10.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 19:15 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bundespräsident Dr. Christian Wulff hat sich "sehr gerne bereit" erklärt, die Schirmherrschaft über die Stiftung Stadtgedächtnis zu übernehmen.
"Meine Schirmherrschaft soll der Stiftung zu einem guten Start ihrer Arbeit verhelfen,"
teilte der Bundespräsident Oberbürgermeister Jürgen Roters mit.
Roters äußerte sich sehr erfreut über die Zusage:
" Ich hoffe, dass viele Menschen dem Beispiel des Bundespräsidenten folgen und ihren Beitrag dazu leisten werden, dass Köln sein kulturelles Erbe retten kann. In keinem anderen Kommunalarchiv findet sich eine vergleichbar dichte Überlieferung. Es wird gewaltige Anstrengungen erfordern, die geretteten 85 Prozent der Archivalien instand zu setzen. Die Restaurationsarbeiten werden 6.300 Personenjahre in Anspruch nehmen und mindestens 350 Millionen Euro kosten. Das kann Köln nicht allein bewältigen, wir brauchen großzügige Unterstützung, um dieses einmalige kulturelle Gedächtnis zu bewahren."
Die im Juli dieses Jahres gegründete Stiftung Stadtgedächtnis soll Finanzmittel beschaffen, um die Restaurierung und Instandsetzung der geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv in den kommenden Jahren zu unterstützen. Das Geld ergänzt die städtischen Mittel, die für diesen Zweck in den Haushalt eingestellt sind. Außerdem setzt sich die Stiftung für die Zusammenführung der Bestände sowie deren Digitalisierung, Erforschung und eine wissenschaftliche Begleitung ein.
Wer die Stiftung Stadtgedächtnis mit einer Spende unterstützen möchte, hat mehrere Möglichkeiten:
*
Spenden Sie 5 Euro über die Spenden-Hotline der Stiftung Stadtgedächtnis unter Telefon 09001 / 030309 (aus dem deutschen Festnetz).
*
Unterstützen Sie die Rettung des kulturellen Erbes mit einer Dauerspende - die Einzugsermächtigung steht auf der Homepage der Stiftung Stadtgedächtnis zum Download bereit.
*
Überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
Stiftung Stadtgedächtnis
Sal. Oppenheim
Kontonummer 3309
Bankleitzahl 370 302 00
Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre vollständige Adresse an, damit Sie eine Spendenbescheinigung erhalten. Bis zu einer Spende in Höhe von 200 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung für das Finanzamt."
Quelle: Stadt Köln, Pressemitteilung 8.10.2010
Homepage der Stiftung Stadtgedächtnis
"Meine Schirmherrschaft soll der Stiftung zu einem guten Start ihrer Arbeit verhelfen,"
teilte der Bundespräsident Oberbürgermeister Jürgen Roters mit.
Roters äußerte sich sehr erfreut über die Zusage:
" Ich hoffe, dass viele Menschen dem Beispiel des Bundespräsidenten folgen und ihren Beitrag dazu leisten werden, dass Köln sein kulturelles Erbe retten kann. In keinem anderen Kommunalarchiv findet sich eine vergleichbar dichte Überlieferung. Es wird gewaltige Anstrengungen erfordern, die geretteten 85 Prozent der Archivalien instand zu setzen. Die Restaurationsarbeiten werden 6.300 Personenjahre in Anspruch nehmen und mindestens 350 Millionen Euro kosten. Das kann Köln nicht allein bewältigen, wir brauchen großzügige Unterstützung, um dieses einmalige kulturelle Gedächtnis zu bewahren."
Die im Juli dieses Jahres gegründete Stiftung Stadtgedächtnis soll Finanzmittel beschaffen, um die Restaurierung und Instandsetzung der geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv in den kommenden Jahren zu unterstützen. Das Geld ergänzt die städtischen Mittel, die für diesen Zweck in den Haushalt eingestellt sind. Außerdem setzt sich die Stiftung für die Zusammenführung der Bestände sowie deren Digitalisierung, Erforschung und eine wissenschaftliche Begleitung ein.
Wer die Stiftung Stadtgedächtnis mit einer Spende unterstützen möchte, hat mehrere Möglichkeiten:
*
Spenden Sie 5 Euro über die Spenden-Hotline der Stiftung Stadtgedächtnis unter Telefon 09001 / 030309 (aus dem deutschen Festnetz).
*
Unterstützen Sie die Rettung des kulturellen Erbes mit einer Dauerspende - die Einzugsermächtigung steht auf der Homepage der Stiftung Stadtgedächtnis zum Download bereit.
*
Überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
Stiftung Stadtgedächtnis
Sal. Oppenheim
Kontonummer 3309
Bankleitzahl 370 302 00
Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre vollständige Adresse an, damit Sie eine Spendenbescheinigung erhalten. Bis zu einer Spende in Höhe von 200 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung für das Finanzamt."
Quelle: Stadt Köln, Pressemitteilung 8.10.2010
Homepage der Stiftung Stadtgedächtnis
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 19:11 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ingo Runde (bisher Archiv der Universität Duisburg-Essen) wechselt an das Universitätsarchiv Heidelberg. Die AG der Hochschularchive in NRW verliert damit ihren Sprecher. Runde war erst 2010 zum Nachfolger von Thomas Becker gewählt worden.
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 17:18 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
vom hofe - am Freitag, 8. Oktober 2010, 12:14 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(Quelle: Wikipedia)
"... Derzeit sichtbarstes Zeichen des Baufortschritts ist die äußere Fertigstellung des Magazin-Gebäudes: Hinter der Luisenschule an der Bert-Brecht-Straße ist ein Anbau entstanden, der künftig rund zehn Regalkilometer mit alten Akten aufnimmt. Er kommt ohne Tageslicht aus, benötigt aber konstante 18 Grad Celsius Raumtemperatur und gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Deshalb sind in die Fassaden keine Fenster, sondern hochformatige Luken eingelassen. Die Fassade wurde mit korrodierendem Stahl verkleidet. „Die Fassade wird weiterrosten und so ihr Aussehen ändern”, erklärt der verantwortliche Architekt Frank Ahlbrecht. Eine Stahlfassade deute auf den „Tresor-Charakter” des Gebäudes hin und unterstreiche die Bedeutung Essens als frühere Stahl-Stadt. Dem Vernehmen nach hat die Fassade erste Fans: Baudezernentin Simone Raskob und Kulturhauptstadt-Organisator Oliver Scheytt sollen von einer „Sensation” ..."
Quelle:derwesten.de, 10.09.2009
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 12:02 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.youtube.com/watch?v=MG_dokXFaec&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9Yr3ErXSrVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J8CNnh9j-sU&feature=related
(Malinowski zur Anzahl ns-freundlicher Adelige)
http://www.youtube.com/watch?v=03SZ1n7GKE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vHE1gityidw&feature=related
Meines Erachtens ein interessanter Beitrag der aber verständlicherweise an der Oberfläche bleiben muss. Die wirtschaftlichen Interessen eines grossen Teils des (insbesondere nicht katholischen) Hochadels werden nicht angesprochen.
Mein Beitrag zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/
verlinkt bei kritische Geschichte
https://kg.hallowiki.biz/index.php/Hauptseite
Vierprinzen
http://www.youtube.com/watch?v=9Yr3ErXSrVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J8CNnh9j-sU&feature=related
(Malinowski zur Anzahl ns-freundlicher Adelige)
http://www.youtube.com/watch?v=03SZ1n7GKE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vHE1gityidw&feature=related
Meines Erachtens ein interessanter Beitrag der aber verständlicherweise an der Oberfläche bleiben muss. Die wirtschaftlichen Interessen eines grossen Teils des (insbesondere nicht katholischen) Hochadels werden nicht angesprochen.
Mein Beitrag zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/
verlinkt bei kritische Geschichte
https://kg.hallowiki.biz/index.php/Hauptseite
Vierprinzen
vom hofe - am Freitag, 8. Oktober 2010, 11:23 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 8. Oktober 2010, 08:54 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 01:43 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://idw-online.de/de/news390431
In dem bisherigen einstweiligen Verfügungsverfahren haben die zuständigen Gerichte, das Landgericht und das Oberlandesgericht Frankfurt, in zwei Instanzen das beklagte Recht der Bibliotheken ausdrücklich bestätigt, das Recht der Nutzer jedoch eingeschränkt. Bibliotheken dürfen unabhängig von den Verlagen Werke aus ihrem Printbestand digitalisieren und in ihren Räumen das so geschaffene digitale Exemplar zur Nutzung anbieten. Den Nutzerinnen und Nutzern muss jedoch jede Möglichkeit genommen werden, daraus für sich Kopien zu machen. Hatte das Landgericht in der ersten Instanz immerhin noch den Ausdruck auf Papier zugelassen und nur den Download verboten, untersagte das Oberlandesgericht am 24.11.2009 auch den Papierausdruck.
Die TU Darmstadt hat diese einstweilige Verfügung nicht akzeptiert, sondern im Sommer 2010 den Weg der sogenannten Klageerzwingung beschritten. Damit war die Verlagsseite gezwungen, Klage in der Hauptsache gegen die TU Darmstadt zu erheben. Dies ist im August 2010 geschehen. Die Sache wird also neu verhandelt werden.
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/search?q=%C2%A7+52b
In dem bisherigen einstweiligen Verfügungsverfahren haben die zuständigen Gerichte, das Landgericht und das Oberlandesgericht Frankfurt, in zwei Instanzen das beklagte Recht der Bibliotheken ausdrücklich bestätigt, das Recht der Nutzer jedoch eingeschränkt. Bibliotheken dürfen unabhängig von den Verlagen Werke aus ihrem Printbestand digitalisieren und in ihren Räumen das so geschaffene digitale Exemplar zur Nutzung anbieten. Den Nutzerinnen und Nutzern muss jedoch jede Möglichkeit genommen werden, daraus für sich Kopien zu machen. Hatte das Landgericht in der ersten Instanz immerhin noch den Ausdruck auf Papier zugelassen und nur den Download verboten, untersagte das Oberlandesgericht am 24.11.2009 auch den Papierausdruck.
Die TU Darmstadt hat diese einstweilige Verfügung nicht akzeptiert, sondern im Sommer 2010 den Weg der sogenannten Klageerzwingung beschritten. Damit war die Verlagsseite gezwungen, Klage in der Hauptsache gegen die TU Darmstadt zu erheben. Dies ist im August 2010 geschehen. Die Sache wird also neu verhandelt werden.
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/search?q=%C2%A7+52b
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 01:35 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Tagungsband zum Regensburger Archivtag liegt nicht Open Access vor, obwohl Open Access ein wichtiges Thema war.
Bibliographisch ist der Band denkbar unprofessionell gemacht. Es fehlt die Angabe des Tagungsjahrs im Untertitel und der Erscheinungsort.
Augias.net, aus dem ich das Inhaltsverzeichnis, kopiere, gibt Fulda, den Sitz des VdA an, was aber nun mal nicht dran steht. Daher läuft der Band in den Verbundkatalogen BVB und GBV (die Deutsche Nationalbibliothek scheint noch kein Pflichtexemplar erhalten zu haben!) unter Neustadt a. d. Aisch, SWB und die Archivschule Marburg haben Fulda. Korrekt wäre wohl: ohne Ort [Fulda]. Satz und Gestaltung: Jens Murken - sapienti sat!
Inhalt
Vorwort (9)
Robert Kretzschmar: Rahmenthema, Programm und Ergebnisse des 79. Deutschen Archivtags (11)
Peter Haber: digital.past – Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter (17)
Dornröschen aufgewacht? Neue Arbeits- und Kommunikationsprozesse im Archiv
Christian Keitel: Benutzerinteressen annehmen und signifikante Eigenschaften festlegen. Einige neue Aufgaben für Archivare (29)
Mario Glauert: Archiv 2.0. Vom Aufbruch der Archive zu ihren Nutzern (43)
Bewertung elektronischer Unterlagen und Überlieferungsbildung
Ilka Stahlberg: Archivische Anforderungen an die Einführung eines DMS/VBS in der Ministerialverwaltung Brandenburgs – Ein Erfahrungsbericht (57)
Matthias Manke, René Wiese: Aktenbewertung elektronisch – eine DOMEA®-Lösung im Landeshauptarchiv Schwerin (67)
Andrea Hänger, Katharina Ernst: Ein System – zwei Lösungen. Digitale Archivierung im Bundesarchiv und im Stadtarchiv Stuttgart 77
Raymond Plache: Zusammenfassung und Diskussion 85
Bildungsarbeit im Netz
Birgit Jooss: Potentiale der Einbindung externen Wissens. Die digitale Edition der Matrikelbücher der Akademie der Bildenden Künste München 91
Peter Pfister: Wege kirchlicher Archivalien ins Netz 107
Hanns Jürgen Küsters: Das Internetportal „Konrad Adenauer“ als Bildungs- und Forschungsquelle 113
Maria Rita Sagstetter: Zusammenfassung und Diskussion 121
Archive als Online-Informationsdienstleister
Nils Brübach: Internationale Erschließungsstandards in der deutschen Erschließungspraxis 127
Johannes Kistenich, Martina Wiech: Auf dem Weg zum elektronischen Landesarchiv? 135
Alfons Ruch: Das MonArch-Projekt in Nürnberg. Kontextorientierte Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Einzelarchiv, in Verbünden und Fachportalen 149
Gisela Haker: Zusammenfassung und Diskussion 159
Open Access und Archive
Angela Ullmann: Schutzwürdige Belange, kommerzielle Verwertung, Nutzungsrechte und Co. Die Grenzen des Open Access 165
Oliver Sander: Open Access vs. E-Commerce? Digitalisierung, Erschließung, Präsentation und Verwertung von Bildern aus dem Bundesarchiv 171
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive 177-185
[Preprint: http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ ]
Beate Dördelmann: Zusammenfassung und Diskussion 187
Internet und Digitalisierung – zukünftige Herausforderungen für die Archive
Jürgen Treffeisen: Komplementäre Bewertung konventioneller Akten und elektronischer Daten 193
Bernhard Grau: Die Einführung der digitalen Leistungsakte bei der Bundesagentur für Arbeit und ihre Auswirkungen auf Bewertung und Überlieferungsbildung 201
Tobias Hillegeist: Probleme mit unbekannten Nutzungsarten bei der Retrodigitalisierung 211
Horst-Dieter Beyerstedt: Online-Dienstleistungen von Kommunalarchiven 219
Robert Kretzschmar mit Ulrike Gutzmann, Gerald Maier, Michael Häusler, Ute Schwens, Veit Scheller und Robert Zink: Die Rolle der Archive im digitalen Zeitalter (225)
Biografien der Autorinnen und Autoren (249)
Info:
Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg
Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, Band 14,
hrsg. vom VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Fulda 2010, ISBN 978-3-9811618-3-0
Bibliographisch ist der Band denkbar unprofessionell gemacht. Es fehlt die Angabe des Tagungsjahrs im Untertitel und der Erscheinungsort.
Augias.net, aus dem ich das Inhaltsverzeichnis, kopiere, gibt Fulda, den Sitz des VdA an, was aber nun mal nicht dran steht. Daher läuft der Band in den Verbundkatalogen BVB und GBV (die Deutsche Nationalbibliothek scheint noch kein Pflichtexemplar erhalten zu haben!) unter Neustadt a. d. Aisch, SWB und die Archivschule Marburg haben Fulda. Korrekt wäre wohl: ohne Ort [Fulda]. Satz und Gestaltung: Jens Murken - sapienti sat!
Inhalt
Vorwort (9)
Robert Kretzschmar: Rahmenthema, Programm und Ergebnisse des 79. Deutschen Archivtags (11)
Peter Haber: digital.past – Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter (17)
Dornröschen aufgewacht? Neue Arbeits- und Kommunikationsprozesse im Archiv
Christian Keitel: Benutzerinteressen annehmen und signifikante Eigenschaften festlegen. Einige neue Aufgaben für Archivare (29)
Mario Glauert: Archiv 2.0. Vom Aufbruch der Archive zu ihren Nutzern (43)
Bewertung elektronischer Unterlagen und Überlieferungsbildung
Ilka Stahlberg: Archivische Anforderungen an die Einführung eines DMS/VBS in der Ministerialverwaltung Brandenburgs – Ein Erfahrungsbericht (57)
Matthias Manke, René Wiese: Aktenbewertung elektronisch – eine DOMEA®-Lösung im Landeshauptarchiv Schwerin (67)
Andrea Hänger, Katharina Ernst: Ein System – zwei Lösungen. Digitale Archivierung im Bundesarchiv und im Stadtarchiv Stuttgart 77
Raymond Plache: Zusammenfassung und Diskussion 85
Bildungsarbeit im Netz
Birgit Jooss: Potentiale der Einbindung externen Wissens. Die digitale Edition der Matrikelbücher der Akademie der Bildenden Künste München 91
Peter Pfister: Wege kirchlicher Archivalien ins Netz 107
Hanns Jürgen Küsters: Das Internetportal „Konrad Adenauer“ als Bildungs- und Forschungsquelle 113
Maria Rita Sagstetter: Zusammenfassung und Diskussion 121
Archive als Online-Informationsdienstleister
Nils Brübach: Internationale Erschließungsstandards in der deutschen Erschließungspraxis 127
Johannes Kistenich, Martina Wiech: Auf dem Weg zum elektronischen Landesarchiv? 135
Alfons Ruch: Das MonArch-Projekt in Nürnberg. Kontextorientierte Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Einzelarchiv, in Verbünden und Fachportalen 149
Gisela Haker: Zusammenfassung und Diskussion 159
Open Access und Archive
Angela Ullmann: Schutzwürdige Belange, kommerzielle Verwertung, Nutzungsrechte und Co. Die Grenzen des Open Access 165
Oliver Sander: Open Access vs. E-Commerce? Digitalisierung, Erschließung, Präsentation und Verwertung von Bildern aus dem Bundesarchiv 171
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive 177-185
[Preprint: http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ ]
Beate Dördelmann: Zusammenfassung und Diskussion 187
Internet und Digitalisierung – zukünftige Herausforderungen für die Archive
Jürgen Treffeisen: Komplementäre Bewertung konventioneller Akten und elektronischer Daten 193
Bernhard Grau: Die Einführung der digitalen Leistungsakte bei der Bundesagentur für Arbeit und ihre Auswirkungen auf Bewertung und Überlieferungsbildung 201
Tobias Hillegeist: Probleme mit unbekannten Nutzungsarten bei der Retrodigitalisierung 211
Horst-Dieter Beyerstedt: Online-Dienstleistungen von Kommunalarchiven 219
Robert Kretzschmar mit Ulrike Gutzmann, Gerald Maier, Michael Häusler, Ute Schwens, Veit Scheller und Robert Zink: Die Rolle der Archive im digitalen Zeitalter (225)
Biografien der Autorinnen und Autoren (249)
Info:
Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg
Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, Band 14,
hrsg. vom VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Fulda 2010, ISBN 978-3-9811618-3-0
KlausGraf - am Freitag, 8. Oktober 2010, 00:29 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Stellt Herr Buchhändler Praefcke in Twitter fest, aber es stimmt.
Beispiele:
Droste
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118527533
Brentano
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118515055
Beispiele:
Droste
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118527533
Brentano
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118515055
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 23:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 23:34 - Rubrik: Digitale Unterlagen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 23:22 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Stadtarchiv Fulda, Bonifatiusplatz 1-3



Gelungenes Entree?

Geschäftsstelle des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, Wörthstr. 1-3

Die lieben Nachbarn:





Gelungenes Entree?

Geschäftsstelle des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, Wörthstr. 1-3

Die lieben Nachbarn:


Wolf Thomas - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 22:39 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 22:20 - Rubrik: Archivbau
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 17:59 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 17:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
Wichtige deutsche Kataloge - BVB und DNB - fehlen, der Filter für VD 17 wird von diesem selbst nicht angeboten.
Wichtige deutsche Kataloge - BVB und DNB - fehlen, der Filter für VD 17 wird von diesem selbst nicht angeboten.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-Kontroverse-um-Online-Publikationsrechte-in-der-Wissenschaft-1103249.html
Stein des Anstoßes ist vor allem das Drängen von Vereinigungen wie der "Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen" auf ein "unabdingbares" Recht für wissenschaftliche Autoren, ihre Aufsätze und unselbständig erschienenen Werke "nach einer angemessenen Embargofrist" Eins zu Eins in der Verlagsversion im Internet veröffentlichen zu dürfen. Es gehe darum, dass die Möglichkeit zur kostenfreien Publikation öffentlich geförderter Forschung nach rund sechs bis zwölf Monaten wieder an den Urheber zurückfalle, erläuterte Anne Lipp, Leiterin der Gruppe "Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme" bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), gegenüber heise online. Um die Zitierfähigkeit zu erhalten, sei es dabei wichtig, dass die Zweitveröffentlichung im Netz im Format der verlegerisch betreuten Erstpublikation erfolge.
Das ist die richtige Richtung. Die Formatfrage ist ein entscheidender Punkt für die Akzeptanz von Open Access in den Wissenschaften, in denen üblicherweise längere Aufsätze publiziert werden. Wissenschaftler tendieren dazu, nicht den "final draft" ins Institutionelle Repositorium abzugeben, sondern ein Verlags-PDF, auch wenn dieses auf unabsehbare Zeit der Öffentlichkeit (oder den Nicht-Universitätsangehörigen) nicht zur Verfügung steht.
Der Mehrwert, den Verlage real erbringen, kann dabei durchaus vergütet werden - aber nicht nach unrealistischen Mondpreisen für Leistungen, die in Wirklichkeit der Autor oder seine Institution erbringt.
Stein des Anstoßes ist vor allem das Drängen von Vereinigungen wie der "Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen" auf ein "unabdingbares" Recht für wissenschaftliche Autoren, ihre Aufsätze und unselbständig erschienenen Werke "nach einer angemessenen Embargofrist" Eins zu Eins in der Verlagsversion im Internet veröffentlichen zu dürfen. Es gehe darum, dass die Möglichkeit zur kostenfreien Publikation öffentlich geförderter Forschung nach rund sechs bis zwölf Monaten wieder an den Urheber zurückfalle, erläuterte Anne Lipp, Leiterin der Gruppe "Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme" bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), gegenüber heise online. Um die Zitierfähigkeit zu erhalten, sei es dabei wichtig, dass die Zweitveröffentlichung im Netz im Format der verlegerisch betreuten Erstpublikation erfolge.
Das ist die richtige Richtung. Die Formatfrage ist ein entscheidender Punkt für die Akzeptanz von Open Access in den Wissenschaften, in denen üblicherweise längere Aufsätze publiziert werden. Wissenschaftler tendieren dazu, nicht den "final draft" ins Institutionelle Repositorium abzugeben, sondern ein Verlags-PDF, auch wenn dieses auf unabsehbare Zeit der Öffentlichkeit (oder den Nicht-Universitätsangehörigen) nicht zur Verfügung steht.
Der Mehrwert, den Verlage real erbringen, kann dabei durchaus vergütet werden - aber nicht nach unrealistischen Mondpreisen für Leistungen, die in Wirklichkeit der Autor oder seine Institution erbringt.
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 14:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 14:53 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 05:25 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.upress.uni-kassel.de/publi/abstract.php?978-3-89958-197-0
Nicht ausdruckbares PDF des Sammelbandes der Aachener Tagung gibts gratis.
Nicht ausdruckbares PDF des Sammelbandes der Aachener Tagung gibts gratis.
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 03:42 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 03:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 03:17 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 02:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bbv-net.de/lokales/regionales/1407132_Ist_die_Kreisstadt_Borken_viel_aelter_als_bisher_vermutet.html
Hier werden aus regionaler Sicht deutliche Zweifel an den vom SPIEGEL als sensationell herausgestellten Ergebnissen einer Berliner Forschergruppe angemeldet. Eine wissenschaftliche Besprechung des Buchs von Kleineberg et al.: Germania und die Insel Thule. WBG 2010 ist mir nicht bekannt.
Spiegel-Artikel
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719602,00.html
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geographike_Hyphegesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_(Ptolemy)#cite_ref-2
Hier werden aus regionaler Sicht deutliche Zweifel an den vom SPIEGEL als sensationell herausgestellten Ergebnissen einer Berliner Forschergruppe angemeldet. Eine wissenschaftliche Besprechung des Buchs von Kleineberg et al.: Germania und die Insel Thule. WBG 2010 ist mir nicht bekannt.
Spiegel-Artikel
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719602,00.html
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geographike_Hyphegesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_(Ptolemy)#cite_ref-2
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn man wissen will, welche modernen Bücher kostenfrei in elektronischer Form im Internet einsehbar sind, kann man bei breiten Themen nur die Waffen strecken.
Probe aufs Exempel mit dem Suchbegriff Knighthood.
Worldcat bietet 2258 Internet-Ressourcen an, eine sinnvolle Eingrenzung existiert nicht. Die Trefferliste ist von Google- und HathiTrust-Treffern ohne Vollansicht zugemüllt.
OAIster bei Worldcat hat 795 Treffer, ebenfalls zugemüllt von kostenpflichtigen/unfreien Ressourcen und Buchbesprechungen.
BASE hat 807 Treffer. Angeboten wird als Zeiteingrenzung für moderne Literatur nur ab 2000. Mit 113 Treffern könnte man das schnell sichten, wenn BASE einen nicht dazu zwingen würde, 10er-Trefferlisten anzusehen. Auch hier Unfreies, zuviel irrelevante Buchbesprechungen und als besondere Sahnehaube Treffer aus Aufklärungszeitschriften, weil das Internetveröffentlichungsdatum zählt!
Da ist man mit Göteborgs OPAC Gunda besser bedient: Du sökte på - GUNDA - Generell: knighthood fri e-bok. 2 Treffer, 1 Volltreffer, eine zentrale Monographie (Scaglione). Diese findet man übrigens auch bei Google in Vollansicht.
Bei elektronischen Publikationen ist die Grenze zwischen Monographien und Aufsätzen fließend. Es wäre schon eine enorme Verbesserung, hätte man einen brauchbaren Filter
* NICHT unfrei (bzw. Google-Schnipselansicht etc.)
* NICHT Rezension.
Probe aufs Exempel mit dem Suchbegriff Knighthood.
Worldcat bietet 2258 Internet-Ressourcen an, eine sinnvolle Eingrenzung existiert nicht. Die Trefferliste ist von Google- und HathiTrust-Treffern ohne Vollansicht zugemüllt.
OAIster bei Worldcat hat 795 Treffer, ebenfalls zugemüllt von kostenpflichtigen/unfreien Ressourcen und Buchbesprechungen.
BASE hat 807 Treffer. Angeboten wird als Zeiteingrenzung für moderne Literatur nur ab 2000. Mit 113 Treffern könnte man das schnell sichten, wenn BASE einen nicht dazu zwingen würde, 10er-Trefferlisten anzusehen. Auch hier Unfreies, zuviel irrelevante Buchbesprechungen und als besondere Sahnehaube Treffer aus Aufklärungszeitschriften, weil das Internetveröffentlichungsdatum zählt!
Da ist man mit Göteborgs OPAC Gunda besser bedient: Du sökte på - GUNDA - Generell: knighthood fri e-bok. 2 Treffer, 1 Volltreffer, eine zentrale Monographie (Scaglione). Diese findet man übrigens auch bei Google in Vollansicht.
Bei elektronischen Publikationen ist die Grenze zwischen Monographien und Aufsätzen fließend. Es wäre schon eine enorme Verbesserung, hätte man einen brauchbaren Filter
* NICHT unfrei (bzw. Google-Schnipselansicht etc.)
* NICHT Rezension.
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 00:21 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Oktober 2010, 00:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 23:41 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"... Am 12. April war am Duisburger Innenhafen großer Auftrieb. An diesem Tag um 13 Uhr fiel der offizielle Startschuss für den Umbau des RWSG-Speichers an der Schifferstraße zum neuen Landesarchiv. Aus diesem Anlass war auch der damals noch amtierende CDU Ministerpräsident Jürgen Rüttgers nach Duisburg gekommen. Seitdem laufen dort die Bauarbeiten auf Hochtouren, auch wenn noch nicht viel von dem neuen Landesarchiv zu sehen ist. Seit vergangenen Montag steht an der Baustelle jetzt auch der höchste Kran in Duisburg - auch ein Zeichen mit Signalwirkung....."
Quelle: RP-Online, 5.10.2010
Quelle: RP-Online, 5.10.2010
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:18 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Inhalt der Stellungnahme der Verwaltung zu einem FDP-Antrag für den Kulturaussschuss vom 05.10.2010:
"1. Besichtigung der Schäden
Vor Beginn der Ausschusssitzung am 05.10.2010 wird der Leiter des Stadtarchivs, Herr Dr. Schloßmacher, die Mitglieder des Kulturausschusses in der Zeit von 16.30 Uhr bis gegen 18.00Uhr durch die Räume des Archivs führen und die aktuelle Situation erläutern.
2. Schutz der Archivalien vor Wassereintritt
Im Jahr 2009 wurden die Magazinräume des Stadtarchivs durch ein externes Statikbüro überprüft und festgestellt, dass von den Rissen in den Wänden keine Gefährdung des Archivgutes ausgeht. Hierbei wurden sowohl die Risse in den nicht tragenden Wänden (Mauerwerksfugen), als auch Haarrisse in den statisch relevanten Betonwänden berücksichtigt. Für die Wiederherstellung einer geschlossenen Oberfläche werden die Mauerwerkswände sukzessive nachverfugt. An den Betonwänden ist keine Überarbeitung notwendig.
Zum Schutz der Archivalien vor Wasseraustritt aus der Decke wurden in den betroffenen Bereichen Auffangwannen an der Deckenunterseite angebracht, die regelmäßig kontrolliert werden. Zusätzlich werden bei zu erwartenden Starkregenereignissen die Regale mit einer Folie abgedeckt.
Eine umfassende Sanierung des über den Magazinräumen befindlichen Parkdecks ist nur in Zusammenhang mit einem Austausch aller unterseitigen Deckenbekleidungen im Keller möglich. Diese kostenintensiven und aufwendigen Arbeiten sollten im Rahmen einer Grundsanierung durchgeführt werden, da großflächig Lagerräume dafür geräumt werden müssen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zur Zukunft des Stadthauses wurde daher bisher auf eine derartige Sanierung verzichtet und stattdessen begonnen, in Teilbe-reichen ein schonenderes Sanierungsverfahren für die Abdichtung der Dehnungsfugen einzusetzen. Da mit diesem Sanierungsverfahren aber keine flächendeckende Abdichtung erreicht werden kann, ist so lediglich eine Reduzierung des Wassereintrags in die Magazinräume möglich.
3. Erfassung der Raumparameter (Klimatisierung)
Für den gesamten Kellerbereich des Stadtarchivs einschließlich der Flure wird die Klimatisierung hinsichtlich der Raumtemperatur und -feuchte in der Gebäudeleittechnik überwacht und aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgt auf Anfrage.
Eine raumscharfe Überwachung des Klimas in den Magazinräumen ist zurzeit nicht möglich. Für die Nachrüstung der Magazinräume mit zusätzlichen Messgeräten zur Überwachung sowie Dokumentation von Temperatur und Feuchte innerhalb der Kompaktanlagen wurden 2007 Kosten in Höhe von rund 47.000,- Euro geschätzt. Damit wäre die Voraussetzung für eine raumscharfe Steuerung des Klimas geschaffen. Eine Erfassung weiterer Raumluftparameter wie Stickoxide oder Schwefel ist damit nicht gegeben.
4. Personalstunden für die provisorische Absicherung
Der Personaleinsatz des Städtischen Gebäudemanagements wird nicht gesondert erfasst, da die Überprüfung der Räume im Rahmen der quartalsweisen Kontrollgänge für alle Keller-bereiche bzw. auch im Zuge von Baumaßnahmen im Keller erfolgt.
Die provisorische Abdeckung in Erwartung von Starkregenereignissen wird in der Regel durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtarchivs vorgenommen.
Seit sich seit 2006 die Wassereintritte in den Magazinräumen des Archivs nicht nur häufen sondern auch immer dramatischere Formen annehmen, stellen Maßnahmen zum Schutz und zur provisorischen Absicherung der Archivalien eine dauerhaft zu erbringende Zusatzleistung der im Archiv beschäftigten Mitarbeiter/innen dar.
Dies reicht von „Bereitschaftsdiensten nach Wetterlage“ mit Telefonketten und nächtlichen wie wochenendlichen Kontrollgängen in den Magazinräumen über akutes Eingreifen und Sichern bei Wassereintritten bis zu regelmäßigem Umräumen des Archivgutes mit zum Teil aufwendigen Ab- und Aufbauten.
Dieser verstärkt seit nunmehr vier Jahren erforderliche zusätzliche Arbeitsaufwand wurde nicht gesondert erfasst, er bindet jedoch, neben den wiederholten Einsätzen nachts und an Wochen-enden, in erheblichem Umfang auch personelle Ressourcen innerhalb der regulären Archivarbeit.
Darüber hinaus verursacht das ungünstige Raumklima infolge der Wassereintritte außer-ordentliche Restaurierungsbedarfe; besonders problematisch sind in diesem Zusammenhang die hohen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Diese zusätzlichen Restaurierungen führen neben entsprechend höheren Sachkosten auch zu einer weiteren spürbaren Inanspruchnahme von Personalstunden, z. B. durch aufwendiges Verpacken und Fahr- und Transportdienste.
Insgesamt stellen die durch den Zustand der Magazinräume bedingten Sicherungsmaßnahmen eine erhebliche regelmäßige Belastung der personellen Ressourcen im Stadtarchiv dar. "
Quelle: Bonner Ratsinformationssystem
"1. Besichtigung der Schäden
Vor Beginn der Ausschusssitzung am 05.10.2010 wird der Leiter des Stadtarchivs, Herr Dr. Schloßmacher, die Mitglieder des Kulturausschusses in der Zeit von 16.30 Uhr bis gegen 18.00Uhr durch die Räume des Archivs führen und die aktuelle Situation erläutern.
2. Schutz der Archivalien vor Wassereintritt
Im Jahr 2009 wurden die Magazinräume des Stadtarchivs durch ein externes Statikbüro überprüft und festgestellt, dass von den Rissen in den Wänden keine Gefährdung des Archivgutes ausgeht. Hierbei wurden sowohl die Risse in den nicht tragenden Wänden (Mauerwerksfugen), als auch Haarrisse in den statisch relevanten Betonwänden berücksichtigt. Für die Wiederherstellung einer geschlossenen Oberfläche werden die Mauerwerkswände sukzessive nachverfugt. An den Betonwänden ist keine Überarbeitung notwendig.
Zum Schutz der Archivalien vor Wasseraustritt aus der Decke wurden in den betroffenen Bereichen Auffangwannen an der Deckenunterseite angebracht, die regelmäßig kontrolliert werden. Zusätzlich werden bei zu erwartenden Starkregenereignissen die Regale mit einer Folie abgedeckt.
Eine umfassende Sanierung des über den Magazinräumen befindlichen Parkdecks ist nur in Zusammenhang mit einem Austausch aller unterseitigen Deckenbekleidungen im Keller möglich. Diese kostenintensiven und aufwendigen Arbeiten sollten im Rahmen einer Grundsanierung durchgeführt werden, da großflächig Lagerräume dafür geräumt werden müssen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zur Zukunft des Stadthauses wurde daher bisher auf eine derartige Sanierung verzichtet und stattdessen begonnen, in Teilbe-reichen ein schonenderes Sanierungsverfahren für die Abdichtung der Dehnungsfugen einzusetzen. Da mit diesem Sanierungsverfahren aber keine flächendeckende Abdichtung erreicht werden kann, ist so lediglich eine Reduzierung des Wassereintrags in die Magazinräume möglich.
3. Erfassung der Raumparameter (Klimatisierung)
Für den gesamten Kellerbereich des Stadtarchivs einschließlich der Flure wird die Klimatisierung hinsichtlich der Raumtemperatur und -feuchte in der Gebäudeleittechnik überwacht und aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgt auf Anfrage.
Eine raumscharfe Überwachung des Klimas in den Magazinräumen ist zurzeit nicht möglich. Für die Nachrüstung der Magazinräume mit zusätzlichen Messgeräten zur Überwachung sowie Dokumentation von Temperatur und Feuchte innerhalb der Kompaktanlagen wurden 2007 Kosten in Höhe von rund 47.000,- Euro geschätzt. Damit wäre die Voraussetzung für eine raumscharfe Steuerung des Klimas geschaffen. Eine Erfassung weiterer Raumluftparameter wie Stickoxide oder Schwefel ist damit nicht gegeben.
4. Personalstunden für die provisorische Absicherung
Der Personaleinsatz des Städtischen Gebäudemanagements wird nicht gesondert erfasst, da die Überprüfung der Räume im Rahmen der quartalsweisen Kontrollgänge für alle Keller-bereiche bzw. auch im Zuge von Baumaßnahmen im Keller erfolgt.
Die provisorische Abdeckung in Erwartung von Starkregenereignissen wird in der Regel durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtarchivs vorgenommen.
Seit sich seit 2006 die Wassereintritte in den Magazinräumen des Archivs nicht nur häufen sondern auch immer dramatischere Formen annehmen, stellen Maßnahmen zum Schutz und zur provisorischen Absicherung der Archivalien eine dauerhaft zu erbringende Zusatzleistung der im Archiv beschäftigten Mitarbeiter/innen dar.
Dies reicht von „Bereitschaftsdiensten nach Wetterlage“ mit Telefonketten und nächtlichen wie wochenendlichen Kontrollgängen in den Magazinräumen über akutes Eingreifen und Sichern bei Wassereintritten bis zu regelmäßigem Umräumen des Archivgutes mit zum Teil aufwendigen Ab- und Aufbauten.
Dieser verstärkt seit nunmehr vier Jahren erforderliche zusätzliche Arbeitsaufwand wurde nicht gesondert erfasst, er bindet jedoch, neben den wiederholten Einsätzen nachts und an Wochen-enden, in erheblichem Umfang auch personelle Ressourcen innerhalb der regulären Archivarbeit.
Darüber hinaus verursacht das ungünstige Raumklima infolge der Wassereintritte außer-ordentliche Restaurierungsbedarfe; besonders problematisch sind in diesem Zusammenhang die hohen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Diese zusätzlichen Restaurierungen führen neben entsprechend höheren Sachkosten auch zu einer weiteren spürbaren Inanspruchnahme von Personalstunden, z. B. durch aufwendiges Verpacken und Fahr- und Transportdienste.
Insgesamt stellen die durch den Zustand der Magazinräume bedingten Sicherungsmaßnahmen eine erhebliche regelmäßige Belastung der personellen Ressourcen im Stadtarchiv dar. "
Quelle: Bonner Ratsinformationssystem
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:05 - Rubrik: Kommunalarchive
Kreisarchiv ist Fundgrube from DC on Vimeo.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:00 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe "Fotografie und Archiv" in Kooperation mit dem Museum für Photographie Braunschweig
Zeit Mittwoch, 17. November · 18:00 - 22:00
Ort Aula der Hochschule für Bildende Künste
Johannes-Selenka-Platz 1
Braunschweig, Germany
Der Vortrag von Jens Schröter geht von der besonderen Beziehung von Fotografie und Archiv aus, einem der zentralen Parameter des fotografischen Zeitalters. Doch wie verändert sich diese Relation im postfotografischen Zeitalter, wie und wohin bewegen sich die Archive? Welche politischen Implikationen wohnen der neuen Mobilität und Distribution der Bilder inne? Und wie reflektieren künstlerische Ansätze diese neue Form und Ortlosigkeit der Archive? Der Vortrag des in Siegen lehrenden Medienwissenschaftlers führt Thesen eines bereits bestehenden Aufsatzes fort.
Quelle: Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Facebook
Zeit Mittwoch, 17. November · 18:00 - 22:00
Ort Aula der Hochschule für Bildende Künste
Johannes-Selenka-Platz 1
Braunschweig, Germany
Der Vortrag von Jens Schröter geht von der besonderen Beziehung von Fotografie und Archiv aus, einem der zentralen Parameter des fotografischen Zeitalters. Doch wie verändert sich diese Relation im postfotografischen Zeitalter, wie und wohin bewegen sich die Archive? Welche politischen Implikationen wohnen der neuen Mobilität und Distribution der Bilder inne? Und wie reflektieren künstlerische Ansätze diese neue Form und Ortlosigkeit der Archive? Der Vortrag des in Siegen lehrenden Medienwissenschaftlers führt Thesen eines bereits bestehenden Aufsatzes fort.
Quelle: Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Facebook
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 21:45 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein Archiv für ostdeutsche Karikaturen soll im ehemaligen Gefängnis von Luckau (Dahme-Spreewald) eingerichtet werden. Der Landkreis habe sich mit seinem Konzept für ein solches Archiv im Kulturministerium erfolgreich um Fördermittel beworben, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch, 6. Oktober 2010, in Lübben mit. Das Ministerium habe rund 33.000 Euro für das Projekt des Vereins „Cartoonlobby” zugesagt. Der Landkreis werde dafür eine Fläche für ein Kultur- und Kunstarchiv in seinem künftigen Zentralarchiv in der ehemaligen Haftanstalt Luckau bereitstellen. Von den Fördergeldern sollen Schränke, Ausstellungsvitrinen und Lampen beschafft werden."
Quelle: Kulturportal Brandeburg
Quelle: Kulturportal Brandeburg
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 21:36 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sucht man nach dem subject: history in http://www.hathitrust.org mit der Zeiteingrenzung nach 1950, so findet man über 3500 Titel, die komplett gelesen werden können.
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 21:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bei der Stadt Koblenz ist im Bereich des Stadtarchivs zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Teilzeitstelle (50 %) einer/eines Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste befristet bis
zum 31. Dezember 2011 zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet gehören:
• Ordnung und Pflege der Archiv- und Bibliotheksbestände
• Einfache Verzeichnungsarbeiten (massenhaft gleichförmige
Einzelfallakten)
• Ausführung einfacher Rechercheaufträge
• Aufsicht im Benutzersaal
• Durchführung verwaltungstechnischer Aufgaben
Anforderungsprofil:
• Die Bewerberin/der Bewerber sollte eine Ausbildung im Bereich
Medien- und Informationsdienste, vorzugsweise Fachrichtung Archiv,
bzw. die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst im Archiv- oder
Bibliothekswesen mitbringen
• Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Hohes Maß an Eigenorganisation
• Hohe Belastbarkeit
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 7 TVöD
bewertet.
Für weitere Informationen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur
Verfügung:
Hans Josef Schmidt, Tel. 0261/129-2641
Michael Koelges, Tel. 0261/129-2645
Kontakt per Email:
stadtarchiv@stadt.koblenz.de"
Link
Zeitpunkt die Teilzeitstelle (50 %) einer/eines Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste befristet bis
zum 31. Dezember 2011 zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet gehören:
• Ordnung und Pflege der Archiv- und Bibliotheksbestände
• Einfache Verzeichnungsarbeiten (massenhaft gleichförmige
Einzelfallakten)
• Ausführung einfacher Rechercheaufträge
• Aufsicht im Benutzersaal
• Durchführung verwaltungstechnischer Aufgaben
Anforderungsprofil:
• Die Bewerberin/der Bewerber sollte eine Ausbildung im Bereich
Medien- und Informationsdienste, vorzugsweise Fachrichtung Archiv,
bzw. die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst im Archiv- oder
Bibliothekswesen mitbringen
• Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Hohes Maß an Eigenorganisation
• Hohe Belastbarkeit
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 7 TVöD
bewertet.
Für weitere Informationen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur
Verfügung:
Hans Josef Schmidt, Tel. 0261/129-2641
Michael Koelges, Tel. 0261/129-2645
Kontakt per Email:
stadtarchiv@stadt.koblenz.de"
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 21:24 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 21:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jens Freitag stellt nützliche Webseiten und Computerprogramme für Ahnenforscher vor: " Später muss man dann in so´n Archiv.....".
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 20:10 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.oapen.org
Via
http://www.facebook.com/notes/europeanaeu/open-access-publishing-takes-off-in-european-research-community/441271717877
= http://telfleur.wordpress.com/2010/10/06/open-access-publishing-takes-off-in-european-research-community/
Via
http://www.facebook.com/notes/europeanaeu/open-access-publishing-takes-off-in-european-research-community/441271717877
= http://telfleur.wordpress.com/2010/10/06/open-access-publishing-takes-off-in-european-research-community/
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 19:37 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digiwis.de/blog/2010/10/06/ag-fruehe-neuzeit-im-web-2-0-angekommen kommentiert den Internetauftritt (mit Weblog) der AG Frühe Neuzeit im Historikerverband: http://agfnz.historikerverband.de/


noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.abendblatt.de/hamburg/article1653447/Senat-kann-das-Altonaer-Museum-gar-nicht-schliessen.html
Rechtsexperte meint: Erst muss das Museumsstiftungsgesetz geändert werden, bevor das Altonaer Museum geschlossen werden kann.
Rechtsexperte meint: Erst muss das Museumsstiftungsgesetz geändert werden, bevor das Altonaer Museum geschlossen werden kann.
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 15:50 - Rubrik: Museumswesen
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 03:59 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=faccae20-d585-4a28-a9b4-16027a283689
Die Bilder tragen leider ärgerliche Wasserzeichen:
http://www.haltadefinizione.com/galleries.jsp?filter=1&lingua=en
Die Bilder tragen leider ärgerliche Wasserzeichen:
http://www.haltadefinizione.com/galleries.jsp?filter=1&lingua=en
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/61045
Weder Darthmouth-College noch die Mitglieder des Triangle-Networks (Duke, UNC at CH u.a.) sind bisher durch Massendigitalisierung hervorgetreten, der Zustrom wird sich also in Grenzen halten.
Darthmouth Digital Collections
http://www.dartmouth.edu/~library/digital/collections/
Duke Digital Collections
http://library.duke.edu/digitalcollections/
NCCU Digital Collection
http://hbcudigitallibrary.auctr.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/nccu
NCSU Digital Collections
http://www.lib.ncsu.edu/specialcollections/digital/index.html
UNC Digital Projects
http://www.lib.unc.edu/digitalprojects.html
Mit dem Internet Archive wurden bislang 6891 Bücher digitalisiert:
http://www.archive.org/search.php?query=collection:unclibraries&sort=-publicdate
Weder Darthmouth-College noch die Mitglieder des Triangle-Networks (Duke, UNC at CH u.a.) sind bisher durch Massendigitalisierung hervorgetreten, der Zustrom wird sich also in Grenzen halten.
Darthmouth Digital Collections
http://www.dartmouth.edu/~library/digital/collections/
Duke Digital Collections
http://library.duke.edu/digitalcollections/
NCCU Digital Collection
http://hbcudigitallibrary.auctr.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/nccu
NCSU Digital Collections
http://www.lib.ncsu.edu/specialcollections/digital/index.html
UNC Digital Projects
http://www.lib.unc.edu/digitalprojects.html
Mit dem Internet Archive wurden bislang 6891 Bücher digitalisiert:
http://www.archive.org/search.php?query=collection:unclibraries&sort=-publicdate
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 00:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.culture-to-go.com/2010/09/28/hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film/
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/cluny_leuchtet_1.7731838.html

http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/cluny_leuchtet_1.7731838.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 00:23 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://openbiomed.info/2010/10/the-predatory-open-access-seal-of-approval-goes-to-intechweb/
See also
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
#beall
See also
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
#beall
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 00:04 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Karl Marx
http://www.faz.net/f30/aktuell/WriteLike.aspx
Analysiert wurde der erste Teil von http://archiv.twoday.net/stories/6164988
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Oktober 2010, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung
KlausGraf - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 23:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Etwas flotter präsentiert als beim MDZ üblich:
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/rrbo-signaturen

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/rrbo-signaturen

KlausGraf - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 23:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/mod-deletes-data-on-afghan-tours-2096802.html
Electronic records on the activities of British troops in Afghanistan are routinely wiped from computers when regiments return to Britain, creating a gap in the documentation of soldiers' actions that a leading legal expert believes "smacks of cover-up". The Ministry of Defence confirmed this weekend that it has no established method of archiving the data generated during the deployment of soldiers abroad.
Electronic records on the activities of British troops in Afghanistan are routinely wiped from computers when regiments return to Britain, creating a gap in the documentation of soldiers' actions that a leading legal expert believes "smacks of cover-up". The Ministry of Defence confirmed this weekend that it has no established method of archiving the data generated during the deployment of soldiers abroad.
KlausGraf - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 23:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wir gehören zu einer Gruppe, die spitzentechnologische Anlagen produziert und über grosses Know-How im Bereich der Automatisierung verfügt.
Wir haben ein innovatives und international patentiertes Archivierungssystem entwickelt, das der Aktualität angepasst und für die Zukunft gedacht ist.
Schriftgut wird mittels Datenerfassung inventarisiert, elektronisch codiert und etikettiert, in unzerstörbaren Containern aus Kunststoff eingelagert und verschlossen.
Ein Heberoboter ordnet diese Container einer Lagerstruktur aus Metall zu.
Schnelles Wiederfinden von Dokumenten, deren Abhandenkommen technisch ausgeschlossen ist; absoluter Datenschutz ist gesichert."
Quelle: Homepage Archivi Robotica S.p.A.
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 21:07 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Render © Zaha Hadid Architects
"PROGRAM:
Archives, Library, Office
CLIENT:
Departement de l’Herault
Herault
Amenagement
1000, rue d’Alco
34087 Montpellier Cedex 4
France
SIZE:
Site: 35000 m²
Building: 28500 m²
CONCEPT:
The Pierres Vives building of the department de l’Herault is characterised by the unification of three institutions – the archive, the library and the sports department – within a single envelope. These various parts of this ‘cite administrative’ combine into a strong figure visible far into the landscape. As one moves closer, the division into three parts becomes apparent. The building has been developed on the basis of a rigorous pursuit of functional and economic logic. However, the resultant figure is reminiscent of a large tree-trunk, laid horizontal.
The archive is located at the solid base of the trunk, followed by the slightly more porous library with the sports department and its well-lit offices on top where the trunk bifurcates and becomes much lighter. The branches projecting off the main trunk are articulating the points of access and the entrances into the various institutions. On the western side all the public entrances are located, with the main entrance under an enormous cantilevering canopy; while on the eastern side all the service entrances, i.e. staff entrances and loading bays are located.
ARCHITECT:
ZAHA HADID ARCHITECTS
DESIGN: Zaha Hadid
PROJECT ARCHITECT: Stephane Hof
PROJECT TEAM: Joris Pauwels, Philipp Vogt, Rafael Portillo, Melissa Fukumoto, Jens Borstelman, Jaime Serra, Kane Yanegawa, Loreto Flores, Edgar Payan, Lisamarie Villegas Ambia, Stella Nikolakaki, Karouko Ogawa, Hon Kong Chee, Caroline Andersen, Judith Reitz, Olivier Ottevaere, Achim Gergen, Daniel Baerlecken, Yosuke Hayano, Martin Henn, Rafael Schmidt, Daniel Gospodinov, Kia Larsdotter, Jasmina Malanovic, Ahmad Sukkar, Ghita Skalli, Elena Perez, Andrea B. Caste, Lisa Cholmondeley, Douglas Chew, Larissa Henke, Steven Hatzellis, Jesse Chima, Adriano De Gioannis, Simon Kim, Stephane Carnuccini, Samer Chamoun, Ram Ahronov, Ross Langdon, Ivan Valdez, Yacira Blanco, Marta Rodriguez, Leonardo Garcia, Sevil Yazici, Renata Paim Tourinho Dantas, Hussam Chakouf.
COMPETITION TEAM: Thomas Vietzke, Achim Gergen, Martin Henn, Christina Beaumont, Yael Brosilovski, Lorenzo Grifantini, Carlos Fernando Perez, Helmut Kinzler, Viggo Haremst, Christian Ludwig, Selim Mimita, Flavio La Gioia, Nina Safainia.
CONSULTANTS:
LOCAL ARCHITECT (Design Phase): Blue Tango
LOCAL ARCHITECT (Execution Phase): Chabanne et Partenaires
STRUCTURAL ENGINEER: Ove Arup & Partners
M&E: Max Fordham and Partners (London, UK), OK Design Group
LIGHTING: Ove Arup & Partners (Concept Design), GEC Ingenierie
ACOUSTIC: Rouch Acoustique
COST: Gec LR"
Link: Homepage Zaha Hadid




Render © Zaha Hadid Architects
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 20:46 - Rubrik: Archivbau

Benutzersaal (Foto: Hans-Christian Schink)
"Sanierung und Umnutzung Schloss Freudenstein
Freiberg zum Sächsischen Bergarchiv und Mineralogische Sammlung
Bauherr: Stadt Freiberg
Die Oberbürgermeisterin, Hochbauamt
Petriplatz 7, 09599 Freiberg
Tel.: 03731-273412 Herr Eckardt
LP 2-8
Planung/Ausführung: 2005-2008
Öffentlicher Auftraggeber
Gebäudedaten: BGF 16.450 m2, BRI 59.120 m3
Mineralogische Sammlung NF 3079 m2
Sächsisches Bergarchiv NF 3265 m2
Gesamtkosten gepl. inkl. MwSt. 21.666.000,- € *KG 300+400 (nach DIN 276)
Das Bild des Schlosses und Eingang Das Schloss als städtische Dominante ist für die Stadt Freiberg prägend. Wir gehen von einer Erhaltung und Unantastbarkeit der äußeren Erscheinung aus. Alle bisherigen Umnutzungen waren mit einer Wandlung des Schlossbildes verbunden. Dem historischen Nutzungszustand werden die neuen Funktionen eingeschrieben. Lediglich die Haupterschließung erfolgt im Schlosshof durch einen monolithartigen Baukörper. Die äußere Einheit der beiden Institutionen in der Schlosskubatur findet im Inneren ohne Einschränkung der funktionalen Eigenstrukturen statt. Bergarchiv mit Lesesaal und Ausstellung sind ebenso separat erreichbar, wie Mineraliensammlung, Cafe und Vortragssaal. Verknüpfungen werden im Inneren sichtbar und geben der gewählten Raumzuordnung aller öffentlichen Bereiche eine größtmögliche Varianz. Bergarchiv und Mineralogische Sammlung reagieren auf unterschiedliche Weisen auf den Bestand. Sinnbild ist dabei die Rezeption der Tätigkeitsfelder. Geht das Archiv von der Funktion des Schützens aus, so stellt sich das Museum einer breiten Öffentlichkeit. In ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen sich beide zu einem spannungsvollen Ganzen."
Quelle: AFF-Architekten
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 20:36 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In the spirit of defending of human rights and for the activist in all of us archivists out there, this is a forum from which debate may be fomented, resolutions found, and new ideas born. All manner of information professionals are welcomed! "
Link: http://thearchivistswatch.wordpress.com/
Link: http://thearchivistswatch.wordpress.com/
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 19:20 - Rubrik: Weblogs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Cataloging A President
View more presentations from kmthomas06.
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 19:15 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stellungnahme des Vereins zu entsprechenden, städtischen Sparvorschlägen:
"Vorab einige Worte zur Kommunikationskompetenz und –kultur. Wir möchten betonen, dass es uns erstaunt, dass im Vorfeld keinerlei Kontakte oder Gespräche mit uns in dieser Angelegenheit gesucht wurden. Wenn schon von einer möglichen Zusammenarbeit, von Synergieeffekten etc. die Rede ist, dann sollte der mögliche Partner doch in die Diskussion vorab einbezogen werden, bevor solche Pläne schriftlich fixiert werden, und nicht mit einem solchen Papier überrascht werden. Deshalb sehen wir uns (wieder einmal) genötigt, in Form eines der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Schreibens Stellung zu nehmen.
Wir freuen uns, dass Kulturdezernent Schumacher in Bezug auf das Archiv von Werkstattfilm e.V. anerkennend von "unwiederbringlichen Materialien" spricht. Soviel zum Positiven. Ansonsten führt er auf, dass entgegen der getätigten Aussagen von Archivar Ahrens das Stadtarchiv auch Materialien aus dem audiovisuellen Bereich sammelt und aufarbeitet. Das ist eine neue Erkenntnis, die wir und auch andere auf dem Gebiete der Medien Tätige nicht bestätigen können.
Zudem unternimmt die Spitze der Kulturverwaltung hier zum zweiten Mal den Versuch, unter Hinweis auf die nicht adäquaten Unterbringungsmöglichkeiten das Archiv von Werkstattfilm "innerhalb des Stadtarchives" lagern zu wollen. Sie unterstellt, dass dort auch "die wissenschaftliche Auswertung des Archivgutes intensiviert" werden könne.
Werkstattfilm stellt dazu fest:
*
Das Stadtarchiv Oldenburg ist bisher auf dem Gebiet der audiovisuellen Medien nur am Rande tätig geworden und leistet auf diesem Gebiet keine qualitativ angemessene Arbeit.
*
Das Archiv von Werkstattfilm wurde in jahrelanger, gemeinnütziger (also unbezahlter) Arbeit von Werkstattfilmmitarbeitern zusammengetragen und in vielbeachteten Aktionen und Filmproduktionen der Oldenburger Öffentlichkeit vorgestellt. Zum Ankauf des Archivgutes hat die Stadt Oldenburg nichts beigetragen, die Diskussion um das im Besitz des Vereins und seiner Mitarbeiter befindliche Archivgut entbehrt also jeglicher Grundlage. Es ist uns deshalb völlig unverständlich, dass im Rahmen des Bürgerhaushaltes, in dem es um die Erhöhung des Etats von Werkstattfilm gehen sollte, der Kulturdezernent Schumacher hier Begehrlichkeiten formuliert. Wir haben schon in der Vergangenheit betont, dass auch wir die Situation in unserem Archiv als nicht hinnehmbar betrachten und haben wiederholt eine bessere Ausgestaltung beantragt. Es muss aber klar sein, dass wir unsere Archivalien nur in Räumlichkeiten unterzubringen gedenken, über die der Verein Werkstattfilm die ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE Verfügung hat und die keiner zeitlichen Beschränkung unterliegen, weil gemeinnützige Arbeit auch an Wochenenden und Abenden stattzufinden pflegt.
*
Die wissenschaftliche Auswertung des Archivgutes erfolgt derzeit und auch in Zukunft ausschließlich beim Verein Werkstattfilm. Dass wir schon in der Vergangenheit die Kooperation mit dem Stadtarchiv gepflegt haben, zeigt der Umstand, dass Schüler bei der Recherche (z.B. über Zwangsarbeit in Oldenburg) von dort an das Archiv von Werkstattfilm verwiesen wurden. Interessenten wie u.a. Studenten und Fachgruppen der Universität und Fachhochschule Oldenburg, die Oldenburger Schulen und überregional Wissenschaftler der Filmhochschule Wien und der Akademie der Künste in Berlin, Sendeanstalten (ARD, ZDF, NDR, Radio Bremen) und die Presse haben sich in der Vergangenheit nach Absprache mehrfach des Archivs bedient. Die Aussage, dass Institutionen, die bisher auf dem Gebiet der Medien eher zurückhaltend tätig waren, die wissenschaftliche Auswertung des Archivgutes "intensivieren" könnten, vermag zu überraschen.
Wir hoffen trotz dieser – vorhersehbaren – Beschlussfassung des Kulturdezernenten, dass sich der Kulturausschuss ernsthaft und sachlich mit dem Antrag des Bürgerhaushaltes befasst und sich nicht auf sachlich unsinnige und unhaltbare Nebenschauplätze abdrängen lässt. Die Verwaltung zeigt mit dieser Beschlussvorlage wieder einmal, dass die Einschätzung vieler Bürger, beim sog. Bürgerhaushalt handele es sich um eine teure Scheinveranstaltung ohne konkrete Folgen, durchaus ihre Berechtigung hat."
Quelle: http://www.werkstattfilm.de/ - dort auch weitere Materialien
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 18:53 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unter nachstehendem Link der DCMI sind Präsentationen zu Dublin Core und weiteren Metadatenkonzepten verfügbar: Material der DCMI zu Metadatenkonzepten
schwalm.potsdam - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 18:30 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://agfnz.historikerverband.de/
Zitat:
Was soll ein Weblog zur Frühen Neuzeit?
Zuallererst: nicht langweilen. Ein lebendiges und buntes (ja: bebildertes) Kaleidoskop des Fachs ist nichts, wofür man sich schämen müsste.
Sodann: Dieses Weblog versteht sich als Teil des Web 2.0. Es ist als Gemeinschaftsweblog konzipiert und für AutorInnen offen, die dieses Format im thematischen Rahmen der Frühen Neuzeit nutzen wollen. Wir freuen uns natürlich auch über sachliche und kluge Kommentare.
Digitales wird einen besonders hohen Stellenwert in diesem Blog haben. Wir wollen keine Buchbesprechungen und kommerzielle Werbung, weisen aber gern auf (seriöse) kostenlose Online-Publikationen hin.
Wir wollen nicht das Rad neu erfinden: Was H-SOZ-U-KULT besser leistet, etwa das Ankündigen von Veranstaltungen und die Mitteilung der Tagungsberichte, wollen wir nicht kopieren. Was dort fehlt, beispielsweise Hinweise zu neuen Ausstellungen oder zu einem Frühneuzeit-Video auf Youtube, ist schon eher für uns relevant.
Neben den Meldungen soll es auch Raum für Meinungen geben, für subjektive Wertungen. Frühneuzeitler sollten zu Fehlentwicklungen etwa im Bereich der Hochschulpolitik oder des Wissenschaftsbetriebs nicht schweigen, wenn diese unmittelbare Auswirkungen auf das Fach hat.
Wir sind gespannt, wie unser Experiment in Sachen Web 2.0 ankommt.
Zitat:
Was soll ein Weblog zur Frühen Neuzeit?
Zuallererst: nicht langweilen. Ein lebendiges und buntes (ja: bebildertes) Kaleidoskop des Fachs ist nichts, wofür man sich schämen müsste.
Sodann: Dieses Weblog versteht sich als Teil des Web 2.0. Es ist als Gemeinschaftsweblog konzipiert und für AutorInnen offen, die dieses Format im thematischen Rahmen der Frühen Neuzeit nutzen wollen. Wir freuen uns natürlich auch über sachliche und kluge Kommentare.
Digitales wird einen besonders hohen Stellenwert in diesem Blog haben. Wir wollen keine Buchbesprechungen und kommerzielle Werbung, weisen aber gern auf (seriöse) kostenlose Online-Publikationen hin.
Wir wollen nicht das Rad neu erfinden: Was H-SOZ-U-KULT besser leistet, etwa das Ankündigen von Veranstaltungen und die Mitteilung der Tagungsberichte, wollen wir nicht kopieren. Was dort fehlt, beispielsweise Hinweise zu neuen Ausstellungen oder zu einem Frühneuzeit-Video auf Youtube, ist schon eher für uns relevant.
Neben den Meldungen soll es auch Raum für Meinungen geben, für subjektive Wertungen. Frühneuzeitler sollten zu Fehlentwicklungen etwa im Bereich der Hochschulpolitik oder des Wissenschaftsbetriebs nicht schweigen, wenn diese unmittelbare Auswirkungen auf das Fach hat.
Wir sind gespannt, wie unser Experiment in Sachen Web 2.0 ankommt.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 17:22 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
nestor, das Kompetenznetzwerks zur digitalen Langzeitarchivierung in Deutschland, hat ein Positionspapier zum Abschlussbericht der Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation veröffentlicht.
Die Blue Ribbon Task Force (BRTF), eine anglo-amerikanische Expertengruppe, betrachtet die Archivierung digitaler Objekte nicht als rein technisches, sondern in erster Linie als sozio-ökonomisches Problem. In ihrem im Februar 2010 erschienenen Abschlussreport formuliert sie Empfehlungen, wie sich Ressourcen für die Archivierung digitaler Objekte nachhaltig mobilisieren lassen können http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf ).
Die in dem Report verhandelten Fragen stellen zwar keine umfassende Lösung für die Archivierung digitaler Objekte dar. Sie beleuchten aber einzelne Aspekte, die bislang in der deutschen Fachdiskussion kaum berücksichtigt wurden. Unter dem Dach von nestor hat sich daher eine Arbeitsgruppe mit den BRTF-Empfehlungen auseinandergesetzt und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland geprüft. Die Ergebnisse sowie eigene Empfehlungen sind in diesem Positionspapier niedergelegt und sollen Wege zur Umsetzung aufzeigen: http://files.d-nb.de/nestor/berichte/nestor_Stellungnahme_BRTF.pdf .
via Archivliste!
Die Blue Ribbon Task Force (BRTF), eine anglo-amerikanische Expertengruppe, betrachtet die Archivierung digitaler Objekte nicht als rein technisches, sondern in erster Linie als sozio-ökonomisches Problem. In ihrem im Februar 2010 erschienenen Abschlussreport formuliert sie Empfehlungen, wie sich Ressourcen für die Archivierung digitaler Objekte nachhaltig mobilisieren lassen können http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf ).
Die in dem Report verhandelten Fragen stellen zwar keine umfassende Lösung für die Archivierung digitaler Objekte dar. Sie beleuchten aber einzelne Aspekte, die bislang in der deutschen Fachdiskussion kaum berücksichtigt wurden. Unter dem Dach von nestor hat sich daher eine Arbeitsgruppe mit den BRTF-Empfehlungen auseinandergesetzt und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland geprüft. Die Ergebnisse sowie eigene Empfehlungen sind in diesem Positionspapier niedergelegt und sollen Wege zur Umsetzung aufzeigen: http://files.d-nb.de/nestor/berichte/nestor_Stellungnahme_BRTF.pdf .
via Archivliste!
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 14:02 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"In de nasleep van de bevrijding van het Belgisch grondgebied door de geallieerden in 1944 daalde de steenkoolproductie in ons land drastisch. Om dit grondstofprobleem structureel aan te pakken, rijpte in regeringskringen het plan om 60.000 Duitse krijgsgevangenen, verspreid over Britse en Amerikaanse kampen op Belgisch grondgebied, in te zetten voor de heropleving van de Belgische industrie. Deze unieke en kortstondige operatie, die reeds begin 1948 werd beëindigd en vaak bekend staat als “de steenkolenslag”, was nochtans van cruciaal belang voor de economische heropleving van België. De uitvoering van deze complexe operatie vereiste een minutieuze coördinatie tussen verschillende militaire en ministeriële diensten. In de praktijk speelden twee instellingen een vooraanstaande rol: enerzijds de Dienst voor Krijgsgevangenen Afdeling B, een beheersorgaan met militair personeel dat ressorteerde onder het Ministerie van Landsverdediging (later onder Economische Zaken), anderzijds het Hoger Commando der Krijgsgevangenenkampen, het hoogste militaire gezagsorgaan achter de kampen waarin de Duitse krijgsgevangenen verbleven.
Mettertijd werden de archieven van beide diensten opgesplitst: één onderdeel werd via Landsverdediging overgebracht in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, terwijl een tweede gedeelte via het voormalige Ministerie van Economische Zaken op het Algemeen Rijksarchief belandde. Dit laatste onderdeel werd onlangs geïnventariseerd en is voortaan vrij raadpleegbaar. Wat de Dienst voor Krijgsgevangenen betreft, bevatten de archieven vooral boekhoudkundige stukken die toelaten om de financiële implicaties van de “steenkolenslag” na te gaan over de jaren 1945-1954. Tevens werpen deze stukken een nieuw licht op het dagelijks leven binnen de krijgsgevangenenkampen (zoals de aanschaf van werkmateriaal, voedings- en geneesmiddelen of de bezoldiging van aalmoezeniers en mecaniciens).
Het archiefbestand afkomstig van het Hoger Commando der Krijgsgevangenen bestaat voornamelijk uit dossiers die een gedetailleerd beeld geven van de infrastructuur van de kampen en van eventuele incidenten die zich tijdens de eigenlijke operatie voordeden.
In beide inventarissen wordt ook stilgestaan bij de complementaire archiefbestanden bewaard door het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. De inventarissen zijn te koop in de shop van het Algemeen Rijksarchief of kunnen worden besteld via mail ( publicat@arch.be Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken ):
STRUBBE Filip, Inventaris van het archief van de Dienst voor Krijgsgevangenen Afdeling B afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken (1945-1954), Brussel, Algemeen Rijksarchief (Inventarissen, 486), 2010, Publ 4862, 4 euro"
Quelle: Het Rijksarchief in Belgie
Wolf Thomas - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 12:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://library.duke.edu/blogs/scholcomm/2010/10/01/going-forward-with-georgia-state-lawsuit/
Good news for fair use!
Good news for fair use!
KlausGraf - am Dienstag, 5. Oktober 2010, 01:09 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sächsisches Hauptstaatsarchiv

Magazinanbau

Archiv mit Ecken und Kanten

Mythos Palace - Stadtarchiv Dresden



Noch ein Archiv mit Ecken und Kanten

MDR, Landesstudio Sachsen, Archiv Servive


Sächsische Archivlöwen


Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 22:17 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Sohn des Architekten Kunz Nierade (1901-1976), Stephan Nierade, übergab am heutigen Donnerstag den Nachlass seines Vaters an das Stadtarchiv Leipzig. Kunz Nierade verewigte sich in Leipzig insbesondere durch seinen Entwurf, nach dem die Leipziger Oper erbaut wurde.
Der Nachlass Nierades besteht aus schriftlichen Aufzeichnungen zur beruflichen Tätigkeit Kunz Nierades sowie aus rund tausend Plänen und Entwürfen zu verschiedenen Bauprojekten, Materialsammlungen, Fotos, Diapositiven, künstlerischen Studien und Zeichnungen. Zeitlich erstreckt er sich von 1923 bis 1976. Für die Leipziger Architektur- und Stadtgeschichte ist er aus mehreren Gründen von hoher Bedeutung. Zum einen sind kaum Nachlässe von Privatarchitekten in Leipzig überliefert, so dass sich deren Schaffen und das private Bauen allgemein nur sehr schwer nachvollziehen lassen. Hier verspricht der Nachlass weiteren Aufschluss. Zudem stand zwischen 1945 und 1989 das kollektive Planen und Entwerfen im Vordergrund, so dass der Einzelne hinter der Gesamtleistung zurücktrat und in der Öffentlichkeit nur das Gesamtergebnis wahrgenommen wurde.
Neben dem Bau der Leipziger Oper war Nierade auch maßgeblich am Bau der DHfK beteiligt, in den letzten Baujahren leitete Nierade den Baubetrieb vor Ort. Auch das Grab Johann Sebastian Bachs in der Thomaskirche wurde nach seinem Entwurf gestaltet.
Nach seinem Umzug nach Berlin im Jahr 1960 gehörten unter anderem das DDR-Außenministerium sowie der Umbau der Komischen Oper Berlin zu seinen Projekten.
Die jetzt dem Stadtarchiv übergebenen Unterlagen werden nun erschlossen, wobei jedes einzelne Stück mit seinen Merkmalen in eine Datenbank aufgenommen und beschrieben wird. Gleichzeitig erfolgen Forschungen zur Biografie. Die Ergebnisse werden in einem Findbuch zusammengestellt, das nach Abschluss der Arbeiten im Lesesaal einsehbar sein wird. Der Nachlass wird somit öffentlich zugänglich und für Interessierte und Wissenschaftler gleichermaßen nutzbar.
Quelle: Leipzigseiten.de, 30.9.2010
Der Nachlass Nierades besteht aus schriftlichen Aufzeichnungen zur beruflichen Tätigkeit Kunz Nierades sowie aus rund tausend Plänen und Entwürfen zu verschiedenen Bauprojekten, Materialsammlungen, Fotos, Diapositiven, künstlerischen Studien und Zeichnungen. Zeitlich erstreckt er sich von 1923 bis 1976. Für die Leipziger Architektur- und Stadtgeschichte ist er aus mehreren Gründen von hoher Bedeutung. Zum einen sind kaum Nachlässe von Privatarchitekten in Leipzig überliefert, so dass sich deren Schaffen und das private Bauen allgemein nur sehr schwer nachvollziehen lassen. Hier verspricht der Nachlass weiteren Aufschluss. Zudem stand zwischen 1945 und 1989 das kollektive Planen und Entwerfen im Vordergrund, so dass der Einzelne hinter der Gesamtleistung zurücktrat und in der Öffentlichkeit nur das Gesamtergebnis wahrgenommen wurde.
Neben dem Bau der Leipziger Oper war Nierade auch maßgeblich am Bau der DHfK beteiligt, in den letzten Baujahren leitete Nierade den Baubetrieb vor Ort. Auch das Grab Johann Sebastian Bachs in der Thomaskirche wurde nach seinem Entwurf gestaltet.
Nach seinem Umzug nach Berlin im Jahr 1960 gehörten unter anderem das DDR-Außenministerium sowie der Umbau der Komischen Oper Berlin zu seinen Projekten.
Die jetzt dem Stadtarchiv übergebenen Unterlagen werden nun erschlossen, wobei jedes einzelne Stück mit seinen Merkmalen in eine Datenbank aufgenommen und beschrieben wird. Gleichzeitig erfolgen Forschungen zur Biografie. Die Ergebnisse werden in einem Findbuch zusammengestellt, das nach Abschluss der Arbeiten im Lesesaal einsehbar sein wird. Der Nachlass wird somit öffentlich zugänglich und für Interessierte und Wissenschaftler gleichermaßen nutzbar.
Quelle: Leipzigseiten.de, 30.9.2010
Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 22:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 21:56 - Rubrik: Veranstaltungen
" .... * I will recognize that the universe of information culture is changing fast and that archives need to respond positively to these changes to provide resources and services that users need and want.
* I will educate myself about the information culture of my users and look for ways to incorporate what I learn into the services my archives provides.
* I will not be defensive about my archives, but will look clearly at its situation and make an honest assessment about what can be accomplished.
* I will become an active participant in moving my archives forward.
* I will recognize that archives change slowly, and will work with my colleagues to expedite our responsiveness to change.
* I will be courageous about proposing new services and new ways of providing services, even though some of my colleagues will be resistant.
* I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users.
* I will let go of previous practices if there is a better way to do things now, even if these practices once seemed so great.
* I will take an experimental approach to change and be willing to make mistakes.
* I will not wait until something is perfect before I release it, and I’ll modify it based on user feedback.
* I will not fear Google or related services, but rather will take advantage of these services to benefit users while also providing excellent services that users need.
* I will avoid requiring users to see things in archivists’ terms but rather will shape services to reflect users’ preferences and expectations.
* I will be willing to go where users are, both online and in physical spaces, to practice my profession.
* I will create open Web sites that allow users to join with archivists to contribute content in order to enhance their learning experience and provide assistance to their peers.
* I will lobby for an open catalog that provides personalized, interactive features that users expect in online information environments.
* I will encourage professional blogging in my archives.
* I will validate, through my actions, archivists’ vital and relevant professional role in any type of information culture that evolves. ..."
Link
* I will educate myself about the information culture of my users and look for ways to incorporate what I learn into the services my archives provides.
* I will not be defensive about my archives, but will look clearly at its situation and make an honest assessment about what can be accomplished.
* I will become an active participant in moving my archives forward.
* I will recognize that archives change slowly, and will work with my colleagues to expedite our responsiveness to change.
* I will be courageous about proposing new services and new ways of providing services, even though some of my colleagues will be resistant.
* I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users.
* I will let go of previous practices if there is a better way to do things now, even if these practices once seemed so great.
* I will take an experimental approach to change and be willing to make mistakes.
* I will not wait until something is perfect before I release it, and I’ll modify it based on user feedback.
* I will not fear Google or related services, but rather will take advantage of these services to benefit users while also providing excellent services that users need.
* I will avoid requiring users to see things in archivists’ terms but rather will shape services to reflect users’ preferences and expectations.
* I will be willing to go where users are, both online and in physical spaces, to practice my profession.
* I will create open Web sites that allow users to join with archivists to contribute content in order to enhance their learning experience and provide assistance to their peers.
* I will lobby for an open catalog that provides personalized, interactive features that users expect in online information environments.
* I will encourage professional blogging in my archives.
* I will validate, through my actions, archivists’ vital and relevant professional role in any type of information culture that evolves. ..."
Link
Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 21:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... 3. Anregungen und Denkanstöße: Archive und Web 2.0
Mit den eben genannten bayerischen Richtlinien zur Erschließung ist bereits Pt. 3 angeschnitten. Die Richtlinien sind ein Anstoß für eine moderne, an der archivischen Realität ausgerichtete Erschließung. Es sollen nun abschließend verschiedene Anregungen erfolgen, mit welchen (weiteren) Methoden die Praxis der Erschließung ergänzt und der Erschließungsstand in den Archiven verbessert werden kann bzw. könnte. Zunächst seien Digitalisate und Online-Präsentationen genannt: Bedenkt man, dass mehr und mehr neben den Erschließungsdaten auch die Archivalien selbst im Netz zu betrachten sind, so spielt dann die Intensität der Verzeichnung bei weitem keine so große Rolle mehr. Ein Beispiel: Im bekannten virtuellen Urkundenarchiv 'Monasterium' ( http://www.monasterium.net ), das ja über 190.000 Urkunden bietet, reichen dem Benutzer kurze Angaben zu den Urkunden; die Weiterarbeit kann von zuhause aus am 'Original' erfolgen. Nur durch die Beschränkung auf kurze Angaben (Kurzregesten) sind die derzeit laufenden, umfangreichen Digitalisierungsprojekte der staatlichen Archive Bayerns im Bereich der Urkunden überhaupt realisierbar. Das Stichwort 'Archive und Web 2.0' verweist auf einen Bereich, der leider von vielen Kollegen noch sehr stiefmütterlich beackert oder gemieden wird. Beiträge oder gar Tagungen zum Thema sind eine große Ausnahme. Web 2.0 als Schlagwort für kollaborative und interaktive Elemente bzw. Anwendungen im Netz bietet eine ganze Reihe positiver Effekte auch für kulturelle Einrichtungen. Dies gilt keineswegs nur für die Öffentlichkeitswahrnehmung der Einrichtungen, die Erweiterung des Zielgruppenspektrums oder die Eröffnung neuer Kommunikationswege: Gerade die Teilung bzw. Produktion von Wissen und die 'Kollaboration' bieten auch Raum für Erschließungsleistungen oder die Ergänzung und Anreicherung der vom Archiv zur Verfügung gestellten Metadaten. Vieles befindet sich derzeit in einer Experimentierphase, manches wird im Sinn des 'try and error' zweifellos nicht weiter geführt werden. Als Anwendungen kommen, ohne dass diese Aufzählung abschließend gemeint ist, insbesondere Wikis und andere kollaborative Werkzeuge, Blogs, soziale Netzwerke wie Facebook, Portale für Fotos/Videos u.ä., aber auch neue Kommunikationsformen wie Twitter in Betracht. Zur Verdeutlichung werden mehrere Beispiele angeführt:
* Wiki 'Your archives' der National archives (UK): Der Wiki enthält mehrere Tausend Artikel mit Bezug zur britischen Geschichte sowie mit Bezug zu den Archivalien des Archivs. Er steht unabhängig zum regulären Webauftritt des Archivs; ein Ziel ist, dass die Benutzer des Archivs ihr Wissen über die Archivalien in den Wiki einbringen sollen. ( http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk )
* 'Monasterium': Kollaboratives Werkzeug 'MOM CA' (bzw. 'EditMOM') zur (Online-)Bearbeitung von Urkunden. Im Rahmen eines DFG-Projekts ('Virtuelles deutsches Urkundennetzwerk') soll ab dem Spätjahr 2010 'MOM CA' zu einer virtuellen Forschungsumgebung ausgebaut werden, namentlich unter Beteiligung historischer Forschungseinrichtungen sowie einer Reihe von Archiven. Das Werkzeug wird derzeit immerhin bereits an mehreren Universitäten in der Lehre eingesetzt und auch einige Archive arbeiten bereits damit. ( http://www.mom-ca.uni-koeln.de/MOM-CA/start.do )
* Flickr: Flickr ist ein sehr erfolgreiches Portal für die Präsentation und das Teilen von digitalen Bildern. Der Schritt ist dann natürlich nicht weit vom 'Teilen' zur Anreicherung der eingestellten Bilder mit ergänzenden Informationen. Dieses Ziel wird im 'Commons-Projekt' dezidiert verfolgt, das Flickr im Jahr 2008 zunächst mit der Library of Congress gestartet hatte. Zu den Hauptzielen des Projekts, an dem eine ganze Reihe großer Bibliotheken, Archive und Museen teilnehmen (unter den wenigen europäischen Partnern sei wenigstens das Nationalarchiv der Niederlande hervorgehoben), zählt neben der Verbesserung des Zugriffs auf Fotos namentlich auch die Möglichkeit, Informationen und Wissen zu den Fotos beizutragen. Die teilnehmenden Institutionen geben an, dass keine Urheberrechtsbeschränkungen bei den Fotos bekannt sind, eine Garantie bezüglich der Gemeinfreiheit der Fotos ist damit jedoch nicht verbunden. ( http://www.flickr.com/commons/usage/ )
* Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia: Das Bundesarchiv verfügt über 11 Millionen Bilddokumente, von denen derzeit über 200.000 Stücke im Rahmen eines Bildarchivs im Netz präsentiert werden. Ca. 80.000 Bilder stehen zusätzlich über Wikipedia (Wikimedia Commons) zur Verfügung. Die Zahl der Benutzer hat sich seit Bekanntwerden der Kooperation verdoppelt (!). ( http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/de )
* Schließlich sei noch das soziale Netzwerk Facebook angeführt: Facebook-Auftritte von Archiven nehmen mittlerweile immer mehr zu (dies gilt leider noch nicht für deutsche Archive). Gewichtige Beispiele sind die jeweiligen Nationalarchive von Großbritannien, Australien und den USA (sowie z.B. die nationalen Archive Österreichs, Rumäniens und der Slowakei). Die Netzwerkbildung funktioniert allem Anschein nach gut, die Zahl der 'Freunde' geht teilweise in die Tausende. Solche sozialen Netzwerke erfordern natürlich eine große und auch aktive Nutzergemeinschaft, aber dies scheint zumindest bei größeren Einrichtungen gegeben zu sein. Und so können durch die Benutzer zum Beispiel auch neue Findmittel kommentiert werden, die Nutzer des Archivs diskutieren und informieren sich gegenseitig in eigenen Forschergruppen bzw. umgekehrt: das Archiv stellt die Frage, wer bei der Verzeichnung eines ungewöhnlichen Archivales helfen kann (Beispiel von der Facebookseite des Österreichischen Staatsarchivs: Nachfrage, wer die Wappenabbildung auf einer böhmischen Urkunde des Haus-, Hof- und Staatsarchivs beschreiben kann).
Es gilt für diese Beispiele wie auch sonst: Je umfassender die Archivalien oder zumindest die Findmittel digital und online vorgehalten werden, desto mehr können auch die Benutzer 'helfend' einspringen, die Quellen auswerten und eben die Verzeichnung ergänzen oder verbessern! Eine Gesamtdigitalisierung der Archivalien, wie sie von Vertretern der historischen Fachinformatik für die Zukunft 'gefordert' wird, wird sich nicht realisieren lassen. Und dies ist natürlich nicht der einzige Haken an der Sache. Die meisten genannten Anwendungen beziehen sich auf (archivisches, museales usw.) Sammlungsgut, weit weniger auf das originär provenienzgebundene Archivgut (wie Aktenbestände). Eine gewichtige Frage ist schließlich auch, wie groß der Aufwand ist, den ein Archiv in die neuen Technologien investieren kann und will. Dass sich aber eine verbesserte Erschließung, Aufwand des Archivs und eine gesteigerte Öffentlichkeitswahrnehmung im Sinn des Web 2.0 gut gegeneinander aufrechnen lassen und sich der Aufwand lohnt: dies steht außer Zweifel und macht optimistisch für die Zukunft."
Quelle: Homepage der EDV-Tage Theuern 2010
Link zur Powerpoint-Präsentation des Vortrages (PDF)
Mit den eben genannten bayerischen Richtlinien zur Erschließung ist bereits Pt. 3 angeschnitten. Die Richtlinien sind ein Anstoß für eine moderne, an der archivischen Realität ausgerichtete Erschließung. Es sollen nun abschließend verschiedene Anregungen erfolgen, mit welchen (weiteren) Methoden die Praxis der Erschließung ergänzt und der Erschließungsstand in den Archiven verbessert werden kann bzw. könnte. Zunächst seien Digitalisate und Online-Präsentationen genannt: Bedenkt man, dass mehr und mehr neben den Erschließungsdaten auch die Archivalien selbst im Netz zu betrachten sind, so spielt dann die Intensität der Verzeichnung bei weitem keine so große Rolle mehr. Ein Beispiel: Im bekannten virtuellen Urkundenarchiv 'Monasterium' ( http://www.monasterium.net ), das ja über 190.000 Urkunden bietet, reichen dem Benutzer kurze Angaben zu den Urkunden; die Weiterarbeit kann von zuhause aus am 'Original' erfolgen. Nur durch die Beschränkung auf kurze Angaben (Kurzregesten) sind die derzeit laufenden, umfangreichen Digitalisierungsprojekte der staatlichen Archive Bayerns im Bereich der Urkunden überhaupt realisierbar. Das Stichwort 'Archive und Web 2.0' verweist auf einen Bereich, der leider von vielen Kollegen noch sehr stiefmütterlich beackert oder gemieden wird. Beiträge oder gar Tagungen zum Thema sind eine große Ausnahme. Web 2.0 als Schlagwort für kollaborative und interaktive Elemente bzw. Anwendungen im Netz bietet eine ganze Reihe positiver Effekte auch für kulturelle Einrichtungen. Dies gilt keineswegs nur für die Öffentlichkeitswahrnehmung der Einrichtungen, die Erweiterung des Zielgruppenspektrums oder die Eröffnung neuer Kommunikationswege: Gerade die Teilung bzw. Produktion von Wissen und die 'Kollaboration' bieten auch Raum für Erschließungsleistungen oder die Ergänzung und Anreicherung der vom Archiv zur Verfügung gestellten Metadaten. Vieles befindet sich derzeit in einer Experimentierphase, manches wird im Sinn des 'try and error' zweifellos nicht weiter geführt werden. Als Anwendungen kommen, ohne dass diese Aufzählung abschließend gemeint ist, insbesondere Wikis und andere kollaborative Werkzeuge, Blogs, soziale Netzwerke wie Facebook, Portale für Fotos/Videos u.ä., aber auch neue Kommunikationsformen wie Twitter in Betracht. Zur Verdeutlichung werden mehrere Beispiele angeführt:
* Wiki 'Your archives' der National archives (UK): Der Wiki enthält mehrere Tausend Artikel mit Bezug zur britischen Geschichte sowie mit Bezug zu den Archivalien des Archivs. Er steht unabhängig zum regulären Webauftritt des Archivs; ein Ziel ist, dass die Benutzer des Archivs ihr Wissen über die Archivalien in den Wiki einbringen sollen. ( http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk )
* 'Monasterium': Kollaboratives Werkzeug 'MOM CA' (bzw. 'EditMOM') zur (Online-)Bearbeitung von Urkunden. Im Rahmen eines DFG-Projekts ('Virtuelles deutsches Urkundennetzwerk') soll ab dem Spätjahr 2010 'MOM CA' zu einer virtuellen Forschungsumgebung ausgebaut werden, namentlich unter Beteiligung historischer Forschungseinrichtungen sowie einer Reihe von Archiven. Das Werkzeug wird derzeit immerhin bereits an mehreren Universitäten in der Lehre eingesetzt und auch einige Archive arbeiten bereits damit. ( http://www.mom-ca.uni-koeln.de/MOM-CA/start.do )
* Flickr: Flickr ist ein sehr erfolgreiches Portal für die Präsentation und das Teilen von digitalen Bildern. Der Schritt ist dann natürlich nicht weit vom 'Teilen' zur Anreicherung der eingestellten Bilder mit ergänzenden Informationen. Dieses Ziel wird im 'Commons-Projekt' dezidiert verfolgt, das Flickr im Jahr 2008 zunächst mit der Library of Congress gestartet hatte. Zu den Hauptzielen des Projekts, an dem eine ganze Reihe großer Bibliotheken, Archive und Museen teilnehmen (unter den wenigen europäischen Partnern sei wenigstens das Nationalarchiv der Niederlande hervorgehoben), zählt neben der Verbesserung des Zugriffs auf Fotos namentlich auch die Möglichkeit, Informationen und Wissen zu den Fotos beizutragen. Die teilnehmenden Institutionen geben an, dass keine Urheberrechtsbeschränkungen bei den Fotos bekannt sind, eine Garantie bezüglich der Gemeinfreiheit der Fotos ist damit jedoch nicht verbunden. ( http://www.flickr.com/commons/usage/ )
* Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia: Das Bundesarchiv verfügt über 11 Millionen Bilddokumente, von denen derzeit über 200.000 Stücke im Rahmen eines Bildarchivs im Netz präsentiert werden. Ca. 80.000 Bilder stehen zusätzlich über Wikipedia (Wikimedia Commons) zur Verfügung. Die Zahl der Benutzer hat sich seit Bekanntwerden der Kooperation verdoppelt (!). ( http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/de )
* Schließlich sei noch das soziale Netzwerk Facebook angeführt: Facebook-Auftritte von Archiven nehmen mittlerweile immer mehr zu (dies gilt leider noch nicht für deutsche Archive). Gewichtige Beispiele sind die jeweiligen Nationalarchive von Großbritannien, Australien und den USA (sowie z.B. die nationalen Archive Österreichs, Rumäniens und der Slowakei). Die Netzwerkbildung funktioniert allem Anschein nach gut, die Zahl der 'Freunde' geht teilweise in die Tausende. Solche sozialen Netzwerke erfordern natürlich eine große und auch aktive Nutzergemeinschaft, aber dies scheint zumindest bei größeren Einrichtungen gegeben zu sein. Und so können durch die Benutzer zum Beispiel auch neue Findmittel kommentiert werden, die Nutzer des Archivs diskutieren und informieren sich gegenseitig in eigenen Forschergruppen bzw. umgekehrt: das Archiv stellt die Frage, wer bei der Verzeichnung eines ungewöhnlichen Archivales helfen kann (Beispiel von der Facebookseite des Österreichischen Staatsarchivs: Nachfrage, wer die Wappenabbildung auf einer böhmischen Urkunde des Haus-, Hof- und Staatsarchivs beschreiben kann).
Es gilt für diese Beispiele wie auch sonst: Je umfassender die Archivalien oder zumindest die Findmittel digital und online vorgehalten werden, desto mehr können auch die Benutzer 'helfend' einspringen, die Quellen auswerten und eben die Verzeichnung ergänzen oder verbessern! Eine Gesamtdigitalisierung der Archivalien, wie sie von Vertretern der historischen Fachinformatik für die Zukunft 'gefordert' wird, wird sich nicht realisieren lassen. Und dies ist natürlich nicht der einzige Haken an der Sache. Die meisten genannten Anwendungen beziehen sich auf (archivisches, museales usw.) Sammlungsgut, weit weniger auf das originär provenienzgebundene Archivgut (wie Aktenbestände). Eine gewichtige Frage ist schließlich auch, wie groß der Aufwand ist, den ein Archiv in die neuen Technologien investieren kann und will. Dass sich aber eine verbesserte Erschließung, Aufwand des Archivs und eine gesteigerte Öffentlichkeitswahrnehmung im Sinn des Web 2.0 gut gegeneinander aufrechnen lassen und sich der Aufwand lohnt: dies steht außer Zweifel und macht optimistisch für die Zukunft."
Quelle: Homepage der EDV-Tage Theuern 2010
Link zur Powerpoint-Präsentation des Vortrages (PDF)
Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 21:35 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 4. Oktober 2010, 21:18 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neben der "regulären" Produktion des Münchner Digitalisierungszentrums gibt es noch die von der BSB bereitgestellten Google-Digitalisate, die zwar eine URN haben, bei denen aber die Einzelseiten keine dauerhafte Adresse haben.
Diese Digitalisate sind weder in einem RSS-Feed noch über OAI-PMH via BASE recherchierbar.
Im Gateway Bayern, dem Bayerischen Verbundkatalog, findet man bei der Eingabe von Einzinger und der Einschränkung auf Einzing von Einzinger und Online_Ressourcen 15 Titel, alle von der BSB, teilweise doppelt, digitalisiert. Man findet dort NICHT das Digitalisat der UB München.
Im OPACPLUS, dem Katalog der BSB, findet man bei gleichem Vorgehen ebenfalls 15 Titel, aber nicht den Bayerischen Löw und die Adelshistorie. Diese erscheinen aber in der Trefferliste mit Einzinger und Online-Sucheinschränkung. Klickt man auf den Autorenlink bei dem Löw, so ergeben sich 23 Treffer.
Wie ist das zu erklären?
Diese Digitalisate sind weder in einem RSS-Feed noch über OAI-PMH via BASE recherchierbar.
Im Gateway Bayern, dem Bayerischen Verbundkatalog, findet man bei der Eingabe von Einzinger und der Einschränkung auf Einzing von Einzinger und Online_Ressourcen 15 Titel, alle von der BSB, teilweise doppelt, digitalisiert. Man findet dort NICHT das Digitalisat der UB München.
Im OPACPLUS, dem Katalog der BSB, findet man bei gleichem Vorgehen ebenfalls 15 Titel, aber nicht den Bayerischen Löw und die Adelshistorie. Diese erscheinen aber in der Trefferliste mit Einzinger und Online-Sucheinschränkung. Klickt man auf den Autorenlink bei dem Löw, so ergeben sich 23 Treffer.
Wie ist das zu erklären?
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 18:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rambow.de/bayerischer-loew.html
http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Martin_Maximilian_Einzinger_von_Einzing

http://de.wikisource.org/wiki/Johann_Martin_Maximilian_Einzinger_von_Einzing

KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 16:59 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://people.pwf.cam.ac.uk/mjw65/BAPLAR/Archive
Die Urheber selbst waren leider verhindert, die Werke einzusprechen ...
Die Urheber selbst waren leider verhindert, die Werke einzusprechen ...
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 16:21 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 15:22 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13291/
Der Aufsatz von Otto Volk aus dem Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 1997 steht nun Open Access zur Verfügung.
Der Aufsatz von Otto Volk aus dem Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 1997 steht nun Open Access zur Verfügung.
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 15:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein "schönes" Gruppenfoto stelle ich mir so vor:
Wolrad Prinz zu Schaumburg Lippe mit Ehefrau Bathildis;
SS Obersturmbannführer Stephan Prinz zu Schaumburg Lippe mit Ehefrau Ingeborg Alix (SS Landesbeauftragte Süd Böhmen und Mähren); die Schwester von Ingeborg Alix, Altburg mit Ehemann Josias zu Waldeck und Pyrmont, Adjutant von Himmler und Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF); die dritte Schwester, Sophie Carlotte mit SA Oberführer Harald von Hedemann; Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe, Adjutant von Goebbels mit Ehefrau und Gestapo Denuntiantin Alexandra Gräfin zu Castell-Rüdenhausen. Soweit die "Familie".
Einige "Freunde" dazu:
Heinrich Himmler, Josef Goebbels, Graf Pückler-Burghauss, Reinhard Heydrich; Kurt von Behr; Hans Kammler..., Otto Fürst von Bismarck, Carl Eduard Herzog von Sachsen Coburg, Präsident des DRK. Es fehlen bestimmt noch einige.
Vierprinzen
Wolrad Prinz zu Schaumburg Lippe mit Ehefrau Bathildis;
SS Obersturmbannführer Stephan Prinz zu Schaumburg Lippe mit Ehefrau Ingeborg Alix (SS Landesbeauftragte Süd Böhmen und Mähren); die Schwester von Ingeborg Alix, Altburg mit Ehemann Josias zu Waldeck und Pyrmont, Adjutant von Himmler und Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF); die dritte Schwester, Sophie Carlotte mit SA Oberführer Harald von Hedemann; Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe, Adjutant von Goebbels mit Ehefrau und Gestapo Denuntiantin Alexandra Gräfin zu Castell-Rüdenhausen. Soweit die "Familie".
Einige "Freunde" dazu:
Heinrich Himmler, Josef Goebbels, Graf Pückler-Burghauss, Reinhard Heydrich; Kurt von Behr; Hans Kammler..., Otto Fürst von Bismarck, Carl Eduard Herzog von Sachsen Coburg, Präsident des DRK. Es fehlen bestimmt noch einige.
Vierprinzen
vom hofe - am Montag, 4. Oktober 2010, 08:52 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 03:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bände 1-10 der geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift aus Dorpat im "Magazin"-Programm von Google einsehbar:
http://books.google.com/books/serial/8H0LtOM5vncC?rview=0&source=gbs_navlinks_s
Aus Estland stehen dort an weiteren wissenschaftlichen Zeitschriften ebenfalls bereit: Estonian Journal of Archaeology, Linguistica Uralica und Trames.
http://books.google.com/books/serial/8H0LtOM5vncC?rview=0&source=gbs_navlinks_s
Aus Estland stehen dort an weiteren wissenschaftlichen Zeitschriften ebenfalls bereit: Estonian Journal of Archaeology, Linguistica Uralica und Trames.
KlausGraf - am Montag, 4. Oktober 2010, 01:38
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christan Hümmeler berichtert im Kölner Stadt-Anzeiger:
" .... Es sollte wohl eine richtig nette kölsche Feier werden: Der Jugendchor St. Stefan sang gleich zum Auftakt vom Veedel und von den Beulen und Schrammen, die man wieder zusammenflickt, während die Besucher in Scharen in die angestaubte Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums strömten. Und dort in drangvoller Enge, zwischen Vitrinen, Schautafeln und Säulen auf Treppen und Absätzen, auf Bürostühlen und Hockern eng zusammenrückten. .... Erst Isabel Pfeiffer-Poensgen, die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, vertrieb die Feierlaune. Und sorgte mit einer für solche Anlässe ungewöhnlich deutlichen Kritik am aktuellen Gebaren der Stadt für die richtige Einordnung wie für eine dem Anlass angemessenere Grundstimmung: Man dürfe sich keineswegs auf den Bergungserfolgen ausruhen, bei der Bearbeitung der Fundsachen stehe man schließlich ganz am Anfang. Umso unerklärlicher sei daher, dass die bereits am Tag des Einsturzes von der Kulturstiftung bereitgestellten Mittel für eine Gefriertrocknungsanlage - unentbehrlich für die vom Grundwasser durchnässten Archivalien - bis heute von der Stadt nicht abgerufen worden seien. Es heiße, ein passender Raum stehe noch nicht zur Verfügung, so Pfeiffer-Poensgen: „Das ist mir völlig unverständlich.“ .... Großen Beifall bekam Feuerwehrchef Stefan Neuhoff, der für seine umsichtige Einsatzleitung mit dem goldenen Ehrenzeichen des Technischen Hilfswerks ausgezeichnet wurde.
Und dann wurde es doch wieder kölsch-gemütlich - viel gefehlt hätte nicht, und mancher im Saal hätte gar das Schunkeln begonnen. ...."
" .... Es sollte wohl eine richtig nette kölsche Feier werden: Der Jugendchor St. Stefan sang gleich zum Auftakt vom Veedel und von den Beulen und Schrammen, die man wieder zusammenflickt, während die Besucher in Scharen in die angestaubte Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums strömten. Und dort in drangvoller Enge, zwischen Vitrinen, Schautafeln und Säulen auf Treppen und Absätzen, auf Bürostühlen und Hockern eng zusammenrückten. .... Erst Isabel Pfeiffer-Poensgen, die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, vertrieb die Feierlaune. Und sorgte mit einer für solche Anlässe ungewöhnlich deutlichen Kritik am aktuellen Gebaren der Stadt für die richtige Einordnung wie für eine dem Anlass angemessenere Grundstimmung: Man dürfe sich keineswegs auf den Bergungserfolgen ausruhen, bei der Bearbeitung der Fundsachen stehe man schließlich ganz am Anfang. Umso unerklärlicher sei daher, dass die bereits am Tag des Einsturzes von der Kulturstiftung bereitgestellten Mittel für eine Gefriertrocknungsanlage - unentbehrlich für die vom Grundwasser durchnässten Archivalien - bis heute von der Stadt nicht abgerufen worden seien. Es heiße, ein passender Raum stehe noch nicht zur Verfügung, so Pfeiffer-Poensgen: „Das ist mir völlig unverständlich.“ .... Großen Beifall bekam Feuerwehrchef Stefan Neuhoff, der für seine umsichtige Einsatzleitung mit dem goldenen Ehrenzeichen des Technischen Hilfswerks ausgezeichnet wurde.
Und dann wurde es doch wieder kölsch-gemütlich - viel gefehlt hätte nicht, und mancher im Saal hätte gar das Schunkeln begonnen. ...."
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 22:23 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 22:13 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 22:08 - Rubrik: Unterhaltung
" 1378(km) wird kommen! Demnächst wird eine Beta-Version mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren veröffentlicht mit dem Ziel, das Spiel nach einer Testphase anhand von Feedback zu überarbeiten. Im Rahmen einer öffentlichen Diskussion mit hochkarätigen Gästen an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe Anfang Dezember wird dann die endgültige Version veröffentlich.
Auf Grund der „widerwärtigen“ Berichterstattung der BILD-Zeitung („Wird das widerwärtige DDR-Ballerspiel verboten?“, BILD-Online v. 29.09.2010) ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, den Veröffentlichungs- und Präsentationstermin am 3. Oktober einzuhalten, da eine sachliche Diskussion im Augenblick nicht möglich ist.
Ein wesentlicher Teil der Kritik bezieht sich auch auf das von mir gewählte Medium Computerspiel. Über Computerspiele als Medium wird zu schnell geurteilt ohne diese genauer zu betrachten. Und so ist es auch bei meinem Kunstprojekt. Es soll dazu dienen, einer jungen Generation mit Hilfe ihres Leitmediums interaktiven Zugang zur jüngsten deutschen Geschichte zu ermöglichen. Mich freut die rege Diskussion und der positive Zuspruch, der meinem Spiel auch zukommt.
An dieser Stelle soll auch klar gestellt werden, dass es sich bei 1378(km) nicht um ein eigenständiges Spiel, sondern um eine kostenlose Modifikation von „Half-life 2: Deathmatch“ handelt, wonach sich auch die oben erwähnte Altersfreigabe richtet.
Im Computerspiel habe ich – anders als beispielweise in einem Dokumentarfilm – selbst die Kontrolle über mein Verhalten und meine Reaktionen auf in Echtzeit stattfindende und sich verändernde Situationen. Das Spiel 1378(km) zwingt in der Rolle des „Grenzsoldaten“ nicht, „Flüchtlinge“ zu erschießen. Es lässt Wahlmöglichkeiten. Gewinnen kann man bei 1378(km) nur, wenn man nicht schießt. Die Regeln des Spiels sind von der innerdeutschen Grenzsituation inspiriert. Grenzanlagen, Todesstreifen und Schießbefehl machen die Brutalität des Spiels aus.
Dass sich Opfer der Todesgrenze oder deren Angehörige verletzt fühlen, bedauere ich zutiefst. Es war keineswegs meine Absicht jemanden zu verletzen.
Jens M. Stober "
Link
Auf Grund der „widerwärtigen“ Berichterstattung der BILD-Zeitung („Wird das widerwärtige DDR-Ballerspiel verboten?“, BILD-Online v. 29.09.2010) ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, den Veröffentlichungs- und Präsentationstermin am 3. Oktober einzuhalten, da eine sachliche Diskussion im Augenblick nicht möglich ist.
Ein wesentlicher Teil der Kritik bezieht sich auch auf das von mir gewählte Medium Computerspiel. Über Computerspiele als Medium wird zu schnell geurteilt ohne diese genauer zu betrachten. Und so ist es auch bei meinem Kunstprojekt. Es soll dazu dienen, einer jungen Generation mit Hilfe ihres Leitmediums interaktiven Zugang zur jüngsten deutschen Geschichte zu ermöglichen. Mich freut die rege Diskussion und der positive Zuspruch, der meinem Spiel auch zukommt.
An dieser Stelle soll auch klar gestellt werden, dass es sich bei 1378(km) nicht um ein eigenständiges Spiel, sondern um eine kostenlose Modifikation von „Half-life 2: Deathmatch“ handelt, wonach sich auch die oben erwähnte Altersfreigabe richtet.
Im Computerspiel habe ich – anders als beispielweise in einem Dokumentarfilm – selbst die Kontrolle über mein Verhalten und meine Reaktionen auf in Echtzeit stattfindende und sich verändernde Situationen. Das Spiel 1378(km) zwingt in der Rolle des „Grenzsoldaten“ nicht, „Flüchtlinge“ zu erschießen. Es lässt Wahlmöglichkeiten. Gewinnen kann man bei 1378(km) nur, wenn man nicht schießt. Die Regeln des Spiels sind von der innerdeutschen Grenzsituation inspiriert. Grenzanlagen, Todesstreifen und Schießbefehl machen die Brutalität des Spiels aus.
Dass sich Opfer der Todesgrenze oder deren Angehörige verletzt fühlen, bedauere ich zutiefst. Es war keineswegs meine Absicht jemanden zu verletzen.
Jens M. Stober "
Link
Wolf Thomas - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 22:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Am 27. und 28. Oktober 2010 findet auf dem Messegelände Berlin wieder der zentrale E-Government-Kongress in Deutschland Moderner Staat statt. Neben dem Kongress ist die Messe empfehlenswert, da die meisten relevanten Anbieter an einem Ort zusammenkommen.
Vgl.: Moderner Staat
Vgl.: Moderner Staat
schwalm.potsdam - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 17:43 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Kontext Standards im Records Management und Weiterentwicklung DOMEA-Konzept ist die Road Map zur Fortschreibung von MoReq hinsichtlich MoReq 2010 und über 2012 hinaus spannend:
Roadmap MoReq 2010
Solange die MoReq allerdings nur auf Englisch vorliegen und dt. Spezifika kaum berücksichtigen (was sich im Kontext MoReq 2010 bzw. über 2012 hinaus ja ändern könnte), werden sie in der dt. Verwaltung erfahrungsgemäß kaum Anwendung finden.
Roadmap MoReq 2010
Solange die MoReq allerdings nur auf Englisch vorliegen und dt. Spezifika kaum berücksichtigen (was sich im Kontext MoReq 2010 bzw. über 2012 hinaus ja ändern könnte), werden sie in der dt. Verwaltung erfahrungsgemäß kaum Anwendung finden.
schwalm.potsdam - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 17:38 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Vorträge des von BearingPoint veranstalteten Ministerialkongresses im Themenkomplex E-Government sind online.
Themene u.a.:
Themene u.a.:
- eVerwaltung
- eKommunikation
- Identitätsmanagement
- eParticipation
- Web 2.0
schwalm.potsdam - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 17:34 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 16:13 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 16:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der IT-Planungsrat des Bundes und der Länder hat die Nationale E-Government Strategie des Bundes und der Länder beschlossen. Einer der Kernpunkte ist u.a. Open Government und eParticipation u.a. mit dem Ziel einer Wissensvernetzung und Interaktion von Verwaltung, Unternehmen, Bürger auf Basis einheitlicher Standards und Architekturen etc.
Vgl. IT-Planungsrat beschließt Nationale E-Government Strategie
Vgl. IT-Planungsrat beschließt Nationale E-Government Strategie
schwalm.potsdam - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 14:19 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine sensationell hohe Zahl, die vor allem durch verlagsseitige Deposits zustandekommt.
http://www.ssoar.info/de.html
http://www.ssoar.info/de.html
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 01:12 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-10.htm
Sehr instruktiver Text, wie meist extrem lesenswert. Allerdings erlaube ich mir den Hinweis, dass ich nur im äußersten Notfall als Wissenschaftler auf ersichtlich totgeborene Kinder wie
http://opendepot.org/
http://www.openaire.eu/
zurückgreifen würde.
Bei Openaire handelt es sich, wenn man die extrem lückenhafte Website sichtet, nicht um ein universelles Repositorium, sondern eine Möglichkeit, für EU-geförderte Wissenschaftler, ihren Deposit-Verpflichtungen nachzukommen. Weitere Angaben zum "orphan repository" fehlen.
Bei Opendepot spricht die Gesamtzahl der Deposits weltweit im Jahr 2009 für sich: 9, in Worten neun.
Sehr instruktiver Text, wie meist extrem lesenswert. Allerdings erlaube ich mir den Hinweis, dass ich nur im äußersten Notfall als Wissenschaftler auf ersichtlich totgeborene Kinder wie
http://opendepot.org/
http://www.openaire.eu/
zurückgreifen würde.
Bei Openaire handelt es sich, wenn man die extrem lückenhafte Website sichtet, nicht um ein universelles Repositorium, sondern eine Möglichkeit, für EU-geförderte Wissenschaftler, ihren Deposit-Verpflichtungen nachzukommen. Weitere Angaben zum "orphan repository" fehlen.
Bei Opendepot spricht die Gesamtzahl der Deposits weltweit im Jahr 2009 für sich: 9, in Worten neun.
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:52 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://google-latlong.blogspot.com/2010/09/explore-world-with-street-view-now-on.html
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview (79 Beiträge)
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview (79 Beiträge)
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:19 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:14 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzleikompa.de/2010/10/02/wikimedia-e-v-hat-ein-neues-problem-1/
Telepolis hat den unter http://archiv.twoday.net/stories/8368792/ angezeigten Beitrag aus redaktionellen Gründen - Näheres ist dem Autor Kompa nach eigenen Angaben nicht bekannt - gelöscht. Wir freuen uns auf mehr Klartext in seinem Blog und auf hoffentlich erfolgreiche juristische Auseinandersetzungen gegen Wikimedia.
Telepolis hat den unter http://archiv.twoday.net/stories/8368792/ angezeigten Beitrag aus redaktionellen Gründen - Näheres ist dem Autor Kompa nach eigenen Angaben nicht bekannt - gelöscht. Wir freuen uns auf mehr Klartext in seinem Blog und auf hoffentlich erfolgreiche juristische Auseinandersetzungen gegen Wikimedia.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Government-2-0-Wenn-Behoerden-von-Wikipedia-lernen-1100501.html
[Nachträglich ergänzt:]
Die Überschrift kombiniert zwei Ansätze, die zusammengehören:
* Open Government - das Verwaltungshandeln sollte offen und transparent sein, die Daten frei = nachnutzbar.
* Government 2.0 - Verwaltung nach dem Muster von Web 2.0 unter besonderer Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung.
[Nachträglich ergänzt:]
Die Überschrift kombiniert zwei Ansätze, die zusammengehören:
* Open Government - das Verwaltungshandeln sollte offen und transparent sein, die Daten frei = nachnutzbar.
* Government 2.0 - Verwaltung nach dem Muster von Web 2.0 unter besonderer Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung.
KlausGraf - am Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:05 - Rubrik: Open Access