Der Fotograf Michael Wolf hat mit abfotografierten Google-Streetview-Funden Momentaufnahmen aus dem Leben der Metropole Paris gesammelt, die jetzt in der Ausstellung "Peurs sur la ville" präsentiert werden.
Wolf-Fotos
http://www.photomichaelwolf.com/paris_street_view/index.html
Beitrag in TTT
http://www.daserste.de/ttt/beitrag_dyn~uid,f29td0c441u3xjow~cm.asp
Siehe auch
http://parisisinvisible.blogspot.com/2011/01/peurs-sur-la-ville-paris-is-battlefield.html
Zu Streetview
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Wolf-Fotos
http://www.photomichaelwolf.com/paris_street_view/index.html
Beitrag in TTT
http://www.daserste.de/ttt/beitrag_dyn~uid,f29td0c441u3xjow~cm.asp
Siehe auch
http://parisisinvisible.blogspot.com/2011/01/peurs-sur-la-ville-paris-is-battlefield.html
Zu Streetview
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 23:36 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) waren einst CIA Top-Agenten, doch ihr geheimes Wissen macht sie nun zu den Top-Angriffszielen der Agency. Des Pensionärs-Daseins ohnehin überdrüssig, finden sich die vier Ex-Agenten in einem Hagel von Mordanschlägen wieder. Nun müssen sie besser, schneller und härter sein als ihre jüngeren Kollegen. Sie setzen ihre jahrelange Erfahrung, ihre ganze Durchtriebenheit und perfektes Teamwork ein, um ihren fatalen Verfolgern stets einen Schritt voraus zu sein und am Leben zu bleiben.
Um die tödliche Operation zu stoppen, lässt sich das Team auf eine schier unmögliche Mission quer durchs Land ein: Sie müssen ins CIA Headquarter einbrechen. Selbst für die alternden Ex-Agenten ein wahnwitziges Vorhaben, bei dem sie eine der größten Verschwörungen und Vertuschungsaktionen der Regierungsgeschichte aufdecken werden…"
Quelle: filmstarts.de
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 20:36 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: Landesarchiv Speyer
"1981 machte die Prinzhorn-Sammlung Heidelberg mit einer eindrucksvollen Ausstellung von Bildern, Zeichnungen und Skulpturen auf die ästhetisch-künstlerischen Ausdrucksformen von Patienten psychiatrischer Anstalten aufmerksam. Eine in der Frankfurter „Schirn Kunsthalle“ präsentierte Ausstellung mit weiteren Materialien aus diesem Bereich („Weltenwandler – Die Kunst der Outsider“ (24.9.2010 - 9.1.2011) bewies den ungebrochenen Reiz solcher Zeugnisse.
Die in der Ausstellung des Landesarchivs Speyer erstmals gezeigten Bilder stellen nur eine kleine Auswahl dar. Mit anderen Bildern entstammen sie einem umfangreichen Bestand von Patientenakten der früheren Heil- und Pflegeanstalt Alzey aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.
Meistens enthalten solche Akten nur Unterlagen, welche den Patienten ausschließlich aus ärztlich-therapeutischer Sicht beschreiben. Von den Patienten selbst angefertigte Bilder, Bastelarbeiten und Texte sind daher authentische Zeugnisse ihres Innenlebens. Darüber hinaus spiegeln sie die Bewegungen, Emotionen und Ängste ihrer Zeit wider – im vorliegenden Fall die Stimmung des Jahres 1914, als die „Jahrhundertkatastrophe“ des Ersten Weltkrieges sich gerade anbahnte.
Individuelle Biographien und historische Entwicklungen vermischen sich in den jetzt gezeigten Bildern in einzigartiger Weise.
Hinweise
Die Ausstellung wird am 26.1.2011 um 19.00 Uhr durch Kulturstaatssekretär Walter Schumacher im Foyer des Landesarchiv/Landesbibliothek eröffnet. "
Quelle: Opus Kulturmagazin
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 20:24 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Thomas Kübler (Direktor des Dresdner Stadtarchivs) präsentiert einen besonderen Schatz seines Hauses: die originalen Pläne von George Bähr zum Bau der Frauenkirche. Thomas Kübler erläutert, welchen historischen Wert die Pläne darstellen; gleichzeitig sind sie von unschätzbarem praktischen Nutzen, denn der Wiederaufbau der Frauenkirche wäre ohne diese Pläne des Stadtarchives kaum möglich gewesen.
Link zum Video
Link zum Video
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:48 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Weitere Überlegungen zum Ngram-Viewer von Google Books
http://sappingattention.blogspot.com/2011/01/digital-history-and-copyright-black.html
 ZIP-Code 02138
ZIP-Code 02138
http://sappingattention.blogspot.com/2011/01/digital-history-and-copyright-black.html
 ZIP-Code 02138
ZIP-Code 02138KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


Quelle: Bundesarchiv
"Am 18. und 19.1.2011 trafen sich die Vertreter der elf Mitgliedsstaaten des Internationalen Ausschusses des Internationalen Suchdienstes im Rahmen ihrer Strategischen Studiengruppe in Berlin und besprachen den Entwurf einer Vereinbarung über eine institutionelle Partnerschaft zwischen dem Internationalen Suchdienst und dem Bundesarchiv in der Nachfolge des Internationalen Roten Kreuzes. Das Ziel ist es, bis zur nächsten turnusmäßigen Sitzung des Internationalen Ausschusses Ende Mai Einvernehmen über den Text zu erzielen.
Der Internationale Suchdienst mit Sitz in Bad Arolsen beantwortet Anfragen nach verfolgten und verschleppten Personen, die während des Krieges auf dem Gebiet des Dritten Reiches verschollen sind oder in der frühen Nachkriegszeit den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben und hilft bei der Suche nach dem Verbleib von nicht-deutschen Personen, die in den Jahren 1927 bis 1949 geboren sind und sich als Kinder während des Krieges auf dem Gebiet des Dritten Reiches oder nach dem Krieg auf dem Gebiet der Besatzungszonen aufgehalten haben.
Die Aufsicht über die Arbeit des Internationalen Suchdienstes obliegt dem Internationalen Ausschuss, in dem Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Israel, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen und die USA vertreten sind. Im Auftrag des Ausschusses wird der Suchdienst durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) verwaltet. Finanziert wird die Einrichtung mit ihren knapp 300 Mitarbeitern aus dem Bundeshaushalt.
Der erste Tag des Treffens der Strategischen Studiengruppe fand im Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte statt. Am zweiten Tag wurde die Sitzung im Bundesarchiv fortgesetzt. Dabei fand zunächst ein Rundgang über die Liegenschaft statt, um den Mitgliedern der Studiengruppe die Möglichkeit zu geben, sich selbst vor Ort einen Eindruck über das Bundesarchiv zu verschaffen. Die Besucher waren beeindruckt von der Größe des Geländes wie von der Vielfalt der hier für die Einsicht bereit gehaltenen Bestände.
Einen Schwerpunkt bildete die Vorstellung des neuen Ernst-Posner-Baus mit den bereits genutzten Magazinbereichen und dem zukünftigen Empfangsbereich des Bundesarchivs in Berlin. Dabei wurde auch der Namensgeber des Gebäudes vorgestellt, ein in die USA emigrierter, früherer Archivar des Preußischen Geheimen Staatsarchivs, der sich nach 1945 als Berater der amerikanischen Truppen um die Sicherung ausgelagerter Archivbestände in Europa kümmerte und in der archivarischen Berufsgemeinschaft in den USA heute noch als ein Begründer der dortigen Archivausbildung hoch geschätzt wird.
Die Strategische Studiengruppe wird ihre Arbeit Anfang März fortsetzen und will sie Mitte Mai abschließen."
Link zur aktuellen Meldung des Bundesarchivs
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:35 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Landessportbund Berlin wird einen großen Teil seiner Aktenbestände, vornehmlich Protokolle von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung, aber auch Handakten zur Sportpolitik und zu Großveranstaltungen, dem Landesarchiv Berlin übergeben und damit eine dauerhafte Lagerung und wissenschaftliche Erschließung sicherstellen. ©Sportmuseum Berlin – AIMS Marathon-Museum of Running
"Parallel dazu werden die umfangreichen Bestände des Berliner LSB-Archivs, insbesondere Nachlässe, Bücher und Erstausgaben sowie Fotos u.ä. an das Sportmuseum Berlin übergeben, das ebenfalls über hervorragende Depotbedingungen verfügt.
Der Landessportbund Berlin wird einen großen Teil seiner Aktenbestände, vornehmlich Protokolle von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung, aber auch Handakten zur Sportpolitik und zu Großveranstaltungen, dem Landesarchiv Berlin übergeben und damit eine dauerhafte Lagerung und wissenschaftliche Erschließung sicherstellen.
Eine ‚archivgerechte’ Lagerung beinhaltet eine klimatisierte, horizontale Ablage in säurefreien Archivkartons, zuvor müssen verrostete Büro- und Heftklammern entfernt werden, verblassende Spiritus- und Thermokopien neu kopiert, alte Dokumente vor Tinten- und Säurefraß bewahrt werden.
Parallel dazu werden die umfangreichen Bestände des Berliner LSB-Archivs, insbesondere Nachlässe, Bücher und Erstausgaben sowie Fotos u.ä. an das Sportmuseum Berlin übergeben, das ebenfalls über hervorragende Depotbedingungen verfügt.
In Gesprächen mit dem Landesarchiv und dem Sportmuseum wurde vereinbart, diese Lagerungsmöglichkeiten auch allen LSB-Mitgliedsorganisationen und Sportvereinen anzubieten und die Übergabe und Einsichtnahme vertraglich zu regeln. Ein entsprechendes Rundschreiben ist unterwegs, eine erste Infotagung ist für das Frühjahr 2011 im Landesarchiv vorgesehen.
Sinn und Zweck ist es, das „Gedächtnis des Berliner Sports“ für weitere Generationen dauerhaft zu bewahren und z.B. im Landesarchiv einen Sonderbestand „Sport“ zu schaffen, der neben den Akten des Senats und der Sportverwaltungen bis hin zur Kaiserzeit auch den Vereinssport erfasst und wissenschaftlich auswertet.
Für Vereins- und Verbandsjubiläen eine dann leicht zu erschließende Quelle.
Aus den jüngsten Archivtagungen des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Fußball-Bundes liegen positive Kooperationserfahrungen mit den Landesarchiven im Saarland, in Hessen und Niedersachsen vor.
Da wollen Berlin und das alte Preußen nicht hintenanstehen."
Manfred Nippe aus ‚Sport in Berlin’, Januar 2011
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:27 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dieter Horky: Spurensicherung. Archive als kulturelles Gedächtnis werden immer dringender benötigt S. 11
Karin Lingl: Stiftung Kunstfonds Archiv für Künstlernachlässe S. 11
Daniel Schütz: Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe - Stiftung bürgerlichen Rechts. Das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe in Bonn will einen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Identität im Rheinland leisten S. 14
Birgit Jooss: Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ist das größte Archiv für schriftliche Nachlässe zur Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum S. 15
Gora Jain: Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg. Das Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg will künstlerische Nachlässe wissenschaftlich betreuen, dokumentieren und bewahren S. 16
Jo Enzweiler: "Lebenswerke" - Sammlung und Archiv. Das Institut für aktuelle Kunst im Saarland beabsichtigt die Gründung eines Nachlassmuseums S. 17
Susanne Will-Flatau: Oder: Selbst ist der Künstler? Die Künstlerin oder der Künstler ist gut beraten, wenn sie oder er sich schon zu Lebzeiten um den Fortbestand ihres oder seines Werkes kümmert S. 18
"Seit der Gründung des BBK 1972 gibt es die Zeitschrift kultur politik. Offizieller Herausgeber ist das vom Bundesausschuss gegründete Kulturwerk des BBK, in dem alle Landesverbände vertreten sind, herausgegeben.
kultur politik informiert ihre Mitglieder, zahlreiche Behörden, Organisationen und Verbände im In- und Ausland mit aktuellen Berichten und Beiträgen über kunst- und kulturrelevante Themen, wie z.B. Urheberrecht und Steuern, Wettbewerbe und Ausschreibungen, Künstlermessen und Ausstellungen, Künstlersozialversicherung und Hartz IV.
Auch Kunstakademien in Deutschland, Museen und Galerien, selbst Bibliotheken in Übersee, beziehen kultur politik ebenso wie Redaktionen von Presseagenturen, Zeitungen, Magazinen und Rundfunk- und Fernsehanstalten.
Große Themen, wie die Diskussion um Ausstellungshonorare oder das Folgerecht in Deutschland und Europa, die kulturpolitischen Positionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien oder die wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, werden in kultur politik von qualifizierten Fachleuten dargelegt und kommentiert. Mit Hinweisen auf weiterführende Literatur oder nützliche Informationsquellen im Internet wird dieses Informationsangebot abgerundet.
Neben Beiträgen über Aktivitäten der Landes- und Bezirksverbände werden auch die Ausstellungstermine der Mitgliedsverbände des BBK in kultur politik publiziert. Künstlerinnen und Künstler, die in den Arbeitsfeldern Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum tätig sind, können in kultur politik über ihre Projekte informieren.
Die Informationen aus den Regionen über weitere Aktivitäten, wie z.B. Berichte über Auslandskontakte oder die Eröffnungen von Werkstätten oder Produzentengalerien, vermitteln Einblicke in die vielfältige Arbeit der BBK-Gliederungen.
Mit dem breiten Spektrum an Nachrichten, Informationen und Neuigkeiten hat sich die Zeitschrift kultur politik einen großen Leserkreis erworben. Nicht zuletzt auch die zahlreichen Ausschreibungen von Wettbewerben, Stipendien und Kunstpreisen machen kultur politik zu einer wichtigen Informationsquelle in der Kunstszene. "
Link
Karin Lingl: Stiftung Kunstfonds Archiv für Künstlernachlässe S. 11
Daniel Schütz: Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe - Stiftung bürgerlichen Rechts. Das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe in Bonn will einen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Identität im Rheinland leisten S. 14
Birgit Jooss: Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ist das größte Archiv für schriftliche Nachlässe zur Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum S. 15
Gora Jain: Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg. Das Forum für Nachlässe von Künstlerinnen und Künstler in Hamburg will künstlerische Nachlässe wissenschaftlich betreuen, dokumentieren und bewahren S. 16
Jo Enzweiler: "Lebenswerke" - Sammlung und Archiv. Das Institut für aktuelle Kunst im Saarland beabsichtigt die Gründung eines Nachlassmuseums S. 17
Susanne Will-Flatau: Oder: Selbst ist der Künstler? Die Künstlerin oder der Künstler ist gut beraten, wenn sie oder er sich schon zu Lebzeiten um den Fortbestand ihres oder seines Werkes kümmert S. 18
"Seit der Gründung des BBK 1972 gibt es die Zeitschrift kultur politik. Offizieller Herausgeber ist das vom Bundesausschuss gegründete Kulturwerk des BBK, in dem alle Landesverbände vertreten sind, herausgegeben.
kultur politik informiert ihre Mitglieder, zahlreiche Behörden, Organisationen und Verbände im In- und Ausland mit aktuellen Berichten und Beiträgen über kunst- und kulturrelevante Themen, wie z.B. Urheberrecht und Steuern, Wettbewerbe und Ausschreibungen, Künstlermessen und Ausstellungen, Künstlersozialversicherung und Hartz IV.
Auch Kunstakademien in Deutschland, Museen und Galerien, selbst Bibliotheken in Übersee, beziehen kultur politik ebenso wie Redaktionen von Presseagenturen, Zeitungen, Magazinen und Rundfunk- und Fernsehanstalten.
Große Themen, wie die Diskussion um Ausstellungshonorare oder das Folgerecht in Deutschland und Europa, die kulturpolitischen Positionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien oder die wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, werden in kultur politik von qualifizierten Fachleuten dargelegt und kommentiert. Mit Hinweisen auf weiterführende Literatur oder nützliche Informationsquellen im Internet wird dieses Informationsangebot abgerundet.
Neben Beiträgen über Aktivitäten der Landes- und Bezirksverbände werden auch die Ausstellungstermine der Mitgliedsverbände des BBK in kultur politik publiziert. Künstlerinnen und Künstler, die in den Arbeitsfeldern Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum tätig sind, können in kultur politik über ihre Projekte informieren.
Die Informationen aus den Regionen über weitere Aktivitäten, wie z.B. Berichte über Auslandskontakte oder die Eröffnungen von Werkstätten oder Produzentengalerien, vermitteln Einblicke in die vielfältige Arbeit der BBK-Gliederungen.
Mit dem breiten Spektrum an Nachrichten, Informationen und Neuigkeiten hat sich die Zeitschrift kultur politik einen großen Leserkreis erworben. Nicht zuletzt auch die zahlreichen Ausschreibungen von Wettbewerben, Stipendien und Kunstpreisen machen kultur politik zu einer wichtigen Informationsquelle in der Kunstszene. "
Link
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 18:02 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Inhalt
62. Westfälischer Archivtag am 16. und 17. März 2010 in Kamen
Gunnar Teske: Tagungsbericht 2
Katharina Tiemann: »Neues aus der Anstalt« – die Rolle der Kommunalarchive in veränderten Betriebsformen 4
Jochen Rath: Mittendrin oder nur dabei? Ein Praxisbericht über Chancen und Grenzen von Kooperationen des Stadtarchivs Bielefeld 11
Diskussionsforen 17
Jochen Oltmer: Bedingungen, Formen und Folgen historischer Migrationsprozesse 20
Hannes Lambacher: Beispiele amtlicher Überlieferung zu Ein- und Auswanderung in Stadt und Kreis Münster im 19. und 20. Jahrhundert 25
Ernst Otto Bräunche: Das Projekt »Zuwanderung nach Karlsruhe« 30
Isabella Scholz: Das Sonderforschungsprojekt am Stadtarchiv Nürnberg: »Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute« 33
Gerhard Pomykaj: Ankommen – Zuwanderung ins Oberbergische nach 1945. Ein Projektbericht 35
Ingrid Wölk: Kooperationen von Archiven des Ruhrgebiets im Rahmen der RUHR.2010: Das Ausstellungsprojekt »Fremd(e) im Revier!?« 39
Weitere Beiträge
Mark Steinert: Das neue Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Regelungen für kommunale Archive 44
Annett Fercho, Hans-Jürgen Höötmann und Christa Wilbrand: Bewertung von Lastenausgleichskarteien 52
Empfehlungen zur Bewertung von Sammelakten zu den Personenstandsregistern 54
Erfahrungsberichte zum Tag der Archive (6./7. März 2010) 57
»Rechtliche Grundlagen im Kommunalarchiv«. Ein Workshopbericht 63
Datenbank der Stiftung polnisch-deutsche Aussöhnung über polnische Zwangsarbeiter 63
13. Treffen des Ausbilderarbeitskreises »FAMI – Fachrichtung Archiv« 64
Fortbildungsveranstaltung für Berufsschullehrer im LWL-Archivamt 65
Chancen für archivische Projektarbeit am Beispiel des Stadtarchivs Iserlohn 65
Startschuss für Archivo – das digitale Langzeitarchiv 66
Archiv Haus Marck wappnet sich gegen Katastrophen 67
Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut in Münster 67
Geschichtsrallye aus Castrop-Rauxel gewinnt Landespreis 69
Bistumsarchiv Münster wiedereröffnet 69
Bücher 71
Infos 75
Link zum Heft (PDF)
62. Westfälischer Archivtag am 16. und 17. März 2010 in Kamen
Gunnar Teske: Tagungsbericht 2
Katharina Tiemann: »Neues aus der Anstalt« – die Rolle der Kommunalarchive in veränderten Betriebsformen 4
Jochen Rath: Mittendrin oder nur dabei? Ein Praxisbericht über Chancen und Grenzen von Kooperationen des Stadtarchivs Bielefeld 11
Diskussionsforen 17
Jochen Oltmer: Bedingungen, Formen und Folgen historischer Migrationsprozesse 20
Hannes Lambacher: Beispiele amtlicher Überlieferung zu Ein- und Auswanderung in Stadt und Kreis Münster im 19. und 20. Jahrhundert 25
Ernst Otto Bräunche: Das Projekt »Zuwanderung nach Karlsruhe« 30
Isabella Scholz: Das Sonderforschungsprojekt am Stadtarchiv Nürnberg: »Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute« 33
Gerhard Pomykaj: Ankommen – Zuwanderung ins Oberbergische nach 1945. Ein Projektbericht 35
Ingrid Wölk: Kooperationen von Archiven des Ruhrgebiets im Rahmen der RUHR.2010: Das Ausstellungsprojekt »Fremd(e) im Revier!?« 39
Weitere Beiträge
Mark Steinert: Das neue Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Regelungen für kommunale Archive 44
Annett Fercho, Hans-Jürgen Höötmann und Christa Wilbrand: Bewertung von Lastenausgleichskarteien 52
Empfehlungen zur Bewertung von Sammelakten zu den Personenstandsregistern 54
Erfahrungsberichte zum Tag der Archive (6./7. März 2010) 57
»Rechtliche Grundlagen im Kommunalarchiv«. Ein Workshopbericht 63
Datenbank der Stiftung polnisch-deutsche Aussöhnung über polnische Zwangsarbeiter 63
13. Treffen des Ausbilderarbeitskreises »FAMI – Fachrichtung Archiv« 64
Fortbildungsveranstaltung für Berufsschullehrer im LWL-Archivamt 65
Chancen für archivische Projektarbeit am Beispiel des Stadtarchivs Iserlohn 65
Startschuss für Archivo – das digitale Langzeitarchiv 66
Archiv Haus Marck wappnet sich gegen Katastrophen 67
Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut in Münster 67
Geschichtsrallye aus Castrop-Rauxel gewinnt Landespreis 69
Bistumsarchiv Münster wiedereröffnet 69
Bücher 71
Infos 75
Link zum Heft (PDF)
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 17:47 - Rubrik: Kommunalarchive



Ort: Außenstelle des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein
Datum: 21.01.2011
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Januar 2011, 17:35 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 14:16 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 13:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/518347
[S]owohl die Textsammlung 'Wikileaks und die Folgen' in der Edition Suhrkamp als auch das Sachbuch 'Staatsfeind Wikileaks' der beiden Spiegel-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark gehen mit dem Thema jeder für sich gewissenhaft und differenziert um. Es lohnt sich, beide zu lesen.
MARCEL ROSENBACH, HOLGER STARK: Staatsfeind Wikileaks. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 336 Seiten, 14,99 Euro.
HEINRICH GEISELBERGER (Redaktion): Wikileaks und die Folgen. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011. 238 Seiten, 10 Euro.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks (derzeit 77 Beiträge in Archivalia)

[S]owohl die Textsammlung 'Wikileaks und die Folgen' in der Edition Suhrkamp als auch das Sachbuch 'Staatsfeind Wikileaks' der beiden Spiegel-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark gehen mit dem Thema jeder für sich gewissenhaft und differenziert um. Es lohnt sich, beide zu lesen.
MARCEL ROSENBACH, HOLGER STARK: Staatsfeind Wikileaks. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 336 Seiten, 14,99 Euro.
HEINRICH GEISELBERGER (Redaktion): Wikileaks und die Folgen. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011. 238 Seiten, 10 Euro.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks (derzeit 77 Beiträge in Archivalia)

KlausGraf - am Sonntag, 23. Januar 2011, 13:01 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 23:40 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die FAZ hat zum Vasari-Archiv - siehe http://archiv.twoday.net/stories/11533467/ (28. Dez. 2010) - recherchiert http://goo.gl/v5YtZ und herausgefunden, dass aus dem angekündigten Verkauf der 31 Faszikal Vasari-Nachlass in Arezzo an einen russischen Investor wohl nichts wird:
In einem Telefongespräch mit dieser Zeitung teilte Wassilij Stepanow, der angebliche Käufer und Vorstandsmitglied der Moskauer ROSS Group – die vor allem im Bau- und Immobiliensektor tätig ist, etwa Einkaufszentren baut –, mit, dass auf Seiten der Familie Festari „keine ernsthafte Absicht“ bestanden habe, „das Geschäft zu tätigen“.
Und:
Die Affäre führt möglicherweise zu einem weiteren, ungeklärten Fall. Denn ein Bericht des italienischen Kulturministers Sandro Bondi an den Senat in Rom vom 1. Juli 2010, der dieser Zeitung vorliegt, stellt fest, dass ein Teil des Archivs der Familie Rasponi-Spinelli, darunter zahlreiche der bedeutendsten Dokumente aus dem Nachlass Vasaris, bereits 1988 aus Italien fortgeschafft wurde.
Anscheinend nahmen italienische Politiker dies weder damals noch heute zum Anlass, um gegen den Export eines nationalen Kulturschatzes zu protestieren. Die rund 150.000 Manuskriptseiten befinden sich nämlich nicht etwa in der Hand eines ausländischen Spekulanten, sondern liegen in der renommierten Beinecke Library der amerikanischen Universität Yale, einer der exquisitesten Handschriftensammlungen der Welt. Das sogenannte Spinelli-Archiv stellt den kulturhistorischen Wert des Vasari-Nachlasses in Arezzo dabei womöglich in den Schatten. [...] „Der Verkauf und illegale Export des Spinelli-Archivs und die damit erfolgte Auflösung des Nachlasses von Giorgio Vasari stellt einen der größten Verluste für unser kulturelles Erbe dar“, sagte dazu die toskanische Archivbeauftragte Toccafondi.
In einem Telefongespräch mit dieser Zeitung teilte Wassilij Stepanow, der angebliche Käufer und Vorstandsmitglied der Moskauer ROSS Group – die vor allem im Bau- und Immobiliensektor tätig ist, etwa Einkaufszentren baut –, mit, dass auf Seiten der Familie Festari „keine ernsthafte Absicht“ bestanden habe, „das Geschäft zu tätigen“.
Und:
Die Affäre führt möglicherweise zu einem weiteren, ungeklärten Fall. Denn ein Bericht des italienischen Kulturministers Sandro Bondi an den Senat in Rom vom 1. Juli 2010, der dieser Zeitung vorliegt, stellt fest, dass ein Teil des Archivs der Familie Rasponi-Spinelli, darunter zahlreiche der bedeutendsten Dokumente aus dem Nachlass Vasaris, bereits 1988 aus Italien fortgeschafft wurde.
Anscheinend nahmen italienische Politiker dies weder damals noch heute zum Anlass, um gegen den Export eines nationalen Kulturschatzes zu protestieren. Die rund 150.000 Manuskriptseiten befinden sich nämlich nicht etwa in der Hand eines ausländischen Spekulanten, sondern liegen in der renommierten Beinecke Library der amerikanischen Universität Yale, einer der exquisitesten Handschriftensammlungen der Welt. Das sogenannte Spinelli-Archiv stellt den kulturhistorischen Wert des Vasari-Nachlasses in Arezzo dabei womöglich in den Schatten. [...] „Der Verkauf und illegale Export des Spinelli-Archivs und die damit erfolgte Auflösung des Nachlasses von Giorgio Vasari stellt einen der größten Verluste für unser kulturelles Erbe dar“, sagte dazu die toskanische Archivbeauftragte Toccafondi.
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 22:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://creativecommons.org/weblog/entry/26115
These cases together highlight some important fundamentals about how CC licenses operate. First and foremost, our licenses operate in conjunction with copyright, not in lieu of copyright. This means that if the terms of the CC license you have applied to your music or other creative work are violated, as the judge concluded in the Belgian case, the result is copyright infringement and nothing less. Conversely, downstream users who abide by the license conditions are not guilty of infringement. Both court decisions also reinforce a related and subtle (yet important) point for CC licensors — using a CC license does not work against you when it comes to enforcing your copyright later, even when users of your work may not be aware of your license choice. There is no penalty down the line for choosing flexibility over “all rights reserved” when it comes to enforcing your copyright.
Siehe dazu auch hier
http://archiv.twoday.net/stories/8423849/
These cases together highlight some important fundamentals about how CC licenses operate. First and foremost, our licenses operate in conjunction with copyright, not in lieu of copyright. This means that if the terms of the CC license you have applied to your music or other creative work are violated, as the judge concluded in the Belgian case, the result is copyright infringement and nothing less. Conversely, downstream users who abide by the license conditions are not guilty of infringement. Both court decisions also reinforce a related and subtle (yet important) point for CC licensors — using a CC license does not work against you when it comes to enforcing your copyright later, even when users of your work may not be aware of your license choice. There is no penalty down the line for choosing flexibility over “all rights reserved” when it comes to enforcing your copyright.
Siehe dazu auch hier
http://archiv.twoday.net/stories/8423849/
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 22:00 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://womensbios.lib.virginia.edu/
The bibliography is the work of Alison Booth, Professor, Department of English of the University of Virginia and Associate Fellow, Institute for Advanced Technology in the Humanities.
Disappointing: Publications are in the English language only!
Via http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63454
The bibliography is the work of Alison Booth, Professor, Department of English of the University of Virginia and Associate Fellow, Institute for Advanced Technology in the Humanities.
Disappointing: Publications are in the English language only!
Via http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63454
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:51 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.viewsoftheworld.net/?p=1092
Zur OA-Woche 2010 siehe hier
http://archiv.twoday.net/stories/8404435/
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:48 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/y3qnF (NZZ)
Glücklicherweise hat dieselbe Technologie, die mir viele Bibliotheken vergällt, teilweise Abhilfe geschaffen. Die Bibliothèque nationale in Paris zum Beispiel stellt sukzessive alle Bücher, die nicht mehr unter Copyright sind, eingescannt ins Netz, und ich kann den Grossteil der Primärliteratur in den Originalausgaben aus vergangenen Jahrhunderten bei mir zu Hause lesen. Das ist eine ungemeine Erleichterung, zumal ich leicht asoziale Arbeitszeiten habe. Wenn ich um zwei Uhr morgens einen Brief von Voltaire oder eine Stelle in einem atheistischen Pamphlet aus dem vorrevolutionären Frankreich nachsehen will, schlafen rechtschaffene Bibliothekare bereits, aber das geduldige Internet zeigt mir, was ich sehen wollte. Ausserdem hat mein Computer auch nichts dagegen, wenn ich beim Lesen der alten Quellentexte eine Tasse Tee trinke. Wenn ich sie umwerfe, ist höchstens mein Keyboard ruiniert.
Glücklicherweise hat dieselbe Technologie, die mir viele Bibliotheken vergällt, teilweise Abhilfe geschaffen. Die Bibliothèque nationale in Paris zum Beispiel stellt sukzessive alle Bücher, die nicht mehr unter Copyright sind, eingescannt ins Netz, und ich kann den Grossteil der Primärliteratur in den Originalausgaben aus vergangenen Jahrhunderten bei mir zu Hause lesen. Das ist eine ungemeine Erleichterung, zumal ich leicht asoziale Arbeitszeiten habe. Wenn ich um zwei Uhr morgens einen Brief von Voltaire oder eine Stelle in einem atheistischen Pamphlet aus dem vorrevolutionären Frankreich nachsehen will, schlafen rechtschaffene Bibliothekare bereits, aber das geduldige Internet zeigt mir, was ich sehen wollte. Ausserdem hat mein Computer auch nichts dagegen, wenn ich beim Lesen der alten Quellentexte eine Tasse Tee trinke. Wenn ich sie umwerfe, ist höchstens mein Keyboard ruiniert.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:37 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Whether "information wants to be free" or not is arguable. But medical students seem overwhelmingly to want it to be free. The largest organization of medical students in the world, the "International Federation of Medical Students' Associations" has joined the open access advocacy group Right to Research in its fight to make research and publication more free.
http://www.readwriteweb.com/archives/worlds_med_students_declare_for_open_publishing_re.php
http://www.righttoresearch.org/blog/IFMSAannouncement.shtml
http://www.readwriteweb.com/archives/worlds_med_students_declare_for_open_publishing_re.php
http://www.righttoresearch.org/blog/IFMSAannouncement.shtml
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:31 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die NZZ widmet sich der Geschichte der Saga-Handschriften und ihrer Rückgabe aus Kopenhagen nach Island.
http://goo.gl/J6uL8

http://goo.gl/J6uL8

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:29 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34056/1.html
Über Jahrzehnte gab Pullach überhaupt nichts preis, nicht einmal den Parlamentariern. Der Bundesrechnungshof darf bis heute operative Vorgänge nicht einsehen, etwa beurteilen, ob die Ausgaben in einem akzeptablen Verhältnis zu den Ergebnissen stehen. Der Geheimschutz verhindert eine Qualitätskontrolle, und das Ergebnis ist unvermeidbar: Erfolge hat der Dienst nicht vorzuweisen, die Ausgaben sind astronomisch. Kritiker werden als "Verschwörungstheoretiker" abgetan und das Material wird vorenthalten. Und das ging viele Jahre gut. Freiwillig gab man so gut wie nichts heraus: peinlich unbedeutende Wochen- und Tagesmeldungen, die im Bundesarchiv lagern, dann einige Aufklärungsergebnisse über die militärische und wirtschaftliche Situation in der DDR. Das, was kritische Geister wissen wollten, wird zurückgehalten - die Politik spielt ja mit, und die Öffentlichkeit hat sich dran gewöhnt.
Da war die Überraschung groß, als Ende April 2010 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig meiner Klage auf Herausgabe der BND-Akten zu Adolf Eichmann stattgab. Die Richter erklärten die Sperrerklärung des Bundeskanzleramtes für rechtswidrig. Nach 30 Jahren, so besagt es das Bundesarchivgesetz, seien amtliche Unterlagen grundsätzlich offen. Daß sie irgendwann einmal als "Geheim" gestempelt worden seien, reiche alleine nicht aus. Doch statt das Urteil zu respektieren und die Akten nunmehr komplett vorzulegen, schaltete das Bundeskanzleramt auf stur und präsentierte erneut eine Sperrerklärung. Sie benutzt dieselben, vom Gericht für rechtswidrig erklärten Argumenten, um diese Papiere aus den fünfziger Jahren bis 1961 weiterhin der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Soviel zum Thema "Kulturwandel".
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=eichmann
Über Jahrzehnte gab Pullach überhaupt nichts preis, nicht einmal den Parlamentariern. Der Bundesrechnungshof darf bis heute operative Vorgänge nicht einsehen, etwa beurteilen, ob die Ausgaben in einem akzeptablen Verhältnis zu den Ergebnissen stehen. Der Geheimschutz verhindert eine Qualitätskontrolle, und das Ergebnis ist unvermeidbar: Erfolge hat der Dienst nicht vorzuweisen, die Ausgaben sind astronomisch. Kritiker werden als "Verschwörungstheoretiker" abgetan und das Material wird vorenthalten. Und das ging viele Jahre gut. Freiwillig gab man so gut wie nichts heraus: peinlich unbedeutende Wochen- und Tagesmeldungen, die im Bundesarchiv lagern, dann einige Aufklärungsergebnisse über die militärische und wirtschaftliche Situation in der DDR. Das, was kritische Geister wissen wollten, wird zurückgehalten - die Politik spielt ja mit, und die Öffentlichkeit hat sich dran gewöhnt.
Da war die Überraschung groß, als Ende April 2010 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig meiner Klage auf Herausgabe der BND-Akten zu Adolf Eichmann stattgab. Die Richter erklärten die Sperrerklärung des Bundeskanzleramtes für rechtswidrig. Nach 30 Jahren, so besagt es das Bundesarchivgesetz, seien amtliche Unterlagen grundsätzlich offen. Daß sie irgendwann einmal als "Geheim" gestempelt worden seien, reiche alleine nicht aus. Doch statt das Urteil zu respektieren und die Akten nunmehr komplett vorzulegen, schaltete das Bundeskanzleramt auf stur und präsentierte erneut eine Sperrerklärung. Sie benutzt dieselben, vom Gericht für rechtswidrig erklärten Argumenten, um diese Papiere aus den fünfziger Jahren bis 1961 weiterhin der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Soviel zum Thema "Kulturwandel".
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=eichmann
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:27 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/cadre_prefets_d.html
"Im Jahre 1998 schlossen der Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) eine auf mehrere Jahre angelegte Konvention ab, der sich kurz darauf die Archives nationales als dritter Partner anschlossen. Mit dieser Konvention verpflichteten sich das DHIP auf deutscher und das Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) auf französischer Seite als Unterzeichner, sowohl die Synthesen der Berichte der französischen Präfekten als auch die Lageberichte der deutschen Militärverwaltung aus den Jahren 1940–1944 zu edieren. Letztere sind in Frankreich auch als Berichte des Majestic bekannt, benannt nach dem Namen jenes Pariser Hotels in der Avenue Kléber, in dem der deutsche Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) im Zweiten Weltkrieg seinen Amtssitz hatte. Beide Überlieferungen sind für die Geschichte der deutschen Besatzung, der Okkupation, von unschätzbarem Wert."
"Im Jahre 1998 schlossen der Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) eine auf mehrere Jahre angelegte Konvention ab, der sich kurz darauf die Archives nationales als dritter Partner anschlossen. Mit dieser Konvention verpflichteten sich das DHIP auf deutscher und das Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) auf französischer Seite als Unterzeichner, sowohl die Synthesen der Berichte der französischen Präfekten als auch die Lageberichte der deutschen Militärverwaltung aus den Jahren 1940–1944 zu edieren. Letztere sind in Frankreich auch als Berichte des Majestic bekannt, benannt nach dem Namen jenes Pariser Hotels in der Avenue Kléber, in dem der deutsche Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) im Zweiten Weltkrieg seinen Amtssitz hatte. Beide Überlieferungen sind für die Geschichte der deutschen Besatzung, der Okkupation, von unschätzbarem Wert."
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:24 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:22 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Ralf Möbius fragte sich in seinem Blog http://goo.gl/sQufa
Wie wäre es denn, abseits überwiegenden oder mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeiten einmal das Wunder im deutschen Prozessrecht zu bemühen und deren Beweis Kirchenjuristen und sachverständigen Kommissionen der katholischen Kirche zu überlassen?

Wie wäre es denn, abseits überwiegenden oder mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeiten einmal das Wunder im deutschen Prozessrecht zu bemühen und deren Beweis Kirchenjuristen und sachverständigen Kommissionen der katholischen Kirche zu überlassen?

KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 21:19 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jürgen Plieninger, selbsternannter Informationsexperte und Aussonderungsfanatiker, schrieb in netbib: "Das verstößt gegen zwei Glaubenssätze wohnzimmerschrankaussondernder Bürger, die mit Buchspenden – ach! so wertvoll! – kommen: DAS SIND WERTVOLLE BÜCHER und ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN."
http://goo.gl/OvSeJ (siehe auch Kommentare)
Mein Credo ist: Bücher sind nicht irgendwelche WAREN, die man nach Belieben vernichten und aussondern kann. Ob die Bücher aus Wohnzimmerschränken in die öffentliche Bibliothek gehören, darf man gern bezweifeln. Ohne Zweifel steht für mich fest, dass öffentliche Büchereien die Pflicht haben, sich in ein Netzwerk von Stellen und Initiativen einzubinden, denen es um die sinnvolle Verwendung und Verteilung von Büchern geht. Solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, gilt für mich in der Tat: ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN.
Zu den 25 meistgelesenen Beiträgen von Archivalia seit seiner Gründung zählt der von dem Eichstätter Kapuziner-Skandal motivierte Beitrag vom 22. Februar 2007: "Bücher weggeben statt wegwerfen" http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Platz 24, 9761 Zugriffe insgesamt).
 Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
[Die Lizenz wurde gegen All Rights reserved ausgetauscht]
http://goo.gl/OvSeJ (siehe auch Kommentare)
Mein Credo ist: Bücher sind nicht irgendwelche WAREN, die man nach Belieben vernichten und aussondern kann. Ob die Bücher aus Wohnzimmerschränken in die öffentliche Bibliothek gehören, darf man gern bezweifeln. Ohne Zweifel steht für mich fest, dass öffentliche Büchereien die Pflicht haben, sich in ein Netzwerk von Stellen und Initiativen einzubinden, denen es um die sinnvolle Verwendung und Verteilung von Büchern geht. Solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, gilt für mich in der Tat: ES INTERESSIERT SICHER JEMANDEN UND KANN NUTZEN BRINGEN.
Zu den 25 meistgelesenen Beiträgen von Archivalia seit seiner Gründung zählt der von dem Eichstätter Kapuziner-Skandal motivierte Beitrag vom 22. Februar 2007: "Bücher weggeben statt wegwerfen" http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Platz 24, 9761 Zugriffe insgesamt).
 Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Weggeworfene Bücher der Badischen Landesbibliothek. Foto: JochenB http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/[Die Lizenz wurde gegen All Rights reserved ausgetauscht]
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 20:33 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Via
http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63432
Example:
http://replay.waybackmachine.org/19990220152754/http://www.uni-koblenz.de/~graf/
http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63432
Example:
http://replay.waybackmachine.org/19990220152754/http://www.uni-koblenz.de/~graf/
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 18:51 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 22. Januar 2011, 16:54 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.jurpc.de/rechtspr/20100194.htm
1. Die Veröffentlichung einer Gerichtsentscheidung kann, auch wenn eine Prozesspartei ohne großen Aufwand bestimmbar und die Entscheidung damit nicht im datenschutzrechtlichen Sinne anonymisiert ist, bei einem überwiegenden Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein.
2. Als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung einer solchen Entscheidung kommt in Baden-Württemberg, da das Landesdatenschutzgesetz auf die Gerichte anwendbar ist, § 18 Abs. 1 Nr. 2 LDSG in Betracht.
3. Das Schutzinteresse des Betroffenen am Ausschluss der Veröffentlichung kann überwiegen, soweit es um besonders sensible Daten (hier: ärztliche Untersuchungsbefunde) geht.
4. Sind zur Herstellung einer veröffentlichungsfähigen Fassung einer Gerichtsentscheidung inhaltliche Kürzungen geboten, so können diese nur von dem Richter bzw. von dem Spruchkörper vorgenommen werden, der die Entscheidung gefällt hat.
1. Die Veröffentlichung einer Gerichtsentscheidung kann, auch wenn eine Prozesspartei ohne großen Aufwand bestimmbar und die Entscheidung damit nicht im datenschutzrechtlichen Sinne anonymisiert ist, bei einem überwiegenden Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein.
2. Als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung einer solchen Entscheidung kommt in Baden-Württemberg, da das Landesdatenschutzgesetz auf die Gerichte anwendbar ist, § 18 Abs. 1 Nr. 2 LDSG in Betracht.
3. Das Schutzinteresse des Betroffenen am Ausschluss der Veröffentlichung kann überwiegen, soweit es um besonders sensible Daten (hier: ärztliche Untersuchungsbefunde) geht.
4. Sind zur Herstellung einer veröffentlichungsfähigen Fassung einer Gerichtsentscheidung inhaltliche Kürzungen geboten, so können diese nur von dem Richter bzw. von dem Spruchkörper vorgenommen werden, der die Entscheidung gefällt hat.
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 19:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diese kurze gedruckte Handreichung hat das Hochschularchiv Aachen digitalisiert und ins Netz gestellt, siehe
http://goo.gl/GKj6U (Weblog des Hochschularchivs Aachen)
http://goo.gl/GKj6U (Weblog des Hochschularchivs Aachen)
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 18:51 - Rubrik: Universitaetsarchive
"Die umfangreichste Anthologie zum Thema. "Eine bewegende Zeitreise" (Titel Thesen Temperamente am letzten Sonntag). Alles Musikalische zum Vietnamkrieg. 13 CDs (330 Titel, rund 17 Stunden Spielzeit). PLUS LP-grosser, üppig gestalteter Bildband (ueber 300 illustrierte Seiten). PLUS CD-ROM mit allen Songtexten. Eindrucksvolle von Bear Family.
174,99 Euro.
Quelle: http://www.zweitausendeins.de/r.cfm?Nr=6846
"
174,99 Euro.
Quelle: http://www.zweitausendeins.de/r.cfm?Nr=6846
"
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Januar 2011, 17:55 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 12:55 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mitte dieser Woche startete die Digitalisierung der Urkunden des Stadtarchivs Speyer, die im Rahmen des DFG-Projekts "Virtuelles deutsches Urkundennetzwerk" erfolgt. Gestern fand ein Pressetermin mit dem Speyerer Oberbürgermeister statt, der gute Resonanz fand. In den nächsten Wochen werden durch die beiden ICARUS-Mitarbeiter auch die Urkunden des Bistumsarchivs Speyer sowie der Stadtarchive Mainz und Worms gescannt.
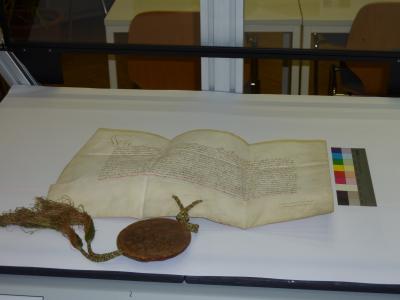



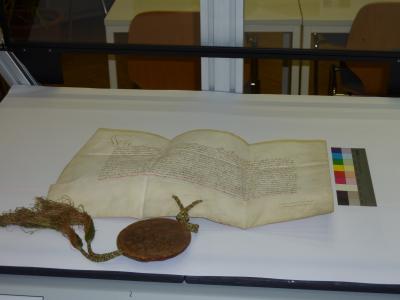



J. Kemper - am Freitag, 21. Januar 2011, 09:49 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1 74329 17.12.03 Deutsche Drucke des 16. Jahrhunderts im WWW KlausGraf
2 32578 04.09.03 Linkliste Lateinische Texte im Internet KlausGraf
3 27853 20.01.04 Neue Soziale Bewegungen: Archive von unten adi
4 24884 06.06.07 Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe KlausGraf
5 24209 06.03.03 Bildersuchmaschinen KlausGraf
6 24110 15.06.03 Urheberrecht im WWW KlausGraf
7 19173 03.04.03 Deutsche Archivbibliotheken mit Internetkatalogen KlausGraf
8 18416 15.07.05 Finding E-Books KlausGraf
9 17234 14.06.04 Digitalisierte Zeitschriften der Geschichtswissenschaft KlausGraf
10 16855 31.05.04 Open Access und Edition KlausGraf
11 15864 20.11.06 Rechtsfragen von Open Access KlausGraf
12 15201 14.05.05 Fürstenhaus Ysenburg-Büdingen verscherbelt Kulturgut KlausGraf
13 13872 28.05.07 Kirchenbücher digital: Evangelische Kirchenarchive planen gnadenlose Abzocke KlausGraf
14 13765 04.04.03 Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl KlausGraf
15 12806 02.05.03 Übersicht der von Gallica faksimilierten Bände der MGH KlausGraf
16 12397 03.03.09 Köln: Historisches Stadtarchiv eingestürzt Wolf Thomas
17 11621 25.11.05 Du bist Deutschland - ein Foto macht Furore - Bildrechtliches KlausGraf
18 11346 07.04.04 Reader Elektronisches Publizieren und Open Access KlausGraf
19 11280 01.03.08 Google Books mit US-Proxy leicht gemacht KlausGraf
20 11266 12.12.06 Wem gehören die badischen Kroninsignien? KlausGraf
21 10466 24.11.04 Archive auf dem Markt? hochstuhl
22 10328 12.11.07 Wie geht das mit dem US-Proxy? KlausGraf
23 9838 05.01.07 UB Eichstätt vernichtet Kulturgut KlausGraf
24 9743 22.02.07 Bücher weggeben statt wegwerfen KlausGraf
25 9720 05.01.05 Digitalisierung auf Ein-Euro-Job-Basis KlausGraf
Letzte Liste:
http://archiv.twoday.net/stories/8413096/
Die 4 Prinzen rücken unaufhaltsam vor!
2 32578 04.09.03 Linkliste Lateinische Texte im Internet KlausGraf
3 27853 20.01.04 Neue Soziale Bewegungen: Archive von unten adi
4 24884 06.06.07 Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe KlausGraf
5 24209 06.03.03 Bildersuchmaschinen KlausGraf
6 24110 15.06.03 Urheberrecht im WWW KlausGraf
7 19173 03.04.03 Deutsche Archivbibliotheken mit Internetkatalogen KlausGraf
8 18416 15.07.05 Finding E-Books KlausGraf
9 17234 14.06.04 Digitalisierte Zeitschriften der Geschichtswissenschaft KlausGraf
10 16855 31.05.04 Open Access und Edition KlausGraf
11 15864 20.11.06 Rechtsfragen von Open Access KlausGraf
12 15201 14.05.05 Fürstenhaus Ysenburg-Büdingen verscherbelt Kulturgut KlausGraf
13 13872 28.05.07 Kirchenbücher digital: Evangelische Kirchenarchive planen gnadenlose Abzocke KlausGraf
14 13765 04.04.03 Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl KlausGraf
15 12806 02.05.03 Übersicht der von Gallica faksimilierten Bände der MGH KlausGraf
16 12397 03.03.09 Köln: Historisches Stadtarchiv eingestürzt Wolf Thomas
17 11621 25.11.05 Du bist Deutschland - ein Foto macht Furore - Bildrechtliches KlausGraf
18 11346 07.04.04 Reader Elektronisches Publizieren und Open Access KlausGraf
19 11280 01.03.08 Google Books mit US-Proxy leicht gemacht KlausGraf
20 11266 12.12.06 Wem gehören die badischen Kroninsignien? KlausGraf
21 10466 24.11.04 Archive auf dem Markt? hochstuhl
22 10328 12.11.07 Wie geht das mit dem US-Proxy? KlausGraf
23 9838 05.01.07 UB Eichstätt vernichtet Kulturgut KlausGraf
24 9743 22.02.07 Bücher weggeben statt wegwerfen KlausGraf
25 9720 05.01.05 Digitalisierung auf Ein-Euro-Job-Basis KlausGraf
Letzte Liste:
http://archiv.twoday.net/stories/8413096/
Die 4 Prinzen rücken unaufhaltsam vor!
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 03:09 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bernd Fuhrmann: Konrad von Weinsberg. Facetten eines adligen Lebens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Studien zur Geschichte des Mittelalters 3). Herne: Gabriele Schäfer Verlag 2010. 134 S., 19,50 Euro
Wer einen lieblos ausgekippten Zettelkasten schätzt, wird dieses schmale Buch lieben. An der Person des Porträtierten liegt es nicht, wenn man das Werk unbefriedigt aus der Hand legt: Konrad von Weinsberg (um 1370-1448) ist eigentlich eine faszinierende Persönlichkeit - als Reichspolitiker und kaufmännisch agierender adeliger Unternehmer. Der Autor, Professor an der Uni Siegen, folgt dem Leben seines Protagonisten im wesentlichen chronologisch, reichspolitische Entwicklungen und alltagsgeschichtliche Notizen aus den Rechnungsbüchern Konrads verbindend. Es gibt zwar Fußnoten, die eine solide Vertrautheit mit der Sekundärliteratur demonstrieren, aber wer ein Detail aus den Quellen zu Konrad von Weinsberg verifizieren möchte, muss die Monographie Fuhrmanns von 2004 "Konrad von Weinsberg – Ein adliger Oikos zwischen Territorium und Reich" konsultieren, die glücklicherweise bei Google Books durchsuchbar und zu großen Teilen lesbar ist:
http://books.google.de/books?id=yIfmnC80ZnAC
Nach dem Textbaustein-Prinzip sind diesem Buch sehr viele Passagen des hier zu besprechenden Büchleins entlehnt.
Es gibt eine Fülle reizvoller und anschaulicher Details in dem Buch, aber diese gehen unter in einem langweiligen, schlecht organisierten und geschriebenen Text, der an allen Aspekten, die nicht Reichspolitik und Wirtschaftsgeschichte betreffen, desinteressiert bleibt.
Es kann doch nicht sein, dass der Leser nichts über den Grund erfährt, wieso Fuhrmann so genau über die Einnahmen und Ausgaben Konrads Bescheid weiß, also über die bemerkenswerte Überlieferungsbildung Konrads, dessen Archiv - wenngleich nur teilweise - im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein erhalten blieb. Es wäre zu fragen, ob Konrads Sinn für Schriftlichkeit außergewöhnlich war (wozu ich tendiere) oder dem entsprach, was vergleichbare Herren praktizierten.
Ich selbst habe mich, von Fuhrmann nicht wahrgenommen, vor längerer Zeit mit Konrad von Weinsberg beschäftigt: Klaus Graf: Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447) aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv. In: Hohenstaufen, Helfenstein 2, 1992, S. 55-73. Auf Konrads Religiosität und Stiftungsfrömmigkeit fällt durch diese Arbeit bzw. die in ihr edierten Quellen einiges Licht. Fuhrmann übergeht die Beziehungen Konrads zur Literatur, obwohl es im "Verfasserlexikon" einen Artikel zu Konrad gibt. Ebenso kommt die Bedeutung des Fehdewesens zu kurz.
Das Literaturverzeichnis ist viel zu dünn. Man vermisst etwa die Monographien von Karasek (1967) und Welck (1973) zu Konrad, aber auch die bei Google Books einsehbare, wenngleich unzulängliche alte Ausgabe des Einnahme- und Ausgaberegisters 1437/38:
http://books.google.de/books?id=J1RJ-SamHAUC
Wenn das Buch wenigstens einige Bilder aufweisen würde! Aber schon das Titelbild, eine Münze aus der Zeit Sigismunds, zeugt davon, dass Fuhrmann keine Ahnung davon hat, wie man Lesern eine solche Biographie schmackhaft machen kann (Beispiele, wie man es besser machen kann: http://archiv.twoday.net/stories/5030448/ http://archiv.twoday.net/stories/6023519/ ). An möglichen Abbildungen fehlt es nicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_IX._(Weinsberg)
Gern hätte man etwa Beispiele für eigenhändige Aufzeichnungen Konrads abgebildet gesehen.
 Grabmalentwurf
Grabmalentwurf
Unterdurchschnittlich ist Fuhrmanns Wissenschaftssprache. Der erste holprige Satz ist Programm: "Als Konrad um 1370 das Licht der Welt erblickte, war wohl kaum abzusehen, dass es sich um das letzte bedeutende Familienmitglied handeln würde, dessen Erben nach seinem Tod am 18. Januar 1448 nur noch über geringe Besitzungen verfügten, in der Überlieferung kaum noch zu fassen sind". Zitiert werden sollen auch die ersten Sätze des ersten Kapitels: "Die frühesten Weinsberger lassen sich im 12. Jahrhundert im Umkreis und im Dienst der staufischen Könige und Kaiser erkennen, die Reste der namensgebenden, einst mächtigen Burganlage liegen unweit von Heilbronn. Dass sie als Herren bezeichnet wurden, lässt ein Herauswachsen aus dem Niederadel erkennen, sie zählten nunmehr zu den edelfreien Familien. Zahlreich waren die Heiratsverbindungen mit anderen Adelsfamilien, doch trotz aller Bindungen kam es nicht zuletzt mit den vielfältig verwandten und benachbarten Hohenlohern immer wieder zu Konflikten, aber auch ein gemeinsames Vorgehen beider Familien lässt sich immer wieder erkennen". Was gibt uns diese Passage zu erkennen?
Es wundert angesichts dieser ungenauen Ausdrucksweise nicht, dass eine stringente Gedankenführung nicht vorhanden ist. Glücklicherweise liegt das Buch nur gedruckt vor, für das Internet wäre es wirklich nicht gut genug ...

Wer einen lieblos ausgekippten Zettelkasten schätzt, wird dieses schmale Buch lieben. An der Person des Porträtierten liegt es nicht, wenn man das Werk unbefriedigt aus der Hand legt: Konrad von Weinsberg (um 1370-1448) ist eigentlich eine faszinierende Persönlichkeit - als Reichspolitiker und kaufmännisch agierender adeliger Unternehmer. Der Autor, Professor an der Uni Siegen, folgt dem Leben seines Protagonisten im wesentlichen chronologisch, reichspolitische Entwicklungen und alltagsgeschichtliche Notizen aus den Rechnungsbüchern Konrads verbindend. Es gibt zwar Fußnoten, die eine solide Vertrautheit mit der Sekundärliteratur demonstrieren, aber wer ein Detail aus den Quellen zu Konrad von Weinsberg verifizieren möchte, muss die Monographie Fuhrmanns von 2004 "Konrad von Weinsberg – Ein adliger Oikos zwischen Territorium und Reich" konsultieren, die glücklicherweise bei Google Books durchsuchbar und zu großen Teilen lesbar ist:
http://books.google.de/books?id=yIfmnC80ZnAC
Nach dem Textbaustein-Prinzip sind diesem Buch sehr viele Passagen des hier zu besprechenden Büchleins entlehnt.
Es gibt eine Fülle reizvoller und anschaulicher Details in dem Buch, aber diese gehen unter in einem langweiligen, schlecht organisierten und geschriebenen Text, der an allen Aspekten, die nicht Reichspolitik und Wirtschaftsgeschichte betreffen, desinteressiert bleibt.
Es kann doch nicht sein, dass der Leser nichts über den Grund erfährt, wieso Fuhrmann so genau über die Einnahmen und Ausgaben Konrads Bescheid weiß, also über die bemerkenswerte Überlieferungsbildung Konrads, dessen Archiv - wenngleich nur teilweise - im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein erhalten blieb. Es wäre zu fragen, ob Konrads Sinn für Schriftlichkeit außergewöhnlich war (wozu ich tendiere) oder dem entsprach, was vergleichbare Herren praktizierten.
Ich selbst habe mich, von Fuhrmann nicht wahrgenommen, vor längerer Zeit mit Konrad von Weinsberg beschäftigt: Klaus Graf: Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447) aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv. In: Hohenstaufen, Helfenstein 2, 1992, S. 55-73. Auf Konrads Religiosität und Stiftungsfrömmigkeit fällt durch diese Arbeit bzw. die in ihr edierten Quellen einiges Licht. Fuhrmann übergeht die Beziehungen Konrads zur Literatur, obwohl es im "Verfasserlexikon" einen Artikel zu Konrad gibt. Ebenso kommt die Bedeutung des Fehdewesens zu kurz.
Das Literaturverzeichnis ist viel zu dünn. Man vermisst etwa die Monographien von Karasek (1967) und Welck (1973) zu Konrad, aber auch die bei Google Books einsehbare, wenngleich unzulängliche alte Ausgabe des Einnahme- und Ausgaberegisters 1437/38:
http://books.google.de/books?id=J1RJ-SamHAUC
Wenn das Buch wenigstens einige Bilder aufweisen würde! Aber schon das Titelbild, eine Münze aus der Zeit Sigismunds, zeugt davon, dass Fuhrmann keine Ahnung davon hat, wie man Lesern eine solche Biographie schmackhaft machen kann (Beispiele, wie man es besser machen kann: http://archiv.twoday.net/stories/5030448/ http://archiv.twoday.net/stories/6023519/ ). An möglichen Abbildungen fehlt es nicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_IX._(Weinsberg)
Gern hätte man etwa Beispiele für eigenhändige Aufzeichnungen Konrads abgebildet gesehen.
 Grabmalentwurf
GrabmalentwurfUnterdurchschnittlich ist Fuhrmanns Wissenschaftssprache. Der erste holprige Satz ist Programm: "Als Konrad um 1370 das Licht der Welt erblickte, war wohl kaum abzusehen, dass es sich um das letzte bedeutende Familienmitglied handeln würde, dessen Erben nach seinem Tod am 18. Januar 1448 nur noch über geringe Besitzungen verfügten, in der Überlieferung kaum noch zu fassen sind". Zitiert werden sollen auch die ersten Sätze des ersten Kapitels: "Die frühesten Weinsberger lassen sich im 12. Jahrhundert im Umkreis und im Dienst der staufischen Könige und Kaiser erkennen, die Reste der namensgebenden, einst mächtigen Burganlage liegen unweit von Heilbronn. Dass sie als Herren bezeichnet wurden, lässt ein Herauswachsen aus dem Niederadel erkennen, sie zählten nunmehr zu den edelfreien Familien. Zahlreich waren die Heiratsverbindungen mit anderen Adelsfamilien, doch trotz aller Bindungen kam es nicht zuletzt mit den vielfältig verwandten und benachbarten Hohenlohern immer wieder zu Konflikten, aber auch ein gemeinsames Vorgehen beider Familien lässt sich immer wieder erkennen". Was gibt uns diese Passage zu erkennen?
Es wundert angesichts dieser ungenauen Ausdrucksweise nicht, dass eine stringente Gedankenführung nicht vorhanden ist. Glücklicherweise liegt das Buch nur gedruckt vor, für das Internet wäre es wirklich nicht gut genug ...

KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:37 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der BGH hat die Stellung der Übersetzer hinsichtlich der Nebenrechte gestärkt, was die Verlage, die die Übersetzer bisher denkbar schlecht behandelt haben, damit der eigene Profit größer ist, verständlicherweise wenig erfreut.
http://www.boersenblatt.net/410768/
Update: http://www.urheberrecht.org/news/4166/ Az.: I ZR 19/09
http://www.boersenblatt.net/410768/
Update: http://www.urheberrecht.org/news/4166/ Az.: I ZR 19/09
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/2609
Siehe http://archiv.twoday.net/stories/11580799/
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11345
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11355
Siehe http://archiv.twoday.net/stories/11580799/
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11345
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11355
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 01:21 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=11325
"Die US-Firma ion Audio hat auf der CES-Messe ein handliches Digitalisierungsgerät vorgestellt, welches bald in den Handel kommen soll. Kostenschätzungen belaufen sich momentan zwischen 150 und 200 US-Dollar."
"Die US-Firma ion Audio hat auf der CES-Messe ein handliches Digitalisierungsgerät vorgestellt, welches bald in den Handel kommen soll. Kostenschätzungen belaufen sich momentan zwischen 150 und 200 US-Dollar."
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:53 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Downloadcharts sind ein gutes Mittel, meint aufgrund von Erfahrungen an der FH Hannover
http://infobib.de/blog/2011/01/20/einwerben-von-inhalten-download-charts/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264283/
http://infobib.de/blog/2011/01/20/einwerben-von-inhalten-download-charts/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264283/
KlausGraf - am Freitag, 21. Januar 2011, 00:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 18:13 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 16:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.manuscripta.at/kataloge/
Neu sind vor allem: Menhardt: Klagenfurt usw. 1927 sowie die bisher via Internet Archive benutzbaren Zisterzienserbibliotheken (in den Xenia Bernardina).
Neu sind vor allem: Menhardt: Klagenfurt usw. 1927 sowie die bisher via Internet Archive benutzbaren Zisterzienserbibliotheken (in den Xenia Bernardina).
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 07:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hermann Julius Hermann, Die illuminierten Handschriften in Tirol (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich 1), Leipzig 1905, S. 118f.
Sie befinden sich heute vermutlich im Landesarchiv Tirol in Innsbruck.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=illuminiert
Sie befinden sich heute vermutlich im Landesarchiv Tirol in Innsbruck.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=illuminiert
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 06:50 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der von Bernhard und Hans Peter Sandbichler bearbeitete Katalog ist online unter:
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=C275
Dass bei Hainrich Erelbach zu Landshut und Regensburg (1471), einem der Schreiber des Vintlerschen Arzneibuchs FB 32008 (fehlt im Handschriftencensus!), ein Zusammenhang mit dem bekannten ehemaligen Augsburger Stadtschreiber Heinrich Erlbach (1472 in Regensburg hingerichtet) besteht, scheint mir plausibel, bedarf aber weiterer Prüfung. [Update: Mit Mail vom 20.1.2011 teilt Prof. Dr. Franz Fuchs freundlicherweise mit: "Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Schreiber mit dem ehemaligen Augsburger Ratsschreiber und späteren Kanzler Herzog Wolfgangs von Bayern identisch ist. Die Belege für seine Aufenthalte in Landshut und Regensburg finden sich in den Aufsätzen in der Festschrift für Hermann Jakobs bzw. in der Festschrift für Kurt Reindel. Sein gleichnamiger Sohn, Heinrich Erlbach der Jüngere (später Mönch in St. Emmeram) kommt als Schreiber nicht in Frage, da er damals noch ein Kind war."
2011 wies mich Fuchs per Mail darauf hin, dass er die Herkunft Erlbachs aus Schwäbisch Hall herausfinden konnte, was übrigens der Haller Forschung seit langem bekannt war, wie ich jetzt Andreas Deutsch: Die Abenteuer des Conrad Gickenbach – ein Schwäbisch Haller Schulmeister studierte 1378 in Paris, in: Hellmar Weber (Hrsg.), Acht Jahrhunderte Schulgeschichte in Text und Bild - Gymnasium bei St. Michael, Schwäbisch Hall 2014, S. 37-56, hier S. 51 entnehme. Er war der Sohn des bis 1412 amtierenden Haller Stadtschreibers Friedrich Erlebach.]
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B157 (S. 157ff.)
Von Erlbach stammt die Budapester Handschrift http://www.handschriftencensus.de/13698
S. 164 hätte man bei Bl. 171v bei den dt. Pestrezepten des Meister Michael Schruh nun wirklich an Michael Puff aus Schrick denken können (zu lat. Pestrezepten von ihm ²VL 7, 907).
Zu Hans Wirker Bl. 172r ff. s. nun ²VL 10, 1250 mit Nennung der Innsbrucker Handschrift
http://www.libreka.de/9783110156065/635
***
FB 32324 fehlt im Handschriftencensus. Die dt. Ulrichslegende 3. V. 15. Jh., Fragment aus einer umfangreicheren Handschrift, weist das Incipit auf, das Williams-Krapp, Legendare, 1986, 466 für fast alle Drucke des "Heiligen Leben" ab d4 (1477) gibt. Es handelt sich aber auch um den Textanfang der Ulrichprosa, die man nach ²VL 9, 1242 aus Cgm 402, 568, 751 kennt.
***
Wappensammlung um 1500 Dip. 1037/VI mit Wappen bayr. Geschlechter (Landshuter Wasserzeichen 1487/9) - wird doch wohl nicht ein Rüxner (dessen Wappenbuch in UB Innsbruck 545) sein?
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B253
[Nachtrag: Dazu teilte Dr. Hansjörg Rabanser mit Mail vom 20. 1. 2011 mit: "die Digitalisate der Handschrift Innsbruck 545 und Dip. 1037/6 ähneln sich auf den ersten Blick, sind jedoch nicht ident. Ich konnte keine übereinstimmenden Seiten entdecken; Seiten, auf denen sich Wappen mit umfangreicheren handschriftlichen Notizen oder aber nur handschriftliche Notizen befinden, scheinen in Dip. nicht auf. Auch besteht die Dip.-Version nur aus wenigen Blättern und die Wappendarstellungen scheinen von zwei Personen gemalt worden zu sein oder aber z.T. Skizzen zu sein, da bei manchen Wappen die feine Ausführung (stärkere Konturen, detailreichere Zeichnung etc.) fehlt. Auch das Schriftbild ist meines Erachtens nicht ident.". Damit kann man zwar Rüxner als möglichen Initiator des Wappenbuchs nicht ausschließen, aber es wäre zu spekulativ ihn mit der Handschrift in Verbindung zu bringen.]
Nachtrag 2014: Zu Dionysius Sibenburgers Arzneibuch FB 1981 siehe
http://archiv.twoday.net/stories/953085301/
#forschung
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=C275
Dass bei Hainrich Erelbach zu Landshut und Regensburg (1471), einem der Schreiber des Vintlerschen Arzneibuchs FB 32008 (fehlt im Handschriftencensus!), ein Zusammenhang mit dem bekannten ehemaligen Augsburger Stadtschreiber Heinrich Erlbach (1472 in Regensburg hingerichtet) besteht, scheint mir plausibel, bedarf aber weiterer Prüfung. [Update: Mit Mail vom 20.1.2011 teilt Prof. Dr. Franz Fuchs freundlicherweise mit: "Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Schreiber mit dem ehemaligen Augsburger Ratsschreiber und späteren Kanzler Herzog Wolfgangs von Bayern identisch ist. Die Belege für seine Aufenthalte in Landshut und Regensburg finden sich in den Aufsätzen in der Festschrift für Hermann Jakobs bzw. in der Festschrift für Kurt Reindel. Sein gleichnamiger Sohn, Heinrich Erlbach der Jüngere (später Mönch in St. Emmeram) kommt als Schreiber nicht in Frage, da er damals noch ein Kind war."
2011 wies mich Fuchs per Mail darauf hin, dass er die Herkunft Erlbachs aus Schwäbisch Hall herausfinden konnte, was übrigens der Haller Forschung seit langem bekannt war, wie ich jetzt Andreas Deutsch: Die Abenteuer des Conrad Gickenbach – ein Schwäbisch Haller Schulmeister studierte 1378 in Paris, in: Hellmar Weber (Hrsg.), Acht Jahrhunderte Schulgeschichte in Text und Bild - Gymnasium bei St. Michael, Schwäbisch Hall 2014, S. 37-56, hier S. 51 entnehme. Er war der Sohn des bis 1412 amtierenden Haller Stadtschreibers Friedrich Erlebach.]
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B157 (S. 157ff.)
Von Erlbach stammt die Budapester Handschrift http://www.handschriftencensus.de/13698
S. 164 hätte man bei Bl. 171v bei den dt. Pestrezepten des Meister Michael Schruh nun wirklich an Michael Puff aus Schrick denken können (zu lat. Pestrezepten von ihm ²VL 7, 907).
Zu Hans Wirker Bl. 172r ff. s. nun ²VL 10, 1250 mit Nennung der Innsbrucker Handschrift
***
FB 32324 fehlt im Handschriftencensus. Die dt. Ulrichslegende 3. V. 15. Jh., Fragment aus einer umfangreicheren Handschrift, weist das Incipit auf, das Williams-Krapp, Legendare, 1986, 466 für fast alle Drucke des "Heiligen Leben" ab d4 (1477) gibt. Es handelt sich aber auch um den Textanfang der Ulrichprosa, die man nach ²VL 9, 1242 aus Cgm 402, 568, 751 kennt.
***
Wappensammlung um 1500 Dip. 1037/VI mit Wappen bayr. Geschlechter (Landshuter Wasserzeichen 1487/9) - wird doch wohl nicht ein Rüxner (dessen Wappenbuch in UB Innsbruck 545) sein?
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=sandbichler&page_fn=B253
[Nachtrag: Dazu teilte Dr. Hansjörg Rabanser mit Mail vom 20. 1. 2011 mit: "die Digitalisate der Handschrift Innsbruck 545 und Dip. 1037/6 ähneln sich auf den ersten Blick, sind jedoch nicht ident. Ich konnte keine übereinstimmenden Seiten entdecken; Seiten, auf denen sich Wappen mit umfangreicheren handschriftlichen Notizen oder aber nur handschriftliche Notizen befinden, scheinen in Dip. nicht auf. Auch besteht die Dip.-Version nur aus wenigen Blättern und die Wappendarstellungen scheinen von zwei Personen gemalt worden zu sein oder aber z.T. Skizzen zu sein, da bei manchen Wappen die feine Ausführung (stärkere Konturen, detailreichere Zeichnung etc.) fehlt. Auch das Schriftbild ist meines Erachtens nicht ident.". Damit kann man zwar Rüxner als möglichen Initiator des Wappenbuchs nicht ausschließen, aber es wäre zu spekulativ ihn mit der Handschrift in Verbindung zu bringen.]
Nachtrag 2014: Zu Dionysius Sibenburgers Arzneibuch FB 1981 siehe
http://archiv.twoday.net/stories/953085301/
#forschung
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 04:24 - Rubrik: Kodikologie
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600664.pdf
Exverpt from this Editorial of The Lancet:
When news came last week that several large publishers—including Elsevier (our publisher), Lippincott Williams & Wilkins, and Springer—had withdrawn journals from HINARI’s Bangladesh programme (and other countries too, such as Kenya and Nigeria, although the full extent of withdrawal remains unclear), there was a collective cry of betrayal. When challenged, one publisher, that of Science, immediately reversed its decision. Unknown to editors at The Lancet, our journals were also part of this withdrawal. Elsevier too, has now reinstated its journals into HINARI for Bangladesh. [...]
Our view is that any country designated as “low human development” by the UN justifies a clear and unambiguous commitment by all publishers to full and free access to research through HINARI. Low human development means exactly that—high burdens of avoidable morbidity and mortality among the most vulnerable populations. Bangladesh’s maternal mortality ratio is 338 per 100 000 livebirths, Kenya’s 413, and Nigeria’s 608. In the UK it is 8. Free access to critical knowledge is vital if those countries are to address their huge burdens of preventable disease.
If publishers are genuine about their mission to improve health through partnerships with medical and research communities, they need to send a stronger signal of commitment to countries that most need the knowledge they control. For our part, we have asked Elsevier to assure us that the editors will be consulted on all future HINARI access negotiations involving The Lancet. That assurance has been given.
See also in The Lancet: "Big publishers cut access to journals in poor countries"
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600676.pdf
See also
http://archiv.twoday.net/stories/11573652/
Exverpt from this Editorial of The Lancet:
When news came last week that several large publishers—including Elsevier (our publisher), Lippincott Williams & Wilkins, and Springer—had withdrawn journals from HINARI’s Bangladesh programme (and other countries too, such as Kenya and Nigeria, although the full extent of withdrawal remains unclear), there was a collective cry of betrayal. When challenged, one publisher, that of Science, immediately reversed its decision. Unknown to editors at The Lancet, our journals were also part of this withdrawal. Elsevier too, has now reinstated its journals into HINARI for Bangladesh. [...]
Our view is that any country designated as “low human development” by the UN justifies a clear and unambiguous commitment by all publishers to full and free access to research through HINARI. Low human development means exactly that—high burdens of avoidable morbidity and mortality among the most vulnerable populations. Bangladesh’s maternal mortality ratio is 338 per 100 000 livebirths, Kenya’s 413, and Nigeria’s 608. In the UK it is 8. Free access to critical knowledge is vital if those countries are to address their huge burdens of preventable disease.
If publishers are genuine about their mission to improve health through partnerships with medical and research communities, they need to send a stronger signal of commitment to countries that most need the knowledge they control. For our part, we have asked Elsevier to assure us that the editors will be consulted on all future HINARI access negotiations involving The Lancet. That assurance has been given.
See also in The Lancet: "Big publishers cut access to journals in poor countries"
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673611600676.pdf
See also
http://archiv.twoday.net/stories/11573652/
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 03:23 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Historiographie & archivistique
Ecriture et méthodes de l'histoire à l'aune de la mise en archives
sous la direction de Philippe Poirrier et Julie Lauvernier
Online Open Access einsehbar unter:
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/historiographie/historiographie.html
SOMMAIRE
Introduction, par Philippe Poirrier
De l'archive au document. Remarques sur l'évolution des régimes documentaires entre le XIXe et le XXIe siècle- Bertrand Müller
Classer et inventorier. Des gestes archivistiques révélateurs d'intentions historiographiques - Julie Lauvernier
Remuements de chartes et passage à l’histoire : la fatalité du déficit de récit dans les programmes centralisés de collecte de sources (1750-1850) - Odile Parsis-Barubé
Des outils pour l'histoire ? Les "Inventaires et documents" des Archives de l'Empire. 1857-1868 - Christine Nougaret
Michel de Certeau et l'archive - François Dosse
Quelles archives soviétiques ? Réflexion sur la constitution des archives du pouvoir stalinien - François-Xavier Nérard
1990-2010 : archives et écriture(s) du PCF - Jean Vigreux
Les enjeux de la politique des archives en France - Vincent Duclert
Postface - Françoise Hildesheimer
Point de vue :
Archives du « spectacle vivant », usages et écriture de l'histoire - Pascale Goetschel
Comptes rendus d'ouvrages :
Cœuré (Sophie), La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi, puis soviétique, Paris, Payot, 2006, par Vincent Chambarlhac
De l’Ancien Régime à l’Empire. Mutations de l’État, avatars des archives, études réunies par Bruno Delmas, Dominique Margairaz et Denise Ogilvie, Bibliothèque de l’École des chartes, t. 166, 2008, par Patrice Marcilloux.
Delmas (Bruno), La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des archives en France, Paris, Bourin éd., 2006, par Julie Lauvernier
Les archives orales : bilan, enjeux et perspectives. Actes du colloque de la Section des archives communales et intercommunales de l’AAF 2008, La Gazette des archives, n° 211, 2008-3, par Florence Descamps
Les archives. Patrimoine et richesse de l'entreprise. La Gazette des archives - 2009-1, par Jean-Claude Daumas
Hiraux Françoise [éd.], Les archives audiovisuelles. Politiques et pratiques dans la société de l’information, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2009, par Xavier Vigna
Hottin Christian, Des hommes, des lieux, des archives : pour une autre pratique de l’archivistique, Paris : LAHIC et Mission à l’ethnologie, 2009 par Anne-Marie Bruleaux
Ecriture et méthodes de l'histoire à l'aune de la mise en archives
sous la direction de Philippe Poirrier et Julie Lauvernier
Online Open Access einsehbar unter:
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/historiographie/historiographie.html
SOMMAIRE
Introduction, par Philippe Poirrier
De l'archive au document. Remarques sur l'évolution des régimes documentaires entre le XIXe et le XXIe siècle- Bertrand Müller
Classer et inventorier. Des gestes archivistiques révélateurs d'intentions historiographiques - Julie Lauvernier
Remuements de chartes et passage à l’histoire : la fatalité du déficit de récit dans les programmes centralisés de collecte de sources (1750-1850) - Odile Parsis-Barubé
Des outils pour l'histoire ? Les "Inventaires et documents" des Archives de l'Empire. 1857-1868 - Christine Nougaret
Michel de Certeau et l'archive - François Dosse
Quelles archives soviétiques ? Réflexion sur la constitution des archives du pouvoir stalinien - François-Xavier Nérard
1990-2010 : archives et écriture(s) du PCF - Jean Vigreux
Les enjeux de la politique des archives en France - Vincent Duclert
Postface - Françoise Hildesheimer
Point de vue :
Archives du « spectacle vivant », usages et écriture de l'histoire - Pascale Goetschel
Comptes rendus d'ouvrages :
Cœuré (Sophie), La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi, puis soviétique, Paris, Payot, 2006, par Vincent Chambarlhac
De l’Ancien Régime à l’Empire. Mutations de l’État, avatars des archives, études réunies par Bruno Delmas, Dominique Margairaz et Denise Ogilvie, Bibliothèque de l’École des chartes, t. 166, 2008, par Patrice Marcilloux.
Delmas (Bruno), La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des archives en France, Paris, Bourin éd., 2006, par Julie Lauvernier
Les archives orales : bilan, enjeux et perspectives. Actes du colloque de la Section des archives communales et intercommunales de l’AAF 2008, La Gazette des archives, n° 211, 2008-3, par Florence Descamps
Les archives. Patrimoine et richesse de l'entreprise. La Gazette des archives - 2009-1, par Jean-Claude Daumas
Hiraux Françoise [éd.], Les archives audiovisuelles. Politiques et pratiques dans la société de l’information, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2009, par Xavier Vigna
Hottin Christian, Des hommes, des lieux, des archives : pour une autre pratique de l’archivistique, Paris : LAHIC et Mission à l’ethnologie, 2009 par Anne-Marie Bruleaux
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 03:14 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/bIWS0 = http://pusztaranger.wordpress.com
http://goo.gl/oODQ4 = freitag.de
"Die Internationale Georg Lukács-Gesellschaft ist beunruhigt über Berichte, die uns über Vorgänge im Lukács-Archiv erreichen. Es ist die Rede von einem „Amoklauf“ des neuen Leiters des Philosophischen Forschungsinstituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA). Es sind – so hören wir - Entlassungen einer Reihe von Forschern in Aussicht gestellt bzw. bereits vorgenommen worden. Betroffen sind wohl Sándor Ferencz, Pál Horváth, Miklós Mesterházi, Gáspár Miklós Tamás. Dagegen regt sich Widerstand unter den intellektuellen Freunden einer vielfältigen philosophischen Kultur in Ungarn. Eine ungarischsprachige Petition gegen diese Entwicklung ist in kurzer Zeit von mehr als 1900 Personen unterzeichnet worden. "
Es geht um
http://web.phil-inst.hu/lua/archivum/de/index.html
Q: Ingrid Strauch, clara-Liste
http://goo.gl/oODQ4 = freitag.de
"Die Internationale Georg Lukács-Gesellschaft ist beunruhigt über Berichte, die uns über Vorgänge im Lukács-Archiv erreichen. Es ist die Rede von einem „Amoklauf“ des neuen Leiters des Philosophischen Forschungsinstituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA). Es sind – so hören wir - Entlassungen einer Reihe von Forschern in Aussicht gestellt bzw. bereits vorgenommen worden. Betroffen sind wohl Sándor Ferencz, Pál Horváth, Miklós Mesterházi, Gáspár Miklós Tamás. Dagegen regt sich Widerstand unter den intellektuellen Freunden einer vielfältigen philosophischen Kultur in Ungarn. Eine ungarischsprachige Petition gegen diese Entwicklung ist in kurzer Zeit von mehr als 1900 Personen unterzeichnet worden. "
Es geht um
http://web.phil-inst.hu/lua/archivum/de/index.html
Q: Ingrid Strauch, clara-Liste
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 01:46 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
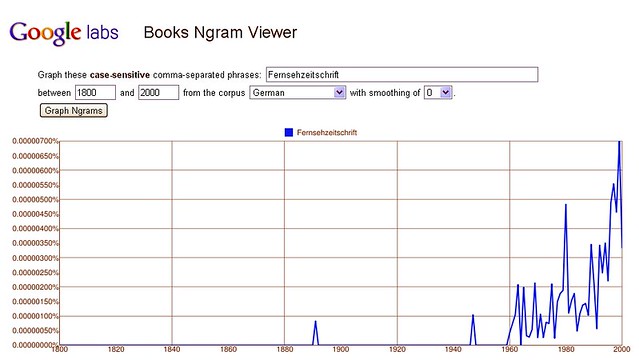
Eine echte Entdeckung. Schade, dass Google Books, die Datengrundlage, das Wort vor 1900 nicht belegen kann ...
Auch das Internet war immer wieder in deutschen Publikationen seit ca. 1820 Thema:
http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=internet&year_start=1800&year_end=2000&corpus=8&smoothing=0
Siehe auch
http://theaporetic.com/?p=1342
http://corpus.byu.edu/coha/compare-googleBooks.asp
http://searchengineland.com/when-ocr-goes-bad-googles-ngram-viewer-the-f-word-59181
http://thebinderblog.com/2010/12/17/googles-word-engine-isnt-ready-for-prime-time/ usw.
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 01:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.portraitindex.de
Via http://agfnz.historikerverband.de/?p=597 , das zurecht fragt, wieso die PND nicht angegeben wird.
Wieso gibt es nicht eine zitierfähige URL der Bilder?

Via http://agfnz.historikerverband.de/?p=597 , das zurecht fragt, wieso die PND nicht angegeben wird.
Wieso gibt es nicht eine zitierfähige URL der Bilder?

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 00:42 - Rubrik: Bildquellen
http://digital-textbooks.blogspot.com/
"DT Is Devoted To Documenting Significant Initiatives That Relate To Any And All Aspects Of Digital Textbooks, Most Notably Their Use In Higher Education"
Hier findet man u.a. den Hinweis auf eine Arbeit über Open Textbooks. "examining five open textbook platforms: (1) Wikibooks, (2) Connexions, (3) Flat World Knowledge, (4) The Global Text Project, and (5) Textbook Media. " (August 2009):
http://www.lib.ncsu.edu/dspc/opentextbookswhitepaper.pdf
"DT Is Devoted To Documenting Significant Initiatives That Relate To Any And All Aspects Of Digital Textbooks, Most Notably Their Use In Higher Education"
Hier findet man u.a. den Hinweis auf eine Arbeit über Open Textbooks. "examining five open textbook platforms: (1) Wikibooks, (2) Connexions, (3) Flat World Knowledge, (4) The Global Text Project, and (5) Textbook Media. " (August 2009):
http://www.lib.ncsu.edu/dspc/opentextbookswhitepaper.pdf
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Januar 2011, 00:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sammelbesprechung von zwei neuen Publikationen
Uwe Danker: Rezension zu: Gasteiner, Martin; Haber, Peter (Hrsg.): Digitale Arbeitstechniken für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien 2010, in: H-Soz-u-Kult, 19.01.2011,
Uwe Danker: Rezension zu: Schmale, Wolfgang: Digitale Geschichtswissenschaft. Wien 2010, in: H-Soz-u-Kult, 19.01.2011 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-041
Uwe Danker: Rezension zu: Gasteiner, Martin; Haber, Peter (Hrsg.): Digitale Arbeitstechniken für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien 2010, in: H-Soz-u-Kult, 19.01.2011,
Uwe Danker: Rezension zu: Schmale, Wolfgang: Digitale Geschichtswissenschaft. Wien 2010, in: H-Soz-u-Kult, 19.01.2011 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-041
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://gatewaytothekoran.wordpress.com/
Zu islamischen Handschriften siehe
http://archiv.twoday.net/stories/11445658/
Zu islamischen Handschriften siehe
http://archiv.twoday.net/stories/11445658/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 23:47 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.google.com/cse/home?cx=016148348663094492773:zw9hmxnt2e0
Eine Suche nach Archivalia argibt: Dieses Blog wird dort so gut wie nicht wahrgenommen.
Eine Suche nach Archivalia argibt: Dieses Blog wird dort so gut wie nicht wahrgenommen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hathitrust.worldcat.org/
Die HT-eigene Suche ist erheblich besser. Schon allein die denkbar benutzerunfreundliche einzelne Aufführung von Erscheinungsjahren im WorldCat anstelle von Intervallen ist erheblich schlechter.
Die HT-eigene Suche ist erheblich besser. Schon allein die denkbar benutzerunfreundliche einzelne Aufführung von Erscheinungsjahren im WorldCat anstelle von Intervallen ist erheblich schlechter.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 22:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 22:47 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dlib.org/dlib/january11/01contents.html
"The first piece is a brief introduction to DataCite written by the Guest Editors. This is followed by nine articles on various data related topics, eight of which are derived from that DataCite meeting last summer and one of which (Waaijers) happened to come in unsolicited at the time we were putting the issue together and was too good to leave out. The articles cover a wide variety of topics, including the acquisition and management of scientific data, the quality and trustworthiness of that data, the connections between data and traditional scholarly publishing, metadata for datasets, and last but not least a peer reviewed journal devoted to the publication of datasets."
"The first piece is a brief introduction to DataCite written by the Guest Editors. This is followed by nine articles on various data related topics, eight of which are derived from that DataCite meeting last summer and one of which (Waaijers) happened to come in unsolicited at the time we were putting the issue together and was too good to leave out. The articles cover a wide variety of topics, including the acquisition and management of scientific data, the quality and trustworthiness of that data, the connections between data and traditional scholarly publishing, metadata for datasets, and last but not least a peer reviewed journal devoted to the publication of datasets."
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 22:37 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die SKD haben als einziges deutsches Museum die Berliner Erklärung für Open Access bei ihrem Start 2003 unterzeichnet - und buchstäblich nichts getan, was man als Förderung von Open Access verstehen könnte. Im Gegenteil: Hinsichtlich der Nutzung von Reproduktionen stehen sie an der Seite des Abzock-Modells der Stiftung Preuß. KB.
Dieser Punkt wird nicht angesprochen in dem Interview im "Culture to go Blog":
http://goo.gl/HJxZb
Dieser Punkt wird nicht angesprochen in dem Interview im "Culture to go Blog":
http://goo.gl/HJxZb
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 22:09 - Rubrik: Open Access
http://telota.bbaw.de/mega/
Die Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) ist die historisch-kritische Edition der Veröffentlichungen, der Manuskripte und des Briefwechsels von Karl Marx und Friedrich Engels, und sie erscheint im Akademie Verlag (Berlin). Die MEGA präsentiert ihre Texte in vier Abteilungen. In der II. Abteilung "'Das Kapital' und Vorarbeiten" werden alle Textfassungen des ökonomischen Hauptwerkes von Marx publiziert, darunter auch umfangreiche, bislang unveröffentlichte Manuskripte.
Für die digitale Ausgabe der MEGA werden die Edierten Texte dieser II. Abteilung und Teile der Editorischen Apparate im Rahmen eines Projekts der Telota-Arbeitsgruppe der BBAW und des Akademienvorhabens MEGA mit Unterstützung einer japanischen Forschergruppe sukzessive im Internet präsentiert. Damit werden zum einen die "Grundrisse" in historisch-kritischer Fassung online zugänglich gemacht, und zum anderen können die zahlreichen Manuskript-, Redaktions- und Druckfassungen zum ersten und zweiten Buch des "Kapital" verglichen werden. Wir danken dem Akademie Verlag (Berlin) für die Freigabe der Edierten Texte.
Derzeit kann man die Edierten Texte von fünf MEGA-Bänden einsehen und durchsuchen; für die verschiedenen Fassungen und Entwürfe zum zweiten Buch des "Kapital" über den Zirkulationsprozess des Kapitals ist zudem ein digitales kumuliertes Sachregister verfügbar. In Kürze wird auch der Edierte Text der Erstausgabe des ersten Buches des "Kapital" (Der Produktionsprozess des Kapitals) von 1867 bereitgestellt werden. Näheres zu den Inhalten von MEGAdigital und eine Liste der verfügbaren Bände mit ihren bibliographischen Angaben finden Sie in der Projektbeschreibung. Alle weiteren Texte und Apparate finden Sie in der Druckausgabe der MEGA.
Es handelt sich nur um E-Texte der Ausgabe. Das Angebot ist schon deshalb unzulänglich, da ein Zitieren einzelner Seiten mit dauerhafter URL nicht möglich ist.
Die Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) ist die historisch-kritische Edition der Veröffentlichungen, der Manuskripte und des Briefwechsels von Karl Marx und Friedrich Engels, und sie erscheint im Akademie Verlag (Berlin). Die MEGA präsentiert ihre Texte in vier Abteilungen. In der II. Abteilung "'Das Kapital' und Vorarbeiten" werden alle Textfassungen des ökonomischen Hauptwerkes von Marx publiziert, darunter auch umfangreiche, bislang unveröffentlichte Manuskripte.
Für die digitale Ausgabe der MEGA werden die Edierten Texte dieser II. Abteilung und Teile der Editorischen Apparate im Rahmen eines Projekts der Telota-Arbeitsgruppe der BBAW und des Akademienvorhabens MEGA mit Unterstützung einer japanischen Forschergruppe sukzessive im Internet präsentiert. Damit werden zum einen die "Grundrisse" in historisch-kritischer Fassung online zugänglich gemacht, und zum anderen können die zahlreichen Manuskript-, Redaktions- und Druckfassungen zum ersten und zweiten Buch des "Kapital" verglichen werden. Wir danken dem Akademie Verlag (Berlin) für die Freigabe der Edierten Texte.
Derzeit kann man die Edierten Texte von fünf MEGA-Bänden einsehen und durchsuchen; für die verschiedenen Fassungen und Entwürfe zum zweiten Buch des "Kapital" über den Zirkulationsprozess des Kapitals ist zudem ein digitales kumuliertes Sachregister verfügbar. In Kürze wird auch der Edierte Text der Erstausgabe des ersten Buches des "Kapital" (Der Produktionsprozess des Kapitals) von 1867 bereitgestellt werden. Näheres zu den Inhalten von MEGAdigital und eine Liste der verfügbaren Bände mit ihren bibliographischen Angaben finden Sie in der Projektbeschreibung. Alle weiteren Texte und Apparate finden Sie in der Druckausgabe der MEGA.
Es handelt sich nur um E-Texte der Ausgabe. Das Angebot ist schon deshalb unzulänglich, da ein Zitieren einzelner Seiten mit dauerhafter URL nicht möglich ist.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 21:56 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://newprairiepress.org/journals/gdr/ (Open Access)
The GDR Bulletin was originally published by the Department of Germanic Languages & Literatures at Washington University in 26 volumes from 1975 to 1999. In its early years, it appeared in the form of a newsletter, with notes on conferences, grants, news, and occasional book reviews. In later years it evolved into a more traditional journal, with scholarly articles, interviews with key GDR literary figures (e.g.- Jurek Becker, Heiner Müller), and book reviews.
The GDR Bulletin was originally published by the Department of Germanic Languages & Literatures at Washington University in 26 volumes from 1975 to 1999. In its early years, it appeared in the form of a newsletter, with notes on conferences, grants, news, and occasional book reviews. In later years it evolved into a more traditional journal, with scholarly articles, interviews with key GDR literary figures (e.g.- Jurek Becker, Heiner Müller), and book reviews.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 21:42 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.idw-online.de/pages/de/news405163
Der Centaurus Verlag [...] verzichtet in seinem Verlagsvertrag ausdrücklich auf die Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte und erlaubt sowohl die Selbstarchivierung als auch eine generelle Verfügbarmachung auf Volltextservern. Davon profitieren die Wissenschaftler und der Verlag, denn dadurch wird nicht nur ein freier Wissensfluss gewährleistet, sondern auch der Bekanntheitsgrad der Autoren erhöht.
Nach den guten Erfahrungen im Bereich Bildungsforschung mit dem Volltextserver pedocs (http://www.pedocs.de) wird der Centaurus Verlag den Open Access Gedanken auch im Bereich der Sozialwissenschaften fortführen. Ausgewählte Volltexte aus dem Soziologie-Verlagsprogramm werden über das Social Science Open Access Repository (SSOAR) (www.ssoar.info) nach dem Open-Access-Prinzip bereitgestellt.
Der Centaurus Verlag [...] verzichtet in seinem Verlagsvertrag ausdrücklich auf die Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte und erlaubt sowohl die Selbstarchivierung als auch eine generelle Verfügbarmachung auf Volltextservern. Davon profitieren die Wissenschaftler und der Verlag, denn dadurch wird nicht nur ein freier Wissensfluss gewährleistet, sondern auch der Bekanntheitsgrad der Autoren erhöht.
Nach den guten Erfahrungen im Bereich Bildungsforschung mit dem Volltextserver pedocs (http://www.pedocs.de) wird der Centaurus Verlag den Open Access Gedanken auch im Bereich der Sozialwissenschaften fortführen. Ausgewählte Volltexte aus dem Soziologie-Verlagsprogramm werden über das Social Science Open Access Repository (SSOAR) (www.ssoar.info) nach dem Open-Access-Prinzip bereitgestellt.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 21:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein starkes Stück zum Thema Plagiat, was uns Kommentator Johann Wilhelm Braun da in einem Kommentar serviert:
http://archiv.twoday.net/stories/11565154/#11583836
Demgegenüber erscheint die häufige Nichterreichbarkeit von manuscriptorium.com eine eher lässliche Sünde!
Update 3.2.2010: Die von mir angeschriebene Kommission verzichtet auf eine Stellungnahme: "mit Blick auf das laufende Gerichtsverfahren verbietet es sich, über diese Vorwürfe eine Diskussion im Internet zu führen." Mal sehen, wie die Sache ausgeht.
http://archiv.twoday.net/stories/11565154/#11583836
Demgegenüber erscheint die häufige Nichterreichbarkeit von manuscriptorium.com eine eher lässliche Sünde!
Update 3.2.2010: Die von mir angeschriebene Kommission verzichtet auf eine Stellungnahme: "mit Blick auf das laufende Gerichtsverfahren verbietet es sich, über diese Vorwürfe eine Diskussion im Internet zu führen." Mal sehen, wie die Sache ausgeht.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 21:16 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Mitarbeiter des Amsterdamer Stadtarchivs hat mehrere Gedichte sowie einige Bücher und Jahrbücher aus der Sammlung des Archivs gestohlen. Dies berichtete gestern die niederländische Zeitung De Volkskrant. Entdeckt wurden die Diebstähle, die bereits 2009 stattgefunden hatten, Anfang letzten Jahres, als der Mann versuchte die Stücke an Antiquare zu verkaufen. Mitarbeiter der Universität von Amsterdam hatten sich zunächst für einige der Gedichte interessiert, wurden dann jedoch skeptisch, was letztlich zur Entdeckung der Diebstähle geführt hatte.
Beitrag auf NiederlandeNet vom 18.1.11
Beitrag auf NiederlandeNet vom 18.1.11
Olaf Piontek - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 19:49 - Rubrik: Kommunalarchive
Alle fünf Bänder "Die gesamte der ungeänderten Augsp. Confeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen und denen einverleibten, auch einigen angrenzenden Landen ... / ausgefertiget von Karl Gottlob Dietmann"
sind jetzt in der digitalen Bibliothek der Universität Halle Online.
Siehe auch: RambowGenealogie
sind jetzt in der digitalen Bibliothek der Universität Halle Online.
Siehe auch: RambowGenealogie
FredLo - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 19:47
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der nach wie vor wichtige Aufsatz ist jetzt endlich online:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1888a/0007
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1888a/0007
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:44 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/sml?sammlung=22
Processionale, St. Kunibert (Köln, um 1500)
[Hs-970]
Beda, Helpericus, Hermannus Contractus u. a.: Computistische Sammelhandschrift (12. Jh., erste Hälfte)
[Hs-1020]

Processionale, St. Kunibert (Köln, um 1500)
[Hs-970]
Beda, Helpericus, Hermannus Contractus u. a.: Computistische Sammelhandschrift (12. Jh., erste Hälfte)
[Hs-1020]

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:40 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://literaturverwaltung.wordpress.com/
" Aus der Erkenntnis heraus, dass bibliothekarische Kooperation zur Intensivierung der Aktivitäten auf dem Gebiet der (Dienstleistungen für) Literaturverwaltung sinnvoll wie zukunftsweisend jedoch noch unzureichend realisiert sind, wurde diese Plattform als zentrales Portal zur Information und Austausch zwischen bibliothekarischen Informationsdienstleistern aus der Taufe gehoben."
" Aus der Erkenntnis heraus, dass bibliothekarische Kooperation zur Intensivierung der Aktivitäten auf dem Gebiet der (Dienstleistungen für) Literaturverwaltung sinnvoll wie zukunftsweisend jedoch noch unzureichend realisiert sind, wurde diese Plattform als zentrales Portal zur Information und Austausch zwischen bibliothekarischen Informationsdienstleistern aus der Taufe gehoben."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Sondersammlungen präsentieren dazu eine umfangreiche virtuelle Ausstellung:
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/inkunabeln/inkillum.htm

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/inkunabeln/inkillum.htm

KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:15 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus "Sonderdruck aus dem 104. Jahresbericht des Öffentl. Gymnasiums der Benediktiner zu Kremsmünster", 1961, "Das Stift unter dem Hakenkreuz" von Dr. P. Rudolf Hundstorfer, O.S.B. S. 79:
"IX. Das Ende des Hakenkreuzes
Eine Erleichterung für die Patres und das Volk waren die Nachrichten über das schnelle Vordringen der Amerikaner über Rohrbach und Peuerbach. Für die Gestapo aber waren sie das Signal, die Akten zu verbrennen (27.4.).
Zunächst begann man damit in einem Kamin; da es aber zuwenig schnell ging, liess der Gestapo-Chef aus Frankfurt a. Oder im "Zwinger" unter dem Pfarramt 3 Feuerhaufen machen.
"Es war für uns eine grosse Genugtuung, von den Fenstern der Seelsorgerwohnung aus dem letztem Gestapo-Feuereifer zuschauen zu dürfen und zu hören, wie die vom II. Stock herabgeworfenen Akten herunten "aufplumpsten". -Diese Räuber unseres Hauses-ereilt nun ihr Geschick-die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Ausserdem wird berichtet, dass sich die Gestapo und vermutlich auch der Sicherheitsdienst zur Abreise bereit machen. Auf dem zur Verbrennung bestimmten Haufen fand man eine Abschrift des Tagebuchs Mussolinis (seine "100 Tage"), das 10 Jahre später in den "Salzburger Nachrichten" veröffentlicht wurde (P. Wbrd. Neumüller).
Brandakten sehen bspw. so aus:
http://www.politikkritik.info/Gestapo_Fuerst_Adolf.pdf
Zu Kremsmünster siehe auch:
S. 93 und 94 in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
http://vierprinzen.blogspot.com/
"IX. Das Ende des Hakenkreuzes
Eine Erleichterung für die Patres und das Volk waren die Nachrichten über das schnelle Vordringen der Amerikaner über Rohrbach und Peuerbach. Für die Gestapo aber waren sie das Signal, die Akten zu verbrennen (27.4.).
Zunächst begann man damit in einem Kamin; da es aber zuwenig schnell ging, liess der Gestapo-Chef aus Frankfurt a. Oder im "Zwinger" unter dem Pfarramt 3 Feuerhaufen machen.
"Es war für uns eine grosse Genugtuung, von den Fenstern der Seelsorgerwohnung aus dem letztem Gestapo-Feuereifer zuschauen zu dürfen und zu hören, wie die vom II. Stock herabgeworfenen Akten herunten "aufplumpsten". -Diese Räuber unseres Hauses-ereilt nun ihr Geschick-die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Ausserdem wird berichtet, dass sich die Gestapo und vermutlich auch der Sicherheitsdienst zur Abreise bereit machen. Auf dem zur Verbrennung bestimmten Haufen fand man eine Abschrift des Tagebuchs Mussolinis (seine "100 Tage"), das 10 Jahre später in den "Salzburger Nachrichten" veröffentlicht wurde (P. Wbrd. Neumüller).
Brandakten sehen bspw. so aus:
http://www.politikkritik.info/Gestapo_Fuerst_Adolf.pdf
Zu Kremsmünster siehe auch:
S. 93 und 94 in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Stadtarchiv Amberg ist dem Hochwasser der Vils nur knapp entgangen. Trotzdem bangen die Mitarbeiter um die dort gelagerten Bestände.
Der Platz in dem Gebäude in der Zeughausstraße reicht nicht mehr aus. Das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis Ambergs und verfügt über Archivalien, die bis ins Jahr 1294 zurück reichen. Mehr als 3.000 Pergamenturkunden, tausende Rechnungsbände, Amts- und Ratsbücher lagern dort.
Den größten Raum nimmt der Aktenbestand ein, so Ambergs Stadtarchivar Doktor Johannes Laschinger im Gespräch mit Radio Ramasuri. Der Bestand beläuft sich momentan auf 1,2 Kilometer. Seit dem Bezug des Gebäudes an der Vils im Jahr 1983 ist der Bestand um unzählige Dokumente gewachsen.
Man ist am Ende der räumlichen Kapazitäten. Alle möglichen Lösungen werden diskutiert. Der historische Schießlstadl ist als neues Domizil für das Amberger Stadtarchiv vorerst vom Tisch. Eine Sanierung im zweistelligen Millionenbereich ist in Zeiten knapper Kassen für die Stadt nicht zu schultern. Fünf bis 10 Jahre hat man laut Laschinger noch Zeit für einen Umzug."
Quelle: Radio Ramasuri, 18.1.11
Der Platz in dem Gebäude in der Zeughausstraße reicht nicht mehr aus. Das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis Ambergs und verfügt über Archivalien, die bis ins Jahr 1294 zurück reichen. Mehr als 3.000 Pergamenturkunden, tausende Rechnungsbände, Amts- und Ratsbücher lagern dort.
Den größten Raum nimmt der Aktenbestand ein, so Ambergs Stadtarchivar Doktor Johannes Laschinger im Gespräch mit Radio Ramasuri. Der Bestand beläuft sich momentan auf 1,2 Kilometer. Seit dem Bezug des Gebäudes an der Vils im Jahr 1983 ist der Bestand um unzählige Dokumente gewachsen.
Man ist am Ende der räumlichen Kapazitäten. Alle möglichen Lösungen werden diskutiert. Der historische Schießlstadl ist als neues Domizil für das Amberger Stadtarchiv vorerst vom Tisch. Eine Sanierung im zweistelligen Millionenbereich ist in Zeiten knapper Kassen für die Stadt nicht zu schultern. Fünf bis 10 Jahre hat man laut Laschinger noch Zeit für einen Umzug."
Quelle: Radio Ramasuri, 18.1.11
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 17:57 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im 14./15. Jahrhundert befand sich das Graduale, Sakramentar und Lektionar Cod. membr. 7 des Klosters Muri (jetzt im Benediktinerkolleg Sarnen) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Besitz der Pfarrkirche von Glatt an der Glatt. Dort wurden Einträge zu Stiftungen vor allem der Familie von Neuneck mit Todesdaten der Familienmitglieder eingetragen: "Zahlreiche nekrologische Einträge für die Kirche von Glatt. Anlage des Kalendars und Mehrzahl der Einträge zu Jahrzeitstiftungen für die Kirche in Glatt mit Galluspatrozinium von pfaff Tunower, kirchherr (17*r). Die Stiftungen betreffen seine eigene Familie, die Herren von Nüwnegg (jeweils mit Todesjahr; Zeitspanne 1360–1430) und die Dorfbewohner." Zitiert nach der Beschreibung:
Charlotte Bretscher-Gisiger und Rudolf Gamper, Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Klöster Muri und Hermetschwil, Dietikon-Zürich 2005, S. 155-158, hier S. 156
http://www.urs-graf-verlag.com/pdf/MSMuriK.pdf
Ältere Beschreibung
Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich Bd. 1, S. 48f.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015028853342;page=root;view=image;size=100;seq=78;num=48 (US-Proxy)
Update: Ich erachte die Formulierung "Im 14./15. Jahrhundert befand sich das Graduale, Sakramentar und Lektionar Cod. membr. 7 des Klosters Muri (jetzt im Benediktinerkolleg Sarnen) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Besitz der Pfarrkirche von Glatt an der Glatt." nach wie vor für korrekt. Der Genetiv bezeichnet den Eigentümer, die Benediktinerabtei Muri-Gries mit Sitz in Bozen und Ableger in Sarnen.
Charlotte Bretscher-Gisiger und Rudolf Gamper, Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Klöster Muri und Hermetschwil, Dietikon-Zürich 2005, S. 155-158, hier S. 156
http://www.urs-graf-verlag.com/pdf/MSMuriK.pdf
Ältere Beschreibung
Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich Bd. 1, S. 48f.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015028853342;page=root;view=image;size=100;seq=78;num=48 (US-Proxy)
Update: Ich erachte die Formulierung "Im 14./15. Jahrhundert befand sich das Graduale, Sakramentar und Lektionar Cod. membr. 7 des Klosters Muri (jetzt im Benediktinerkolleg Sarnen) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Besitz der Pfarrkirche von Glatt an der Glatt." nach wie vor für korrekt. Der Genetiv bezeichnet den Eigentümer, die Benediktinerabtei Muri-Gries mit Sitz in Bozen und Ableger in Sarnen.
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 17:41 - Rubrik: Kodikologie
Faszinierende historische Aufnahmen (spätes 19./frühes 20. Jh.) aus einer ganzen Reihe von Sportarten bietet dieser Kalender, darunter das früheste Foto von Tennisspielern aus der Pfalz aus dem Stadtarchiv Speyer (um 1900)
Link
Link
J. Kemper - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 17:16 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 16:53 - Rubrik: Architekturarchive
Bd. 3, 1907 liegt im Internet Archive vor
http://www.archive.org/details/DieIlluminiertenHandschriftenInKaernten
Die Bände 1, 2, 3, 5, 6, 7 sind nun mit US-Proxy in HathiTrust nutzbar:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000865949
Man beachte, dass man früher auch ohne US-proxy sehen konnte, welche Bände für US-Bürger frei sind. Das ist jetzt nicht mehr möglich, man muss also gleich mit dem Proxy benutzen (zur Zeit nehme ich uethepl.us).
http://www.archive.org/details/DieIlluminiertenHandschriftenInKaernten
Die Bände 1, 2, 3, 5, 6, 7 sind nun mit US-Proxy in HathiTrust nutzbar:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000865949
Man beachte, dass man früher auch ohne US-proxy sehen konnte, welche Bände für US-Bürger frei sind. Das ist jetzt nicht mehr möglich, man muss also gleich mit dem Proxy benutzen (zur Zeit nehme ich uethepl.us).
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 16:39 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In Boston sind wichtige Unterlagen aus der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy ins Internet gestellt worden. Die Kennedy Presidential Library hat Dokumente, Fotografien sowie Ton-und Filmaufnahmen digitalisiert und zugänglich gemacht. Interessenten können ab sofort 200.000 Seiten Papier nachlesen, jedes Jahr sollen weitere 100.000 Seiten dazu kommen. Nach Angaben des Archivs würde es jedoch mehr als 100 Jahre dauern, bis alle Unterlagen der Kennedy-Regierung in digitaler Form vorliegen."
WDR.de, Kulturnachrichten v. 18.01.2011
Link zur Homepage der JFK-Library
WDR.de, Kulturnachrichten v. 18.01.2011
Link zur Homepage der JFK-Library
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Januar 2011, 08:03 - Rubrik: Internationale Aspekte

"Témoins privilégiés de notre passé, les archives réapparaissent parfois après des siècles d'enfouissement et d'abandon. Blessées, décolorées, déformées, déchirées, moisies, rongées par les champignons, endommagées par la pourriture, elles sont devenues alors méconnaissables, lacunaires ou réduites à l'état de fragments et de poussière.
Quels sont les agents de dégradation des documents ? Quels sont les facteurs aggravants ? Quelles sont les protections appropriées possibles ? Quels moyens mettre en œuvre pour stopper les outrages du temps et prévenir les détériorations de ce patrimoine ? Comment éviter la disparition irrémédiable de précieux témoignages historiques ? Comment bien conserver pour transmettre au futur la compréhension de notre quotidien ?
La conservation préventive, devenue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des spécialistes du patrimoine, identifie les causes des mécanismes d'altération, tente de les enrayer en établissant des diagnostics permettant le choix de traitements adaptés qui viendront ralentir ou arrêter les processus de dégradation.
Le travail des restaurateurs interviendra lorsque les traumatismes du document portent atteinte à sa lisibilité et à sa survie.
Les pratiques archivistiques, les classements, les techniques de communication, les transferts sur de nouveaux supports viennent s'inscrire dans le long parcours de sauvegarde du patrimoine.
Le temps passe, la matière se transforme inéluctablement, mais il est possible de retarder cet instant de la disparition définitive.
Exposition présentée dans le hall d'entrée des Archives départementales [Vaucluse]
lundi de 11 H 00 à 17 H 00
et du mardi au vendredi de 8 H 30 à 17 H 00
Entrée libre "
Link
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 19:50 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Die Stadt Augsburg hat eines der bedeutendsten Stadtarchive im deutschsprachigen Raum mit 750.000 Dokumenten. Doch die wertvollen Bestände aus der über 2000-jährigen Geschichte der Stadt waren akut bedroht: Vom Brotkäfer, einem gefräßigen Nager, der sich aus dem benachbarten Stadtmarkt in das Stadtarchiv eingeschlichen hatte.
Seit eineinhalb Jahren geht es ihm an den Kragen. In der Außenstelle des Stadtarchivs neben dem Textil- und Industriemuseum "tim" werden die befallenen Bestände mit Stickstoff behandelt, was der Brotkäfer nicht überlebt. Ab Mittwoch wird ein Teil der Bestände erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Rund die Hälfte des Archivbestands ist schon käferfrei. Ein abgetrennter Raum in einer Fabrikhalle der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei ist der Ort der Begasung. Mehr als ein Kilometer Regale stehen dort - bis an die Decke hoch mit wertvollen Dokumenten, Karten und Plänen von der Blütezeit der alten Reichsstadt Augsburg bis zum Jahr 1806. Dazu lagern dort Urkunden aus Augsburger Kirchen und Klöstern aus der Zeit der Säkularisation. Die Dokumente waren alle vom Brotkäfer befallen, der sich rasend schnell durch das Archiv gefressen hat. Die Hälfte des Raumes nimmt ein großes, durchsichtiges Zelt ein: für die Bekämpfungsaktion mit Stickstoff.
Im August oder September dieses Jahres soll die Aktion abgeschlossen sein. 2013, so hofft der Leiter des Stadtarchivs, Michael Cramer-Fürtig, sollen die gereinigten Bestände dann in den geplanten Neubau auf dem AKS-Gelände umziehen. Indes geht dem Freundeskreis Stadtarchiv, der zwei 400-Euro-Jobber finanziert, das Geld für die Sichtung der Dokumente aus. Die Mittel reichen gerade noch für zwei Monate, dann ist Schluss."
Quelle: Bayern1, Mittags in Schwaben, 18.1.2011
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=stadtarchiv+brotk%C3%A4fer
Seit eineinhalb Jahren geht es ihm an den Kragen. In der Außenstelle des Stadtarchivs neben dem Textil- und Industriemuseum "tim" werden die befallenen Bestände mit Stickstoff behandelt, was der Brotkäfer nicht überlebt. Ab Mittwoch wird ein Teil der Bestände erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Rund die Hälfte des Archivbestands ist schon käferfrei. Ein abgetrennter Raum in einer Fabrikhalle der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei ist der Ort der Begasung. Mehr als ein Kilometer Regale stehen dort - bis an die Decke hoch mit wertvollen Dokumenten, Karten und Plänen von der Blütezeit der alten Reichsstadt Augsburg bis zum Jahr 1806. Dazu lagern dort Urkunden aus Augsburger Kirchen und Klöstern aus der Zeit der Säkularisation. Die Dokumente waren alle vom Brotkäfer befallen, der sich rasend schnell durch das Archiv gefressen hat. Die Hälfte des Raumes nimmt ein großes, durchsichtiges Zelt ein: für die Bekämpfungsaktion mit Stickstoff.
Im August oder September dieses Jahres soll die Aktion abgeschlossen sein. 2013, so hofft der Leiter des Stadtarchivs, Michael Cramer-Fürtig, sollen die gereinigten Bestände dann in den geplanten Neubau auf dem AKS-Gelände umziehen. Indes geht dem Freundeskreis Stadtarchiv, der zwei 400-Euro-Jobber finanziert, das Geld für die Sichtung der Dokumente aus. Die Mittel reichen gerade noch für zwei Monate, dann ist Schluss."
Quelle: Bayern1, Mittags in Schwaben, 18.1.2011
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=stadtarchiv+brotk%C3%A4fer
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 19:40 - Rubrik: Kommunalarchive
"Nach der Gründungsversammlung am 12. Juli 2010 sind in den vergangenen Monaten in einer Kuratoriumssitzung und zwei Vorstandssitzungen eine Reihe von Entscheidungen für die Zukunft der Stiftung Stadtgedächtnis gefallen. Kulturdezernent Prof. Georg Quander informiert als kommissarischer Vorstandsvorsitzender über die Zusammensetzung der Stiftungsgremien, ihre Aufgaben und den zukünftigen Geschäftssitz.
Neben den bisherigen Entscheidungen zur Aufnahme des Stiftungsgeschäfts berichtet er auch über die ersten konkreten Restaurierungsvorhaben. Dabei unterstützt ihn Hermann-Josef Johanns, den die Stiftung in ihrer Gründungsphase als externen Berater zugezogen hat. Archivdirektorin Dr. Bettina Schmidt-Czaia präsentiert ein Objekt, dessen Restaurierung die Stiftung finanziert.
Die Gründung der Stiftung Stadtgedächtnis schafft die Grundlage, unabhängig von den Regelungen des städtischen Haushalts und ergänzend dazu mit Finanzmitteln Dritter die Restaurierung und Instandsetzung der geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv in den kommenden Jahren zu unterstützen. Außerdem setzt sich die Stiftung für die Zusammenführung der Bestände sowie deren Digitalisierung, Erforschung und eine wissenschaftliche Begleitung ein.
Als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts besteht sie aus dem Kuratorium, dem Vorstand und dem Vorstandsvorsitzenden, wobei das Kuratorium den Vorstand unterstützt und kontrolliert. Dieser wiederum übernimmt unter anderem die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stiftung. Dem Vorstandsvorsitzenden kommt nach der Stiftungssatzung eine starke Stellung zu. Er handelt für die Stiftung und führt ihre laufenden Geschäfte.
Ein kostenloser Newsletter informiert unter http://www.stiftung-stadtgedaechtnis.de regelmäßig über die Stiftung Stadtgedächtnis. Für Spenden ist beim Bankhaus Sal. Oppenheim das Konto 3309, BLZ 370 302 00, eingerichtet. Oder man spendet einfach per Anruf aus dem deutschen Festnetz unter 09001-03 03 09 einen Festbetrag von fünf Euro für den guten Zweck."
Pressegespräch
Mittwoch, 19. Januar 2011, 11 Uhr
Excelsior Hotel Ernst
Trankgasse 1-5
Köln-Innenstadt
Link zur Pressemitteilung (PDF)
Neben den bisherigen Entscheidungen zur Aufnahme des Stiftungsgeschäfts berichtet er auch über die ersten konkreten Restaurierungsvorhaben. Dabei unterstützt ihn Hermann-Josef Johanns, den die Stiftung in ihrer Gründungsphase als externen Berater zugezogen hat. Archivdirektorin Dr. Bettina Schmidt-Czaia präsentiert ein Objekt, dessen Restaurierung die Stiftung finanziert.
Die Gründung der Stiftung Stadtgedächtnis schafft die Grundlage, unabhängig von den Regelungen des städtischen Haushalts und ergänzend dazu mit Finanzmitteln Dritter die Restaurierung und Instandsetzung der geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv in den kommenden Jahren zu unterstützen. Außerdem setzt sich die Stiftung für die Zusammenführung der Bestände sowie deren Digitalisierung, Erforschung und eine wissenschaftliche Begleitung ein.
Als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts besteht sie aus dem Kuratorium, dem Vorstand und dem Vorstandsvorsitzenden, wobei das Kuratorium den Vorstand unterstützt und kontrolliert. Dieser wiederum übernimmt unter anderem die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stiftung. Dem Vorstandsvorsitzenden kommt nach der Stiftungssatzung eine starke Stellung zu. Er handelt für die Stiftung und führt ihre laufenden Geschäfte.
Ein kostenloser Newsletter informiert unter http://www.stiftung-stadtgedaechtnis.de regelmäßig über die Stiftung Stadtgedächtnis. Für Spenden ist beim Bankhaus Sal. Oppenheim das Konto 3309, BLZ 370 302 00, eingerichtet. Oder man spendet einfach per Anruf aus dem deutschen Festnetz unter 09001-03 03 09 einen Festbetrag von fünf Euro für den guten Zweck."
Pressegespräch
Mittwoch, 19. Januar 2011, 11 Uhr
Excelsior Hotel Ernst
Trankgasse 1-5
Köln-Innenstadt
Link zur Pressemitteilung (PDF)
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 18:01 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://books2ebooks.eu/prices.php5
Die Preisliste für ein 200-Seiten-Buch erlaubt einen Vergleich der EOD-Digitalisierungstarife. Mit 77 Euro der zweitteuerste Anbieter: die BSB München. Noch teurer ist nur die KB Kopenhagen (107,40 Euro). Am günstigsten sind mit 34 Euro die UB Graz, dicht gefolgt von den beiden estnischen Bibliotheken und der Ungarischen NB (je 35 Euro). Die billigste deutsche Bibliothek ist mit 40 Euro die HU Berlin.
Die Preisliste für ein 200-Seiten-Buch erlaubt einen Vergleich der EOD-Digitalisierungstarife. Mit 77 Euro der zweitteuerste Anbieter: die BSB München. Noch teurer ist nur die KB Kopenhagen (107,40 Euro). Am günstigsten sind mit 34 Euro die UB Graz, dicht gefolgt von den beiden estnischen Bibliotheken und der Ungarischen NB (je 35 Euro). Die billigste deutsche Bibliothek ist mit 40 Euro die HU Berlin.
KlausGraf - am Dienstag, 18. Januar 2011, 17:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte –
Bildarchiv Foto Marburg Fotopositive im Bildarchiv Mittwoch 2. Februar 2011, 16:30 - 19:30 Uhr Ernst-von-Hülsen-Haus, Biegenstraße 11, 35037 Marburg, Tagungsraum
Die Wende zum digitalen Bild lässt die für die analoge Fotografie elementare Unterscheidung von Negativ und Positivbild (Abzug, Print, Dia) in neuem Licht erscheinen. Im Bildarchiv Foto Marburg werden seit jeher in erster Linie Negative archiviert und für die professionelle Vervielfältigung verwendet. Doch schon seit 1889 – noch vor der Gründung des Kunstgeschichtlichen Seminars (1913) – wurden in Marburg auch Fotopositive in einem „Kunsthistorischen Apparat“ für Lehre und Forschung gesammelt, bald auch, bedingt durch die Nähe des Bildarchivs, mit besonderem Anspruch.
Dieser Bestand wird heute als Teil der Sammlung des Deutschen
Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg geführt und ist inzwischen entsprechend seiner Bedeutung auch Gegenstand der Forschung. Er soll im Rahmen des „Bildindex der Kunst und Architektur“ und in Zusammenarbeit mit den Fototheken der Kunsthistorischen Max-Planck-Institute in Rom und Florenz demnächst digitalisiert und systematisch gemäß den jüngsten Forschungsinteressen erschlossen werden.
Das Arbeitsgespräch soll einige aktuelle Überlegungen und Forschungsergebnisse zur Diskussion stellen.
Begrüßung und Einführung: Hubert Locher
Costanza Caraffa, Florenz, Deutsches Kunsthistorisches Institut, MPI: Fotografien in Archiven im Zeitalter ihrer Digitalisierbarkeit: Ein Material Turn
Jörg Probst, Marburg: Originale. Autoren und ihre Dias
Kaffee
Dorothea Peters, Berlin / Florenz, Deutsches Kunsthistorisches Institut, MPI: Bildergeschichte(n). Zur Kontextualisierung von Fotografien aus dem Bildarchiv Foto Marburg
Studierende der Philipps-Universität: Präsentation des Prototyps des Seminarprojekts „Virtuelle Fotoausstellung“
Verantwortlich: Prof. Dr. Hubert Locher
Kontakt: Jörg Probst M.A., Tel.: 06421/28-22174, E-Mail:
probst@fotomarburg.de Andrea Schutte M.A., Tel.: 06421/28-23676, E-Mail: schutte@fotomarburg.de Die Veranstaltung ist öffentlich. Um Anmeldung wird gebeten.
via Archivliste.
Bildarchiv Foto Marburg Fotopositive im Bildarchiv Mittwoch 2. Februar 2011, 16:30 - 19:30 Uhr Ernst-von-Hülsen-Haus, Biegenstraße 11, 35037 Marburg, Tagungsraum
Die Wende zum digitalen Bild lässt die für die analoge Fotografie elementare Unterscheidung von Negativ und Positivbild (Abzug, Print, Dia) in neuem Licht erscheinen. Im Bildarchiv Foto Marburg werden seit jeher in erster Linie Negative archiviert und für die professionelle Vervielfältigung verwendet. Doch schon seit 1889 – noch vor der Gründung des Kunstgeschichtlichen Seminars (1913) – wurden in Marburg auch Fotopositive in einem „Kunsthistorischen Apparat“ für Lehre und Forschung gesammelt, bald auch, bedingt durch die Nähe des Bildarchivs, mit besonderem Anspruch.
Dieser Bestand wird heute als Teil der Sammlung des Deutschen
Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg geführt und ist inzwischen entsprechend seiner Bedeutung auch Gegenstand der Forschung. Er soll im Rahmen des „Bildindex der Kunst und Architektur“ und in Zusammenarbeit mit den Fototheken der Kunsthistorischen Max-Planck-Institute in Rom und Florenz demnächst digitalisiert und systematisch gemäß den jüngsten Forschungsinteressen erschlossen werden.
Das Arbeitsgespräch soll einige aktuelle Überlegungen und Forschungsergebnisse zur Diskussion stellen.
Begrüßung und Einführung: Hubert Locher
Costanza Caraffa, Florenz, Deutsches Kunsthistorisches Institut, MPI: Fotografien in Archiven im Zeitalter ihrer Digitalisierbarkeit: Ein Material Turn
Jörg Probst, Marburg: Originale. Autoren und ihre Dias
Kaffee
Dorothea Peters, Berlin / Florenz, Deutsches Kunsthistorisches Institut, MPI: Bildergeschichte(n). Zur Kontextualisierung von Fotografien aus dem Bildarchiv Foto Marburg
Studierende der Philipps-Universität: Präsentation des Prototyps des Seminarprojekts „Virtuelle Fotoausstellung“
Verantwortlich: Prof. Dr. Hubert Locher
Kontakt: Jörg Probst M.A., Tel.: 06421/28-22174, E-Mail:
probst@fotomarburg.de Andrea Schutte M.A., Tel.: 06421/28-23676, E-Mail: schutte@fotomarburg.de Die Veranstaltung ist öffentlich. Um Anmeldung wird gebeten.
via Archivliste.
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 11:49 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Web 2.0 für Archivare
View more presentations from Stefan Krause.
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 09:47 - Rubrik: Web 2.0
schreibt spirandelli zusammenfassend: " ..... Kölbl Kruse kauft im Juni 2007 den Speicher samt der zugehörigen Flurstücke vom RWSGEigentümer, obwohl die DUISBURGER HAFEN AG und damit auch das Land NRW und die Stadt DUISBURG laut Grundbuch Vor- bzw. Widerkaufsrechte an der Liegenschaft halten.
Außerdem übernimmt Kölbl Kruse einen Untermieter der RWSG und die Erbbaurechte der RWSG auf zwei weiteren zur Flur 17 gehörenden Flurstücken. Der Preis: 3.85 Mio. Euro. Der Wert des Grundstücks liegt bei etwa 2,5 Mio. Euro, der Wert des Speichers beträgt NULL bis MINUS X (er sollte 15 Monate zuvor abgerissen werden, um einem Neubau zu weichen).
Kölbl Kruse kauft im November 2007 drei weitere Flurstücke, inklusive der Erbbaurechte von der Stadt Duisburg. Vertreten wird die Stadt Duisburg durch den Geschäftsführer der INNENSTADT DUISBURG ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT, abgewickelt wird der Deal über die stadteigene IMMOBILIEN-MANAGEMENT DUISBURG. Der Preis: Euro 765.000 (etwa ein Drittel des Marktwertes). Außerdem verzichtet Duisburg auf Erbpachteinnahmen von mehr als Euro 100.000, die bis zum Jahresende 2016 fällig werden. Dennoch behauptet die Stadt Duisburg standhaft, ihr sei im Zusammenhang mit dem Landesarchiv kein finanzieller Schaden entstanden.
Der BLB NRW kauft im September 2008 die gesamte Liegenschaft inklusive des Speichers, der Erbbaurechte, einer windigen Grundstücksoptimierung, einer wackeligen Planung und einer Entschädigung für einen zuvor geschlossenen Mietvertrag für zusammen 29,9 Mio. Euro von Kölbl Kruse. Bei dieser Gelegenheit stellt sich heraus, dass die Liegenschaft mittlerweile mit einer Grundschuld von 7,8 Mio. Euro zzgl. 19% Zinsen belastet ist und dass der Kaufvertrag No. 2, den Kölbl Kruse im November des vergangenen Jahres unterzeichnet hatte, noch immer nicht vollzogen wurde. Er wird erst „posthum“ umgesetzt werden.
Ein wirklich geniales Geschäft. Zumindest für den Speicher-Eigentümer Koenig und den Projektentwickler Kölbl Kruse. Für Duisburg sieht es nicht ganz so gut aus. Man hat ein paar Miese gemacht, aber dafür immerhin das Landesarchiv zugesprochen bekommen.
Aber wirklich lustig wird es, wenn das Land bilanziert: rund 25 Mio. Euro Steuergelder verballert für ein aus archivfachlicher Sicht eher ungeeignetes Gebäude samt ungeeigneter Planung. Und vor sich die schöne Hypothek, noch mehr als 100 Mio. Euro plus ein paar Jahre extra investieren zu müssen um nicht in des Kaisers neuen Kleidern dazustehen.
Und warum das alles? Weil das Land unbedingt den Speicher als Archivhülle haben wollte? Weil Duisburg unbedingt das Landesarchiv haben wollte? Wahrscheinlich trifft beides zu. Es macht jedenfalls ganz stark den Eindruck, dass die Stadt das Land ins offene Messer laufen lassen hat, indem man der Staatskanzlei ein realitätsfernes Duisburger Szenario präsentierte, das auf die Erwartungen der Entscheider maßgeschneidert war und bei dem es nur darum ging, den Haken in den Fisch zu bringen. ...."
Link zum Volltext (PDF)
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Außerdem übernimmt Kölbl Kruse einen Untermieter der RWSG und die Erbbaurechte der RWSG auf zwei weiteren zur Flur 17 gehörenden Flurstücken. Der Preis: 3.85 Mio. Euro. Der Wert des Grundstücks liegt bei etwa 2,5 Mio. Euro, der Wert des Speichers beträgt NULL bis MINUS X (er sollte 15 Monate zuvor abgerissen werden, um einem Neubau zu weichen).
Kölbl Kruse kauft im November 2007 drei weitere Flurstücke, inklusive der Erbbaurechte von der Stadt Duisburg. Vertreten wird die Stadt Duisburg durch den Geschäftsführer der INNENSTADT DUISBURG ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT, abgewickelt wird der Deal über die stadteigene IMMOBILIEN-MANAGEMENT DUISBURG. Der Preis: Euro 765.000 (etwa ein Drittel des Marktwertes). Außerdem verzichtet Duisburg auf Erbpachteinnahmen von mehr als Euro 100.000, die bis zum Jahresende 2016 fällig werden. Dennoch behauptet die Stadt Duisburg standhaft, ihr sei im Zusammenhang mit dem Landesarchiv kein finanzieller Schaden entstanden.
Der BLB NRW kauft im September 2008 die gesamte Liegenschaft inklusive des Speichers, der Erbbaurechte, einer windigen Grundstücksoptimierung, einer wackeligen Planung und einer Entschädigung für einen zuvor geschlossenen Mietvertrag für zusammen 29,9 Mio. Euro von Kölbl Kruse. Bei dieser Gelegenheit stellt sich heraus, dass die Liegenschaft mittlerweile mit einer Grundschuld von 7,8 Mio. Euro zzgl. 19% Zinsen belastet ist und dass der Kaufvertrag No. 2, den Kölbl Kruse im November des vergangenen Jahres unterzeichnet hatte, noch immer nicht vollzogen wurde. Er wird erst „posthum“ umgesetzt werden.
Ein wirklich geniales Geschäft. Zumindest für den Speicher-Eigentümer Koenig und den Projektentwickler Kölbl Kruse. Für Duisburg sieht es nicht ganz so gut aus. Man hat ein paar Miese gemacht, aber dafür immerhin das Landesarchiv zugesprochen bekommen.
Aber wirklich lustig wird es, wenn das Land bilanziert: rund 25 Mio. Euro Steuergelder verballert für ein aus archivfachlicher Sicht eher ungeeignetes Gebäude samt ungeeigneter Planung. Und vor sich die schöne Hypothek, noch mehr als 100 Mio. Euro plus ein paar Jahre extra investieren zu müssen um nicht in des Kaisers neuen Kleidern dazustehen.
Und warum das alles? Weil das Land unbedingt den Speicher als Archivhülle haben wollte? Weil Duisburg unbedingt das Landesarchiv haben wollte? Wahrscheinlich trifft beides zu. Es macht jedenfalls ganz stark den Eindruck, dass die Stadt das Land ins offene Messer laufen lassen hat, indem man der Staatskanzlei ein realitätsfernes Duisburger Szenario präsentierte, das auf die Erwartungen der Entscheider maßgeschneidert war und bei dem es nur darum ging, den Haken in den Fisch zu bringen. ...."
Link zum Volltext (PDF)
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Januar 2011, 08:51 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs (Hg.): Österreichs
Archive unter dem Hakenkreuz, Innsbruck: StudienVerlag 2010, ISBN
978-3-7065-4941-7
Rezensiert von: Tobias Schenk, in http://www.sehepunkte.de/2011/01/19015.html
Archive unter dem Hakenkreuz, Innsbruck: StudienVerlag 2010, ISBN
978-3-7065-4941-7
Rezensiert von: Tobias Schenk, in http://www.sehepunkte.de/2011/01/19015.html
Bernd Hüttner - am Dienstag, 18. Januar 2011, 06:34 - Rubrik: Archivgeschichte
Armin Talke ist an der SB Berlin tätig und hat einen wenig kenntnisreichen Aufsatz "Lichtbildschutz für digitale Bilder von zweidimensionalen Vorlagen" in ZUM 2010, 846 ff. veröffentlicht.
Aus seinem Fazit: Für die Nutzung fremder digitaler Bilder bleibt die Frage der
Schutzfähigkeit – insbesondere wenn es sich bei den digitalisierten
Vorlagen um gemeinfreie Werke handelt – wesentlich. Die Entscheidung
über die Frage des Leistungsschutzrechtes nach § 72 UrhG oder gar
eines urheberrechtlichen Werkschutzes nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG kann
dabei im Einzelfall schwierig sein. Nichtsdestotrotz sind aufgrund der
oben angestellten Erwägungen Kategorien ersichtlich, an denen sich
Hersteller von Bildern zweidimensionaler Vorlagen, wie z. B. Gemälden
oder Buchblättern und deren Nutzer bei der Beurteilung des
Urheberrechtsschutzes orientieren können. Keinem Lichtbildschutz nach
§ 72 oder § 2 UrhG unterliegen originalgetreue Digitalisate von im
Massenverfahren hergestellten Büchern, denn dann handelt es sich um
nicht geschützte »Lichtbilder von Lichtbildern«.
Dagegen können Bilder von (teilweise) handgezeichneten oder
-geschriebenen Werken einem eigenen Lichtbildschutz nach § 72 UrhG
unterliegen, wenn hinsichtlich der Bildgestaltung ein
Gestaltungsspielraum, z. B. im Hinblick auf bestimmte Bedürfnisse von
Buchhistorikern, genutzt wird. Im Einzelfall kann das Ergebnis dann
sogar ein Lichtbildwerk sein.
Selbstverständlich bleibe ich bei meiner in der Kunstchronik 2008 dargelegten Position:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Siehe zuletzt auch meinen Kommentar zu
http://blog.arthistoricum.net/prometheus/
Talke hat die relevante jüngere Literatur nicht zur Kenntnis genommen, er stützt sich auf die wenigen Urteile zum Thema, auf die Kommentare von Dreier/Schultze und Wandtke/Bullinger, die - nicht überzeugende - Dissertation von Platena von 1995 und den Aufsatz von Nordemann GRUR 1987. Selbst wenn man meine zahlreichen Äußerungen in diesem Weblog und anderswo nicht als berücksichtigungswürdig ansieht, gibt es keine Entschuldigung, dass Talke die Studie von Lehment: Das Fotografieren von Kunstgegenständen, 2008 (die einschlägigen Seiten 25-37 sind einsehbar unter http://books.google.de/books?id=UzgDgc496XgC&pg=PA25 ), die ich hier rezensiert habe http://archiv.twoday.net/stories/5333018/, und den Aufsatz von Stang Z Geist Eig 2009 http://archiv.twoday.net/stories/5842438/ übersehen hat oder übergeht.
Seit 1989 beschäftigt mich die Frage (siehe http://archiv.twoday.net/stories/2478252/ ), und ich darf durchaus versichern, dass ich sehr viel mehr Literatur zum Thema seitdem zur Kenntnis genommen habe als Herr Talke oder irgendwelche Wald-und-Wiesen-Juristen die der Ansicht sind, dass ich doch mal gelegentlich in einen Kommentar schauen solle. Ich kann dazu z.B. in den von mir verfassten Urheberrechtskommentar "Urheberrechtsfibel" (2009) schauen. Die Todsünde ist ja, dass ich mich als Nicht-Jurist erdreiste, Juristen oder juristischen Fachreferenten zu widersprechen!
Ich will mich bei der Widerlegung von Talke kurz fassen:
In den Genuss des Leistungsschutzrechtes können also nur »Urbilder« kommen. Der Gesetzeswortlaut bedarf insoweit also einer einschränkenden Auslegung. Buchseiten, die mit Drucktechniken hergestellt wurden, bei denen von vorhandenen Textvorlagen auf reprografischem Wege Druckträger hergestellt werden, sowie mittels moderner Foto- und Lichtsatztechnik, bei der Schriftzeichen über vorhandene Negative oder einer Kathodenstrahlröhre auf lichtempfindliches Material übertragen
werden und grundsätzlich alle Hoch-, Flach- und Tiefdrucke sind
objektiv als Lichtbilder anzusehen. Darunter dürften regelmäßig die
seit ca. 1500 für den Buchdruck genutzten Techniken fallen. Die
digitalen Bilder von rein maschinell oder mechanisch hergestellten
Druckschriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Bibliotheken im Rahmen von Digitalisierungsprojekten oder Google im Rahmen seines »Google-Books«-Programms anfertigt, unterliegen daher von vornherein keinem urheberrechtlichen Schutz. Als dem Leistungsschutz grundsätzlich zugänglich verbleiben danach aber Bilder von Gemälden, Handschriften, Wiegendrucken oder gedruckten Seiten, auf denen sich auch per Hand gefertigte Zeichnungen finden bzw. handschriftliche Anmerkungen einen wesentlichen Teil ausmachen. Denn hier wird kein bloßes Lichtbild vom Lichtbild, sondern ein Urbild erzeugt.
Immerhin gesteht Talke zu, dass die Massendigitalisierung von Büchern ab dem 16. Jahrhundert kein Schutzrecht nach § 72 UrhG entstehen lässt.
Die Urbild-Theorie führt ersichtlich zu widersprüchlichen Wertungen.
Google-Digitalisate, auf denen handschriftliche Randbemerkungen zu sehen sind, wären demnach nach § 72 UrhG geschützt, obwohl die Leistung exakt die gleiche ist wie bei den anderen von Google digitalisierten Seiten.
Legt ein Archivar ein altes Aktenstück auf den Kopierer, entsteht ein Urbild - obwohl die juristische Lehre davon ausgeht, dass bei der Nutzung eines Kopierers eben kein Recht nach § 72 UrhG gegeben ist. Eine Xerokopie ist eindeutig ein Produkt, das ähnlich wie ein Lichtbild mittels strahlender Energie hergestellt wird und daher nach dem Wortlaut des Gesetzes den Lichtbildschutz entstehen lässt (siehe dazu auch Platena).
Flachbettscanner werden vom Schrifttum wie Kopierer betrachtet. Ich sehe keinen Grund, die überwiegend bei Digitalisierungen eingesetzten Aufsichtsscanner/Digitalkameras anders zu behandeln.
Die von Talke in den Vordergrund gestellten verschiedensten Scannereinstellungsmöglichkeiten sind für Kreutzer S. 36 kein Grund, den Schutz zu gewähren:
Entscheidend ist letztlich jedoch das Argument, dass ein Recht an Digitalisaten zu einer massiven Ausweitung des Lichtbildschutzrechts führen würde. Sie hätte zur Folge, dass die Ergebnisse von Kopiervorgängen durch hierfür bestimmte Geräte einem Schutzrecht unter-worfen würden. Dies würde der eindeutigen Aussage des BGH widersprechen, dass das Lichtbildrecht restriktiv zu verstehen ist, zuwiderlaufen.
Auch würde ein solches Ergebnis zu unlösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Es dürfte unbestreitbar sein, dass durch einfache Kopierer oder Scanner erzeugte Vervielfäl-tigungsstücke keinen Lichtbildschutz erlangen (sondern bloße Vervielfältigungen sind). In Frage käme dies nur für Kopien, die von mehr oder weniger komplexen Geräten erzeugt werden, da nur hier der Bedienende eine nennenswerte Eigenleistung erbringen muss. Wie komplex müsste aber ein solches Gerät sein? Und wer beurteilt, was komplex ist bzw. aus wessen Sicht muss das Gerät komplex sein (aus Sicht des Laien, eines Digitalisierungsprofis, des Entwicklers des Gerätes selbst)?
http://www.irights.info/userfiles/Digitalisierungsleitfaden.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/11581045/
Auch bei modernen Fotokopierern können die Nutzer verschiedene Parameter einstellen, ohne dass dies jemand bewogen hat, den Kopierer einem Lichtbildner gleichzustellen.
Lehment brachte das Beispiel des Fotografen, der in einer Ausstellung Fotokunst fotografiert. Billigt man der Gemäldereproduktion entgegen der von mir vertretenen Auffassung den Schutz zu, hat man ein Problem, denn die Leistung des Fotografen ist im wesentlichen die gleiche, ob er nun Fotokunst oder ein anderes zweidimensionales Kunstwerk fotografiert. das Foto der Fotokunst ist nach BGH Bibelreproduktion aber eine nicht schützbare Lichtbildkopie. Das Problem löst sich, wie ich schon in meiner Rezension zu Lehment schrieb, indem man weder der Gemäldefotografie noch der Fotokunst-Reproduktion den Schutz gewährt!
Offenbar ist Talke auch entgangen, dass der BGH in seiner Telefonkarten-Entscheidung aus dem Jahr 2000 die Urbild-Theorie nicht mehr akzeptiert.
Es ging um eine stilisierte Weltkarte, also nicht um ein Foto, für das ja seit "Bibelreproduktion" feststand, dass ein "Bild vom Bild" nicht unter § 72 UrhG fiel.
Soweit die Klägerin den Lichtbildschutz des § 72 UrhG für sich in Anspruch genommen hat, fehlt es an Klagevorbringen dazu, ob und inwieweit die Telefonkarte der Klägerin ein Lichtbild oder ein auf ähnliche Weise hergestelltes Erzeugnis wiedergibt. Unabhängig davon müßte das Bild, für das die Klägerin den Schutz des § 72 UrhG in Anspruch nimmt, mehr sein als eine bloße technische Reproduktion einer bestehenden Graphik. Denn der technische Reproduktionsvorgang allein begründet noch keinen Lichtbildschutz (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 14/88, GRUR 1990, 669, 673 - Bibelreproduktion, m.w.N.; Schricker/Vogel, Urheberrecht, 2. Aufl., § 72 UrhG Rdn. 22). Vielmehr ist ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung erforderlich, die dann zu verneinen ist, wenn ein Lichtbild oder ein ähnlich hergestelltes Erzeugnis nicht mehr als die bloße technische Reproduktion einer vorhandenen Darstellung ist. Daß diese Voraussetzungen im Streitfall erfüllt sind, läßt sich dem Vorbringen der Klägerin nicht entnehmen.
Die Weltkarten-Grafik, deren Schöpfungshöhe der BGH bezweifelte, ist das Urbild, wobei zwischen der Zeichnung/Erstellung der Weltkarte und ihrem Erscheinen auf der Telefonkarte eine oder mehrere fotografische Vervielfältigungen gelegen haben müssen. Diese sind aber für den BGH als bloße technische Reproduktionen irrelevant, obwohl sie ein Urbild fotografierten.
Wer Handschriften, Inkunabeln und Drucke mit handschriftlichen Einträgen bloß technisch reproduziert, kann also trotz des Urbildcharakters der Vorlage keinen Schutz beanspruchen. Die üblichen Massendigitalisierungsgeräte leisten nichts als bloße technische Reproduktionen.
Talke schreibt "Originaltreue und ein Mindestmaß an individueller Gestaltung, das nach § 72 UrhG erforderlich ist, schließen einander [...] aus", was wörtlich auf Nordemann zurückgeht. Wer gemeinfreie Kulturgüter reproduziert, dem geht es nicht um die eigene kreative Leistung, es geht ihm einzig und allein um die möglichst originalgetreue Wiedergabe. Die Monopolisierung gemeinfreier Werke durch Reproduktionsvorgänge hat der BGH in "Bibelreproduktion" ausdrücklich angesprochen (Nordemann hatte das Beispiel von Zille-Fotografien gebildet, deren Originale nicht mehr greifbar sind). Die Vermarktung der Reproduktion zielt nicht auf Originalität des Fotografen/Schöpfers, sondern einzig und allein auf den gemeinfreien geistigen Gehalt des abgebildeten Werks, hinter dem der Fotograf/Scanmeister zurücktreten soll. Daher kann er auch keinen Anspruch auf eine "Belohnung" nach dem UrhG erheben.
Es bleibt also dabei: Es gibt keinen Lichtbildschutz für digitale Bilder zweidimensionaler Vorlagen. Der Aufsatz von Talke ist unbeachtlich.
Aus seinem Fazit: Für die Nutzung fremder digitaler Bilder bleibt die Frage der
Schutzfähigkeit – insbesondere wenn es sich bei den digitalisierten
Vorlagen um gemeinfreie Werke handelt – wesentlich. Die Entscheidung
über die Frage des Leistungsschutzrechtes nach § 72 UrhG oder gar
eines urheberrechtlichen Werkschutzes nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG kann
dabei im Einzelfall schwierig sein. Nichtsdestotrotz sind aufgrund der
oben angestellten Erwägungen Kategorien ersichtlich, an denen sich
Hersteller von Bildern zweidimensionaler Vorlagen, wie z. B. Gemälden
oder Buchblättern und deren Nutzer bei der Beurteilung des
Urheberrechtsschutzes orientieren können. Keinem Lichtbildschutz nach
§ 72 oder § 2 UrhG unterliegen originalgetreue Digitalisate von im
Massenverfahren hergestellten Büchern, denn dann handelt es sich um
nicht geschützte »Lichtbilder von Lichtbildern«.
Dagegen können Bilder von (teilweise) handgezeichneten oder
-geschriebenen Werken einem eigenen Lichtbildschutz nach § 72 UrhG
unterliegen, wenn hinsichtlich der Bildgestaltung ein
Gestaltungsspielraum, z. B. im Hinblick auf bestimmte Bedürfnisse von
Buchhistorikern, genutzt wird. Im Einzelfall kann das Ergebnis dann
sogar ein Lichtbildwerk sein.
Selbstverständlich bleibe ich bei meiner in der Kunstchronik 2008 dargelegten Position:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Siehe zuletzt auch meinen Kommentar zu
http://blog.arthistoricum.net/prometheus/
Talke hat die relevante jüngere Literatur nicht zur Kenntnis genommen, er stützt sich auf die wenigen Urteile zum Thema, auf die Kommentare von Dreier/Schultze und Wandtke/Bullinger, die - nicht überzeugende - Dissertation von Platena von 1995 und den Aufsatz von Nordemann GRUR 1987. Selbst wenn man meine zahlreichen Äußerungen in diesem Weblog und anderswo nicht als berücksichtigungswürdig ansieht, gibt es keine Entschuldigung, dass Talke die Studie von Lehment: Das Fotografieren von Kunstgegenständen, 2008 (die einschlägigen Seiten 25-37 sind einsehbar unter http://books.google.de/books?id=UzgDgc496XgC&pg=PA25 ), die ich hier rezensiert habe http://archiv.twoday.net/stories/5333018/, und den Aufsatz von Stang Z Geist Eig 2009 http://archiv.twoday.net/stories/5842438/ übersehen hat oder übergeht.
Seit 1989 beschäftigt mich die Frage (siehe http://archiv.twoday.net/stories/2478252/ ), und ich darf durchaus versichern, dass ich sehr viel mehr Literatur zum Thema seitdem zur Kenntnis genommen habe als Herr Talke oder irgendwelche Wald-und-Wiesen-Juristen die der Ansicht sind, dass ich doch mal gelegentlich in einen Kommentar schauen solle. Ich kann dazu z.B. in den von mir verfassten Urheberrechtskommentar "Urheberrechtsfibel" (2009) schauen. Die Todsünde ist ja, dass ich mich als Nicht-Jurist erdreiste, Juristen oder juristischen Fachreferenten zu widersprechen!
Ich will mich bei der Widerlegung von Talke kurz fassen:
In den Genuss des Leistungsschutzrechtes können also nur »Urbilder« kommen. Der Gesetzeswortlaut bedarf insoweit also einer einschränkenden Auslegung. Buchseiten, die mit Drucktechniken hergestellt wurden, bei denen von vorhandenen Textvorlagen auf reprografischem Wege Druckträger hergestellt werden, sowie mittels moderner Foto- und Lichtsatztechnik, bei der Schriftzeichen über vorhandene Negative oder einer Kathodenstrahlröhre auf lichtempfindliches Material übertragen
werden und grundsätzlich alle Hoch-, Flach- und Tiefdrucke sind
objektiv als Lichtbilder anzusehen. Darunter dürften regelmäßig die
seit ca. 1500 für den Buchdruck genutzten Techniken fallen. Die
digitalen Bilder von rein maschinell oder mechanisch hergestellten
Druckschriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Bibliotheken im Rahmen von Digitalisierungsprojekten oder Google im Rahmen seines »Google-Books«-Programms anfertigt, unterliegen daher von vornherein keinem urheberrechtlichen Schutz. Als dem Leistungsschutz grundsätzlich zugänglich verbleiben danach aber Bilder von Gemälden, Handschriften, Wiegendrucken oder gedruckten Seiten, auf denen sich auch per Hand gefertigte Zeichnungen finden bzw. handschriftliche Anmerkungen einen wesentlichen Teil ausmachen. Denn hier wird kein bloßes Lichtbild vom Lichtbild, sondern ein Urbild erzeugt.
Immerhin gesteht Talke zu, dass die Massendigitalisierung von Büchern ab dem 16. Jahrhundert kein Schutzrecht nach § 72 UrhG entstehen lässt.
Die Urbild-Theorie führt ersichtlich zu widersprüchlichen Wertungen.
Google-Digitalisate, auf denen handschriftliche Randbemerkungen zu sehen sind, wären demnach nach § 72 UrhG geschützt, obwohl die Leistung exakt die gleiche ist wie bei den anderen von Google digitalisierten Seiten.
Legt ein Archivar ein altes Aktenstück auf den Kopierer, entsteht ein Urbild - obwohl die juristische Lehre davon ausgeht, dass bei der Nutzung eines Kopierers eben kein Recht nach § 72 UrhG gegeben ist. Eine Xerokopie ist eindeutig ein Produkt, das ähnlich wie ein Lichtbild mittels strahlender Energie hergestellt wird und daher nach dem Wortlaut des Gesetzes den Lichtbildschutz entstehen lässt (siehe dazu auch Platena).
Flachbettscanner werden vom Schrifttum wie Kopierer betrachtet. Ich sehe keinen Grund, die überwiegend bei Digitalisierungen eingesetzten Aufsichtsscanner/Digitalkameras anders zu behandeln.
Die von Talke in den Vordergrund gestellten verschiedensten Scannereinstellungsmöglichkeiten sind für Kreutzer S. 36 kein Grund, den Schutz zu gewähren:
Entscheidend ist letztlich jedoch das Argument, dass ein Recht an Digitalisaten zu einer massiven Ausweitung des Lichtbildschutzrechts führen würde. Sie hätte zur Folge, dass die Ergebnisse von Kopiervorgängen durch hierfür bestimmte Geräte einem Schutzrecht unter-worfen würden. Dies würde der eindeutigen Aussage des BGH widersprechen, dass das Lichtbildrecht restriktiv zu verstehen ist, zuwiderlaufen.
Auch würde ein solches Ergebnis zu unlösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Es dürfte unbestreitbar sein, dass durch einfache Kopierer oder Scanner erzeugte Vervielfäl-tigungsstücke keinen Lichtbildschutz erlangen (sondern bloße Vervielfältigungen sind). In Frage käme dies nur für Kopien, die von mehr oder weniger komplexen Geräten erzeugt werden, da nur hier der Bedienende eine nennenswerte Eigenleistung erbringen muss. Wie komplex müsste aber ein solches Gerät sein? Und wer beurteilt, was komplex ist bzw. aus wessen Sicht muss das Gerät komplex sein (aus Sicht des Laien, eines Digitalisierungsprofis, des Entwicklers des Gerätes selbst)?
http://www.irights.info/userfiles/Digitalisierungsleitfaden.pdf
http://archiv.twoday.net/stories/11581045/
Auch bei modernen Fotokopierern können die Nutzer verschiedene Parameter einstellen, ohne dass dies jemand bewogen hat, den Kopierer einem Lichtbildner gleichzustellen.
Lehment brachte das Beispiel des Fotografen, der in einer Ausstellung Fotokunst fotografiert. Billigt man der Gemäldereproduktion entgegen der von mir vertretenen Auffassung den Schutz zu, hat man ein Problem, denn die Leistung des Fotografen ist im wesentlichen die gleiche, ob er nun Fotokunst oder ein anderes zweidimensionales Kunstwerk fotografiert. das Foto der Fotokunst ist nach BGH Bibelreproduktion aber eine nicht schützbare Lichtbildkopie. Das Problem löst sich, wie ich schon in meiner Rezension zu Lehment schrieb, indem man weder der Gemäldefotografie noch der Fotokunst-Reproduktion den Schutz gewährt!
Offenbar ist Talke auch entgangen, dass der BGH in seiner Telefonkarten-Entscheidung aus dem Jahr 2000 die Urbild-Theorie nicht mehr akzeptiert.
Es ging um eine stilisierte Weltkarte, also nicht um ein Foto, für das ja seit "Bibelreproduktion" feststand, dass ein "Bild vom Bild" nicht unter § 72 UrhG fiel.
Soweit die Klägerin den Lichtbildschutz des § 72 UrhG für sich in Anspruch genommen hat, fehlt es an Klagevorbringen dazu, ob und inwieweit die Telefonkarte der Klägerin ein Lichtbild oder ein auf ähnliche Weise hergestelltes Erzeugnis wiedergibt. Unabhängig davon müßte das Bild, für das die Klägerin den Schutz des § 72 UrhG in Anspruch nimmt, mehr sein als eine bloße technische Reproduktion einer bestehenden Graphik. Denn der technische Reproduktionsvorgang allein begründet noch keinen Lichtbildschutz (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 14/88, GRUR 1990, 669, 673 - Bibelreproduktion, m.w.N.; Schricker/Vogel, Urheberrecht, 2. Aufl., § 72 UrhG Rdn. 22). Vielmehr ist ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung erforderlich, die dann zu verneinen ist, wenn ein Lichtbild oder ein ähnlich hergestelltes Erzeugnis nicht mehr als die bloße technische Reproduktion einer vorhandenen Darstellung ist. Daß diese Voraussetzungen im Streitfall erfüllt sind, läßt sich dem Vorbringen der Klägerin nicht entnehmen.
Die Weltkarten-Grafik, deren Schöpfungshöhe der BGH bezweifelte, ist das Urbild, wobei zwischen der Zeichnung/Erstellung der Weltkarte und ihrem Erscheinen auf der Telefonkarte eine oder mehrere fotografische Vervielfältigungen gelegen haben müssen. Diese sind aber für den BGH als bloße technische Reproduktionen irrelevant, obwohl sie ein Urbild fotografierten.
Wer Handschriften, Inkunabeln und Drucke mit handschriftlichen Einträgen bloß technisch reproduziert, kann also trotz des Urbildcharakters der Vorlage keinen Schutz beanspruchen. Die üblichen Massendigitalisierungsgeräte leisten nichts als bloße technische Reproduktionen.
Talke schreibt "Originaltreue und ein Mindestmaß an individueller Gestaltung, das nach § 72 UrhG erforderlich ist, schließen einander [...] aus", was wörtlich auf Nordemann zurückgeht. Wer gemeinfreie Kulturgüter reproduziert, dem geht es nicht um die eigene kreative Leistung, es geht ihm einzig und allein um die möglichst originalgetreue Wiedergabe. Die Monopolisierung gemeinfreier Werke durch Reproduktionsvorgänge hat der BGH in "Bibelreproduktion" ausdrücklich angesprochen (Nordemann hatte das Beispiel von Zille-Fotografien gebildet, deren Originale nicht mehr greifbar sind). Die Vermarktung der Reproduktion zielt nicht auf Originalität des Fotografen/Schöpfers, sondern einzig und allein auf den gemeinfreien geistigen Gehalt des abgebildeten Werks, hinter dem der Fotograf/Scanmeister zurücktreten soll. Daher kann er auch keinen Anspruch auf eine "Belohnung" nach dem UrhG erheben.
Es bleibt also dabei: Es gibt keinen Lichtbildschutz für digitale Bilder zweidimensionaler Vorlagen. Der Aufsatz von Talke ist unbeachtlich.
KlausGraf - am Dienstag, 18. Januar 2011, 00:06 - Rubrik: Archivrecht
http://www.irights.info/userfiles/Digitalisierungsleitfaden.pdf
Bei einzelnen Aussagen fragwürdig, aber in der Grundtendenz sympathisch. Zitat:
Nach den vorstehenden Ausführungen sind vertragliche Nutzungsbeschränkungen für ge-meinfreie Inhalte – jedenfalls wenn sie durch allgemeine Geschäftsbedingungen auferlegt werden sollen – in den meisten Fällen unwirksam.
Neben diesen rechtlichen Bedenken, wäre es m. E. auch höchst fragwürdig, wenn Bibliotheken versuchen, die von ihnen im Regelfall mit Steuergeldern finanzierten Digitalisate gemeinfreier Werke derartigen Beschränkungen zu unterwerfen. Dieses Bedenken gilt unabhängig davon, ob sich die Restriktionen nur gegen gewerbliche Nutzer oder sogar gegen andere Einrichtungen oder gar Endnutzer richten sollen. Für den Versuch einer „Proprietarisierung“ von Inhalten, die aus guten Gründen frei von geistigen Eigentumsrechten sind, ist eine Rechtfertigung nicht ersichtlich, ganz gleich, gegen wen sich solche Maßnahmen richten.
Deutliche Worte zum Copyfraud der Bibliotheken sehen anders aus.
Die winzige Literaturauswahl ist einseitig und Kreutzer-lastig.
Obwohl die Ansicht zu § 72 UrhG anfechtbar ist, ist Kreutzer der Ansicht, dass durch das Scannen in Bibliotheken kein Schutzrecht entsteht.
Bei einzelnen Aussagen fragwürdig, aber in der Grundtendenz sympathisch. Zitat:
Nach den vorstehenden Ausführungen sind vertragliche Nutzungsbeschränkungen für ge-meinfreie Inhalte – jedenfalls wenn sie durch allgemeine Geschäftsbedingungen auferlegt werden sollen – in den meisten Fällen unwirksam.
Neben diesen rechtlichen Bedenken, wäre es m. E. auch höchst fragwürdig, wenn Bibliotheken versuchen, die von ihnen im Regelfall mit Steuergeldern finanzierten Digitalisate gemeinfreier Werke derartigen Beschränkungen zu unterwerfen. Dieses Bedenken gilt unabhängig davon, ob sich die Restriktionen nur gegen gewerbliche Nutzer oder sogar gegen andere Einrichtungen oder gar Endnutzer richten sollen. Für den Versuch einer „Proprietarisierung“ von Inhalten, die aus guten Gründen frei von geistigen Eigentumsrechten sind, ist eine Rechtfertigung nicht ersichtlich, ganz gleich, gegen wen sich solche Maßnahmen richten.
Deutliche Worte zum Copyfraud der Bibliotheken sehen anders aus.
Die winzige Literaturauswahl ist einseitig und Kreutzer-lastig.
Obwohl die Ansicht zu § 72 UrhG anfechtbar ist, ist Kreutzer der Ansicht, dass durch das Scannen in Bibliotheken kein Schutzrecht entsteht.
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 23:54 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34025/1.html
Die Hamburger Innen- und Justizbehörden verschwendeten angeblich zwei Hundertschaften Polizei und sieben Jahre Prozessaufwand bis zum Bundesverfassungsgericht, um ein paar ungenehmigt mitgeschnittene Sätze eines Polizeipressesprechers zu ahnden. Darüber, was das den Steuerzahler gekostet hat, schweigt sich das Bundesland eisern aus. [...] Nachdem wir bei den politischen Parteien angefragt hatten, meldete sich plötzlich auch die Hamburger Polizei. Zu einer für Beamte ungewöhnlichen Arbeitszeit, die nahelegt, dass hier möglicherweise jemand Überstunden aufgebrummt bekam. Nun war plötzlich nicht mehr die Rede davon, dass man schlicht und einfach keine Auskünfte gebe. Stattdessen meinte man jetzt, dass die Unterlagen "zwischenzeitlich vernichtet" wurden, weshalb man Fragen dazu nicht mehr beantworten könne.
Das Hamburger Staatsarchiv dürfte wohl - seinem reaktionären Chef folgend - eine unbefristete Vernichtungsgenehmigung für alle politisch brisanten Unterlagen erteilt haben ...
(Auf einen Bescheid zu http://archiv.twoday.net/stories/5702795/ warte ich bis heute.)
Die Hamburger Innen- und Justizbehörden verschwendeten angeblich zwei Hundertschaften Polizei und sieben Jahre Prozessaufwand bis zum Bundesverfassungsgericht, um ein paar ungenehmigt mitgeschnittene Sätze eines Polizeipressesprechers zu ahnden. Darüber, was das den Steuerzahler gekostet hat, schweigt sich das Bundesland eisern aus. [...] Nachdem wir bei den politischen Parteien angefragt hatten, meldete sich plötzlich auch die Hamburger Polizei. Zu einer für Beamte ungewöhnlichen Arbeitszeit, die nahelegt, dass hier möglicherweise jemand Überstunden aufgebrummt bekam. Nun war plötzlich nicht mehr die Rede davon, dass man schlicht und einfach keine Auskünfte gebe. Stattdessen meinte man jetzt, dass die Unterlagen "zwischenzeitlich vernichtet" wurden, weshalb man Fragen dazu nicht mehr beantworten könne.
Das Hamburger Staatsarchiv dürfte wohl - seinem reaktionären Chef folgend - eine unbefristete Vernichtungsgenehmigung für alle politisch brisanten Unterlagen erteilt haben ...
(Auf einen Bescheid zu http://archiv.twoday.net/stories/5702795/ warte ich bis heute.)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/60602
Die schön illustrierte Handschrift ist nur unzureichend auf der Website des Angebots erschlossen. Es fehlt ein Hinweis auf die Illustrationen, und der sonst übliche Link auf den Katalog oder den Handschriftencensus fehlt.
http://www.handschriftencensus.de/16348 (natürlich noch ohne den Link zum Digitalisat, ärgerlicherweise auch ohne Angaben zur Datierung 1490 und zum Schreiber/Illuminator)
Katalog Längin:
http://goo.gl/ITe2E (IA)
Als Schreiber nennt sich Bl. 143r Peter Artzt, Richter zu Vells (= Völs), als Illuminator Benedikt Hoben von Magdeburg, der sein Werk 1490 datiert:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/60917
Die schön illustrierte Handschrift ist nur unzureichend auf der Website des Angebots erschlossen. Es fehlt ein Hinweis auf die Illustrationen, und der sonst übliche Link auf den Katalog oder den Handschriftencensus fehlt.
http://www.handschriftencensus.de/16348 (natürlich noch ohne den Link zum Digitalisat, ärgerlicherweise auch ohne Angaben zur Datierung 1490 und zum Schreiber/Illuminator)
Katalog Längin:
http://goo.gl/ITe2E (IA)
Als Schreiber nennt sich Bl. 143r Peter Artzt, Richter zu Vells (= Völs), als Illuminator Benedikt Hoben von Magdeburg, der sein Werk 1490 datiert:
http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/60917
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 22:21 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.e-lib.ch/
Eine kurze Einordnung gibt
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/e-libch-online.html
Eine kurze Einordnung gibt
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2011/01/e-libch-online.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ethikvonunten.wordpress.com/2011/01/17/ala-wikileaks-resolution/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 22:02 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://francesscientist.wordpress.com/2011/01/15/impact-factor-who-are-you-bullshitting/
Impact factor is a crutch that is most often used by impotent, unimaginative and incompetent committees in the academic institutions for recruitment, promotions, and fiscal matters. Notice that I showered the adjectives on committees, not the members of the committees, who are generally intelligent people (including me). Overworked, unappreciated, and sometimes lazy and indifferent members of a committee do not want to be held responsible for making a decision. Therefore, they rely on impact factor to show their ‘objectivity’. If they hire a new faculty member who later turns out to be a complete jerk in the department, they can easily blame it on the impact factor of his publication which led to his recruitment. Had they selected him on the basis of their ‘judgement’, they would be scoffed at by their peers and colleagues.
So, once you begin to equate impact factor as being objective index of productivity, smartness, intelligence, and innovation, you have unleashed a monster that is going to take over the part of the system that traditionally relied on competing interests. Grant reviewers and paper reviewers can now exercise more arbitrary control over the decision-making without appearing to be unfair. They can veto the impact factor invoking their experience and judgement. Essentially, the reviewers are manipulating the system in their favor.
One may argue that eventually, the system will be ‘normalized’ so that no one will be clearly at an undue advantage. The truth is that it is the same old bullshit with the added objectivity armor of the impact factor.
In case you wondered how some journals achieve high impact factor, it is quite revealing to notice that the Annual Reviews series have some of the highest impact factor. Wow!! You would have thought that the real research papers should be the winners. Apparently not! And there lies the trick. Most high impact journals are highly cited not because of their published research papers but because of the review articles. It is not their altruism that glitzy journals are happy to let you download the artistic slides for your PowerPoint presentations.
Although it is a great business plan to target the lazy scientists who don’t want to do their own legwork of literature review, there is another reason for using review articles to boost impact factor. Many shrewd scientists like to cite the reviews published in the high impact factor journals in their grant proposals and research papers upfront. This way the lazy reviewer can be convinced that because the topic was reviewed in a high impact journal, it must be of great importance.
When I was a new postdoc, I learnt a valuable lesson in assessing the scientific caliber of a scientist. My research advisor was a soft-spoken, astute scientist with an incisive vision. He showed me how he judged the quality and productivity of a faculty candidate from his Curriculum vitae.
1. Throw out all the reviews, he (or she) has listed.
2. Take away all the papers where authorship is beyond the second author (or senior author).
3. Trash all the conferences and posters presented.
4. Look at how regularly the papers have been published and how good they are. Yes, use your judgement. A good paper does not need any assistance, you will know when you see it (at least in the area of research close to you).
I think I agree with his style of assessment rather than the bullshit of impact factor. Won’t you agree?
Impact factor is a crutch that is most often used by impotent, unimaginative and incompetent committees in the academic institutions for recruitment, promotions, and fiscal matters. Notice that I showered the adjectives on committees, not the members of the committees, who are generally intelligent people (including me). Overworked, unappreciated, and sometimes lazy and indifferent members of a committee do not want to be held responsible for making a decision. Therefore, they rely on impact factor to show their ‘objectivity’. If they hire a new faculty member who later turns out to be a complete jerk in the department, they can easily blame it on the impact factor of his publication which led to his recruitment. Had they selected him on the basis of their ‘judgement’, they would be scoffed at by their peers and colleagues.
So, once you begin to equate impact factor as being objective index of productivity, smartness, intelligence, and innovation, you have unleashed a monster that is going to take over the part of the system that traditionally relied on competing interests. Grant reviewers and paper reviewers can now exercise more arbitrary control over the decision-making without appearing to be unfair. They can veto the impact factor invoking their experience and judgement. Essentially, the reviewers are manipulating the system in their favor.
One may argue that eventually, the system will be ‘normalized’ so that no one will be clearly at an undue advantage. The truth is that it is the same old bullshit with the added objectivity armor of the impact factor.
In case you wondered how some journals achieve high impact factor, it is quite revealing to notice that the Annual Reviews series have some of the highest impact factor. Wow!! You would have thought that the real research papers should be the winners. Apparently not! And there lies the trick. Most high impact journals are highly cited not because of their published research papers but because of the review articles. It is not their altruism that glitzy journals are happy to let you download the artistic slides for your PowerPoint presentations.
Although it is a great business plan to target the lazy scientists who don’t want to do their own legwork of literature review, there is another reason for using review articles to boost impact factor. Many shrewd scientists like to cite the reviews published in the high impact factor journals in their grant proposals and research papers upfront. This way the lazy reviewer can be convinced that because the topic was reviewed in a high impact journal, it must be of great importance.
When I was a new postdoc, I learnt a valuable lesson in assessing the scientific caliber of a scientist. My research advisor was a soft-spoken, astute scientist with an incisive vision. He showed me how he judged the quality and productivity of a faculty candidate from his Curriculum vitae.
1. Throw out all the reviews, he (or she) has listed.
2. Take away all the papers where authorship is beyond the second author (or senior author).
3. Trash all the conferences and posters presented.
4. Look at how regularly the papers have been published and how good they are. Yes, use your judgement. A good paper does not need any assistance, you will know when you see it (at least in the area of research close to you).
I think I agree with his style of assessment rather than the bullshit of impact factor. Won’t you agree?
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 21:54 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/die_buechse_der_pandora_1.9116643.html
Ein massiver Schlag ins Kontor der Geistes- und Sozialwissenschaften ist der geplante vollständige Entzug öffentlicher Gelder für die Lehre. Die sogenannte «Browne Review», der Report eines ehemaligen BP-Topmanagers über die Zukunft der Universitäten, auf dessen Ergebnisse die Regierung sich bei ihren Beschlüssen beruft, empfiehlt das Zurückfahren aller direkten Regierungszuschüsse für die Lehre, ausser bei einigen «prioritär» behandelten Universitätsfächern wie Naturwissenschaften, Technik, Krankenpflege, Medizin und bestimmten aussereuropäischen Sprachen. Die Geisteswissenschaften sollen dabei leer ausgehen. In einem Brief an die «Times» vom 3. Dezember beschwerten sich 168 Professoren darüber, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass die Universitäten essenziell für eine lebendige Demokratie seien und die Mittel zum Streben nach kreativer und intellektueller Erfüllung bereitstellten.
Ein massiver Schlag ins Kontor der Geistes- und Sozialwissenschaften ist der geplante vollständige Entzug öffentlicher Gelder für die Lehre. Die sogenannte «Browne Review», der Report eines ehemaligen BP-Topmanagers über die Zukunft der Universitäten, auf dessen Ergebnisse die Regierung sich bei ihren Beschlüssen beruft, empfiehlt das Zurückfahren aller direkten Regierungszuschüsse für die Lehre, ausser bei einigen «prioritär» behandelten Universitätsfächern wie Naturwissenschaften, Technik, Krankenpflege, Medizin und bestimmten aussereuropäischen Sprachen. Die Geisteswissenschaften sollen dabei leer ausgehen. In einem Brief an die «Times» vom 3. Dezember beschwerten sich 168 Professoren darüber, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass die Universitäten essenziell für eine lebendige Demokratie seien und die Mittel zum Streben nach kreativer und intellektueller Erfüllung bereitstellten.
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 21:45 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 21:34 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 21:05 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 21:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 21:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam is bestolen door een eigen medewerker. De man nam 17de- en 18de-eeuwse gelegenheidsgedichten mee uit het archief, en bood ze aan bij antiquaren. Omdat een conservator van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de zaak niet vertrouwde, liep de man tegen de lamp.
Burgemeester Van der Laan, de portefeuillehouder van het Stadsarchief, stelt deze week de gemeenteraad op de hoogte van de kwestie. De diefstallen vonden plaats in 2009. Het Stadsarchief zoekt nu de publiciteit, omdat is gebleken dat er mogelijk nog meer door de man is gestolen dan bekend is. Een recherchebureau doet daar onderzoek naar.
Geen groot bedrag
'De stukken zijn een paar duizend euro waard', zegt Emmy Ferbeek, het hoofd van de afdeling Archief- en Collectiebeheer van het Stadsarchief. 'Dat is geen groot bedrag. Maar de schok bij ons was er niet minder om. De collega die dit heeft gedaan, werkte al dertig jaar bij het Stadsarchief en werd zeer gewaardeerd.' De man, die ook enkele boeken en almanakken stal, is ontslagen en veroordeeld tot een taakstraf.
Gelegenheidsgedichten werden in de 17de en 18de eeuw gemaakt bij familieaangelegenheden als huwelijk, geboorte en overlijden. Maar ook over beroemde personen werden dit soort gedichten geschreven. Ferbeek: 'Ze werden gedrukt en uitgegeven, soms als boekjes. Ze zijn niet heel zeldzaam, maar er zijn er ook niet heel veel bewaard gebleven. Dat maakt het tot goed verhandelbaar, interessant materiaal.'
Teruggekocht
Het Stadsarchief heeft alle materiaal dat was gestolen, teruggekocht. Maar nu zijn er aanwijzingen dat de oud-medewerker mogelijk nog meer heeft aangeboden bij antiquariaten. 'We weten het niet zeker, en dat is een afschuwelijk gevoel', zegt Ferbeek. Het Stadsarchief beheert bij elkaar 40 kilometer aan planken met materiaal, waardoor diefstal niet makkelijk te ontdekken is.
Het Stadsarchief hoopt dat collega-instanties zich ervan bewust worden dat dit soort diefstal ook bij hen kan plaatsvinden. 'Wij zijn niet het enige archief waar dit gebeurt, het probleem bestaat bij meer erfgoedinstellingen', zegt Ferbeek. 'Meestal wordt daar weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Wij kiezen voor openbaarheid, ook om maatregelen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.'
Ferbeek hoopt ook dat er bij de politie meer kennis over dit probleem komt. 'De politie is zeer behulpzaam, maar weet te weinig van archieven om echt goed onderzoek te kunnen doen.' "
Quelle: Volkskrant, 17.1.2011
Diskussion im holländischen Archivforum
Burgemeester Van der Laan, de portefeuillehouder van het Stadsarchief, stelt deze week de gemeenteraad op de hoogte van de kwestie. De diefstallen vonden plaats in 2009. Het Stadsarchief zoekt nu de publiciteit, omdat is gebleken dat er mogelijk nog meer door de man is gestolen dan bekend is. Een recherchebureau doet daar onderzoek naar.
Geen groot bedrag
'De stukken zijn een paar duizend euro waard', zegt Emmy Ferbeek, het hoofd van de afdeling Archief- en Collectiebeheer van het Stadsarchief. 'Dat is geen groot bedrag. Maar de schok bij ons was er niet minder om. De collega die dit heeft gedaan, werkte al dertig jaar bij het Stadsarchief en werd zeer gewaardeerd.' De man, die ook enkele boeken en almanakken stal, is ontslagen en veroordeeld tot een taakstraf.
Gelegenheidsgedichten werden in de 17de en 18de eeuw gemaakt bij familieaangelegenheden als huwelijk, geboorte en overlijden. Maar ook over beroemde personen werden dit soort gedichten geschreven. Ferbeek: 'Ze werden gedrukt en uitgegeven, soms als boekjes. Ze zijn niet heel zeldzaam, maar er zijn er ook niet heel veel bewaard gebleven. Dat maakt het tot goed verhandelbaar, interessant materiaal.'
Teruggekocht
Het Stadsarchief heeft alle materiaal dat was gestolen, teruggekocht. Maar nu zijn er aanwijzingen dat de oud-medewerker mogelijk nog meer heeft aangeboden bij antiquariaten. 'We weten het niet zeker, en dat is een afschuwelijk gevoel', zegt Ferbeek. Het Stadsarchief beheert bij elkaar 40 kilometer aan planken met materiaal, waardoor diefstal niet makkelijk te ontdekken is.
Het Stadsarchief hoopt dat collega-instanties zich ervan bewust worden dat dit soort diefstal ook bij hen kan plaatsvinden. 'Wij zijn niet het enige archief waar dit gebeurt, het probleem bestaat bij meer erfgoedinstellingen', zegt Ferbeek. 'Meestal wordt daar weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Wij kiezen voor openbaarheid, ook om maatregelen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.'
Ferbeek hoopt ook dat er bij de politie meer kennis over dit probleem komt. 'De politie is zeer behulpzaam, maar weet te weinig van archieven om echt goed onderzoek te kunnen doen.' "
Quelle: Volkskrant, 17.1.2011
Diskussion im holländischen Archivforum
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 20:56 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 20:54 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"A disaster can occur to an audiovisual materials collection as a result of long-term or short-term factors.
Short-term factors involve the more commonly thought of disasters such as flood, fire and severe damage or destruction of the storage vaults.
Long-term factors can include extended periods of storage where:
* the relative humidity is high, especially when it is greater than 60 per cent
* storage temperatures are constantly or frequently high or fluctuate over a short period
* vermin are uncontrolled
* high levels of oxidising agents or other pollutants are found.
Disaster planning should be a very high priority and plans need to be reviewed on a regular basis. Creating a list of disaster planning questions that cover likely disaster scenarios is an important first step in planning or planning review.
Equipment and external services required for recovery should be checked and updated similarly. Staff should be familiar with the elements of the plan, especially their own areas of responsibility.
Prevention practices and planning
Some aspects of good collection management practices such as correct wind tension, clearly identifying marks on both the film can and film, and condition reports are important elements of disaster planning. Correct wind tension can prevent or reduce the impact of some disasters and clear identification marks will enable accurate notes to be included in condition reports. Any unanticipated changes in the condition of the film in the future can be cross checked against other films that have suffered the same disaster and treatment, possibly avoiding a further collection crisis.
An essential factor of any disaster recovery is the ability to rapidly house the collection in a safe and stabilising environment as soon as the disaster has been noted. In film collections this invariably means cool or cold, dry conditions. An important first stage of disaster planning is identifying local cool-store or cold-store facilities that may be used at short notice. Food suppliers and shipping agents are often a good starting point for this.
Other components of a disaster recovery plan should include:
* identify high priority sections of the collection
* staff organised into teams to handle each stage of a disaster recovery
* equipment and training needs to be provided and procedures continually refined
* organisations or companies that offer products or services that are required for disaster recovery should be listed and the list should be frequently revised.
Water
Where significant water damage is suspected, as in floodwater or fire supression, films need to be stored in very cool conditions to reduce the likelihood of mould growth or bacterial action. Rapid air drying of wet film can create significant problems with the gelatin emulsion strongly adhering to adjacent layers in the film pack. This is known as 'blocking’.
Where fire hoses have been used there may be the need to match films with cans as the hose pressure may have blown cans from shelves.
Water damage recovery
The first recovery actions should involve a rinse with clean, preferably deionised or distilled water, to remove any surface debris and then placing in temporary storage under very cool or cold conditions until conservation treatments can be arranged.
Time is critical. Biological and chemical reactions are only slowed down by cold conditions, not stopped!
The sooner conservation treatments can start, the lower the risk of more serious damage.
Films should not be unwound for examination at this stage. If the film had high free acid levels, as may be encountered in decomposing films, then the gelatin emulsion will be very unstable and suffer significant damage by unwinding.
Where extended storage under high relative humidity has occurred, the films should not be immediately unwound as the gelatin may have blocked.
To identify the extent of the effect of the disaster a program of careful unwinding and examination needs to be instigated, possibly working on a statistically determined sample from each storage location. The program must incorporate training of staff in film handling and especially the problems of blocking and the degree of damage that can occur by incautious examination.
In the desire to quickly establish a remediation plan staff concerns such as OH&S issues of extended periods of film winding, with the possibility of Occupational Overuse Syndrome, and suitably designed and equipped work spaces must be considered.
Water damaged films where the gelatin is still stable will most probably require some form of rewash treatment to rinse any pollutants from the gelatin and film base. Before a rewash can be performed some films may require an unblocking treatment to gently release the adhesion between the film layers. This is a specialised treatment that often requires long periods of time with regular attention to the films to prevent further damage.
After rewashing, which is an aqueous process, a solvent cleaning may also be required to remove any oils or greases that have been carried onto the film during the disaster.
Fire
Fire poses the obvious problem of charring of the film itself, but there are several other issues that can arise:
* melting or fusing of a plastic reel, film can or can coating onto the film
* large dimensional changes in the film base or distortion of the film base
* fading or loss of the image, especially colour dye images
* blocking of the gelatin emulsion by melting.
It is often the case that only one part of the film is affected when there is a fire. This could be in part due to the low specific heat of film base materials, so only the area directly touched by fire is significantly affected. However, due to the way in which film is stored and transported through equipment, this can have a devastating effect on the film. If one part of the reel has been damaged then this will appear as a cyclic blemish, or regular loss of content when a film is projected or duplicated.
Fire damage recovery
The first stage of recovery from fire is identifying the film and assessing any obvious physical damage or soiling. Loose soils can be vacuumed away and melted plastics or coatings can usually be carefully removed — often there is little in the way of adhesion. The film should be recanned if necessary with all identification marks transferred to the new can.
When the film is examined, extreme care is required as the film may be blocked or very brittle, especially the emulsion. Assess the first few layers or wraps of the film reel for any dimensional changes or distortion. Any changes will be most apparent in the outer layers.
Some success has been had with unblocking fire damaged films. This, however, is a high risk operation and should only be undertaken if there are no alternatives.
Before extensive repair work is commenced, check the holdings of the collection for duplicate films as it may be more cost effective to change the collection status of the duplicate film or even obtain a copy from another institution.
If no other options are available then the film can be spliced together, removing the damaged sections.
Severe damage or destruction of the storage vaults
In the event of an earthquake or other event that seriously damages the storage structure and dislodges films the first response, once the site is safe for staff return to, is to identify films and return them to their respective cans or recan them if the former is not possible. Debris can be vacuumed away at this stage.
Physical damage needs to be assessed. If the films are not affected by water or fire they can be carefully unwound for examination. Film wound in a pack is relatively tough and any physical damage is likely to be restricted to the edges of the pack or the reel or core. Therefore basic repair techniques should be able to restore the film to a fully useable condition.
A solvent clean before returning to storage is advisable, but not necessarily essential. The decision needs to be made on the type of conditions the film was exposed to and whether the cans remained intact.
Storage plant failure
In the event of plant failure in the storage vault all access to the store should be suspended. This will slow the rate at which the temperature inside the vault will rise and help reduce the inflow of water vapour.
If the plant cannot be repaired quickly or if the fault occurs at a time when staff are not around to monitor the failure or there are delays in arranging repairs, 'time out of storage’ should be noted in condition reports. Remote sensing of the conditions inside the vault is highly desirable. If the conditions exceed preset safety levels then arrangements to relocate the collection to temporary storage should be made.
Long-term issues
The effect of the long-term issues listed can be controlled by regular inspection, testing and datalogging of environmental conditions of the storage facilities. Correct preparation of films before entering long-term storage, i.e. correct wind tension, can material and no foreign matter inside the film can, will further ensure a reduction in the risk.
Good environmental hygiene and pest management to reduce vermin around vaults are also important. Pest management does not necessarily mean chemical fumigation, but rather preventing vermin becoming established through measures such as:
* clearing away vegetation and rubbish from around buildings
* sealing potential entry points around the roof or service areas
* regularly cleaning and removing rubbish from the vaults themselves."
Link
Short-term factors involve the more commonly thought of disasters such as flood, fire and severe damage or destruction of the storage vaults.
Long-term factors can include extended periods of storage where:
* the relative humidity is high, especially when it is greater than 60 per cent
* storage temperatures are constantly or frequently high or fluctuate over a short period
* vermin are uncontrolled
* high levels of oxidising agents or other pollutants are found.
Disaster planning should be a very high priority and plans need to be reviewed on a regular basis. Creating a list of disaster planning questions that cover likely disaster scenarios is an important first step in planning or planning review.
Equipment and external services required for recovery should be checked and updated similarly. Staff should be familiar with the elements of the plan, especially their own areas of responsibility.
Prevention practices and planning
Some aspects of good collection management practices such as correct wind tension, clearly identifying marks on both the film can and film, and condition reports are important elements of disaster planning. Correct wind tension can prevent or reduce the impact of some disasters and clear identification marks will enable accurate notes to be included in condition reports. Any unanticipated changes in the condition of the film in the future can be cross checked against other films that have suffered the same disaster and treatment, possibly avoiding a further collection crisis.
An essential factor of any disaster recovery is the ability to rapidly house the collection in a safe and stabilising environment as soon as the disaster has been noted. In film collections this invariably means cool or cold, dry conditions. An important first stage of disaster planning is identifying local cool-store or cold-store facilities that may be used at short notice. Food suppliers and shipping agents are often a good starting point for this.
Other components of a disaster recovery plan should include:
* identify high priority sections of the collection
* staff organised into teams to handle each stage of a disaster recovery
* equipment and training needs to be provided and procedures continually refined
* organisations or companies that offer products or services that are required for disaster recovery should be listed and the list should be frequently revised.
Water
Where significant water damage is suspected, as in floodwater or fire supression, films need to be stored in very cool conditions to reduce the likelihood of mould growth or bacterial action. Rapid air drying of wet film can create significant problems with the gelatin emulsion strongly adhering to adjacent layers in the film pack. This is known as 'blocking’.
Where fire hoses have been used there may be the need to match films with cans as the hose pressure may have blown cans from shelves.
Water damage recovery
The first recovery actions should involve a rinse with clean, preferably deionised or distilled water, to remove any surface debris and then placing in temporary storage under very cool or cold conditions until conservation treatments can be arranged.
Time is critical. Biological and chemical reactions are only slowed down by cold conditions, not stopped!
The sooner conservation treatments can start, the lower the risk of more serious damage.
Films should not be unwound for examination at this stage. If the film had high free acid levels, as may be encountered in decomposing films, then the gelatin emulsion will be very unstable and suffer significant damage by unwinding.
Where extended storage under high relative humidity has occurred, the films should not be immediately unwound as the gelatin may have blocked.
To identify the extent of the effect of the disaster a program of careful unwinding and examination needs to be instigated, possibly working on a statistically determined sample from each storage location. The program must incorporate training of staff in film handling and especially the problems of blocking and the degree of damage that can occur by incautious examination.
In the desire to quickly establish a remediation plan staff concerns such as OH&S issues of extended periods of film winding, with the possibility of Occupational Overuse Syndrome, and suitably designed and equipped work spaces must be considered.
Water damaged films where the gelatin is still stable will most probably require some form of rewash treatment to rinse any pollutants from the gelatin and film base. Before a rewash can be performed some films may require an unblocking treatment to gently release the adhesion between the film layers. This is a specialised treatment that often requires long periods of time with regular attention to the films to prevent further damage.
After rewashing, which is an aqueous process, a solvent cleaning may also be required to remove any oils or greases that have been carried onto the film during the disaster.
Fire
Fire poses the obvious problem of charring of the film itself, but there are several other issues that can arise:
* melting or fusing of a plastic reel, film can or can coating onto the film
* large dimensional changes in the film base or distortion of the film base
* fading or loss of the image, especially colour dye images
* blocking of the gelatin emulsion by melting.
It is often the case that only one part of the film is affected when there is a fire. This could be in part due to the low specific heat of film base materials, so only the area directly touched by fire is significantly affected. However, due to the way in which film is stored and transported through equipment, this can have a devastating effect on the film. If one part of the reel has been damaged then this will appear as a cyclic blemish, or regular loss of content when a film is projected or duplicated.
Fire damage recovery
The first stage of recovery from fire is identifying the film and assessing any obvious physical damage or soiling. Loose soils can be vacuumed away and melted plastics or coatings can usually be carefully removed — often there is little in the way of adhesion. The film should be recanned if necessary with all identification marks transferred to the new can.
When the film is examined, extreme care is required as the film may be blocked or very brittle, especially the emulsion. Assess the first few layers or wraps of the film reel for any dimensional changes or distortion. Any changes will be most apparent in the outer layers.
Some success has been had with unblocking fire damaged films. This, however, is a high risk operation and should only be undertaken if there are no alternatives.
Before extensive repair work is commenced, check the holdings of the collection for duplicate films as it may be more cost effective to change the collection status of the duplicate film or even obtain a copy from another institution.
If no other options are available then the film can be spliced together, removing the damaged sections.
Severe damage or destruction of the storage vaults
In the event of an earthquake or other event that seriously damages the storage structure and dislodges films the first response, once the site is safe for staff return to, is to identify films and return them to their respective cans or recan them if the former is not possible. Debris can be vacuumed away at this stage.
Physical damage needs to be assessed. If the films are not affected by water or fire they can be carefully unwound for examination. Film wound in a pack is relatively tough and any physical damage is likely to be restricted to the edges of the pack or the reel or core. Therefore basic repair techniques should be able to restore the film to a fully useable condition.
A solvent clean before returning to storage is advisable, but not necessarily essential. The decision needs to be made on the type of conditions the film was exposed to and whether the cans remained intact.
Storage plant failure
In the event of plant failure in the storage vault all access to the store should be suspended. This will slow the rate at which the temperature inside the vault will rise and help reduce the inflow of water vapour.
If the plant cannot be repaired quickly or if the fault occurs at a time when staff are not around to monitor the failure or there are delays in arranging repairs, 'time out of storage’ should be noted in condition reports. Remote sensing of the conditions inside the vault is highly desirable. If the conditions exceed preset safety levels then arrangements to relocate the collection to temporary storage should be made.
Long-term issues
The effect of the long-term issues listed can be controlled by regular inspection, testing and datalogging of environmental conditions of the storage facilities. Correct preparation of films before entering long-term storage, i.e. correct wind tension, can material and no foreign matter inside the film can, will further ensure a reduction in the risk.
Good environmental hygiene and pest management to reduce vermin around vaults are also important. Pest management does not necessarily mean chemical fumigation, but rather preventing vermin becoming established through measures such as:
* clearing away vegetation and rubbish from around buildings
* sealing potential entry points around the roof or service areas
* regularly cleaning and removing rubbish from the vaults themselves."
Link
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 20:46 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Binden auf erhabenen Bünden in der Restaurierungswerkstatt

Stillleben Konservierungsband aus der Restaurierungswerkstatt

Privilegienurkunden erhalten ein neues Schutzbehältnis
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 20:40 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://beta.canadiana.ca/co/en
Hatten wir schon:
http://archiv.twoday.net/stories/6457874/
Aber
http://xrefer.blogspot.com/2011/01/canadiana-discovery-portal.html
tut so, als ob das ganz neu sei.
Zum Suchwort leipzig werden 7166 Treffer gefunden, obwohl
http://books2.scholarsportal.info/home.html
in den Public Collections 51.000+ Treffer findet. Das Scholarsportal enthält neben den in Kanada für das Internet Archive gescannten Büchern offenbar auch gespiegelte Google-Scans.
Hatten wir schon:
http://archiv.twoday.net/stories/6457874/
Aber
http://xrefer.blogspot.com/2011/01/canadiana-discovery-portal.html
tut so, als ob das ganz neu sei.
Zum Suchwort leipzig werden 7166 Treffer gefunden, obwohl
http://books2.scholarsportal.info/home.html
in den Public Collections 51.000+ Treffer findet. Das Scholarsportal enthält neben den in Kanada für das Internet Archive gescannten Büchern offenbar auch gespiegelte Google-Scans.
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 19:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


Quelle: Mies van der Rohe Haus
"Die Ausstellung „Mies und sein Archivar“ von Ludwig Glaeser (1930-2006) bildet den Anfang des Mies-125-Jahres. Die Schwarzweißfotografien des Architekturhistorikers und MoMA Curators Ludwig Glaeser bringen Mies’ Architektur noch einmal zu Bewusstsein und liefern die Ausgangsposition. Nicht nur dass Ludwig Glaeser Mies’ Bauten fotografiert hat, er hat sich auch mit den Miesschen Gedanken auseinandergesetzt und sich in die Miessche Ästhetik eingefühlt. Glaesers fotografische Haltung ist stilistisch sachlich und klar. Das architektonische Interesse bestimmte seine Herangehensweise auch bei ungewöhnlichen Aufnahmen, wie beispielsweise aus dem Hubschrauber. Die bisher noch nie gezeigten Architekturfotografien, werden erstmalig im Mies van der Rohe Haus vorgestellt.
Beginn: So, 23.01.2011, 14:00 .....
Ort: Mies van der Rohe Haus, Oberseestraße 60, 13053 Berlin"
Quelle: XING
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 19:36 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.wikimedia.fr/huit-millions-de-fichiers-dans-la-mediatheque-libre-wikimedia-commons-2560
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
Im Vergleich dazu die Erbärmlichkeiten des Prometheus-Bildarchivs:
* Keine freien Medien, eine CC-Lizenz habe ich bisher vergeblich gesucht (wieso Bilder von Kunsthistorikern wie Stephan Hoppe oder Ute Verstegen in Prometheus nur einem geschlossenen Benutzerkreis zur Ansicht - von der Nachnutzung ganz zu schweigen - zur Verfügung stellen sollten, erschließt sich mir nicht)
* Für Institutionen nicht gerade billig
* Winzige Open-Access-Sektion, deren Sammlungen nur einzeln durchsucht werden können. In Prometheus nur im Abo zugängliche Sammlungen stehen teilweise anderweitig frei im Internet (Pictura Paedagocica)
* Keine freie Suche für Jedermann (anders als bei JSTOR).
* Prometheus verletzt die Rechte von Fotografen zugunsten eines geschlossenen Benutzerkreises
* Copyfraud ohne Ende, keine Anerkenntnis der Tatsache, dass Fotos von 2-D-Objekten nicht geschützt sind
http://archiv.twoday.net/search?q=prometheus

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
Im Vergleich dazu die Erbärmlichkeiten des Prometheus-Bildarchivs:
* Keine freien Medien, eine CC-Lizenz habe ich bisher vergeblich gesucht (wieso Bilder von Kunsthistorikern wie Stephan Hoppe oder Ute Verstegen in Prometheus nur einem geschlossenen Benutzerkreis zur Ansicht - von der Nachnutzung ganz zu schweigen - zur Verfügung stellen sollten, erschließt sich mir nicht)
* Für Institutionen nicht gerade billig
* Winzige Open-Access-Sektion, deren Sammlungen nur einzeln durchsucht werden können. In Prometheus nur im Abo zugängliche Sammlungen stehen teilweise anderweitig frei im Internet (Pictura Paedagocica)
* Keine freie Suche für Jedermann (anders als bei JSTOR).
* Prometheus verletzt die Rechte von Fotografen zugunsten eines geschlossenen Benutzerkreises
* Copyfraud ohne Ende, keine Anerkenntnis der Tatsache, dass Fotos von 2-D-Objekten nicht geschützt sind
http://archiv.twoday.net/search?q=prometheus

KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 18:39 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Sammelband, der u.a. die materialreiche Studie von Michael Klein zu Württemberg enthält, ist online unter
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00044184/image_1
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00044184/image_1
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 17:05 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Baustelle des Landesarchivs NRW in Duisburg
(Foto: spirandelli, 11.1.11, http://www.landesarchiv-forum.de )
s.a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 10:35 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 17. Januar 2011, 08:16 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
CX 160 Name:
# of Volumes: 5
Dates: 1628-1634. 1628
Description: Manuscript compilation of information about the noble families of Germany. Includes coats-of-arms (some in color), printed material, engravings of people and places. Engraving of Wilibald Pirkheimer by Albrecht Durer in volume 4.
Subjects: Germany genealogy; Heraldry; Nuremberg (Germany) -- history
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=4712
#fnzhss
# of Volumes: 5
Dates: 1628-1634. 1628
Description: Manuscript compilation of information about the noble families of Germany. Includes coats-of-arms (some in color), printed material, engravings of people and places. Engraving of Wilibald Pirkheimer by Albrecht Durer in volume 4.
Subjects: Germany genealogy; Heraldry; Nuremberg (Germany) -- history
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=4712
#fnzhss
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 03:28 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein ansprechendes Weblog unterrichtet über digitalisierte Notendrucke:
http://digitalscores.wordpress.com/
Unter den 9300+ Digitalisaten befinden sich derzeit auch über 60+ Bücher, davon einige auf Deutsch.
https://urresearch.rochester.edu/viewInstitutionalCollection.action?collectionId=63
RSS-Feed für Neuzugänge der Notendrucke-Digitalisate ist verfügbar.
http://digitalscores.wordpress.com/
Unter den 9300+ Digitalisaten befinden sich derzeit auch über 60+ Bücher, davon einige auf Deutsch.
https://urresearch.rochester.edu/viewInstitutionalCollection.action?collectionId=63
RSS-Feed für Neuzugänge der Notendrucke-Digitalisate ist verfügbar.
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 03:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.karl-schneider.com/
Modisch flott, aber sehr stark von der Werbung für das Buch des Bloggers http://digireg.twoday.net/ dominiert, ansonsten extrem inhaltsarm. Kein Volltext! Man mag meine Homepage (gepflegt 1997-2003) eine völlig veraltete und optisch abschreckende Website nennen, aber durch die Volltexte ist sie nach wie vor von Wert und ich ziehe sie Schneiders Schnickschnack allemal vor ...
Modisch flott, aber sehr stark von der Werbung für das Buch des Bloggers http://digireg.twoday.net/ dominiert, ansonsten extrem inhaltsarm. Kein Volltext! Man mag meine Homepage (gepflegt 1997-2003) eine völlig veraltete und optisch abschreckende Website nennen, aber durch die Volltexte ist sie nach wie vor von Wert und ich ziehe sie Schneiders Schnickschnack allemal vor ...
http://www.ctt-journal.com/2-6-en-gratwohl-2011jan14.html
In CTT, via
http://www.connotea.org/article/cf301e4b191273cecf3e42ba5babd32b
In CTT, via
http://www.connotea.org/article/cf301e4b191273cecf3e42ba5babd32b
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 01:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/NdCP4
"The Montana State Library (MSL) has just completed moving 3,070 born-digital state publications from OCLC’s CONTENTdm to the Internet Archive. "
"The Montana State Library (MSL) has just completed moving 3,070 born-digital state publications from OCLC’s CONTENTdm to the Internet Archive. "
KlausGraf - am Montag, 17. Januar 2011, 01:39 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


















