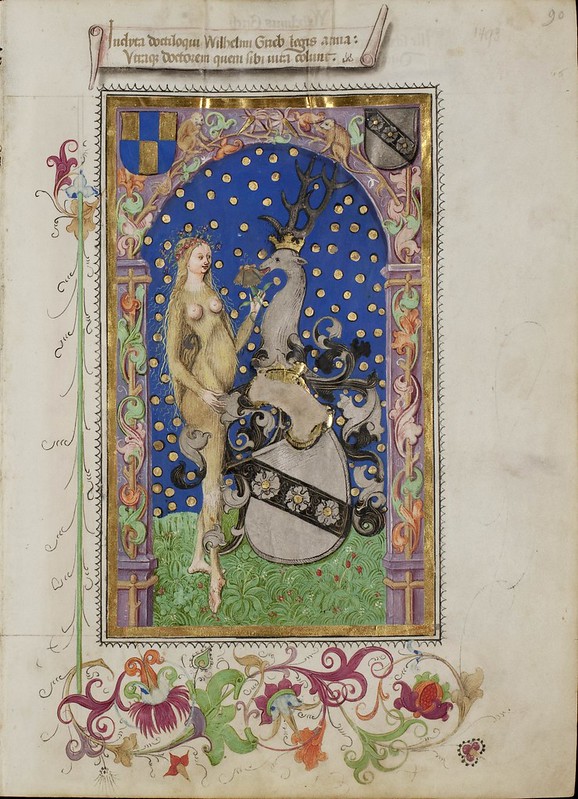http://digi.ub.uni-heidelberg.de/fwhb/klebebaende
Ohne eine Erschließung eine reine Wundertüte.
Auf ein Fürstlich Waldeckisches Quellenermittlungscollegium zu warten, wäre wohl vertane Zeit. Daher wäre ein wenig Crowdsourcing angesagt.
Nachtrag: Tiefenerschließung ist in Arbeit, siehe ergänzte Fassung der Seite.

Ohne eine Erschließung eine reine Wundertüte.
Auf ein Fürstlich Waldeckisches Quellenermittlungscollegium zu warten, wäre wohl vertane Zeit. Daher wäre ein wenig Crowdsourcing angesagt.
Nachtrag: Tiefenerschließung ist in Arbeit, siehe ergänzte Fassung der Seite.

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 23:21 - Rubrik: Bildquellen
Vor dem Lesen beachten: Ist eine SATIRE, also NICHT ECHT:
http://mishaanouk.com/2013/12/16/neue-abmahnwelle-jagd-auf-serien-streamer-via-facebook/

http://mishaanouk.com/2013/12/16/neue-abmahnwelle-jagd-auf-serien-streamer-via-facebook/

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 22:26 - Rubrik: Archivrecht
http://www.saechsdsb.de/images/stories/sdb_inhalt/oeb/taetigkeitsberichte/16-Ttigkeitsbericht-Endfassung.pdf
Abschnitt 5.8 des wie üblich sehr engstirnigen Berichts betrifft das Archivwesen. Auszug:
"Erneut (vgl. auch 9/5.8.4 und 11/5.8.2.) musste ich einer Petentin, die Nachforschungen
zur Person ihres (ihr unbekannten) Vaters durchführen wollte, mitteilen, dass derzeit
keine Rechtsvorschrift existiert, die eine Nutzung personenbezogenen Archivguts zu
diesem Zwecke erlaubt.". Statt auf eine Novellierung des Archivgesetzes zu warten, würde ich der Petentin eine Klage empfehlen. Zum grundrechtlich geschützten Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung:
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv079256.html
Via
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=6290
Abschnitt 5.8 des wie üblich sehr engstirnigen Berichts betrifft das Archivwesen. Auszug:
"Erneut (vgl. auch 9/5.8.4 und 11/5.8.2.) musste ich einer Petentin, die Nachforschungen
zur Person ihres (ihr unbekannten) Vaters durchführen wollte, mitteilen, dass derzeit
keine Rechtsvorschrift existiert, die eine Nutzung personenbezogenen Archivguts zu
diesem Zwecke erlaubt.". Statt auf eine Novellierung des Archivgesetzes zu warten, würde ich der Petentin eine Klage empfehlen. Zum grundrechtlich geschützten Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung:
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv079256.html
Via
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=6290
KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:53 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Aufsatz in "Zum Lesen" lotet Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus:
http://www.bvs.bz.it/download/27dextOdACjE.pdf
http://www.bvs.bz.it/download/27dextOdACjE.pdf
KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:39 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 21:31 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Artikel aus dem November, den wir aber trotzdem nachtragen möchten:
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/uwe-kamenz-plagiat
In der ZEIT auch ein unterstützungswürdiges Plädoyer: Digitalisiert die Dissertationen!
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/steinmeier-dissertation-transparenz
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/uwe-kamenz-plagiat
In der ZEIT auch ein unterstützungswürdiges Plädoyer: Digitalisiert die Dissertationen!
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-11/steinmeier-dissertation-transparenz
KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 20:46 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-12/forschungspreis-plagiat-urologen-nationalsozialismus (Hermann Horstkotte)
"Vor einigen Wochen wurde der Doppelband Urologen im Nationalsozialismus von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der Bundesärztekammer und der Vereinigung der Kassenärzte mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. Die Jury hob "die Mischung aus biographischen Kurzdarstellungen und exemplarischen Lebensbildern" hervor.
Dabei hatte die verantwortliche Nachwuchshistorikerin Julia Bellmann voriges Jahr nachträglich erklärt, dass rund ein Drittel ihrer 241 Kurzbiographien "wesentlich auf den Angaben" eines zwei Jahre jüngeren Werkes ihrer Kollegin Rebecca Schwoch basieren. Teilweise hat Bellmann Textabschnitte eins zu eins aus der Vorlage übernommen, ohne das zu erwähnen – ein Plagiat."
Korrigierte Urologen-Liste:
http://newsletter.dgu.de/mat/Liste.pdf
"Vor einigen Wochen wurde der Doppelband Urologen im Nationalsozialismus von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der Bundesärztekammer und der Vereinigung der Kassenärzte mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. Die Jury hob "die Mischung aus biographischen Kurzdarstellungen und exemplarischen Lebensbildern" hervor.
Dabei hatte die verantwortliche Nachwuchshistorikerin Julia Bellmann voriges Jahr nachträglich erklärt, dass rund ein Drittel ihrer 241 Kurzbiographien "wesentlich auf den Angaben" eines zwei Jahre jüngeren Werkes ihrer Kollegin Rebecca Schwoch basieren. Teilweise hat Bellmann Textabschnitte eins zu eins aus der Vorlage übernommen, ohne das zu erwähnen – ein Plagiat."
Korrigierte Urologen-Liste:
http://newsletter.dgu.de/mat/Liste.pdf
KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 20:30 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
ingobobingo - am Montag, 16. Dezember 2013, 13:59 - Rubrik: Kommunalarchive
Ich habe Archivalia als "Sturmgeschütz für Open Access" bezeichnet und allein in der Rubrik Open Access mehr als 1700 Beiträge geschrieben:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750
Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,
http://archiv.twoday.net/stories/97013461/
in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:
http://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)
Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:
http://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
http://archiv.twoday.net/stories/4987529/
Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":
http://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/
Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."
Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen
Alle Türchen: #bestof
***
Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.
(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!
Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.
Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans
Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.
In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf
http://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm
beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)
Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.
Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.
Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf
http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm
Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!
"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.
"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.
Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."
B.I.T: keine freien Volltexte mehr!
BuB: keine Volltexte!
ABi-Technik: keine Volltexte!
Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.
(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!
Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.
Man lese etwa aus dem Jahr 2005:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html
Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!
Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.
Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.
Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!
Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.
Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.
Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (http://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.
(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!
Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.
Mehr unter:
http://archiv.twoday.net/stories/2512361/
Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch
http://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint
(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!
Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"
Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.
So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).
"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!
(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!
Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.
Mehr unter:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html
(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!
Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.
Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.
Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).
Ein typisches Beispiel:
"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."
http://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm
Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.
Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!
Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.
Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.
Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:
http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: http://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:
"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."
http://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html
Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe
http://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html
Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:
Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften
http://archiv.twoday.net/stories/2383226/
Weimarer Erklärung zu Nachlässen
http://archiv.twoday.net/stories/549953/
Kartenforum Sachsen
http://archiv.twoday.net/stories/1289837/
Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC
http://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/
Siehe zum Thema Bildrechte auch:
http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte
http://archiv.twoday.net/stories/2478252/
Für die USA: Rising Permission Costs
http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Eigene Stellungnahmen:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!
Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife
Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.
Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html
und weitere Listenbeiträge.
Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.
FAZIT:
Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.
NACHTRÄGE:
Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750
Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,
http://archiv.twoday.net/stories/97013461/
in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:
http://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)
Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:
http://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch
http://archiv.twoday.net/stories/6400333/
http://archiv.twoday.net/stories/4987529/
Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":
http://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/
Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."
Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen
Alle Türchen: #bestof
***
Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.
(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!
Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.
Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans
Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.
In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf
http://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm
beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)
Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.
Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.
Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf
http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm
Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!
"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.
"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.
Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."
B.I.T: keine freien Volltexte mehr!
BuB: keine Volltexte!
ABi-Technik: keine Volltexte!
Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.
(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!
Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.
Man lese etwa aus dem Jahr 2005:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html
Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!
Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.
Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.
Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!
Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.
Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.
Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (http://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.
(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!
Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.
Mehr unter:
http://archiv.twoday.net/stories/2512361/
Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch
http://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint
(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!
Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"
Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.
So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).
"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!
(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!
Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.
Mehr unter:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html
(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!
Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.
Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.
Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).
Ein typisches Beispiel:
"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."
http://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm
Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.
Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!
Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.
Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.
Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:
http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: http://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:
"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."
http://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html
Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe
http://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html
Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:
Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften
http://archiv.twoday.net/stories/2383226/
Weimarer Erklärung zu Nachlässen
http://archiv.twoday.net/stories/549953/
Kartenforum Sachsen
http://archiv.twoday.net/stories/1289837/
Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC
http://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/
Siehe zum Thema Bildrechte auch:
http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte
http://archiv.twoday.net/stories/2478252/
Für die USA: Rising Permission Costs
http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Eigene Stellungnahmen:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!
Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife
Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.
Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html
und weitere Listenbeiträge.
Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.
FAZIT:
Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.
NACHTRÄGE:
Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 00:33 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Tanja Bernsau begleitet den Fall umfassend und hat mehrere interessante Artikel über Gurlitt selbst, seine Sammlung, die Praxis des Kunsthandels im Nationalsozialismus und die Monument Men. Lesen!" meint Schmalenstroer, dem beizupflichten ist.
http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/gurlitt-3-ein-kurzer-lesetipp/
Das Blog:
http://bernsau.wordpress.com/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=gurlitt

http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/gurlitt-3-ein-kurzer-lesetipp/
Das Blog:
http://bernsau.wordpress.com/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=gurlitt

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 17:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ist ja auch sonntags geschlossen ...
Die Website ist mindestens seit gestern offline.
Die Website ist mindestens seit gestern offline.
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 14:30 - Rubrik: Bibliothekswesen
http://www.kunstsammlungen-coburg.de/sammlungen-online.php
Zu den Gemäldesammlung gibt es eine Datenbank. Unter anderem ein Katalog der Musikhandschriften und ein umfangreicher Katalog zu illustrierten Reformations-Flugschriften stehen als PDFs bereit.
Das in
http://www.oberfranken.de/-16-04-13--Sammlungen-der-Veste-Coburg-online.htm
genannte Turnierbuch habe ich nicht gefunden.

Zu den Gemäldesammlung gibt es eine Datenbank. Unter anderem ein Katalog der Musikhandschriften und ein umfangreicher Katalog zu illustrierten Reformations-Flugschriften stehen als PDFs bereit.
Das in
http://www.oberfranken.de/-16-04-13--Sammlungen-der-Veste-Coburg-online.htm
genannte Turnierbuch habe ich nicht gefunden.

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 14:03 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"KIT Scientific Publishing ist der Wissenschaftsverlag des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und seine Mission liegt in der elektronischen Verbreitung Karlsruher Forschungsergebnisse. Parallel dazu vertreibt er seine gedruckten Verlagserzeugnisse über den weltweiten Buchhandel. Als Open-Access-Verlag werden im Einvernehmen mit den Autoren seit Beginn der Verlagsarbeit in 2004 Creative-Commons-Lizenzen vergeben, um die Verbreitung transparent und einheitlich zu gewährleisten. Lange Jahre wurde die Lizenz CC BY-NC-ND gewählt, die eine kommerzielle Nutzung und Veränderungen der Werke unterband. Gemäß dieser Lizenz konnten die Karlsruher Verlagserzeugnisse nur als identische Kopien kostenlos weitergeben werden.
Seit Mitte 2013 verzichtet KIT Scientific Publishing zugunsten seiner Autoren auf die „NC“-Einschränkung. Beabsichtigt ist damit eine erhöhte und einheitlichere Verbreitung der Verlagserzeugnisse, die nun auch in kommerzielle Angebote von Dritten wie Datenbankherstellern eingebunden werden können. Auch der Verzicht auf die „ND“-Einschränkung vergrößert die Möglichkeiten zur Nutzung der Inhalte und erhöht damit die Wahrnehmbarkeit der Autoren: Übersetzungen, Aktualisierungen, Erweiterungen und Ähnliches können nun von Dritten erstellt werden, wobei aufbauende und abgeleitete Werke stets als solche gekennzeichnet werden müssen. Damit ist sofort ersichtlich, ob es sich um die Originalversion des Autors oder eine veränderte oder aufbauende Version handelt, denn „BY“ verlangt, dass der Originalautor immer angemessen genannt wird. Die neu hinzugekommene „SA“-Klausel stellt sicher, dass alle aufbauenden Werke ebenfalls wieder so frei sind wie das Originalwerk und steht so dem Gedanken von Open Access am nächsten.
Der Verlag schützt sich vor hundertprozentigem Nachdruck und Vertrieb mit Hilfe des Markenrechts: das KIT-Logo ist markenrechtlich geschützt. Damit dürfen Dritte es nicht verwenden um den Anschein zu erwecken, die von ihnen angebotenen Nachdrucke wären Produkte des KIT-Verlags. Auch die ISBN ist für unveränderte Ausgabe von KIT Scientific Publishing reserviert.
Regine Tobias"
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=356#c2435 (CC-BY)
Seit Mitte 2013 verzichtet KIT Scientific Publishing zugunsten seiner Autoren auf die „NC“-Einschränkung. Beabsichtigt ist damit eine erhöhte und einheitlichere Verbreitung der Verlagserzeugnisse, die nun auch in kommerzielle Angebote von Dritten wie Datenbankherstellern eingebunden werden können. Auch der Verzicht auf die „ND“-Einschränkung vergrößert die Möglichkeiten zur Nutzung der Inhalte und erhöht damit die Wahrnehmbarkeit der Autoren: Übersetzungen, Aktualisierungen, Erweiterungen und Ähnliches können nun von Dritten erstellt werden, wobei aufbauende und abgeleitete Werke stets als solche gekennzeichnet werden müssen. Damit ist sofort ersichtlich, ob es sich um die Originalversion des Autors oder eine veränderte oder aufbauende Version handelt, denn „BY“ verlangt, dass der Originalautor immer angemessen genannt wird. Die neu hinzugekommene „SA“-Klausel stellt sicher, dass alle aufbauenden Werke ebenfalls wieder so frei sind wie das Originalwerk und steht so dem Gedanken von Open Access am nächsten.
Der Verlag schützt sich vor hundertprozentigem Nachdruck und Vertrieb mit Hilfe des Markenrechts: das KIT-Logo ist markenrechtlich geschützt. Damit dürfen Dritte es nicht verwenden um den Anschein zu erwecken, die von ihnen angebotenen Nachdrucke wären Produkte des KIT-Verlags. Auch die ISBN ist für unveränderte Ausgabe von KIT Scientific Publishing reserviert.
Regine Tobias"
http://oa.helmholtz.de/index.php?id=356#c2435 (CC-BY)
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 13:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sensationell:
http://visit.uc.pt/en/library/
 Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://visit.uc.pt/en/library/
 Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Lohen11 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 04:37 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://catalogo.cesareia.com/
Auch solche mit Altbeständen. Künftig integriert werden soll die wunderbare (staatliche) Barockbibliothek des Nationalpalastes von Mafra (siehe Video).
http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95288
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Mafra
Auch solche mit Altbeständen. Künftig integriert werden soll die wunderbare (staatliche) Barockbibliothek des Nationalpalastes von Mafra (siehe Video).
http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95288
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Mafra
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 04:10 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Vertrauliche-Patientendossiers-lagen-auf-der-Strasse%3Bart2889,3638089
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Das-darf-nie-mehr-passieren%3Bart2889,3639510
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/rorschach/tb-ot08/Das-darf-nie-mehr-passieren%3Bart2889,3639510
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 03:16 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eigentlich sind die 52 Kommentare (Rekord in Archivalia?) der eigentliche Inhalt dieses Adventskalender-Türchens. Der eher harmlose Beitrag von "Kassationswütige" über Volontariate im Archiv am 14. Oktober 2013@Archivalia_kg auch wenns noch nicht lang zurück liegt http://t.co/FNLtLYPWgS
--- Tristan Schwennsen (@gonzo_archivist) 30. November 2013
http://archiv.twoday.net/stories/506933972/
wurde schon am nächsten Tag zum Ausgangspunkt einer heftigen Debatte über Quereinsteiger im Archivwesen bzw. den Nutzen einer archivischen Fachausbildung.
An dieser Stelle ein dickes Lob an diejenigen Kommentatoren von Archivalia, die dieses Weblog lebendig halten!
Und weil es hier um Ausbildungsfragen
http://archiv.twoday.net/topics/Ausbildungsfragen/
geht, packe ich noch einen Vorschlag von Thomas Wolf in Form einer Illustration dazu. Am 20. Oktober 2013 wies er auf den von FAMIs erstellten Archiv-Manga "Das Archivwesen hin":
http://archiv.twoday.net/stories/524896210/
Alle Türchen: #bestof
***
In meinem Arbeitsumfeld ist die Idee aufgekommen, ein Volontariat im Archiv anzubieten. Bisher weiß ich nur von wenigen Archiven, die ein solches anbieten (z.B. das Stadtarchiv Leipzig).
Gibt es Erfahrungen damit? Wozu braucht man das überhaupt? Im Journalismus oder Museumswesen ist es ja durchaus eine gängige Praxis bzw. sogar notwendig, aber im Archivwesen?
Ist es überhaupt notwendig, wenn es doch entsprechende Ausbildungen für alle Dienste gibt? Oder ist es eine Ausbeutung? Die Personalvertretung wird in der Diskussion sicherlich den Begriff einer "prekären Beschäftigung" in den Ring werfen...

Der Archiv-Manga war beziehbar über
https://www.facebook.com/dasarchivwesen
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 02:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieso zum Teufel kann man, wenn man unbedingt die URL ändern muss, keine Weiterleitung einrichten?
http://archiv.twoday.net/stories/472714967/
http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende.html
http://archiv.twoday.net/stories/472714967/
http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende.html
KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 02:13 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Petring machte schon im November auf eine wohl auch auf die aktuellen Streaming-Abmahnungen übertragbare, noch nicht rechtskräftige Entscheidung aufmerksam:
"Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 08.10.2013 (Az. 57 C 6993/13) eine Filesharingklage von vier Tonträgerherstellerinnen wegen arglistiger Täuschung, Betruges und sittenwidriger Schädigung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist derzeit beim Landgericht Düsseldorf (zum Az. 23 S 358/13) anhängig. "
http://petringlegal.blogspot.de/2013/11/betrug-per-anwaltlicher-filesharing.html
Zitat: "Somit haben die Klägerinnen der Beklagten in ihrem Abmahnschreiben eine unzutreffende der Beklagten ausweglos erscheinende Rechtslage vorgespiegelt."
Zur Verantwortlichkeit von Anwälten siehe auch
http://www.dury.de/sonstige-blogartikel/anwalt-verurteilt-versuchte-notigung-durch-anwaltliches-mahnschreiben
***
Zur Pornoabmahnung meldet
http://www.focus.de/digital/redtube-abmahnung-falsche-rechtsgrundlage-streaming-skandal-schadensersatz-fuer-porno-gucker-moeglich_id_3481401.html
"Nutzer von Pornokanälen wie Redtube und Youporn, die nach Abmahnschreiben wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung das geforderte Geld gezahlt haben, können nach Ansicht des Kölner Rechtsanwalts Christian Solmecke Schadenersatz vom Land Nordrhein-Westfalen verlangen."
"Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 08.10.2013 (Az. 57 C 6993/13) eine Filesharingklage von vier Tonträgerherstellerinnen wegen arglistiger Täuschung, Betruges und sittenwidriger Schädigung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist derzeit beim Landgericht Düsseldorf (zum Az. 23 S 358/13) anhängig. "
http://petringlegal.blogspot.de/2013/11/betrug-per-anwaltlicher-filesharing.html
Zitat: "Somit haben die Klägerinnen der Beklagten in ihrem Abmahnschreiben eine unzutreffende der Beklagten ausweglos erscheinende Rechtslage vorgespiegelt."
Zur Verantwortlichkeit von Anwälten siehe auch
http://www.dury.de/sonstige-blogartikel/anwalt-verurteilt-versuchte-notigung-durch-anwaltliches-mahnschreiben
***
Zur Pornoabmahnung meldet
http://www.focus.de/digital/redtube-abmahnung-falsche-rechtsgrundlage-streaming-skandal-schadensersatz-fuer-porno-gucker-moeglich_id_3481401.html
"Nutzer von Pornokanälen wie Redtube und Youporn, die nach Abmahnschreiben wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung das geforderte Geld gezahlt haben, können nach Ansicht des Kölner Rechtsanwalts Christian Solmecke Schadenersatz vom Land Nordrhein-Westfalen verlangen."
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 23:17 - Rubrik: Archivrecht
Schriftenverzeichnis:
http://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Schriftenverzeichnis_2013-12.pdf
Zu den Online-Nachweisen drei Anmerkungen
- Sehr wenige moderne Bände werden als PDF Open Access bereitgestellt
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de
- Wie lange es PaperC.de noch gibt, steht dahin (siehe auch PaperC.com)
- Bei den älteren Bänden hat man sich nicht viel Mühe gemacht, Digitalisate einzutragen!
Siehe etwa
https://archive.org/details/inventaredernic02kommgoog
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022379367/
http://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Schriftenverzeichnis_2013-12.pdf
Zu den Online-Nachweisen drei Anmerkungen
- Sehr wenige moderne Bände werden als PDF Open Access bereitgestellt
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de
- Wie lange es PaperC.de noch gibt, steht dahin (siehe auch PaperC.com)
- Bei den älteren Bänden hat man sich nicht viel Mühe gemacht, Digitalisate einzutragen!
Siehe etwa
https://archive.org/details/inventaredernic02kommgoog
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022379367/
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 23:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitalisate des "Fremdenblatts" sind auf der Seite des Stadtarchivs einsehbar:
http://baden.docuteam.ch/mets/results.html?base=mets&mode=subset&champ1=subsetall&query1=collections-mets&cop1=AND
http://baden.docuteam.ch/mets/results.html?base=mets&mode=subset&champ1=subsetall&query1=collections-mets&cop1=AND
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 22:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://stmatthias.uni-trier.de/index.php?id=24
"9. Dezember 2013: Zurzeit sind 400 Kodizes mit 3456 Inhalten digital verfügbar."
"9. Dezember 2013: Zurzeit sind 400 Kodizes mit 3456 Inhalten digital verfügbar."
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 22:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/ZyVSdc (Google Cache)
Althistoriker Christian Gizewski hatte seinem Internet-Beitrag "'Mein Kampf': Zu antiken Wurzeln 'völkischer' Militanz in der deutschen Zeitgeschichte" ein PDF des Originals beigegeben. Die TU Berlin nahm anscheinend auch die Projektseiten vom Netz.
http://www.sueddeutsche.de/kultur/hetzschrift-mein-kampf-hitler-unzensiert-1.1843549
Hier gibt es das Buch online:
http://archive.org/search.php?query=hitler+kampf%20AND%20mediatype:texts
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=mein+kampf+hitler
Althistoriker Christian Gizewski hatte seinem Internet-Beitrag "'Mein Kampf': Zu antiken Wurzeln 'völkischer' Militanz in der deutschen Zeitgeschichte" ein PDF des Originals beigegeben. Die TU Berlin nahm anscheinend auch die Projektseiten vom Netz.
http://www.sueddeutsche.de/kultur/hetzschrift-mein-kampf-hitler-unzensiert-1.1843549
Hier gibt es das Buch online:
http://archive.org/search.php?query=hitler+kampf%20AND%20mediatype:texts
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=mein+kampf+hitler
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 21:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Unglaublich, dass ich das tolle Blog (Tumblr-style) des Archivalia-Fans Hans Rudolf Lavater (Schweizer Reformationshistoriker) hier anscheinend noch nie erwähnt habe. Das sei nachgeholt:
http://www.hr-lavater.ch/
http://www.hr-lavater.ch/
"Digitalisate von Archivgut des Staatsarchivs Hamburg dürfen von dessen Website kostenlos heruntergeladen, weiterverwendet und weitergegeben werden. Die Herkunft und die Signatur des Archivguts muss dabei genannt werden."
Bisher nur: Unterlagen der Standesämter (PDFs von Mikrofilmen)
http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/digitalisate/
Bisher nur: Unterlagen der Standesämter (PDFs von Mikrofilmen)
http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/digitalisate/
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 21:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sie haben einen neuen Auftritt (Software Goobi):
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/
Alte Drucke findet man aber auch noch hier:
http://edoc.hu-berlin.de/
Im neuen "digi alt" sind schon zahlreiche Werke der Grimm-Bibliothek einsehbar.
Es gibt auch fünf mittelalterliche Handschriften online:
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/mittelalterlichehandschriften/-/1/-/-/
Darunter natürlich dummdreist das auf Rüxner (1532 ff.) fußende Turnierbuch, über das ich mich unter
http://archiv.twoday.net/stories/96988341/
verbreitet habe. Paläographisch datiere ich immer noch 16./17. Jahrhundert. Wer kanns genauer?
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615043
Nachtrag: Ich sehe erst jetzt, dass der Posener Historiker Jasinski auf die aus dem Kloster Blesen stammende Berliner Handschrift 2004 in einem eigenen Aufsatz eingegangen ist - auf polnisch mit kurzer Zusammenfassung.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=166470
Er datiert die Handschrift ins 16. Jahrhundert und sieht sie - völlig unkritisch - als mögliche Vorlage Rüxners. Da die Handschrift meines Erachtens frühestens in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gehört, ist vom umgekehrten Verhältnis auszugehen.
Nachtrag: Klaus Arnold (Mail) denkt eher an das 17. Jahrhundert.
Bertold von Haller schreibt mir: "zur Berliner Handschrift kann ich immerhin sagen, daß sie keinesfalls vor 1554 entstanden sein kann, da das Wappen der Pfinzing (zum Turnier 1198 = S. 95 des Digitalisats, 1. Schild der 3. R.v.u.) bereits den damals erst verliehenen Herzschild Henfenfeld zeigt (wobei das Wappen eigentlich quadriert sein müßte). Vgl. dazu meinen soeben in den MVGN Bd. 100 (2013), S. 149–226 erschienenen Aufsatz über die Pfinzing, S. 181 (s. pdf anbei). Diese 12 Wappen der Nürnberger „Turnierverordneten“ fehlen im Druck, ein weiterer Hinweis, daß die Handschrift kein „Entwurf“ ist."
 http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615141
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615141
#fnzhss
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/
Alte Drucke findet man aber auch noch hier:
http://edoc.hu-berlin.de/
Im neuen "digi alt" sind schon zahlreiche Werke der Grimm-Bibliothek einsehbar.
Es gibt auch fünf mittelalterliche Handschriften online:
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/browse/mittelalterlichehandschriften/-/1/-/-/
Darunter natürlich dummdreist das auf Rüxner (1532 ff.) fußende Turnierbuch, über das ich mich unter
http://archiv.twoday.net/stories/96988341/
verbreitet habe. Paläographisch datiere ich immer noch 16./17. Jahrhundert. Wer kanns genauer?
http://goobi.ub.hu-berlin.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Akobv%3A11-D-615043
Nachtrag: Ich sehe erst jetzt, dass der Posener Historiker Jasinski auf die aus dem Kloster Blesen stammende Berliner Handschrift 2004 in einem eigenen Aufsatz eingegangen ist - auf polnisch mit kurzer Zusammenfassung.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=166470
Er datiert die Handschrift ins 16. Jahrhundert und sieht sie - völlig unkritisch - als mögliche Vorlage Rüxners. Da die Handschrift meines Erachtens frühestens in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gehört, ist vom umgekehrten Verhältnis auszugehen.
Nachtrag: Klaus Arnold (Mail) denkt eher an das 17. Jahrhundert.
Bertold von Haller schreibt mir: "zur Berliner Handschrift kann ich immerhin sagen, daß sie keinesfalls vor 1554 entstanden sein kann, da das Wappen der Pfinzing (zum Turnier 1198 = S. 95 des Digitalisats, 1. Schild der 3. R.v.u.) bereits den damals erst verliehenen Herzschild Henfenfeld zeigt (wobei das Wappen eigentlich quadriert sein müßte). Vgl. dazu meinen soeben in den MVGN Bd. 100 (2013), S. 149–226 erschienenen Aufsatz über die Pfinzing, S. 181 (s. pdf anbei). Diese 12 Wappen der Nürnberger „Turnierverordneten“ fehlen im Druck, ein weiterer Hinweis, daß die Handschrift kein „Entwurf“ ist."
#fnzhss
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 20:54 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 19:54 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
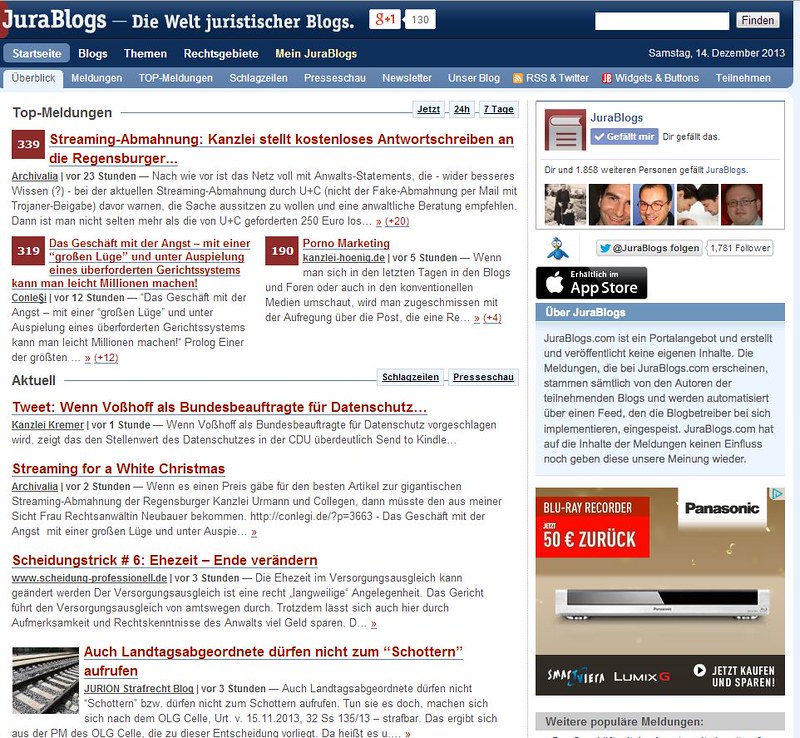
Populär in den letzten 24 Stunden auf Jurablogs:
http://www.jurablogs.com/popular/24h
Weitere Archivalia-Beiträge davon:
102 Gaunerzinken heute
25 Streaming for a White Christmas
Im Jurablogs-Blog-Ranking steht Archivalia (nur Kategorie Archivrecht) auf Platz 90.
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 18:49 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn es einen Preis gäbe für den besten Artikel zur gigantischen Streaming-Abmahnung der Regensburger Kanzlei Urmann und Collegen, dann müsste den aus meiner Sicht Frau Rechtsanwältin Neubauer bekommen.
http://conlegi.de/?p=3663 - Das Geschäft mit der Angst – mit einer “großen Lüge” und unter Auspielung eines überforderten Gerichtssystems kann man leicht Millionen machen!
Ein bitterböser und wütender Artikel, der mit Justizkritik nicht spart. Zitat:
Tja, und wenn so viele Abmahnungen unterwegs sind, dann fragen sich alle „ist da nicht doch was dran?“
Ich stelle die Gegenfrage: UND WENN NICHT? Was ist, wenn das alles nur ne Riesenverlade ist?
Es gibt keine “Nachweise” und keine „Strafbarkeit“ und auch nach § 44a UrhG werden die Abmahnungen nicht haltbar, sogar unwirksam sein!
Was dann?
Bis das durch Gerichte bestätigt und geprüft der Fall ist, ist schon einmal ein Jahr herum. Also würden wir uns Weihnachten 2014 zu diesem Thema nochmals treffen und Revue passieren lassen: Ja, das war nix!
Dann haben aber schon mal 20% der 50.000 (wenn es dabei bleibt, aber nur mal angenommen!) gezahlt. Das macht 10.000 mal 250,00 Euro gleich 2.500.000 Euro. Zweikommafünfmillionen !!!
***
Ansonsten gibt es wenig Neues. "Alle Hintergründe und Details" verspricht
http://www.pcgameshardware.de/Filesharing-Thema-209950/Specials/Porno-Abmahnungen-Redtube-UC-1100881/
Aber da hat man einfach nur frühere Meldungen zusammenkopiert. Links zu anderen Seiten: Fehlanzeige.
***
Heise hat schon länger bekannte, in den Lawblogkommentaren diskutierte Indizien zur Herkunft der IP-Adressen sauber aufgearbeitet:
http://heise.de/-2065879
Zuvor hatte aber auch schon CHIP Online eine gut belegte Dokumentation erstellt:
http://www.chip.de/news/Redtube-Wurden-die-Opfer-in-die-Falle-gelockt_66033141.html
***
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=Streaming
 Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://conlegi.de/?p=3663 - Das Geschäft mit der Angst – mit einer “großen Lüge” und unter Auspielung eines überforderten Gerichtssystems kann man leicht Millionen machen!
Ein bitterböser und wütender Artikel, der mit Justizkritik nicht spart. Zitat:
Tja, und wenn so viele Abmahnungen unterwegs sind, dann fragen sich alle „ist da nicht doch was dran?“
Ich stelle die Gegenfrage: UND WENN NICHT? Was ist, wenn das alles nur ne Riesenverlade ist?
Es gibt keine “Nachweise” und keine „Strafbarkeit“ und auch nach § 44a UrhG werden die Abmahnungen nicht haltbar, sogar unwirksam sein!
Was dann?
Bis das durch Gerichte bestätigt und geprüft der Fall ist, ist schon einmal ein Jahr herum. Also würden wir uns Weihnachten 2014 zu diesem Thema nochmals treffen und Revue passieren lassen: Ja, das war nix!
Dann haben aber schon mal 20% der 50.000 (wenn es dabei bleibt, aber nur mal angenommen!) gezahlt. Das macht 10.000 mal 250,00 Euro gleich 2.500.000 Euro. Zweikommafünfmillionen !!!
***
Ansonsten gibt es wenig Neues. "Alle Hintergründe und Details" verspricht
http://www.pcgameshardware.de/Filesharing-Thema-209950/Specials/Porno-Abmahnungen-Redtube-UC-1100881/
Aber da hat man einfach nur frühere Meldungen zusammenkopiert. Links zu anderen Seiten: Fehlanzeige.
***
Heise hat schon länger bekannte, in den Lawblogkommentaren diskutierte Indizien zur Herkunft der IP-Adressen sauber aufgearbeitet:
http://heise.de/-2065879
Zuvor hatte aber auch schon CHIP Online eine gut belegte Dokumentation erstellt:
http://www.chip.de/news/Redtube-Wurden-die-Opfer-in-die-Falle-gelockt_66033141.html
***
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=Streaming
 Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Urmels Gabentisch. Foto: Sigismund von Dobschütz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 17:06 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anlass des am 13. Oktober 2006 in Archivalia erschienenen Aufsatzes von Martin Germann
http://archiv.twoday.net/stories/2799773/
war der sogenannte "Karlsruher Kulturgüterstreit", zu dem ich hier unzählige Beiträge veröffentlicht habe.
"Im September des Jahres 2006 wurde zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland seitens einer Landesregierung der Versuch unternommen, in Museen und Bibliotheken verwahrte größere Mengen an Kulturgütern in den Kunst- und Antiquitätenhandel zu geben; der Versuch verursachte einen bis dahin beispiellosen internationalen Protest von Fachleuten, Wissenschaftlern und Bürgern." (Wikipedia)
Nach der (provisorischen) "Gesamtübersicht" (November 2006)
http://archiv.twoday.net/stories/2895938/
wurden noch viele weitere Beiträge zum Thema in Archivalia geschrieben. Um nur zwei zu nennen:
Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006
http://archiv.twoday.net/stories/3287721/
Der Unheilsspiegel
http://archiv.twoday.net/stories/55775123/
Die Karlsruher Handschriften sind gerettet, Schloss Salem wurde vom Land gekauft. Archivalia freut sich, dazu beigetragen zu haben, eine riesige Kulturgut-Katastrophe abgewendet zu haben. Unvermindert aktuell ist das Plädoyer von Martin Germann für den Schutz historischer Sammlungen.
Alle Türchen: #bestof
***
Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind
von Martin Germann
Konservator der Bibliotheca Bongarsiana, Burgerbibliothek Bern
Herrn Germann bin ich für die Erlaubnis dankbar, den in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2006, Seite 16 unter dem Titel "Die abenteuerliche Reise muss ein Ende haben;
Eine europäische Odyssee von Fleury nach Karlsruhe, oder: Warum alte Handschriften intakt zu bewahren sind" veröffentlichten wunderbaren Artikel in der Originalfassung hier wiederzugeben dürfen. Die Bilder befinden sich aus technischen Gründen bei Flickr.com. KG
An einem Beispiel soll gezeigt werden, warum eine Verauktionierung von Handschriften- und Inkunabelbeständen, wie jenen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, ein großes Unglück für die europäische Buch- und Textüberlieferung des Altertums und des Mittelalters wäre.
Das Schicksal einer mittelalterlichen Bibliothek
Ein Einzelfall als Beispiel für andere
Was haben die Bibliotheken der Abtei Fleury an der Loire (gegründet 651), die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (gegründet um 1500) und die Burgerbibliothek Bern (gegründet 1528) miteinander zu tun?
Die Benediktinerabtei Fleury, oberhalb von Orléans an der Loire im ehemals römischen Gallien gelegen (heute: Saint-Benoît-sur-Loire), war bis zur Karolingerzeit zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum herangewachsen. In der Zeit der Völkerwanderung waren die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia (um 480-560), Gründer des Benediktinerordens, zur Zeit der Langobardengefahr um 577 aus Monte Cassino hierher verbracht worden. Fleury entwickelte sich zu einem wichtigen Wallfahrtsort und, in der Karolingerzeit, dank weitreichenden Beziehungen, zu einem Kloster mit Schule und Schreibort mit bedeutender Bibliothek. Die älteste überlieferte Bücherliste stammt aus dem 11. Jahrhundert und enthält 45 Titel. Bis zum Vorabend der Reformation sammelte sich hier eine für die damalige Zeit große Bibliothek von mindestens 600 bis 800 Handschriften an.
Die Bücherzerstreuung während der Hugenottenkriege und seither (siehe die Tabelle)

Während des Bürgerkriegs zwischen den Hugenotten und den Altgläubigen, 1562, wurden die Mönche verjagt und die Bibliothek von den Protestanten geplündert, wenn auch nicht zerstört, wie Kloster- und Kirchenbibliotheken andernorts in Frankreich. Der bücherliebende Jurist und Gelehrte Pierre Daniel (1531-1604) nahm sie in seinen Besitz. Nach seinem Tod wurde sie unter seine Schüler, drei ebenfalls bücherliebende Sammler aufgeteilt:
Ein erster Teil ging an Paul Petau (1568-1614) und kam über dessen Sohn in die Hände des gelehrten Isaac Vossius (1618-1689), Bibliothekar der wissenschaftlich und künstlerisch interessierten Tochter König Gustav Adolfs, Christine (1629-1689), welche nach ihres Vaters Tod Königin von Schweden wurde. Als sie sich dem Katholizismus zuwandte und nach Rom zog, vermachte sie auf ihr Ableben hin ihre Bibliothek dem Papst. Aus diesem Grund sind heute 198 Handschriften der Abtei Fleury in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Etwa 100 weitere wichtige Handschriften kamen als Geschenk der Königin an ihren Bibliothekar Vossius und aus dessen Besitz schließlich in die Universitätsbibliothek Leiden (Niederlande).
Der zweite Teil kam an Jacques Bongars (1554-1612), Jurist und Diplomat im Dienste der französischen Krone, der auch als Gelehrter wirkte und mehrere historische Werke publizierte. Da ohne Nachkommen, verschrieb er seine im Laufe des Lebens gesammelte wertvolle Bibliothek seinem Patensohn Jacques Graviseth (1598-1658), Sohn seines Freundes René Graviseth, Bankier und Juwelier in Straßburg. Nach dem Erwerb des Schlosses Liebegg im damals bernischen Aargau durch seinen Vater und nach der Heirat mit der Berner Schultheißentochter Maria Salomea von Erlach (1604-1636) wurde Jacques Graviseth Burger Berns. Als Dank für das Burgerrecht schenkte er seiner neuen Heimat die von Bongars ererbte Bibliothek, welche die Bestände der damaligen Stadtbibliothek Bern verdoppelte und somit auch mit Büchern aus der Abtei Fleury versah: in der Burgerbibliothek Bern sind heute 70 Handschriften aus Fleury nachweisbar.
Der dritte Teil gelangte in die Hände von Claude Dupuy, auch unter seinem Gelehrtennamen Puteanus bekannt, der 1594 starb, und in jene des Philologen und Advokaten Pierre Pithou (gest. 1596). Ihre Nachlässe und Bibliotheken kamen später in die königliche Bibliothek Paris, welche heute in der Bibliothèque nationale de France aufgegangen ist. Hierher kamen aus verschiedenen Quellen weitere Handschriften, teils aus einer in Fleury aus Fluchtgut nach der Plünderung von 1562 neu gegründeten Bibliothek. Heute enthält die Bibliothèque nationale de France 69 Handschriften aus Fleury, deren zuletzt eingegangene aus einem berühmten Kriminalfall des 19. Jahrhunderts stammen: Graf Guilelmo Libri (1803-1869) hatte als hoher Beamter der Krone ungehinderten Zutritt zu allen Provinz- und Stadtbibliotheken, die nach der französischen Revolution aus den enteigneten Bibliotheken des Adels und der Kirchen und Klöster gebildet worden waren, so auch zur Bibliothèque municipale Orléans, welche viele Handschriften aus dem benachbarten Fleury übernommen hatte. Er hatte, als hoher Beamter, seine Stellung zu Diebstählen in vielen Bibliotheken ausgenützt, auch in Orléans. Bereits lagen seine Schätze auf einer Auktion in London. Da entdeckte der kluge Bibliothekar Léopold Delisle in Paris die Diebstähle und konnte auf noch nicht verkaufte Bücher seine Hand legen; dem französischen Staat blieb nichts anderes übrig, als sie von den Erwerbern soweit möglich zurück zu kaufen. Dadurch kamen solche Handschriften nicht an ihren Aufbeahrungsort (Orléans) zurück, sondern an die heute rund 350'000 Handschriften verwaltende Bibliothèque nationale de France in Paris. Neun bereits verkaufte Handschriften aus Fleury gelangten in die Bibliotheca Laurenziana in Florenz.
Zusätzlich zu diesen rund 500 Handschriften gibt es auch etwa hundert Codices aus Fleury in Streubesitz in etwa 50 verschiedenen Bibliotheken Europas und in Übersee, von Amsterdam über Genf, Den Haag, Düsseldorf, London, Malibu, Sankt Gallen, Trier bis Wolfenbüttel.
Eine Handschrift aus Fleury in Karlsruhe
Was hat die mittelalterliche Bibliothek des Klosters an der Loire mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zu tun? Anhand eines Beispiels kann die heutige internationale Verflechtung der Handschriftenbestände demonstriert und das Mittelalter sehr schön als Wurzel unserer gemeinsamen europäischen Geschichte aufgezeigt werden.
Auch in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wird nämlich eine Handschrift aufbewahrt, die aus Fleury stammt. In Orléans aus einem Einband einer Handschrift aus Fleury abgelöst, ist das Fragment im 19. Jahrhundert nach Karlsruhe gelangt.
Das Fragment enthält lateinische Briefe des Kirchenvaters Hieronymus, welche im 6. Jahrhundert in Italien auf Pergament abgeschrieben worden sind. Vielleicht kam die Handschrift bei der Übertragung der Gebeine des heiligen Benedikt aus Monte Cassino nach Fleury mit. Jedenfalls wurde sie hier gegen Ende des Mittelalters ausgeschieden, nachdem sie als veraltet galt und der Text der Hieronymus-Briefe vielleicht bereits im Buchdruck zur Verfügung stand. Die Pergamenthandschrift wurde dem Buchbinder des Klosters zur Verwendung als Einbandmaterial überlassen. Jahrhunderte lang blieb das Fragment im betreffenden Einband, bis ein interessierter Zeitgenosse im 19. Jahrhundert an dem schönen Stück Schrift, einer kalligraphischen Unzialschrift, Gefallen fand, es ablösen ließ und nach Karlsruhe brachte. Hier wurde es katalogisiert, die Kataloge wurden 1896 und 1970 publiziert, und so steht es dem kundigen Forscher heute in Karlsruhe zur Einsichtnahme und Entzifferung zur Verfügung, als zufällig mitüberliefertes Fragment seinerseits ein Mosaikstein im noch längst nicht umfassend erforschten Gesamtbild der europäischen Buch-, Kunst- und Kulturgeschichte.
Eine Zerstreuung des Handschriftenbestandes einer großen Sammelbibliothek wie der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wäre ein fataler Schritt zur weiteren Zerstreuung und Dezimierung unserer Quellen. Denn ein Blick in das Nachschlagewerk „Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters“ zeigt, dass in der badischen Landesbibliothek Karlsruhe nicht nur ein großer Teil der berühmten Handschriften des Klosters Reichenau liegen, sondern Handschriften aus dem ganzen mittelalterlichen Deutschland:
• aus karolingischen und hochmittelalterlichen Klöstern wie Alpirsbach, Alsbach, Blaubeuren, Ettenheimmünster, Fulda, Günterstal, Herrenalb, Hirsau, Lorsch, Sankt Blasien, Schuttern, Schwarzach, Tennenbach, Villingen, Wiblingen, Zwiefalten und anderen;
• aus den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg, Ulm und ihren Klöstern;
• aus Bischofsstädten Bamberg, Erfurt, Konstanz, Speyer, Würzburg;
• aus weiteren Städten wie Baden-Baden, Braunschweig, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Offenburg, Pforzheim.
• Aus linksrheinischen Gebieten wie Colmar, Straßburg und Weißenburg im Elsaß. Hier ist auf die Katastrophe zu verweisen, welche im Deutsch-französischen Krieg 1870 das Archiv und die Bibliothek von Straßburg durch deutschen Beschuss vernichtet hat. Damals sind tausende mittelalterliche Handschriften und Dokumente, darunter bestimmt auch Vorstufen der Buchdruckerkunst aus den dortigen Versuchen des Johannes Gutenberg, restlos untergegangen.
Wo sind die Bücher der mittelalterlichen Bibliotheken Europas?
Kloster- und Kirchenbibliotheken, die ihre eigenen mittelalterlichen Buchbestände noch heute besitzen, gibt es nur noch ganz wenige: in unseren Gegenden sind es Verona, Einsiedeln und Engelberg, sowie die weltberühmte Stiftsbibliothek Sankt Gallen.
Die mittelalterlichen Klöster haben durch ihre Bibliotheken aber nicht nur die Texte der Kirche und des Mittelalters überliefert, sondern auch zum größten Teil die Texte des griechisch-römischen Altertums: Ohne die geduldige Abschreibetätigkeit der Benediktiner hätten wir weder von Vergil, noch von Ovid, Cicero oder Cäsar zusammenhängende Texte und vollständige Werke! Sie sind uns fast ausschließlich durch Abschriften aus den karolingischen Klöstern bekannt, und diese Handschriften liegen heute in den großen Sammelbibliotheken Europas und der Welt, so auch in Karlsruhe.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden ganze Bibliotheken in alle Winde zerstreut, wie im Fall Fleury gezeigt, und viele Bücher sind ganz untergegangen. Deshalb muss jedes erhaltene mittelalterliche Buch einzeln untersucht und bestimmt werden, um seine Geschichte zu verfolgen: Wann war es wo aufbewahrt, von wem wurde es benutzt, gelesen, abgeschrieben oder, später, abgedruckt? Auf Grund solcher Forschungsergebnisse können Aussagen über die alten Texte und ihre Rezeption gemacht werden. Weiterführende Forschungen über die mittelalterliche Literaturgeschichte bauen auf der Geschichte der Textüberlieferung auf. So war es eine Sensation, als 1984 nachgewiesen wurde, dass die berühmte Vergilhandschrift (der sogenannte Vergilius Vaticanus aus den Jahren um 400, der in der Vatikanischen Bibliothek in Rom aufbewahrt wird) in der Karolingerzeit in einem der Loireklöster Fleury, Orléans oder Tours mit Notizen versehen worden ist von Schreibern, die auch an der Abschrift der Vergiltexte um 830 in Tours (heute Burgerbibliothek Bern, Codex 165) mitgewirkt haben: eine großartige Entdeckung, die mit einem Nobelpreis zu würdigen wäre, wenn es einen solchen gäbe.
Nun sind seit 200 Jahren die überlieferten Handschriften einigermaßen in festen Händen staatlicher oder staatlich unterstützter Bibliotheken geblieben, wenn auch Katastrophen zu melden sind wie
• die oben erwähnte Vernichtung von Bibliothek und Archiv Straßburg 1870;
• die Zerstörung von Stadt und Universität Löwen in Belgien im August 1914, wobei die ganze Universitätsbibliothek von 300'000 Bänden mit 1000 Handschriften und 800 Inkunabeln vernichtet wurde;
• die Zerstörung der Stadt und Bibliothek Karlsruhe im Jahr 1942 durch allierte Bomben; glücklicherweise waren die unersetzlichen Handschriften- und Altbestände schon 1939 ausgelagert worden;
• Verkäufe von Adelsbibliotheken wie jener der fürstlich Fürstenbergischen Bibliothek Donaueschingen von 1999 an;
• Raub und Diebstähle, wie die Entwendungen des Grafen Libri, sowie Naturkatastrophen, die immer drohen.
Die relative Ortsbeständigkeit der alten Bücher während zweihundert Jahren hat den gewaltigen Aufschwung der buch- und bibliothekswissenschaftlichen Forschungen ermöglicht, die noch längst nicht abgeschlossen sind. Forscher und Gelehrte auf der ganzen Welt bemühen sich um Aufschluss über die Herkunft der einzelnen Handschriften und um die virtuelle Rekonstruktion ganzer Bibliotheksbestände, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen über das geistliche und geistige Leben, die Lebensverhältnisse und die Versorgung mit Büchern und Texten in früheren Zeiten.
Haben die alten Bücher eine Zukunft?
Wenn man die Geschichte der Bücher kennt, versteht man auch, warum der Protest gegen die Absichten der Baden-württembergischen Regierung unterdessen die ganze zivilisierte Welt ergriffen hat. Würden nämlich deren Pläne verwirklicht und machten diese im 21. Jahrhundert Schule, zerstreuten sich die Handschriften nochmals über die ganze Welt und wären auf Jahrzehnte hinaus wieder unauffindbar, wie im Mittelalter, und vielleicht auf immer.
Das Schicksal der alten Bücher Europas ruht in Zukunft fast völlig auf den staatlichen und staatlich unterstützten Bibliotheken: nur sie sind in der Lage, auf Dauer die alten Buchbestände zu bewahren, zu pflegen und sie der Forschung und damit der Öffentlichkeit und den nächsten Generationen zu erhalten. Der Aufschrei der Öffentlichkeit beim Bekanntwerden der Pläne der Baden-württembergischen Landesregierung ist mit der Befürchtung zu erklären, dass diese Pläne den Beginn einer weiteren Zerstreuung alter Buchbestände darstellen könnten, nach all den Plünderungen, Kriegen und Katastrophen im Laufe unserer Geschichte. Die gleiche Pflicht zur Erhaltung der Ganzheit des Überlieferungszusammenhanges gilt auch für die Inkunabel- und Frühdruckbestände. Nur durch den Erhalt des Zusammenhanges der Überlieferung können die Quellen für das Studium der Verbreitungs- und Rezeptionsgeschichte bewahrt werden.
Es ist zu hoffen, dass die Regierung des Landes Baden-Württemberg ihre Verantwortung für das europäische Kulturgut Buch erkennt, das in ihrem Hoheitsgebiet verwahrt wird.
Dr. Martin Germann
Konservator
Burgerbibliothek Bern
5. Oktober 2006
Literatur:
Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Zürich 1961-1964, 2 Bände
Mostert, Marco: The library of Fleury, a provisional list of manuscripts, Hilversum 1989 (Middeleeuwse studies en bronnen, 3)
Krämer, Sigrid, & Michael Bernhard: Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, München 1990
Pöhlmann, Egert: Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur, Darmstadt 1994-2003, 2 Bände

Legende zum Bild:
Brief des Kirchenvaters Hieronymus, Pergamentfragment; geschrieben in der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts in Italien. Abbildung aus der Bibliothèque municipale Orléans, ms. 192 (169), abgelöst aus dem Einband von Orléans ms. 18 (15) aus Fleury OSB. Die Badische Landesbibliothek Karlsruhe besitzt unter Ms. Nr. 339.2 ein weiteres Doppelblatt dieser Handschrift.

Ein prächtiges Musteralphabet der römischen Steinschrift (Capitalis quadrata) wurde kurz nach dem Jahr 1000 in einer Sammelhandschrift in Fleury eingetragen. Der Codex enthält Texte zur Arithmetik (Tabellen zum Bruchrechnen), Astronomie und Kalenderrechnung (Computus des Abtes Abbo von Fleury, +1004). Das Alphabet steht neben anderen Texten: Oben eine Erklärung über das Mondalter, links darunter eine Tabelle des Mondscheines während des Mondmonats von 29 Tagen, rechts Merkverse für Sternbilder und Tierkreiszeichen, am Fuß unten links die Angaben der karolingischen Längenmaße und ihrer Unterteilungen.
Abbildung aus der Burgerbibliothek Bern, Codex 250 f. 11verso
Über die Burgerbibliothek Bern:
Burgerbibliothek Bern
Münstergasse 63, Postfach, 3000 Bern 8
Tel. +31-3203333; Fax +31-3203370
http://www.burgerbib.ch/
Öffnungszeiten des Lesesaales: Montag bis Freitag 9-17 Uhr.
Die Burgerbibliothek Bern betreut seit 1951 die Berner Handschriftensammlung, deren Anfänge in die Zeit der Reformation (1528) zurückreicht. Sie besitzt die drittgrößte mittelalterliche Handschriftensammlung der Schweiz, meist aus der Sammlung des Jacques Bongars (1554-1612), welche als Geschenk seines Erben Jacques Graviseth 1632 an Bern gelangt ist. Weitere Bestände: neuere Handschriften und Archivalien zur Berner und Schweizer Geschichte; bernische Grafiksammlung und Porträtdokumentation.
http://archiv.twoday.net/stories/2799773/
war der sogenannte "Karlsruher Kulturgüterstreit", zu dem ich hier unzählige Beiträge veröffentlicht habe.
"Im September des Jahres 2006 wurde zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland seitens einer Landesregierung der Versuch unternommen, in Museen und Bibliotheken verwahrte größere Mengen an Kulturgütern in den Kunst- und Antiquitätenhandel zu geben; der Versuch verursachte einen bis dahin beispiellosen internationalen Protest von Fachleuten, Wissenschaftlern und Bürgern." (Wikipedia)
Nach der (provisorischen) "Gesamtübersicht" (November 2006)
http://archiv.twoday.net/stories/2895938/
wurden noch viele weitere Beiträge zum Thema in Archivalia geschrieben. Um nur zwei zu nennen:
Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006
http://archiv.twoday.net/stories/3287721/
Der Unheilsspiegel
http://archiv.twoday.net/stories/55775123/
Die Karlsruher Handschriften sind gerettet, Schloss Salem wurde vom Land gekauft. Archivalia freut sich, dazu beigetragen zu haben, eine riesige Kulturgut-Katastrophe abgewendet zu haben. Unvermindert aktuell ist das Plädoyer von Martin Germann für den Schutz historischer Sammlungen.
Alle Türchen: #bestof
***
Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind
von Martin Germann
Konservator der Bibliotheca Bongarsiana, Burgerbibliothek Bern
Herrn Germann bin ich für die Erlaubnis dankbar, den in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2006, Seite 16 unter dem Titel "Die abenteuerliche Reise muss ein Ende haben;
Eine europäische Odyssee von Fleury nach Karlsruhe, oder: Warum alte Handschriften intakt zu bewahren sind" veröffentlichten wunderbaren Artikel in der Originalfassung hier wiederzugeben dürfen. Die Bilder befinden sich aus technischen Gründen bei Flickr.com. KG
An einem Beispiel soll gezeigt werden, warum eine Verauktionierung von Handschriften- und Inkunabelbeständen, wie jenen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, ein großes Unglück für die europäische Buch- und Textüberlieferung des Altertums und des Mittelalters wäre.
Das Schicksal einer mittelalterlichen Bibliothek
Ein Einzelfall als Beispiel für andere
Was haben die Bibliotheken der Abtei Fleury an der Loire (gegründet 651), die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (gegründet um 1500) und die Burgerbibliothek Bern (gegründet 1528) miteinander zu tun?
Die Benediktinerabtei Fleury, oberhalb von Orléans an der Loire im ehemals römischen Gallien gelegen (heute: Saint-Benoît-sur-Loire), war bis zur Karolingerzeit zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum herangewachsen. In der Zeit der Völkerwanderung waren die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia (um 480-560), Gründer des Benediktinerordens, zur Zeit der Langobardengefahr um 577 aus Monte Cassino hierher verbracht worden. Fleury entwickelte sich zu einem wichtigen Wallfahrtsort und, in der Karolingerzeit, dank weitreichenden Beziehungen, zu einem Kloster mit Schule und Schreibort mit bedeutender Bibliothek. Die älteste überlieferte Bücherliste stammt aus dem 11. Jahrhundert und enthält 45 Titel. Bis zum Vorabend der Reformation sammelte sich hier eine für die damalige Zeit große Bibliothek von mindestens 600 bis 800 Handschriften an.
Die Bücherzerstreuung während der Hugenottenkriege und seither (siehe die Tabelle)

Während des Bürgerkriegs zwischen den Hugenotten und den Altgläubigen, 1562, wurden die Mönche verjagt und die Bibliothek von den Protestanten geplündert, wenn auch nicht zerstört, wie Kloster- und Kirchenbibliotheken andernorts in Frankreich. Der bücherliebende Jurist und Gelehrte Pierre Daniel (1531-1604) nahm sie in seinen Besitz. Nach seinem Tod wurde sie unter seine Schüler, drei ebenfalls bücherliebende Sammler aufgeteilt:
Ein erster Teil ging an Paul Petau (1568-1614) und kam über dessen Sohn in die Hände des gelehrten Isaac Vossius (1618-1689), Bibliothekar der wissenschaftlich und künstlerisch interessierten Tochter König Gustav Adolfs, Christine (1629-1689), welche nach ihres Vaters Tod Königin von Schweden wurde. Als sie sich dem Katholizismus zuwandte und nach Rom zog, vermachte sie auf ihr Ableben hin ihre Bibliothek dem Papst. Aus diesem Grund sind heute 198 Handschriften der Abtei Fleury in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Etwa 100 weitere wichtige Handschriften kamen als Geschenk der Königin an ihren Bibliothekar Vossius und aus dessen Besitz schließlich in die Universitätsbibliothek Leiden (Niederlande).
Der zweite Teil kam an Jacques Bongars (1554-1612), Jurist und Diplomat im Dienste der französischen Krone, der auch als Gelehrter wirkte und mehrere historische Werke publizierte. Da ohne Nachkommen, verschrieb er seine im Laufe des Lebens gesammelte wertvolle Bibliothek seinem Patensohn Jacques Graviseth (1598-1658), Sohn seines Freundes René Graviseth, Bankier und Juwelier in Straßburg. Nach dem Erwerb des Schlosses Liebegg im damals bernischen Aargau durch seinen Vater und nach der Heirat mit der Berner Schultheißentochter Maria Salomea von Erlach (1604-1636) wurde Jacques Graviseth Burger Berns. Als Dank für das Burgerrecht schenkte er seiner neuen Heimat die von Bongars ererbte Bibliothek, welche die Bestände der damaligen Stadtbibliothek Bern verdoppelte und somit auch mit Büchern aus der Abtei Fleury versah: in der Burgerbibliothek Bern sind heute 70 Handschriften aus Fleury nachweisbar.
Der dritte Teil gelangte in die Hände von Claude Dupuy, auch unter seinem Gelehrtennamen Puteanus bekannt, der 1594 starb, und in jene des Philologen und Advokaten Pierre Pithou (gest. 1596). Ihre Nachlässe und Bibliotheken kamen später in die königliche Bibliothek Paris, welche heute in der Bibliothèque nationale de France aufgegangen ist. Hierher kamen aus verschiedenen Quellen weitere Handschriften, teils aus einer in Fleury aus Fluchtgut nach der Plünderung von 1562 neu gegründeten Bibliothek. Heute enthält die Bibliothèque nationale de France 69 Handschriften aus Fleury, deren zuletzt eingegangene aus einem berühmten Kriminalfall des 19. Jahrhunderts stammen: Graf Guilelmo Libri (1803-1869) hatte als hoher Beamter der Krone ungehinderten Zutritt zu allen Provinz- und Stadtbibliotheken, die nach der französischen Revolution aus den enteigneten Bibliotheken des Adels und der Kirchen und Klöster gebildet worden waren, so auch zur Bibliothèque municipale Orléans, welche viele Handschriften aus dem benachbarten Fleury übernommen hatte. Er hatte, als hoher Beamter, seine Stellung zu Diebstählen in vielen Bibliotheken ausgenützt, auch in Orléans. Bereits lagen seine Schätze auf einer Auktion in London. Da entdeckte der kluge Bibliothekar Léopold Delisle in Paris die Diebstähle und konnte auf noch nicht verkaufte Bücher seine Hand legen; dem französischen Staat blieb nichts anderes übrig, als sie von den Erwerbern soweit möglich zurück zu kaufen. Dadurch kamen solche Handschriften nicht an ihren Aufbeahrungsort (Orléans) zurück, sondern an die heute rund 350'000 Handschriften verwaltende Bibliothèque nationale de France in Paris. Neun bereits verkaufte Handschriften aus Fleury gelangten in die Bibliotheca Laurenziana in Florenz.
Zusätzlich zu diesen rund 500 Handschriften gibt es auch etwa hundert Codices aus Fleury in Streubesitz in etwa 50 verschiedenen Bibliotheken Europas und in Übersee, von Amsterdam über Genf, Den Haag, Düsseldorf, London, Malibu, Sankt Gallen, Trier bis Wolfenbüttel.
Eine Handschrift aus Fleury in Karlsruhe
Was hat die mittelalterliche Bibliothek des Klosters an der Loire mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zu tun? Anhand eines Beispiels kann die heutige internationale Verflechtung der Handschriftenbestände demonstriert und das Mittelalter sehr schön als Wurzel unserer gemeinsamen europäischen Geschichte aufgezeigt werden.
Auch in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wird nämlich eine Handschrift aufbewahrt, die aus Fleury stammt. In Orléans aus einem Einband einer Handschrift aus Fleury abgelöst, ist das Fragment im 19. Jahrhundert nach Karlsruhe gelangt.
Das Fragment enthält lateinische Briefe des Kirchenvaters Hieronymus, welche im 6. Jahrhundert in Italien auf Pergament abgeschrieben worden sind. Vielleicht kam die Handschrift bei der Übertragung der Gebeine des heiligen Benedikt aus Monte Cassino nach Fleury mit. Jedenfalls wurde sie hier gegen Ende des Mittelalters ausgeschieden, nachdem sie als veraltet galt und der Text der Hieronymus-Briefe vielleicht bereits im Buchdruck zur Verfügung stand. Die Pergamenthandschrift wurde dem Buchbinder des Klosters zur Verwendung als Einbandmaterial überlassen. Jahrhunderte lang blieb das Fragment im betreffenden Einband, bis ein interessierter Zeitgenosse im 19. Jahrhundert an dem schönen Stück Schrift, einer kalligraphischen Unzialschrift, Gefallen fand, es ablösen ließ und nach Karlsruhe brachte. Hier wurde es katalogisiert, die Kataloge wurden 1896 und 1970 publiziert, und so steht es dem kundigen Forscher heute in Karlsruhe zur Einsichtnahme und Entzifferung zur Verfügung, als zufällig mitüberliefertes Fragment seinerseits ein Mosaikstein im noch längst nicht umfassend erforschten Gesamtbild der europäischen Buch-, Kunst- und Kulturgeschichte.
Eine Zerstreuung des Handschriftenbestandes einer großen Sammelbibliothek wie der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wäre ein fataler Schritt zur weiteren Zerstreuung und Dezimierung unserer Quellen. Denn ein Blick in das Nachschlagewerk „Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters“ zeigt, dass in der badischen Landesbibliothek Karlsruhe nicht nur ein großer Teil der berühmten Handschriften des Klosters Reichenau liegen, sondern Handschriften aus dem ganzen mittelalterlichen Deutschland:
• aus karolingischen und hochmittelalterlichen Klöstern wie Alpirsbach, Alsbach, Blaubeuren, Ettenheimmünster, Fulda, Günterstal, Herrenalb, Hirsau, Lorsch, Sankt Blasien, Schuttern, Schwarzach, Tennenbach, Villingen, Wiblingen, Zwiefalten und anderen;
• aus den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg, Ulm und ihren Klöstern;
• aus Bischofsstädten Bamberg, Erfurt, Konstanz, Speyer, Würzburg;
• aus weiteren Städten wie Baden-Baden, Braunschweig, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Offenburg, Pforzheim.
• Aus linksrheinischen Gebieten wie Colmar, Straßburg und Weißenburg im Elsaß. Hier ist auf die Katastrophe zu verweisen, welche im Deutsch-französischen Krieg 1870 das Archiv und die Bibliothek von Straßburg durch deutschen Beschuss vernichtet hat. Damals sind tausende mittelalterliche Handschriften und Dokumente, darunter bestimmt auch Vorstufen der Buchdruckerkunst aus den dortigen Versuchen des Johannes Gutenberg, restlos untergegangen.
Wo sind die Bücher der mittelalterlichen Bibliotheken Europas?
Kloster- und Kirchenbibliotheken, die ihre eigenen mittelalterlichen Buchbestände noch heute besitzen, gibt es nur noch ganz wenige: in unseren Gegenden sind es Verona, Einsiedeln und Engelberg, sowie die weltberühmte Stiftsbibliothek Sankt Gallen.
Die mittelalterlichen Klöster haben durch ihre Bibliotheken aber nicht nur die Texte der Kirche und des Mittelalters überliefert, sondern auch zum größten Teil die Texte des griechisch-römischen Altertums: Ohne die geduldige Abschreibetätigkeit der Benediktiner hätten wir weder von Vergil, noch von Ovid, Cicero oder Cäsar zusammenhängende Texte und vollständige Werke! Sie sind uns fast ausschließlich durch Abschriften aus den karolingischen Klöstern bekannt, und diese Handschriften liegen heute in den großen Sammelbibliotheken Europas und der Welt, so auch in Karlsruhe.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden ganze Bibliotheken in alle Winde zerstreut, wie im Fall Fleury gezeigt, und viele Bücher sind ganz untergegangen. Deshalb muss jedes erhaltene mittelalterliche Buch einzeln untersucht und bestimmt werden, um seine Geschichte zu verfolgen: Wann war es wo aufbewahrt, von wem wurde es benutzt, gelesen, abgeschrieben oder, später, abgedruckt? Auf Grund solcher Forschungsergebnisse können Aussagen über die alten Texte und ihre Rezeption gemacht werden. Weiterführende Forschungen über die mittelalterliche Literaturgeschichte bauen auf der Geschichte der Textüberlieferung auf. So war es eine Sensation, als 1984 nachgewiesen wurde, dass die berühmte Vergilhandschrift (der sogenannte Vergilius Vaticanus aus den Jahren um 400, der in der Vatikanischen Bibliothek in Rom aufbewahrt wird) in der Karolingerzeit in einem der Loireklöster Fleury, Orléans oder Tours mit Notizen versehen worden ist von Schreibern, die auch an der Abschrift der Vergiltexte um 830 in Tours (heute Burgerbibliothek Bern, Codex 165) mitgewirkt haben: eine großartige Entdeckung, die mit einem Nobelpreis zu würdigen wäre, wenn es einen solchen gäbe.
Nun sind seit 200 Jahren die überlieferten Handschriften einigermaßen in festen Händen staatlicher oder staatlich unterstützter Bibliotheken geblieben, wenn auch Katastrophen zu melden sind wie
• die oben erwähnte Vernichtung von Bibliothek und Archiv Straßburg 1870;
• die Zerstörung von Stadt und Universität Löwen in Belgien im August 1914, wobei die ganze Universitätsbibliothek von 300'000 Bänden mit 1000 Handschriften und 800 Inkunabeln vernichtet wurde;
• die Zerstörung der Stadt und Bibliothek Karlsruhe im Jahr 1942 durch allierte Bomben; glücklicherweise waren die unersetzlichen Handschriften- und Altbestände schon 1939 ausgelagert worden;
• Verkäufe von Adelsbibliotheken wie jener der fürstlich Fürstenbergischen Bibliothek Donaueschingen von 1999 an;
• Raub und Diebstähle, wie die Entwendungen des Grafen Libri, sowie Naturkatastrophen, die immer drohen.
Die relative Ortsbeständigkeit der alten Bücher während zweihundert Jahren hat den gewaltigen Aufschwung der buch- und bibliothekswissenschaftlichen Forschungen ermöglicht, die noch längst nicht abgeschlossen sind. Forscher und Gelehrte auf der ganzen Welt bemühen sich um Aufschluss über die Herkunft der einzelnen Handschriften und um die virtuelle Rekonstruktion ganzer Bibliotheksbestände, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen über das geistliche und geistige Leben, die Lebensverhältnisse und die Versorgung mit Büchern und Texten in früheren Zeiten.
Haben die alten Bücher eine Zukunft?
Wenn man die Geschichte der Bücher kennt, versteht man auch, warum der Protest gegen die Absichten der Baden-württembergischen Regierung unterdessen die ganze zivilisierte Welt ergriffen hat. Würden nämlich deren Pläne verwirklicht und machten diese im 21. Jahrhundert Schule, zerstreuten sich die Handschriften nochmals über die ganze Welt und wären auf Jahrzehnte hinaus wieder unauffindbar, wie im Mittelalter, und vielleicht auf immer.
Das Schicksal der alten Bücher Europas ruht in Zukunft fast völlig auf den staatlichen und staatlich unterstützten Bibliotheken: nur sie sind in der Lage, auf Dauer die alten Buchbestände zu bewahren, zu pflegen und sie der Forschung und damit der Öffentlichkeit und den nächsten Generationen zu erhalten. Der Aufschrei der Öffentlichkeit beim Bekanntwerden der Pläne der Baden-württembergischen Landesregierung ist mit der Befürchtung zu erklären, dass diese Pläne den Beginn einer weiteren Zerstreuung alter Buchbestände darstellen könnten, nach all den Plünderungen, Kriegen und Katastrophen im Laufe unserer Geschichte. Die gleiche Pflicht zur Erhaltung der Ganzheit des Überlieferungszusammenhanges gilt auch für die Inkunabel- und Frühdruckbestände. Nur durch den Erhalt des Zusammenhanges der Überlieferung können die Quellen für das Studium der Verbreitungs- und Rezeptionsgeschichte bewahrt werden.
Es ist zu hoffen, dass die Regierung des Landes Baden-Württemberg ihre Verantwortung für das europäische Kulturgut Buch erkennt, das in ihrem Hoheitsgebiet verwahrt wird.
Dr. Martin Germann
Konservator
Burgerbibliothek Bern
5. Oktober 2006
Literatur:
Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Zürich 1961-1964, 2 Bände
Mostert, Marco: The library of Fleury, a provisional list of manuscripts, Hilversum 1989 (Middeleeuwse studies en bronnen, 3)
Krämer, Sigrid, & Michael Bernhard: Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, München 1990
Pöhlmann, Egert: Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur, Darmstadt 1994-2003, 2 Bände

Legende zum Bild:
Brief des Kirchenvaters Hieronymus, Pergamentfragment; geschrieben in der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts in Italien. Abbildung aus der Bibliothèque municipale Orléans, ms. 192 (169), abgelöst aus dem Einband von Orléans ms. 18 (15) aus Fleury OSB. Die Badische Landesbibliothek Karlsruhe besitzt unter Ms. Nr. 339.2 ein weiteres Doppelblatt dieser Handschrift.

Ein prächtiges Musteralphabet der römischen Steinschrift (Capitalis quadrata) wurde kurz nach dem Jahr 1000 in einer Sammelhandschrift in Fleury eingetragen. Der Codex enthält Texte zur Arithmetik (Tabellen zum Bruchrechnen), Astronomie und Kalenderrechnung (Computus des Abtes Abbo von Fleury, +1004). Das Alphabet steht neben anderen Texten: Oben eine Erklärung über das Mondalter, links darunter eine Tabelle des Mondscheines während des Mondmonats von 29 Tagen, rechts Merkverse für Sternbilder und Tierkreiszeichen, am Fuß unten links die Angaben der karolingischen Längenmaße und ihrer Unterteilungen.
Abbildung aus der Burgerbibliothek Bern, Codex 250 f. 11verso
Über die Burgerbibliothek Bern:
Burgerbibliothek Bern
Münstergasse 63, Postfach, 3000 Bern 8
Tel. +31-3203333; Fax +31-3203370
http://www.burgerbib.ch/
Öffnungszeiten des Lesesaales: Montag bis Freitag 9-17 Uhr.
Die Burgerbibliothek Bern betreut seit 1951 die Berner Handschriftensammlung, deren Anfänge in die Zeit der Reformation (1528) zurückreicht. Sie besitzt die drittgrößte mittelalterliche Handschriftensammlung der Schweiz, meist aus der Sammlung des Jacques Bongars (1554-1612), welche als Geschenk seines Erben Jacques Graviseth 1632 an Bern gelangt ist. Weitere Bestände: neuere Handschriften und Archivalien zur Berner und Schweizer Geschichte; bernische Grafiksammlung und Porträtdokumentation.
KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 00:26 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schleswig-Holstein: "Die Polizei schlägt Alarm – es geht unter anderem um Kreise, Striche und Rechtecke: Seit einigen Wochen verzeichnet sie Einbrüche in Häusern und Wohnungen in und um Flensburg herum, in deren unmittelbarer Nähe Zeichen auf Hauswänden oder Gartenzäunen aufgemalt sind – sogenannte Gaunerzinken. „Es handelt sich möglicherweise um organisierte Strukturen“, sagt Polizeisprecher Matthias Glamann.
Was steckt hinter den Zeichen? Gaunerzinken, früher auch als Kuckuckszeichen bekannt, sollen potenzielle Einbrecher auf Häuser und Wohnungen aufmerksam machen, die sich für einen Einbruch „lohnen“. Außerdem können sie auch Auskunft über geeignete Tatzeiten sowie Fluchtrichtungen geben. Sie werden mit Kreide oder Bleistift aufgemalt."
http://www.shz.de/nachrichten/meldungen/die-geheimen-zeichen-der-einbrecher-banden-id5182556.html
Zur (Rechts-)Geschichte der "Gaunerzinken":
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinken_%28Geheimzeichen%29
 http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/TutKrypto/tutorien/gaunerzinken.htm
http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/TutKrypto/tutorien/gaunerzinken.htm
Was steckt hinter den Zeichen? Gaunerzinken, früher auch als Kuckuckszeichen bekannt, sollen potenzielle Einbrecher auf Häuser und Wohnungen aufmerksam machen, die sich für einen Einbruch „lohnen“. Außerdem können sie auch Auskunft über geeignete Tatzeiten sowie Fluchtrichtungen geben. Sie werden mit Kreide oder Bleistift aufgemalt."
http://www.shz.de/nachrichten/meldungen/die-geheimen-zeichen-der-einbrecher-banden-id5182556.html
Zur (Rechts-)Geschichte der "Gaunerzinken":
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinken_%28Geheimzeichen%29
 http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/TutKrypto/tutorien/gaunerzinken.htm
http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/TutKrypto/tutorien/gaunerzinken.htmKlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 20:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach wie vor ist das Netz voll mit Anwalts-Statements, die - wider besseres Wissen (?) - bei der aktuellen Streaming-Abmahnung durch U+C (nicht der Fake-Abmahnung per Mail mit Trojaner-Beigabe) davor warnen, die Sache aussitzen zu wollen und eine anwaltliche Beratung empfehlen. Dann ist man nicht selten mehr als die von U+C geforderten 250 Euro los ...
Von daher ist löblich: "Die Kanzlei Hild & Kollegen möchte sich nicht an der mit der Abmahnwelle verbundenen Geldmaschinerie beteiligen und von den Betroffenen so kurz vor Weihnachten anders verplantes Geld abkassieren. Vielmehr hat sich kanzlei.biz dazu entschieden, den Betroffenen quasi als Weihnachtsgeschenk kostenlos ein umfangreiches Antwortschreiben als Download auf seiner Facebook-Seite (https://www.facebook.com/kanzlei.biz/app_151503908244383) zur Verfügung zu stellen. Dieses ersetzt keine Rechtsberatung, soll jedoch dem Betroffenen dennoch die Möglichkeit eröffnen, sich selbst und dennoch effektiv und ohne weitere Kosten gegen die Abmahnung zur Wehr zu setzen."
Einzige Gegenleistung: 1 Facebook-Like ist erforderlich, um das PDF abrufen zu können:
https://www.facebook.com/kanzlei.biz
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/13-12-2013-redtube-abmahnung-kostenloses-antwortschreiben.html
Die Stellungnahme enthält unter I:
"Ich bestreite, den gegenständlichen Film gestreamt zu haben."
1. "Keine Vervielfältigung des streitgegenständlichen Werkes"
Zitat: "Selbst wenn eine Vervielfältigung angenommen würde, kommt das Eingreifen der Schrankenregelung nach § 44a UrhG in Betracht. Diese schränkt die Unzulässigkeit von Vervielfältigungshandlungen dahingehend ein, dass eine flüchtige oder begleitende Vervielfältigung dann zulässig ist, wenn sie
einen wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens ohne eigenständige wirtschaftliche Bedeutung darstellt und es deren alleiniger Zweck ist, eine rechtmäßige Nutzung zu ermöglichen, § 44a Nr. 2 UrhG. Bei der rechtmäßigen Nutzung geht es um die Frage, ob der allein rezeptive Werkgenuss darunter fällt. Wenn man berücksichtigt, dass im Zeitalter des analogen Fernsehens/Videos der alleinige Genuss einer auch illegal erstellten Vervielfältigung nicht strafbar war, führt eine normative
Betrachtung dazu, dass Streaming zum reinen Betrachten eines Videos als unter die Schrankenregelung des § 44a Nr. 2 UrhG fallend und damit straffrei anzusehen ist (vgl. Münchener
Anwaltshandbuch IT -Recht, 3. Auflage, Rn. 330; vgl. BGHZ 37, 1 (6f.) - AKI; Beck’scher Online - Kommentar Urheberrecht, Stand: 01.09.2013, § 44a UrhG, Rn. 3)."
2. "Zulässige Privatkopie (§ 53 Abs.1 Satz 1 UrhG)"
3. "Keine Werkqualität"
"Ferner fehlt es pornographischen Filmen regelmäßig an der Werkqualität gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG. Bei diesen Filmen liegt keine persönliche geistige Schöpfung vor, da diese
lediglich sexuelle Vorgänge in primitiver Weise zeigen (vgl.
LG München I, Beschluss vom 29.05.2013, Az. 7 O
22293/12 )."
Dazu ausführlicher hier:
http://archiv.twoday.net/stories/572463488/
Die Kanzlei beachtet nicht, dass das Nichtvorliegen des Urheberrechtsschutzes trotzdem die Abmahnung ermöglicht, wenn die Laufbilder in Deutschland geschützt sind (was ich ja bezweifle).
Unter II wird subsummiert:
1. "Anwendung des § 97 a Abs. 2 Nr. 4 UrhG "
2. Abmahnung sei "rechtsmissbräuchlich"
3. (Lückenloser Nachweis der Rechte fehle.)
4. Angesichts Unklarheit über die Ermittlung der IP-Adresse wird auf die Strafbarkeit des Datenausspähens nach § 202 StGB hingewiesen und nach § 34 BDSG Auskunft über die gespeicherten Daten (Fristsetzung 2 Wochen) verlangt.
III. U+C soll binnen zwei Wochen erklären, dass keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
Fazit: Eine im wesentlichen brauchbare Zurückweisung, die diejenigen verwenden können, die nicht einfach abwarten wollen. Nach wie vor sehe ich auch im Nichtstun in diesem Fall kein nennenswertes Risiko.
***
Weitere Infos hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
und auf Google+ (umfangreiche Linksammlung in meinem Stream)
Update:
RA Udo Vetter im Interview: "Bei den Leuten, die jetzt eine Abmahnung bekommen haben, kann ich sagen: Die Abmahnung ist ganz klar rechtswidrig. Wegen einer rechtswidrigen Abmahnung, die unwirksam ist, muss man keine Unterlassungserklärung abgeben. Wozu ich allerdings auch nicht rate, ist, gar nichts zu machen, sondern der Kanzlei U+C unter den bekannten Kontaktdaten und unter Angabe des Aktenzeichens zu widersprechen. Dazu genügt ein Satz: „Sehr geehrte Damen und Herren, ich widerspreche der Forderung." Das geht per Mail oder man kann da auch per Fax und per Post und von mir aus mit Einschreiben und Rückschein machen. Man braucht für diesen Widerspruch keinen Anwalt."
http://wsj.de/article/SB10001424052702303293604579256252616552172.html
Von daher ist löblich: "Die Kanzlei Hild & Kollegen möchte sich nicht an der mit der Abmahnwelle verbundenen Geldmaschinerie beteiligen und von den Betroffenen so kurz vor Weihnachten anders verplantes Geld abkassieren. Vielmehr hat sich kanzlei.biz dazu entschieden, den Betroffenen quasi als Weihnachtsgeschenk kostenlos ein umfangreiches Antwortschreiben als Download auf seiner Facebook-Seite (https://www.facebook.com/kanzlei.biz/app_151503908244383) zur Verfügung zu stellen. Dieses ersetzt keine Rechtsberatung, soll jedoch dem Betroffenen dennoch die Möglichkeit eröffnen, sich selbst und dennoch effektiv und ohne weitere Kosten gegen die Abmahnung zur Wehr zu setzen."
Einzige Gegenleistung: 1 Facebook-Like ist erforderlich, um das PDF abrufen zu können:
https://www.facebook.com/kanzlei.biz
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/13-12-2013-redtube-abmahnung-kostenloses-antwortschreiben.html
Die Stellungnahme enthält unter I:
"Ich bestreite, den gegenständlichen Film gestreamt zu haben."
1. "Keine Vervielfältigung des streitgegenständlichen Werkes"
Zitat: "Selbst wenn eine Vervielfältigung angenommen würde, kommt das Eingreifen der Schrankenregelung nach § 44a UrhG in Betracht. Diese schränkt die Unzulässigkeit von Vervielfältigungshandlungen dahingehend ein, dass eine flüchtige oder begleitende Vervielfältigung dann zulässig ist, wenn sie
einen wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens ohne eigenständige wirtschaftliche Bedeutung darstellt und es deren alleiniger Zweck ist, eine rechtmäßige Nutzung zu ermöglichen, § 44a Nr. 2 UrhG. Bei der rechtmäßigen Nutzung geht es um die Frage, ob der allein rezeptive Werkgenuss darunter fällt. Wenn man berücksichtigt, dass im Zeitalter des analogen Fernsehens/Videos der alleinige Genuss einer auch illegal erstellten Vervielfältigung nicht strafbar war, führt eine normative
Betrachtung dazu, dass Streaming zum reinen Betrachten eines Videos als unter die Schrankenregelung des § 44a Nr. 2 UrhG fallend und damit straffrei anzusehen ist (vgl. Münchener
Anwaltshandbuch IT -Recht, 3. Auflage, Rn. 330; vgl. BGHZ 37, 1 (6f.) - AKI; Beck’scher Online - Kommentar Urheberrecht, Stand: 01.09.2013, § 44a UrhG, Rn. 3)."
2. "Zulässige Privatkopie (§ 53 Abs.1 Satz 1 UrhG)"
3. "Keine Werkqualität"
"Ferner fehlt es pornographischen Filmen regelmäßig an der Werkqualität gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG. Bei diesen Filmen liegt keine persönliche geistige Schöpfung vor, da diese
lediglich sexuelle Vorgänge in primitiver Weise zeigen (vgl.
LG München I, Beschluss vom 29.05.2013, Az. 7 O
22293/12 )."
Dazu ausführlicher hier:
http://archiv.twoday.net/stories/572463488/
Die Kanzlei beachtet nicht, dass das Nichtvorliegen des Urheberrechtsschutzes trotzdem die Abmahnung ermöglicht, wenn die Laufbilder in Deutschland geschützt sind (was ich ja bezweifle).
Unter II wird subsummiert:
1. "Anwendung des § 97 a Abs. 2 Nr. 4 UrhG "
2. Abmahnung sei "rechtsmissbräuchlich"
3. (Lückenloser Nachweis der Rechte fehle.)
4. Angesichts Unklarheit über die Ermittlung der IP-Adresse wird auf die Strafbarkeit des Datenausspähens nach § 202 StGB hingewiesen und nach § 34 BDSG Auskunft über die gespeicherten Daten (Fristsetzung 2 Wochen) verlangt.
III. U+C soll binnen zwei Wochen erklären, dass keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
Fazit: Eine im wesentlichen brauchbare Zurückweisung, die diejenigen verwenden können, die nicht einfach abwarten wollen. Nach wie vor sehe ich auch im Nichtstun in diesem Fall kein nennenswertes Risiko.
***
Weitere Infos hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
und auf Google+ (umfangreiche Linksammlung in meinem Stream)
Update:
RA Udo Vetter im Interview: "Bei den Leuten, die jetzt eine Abmahnung bekommen haben, kann ich sagen: Die Abmahnung ist ganz klar rechtswidrig. Wegen einer rechtswidrigen Abmahnung, die unwirksam ist, muss man keine Unterlassungserklärung abgeben. Wozu ich allerdings auch nicht rate, ist, gar nichts zu machen, sondern der Kanzlei U+C unter den bekannten Kontaktdaten und unter Angabe des Aktenzeichens zu widersprechen. Dazu genügt ein Satz: „Sehr geehrte Damen und Herren, ich widerspreche der Forderung." Das geht per Mail oder man kann da auch per Fax und per Post und von mir aus mit Einschreiben und Rückschein machen. Man braucht für diesen Widerspruch keinen Anwalt."
http://wsj.de/article/SB10001424052702303293604579256252616552172.html
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 19:33 - Rubrik: Archivrecht
http://www.kirchen.net/upload/53432_Tipps_Familienforscher_UEberarbeitung_2012.pdf
Findet Margret Ott auf G+ nicht nur für österreichische Genealogen mit Recht hilfreich.
Findet Margret Ott auf G+ nicht nur für österreichische Genealogen mit Recht hilfreich.
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 17:53 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/50/0
Einige lateinische Handschriften der UB Basel und der Abtei Einsiedeln, ein Cartular aus Lausanne der Berner Burgerbibliothek, ein Kanzleiregister des Domkapitels Sitten, die Boner-Handschrift der Bodmeriana aus der Lauber-Werkstatt, Heinrich Murers "Helvetia sancta" aus Frauenfeld und vieles andere mehr.
Von den St. Galler Handschriften greife ich heraus:
"St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 990
Papier · 589 pp. · 30.5 × 21/21.5 cm · Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in St. Gallen (Regina Sattler, Dorothea Hertenstein, Elisabeth Schaigenwiler) · 1521/22
Sammelband aszetischen Inhalts mit geistlichen Traktaten des Dominikanermönchs Wendelin Fabri aus Pforzheim
Die im Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in St. Gallen in den Jahren 1521 und 1522 von den dortigen Schreiberinnen Regina Sattler, Dorothea von Hertenstein und Elisabeth Schaigenwiler geschriebene Handschrift überliefert als einzige die geistlichen Werke des aus Pforzheim gebürtigen Dominikanermönchs Wendelin Fabri (um 1465 – nach 1533). In seiner Funktion als Spiritual im Dominikanerinnenkloster Zoffingen in Konstanz entstanden zwischen 1510 und 1518 geistliche Traktate für die klösterlichen Tischlesungen, nämlich zum Altarssakrament, zu den fünf Gerstenbroten der Ordensleute und zu den Früchten der heiligen Messe, die Kollationen über die sieben O-Antiphonen sowie die Traktate Villicatorius und Prudentia simplex religiosorum. Die Handschrift gelangte zwischen 1780 und 1782 in die Klosterbibliothek von St. Gallen; Ende des 16. Jahrhunderts war sie noch im Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in Wil gelegen."
Fabri war mir bisher kein Begriff. Nicht nur Thomas Finck oder Felix Fabri haben um 1500 deutschsprachige Schriften für Klosterfrauen geschrieben. Zu Augustin Frick siehe
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5027
 Freiburger (CH) Schulordnung
Freiburger (CH) Schulordnung
Einige lateinische Handschriften der UB Basel und der Abtei Einsiedeln, ein Cartular aus Lausanne der Berner Burgerbibliothek, ein Kanzleiregister des Domkapitels Sitten, die Boner-Handschrift der Bodmeriana aus der Lauber-Werkstatt, Heinrich Murers "Helvetia sancta" aus Frauenfeld und vieles andere mehr.
Von den St. Galler Handschriften greife ich heraus:
"St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 990
Papier · 589 pp. · 30.5 × 21/21.5 cm · Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in St. Gallen (Regina Sattler, Dorothea Hertenstein, Elisabeth Schaigenwiler) · 1521/22
Sammelband aszetischen Inhalts mit geistlichen Traktaten des Dominikanermönchs Wendelin Fabri aus Pforzheim
Die im Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in St. Gallen in den Jahren 1521 und 1522 von den dortigen Schreiberinnen Regina Sattler, Dorothea von Hertenstein und Elisabeth Schaigenwiler geschriebene Handschrift überliefert als einzige die geistlichen Werke des aus Pforzheim gebürtigen Dominikanermönchs Wendelin Fabri (um 1465 – nach 1533). In seiner Funktion als Spiritual im Dominikanerinnenkloster Zoffingen in Konstanz entstanden zwischen 1510 und 1518 geistliche Traktate für die klösterlichen Tischlesungen, nämlich zum Altarssakrament, zu den fünf Gerstenbroten der Ordensleute und zu den Früchten der heiligen Messe, die Kollationen über die sieben O-Antiphonen sowie die Traktate Villicatorius und Prudentia simplex religiosorum. Die Handschrift gelangte zwischen 1780 und 1782 in die Klosterbibliothek von St. Gallen; Ende des 16. Jahrhunderts war sie noch im Dominikanerinnenkloster St. Katharinen in Wil gelegen."
Fabri war mir bisher kein Begriff. Nicht nur Thomas Finck oder Felix Fabri haben um 1500 deutschsprachige Schriften für Klosterfrauen geschrieben. Zu Augustin Frick siehe
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5027
 Freiburger (CH) Schulordnung
Freiburger (CH) SchulordnungKlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 17:12 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Zeitungsverlage müssen die Nutzung von Zeitungsartikeln freier Mitarbeiter in entgeltpflichtigen Online-Archiven angemessen honorieren. Der Betrag kann dabei 110 Euro pro Zeitungsartikel für einen Zeitraum von drei Jahren erreichen. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 19. November 2013 entschieden. "
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/detail/article/freie-journalisten-erhalten-richtig-geld-fuer-zeitungsartikel-in-zahlungspflichtigen-online-archiven.html
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/detail/article/freie-journalisten-erhalten-richtig-geld-fuer-zeitungsartikel-in-zahlungspflichtigen-online-archiven.html
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 17:05 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html
Mittels Crowdsourcing sollen die Bilder, die wie auf Flickr Commons üblich keine bekannten urheberrechtlichen Beschränkungen aufweisen, erschlossen werden.
Update:
http://www.generalist.org.uk/blog/2013/mechanical-curator-on-commons/
http://www.fotostoria.de/?p=2077
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/gratisbilder-zeichnungen-aus-dem-schatz-der-british-library-a-939419.html
Ich hatte übersehen, dass die Bilder mit einem Link zum PDF des ganzen Buchs versehen sind. Oder mit einem Link zum OPAC, wo sich der PDF-Link findet.
Im OPAC http://explore.bl.uk/ gibt es anscheinend keine primäre Filtermöglichkeit, aber nach Eingabe eines Suchworts lassen sich die online einsehbaren Bücher filtern. Zum Suchwort leipzig derzeit 652 Bücher, überwiegend deutschsprachig. Es sind viele Bücher nach der Google-Grenze von derzeit 1872 digitalisiert, selbstverständlich nicht nur solche mit Bildern (aus denen die Flickr-Bilder automatisiert ausgeschnitten wurden).
Bei nicht wenigen kommt man aber nicht zu einem Digitalisat, obwohl der Katalog das verspricht. Das hängt mit einem Bug zusammen, der auf
http://www.bl.uk/catalogues/search/issues.html
besprochen wird. Man muss ggf. alle Browserfenster schließen. Bei
http://access.bl.uk/item/pdf/lsidyv37d75da2
half das.
![Image taken from page 11 of 'Poems. [With letters, illustrations, etc.]'](http://farm8.staticflickr.com/7310/11219128845_33ec12c86d.jpg)
Mittels Crowdsourcing sollen die Bilder, die wie auf Flickr Commons üblich keine bekannten urheberrechtlichen Beschränkungen aufweisen, erschlossen werden.
Update:
http://www.generalist.org.uk/blog/2013/mechanical-curator-on-commons/
http://www.fotostoria.de/?p=2077
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/gratisbilder-zeichnungen-aus-dem-schatz-der-british-library-a-939419.html
Ich hatte übersehen, dass die Bilder mit einem Link zum PDF des ganzen Buchs versehen sind. Oder mit einem Link zum OPAC, wo sich der PDF-Link findet.
Im OPAC http://explore.bl.uk/ gibt es anscheinend keine primäre Filtermöglichkeit, aber nach Eingabe eines Suchworts lassen sich die online einsehbaren Bücher filtern. Zum Suchwort leipzig derzeit 652 Bücher, überwiegend deutschsprachig. Es sind viele Bücher nach der Google-Grenze von derzeit 1872 digitalisiert, selbstverständlich nicht nur solche mit Bildern (aus denen die Flickr-Bilder automatisiert ausgeschnitten wurden).
Bei nicht wenigen kommt man aber nicht zu einem Digitalisat, obwohl der Katalog das verspricht. Das hängt mit einem Bug zusammen, der auf
http://www.bl.uk/catalogues/search/issues.html
besprochen wird. Man muss ggf. alle Browserfenster schließen. Bei
http://access.bl.uk/item/pdf/lsidyv37d75da2
half das.
![Image taken from page 11 of 'Poems. [With letters, illustrations, etc.]'](http://farm8.staticflickr.com/7310/11219128845_33ec12c86d.jpg)
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 16:56 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Zürcher Handschrift von 1670 ist online unter:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4284186
Ebenda neu online ein Augsburger Büchsenmeisterbuch des 17. Jahrhunderts:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/5846799
#fnzhss
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4284186
Ebenda neu online ein Augsburger Büchsenmeisterbuch des 17. Jahrhunderts:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/5846799
#fnzhss
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 16:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.main-netz.de/nachrichten/regionalenachrichten/bayern/art11994,2864054
"Die Münchner Bundeswehr-Universität erkannte dem Landrat von Miesbach den Titel ab. »Die Arbeit von Herrn Kreidl stellt keine eigenständige wissenschaftliche Leistung dar und war damit nicht dissertationswürdig«, teilte die Uni am Donnerstag zur Begründung mit. Der Fakultätsrat der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften habe dies am Vortag einstimmig entschieden.
Kreidl akzeptierte die Entscheidung und kündigte an, keine Rechtsmittel dagegen einzulegen. »Ich bedauere sehr, dass meine Arbeit wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügt und wiederhole meine Entschuldigung hierfür«, sagte er laut Mitteilung."
Interview mit ihm:
http://www.tegernseerstimme.de/jakob-kreidl-doktortitel-aberkannt/108593.html
"Die Münchner Bundeswehr-Universität erkannte dem Landrat von Miesbach den Titel ab. »Die Arbeit von Herrn Kreidl stellt keine eigenständige wissenschaftliche Leistung dar und war damit nicht dissertationswürdig«, teilte die Uni am Donnerstag zur Begründung mit. Der Fakultätsrat der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften habe dies am Vortag einstimmig entschieden.
Kreidl akzeptierte die Entscheidung und kündigte an, keine Rechtsmittel dagegen einzulegen. »Ich bedauere sehr, dass meine Arbeit wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügt und wiederhole meine Entschuldigung hierfür«, sagte er laut Mitteilung."
Interview mit ihm:
http://www.tegernseerstimme.de/jakob-kreidl-doktortitel-aberkannt/108593.html
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 16:12 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Zu den meistgelesenen Artikeln von Archivalia (Platz 19 mit 21887 Zugriffen) zählt der am 27. Februar 2007 hier erschienene Beitrag (vorgeschlagen von "Chris" am 2013/11/30 23:57):
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Links hier nicht aktualisiert, viele konstruktive Kommentare und Hinweise am Originalartikel)
Er erschien im Zusammenhang mit der Causa Eichstätt, der Vernichtung von Büchern aus Kapuzinerbibliotheken durch die UB Eichstätt. Zusammenfassend jüngst dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/453138938/
Wenige Tage zuvor hatte ich in der FAZ einen Artikel dazu geschrieben:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/universitaet-eichstaett-83-tonnen-buecher-als-muell-1411791.html
Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass bei Büchervernichtungen zu wenig getan wird, um sie denjenigen zu übermitteln, die etwas mit ihnen anfangen können. Niemand kann mich davon überzeugen, dass Bilder, wie sie in Detroit aufgenommen wurden
http://archiv.twoday.net/stories/506932973/
"alternativlose" Abläufe dokumentieren.
Teilen statt vernichten! Das gilt für Lebensmittel wie für Bücher.
Alle Türchen: #bestof
***
Wieso entsetzt die Vernichtung riesiger Mengen (alter) Bücher so viele Menschen?
Wieso haben sehr viele Menschen, die Bücher lieben, eine Scheu davor, Bücher in den Müll zu werfen, auch wenn sie keinen Bedarf mehr dafür haben?
Besteht zwischen der Scheu, Bücher wegzuwerfen, und der Abscheu, mit der wir die NS-Bücherverbrennungen quittieren, eine geheime Verbindung?
Überregional bekanntgeworden ist die von dem Pfarrer Martin Weskott betriebene "Bücherburg Katlenburg" bei Göttingen, wo man gegen eine Spende Bücher mitnehmen kann. Nach der Wende wurden riesige Mengen DDR-Bücher vor der Entsorgung gerettet.
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/443006/
http://www.buecherburg.de/
Sie haben überflüssige Bücher oder kennen jemanden, der gut erhaltene Bücher ins Altpapier wirft?
Bücher gehören nicht auf den Müll!
Bitte unterstützen Sie die Aktion
"BÜCHER WEITERGEBEN STATT WEGWERFEN"
Wussten Sie, ...
... dass der Physiker Hans Lauche vom Max-Planck-Institut für Aeronomie in einem Buch aus dem Büchermagazin Hinweise auf Materialkombinationen gefunden hat, die für den Bau eines Spektral-Fotometers für die Saturn-Sonde Cassini hervorragend geeignet waren?
Dazu auch:
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/08.06.2006/2549283.asp
"Ein Ingenieur vom Max-Planck-Institut für Sonnenfeldforschung ganz in der Nähe hatte bei ihm ein altes DDR-Physik-Fachbuch gefunden. Und da stand drin, wie man eine Fassung macht aus Magnesiumsilikat. Eine Fassung, wie er sie brauchte für das Fotospektrometer der „Cassini“-Sonde."
Immer wieder werfen aber Bibliotheken kaltschnäuzig Bücher weg, die andere gerne gehabt hätten:
http://www.flickr.com/photos/ants_in_my_pants/91875957/
zur badischen Landesbibliothek

Foto: JochenB
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.ib.hu-berlin.de/~ben/humboldt_buecher/
zur UB der Humboldt-Uni
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=3299
Fürs Verschenken überzähliger Bücher plädiert:
http://www.rbb-online.de/_/themen/beitrag_jsp/key=5168898.html
Die Berliner Stadtreinigung listet auf, wer in Berlin Bücher für wohltätige Zwecke entgegennimmt:
http://www.bsr.de/bsr/html/5095.htm
Sie betreibt auch einen Verschenkmarkt:
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
Bücher nehmen insbesondere die Oxfam-Shops an:
http://www.oxfam.de/a_51_sachen_spenden.asp?me=51
Die Bibliotheken haben ihren Tausch über eine Mailingliste organisiert:
http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/dubletten.htm
Weitere Hinweise zu Bücherprojekten in einer Liste von Umsonstökonomie-Projekten:
http://www.autoorganisation.org/mediawiki/index.php/Anders_Leben/Anders_wirtschaften/Umsonst%C3%B6konomien
Beispiel eines Umsonstladens:
http://www.neue-arbeit-hamburg.de/pmwiki.php/Main/BildetUmsonstl%e4den
Zur Bookcrossing-Szene
http://de.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing
Beispiel einer Büchertauschbörse im WWW
http://www.meinbuch-deinbuch.com/
In manchen (viel zu wenigen) Städten gibt es öffentliche Bücherschränke, wie z.B. in Bonn:
 Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Weitere Hinweise, Ideen?
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/ (Links hier nicht aktualisiert, viele konstruktive Kommentare und Hinweise am Originalartikel)
Er erschien im Zusammenhang mit der Causa Eichstätt, der Vernichtung von Büchern aus Kapuzinerbibliotheken durch die UB Eichstätt. Zusammenfassend jüngst dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/453138938/
Wenige Tage zuvor hatte ich in der FAZ einen Artikel dazu geschrieben:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/universitaet-eichstaett-83-tonnen-buecher-als-muell-1411791.html
Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass bei Büchervernichtungen zu wenig getan wird, um sie denjenigen zu übermitteln, die etwas mit ihnen anfangen können. Niemand kann mich davon überzeugen, dass Bilder, wie sie in Detroit aufgenommen wurden
http://archiv.twoday.net/stories/506932973/
"alternativlose" Abläufe dokumentieren.
Teilen statt vernichten! Das gilt für Lebensmittel wie für Bücher.
Alle Türchen: #bestof
***
Wieso entsetzt die Vernichtung riesiger Mengen (alter) Bücher so viele Menschen?
Wieso haben sehr viele Menschen, die Bücher lieben, eine Scheu davor, Bücher in den Müll zu werfen, auch wenn sie keinen Bedarf mehr dafür haben?
Besteht zwischen der Scheu, Bücher wegzuwerfen, und der Abscheu, mit der wir die NS-Bücherverbrennungen quittieren, eine geheime Verbindung?
Überregional bekanntgeworden ist die von dem Pfarrer Martin Weskott betriebene "Bücherburg Katlenburg" bei Göttingen, wo man gegen eine Spende Bücher mitnehmen kann. Nach der Wende wurden riesige Mengen DDR-Bücher vor der Entsorgung gerettet.
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/443006/
http://www.buecherburg.de/
Sie haben überflüssige Bücher oder kennen jemanden, der gut erhaltene Bücher ins Altpapier wirft?
Bücher gehören nicht auf den Müll!
Bitte unterstützen Sie die Aktion
"BÜCHER WEITERGEBEN STATT WEGWERFEN"
Wussten Sie, ...
... dass der Physiker Hans Lauche vom Max-Planck-Institut für Aeronomie in einem Buch aus dem Büchermagazin Hinweise auf Materialkombinationen gefunden hat, die für den Bau eines Spektral-Fotometers für die Saturn-Sonde Cassini hervorragend geeignet waren?
Dazu auch:
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/08.06.2006/2549283.asp
"Ein Ingenieur vom Max-Planck-Institut für Sonnenfeldforschung ganz in der Nähe hatte bei ihm ein altes DDR-Physik-Fachbuch gefunden. Und da stand drin, wie man eine Fassung macht aus Magnesiumsilikat. Eine Fassung, wie er sie brauchte für das Fotospektrometer der „Cassini“-Sonde."
Immer wieder werfen aber Bibliotheken kaltschnäuzig Bücher weg, die andere gerne gehabt hätten:
http://www.flickr.com/photos/ants_in_my_pants/91875957/
zur badischen Landesbibliothek

Foto: JochenB
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.ib.hu-berlin.de/~ben/humboldt_buecher/
zur UB der Humboldt-Uni
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=3299
Fürs Verschenken überzähliger Bücher plädiert:
http://www.rbb-online.de/_/themen/beitrag_jsp/key=5168898.html
Die Berliner Stadtreinigung listet auf, wer in Berlin Bücher für wohltätige Zwecke entgegennimmt:
http://www.bsr.de/bsr/html/5095.htm
Sie betreibt auch einen Verschenkmarkt:
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
Bücher nehmen insbesondere die Oxfam-Shops an:
http://www.oxfam.de/a_51_sachen_spenden.asp?me=51
Die Bibliotheken haben ihren Tausch über eine Mailingliste organisiert:
http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/dubletten.htm
Weitere Hinweise zu Bücherprojekten in einer Liste von Umsonstökonomie-Projekten:
http://www.autoorganisation.org/mediawiki/index.php/Anders_Leben/Anders_wirtschaften/Umsonst%C3%B6konomien
Beispiel eines Umsonstladens:
http://www.neue-arbeit-hamburg.de/pmwiki.php/Main/BildetUmsonstl%e4den
Zur Bookcrossing-Szene
http://de.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing
Beispiel einer Büchertauschbörse im WWW
http://www.meinbuch-deinbuch.com/
In manchen (viel zu wenigen) Städten gibt es öffentliche Bücherschränke, wie z.B. in Bonn:
 Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.htmlWeitere Hinweise, Ideen?
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 04:32 - Rubrik: Unterhaltung
Es gibt viele Gründe, wieso die aktuelle riesige Abmahnwelle der Kanzlei U+C wegen angeblichen Porno-Streamings auf der Plattform Redtube unwirksam sein könnte. Auf meine Berichterstattung hier und auf G+ wird verwiesen.
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
Immer wieder wurde in Foren auf ein Urteil verwiesen, wonach Pornos ohnehin nicht urheberrechtlich geschützt seien.
Eine genaue Prüfung der Rechtslage ergibt, dass die Nichtbeachtung der fremdenrechtlichen Voraussetzungen in den jetzigen Gestattungsbeschlüssen des Landgerichts Köln rechtsfehlerhaft war und insoweit einen urheberrechtlichen Skandal fortsetzt, der schon früher sogar zu rechtswidriger Strafverfolgung geführt hat.
Angesichts der Tragweite des mit § 101 UrhG verbundenen Grundrechtseingriffs hätte sorgfältig geprüft werden müssen, ob - bei Nichtvorliegen eines Filmwerks - der Schweizer Laufbildhersteller die Formalitäten des § 121 Abs. 1 UrhG eingehalten hat, woran es zum jetzigen Zeitpunkt erhebliche Zweifel gibt.
Dass noch viel wichtigere Punkte von den offensichtlich unfähigen Kölner Richtern sorgfältig hätten geprüft werden müssen, schließt nicht aus, dass bereits die Nichtbeachtung der fremdenrechtlichen Problematik die entsprechenden Beschlüsse als rechtswidrig erscheinen lässt. Und das selbst dann, wenn man doch zum Schluss kommt, dass ein Laufbilderschutz in Deutschland besteht. Dies ergibt sich daraus, dass an die Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung strenge Anforderungen zu stellen sind. Es reicht nicht aus, wenn die Rechtsverletzung wahrscheinlich erscheint (Wimmers in Schricker/Loewenheim, UrhR, 4. Aufl. 2010, § 101 Rz. 67). Es hätte also bewiesen werden müssen, dass die Laufbilder erstmals in Deutschland oder bei Erscheinen im Ausland innerhalb eines Monats erschienen sind.
Hat eine Schweizer Firma als Inhaberin des Laufbilderschutzes nach § 95 UrhG die Pornofilme auf einen US-Server in der Art von Redtube hochgeladen, ohne sie in Deutschland innerhalb der Monatsfrist auch in Form von Vervielfältigungsstücken in den Handel zu bringen, so scheidet nach herrschender Meinung ein Laufbild-Schutz und damit ein Schutz in Deutschland aus. Auf dieser Basis darf niemand abgemahnt werden.
Bei dem Landgericht Köln hätten angesichts der Kombination Porno und Schweizer Firma die Alarmglocken schrillen müssen, da Pornos der Urheberrechtsschutz abgesprochen wird und ein Schutz als Laufbilder bei einem Nicht-EU-Rechteinhaber formale Voraussetzungen hat, die vom Antragsteller hätten dargelegt werden müssen.
Zunächst einmal ist zu belegen, dass die These zutrifft:
Die herrschende urheberrechtliche Meinung schließt Pornos und Sexfilme vom Urheberrechtsschutz als "Filmwerke" nach § 2 UrhG aus und gewährt ihnen nur den Schutz als Laufbilder nach § 95 UrhG.
Wie recht häufig äußerte sich Udo Vetter in seinem Lawblog fahrlässig ungenau, als er ohne irgendwelche Belege und natürlich wie üblich ohne einen Link zur Entscheidung behauptete, dass bei Pornofilmen, deren Handlung nur im Geschlechtsverkehr besteht, "fast alle Gerichte" die Schöpfungshöhe bejahten. Das ist ersichtlich aus der Luft gegriffen, denn Rechtsprechung und Schrifttum sehen das einhellig anders.
Das Landgericht München hat sich in seiner Entscheidung gegen die Firma Malibu, die - so ein Zufall! - von den jetzt abmahnenden Urmann und Collegen vertreten wurde, an eine bestehende Rechtsprechung angeschlossen.
http://www.wbs-law.de/wp-content/uploads/2013/06/LG-M%C3%BCnchen-7-O-22293-12.pdf
Auf Anwaltsseiten und in Blawgs wurde soweit ich sehe, keine Kritik an dem Beschluss geübt, auch wenn man die Konsequenzen relativiert hat. Von einer "Porno-Ente" zu sprechen, wie es Weitzmann und Kreutzer getan haben
http://irights.info/nicht-kreativ-genug-eine-porno-ente-erobert-die-schlagzeilen
geht aber zu weit.
Katzenberger nennt im umfangreichsten Urheberrechtskommentar (Schricker/Loewenheim § 95 Rz. 12) als Beispiele für bloße Laufbilder "Sex und Pornofilme", ohne irgendwelche abweichenden Meinungen zu vermerken. Stattdessen nennt er Gerichtsentscheidungen, die das ebenso sehen:
OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 53 - Laufbilder
OLG Hamburg, UFITA 87 (1980), 322/4 - Tiffany [3 U 140/79]
OLG Hamburg, GRUR 1984, 663 - Video Intim
Das LG Köln stellte 2010 fest:
"Bei den Erotikfilmen handelt es sich mangels "Werkqualität" um Laufbilder (OLG Hamburg, GRUR 1984, 663 - Video Intim), die Laufbildschutz nach §§ 95 i.V.m. 94 UrhG genießen."
http://openjur.de/u/536931.html
Der Kommentar von Dreyer et al. 2009 hält kurz und knackig fest: "An der notwendigen schöpferischen Gestaltungshöhe fehlt es idR Pornofilmen (OLG Hamburg GRUR 1984, 663 - Video intim)."
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22Video+Intim%22+olg+hamburg
1992 führte Thomas Hoeren in GRUR die Sexfilme unter den Filmen "zweiter Klasse", die nur Laufbilder seien, auf:
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/043.pdf
Die Belege ließen sich wohl unschwer vermehren.
Jedenfalls bei kürzeren Filmen (im Münchner Fall war der längere Film 19 Minuten lang), bei denen es an einer Handlung abgesehen vom "Gerammel" fehlt, darf ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein Schutz als Filmwerk nicht gegeben ist.
Paul Katzenberger hat den Justiz-Skandal in Sachen Laufbilder wenn man so will "aufgedeckt" (Schricker/Loewenheim § 95 Rz. 12). Ich selbst schrieb in meiner Urheberrechtsfibel 2009 zu § 128
"Ein in den USA erstellter kurzer Pornoclip zählt nach deutschem Recht nicht zu den Filmwerken, sondern zu den Laufbildern (§ 95). Er ist in Deutschland nicht nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt. (Geschützt sind aber die Filmeinzelbilder nach § 72 als einfache Lichtbilder.) Die Vorschrift orientiert sich an § 126. Da einschlägige Staatsverträge fehlen, sind ausländische Filmhersteller außerhalb der EU/EWRStaaten kaum geschützt. Es geht wohlgemerkt nicht um den urheberrechtlichen Schutz, der den Urhebern von Filmwerken selbstverständlich zukommt, sondern um das Leistungsschutzrecht des Filmherstellers. Besteht im Ausland (z. B. in den USA) kein solcher spezifischer Schutz, ist nach dem Schutzfristenvergleich auch in Deutschland kein Schutz möglich. Im Fall des Pornoclips gibt es keine Film-Urheber, da kein Filmwerk vorliegt, und die Darsteller sind auch, da sie einfach Sex haben und nicht ein Werk zum Vortrage bringen, keine ausübenden Künstler.
Mit der fremdenrechtlichen Vorschrift des § 128 waren einige deutsche Gerichte offensichtlich überfordert. Sie haben sie schlicht und einfach übersehen oder ignoriert.
Der Schutz des Filmherstellers ist zu streichen und daher muss auch
§ 128 weg!"
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
Wie das mit den Filmeinzelbildern ist, kann dahingestellt bleiben. Rechteinhaber haben sich meines Wissens bei einem Film noch nie auf den Schutz der Filmeinzelbilder berufen, aber man weiß ja nie (Graf's Law von 2006: Alles was abgemahnt werden kann, wird irgendwann einmal abgemahnt werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/GNU_FDL_Highway_to_Hell_-_FAQ#Definitionen ).
Bei meinen Ausführungen 2009 stützte ich mich auf Katzenberger, der vor allem anhand der Videospiele, die überwiegend auch nur als Laufbilder gelten, kritisiert hat, dass die Gerichte die fremdenrechtliche Rechtslage bei Spielen aus den USA und Japan verkannt und falsche Entscheidungen getroffen haben. "Bedauerlicherweise", schreibt er (zitiert nach der 4. Auflage, die 2009 natürlich noch nicht vorlag), "sind offensichtlich auch zahlreiche strafrechtliche Verfolgungsmaßnahmen, auch solche gegen Jugendliche, auf jene nicht existente gesetzliche Grundlage gestützt worden".
Das ist aus meiner Sicht durchaus ein Justizskandal. Wenn man verlangt, dass man sich an die Regeln des UrhG hält, dann kann man nicht einfach Regeln weglassen, weil das den Rechteinhabern besser passt.
Es gibt keinen internationalen Schutz für Laufbilder. Katzenberger bezieht sich auf eine richtige Entscheidung des österreichischen OGH "Game Boy", die ein japanisches Videospiel betraf und online ist:
http://ww.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19911217_OGH0002_0040OB00003_9200000_000
Da es bei den vorliegenden Streaming-Abmahnungen um Pornos ging, hätte zunächst einmal die Eigenschaft als Filmwerk erwiesen werden müssen, da die gefestigte deutsche Rechtsprechung Pornos eben nicht als Filmwerke, sondern als Laufbilder sieht.
Im Antrag des RA Sebastian an das LG Köln ist ausdrücklich von der Übertragung der "verfahrensgegenständlichen Rechte" hinsichtlich des durch eine spanische Firma hergestellten Films "Amanda's Secret" an die Schweizer Antragstellerin "The Archive AG" die Rede.
http://www.abmahnhelfer.de/wp-content/uploads/2013/12/Antrag.pdf
Da die Rechte des Filmherstellers übertragbar sind (§ 94 UrhG), ist als Rechteinhaber des Laufbildschutzes eine Firma außerhalb von EU und EWR anzusehen, denn die Schweiz gehört dazu nicht! Wären die Rechte noch bei der spanischen Firma (EU) oder an eine deutsche Firma übertragen worden, so wäre der Laufbildschutz automatisch gegeben und ein Einwand aussichtslos.
Was auch immer sich die Abmahner von dem Schweizer Standort von "The Archive" versprochen haben mögen, die Rechteübertragung bereitet ihnen, folgt man meiner Argumentation, erhebliche fremdenrechtliche Probleme mit dem Laufbildschutz.
Im Lawblog-Forum wurde hinreichend Beweismaterial zusammengetragen, dass die Filme, um die es in der Abmahnung geht, obskure Machwerke sind, über die man sonst nichts findet, also auch kein DVD-Angebot. Damit aber stellen sich ähnliche Beweisprobleme wie bei dem Münchner Fall, bei dem die Rechteinhaber das Erscheinen in Deutschland bzw. bei Erscheinen im Ausland spätestens einen Monat später in Deutschland (Voraussetzung des fremdenrechtlichen Schutzes nach § 121 Abs. 1 UrhG) nicht darlegen konnten. Nach Katzenberger (§ 6 Rz. 56) reicht ein Upload auf einen Server in oder außerhalb Deutschlands nicht aus, um den Urheberrechtsschutz nach § 121 Abs. 1 zu begründen! Durch eine reine Internetveröffentlichung kann also z.B. Amanda's Secret nach dieser autoritativen Meinung keinen deutschen Laufbildschutz erlangt haben.
Ohne Laufbildschutz keine Urheberrechtsverletzung und a) keine Gerichtsauskunft hinsichtlich der Anschrift und b) auch keine wirksame Abmahnung!
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
Immer wieder wurde in Foren auf ein Urteil verwiesen, wonach Pornos ohnehin nicht urheberrechtlich geschützt seien.
Eine genaue Prüfung der Rechtslage ergibt, dass die Nichtbeachtung der fremdenrechtlichen Voraussetzungen in den jetzigen Gestattungsbeschlüssen des Landgerichts Köln rechtsfehlerhaft war und insoweit einen urheberrechtlichen Skandal fortsetzt, der schon früher sogar zu rechtswidriger Strafverfolgung geführt hat.
Angesichts der Tragweite des mit § 101 UrhG verbundenen Grundrechtseingriffs hätte sorgfältig geprüft werden müssen, ob - bei Nichtvorliegen eines Filmwerks - der Schweizer Laufbildhersteller die Formalitäten des § 121 Abs. 1 UrhG eingehalten hat, woran es zum jetzigen Zeitpunkt erhebliche Zweifel gibt.
Dass noch viel wichtigere Punkte von den offensichtlich unfähigen Kölner Richtern sorgfältig hätten geprüft werden müssen, schließt nicht aus, dass bereits die Nichtbeachtung der fremdenrechtlichen Problematik die entsprechenden Beschlüsse als rechtswidrig erscheinen lässt. Und das selbst dann, wenn man doch zum Schluss kommt, dass ein Laufbilderschutz in Deutschland besteht. Dies ergibt sich daraus, dass an die Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung strenge Anforderungen zu stellen sind. Es reicht nicht aus, wenn die Rechtsverletzung wahrscheinlich erscheint (Wimmers in Schricker/Loewenheim, UrhR, 4. Aufl. 2010, § 101 Rz. 67). Es hätte also bewiesen werden müssen, dass die Laufbilder erstmals in Deutschland oder bei Erscheinen im Ausland innerhalb eines Monats erschienen sind.
Hat eine Schweizer Firma als Inhaberin des Laufbilderschutzes nach § 95 UrhG die Pornofilme auf einen US-Server in der Art von Redtube hochgeladen, ohne sie in Deutschland innerhalb der Monatsfrist auch in Form von Vervielfältigungsstücken in den Handel zu bringen, so scheidet nach herrschender Meinung ein Laufbild-Schutz und damit ein Schutz in Deutschland aus. Auf dieser Basis darf niemand abgemahnt werden.
Bei dem Landgericht Köln hätten angesichts der Kombination Porno und Schweizer Firma die Alarmglocken schrillen müssen, da Pornos der Urheberrechtsschutz abgesprochen wird und ein Schutz als Laufbilder bei einem Nicht-EU-Rechteinhaber formale Voraussetzungen hat, die vom Antragsteller hätten dargelegt werden müssen.
Zunächst einmal ist zu belegen, dass die These zutrifft:
Die herrschende urheberrechtliche Meinung schließt Pornos und Sexfilme vom Urheberrechtsschutz als "Filmwerke" nach § 2 UrhG aus und gewährt ihnen nur den Schutz als Laufbilder nach § 95 UrhG.
Wie recht häufig äußerte sich Udo Vetter in seinem Lawblog fahrlässig ungenau, als er ohne irgendwelche Belege und natürlich wie üblich ohne einen Link zur Entscheidung behauptete, dass bei Pornofilmen, deren Handlung nur im Geschlechtsverkehr besteht, "fast alle Gerichte" die Schöpfungshöhe bejahten. Das ist ersichtlich aus der Luft gegriffen, denn Rechtsprechung und Schrifttum sehen das einhellig anders.
Das Landgericht München hat sich in seiner Entscheidung gegen die Firma Malibu, die - so ein Zufall! - von den jetzt abmahnenden Urmann und Collegen vertreten wurde, an eine bestehende Rechtsprechung angeschlossen.
http://www.wbs-law.de/wp-content/uploads/2013/06/LG-M%C3%BCnchen-7-O-22293-12.pdf
Auf Anwaltsseiten und in Blawgs wurde soweit ich sehe, keine Kritik an dem Beschluss geübt, auch wenn man die Konsequenzen relativiert hat. Von einer "Porno-Ente" zu sprechen, wie es Weitzmann und Kreutzer getan haben
http://irights.info/nicht-kreativ-genug-eine-porno-ente-erobert-die-schlagzeilen
geht aber zu weit.
Katzenberger nennt im umfangreichsten Urheberrechtskommentar (Schricker/Loewenheim § 95 Rz. 12) als Beispiele für bloße Laufbilder "Sex und Pornofilme", ohne irgendwelche abweichenden Meinungen zu vermerken. Stattdessen nennt er Gerichtsentscheidungen, die das ebenso sehen:
OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 53 - Laufbilder
OLG Hamburg, UFITA 87 (1980), 322/4 - Tiffany [3 U 140/79]
OLG Hamburg, GRUR 1984, 663 - Video Intim
Das LG Köln stellte 2010 fest:
"Bei den Erotikfilmen handelt es sich mangels "Werkqualität" um Laufbilder (OLG Hamburg, GRUR 1984, 663 - Video Intim), die Laufbildschutz nach §§ 95 i.V.m. 94 UrhG genießen."
http://openjur.de/u/536931.html
Der Kommentar von Dreyer et al. 2009 hält kurz und knackig fest: "An der notwendigen schöpferischen Gestaltungshöhe fehlt es idR Pornofilmen (OLG Hamburg GRUR 1984, 663 - Video intim)."
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22Video+Intim%22+olg+hamburg
1992 führte Thomas Hoeren in GRUR die Sexfilme unter den Filmen "zweiter Klasse", die nur Laufbilder seien, auf:
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/043.pdf
Die Belege ließen sich wohl unschwer vermehren.
Jedenfalls bei kürzeren Filmen (im Münchner Fall war der längere Film 19 Minuten lang), bei denen es an einer Handlung abgesehen vom "Gerammel" fehlt, darf ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein Schutz als Filmwerk nicht gegeben ist.
Paul Katzenberger hat den Justiz-Skandal in Sachen Laufbilder wenn man so will "aufgedeckt" (Schricker/Loewenheim § 95 Rz. 12). Ich selbst schrieb in meiner Urheberrechtsfibel 2009 zu § 128
"Ein in den USA erstellter kurzer Pornoclip zählt nach deutschem Recht nicht zu den Filmwerken, sondern zu den Laufbildern (§ 95). Er ist in Deutschland nicht nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt. (Geschützt sind aber die Filmeinzelbilder nach § 72 als einfache Lichtbilder.) Die Vorschrift orientiert sich an § 126. Da einschlägige Staatsverträge fehlen, sind ausländische Filmhersteller außerhalb der EU/EWRStaaten kaum geschützt. Es geht wohlgemerkt nicht um den urheberrechtlichen Schutz, der den Urhebern von Filmwerken selbstverständlich zukommt, sondern um das Leistungsschutzrecht des Filmherstellers. Besteht im Ausland (z. B. in den USA) kein solcher spezifischer Schutz, ist nach dem Schutzfristenvergleich auch in Deutschland kein Schutz möglich. Im Fall des Pornoclips gibt es keine Film-Urheber, da kein Filmwerk vorliegt, und die Darsteller sind auch, da sie einfach Sex haben und nicht ein Werk zum Vortrage bringen, keine ausübenden Künstler.
Mit der fremdenrechtlichen Vorschrift des § 128 waren einige deutsche Gerichte offensichtlich überfordert. Sie haben sie schlicht und einfach übersehen oder ignoriert.
Der Schutz des Filmherstellers ist zu streichen und daher muss auch
§ 128 weg!"
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
Wie das mit den Filmeinzelbildern ist, kann dahingestellt bleiben. Rechteinhaber haben sich meines Wissens bei einem Film noch nie auf den Schutz der Filmeinzelbilder berufen, aber man weiß ja nie (Graf's Law von 2006: Alles was abgemahnt werden kann, wird irgendwann einmal abgemahnt werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/GNU_FDL_Highway_to_Hell_-_FAQ#Definitionen ).
Bei meinen Ausführungen 2009 stützte ich mich auf Katzenberger, der vor allem anhand der Videospiele, die überwiegend auch nur als Laufbilder gelten, kritisiert hat, dass die Gerichte die fremdenrechtliche Rechtslage bei Spielen aus den USA und Japan verkannt und falsche Entscheidungen getroffen haben. "Bedauerlicherweise", schreibt er (zitiert nach der 4. Auflage, die 2009 natürlich noch nicht vorlag), "sind offensichtlich auch zahlreiche strafrechtliche Verfolgungsmaßnahmen, auch solche gegen Jugendliche, auf jene nicht existente gesetzliche Grundlage gestützt worden".
Das ist aus meiner Sicht durchaus ein Justizskandal. Wenn man verlangt, dass man sich an die Regeln des UrhG hält, dann kann man nicht einfach Regeln weglassen, weil das den Rechteinhabern besser passt.
Es gibt keinen internationalen Schutz für Laufbilder. Katzenberger bezieht sich auf eine richtige Entscheidung des österreichischen OGH "Game Boy", die ein japanisches Videospiel betraf und online ist:
http://ww.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19911217_OGH0002_0040OB00003_9200000_000
Da es bei den vorliegenden Streaming-Abmahnungen um Pornos ging, hätte zunächst einmal die Eigenschaft als Filmwerk erwiesen werden müssen, da die gefestigte deutsche Rechtsprechung Pornos eben nicht als Filmwerke, sondern als Laufbilder sieht.
Im Antrag des RA Sebastian an das LG Köln ist ausdrücklich von der Übertragung der "verfahrensgegenständlichen Rechte" hinsichtlich des durch eine spanische Firma hergestellten Films "Amanda's Secret" an die Schweizer Antragstellerin "The Archive AG" die Rede.
http://www.abmahnhelfer.de/wp-content/uploads/2013/12/Antrag.pdf
Da die Rechte des Filmherstellers übertragbar sind (§ 94 UrhG), ist als Rechteinhaber des Laufbildschutzes eine Firma außerhalb von EU und EWR anzusehen, denn die Schweiz gehört dazu nicht! Wären die Rechte noch bei der spanischen Firma (EU) oder an eine deutsche Firma übertragen worden, so wäre der Laufbildschutz automatisch gegeben und ein Einwand aussichtslos.
Was auch immer sich die Abmahner von dem Schweizer Standort von "The Archive" versprochen haben mögen, die Rechteübertragung bereitet ihnen, folgt man meiner Argumentation, erhebliche fremdenrechtliche Probleme mit dem Laufbildschutz.
Im Lawblog-Forum wurde hinreichend Beweismaterial zusammengetragen, dass die Filme, um die es in der Abmahnung geht, obskure Machwerke sind, über die man sonst nichts findet, also auch kein DVD-Angebot. Damit aber stellen sich ähnliche Beweisprobleme wie bei dem Münchner Fall, bei dem die Rechteinhaber das Erscheinen in Deutschland bzw. bei Erscheinen im Ausland spätestens einen Monat später in Deutschland (Voraussetzung des fremdenrechtlichen Schutzes nach § 121 Abs. 1 UrhG) nicht darlegen konnten. Nach Katzenberger (§ 6 Rz. 56) reicht ein Upload auf einen Server in oder außerhalb Deutschlands nicht aus, um den Urheberrechtsschutz nach § 121 Abs. 1 zu begründen! Durch eine reine Internetveröffentlichung kann also z.B. Amanda's Secret nach dieser autoritativen Meinung keinen deutschen Laufbildschutz erlangt haben.
Ohne Laufbildschutz keine Urheberrechtsverletzung und a) keine Gerichtsauskunft hinsichtlich der Anschrift und b) auch keine wirksame Abmahnung!
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 03:46 - Rubrik: Archivrecht
Da eine Firma betroffen ist und nicht zehntausende verunsicherte Abgemahnte in Sachen angeblichen Porno-Konsums, gibt es blitzschnell eine Facebook-Gruppe, die den Widerstand koordiniert:
http://www.getdigital.de/blog/fall-trade-buzzer-abmahnung-gerichtliches-verbot-der-benutzung-von-geek-nerd/
http://www.getdigital.de/blog/fall-trade-buzzer-abmahnung-gerichtliches-verbot-der-benutzung-von-geek-nerd/
KlausGraf - am Freitag, 13. Dezember 2013, 00:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Viele Behörden in Nordrhein-Westfalen verweigern Verbrauchern laut der Organisation Foodwatch Auskünfte zu Lebensmittelkontrollen. Bei einem Test habe Foodwatch nur in fünf von 49 Fällen vollständig und kostenfrei Zugang zu allen beantragten Informationen erhalten, teilte die Verbraucherschutzorganisation am Donnerstag in Berlin mit."
http://www.focus.de/regional/nrw/lebensmittel-foodwatch-behoerden-verweigern-auskunft-zu-lebensmittelkontrollen_id_3477054.html
Siehe auch
http://www.derwesten.de/politik/behoerden-in-nrw-verschleppen-buerger-anfragen-id8762702.html
http://www.foodwatch.org/uploads/media/2013-12-12_foodwatch-Report_Lebensmittelueberwachung.pdf
http://www.focus.de/regional/nrw/lebensmittel-foodwatch-behoerden-verweigern-auskunft-zu-lebensmittelkontrollen_id_3477054.html
Siehe auch
http://www.derwesten.de/politik/behoerden-in-nrw-verschleppen-buerger-anfragen-id8762702.html
http://www.foodwatch.org/uploads/media/2013-12-12_foodwatch-Report_Lebensmittelueberwachung.pdf
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 22:31 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://marielebert.wordpress.com/2013/12/11/doaj/
Spätestens seit dem Bohannon-Sting ist das DOAJ diskreditiert. Zwei unsägliche Antworten auf Bohannon zeigen, dass man dort nicht bereit ist, überfällige Konsequenzen zu ziehen.
Solange das indische Journal "Annalen der Chemischen Forschung" vertreten ist, besteht kein Grund, diese lächerliche Liste irgendwie ernstzunehmen.
Wir lesen dazu in Bealls Kriterienliste:
"The name of a journal does not adequately reflect its origin (e.g., a journal with the word “Canadian” or “Swiss” in its name that has no meaningful relationship to Canada or Switzerland)."
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/
Es besteht ersichtlich kein Zusammenhang mit traditionsreichen deutschsprachigen Fachzeitschriften "Annalen der ...".
Wie schon früher schadet Jeffrey Beall derzeit mit einem widerlichen Anti-Open-Access-Pamphlet dem Ansehen seiner an sich verdienstvollen Recherchetätigkeit in Sachen unseriöse Open-Access-Journale. Harnad dazu:
http://mailman.ecs.soton.ac.uk/pipermail/goal/2013-December/002419.html
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/1087-Cameo-Replies-to-Bealls-List-of-Howlers.html
Spätestens seit dem Bohannon-Sting ist das DOAJ diskreditiert. Zwei unsägliche Antworten auf Bohannon zeigen, dass man dort nicht bereit ist, überfällige Konsequenzen zu ziehen.
Solange das indische Journal "Annalen der Chemischen Forschung" vertreten ist, besteht kein Grund, diese lächerliche Liste irgendwie ernstzunehmen.
Wir lesen dazu in Bealls Kriterienliste:
"The name of a journal does not adequately reflect its origin (e.g., a journal with the word “Canadian” or “Swiss” in its name that has no meaningful relationship to Canada or Switzerland)."
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/
Es besteht ersichtlich kein Zusammenhang mit traditionsreichen deutschsprachigen Fachzeitschriften "Annalen der ...".
Wie schon früher schadet Jeffrey Beall derzeit mit einem widerlichen Anti-Open-Access-Pamphlet dem Ansehen seiner an sich verdienstvollen Recherchetätigkeit in Sachen unseriöse Open-Access-Journale. Harnad dazu:
http://mailman.ecs.soton.ac.uk/pipermail/goal/2013-December/002419.html
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/1087-Cameo-Replies-to-Bealls-List-of-Howlers.html
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:59 - Rubrik: Open Access
Markus Kompa macht uns auf eine nicht jugendfreie Perle auf YouTube aufmerksam.
http://www.kanzleikompa.de/2013/12/12/hallo-liebe-pornofreunde/
Wer sich über die aktuellen Streaming-Abmahnungen unterrichten will, kann hier schauen
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
oder besser noch auf meinem G+-Stream, wo ich alle irgendwie bedeutsamen Meldungen zur U+C-Affäre teile:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts
Eine sehr gute Zusammenfassung der juristischen Aspekte:
http://www.juraserv.de/startseite/abmahnung-der-u-c-kanzlei-fuer-porno-streaming-von-redtube-com-01018
http://www.kanzleikompa.de/2013/12/12/hallo-liebe-pornofreunde/
Wer sich über die aktuellen Streaming-Abmahnungen unterrichten will, kann hier schauen
http://archiv.twoday.net/search?q=streaming
oder besser noch auf meinem G+-Stream, wo ich alle irgendwie bedeutsamen Meldungen zur U+C-Affäre teile:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts
Eine sehr gute Zusammenfassung der juristischen Aspekte:
http://www.juraserv.de/startseite/abmahnung-der-u-c-kanzlei-fuer-porno-streaming-von-redtube-com-01018
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:45 - Rubrik: Archivrecht
"In diesem Zusammenhang erscheint mir der Hinweis angebracht, dass die
Existenz eines Menschen definitionsgemäß zeitlich begrenzt ist und dass in
diesem Zeitraum sowohl die Vergangenheit, seine eigene Geschichte und letzten
Endes seine Erinnerungen, als auch die Gegenwart, das mehr oder weniger
unmittelbar Erlebte, das Bewusstsein dessen, was er gerade erlebt,
konvergieren109. Auch wenn sie schwer zu bestimmen ist, trennt eine Linie, die für
jede Person sicherlich anders verläuft, die Vergangenheit von der Gegenwart. Die
Möglichkeit, zwischen der Wahrnehmung der Gegenwart und der Wahrnehmung
der Vergangenheit zu unterscheiden, dürfte außer Frage stehen. Bei jeder dieser
Wahrnehmungen kann das Bewusstsein des eigenen Lebens – vor allem des
„Privatlebens“ – als „aufgezeichnetes“ Leben eine Rolle spielen. Und es besteht
ein Unterschied, je nachdem, ob es sich bei diesem „aufgezeichneten Leben“ um
dasjenige handelt, das man als gegenwärtig wahrnimmt, oder um dasjenige, das
man als seine eigene Geschichte erlebt."
Fn. 109
– Elias, N., Du temps, Fayard, 1998, und Rosa, H., Accélération. Une critique sociale du temps,
La Découverte, 2013.
Zu dem Buch von Elias siehe auch
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1997_num_47_6_395223
Welcher Schöngeist zitiert das?
Es ist einer der EU-Generalstaatsanwälte. Er hält die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für zu weitgehend. In der Regel folgt der Europäische Gerichtshof dem entsprechenden Gutachten.
http://malte-spitz.de/wp-content/uploads/2013/12/C_0293_2012-DE-CNC.pdf
Zur Sache siehe nur:
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-12/vorratsdaten-eu-richtlinie-spd
Existenz eines Menschen definitionsgemäß zeitlich begrenzt ist und dass in
diesem Zeitraum sowohl die Vergangenheit, seine eigene Geschichte und letzten
Endes seine Erinnerungen, als auch die Gegenwart, das mehr oder weniger
unmittelbar Erlebte, das Bewusstsein dessen, was er gerade erlebt,
konvergieren109. Auch wenn sie schwer zu bestimmen ist, trennt eine Linie, die für
jede Person sicherlich anders verläuft, die Vergangenheit von der Gegenwart. Die
Möglichkeit, zwischen der Wahrnehmung der Gegenwart und der Wahrnehmung
der Vergangenheit zu unterscheiden, dürfte außer Frage stehen. Bei jeder dieser
Wahrnehmungen kann das Bewusstsein des eigenen Lebens – vor allem des
„Privatlebens“ – als „aufgezeichnetes“ Leben eine Rolle spielen. Und es besteht
ein Unterschied, je nachdem, ob es sich bei diesem „aufgezeichneten Leben“ um
dasjenige handelt, das man als gegenwärtig wahrnimmt, oder um dasjenige, das
man als seine eigene Geschichte erlebt."
Fn. 109
– Elias, N., Du temps, Fayard, 1998, und Rosa, H., Accélération. Une critique sociale du temps,
La Découverte, 2013.
Zu dem Buch von Elias siehe auch
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1997_num_47_6_395223
Welcher Schöngeist zitiert das?
Es ist einer der EU-Generalstaatsanwälte. Er hält die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für zu weitgehend. In der Regel folgt der Europäische Gerichtshof dem entsprechenden Gutachten.
http://malte-spitz.de/wp-content/uploads/2013/12/C_0293_2012-DE-CNC.pdf
Zur Sache siehe nur:
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-12/vorratsdaten-eu-richtlinie-spd
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:32 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dondahlmann.de/?p=24312
Da Rechteketten immer unübersichtlicher werden, kommt es immer wieder mal vor, dass vollständig legal genutzte Bilder abgemahnt werden.
Da Rechteketten immer unübersichtlicher werden, kommt es immer wieder mal vor, dass vollständig legal genutzte Bilder abgemahnt werden.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:31 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In den letzten Tagen habe ich meinen Blogaggregator Planet History mit Auftritten in den relevanten Sozialen Netzwerken versorgt. Wer also nicht regelmäßig die Webseite besuchen will, kann jetzt auf Twitter, Facebook und Google Plus verfolgen, was die deutschsprachigen Geschichtsblogs schreiben.
Damit könnt ihr jetzt insgesamt 158 Geschichtsblogs bequem über folgende Wege lesen:
Webseite
RSS
Twitter
Facebook
Google Plus "
http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/planet-history-jetzt-auch-auf-facebook-und-google-plus/
Damit könnt ihr jetzt insgesamt 158 Geschichtsblogs bequem über folgende Wege lesen:
Webseite
RSS
Google Plus "
http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/planet-history-jetzt-auch-auf-facebook-und-google-plus/
http://www.europeansources.info/
Via
http://oebib.wordpress.com/2013/12/11/tib-datenbank-european-sources-online-eso-ist-frei-verfugbar/
Via
http://oebib.wordpress.com/2013/12/11/tib-datenbank-european-sources-online-eso-ist-frei-verfugbar/
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://landbuch.rechtsquellen.ch/teiviewer/
Landesarchiv Appenzell Innerrhoden (ISIL CH-000244-3), Bücher, Nr. 10, Landbuch, sog. «Älteres Landbuch».
Ohne Datum, entstanden in den 1540er-Jahren.
Via
http://www.infoclio.ch/de/node/54534
Landesarchiv Appenzell Innerrhoden (ISIL CH-000244-3), Bücher, Nr. 10, Landbuch, sog. «Älteres Landbuch».
Ohne Datum, entstanden in den 1540er-Jahren.
Via
http://www.infoclio.ch/de/node/54534
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:21 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.blog.pommerscher-greif.de/odyssee-labes/
Der Pommersche Greif als Käufer gibt leider nicht an, wieviel er dem unrechtmäßigen Besitzer gezahlt hat. Transparenz sieht anders aus.
Der Pommersche Greif als Käufer gibt leider nicht an, wieviel er dem unrechtmäßigen Besitzer gezahlt hat. Transparenz sieht anders aus.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:18 - Rubrik: Kirchenarchive
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:13 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit ihrer überraschenden Entscheidung, Adolf Hitlers Hetzschrift "Mein Kampf" auch nach 2015, wenn das Copyright für das Buch ausläuft, zu verbieten, hat die bayerische Staatsregierung sowohl den Landtag als auch das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) überrascht. Das IfZ arbeitet seit längerem an einer kommentierten kritischen Fassung des Buchs - im Auftrag des Freistaats.
Die Entscheidung hat im Landtag entsprechend parteiübergreifende Kritik ausgelöst - auch von der CSU. Die Abgeordneten wehrten sich am Mittwoch dagegen, dass die Regierung sich über einen einstimmigen Beschluss des Landtags hinwegsetze."
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/hilters-mein-kampf-soll-verboten-bleiben-a-938511.html
Schon der erste Satz dieser Meldung ist ein Fehler. Denn ob nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist am 1.1.2016 die Bayerische Staatsregierung eine Strafanzeige stellt oder jemand anderes, macht keinen rechtlichen Unterschied. Die Staatsregierung kann gar nix verbieten, da die entsprechenden Strafvorschriften Bundesrecht sind. Eine wissenschaftliche Ausgabe steht zudem unter dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG).
Die verbreitete Kritik an der Haltung der Staatsregierung ist berechtigt. Wir brauchen eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem - auf dem Internet Archive ja auch online verfügbaren - Text. Verbote sind da kontraproduktiv.
Siehe auch
http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/bayern-stoppt-historisch-kritische-ausgabe-von-mein-kampf/
http://www.hellojed.de/wp/2013/12/sein-kampf/

Die Entscheidung hat im Landtag entsprechend parteiübergreifende Kritik ausgelöst - auch von der CSU. Die Abgeordneten wehrten sich am Mittwoch dagegen, dass die Regierung sich über einen einstimmigen Beschluss des Landtags hinwegsetze."
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/hilters-mein-kampf-soll-verboten-bleiben-a-938511.html
Schon der erste Satz dieser Meldung ist ein Fehler. Denn ob nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist am 1.1.2016 die Bayerische Staatsregierung eine Strafanzeige stellt oder jemand anderes, macht keinen rechtlichen Unterschied. Die Staatsregierung kann gar nix verbieten, da die entsprechenden Strafvorschriften Bundesrecht sind. Eine wissenschaftliche Ausgabe steht zudem unter dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG).
Die verbreitete Kritik an der Haltung der Staatsregierung ist berechtigt. Wir brauchen eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem - auf dem Internet Archive ja auch online verfügbaren - Text. Verbote sind da kontraproduktiv.
Siehe auch
http://schmalenstroer.net/blog/2013/12/bayern-stoppt-historisch-kritische-ausgabe-von-mein-kampf/
http://www.hellojed.de/wp/2013/12/sein-kampf/

KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die BWG ist eine Gründung der Nazi-Zeit (1943) und schreibt heute über sich: "Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen.
Sie hat die Aufgabe, durch eigene Tätigkeit und in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen des In- und Auslandes die Wissenschaften, insbesondere das Zusammenwirken von Naturwissenschaften, Technischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften, zu fördern.
Die BWG ist nach Struktur und Zielsetzung eine den Akademien der Wissenschaften analoge Institution, deren 145 ordentliche Mitglieder ihre wissenschaftliche Heimat vorrangig in den technisch ausgerichteten Universitäten des Dreiecks Braunschweig - Hannover - Clausthal haben. "
http://bwg-nds.de/%C3%BCber-die-bwg/
Mich erreichte folgende Zuschrift auf elektronischem Wege:
"Braunschweigische
Wissenschaftliche Gesellschaft
- Der Vorsitzende der Klasse für Geisteswissenschaften -
Prof. Dr. Klaus Alpers
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
es dürfte Sie und die Leser von Archivalia interessieren, daß im Laufe des Jahres 2013 sämtliche 1.257 Aufsätze aus den Abhandlungen und Jahrbüchern der BWG von der Universitätsbibliothek Braunschweig digitalisiert und als Volltexte in die Digitale Bibliothek Braunschweig eingestellt worden sind: http://digisrv-1.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/content/main/bwg.xml
Sie sind nicht nur dort zu finden, sondern auch über die Kataloge der UB Braunschweig und den GBV.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Klaus Alpers "
Das ist in der Tat sehr begrüßenswert, vorbildlich, aber auch - was andere gelehrte Gesellschaften und Akademien angeht - vermutlich singulär.
Gibt man in der Suchmaske (Volltextsuche!) Nationalsozialismus ein, wieviele Treffer werden wohl in den 1257 Publikationen gefunden? Richtig: null.
Update: Herr Alpers schreibt mir: " ... halte ich es für angezeigt, Sie auf folgende vor wenigen Tagen erschienene Publikation hinzuweisen: Daniel Weßelhöft (†) und Oliver Matuschek, "70 Jahre Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 1943 - 2013", Braunschweig 2013. 134 Seiten (ISBN 978-3-941737-97-6)." Diese Publikation ist nicht Open Access und der Aufwand, sie mir wegen dieses Beitrags zu verschaffen, zu hoch.
Sie hat die Aufgabe, durch eigene Tätigkeit und in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen des In- und Auslandes die Wissenschaften, insbesondere das Zusammenwirken von Naturwissenschaften, Technischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften, zu fördern.
Die BWG ist nach Struktur und Zielsetzung eine den Akademien der Wissenschaften analoge Institution, deren 145 ordentliche Mitglieder ihre wissenschaftliche Heimat vorrangig in den technisch ausgerichteten Universitäten des Dreiecks Braunschweig - Hannover - Clausthal haben. "
http://bwg-nds.de/%C3%BCber-die-bwg/
Mich erreichte folgende Zuschrift auf elektronischem Wege:
"Braunschweigische
Wissenschaftliche Gesellschaft
- Der Vorsitzende der Klasse für Geisteswissenschaften -
Prof. Dr. Klaus Alpers
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
es dürfte Sie und die Leser von Archivalia interessieren, daß im Laufe des Jahres 2013 sämtliche 1.257 Aufsätze aus den Abhandlungen und Jahrbüchern der BWG von der Universitätsbibliothek Braunschweig digitalisiert und als Volltexte in die Digitale Bibliothek Braunschweig eingestellt worden sind: http://digisrv-1.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/content/main/bwg.xml
Sie sind nicht nur dort zu finden, sondern auch über die Kataloge der UB Braunschweig und den GBV.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Klaus Alpers "
Das ist in der Tat sehr begrüßenswert, vorbildlich, aber auch - was andere gelehrte Gesellschaften und Akademien angeht - vermutlich singulär.
Gibt man in der Suchmaske (Volltextsuche!) Nationalsozialismus ein, wieviele Treffer werden wohl in den 1257 Publikationen gefunden? Richtig: null.
Update: Herr Alpers schreibt mir: " ... halte ich es für angezeigt, Sie auf folgende vor wenigen Tagen erschienene Publikation hinzuweisen: Daniel Weßelhöft (†) und Oliver Matuschek, "70 Jahre Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 1943 - 2013", Braunschweig 2013. 134 Seiten (ISBN 978-3-941737-97-6)." Diese Publikation ist nicht Open Access und der Aufwand, sie mir wegen dieses Beitrags zu verschaffen, zu hoch.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 20:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Walter Mitty (Ben Stiller) arbeitet seit Jahren im Fotoarchiv der Zeitschrift Life!. Er ist ein Einzelgänger, der sich, um seinem grauen Alltag zu entfliehen, in abenteuerlichen, heldenhaften und romantischen Tagträumen verliert. Einziger Lichtblick ist die neue Kollegin Cheryl (Kristen Wiig), die Walter aus der Ferne bewundert.
Eines Tages wird bekannt, dass Life! zukünftig nur noch online erscheinen und eine letzte Printausgabe herausgebracht werden soll, die auf dem Titel ein Bild des berühmten Life!-Fotografen Sean O’Connell (Sean Penn) zeigen soll. Doch das besagte Bild, das an Walter geschickt wurde, ist verschwunden. Motiviert durch Cheryl nimmt Walter all seinen Mut zusammen und begibt sich auf eine aufregende Reise ans andere Ende der Welt, die für ihn zu einem wunderbaren Abenteuer wird, das er sich nicht besser hätte erträumen können…
DAS ERSTAUNLICHE LEBEN DES WALTER MITTY entstand unter der Regie von Ben Stiller mit Stars wie Shirley MacLaine, Kristen Wiig und Sean Penn. Filmstart ist der 1. Januar 2014!"
Quelle: Homepage des Films
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 16:39 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die neuesten Archivnachrichten aus Hessen stehen ganz im Zeichen der Exotik: "Dem Fremden auf der Spur". Die Beiträge widmen sich Weltreisen, Expeditionen, dem Tourismus und exotischen Pflanzen. Daneben werden aber wie gehabt Archivbestände präsentiert, archivwissenschaftliche Themen erörtert und archivische Projekte vorgestellt. Schauen Sie doch einfach rein unter http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de
Hessisches Hauptstaatsarchiv - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 14:00 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
@Archivalia_kg Für best of schlage ich vor, die FAZ-Freundin-Story aufzugreifen (evtl mit Update über aktuelle Sachlage?)
-- Erbloggtes (@Erbloggtes) 1. Dezember 2013
Einiges Aufsehen erregte das von mir am 13. März 2013 referierte Abmahnschreiben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die mir vorwarf, ich hätte die FAZ-Redakteurin Heike Schmoll als Schavan-Freundin bezeichnet und damit auf eine lesbische Beziehung angespielt.
http://archiv.twoday.net/stories/326202963/ (Kommentare zum Original-Artikel beachten!)
17082 Zugriffe laut Twoday-Mostread-Auswertung von heute.
Wie ging es weiter? Allgemeines Kopfschütteln in der Blogosphäre. Die Resonanz habe ich eingesammelt in:
http://archiv.twoday.net/stories/326204812/
http://archiv.twoday.net/stories/326528058/
http://archiv.twoday.net/stories/404096603/
In einem offenen Brief klagte ich die FAZ an:
http://archiv.twoday.net/stories/326207397/
Und die FAZ? Hat nie wieder etwas von sich hören lassen ... Ich schwörs.
Auf den Plagiats-Skandal um die Wissenschaftsministerin Annette Schavan beziehen sich die meisten der inzwischen über 100 Beiträge, die von der Suchfunktion aufgespürt werden:
http://archiv.twoday.net/search?q=schavan
Die Archivalia-Rubrik Wissenschaftsbetrieb gibt es seit 2008:
http://archiv.twoday.net/topics/Wissenschaftsbetrieb/?start=350
Anders als die analytischen und brillanten Blogs Erbloggtes und Causaschavan
http://causaschavan.wordpress.com/
http://erbloggtes.wordpress.com/
muss sich Archivalia meist damit begnügen, vermischte Meldungen vor allem zum Plagiate-Unwesen einzusammeln und gelegentlich meinungsfreudig zu bewerten. Ab und an gibt es aber auch längere Stellungnahmen.
Die meisten Beiträge der Kategorie stammen aus der Zeit nach Aufdeckung des Guttenberg-Plagiats 2011. "Weitere Quelle(n) zu Guttenberg-Plagiat entdeckt" (in der konkurrierenden Rubrik Archivrecht")
http://archiv.twoday.net/stories/14638009/ (16. Februar 2011)
steht mit gut 36.000 Zugriffen auf Platz 8 der Bestenliste "Mostread" von Archivalia. Er war ist meines Wissens auch der erste und bisher einzige Beitrag von Archivalia, der in SPIEGEL ONLINE verlinkt wurde:
http://archiv.twoday.net/stories/14639502/
Das dem Originalbeitrag jetzt hinzugefügte Bild zeigt Frau Streisand, vor allem populär durch den Streisand-Effekt ...
Alle Türchen: #bestof
***
Eigentlich sollte ich schon in Prag auf Dienstreise sein (VdA 8), aber da mein Flieger annulliert ist, muss ich später fliegen und kann noch kurz vermelden, welches Einschreiben des Justiariats der FAZ (falsch adressiert an Professor Dr. Klaus Graf) mich erreichte. Da ich
http://archiv.twoday.net/stories/235550257/
die Formulierung "Schavan-Freundin Schmoll" verwendet habe und einen Hyperlink auf http://causaschavan.wordpress.com gesetzt hätte, wo u.a. die Vorwürfe erhoben würden, Schmoll sei die Lebensgefährtin von Schavan, soll ich künftig bei einer Vertragsstrafe von 5001 EUR die Veröffentlichung unterlassen "dass Frau Dr. Heike Schmoll die Freundin und/oder die Lebenshefährtin von Frau Annette Schavan sei".
Streisand lässt grüßen - bitte recht oft weiterverbreiten, dass die große FAZ einen kleinen Blogger in die Knie zwingen will!
Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass Schmoll von causaschavan als Lebensgeführtin angesprochen wurde und das bloße Setzen eines Links besagt auch nicht, dass ich mir alles zu eigen mache, was causaschavan behauptet. Ich habe lediglich die Lektüre empfohlen, da causaschavan besser unterrichte als die Journaille. Auch waren mir bis heute die Gerüchte, Schavan sei lesbisch, unbekannt. Die Deutung "Freundin" beziehe sich auf eine sexuelle Beziehung, ist offenkundig völlig fernliegend, da die naheliegende Deutung im Sinne von "politische Freundin", "persönliche Freundin ohne sexuellen Hintergrund","Spezi", "Kumpel" absolut naheliegt. Was Frau Schavan in ihrer Freizeit und in ihrem Liebesleben macht, interessiert mich nicht. Ich habe keine Tatsachenbehauptung und schon gar keine üble Nachrede getätigt, als ich Schmoll-Freundin schrieb. Aufgrund der auffälligen Verteidigung von Schavan durch Schmoll war die Wertung, dass Schmoll eine freundschaftliche Beziehung (im Sinne von: Journalisten pflegen Freundschaften zu Politikern) zu Schavan unterhielte, naheliegend. Ich habe nie behauptet, dass Schmoll die Lebensgefährtin von Schavan sei und werde dies auch nicht tun, zumal dies in Abrede gestellt wird. Aber die Formulierung Schmoll-Freundin lasse ich mir nicht verbieten, da sie ganz harmlos a) gemeint war und b) von jedem billig und aufrecht Denkenden zu verstehen ist!
Update: http://archiv.twoday.net/stories/326204812/

KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 00:43 - Rubrik: Unterhaltung
http://www.hurriyet.com.tr/kultur-sanat/25310113.asp (tr)
"The library sold 147 tons of books to a junk company at a price of 7 to 25 cents a kg. Most of them were antiquarian titles and serial in Armenian, Greek and Karamanlica (Turkish using Greek alphabet). The reason is that the TNL does not have staff who can read Armenian, Greek, Hebrew, Judeospanish or Assyrian." (Rifat Bali, EXLIBRIS)
"The library sold 147 tons of books to a junk company at a price of 7 to 25 cents a kg. Most of them were antiquarian titles and serial in Armenian, Greek and Karamanlica (Turkish using Greek alphabet). The reason is that the TNL does not have staff who can read Armenian, Greek, Hebrew, Judeospanish or Assyrian." (Rifat Bali, EXLIBRIS)
KlausGraf - am Mittwoch, 11. Dezember 2013, 21:20 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"[D]ie Universität Bielefeld hat als erste deutsche Hochschule in einer durch das Rektorat beschlossenen Resolution konkrete Maßnahmen für den qualitätsbewussten Zugang zu Forschungsdaten verabschiedet. Im Sinne der Grundsätze zu Forschungsdaten an der Universität Bielefeld vom 19. Juli 2011 heißt es:
1) Das Rektorat ruft alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf, bereits im Vorfeld von Drittmittelvorhaben, die einen Data Management Plan erfordern (z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft), Beratungsleistungen der Hochschule in Anspruch zu nehmen.
2) Das Rektorat ermutigt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Forschungsdaten über registrierte disziplinäre Forschungsdaten-Archive, oder, wenn nicht vorhanden, über das Forschungsdaten-Archiv der Universität Bielefeld zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll personen- und unternehmensbezogene Interessen berücksichtigen und unter verbindlichen Lizenzbedingungen erfolgen.
Im gleichen Zuge hat die Universitätsbibliothek ihre Dienste für die Online-Erstellung von Data-Management-Plänen freigeschaltet und ermöglicht die Veröffentlichung von Forschungsdaten im Rahmen ihrer integrierten Repositorienstrategie. Verzeichnisse wie das DFG geförderte "Registry of Research Data Repositories (re3data.org)" bilden die Grundlage für die Suche nach geeigneten, disziplinären Publikationsorten für die Forschungsdaten.
"Die Bibliothek hat einen in Deutschland einmaligen Service aufgebaut." betont Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Transfer. "Wir fordern die Forschenden der Universität Bielefeld nicht nur auf, ihre Daten frei zugänglich zu machen, sondern bieten ihnen dafür Beratung, Service und Infrastruktur. Damit stellen wir uns bereits heute so auf, wie es die Hochschulpolitik von den Hochschulen in Zukunft fordern wird."
Resolution:
http://data.uni-bielefeld.de/de/resolution
Überblick über die Services:
http://data.uni-bielefeld.de/de/news/neue-services-rund-um-forschungsdaten-gehen-live
Stimmen aus der Universität:
http://data.uni-bielefeld.de/de/stimmen " (INETBIB u.a.)
1) Das Rektorat ruft alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf, bereits im Vorfeld von Drittmittelvorhaben, die einen Data Management Plan erfordern (z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft), Beratungsleistungen der Hochschule in Anspruch zu nehmen.
2) Das Rektorat ermutigt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Forschungsdaten über registrierte disziplinäre Forschungsdaten-Archive, oder, wenn nicht vorhanden, über das Forschungsdaten-Archiv der Universität Bielefeld zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll personen- und unternehmensbezogene Interessen berücksichtigen und unter verbindlichen Lizenzbedingungen erfolgen.
Im gleichen Zuge hat die Universitätsbibliothek ihre Dienste für die Online-Erstellung von Data-Management-Plänen freigeschaltet und ermöglicht die Veröffentlichung von Forschungsdaten im Rahmen ihrer integrierten Repositorienstrategie. Verzeichnisse wie das DFG geförderte "Registry of Research Data Repositories (re3data.org)" bilden die Grundlage für die Suche nach geeigneten, disziplinären Publikationsorten für die Forschungsdaten.
"Die Bibliothek hat einen in Deutschland einmaligen Service aufgebaut." betont Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Transfer. "Wir fordern die Forschenden der Universität Bielefeld nicht nur auf, ihre Daten frei zugänglich zu machen, sondern bieten ihnen dafür Beratung, Service und Infrastruktur. Damit stellen wir uns bereits heute so auf, wie es die Hochschulpolitik von den Hochschulen in Zukunft fordern wird."
Resolution:
http://data.uni-bielefeld.de/de/resolution
Überblick über die Services:
http://data.uni-bielefeld.de/de/news/neue-services-rund-um-forschungsdaten-gehen-live
Stimmen aus der Universität:
http://data.uni-bielefeld.de/de/stimmen " (INETBIB u.a.)
KlausGraf - am Mittwoch, 11. Dezember 2013, 21:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Wolfratshausen streitet man sich um den Stadtarchiv-Neubau.
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/debatte-ueber-das-stadtarchiv-keiner-der-beiden-entwuerfe-ueberzeugt-1.1841639
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/debatte-ueber-das-stadtarchiv-keiner-der-beiden-entwuerfe-ueberzeugt-1.1841639
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Müsste man eigentlich bald wieder an pöbelnden Rechtsanwälten am Wochenende merken ...
Es lag wohl an einem Sonderzeichen in einem Twitter-Einbettungscode ...
Es lag wohl an einem Sonderzeichen in einem Twitter-Einbettungscode ...
KlausGraf - am Mittwoch, 11. Dezember 2013, 13:42 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Was ist denn in Stade mit kirchlichem Archivgut los? Stadtarchäologe Andreas Schäfer drückt einem Mitarbeiter "einen Stapel bisher noch nicht gesichteter geheimnisvoller Kirchenakten in die Hand." Erst kürzlich seien sie "auf einem Kirchenboden gefunden" worden, heißt es im Spiegel-Blog einer Hamburger Archäologin:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/archaeologie-glasfund-in-stade-zeugnis-eines-blutigen-rituals-a-937936.html
Nach der in den Papieren beschriebenen Enthauptung einer Kindesmörderin 1856 haben sechs epileptische Kranke deren Blut aus Gläsern getrunken. Von denen soll eines gefunden worden sein, das genau von dieser Hinrichtung stamme, und auch nicht etwa von einem der vielen Zuschauer oder gar der wartenden Kutscher, obwohl es sich doch um ein "Kutscherglas" handeln soll – alles egal. Aus den geheimnisvollen Kirchenakten geht zudem offenbar nicht hervor, dass, wie behauptet, die Kirche an diesem Blutstrank ordentlich verdient hat.
Aufgebracht hat die Geschichte der Schriftsteller Dietrich Alsdorf, der auf nicht genauer erfahrbare Weise mit der Stader "Kreisarchäologie" verbandelt ist:
https://nds.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Alsdorf
Alsdorf hat das Glas selbst gefunden und früher im Stader Ausstellungsort Schwedenspeicher gearbeitet, der nun genau das Glas ausstellt. Und Alsdorf will die Blut-und-Boden-Geschichte in seinem nächsten historischen Roman verarbeiten. Er richtet damit ein heilloses Durcheinander an, aber Scherben sind bekanntlich das Glück der Archäologen.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/archaeologie-glasfund-in-stade-zeugnis-eines-blutigen-rituals-a-937936.html
Nach der in den Papieren beschriebenen Enthauptung einer Kindesmörderin 1856 haben sechs epileptische Kranke deren Blut aus Gläsern getrunken. Von denen soll eines gefunden worden sein, das genau von dieser Hinrichtung stamme, und auch nicht etwa von einem der vielen Zuschauer oder gar der wartenden Kutscher, obwohl es sich doch um ein "Kutscherglas" handeln soll – alles egal. Aus den geheimnisvollen Kirchenakten geht zudem offenbar nicht hervor, dass, wie behauptet, die Kirche an diesem Blutstrank ordentlich verdient hat.
Aufgebracht hat die Geschichte der Schriftsteller Dietrich Alsdorf, der auf nicht genauer erfahrbare Weise mit der Stader "Kreisarchäologie" verbandelt ist:
https://nds.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Alsdorf
Alsdorf hat das Glas selbst gefunden und früher im Stader Ausstellungsort Schwedenspeicher gearbeitet, der nun genau das Glas ausstellt. Und Alsdorf will die Blut-und-Boden-Geschichte in seinem nächsten historischen Roman verarbeiten. Er richtet damit ein heilloses Durcheinander an, aber Scherben sind bekanntlich das Glück der Archäologen.
Dietmar Bartz - am Mittwoch, 11. Dezember 2013, 10:16
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Maria Rottler schlug meinen Beitrag vom 22. März 2013 vor:
http://archiv.twoday.net/stories/326525839/
Hier nicht aktualisiert, aber mit zwei Bildern versehen. Auf die Kommentare zum Originalbeitrag sei ausdrücklich verwiesen.
Alle Türchen: #bestof
***
Auf der Prager Frühjahrstagung der VdA-Fachgruppe 8, der ich ja seit 1989 angehöre, hatte ich die GND (ehemals PND) mehrfach erwähnt und versprochen, hier über sie zu informieren.
Frühere Beiträge in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=gnd
http://archiv.twoday.net/search?q=pnd
Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON
Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.
Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:
http://d-nb.info/gnd/118635646
Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.
Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm
Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm
Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold
Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880
Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646
verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:
http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/
Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive
geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646
Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.
Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.
Alles klar?
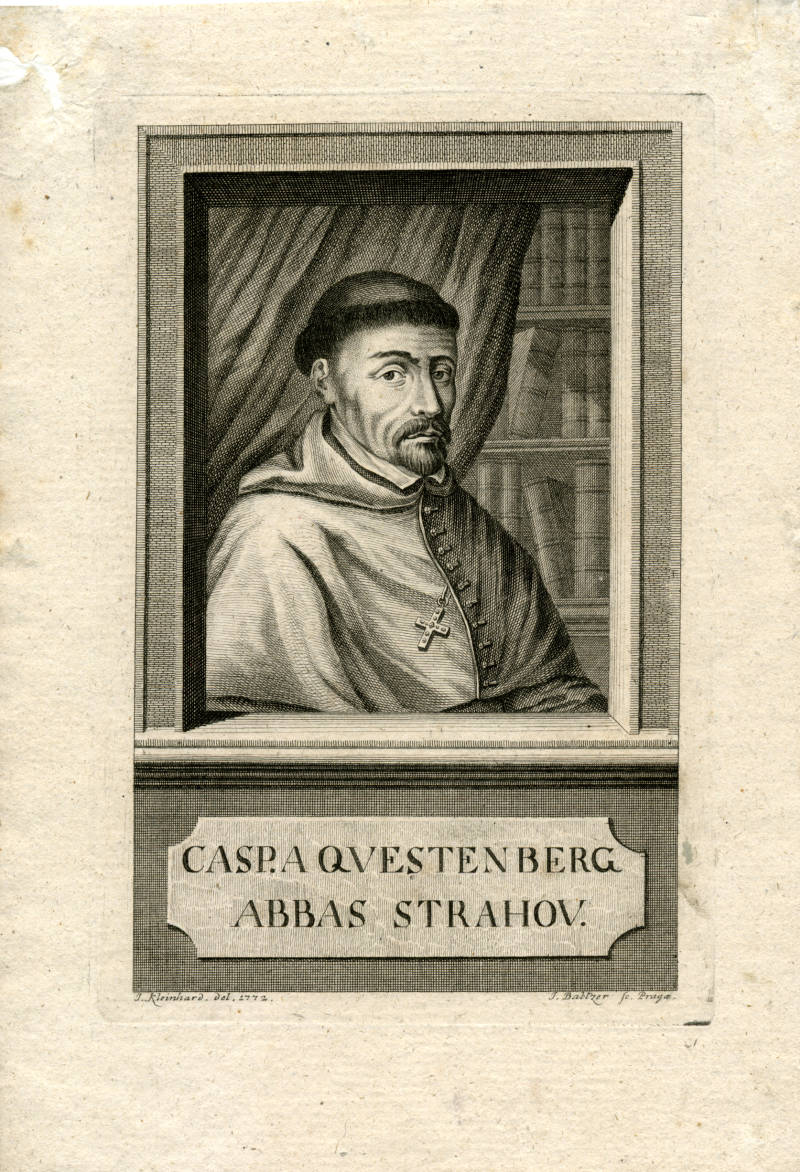 Abt Kaspar von Questenberg (GND 104236752) des Klosters Strahov in Prag. Unten: Screenshot von
Abt Kaspar von Questenberg (GND 104236752) des Klosters Strahov in Prag. Unten: Screenshot von
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=104236752
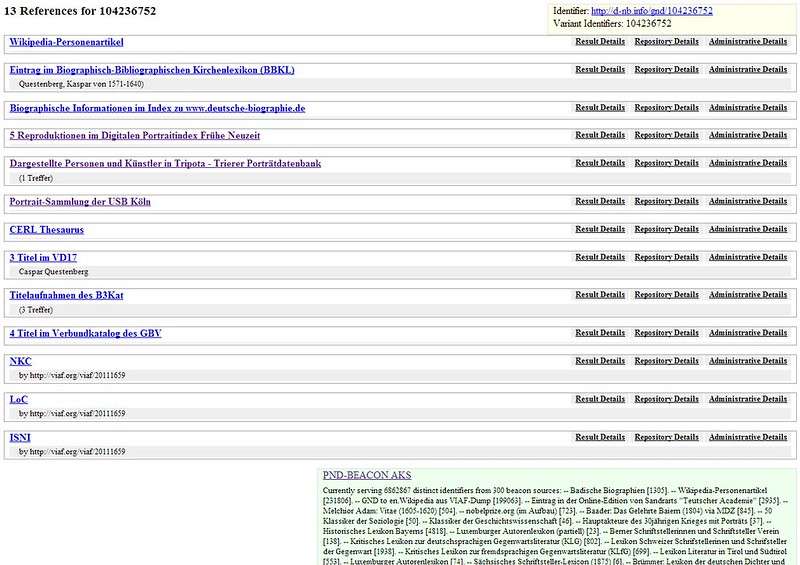
http://archiv.twoday.net/stories/326525839/
Hier nicht aktualisiert, aber mit zwei Bildern versehen. Auf die Kommentare zum Originalbeitrag sei ausdrücklich verwiesen.
Alle Türchen: #bestof
***
Auf der Prager Frühjahrstagung der VdA-Fachgruppe 8, der ich ja seit 1989 angehöre, hatte ich die GND (ehemals PND) mehrfach erwähnt und versprochen, hier über sie zu informieren.
Frühere Beiträge in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=gnd
http://archiv.twoday.net/search?q=pnd
Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON
Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.
Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:
http://d-nb.info/gnd/118635646
Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.
Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm
Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm
Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold
Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880
Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646
verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:
http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/
Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive
geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646
Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.
Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.
Alles klar?
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=104236752
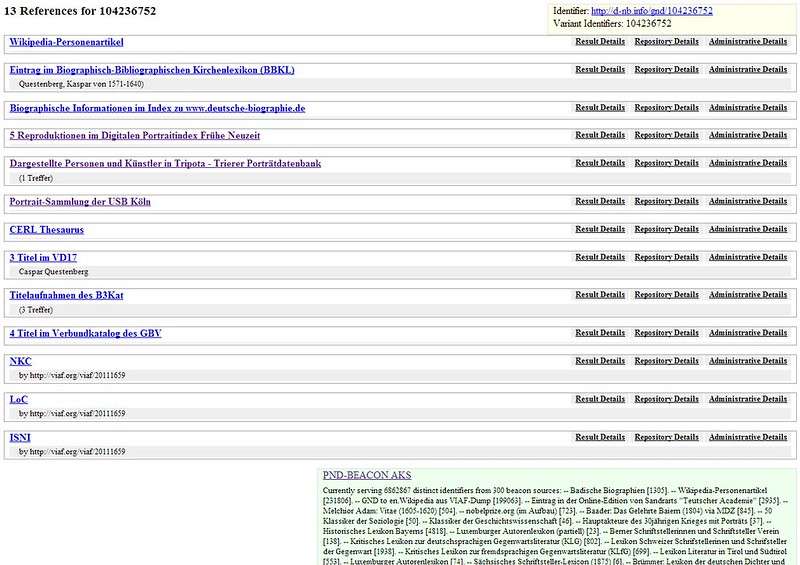
KlausGraf - am Mittwoch, 11. Dezember 2013, 00:03 - Rubrik: Unterhaltung
Matthias Meiler schrieb dazu einen Aufsatz in einer linguistischen Zeitschrift:
http://dx.doi.org/10.1515/zfal-2013-0013
De Gruyter verlangt 30 Teuro für den Text. Eine Frechheit ist die Formulierung auf
http://metablock.hypotheses.org/337
‘Access‘ zum digitalen Volltext leider nicht vollständig ‘open’.
http://dx.doi.org/10.1515/zfal-2013-0013
De Gruyter verlangt 30 Teuro für den Text. Eine Frechheit ist die Formulierung auf
http://metablock.hypotheses.org/337
‘Access‘ zum digitalen Volltext leider nicht vollständig ‘open’.
Eingangsüberlegungen von Claudine Moulin zu einer Wolfenbütteler Tagung. Kaum Neues, viel Blabla.
http://annotatio.hypotheses.org/353
http://annotatio.hypotheses.org/353
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 21:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ueberwachung-562-schriftsteller-protestieren-gegen-nsa-a-938156.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/autoren-gegen-ueberwachung/demokratie-im-digitalen-zeitalter-der-aufruf-der-schriftsteller-12702040.html
Eine Kernaussage:
"Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei; und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr. Deshalb müssen unsere demokratischen Grundrechte in der virtuellen Welt ebenso durchgesetzt werden wie in der realen."
Man kann sich anschließen unter:
http://www.change.org/petitions/die-demokratie-verteidigen-im-digitalen-zeitalter
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/autoren-gegen-ueberwachung/demokratie-im-digitalen-zeitalter-der-aufruf-der-schriftsteller-12702040.html
Eine Kernaussage:
"Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei; und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr. Deshalb müssen unsere demokratischen Grundrechte in der virtuellen Welt ebenso durchgesetzt werden wie in der realen."
Man kann sich anschließen unter:
http://www.change.org/petitions/die-demokratie-verteidigen-im-digitalen-zeitalter
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 21:39 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rechtambild.de/2013/06/14-000-e-fur-die-nichtnennung-des-urhebers/
http://www.lhr-law.de/magazin/urheberrecht/lhr-erzielt-rekordsumme-fur-mandanten-fotograf-erhalt-14-000-e-schadensersatz-wegen-nichtnennung-als-urheber
" Es handelte sich um ein hochwertiges Lichtbildwerk, auf dem eine Sehenswürdigkeit abgebildet war. Der Betrag bezog sich auf mehrere Veröffentlichungen in Pressemitteilungen an verschiedensten Stellen im Internet und in Katalogen über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren. Er entspricht daher nicht dem Fall, bei dem ein Lichtbild lediglich an einer Stelle und über einen kurzen Zeitraum verwendet wird. "
Via
http://www.fr-online.de/recht/-creative-commons-so-darf-man-fotos-und-co-teilen,21157310,24333396.html
Zur lizenzgerechten Nutzung siehe
http://archiv.twoday.net/stories/219051498/
"Nicht nur die Printpresse hat immer wieder Probleme damit zu begreifen, dass Bilder aus der Wikipedia & Co. (wobei & Co. insbesondere für den Bilderschatz auf Wikimedia Commons steht) nicht nach eigenem Gutdünken frei genutzt werden können. Man muss sich dabei sehr wohl an bestimmte Regeln halten. Im Wesentlichen sind es zwei sehr einfache Grundregeln bei Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen):
1. Nenne den Namen (oder das Pseudonym) des Fotografen!
2. Verlinke die maßgebliche Lizenz!"
Nochmals am Beispiel eines der Sieger des Wettbewerbs Wiki loves Monuments 2013, wobei wieder unkritische Postkartenansichten als Sieger ausgewählt wurden.
 Foto: Thaler https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Foto: Thaler https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Aus der Seite
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r4.JPG
entnimmt man:
1. Es gibt keine besonderen Forderungen (z.B. Verlinkung einer Seite), die im Rahmen der CC-BY-SA-Lizenz zu beachten wären
2. Der Name oder das Pseudonym des Fotografen ist Thaler (wenn er sich Moppelhoppel nennen würde, wäre das ebenso anzugeben).
3. Der Lizenzlink ist
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
4. Die Quelle zu verlinken ist sinnvoll, aber in diesem Fall nicht zwingend:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r4.JPG
Bei Online-Publikationen sollten die Angaben am Bild oder in nächster Nähe stehen. Das ist auch eine Anerkennung für den Fotografen. Natürlich sollte man, wenn mans hübscher oder kürzer schätzt, den Link unter CC-BY-SA verstecken
Bei gedruckten Publikationen stehen die Angaben (mit Abdruck der URL der Lizenzadresse
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en ) im üblichen Bildnachweis (z.B. am Ende eines Buchs oder klein neben einem Foto in einer Zeitung).
http://www.lhr-law.de/magazin/urheberrecht/lhr-erzielt-rekordsumme-fur-mandanten-fotograf-erhalt-14-000-e-schadensersatz-wegen-nichtnennung-als-urheber
" Es handelte sich um ein hochwertiges Lichtbildwerk, auf dem eine Sehenswürdigkeit abgebildet war. Der Betrag bezog sich auf mehrere Veröffentlichungen in Pressemitteilungen an verschiedensten Stellen im Internet und in Katalogen über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren. Er entspricht daher nicht dem Fall, bei dem ein Lichtbild lediglich an einer Stelle und über einen kurzen Zeitraum verwendet wird. "
Via
http://www.fr-online.de/recht/-creative-commons-so-darf-man-fotos-und-co-teilen,21157310,24333396.html
Zur lizenzgerechten Nutzung siehe
http://archiv.twoday.net/stories/219051498/
"Nicht nur die Printpresse hat immer wieder Probleme damit zu begreifen, dass Bilder aus der Wikipedia & Co. (wobei & Co. insbesondere für den Bilderschatz auf Wikimedia Commons steht) nicht nach eigenem Gutdünken frei genutzt werden können. Man muss sich dabei sehr wohl an bestimmte Regeln halten. Im Wesentlichen sind es zwei sehr einfache Grundregeln bei Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen):
1. Nenne den Namen (oder das Pseudonym) des Fotografen!
2. Verlinke die maßgebliche Lizenz!"
Nochmals am Beispiel eines der Sieger des Wettbewerbs Wiki loves Monuments 2013, wobei wieder unkritische Postkartenansichten als Sieger ausgewählt wurden.
 Foto: Thaler https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Foto: Thaler https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.enAus der Seite
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r4.JPG
entnimmt man:
1. Es gibt keine besonderen Forderungen (z.B. Verlinkung einer Seite), die im Rahmen der CC-BY-SA-Lizenz zu beachten wären
2. Der Name oder das Pseudonym des Fotografen ist Thaler (wenn er sich Moppelhoppel nennen würde, wäre das ebenso anzugeben).
3. Der Lizenzlink ist
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
4. Die Quelle zu verlinken ist sinnvoll, aber in diesem Fall nicht zwingend:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r4.JPG
Bei Online-Publikationen sollten die Angaben am Bild oder in nächster Nähe stehen. Das ist auch eine Anerkennung für den Fotografen. Natürlich sollte man, wenn mans hübscher oder kürzer schätzt, den Link unter CC-BY-SA verstecken
Bei gedruckten Publikationen stehen die Angaben (mit Abdruck der URL der Lizenzadresse
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en ) im üblichen Bildnachweis (z.B. am Ende eines Buchs oder klein neben einem Foto in einer Zeitung).
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 21:13 - Rubrik: Archivrecht
https://www.facebook.com/HistBav/posts/185471508321980 (Florian Sepp)
"Jeder Historiker kennt die AHF - die "Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V", die das Jahrbuch der Historischen Forschung und die Historische Bibliographie erstellt.
Einer Infomail der AHF war nun zu entnehmen, dass die AHF zum 31. Dezember 2013 aufgelöst wird. Die Historische Bibliographie Online (die die Beiträge des Jahrbuchs und der Bibliographie enthält) werde ab 1. Januar 2014 in neuer Trägerschaft betrieben, allerdings sei noch unklar, in welcher."
"Jeder Historiker kennt die AHF - die "Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V", die das Jahrbuch der Historischen Forschung und die Historische Bibliographie erstellt.
Einer Infomail der AHF war nun zu entnehmen, dass die AHF zum 31. Dezember 2013 aufgelöst wird. Die Historische Bibliographie Online (die die Beiträge des Jahrbuchs und der Bibliographie enthält) werde ab 1. Januar 2014 in neuer Trägerschaft betrieben, allerdings sei noch unklar, in welcher."
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 20:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"Die Universitätsbibliothek Salzburg verwahrt in ihren Sondersammlungen einen Bestand von mehr als 1100 Handschriften, die in drei (Teil-)Katalogen beschrieben sind. Der 1946 beendete, handgeschriebene Katalog von E. Frisch wurde nun digitalisiert und ist neben dem Katalog der deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg (A. Jungreithmayr, 1988) und dem im Aufbau begriffenen Katalog der lateinischen Handschriften des Mittelalters (B. Koll) auf der Webseite der Sondersammlungen abrufbar:
Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg
Zu den drei nach Format und Numerus Currens geordneten Listen gibt es außerdem ein alphabetisches Register zum Handschriftenkatalog von E. Frisch."
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=30102
Fau Knoll ist arm dran:
" Für das Jahr 2014 ist die Installation eines Medienservers geplant, der es erlaubt, die bereits digital vorhandenen Handschriften mitsamt ihren Beschreibungen kostenlos (open access) anzubieten.
Auf dem Webserver der Universitätsbibliothek Salzburg sind aus Platzgründen derzeit lediglich fünf digitalisierte Handschriften verfügbar".
Im Vöbblog hätte ruhig auch ausdrücklich vermeldet werden können, dass der Katalog der deutschen Handschriften von Jungreithmayr jetzt Open Access einsehbar ist:
http://epub.oeaw.ac.at/1371-4
Wichtig ist der jetzige Katalog vor allem für die Handschriften des 16.-19. Jahrhunderts. Am einfachsten verwendet man das Register zur Durchsicht:
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/frisch.htm
#fnzhss

Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg
Zu den drei nach Format und Numerus Currens geordneten Listen gibt es außerdem ein alphabetisches Register zum Handschriftenkatalog von E. Frisch."
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=30102
Fau Knoll ist arm dran:
" Für das Jahr 2014 ist die Installation eines Medienservers geplant, der es erlaubt, die bereits digital vorhandenen Handschriften mitsamt ihren Beschreibungen kostenlos (open access) anzubieten.
Auf dem Webserver der Universitätsbibliothek Salzburg sind aus Platzgründen derzeit lediglich fünf digitalisierte Handschriften verfügbar".
Im Vöbblog hätte ruhig auch ausdrücklich vermeldet werden können, dass der Katalog der deutschen Handschriften von Jungreithmayr jetzt Open Access einsehbar ist:
http://epub.oeaw.ac.at/1371-4
Wichtig ist der jetzige Katalog vor allem für die Handschriften des 16.-19. Jahrhunderts. Am einfachsten verwendet man das Register zur Durchsicht:
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/frisch.htm
#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 19:37 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Offener Brief an
Kulturstaatsminister Bernd Neumann,
den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Volker Kauder,
den Vorsitzenden der SPD‐Bundestagsfraktion, Dr. Frank‐Walter Steinmeier,
die Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer bei den Koalitionsverhandlungen
der Arbeitsgruppe Kultur und Medien, Klaus Wowereit und Michael Kretschmer,
der Arbeitsgruppe Finanzen, Haushalt, Finanzbeziehungen Bund‐Länder, Olaf Scholz und Dr.
Wolfgang Schäuble,
der Arbeitsgruppe Wissenschaft, Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka und Doris Ahnen
....
Die Bundesstiftung Aufarbeitung fördert seit ihrem Bestehen zahlreiche Projekte von Opferverbänden, Aufarbeitungsinitiativen und Archiven der DDR‐Opposition, die mit ihrer wichtigen
Arbeit einen unverzichtbaren Beitrag bei der Aufklärung über die kommunistische Diktatur leisten. Mit der Bundesstiftung Aufarbeitung wurde eine Einrichtung mit einem umfassenden Auftrag geschaffen, um in der Gesellschaft in großer Breite zur Aufklärung über die kommunistische Diktatur, zur Erinnerung an die Folgen der Diktatur und zum Gedenken an die Opfer beizutragen. Die Stiftung ist tätig in den Bereichen der dezentralen Projektförderung, der Förderung politischer Bildungsarbeit, der Förderung von Forschungsvorhaben; sie unterstützt Museen und Gedenkstätten in ihrer Kommunikation und Kooperation und trägt zur Vernetzung und Professionalisierung zivilgesellschaftlicher Initiativen und von Projektarbeit bei.
Im Bereich der politischen Bildung und der gesellschaftlichen Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur hat sich erfreulicherweise ein Netz von Initiativen, Dokumentationszentren, Foren und Archiven entwickelt. Viele von ihnen erhalten Unterstützung durch die Bundesstiftung Aufarbeitung. Diese Arbeit muss erhalten bleiben.
Die finanzielle Förderung solcher Projekte und damit die Arbeit der genannten Initiativen sind im 25. Jahr der Friedlichen Revolution in Gefahr. Von den jährlichen 2,8 Millionen Euro durch die Bundesstiftung zu vergebenden Fördermitteln fehlen für die Projekte im Jahr 2014 etwa 1,5 Millionen Euro, bedingt durch die schlechte Zinsentwicklung. Damit können wichtige Projekte, vor
allem dezentraler Initiativen, deren wichtige oder einzige Geldgeberin die Bundesstiftung ist, nicht mehr durchgeführt werden.
Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, dass der von der Bundesstiftung Aufarbeitung unverschuldete Mittelausfall vom Bund ausgeglichen wird. Die Bundesregierung wird beweisen müssen, dass sie der Aufarbeitung des Kommunismus weiterhin die gebührende Aufmerksamkeit widmet.
5. November 2013
Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V.
Bautzen‐Komitee e. V.
Bürgerkomitee Leipzig e. V., Träger der Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" mit dem
Museum im Stasi‐Bunker
Bürgerkomitee Sachsen‐Anhalt e. V. Magdeburg
Cottbuser Häftlingsgemeinschaft
Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Kommunismus / Stalinismus e. V.
Geschichtswerkstatt Jena e. V.
Gruppe der "Kinder aus den Lagern und Gefängnissen der SBZ/DDR"
Initiativgruppe Buchenwald 1945‐1950 e. V.
Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V.
Initiativgruppe Internierungslager Ketschendorf/Speziallager Nr. 5 e. V.
Initiativgruppe Lager Mühlberg e. V.
Kreisau‐Initiative e. V.
Martin‐Luther‐King‐Zentrum Werdau
MEMORIAL Deutschland e. V.
Menschenrechtszentrum Cottbus e. V.
PRORA‐ZENTRUM e. V.
Robert‐Havemann‐Gesellschaft e. V.
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Thüringer Archiv für Zeitgeschichte "Matthias Domaschk"
Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V.
Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft
Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e. V.
VOS‐ Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. ‐ Gemeinschaft von Verfolgten und Gegnern des
Kommunismus
Zeit‐Geschichte(n) e. V. ‐ Verein für erlebte Geschichte Halle"
Link
Kulturstaatsminister Bernd Neumann,
den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Volker Kauder,
den Vorsitzenden der SPD‐Bundestagsfraktion, Dr. Frank‐Walter Steinmeier,
die Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer bei den Koalitionsverhandlungen
der Arbeitsgruppe Kultur und Medien, Klaus Wowereit und Michael Kretschmer,
der Arbeitsgruppe Finanzen, Haushalt, Finanzbeziehungen Bund‐Länder, Olaf Scholz und Dr.
Wolfgang Schäuble,
der Arbeitsgruppe Wissenschaft, Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka und Doris Ahnen
....
Die Bundesstiftung Aufarbeitung fördert seit ihrem Bestehen zahlreiche Projekte von Opferverbänden, Aufarbeitungsinitiativen und Archiven der DDR‐Opposition, die mit ihrer wichtigen
Arbeit einen unverzichtbaren Beitrag bei der Aufklärung über die kommunistische Diktatur leisten. Mit der Bundesstiftung Aufarbeitung wurde eine Einrichtung mit einem umfassenden Auftrag geschaffen, um in der Gesellschaft in großer Breite zur Aufklärung über die kommunistische Diktatur, zur Erinnerung an die Folgen der Diktatur und zum Gedenken an die Opfer beizutragen. Die Stiftung ist tätig in den Bereichen der dezentralen Projektförderung, der Förderung politischer Bildungsarbeit, der Förderung von Forschungsvorhaben; sie unterstützt Museen und Gedenkstätten in ihrer Kommunikation und Kooperation und trägt zur Vernetzung und Professionalisierung zivilgesellschaftlicher Initiativen und von Projektarbeit bei.
Im Bereich der politischen Bildung und der gesellschaftlichen Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur hat sich erfreulicherweise ein Netz von Initiativen, Dokumentationszentren, Foren und Archiven entwickelt. Viele von ihnen erhalten Unterstützung durch die Bundesstiftung Aufarbeitung. Diese Arbeit muss erhalten bleiben.
Die finanzielle Förderung solcher Projekte und damit die Arbeit der genannten Initiativen sind im 25. Jahr der Friedlichen Revolution in Gefahr. Von den jährlichen 2,8 Millionen Euro durch die Bundesstiftung zu vergebenden Fördermitteln fehlen für die Projekte im Jahr 2014 etwa 1,5 Millionen Euro, bedingt durch die schlechte Zinsentwicklung. Damit können wichtige Projekte, vor
allem dezentraler Initiativen, deren wichtige oder einzige Geldgeberin die Bundesstiftung ist, nicht mehr durchgeführt werden.
Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, dass der von der Bundesstiftung Aufarbeitung unverschuldete Mittelausfall vom Bund ausgeglichen wird. Die Bundesregierung wird beweisen müssen, dass sie der Aufarbeitung des Kommunismus weiterhin die gebührende Aufmerksamkeit widmet.
5. November 2013
Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V.
Bautzen‐Komitee e. V.
Bürgerkomitee Leipzig e. V., Träger der Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" mit dem
Museum im Stasi‐Bunker
Bürgerkomitee Sachsen‐Anhalt e. V. Magdeburg
Cottbuser Häftlingsgemeinschaft
Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Kommunismus / Stalinismus e. V.
Geschichtswerkstatt Jena e. V.
Gruppe der "Kinder aus den Lagern und Gefängnissen der SBZ/DDR"
Initiativgruppe Buchenwald 1945‐1950 e. V.
Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V.
Initiativgruppe Internierungslager Ketschendorf/Speziallager Nr. 5 e. V.
Initiativgruppe Lager Mühlberg e. V.
Kreisau‐Initiative e. V.
Martin‐Luther‐King‐Zentrum Werdau
MEMORIAL Deutschland e. V.
Menschenrechtszentrum Cottbus e. V.
PRORA‐ZENTRUM e. V.
Robert‐Havemann‐Gesellschaft e. V.
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Thüringer Archiv für Zeitgeschichte "Matthias Domaschk"
Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V.
Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft
Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e. V.
VOS‐ Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V. ‐ Gemeinschaft von Verfolgten und Gegnern des
Kommunismus
Zeit‐Geschichte(n) e. V. ‐ Verein für erlebte Geschichte Halle"
Link
Wolf Thomas - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 17:16 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Land NRW fördert Projekt der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule OWL
"Mit insgesamt 59.000 Euro unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen ein Projekt der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule OWL: Die Zuwendung des Wissenschaftsministeriums ist für den Aufbau eines digitalen Musikarchivs bestimmt. Es soll den besseren Zugriff auf die Sammlung von historischen Konzertmitschnitten ermöglichen. Zudem werden damit alte Tondokumente vor dem Verfall geschützt. Zuständig ist das gemeinsame Zentrum für Musik- und Filminformatik.
Die Hochschule für Musik veranstaltet seit ihrer Gründung 1946 regelmäßig Konzerte. Ein Großteil dieser Musikveranstaltungen wird vom hauseigenen Erich-Thienhaus-Institut (ETI) mitgeschnitten. „Diese Aufnahmen entsprechen höchsten professionellen Ansprüchen hinsichtlich technischer und künstlerischer Qualität“, erklärt Projektleiter Aristotelis Hadjakos, der seit April dieses Jahres die Stiftungsprofessur an der Hochschule für Musik Detmold innehat.
Die Sammlung enthält nicht nur wertvolle Mitschnitte von renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland, sondern deckt auch einen bedeutenden Teil der Geschichte der Aufnahmetechnik ab. Auch experimentelle Aufnahmen sind vorhanden: Zum Beispiel wurden einige musikalische Aufführungen mit verschiedenen Verfahren aufgenommen. „So hat sich über die Jahre eine stilistisch-künstlerisch reichhaltige und umfangreiche Sammlung an Tondokumenten gebildet“, sagt Hadjakos.
Musikerinnen und Musiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende nutzen das Archiv regelmäßig. Ein gezielter Zugriff ist jedoch wegen der uneinheitlichen Struktur zurzeit nur mit erheblichem Aufwand möglich. „Hier setzt unsere Arbeit an“, erklärt Malte Kob, Professor für Theorie der Musikübertragung am Erich-Thienhaus-Institut der Hochschule für Musik Detmold. Im Rahmen des Projektes werden die Konzertmitschnitte aus den Jahren 1948 bis 1958 digitalisiert. „Langfristig ist beabsichtigt, die gesamte Sammlung ins neue Archiv zu überführen“, kündigt Kob an.
Die Arbeit erfolgt in vier Schritten: Auf dem Weg zum digitalen Musikarchiv muss die Expertengruppe zunächst die erforderliche Infrastruktur aufbauen, dann die Archivstruktur entwickeln und programmieren. „Abschließend richten wir eine Schnittstelle für die Nutzer ein, mit der vielfältige Aufrufe und Auswertungen des digitalisierten Materials möglich sein werden“, erläutert Professor Steffen Bock vom Fachbereich Medienproduktion der Hochschule OWL, der neben Professor Hadjakos Leiter des Zentrums für Musik- und Filminformatik ist.
Der Zugriff auf das technisch und künstlerisch vielfältige Material erlaubt zusätzliche Grundlagen für musikwissenschaftliche Arbeiten, etwa in Bereichen wie Interpretationsforschung oder Geschichte der Aufnahmetechnik. Gleichzeitig sorgt die Modernisierung dafür, dass alte analoge Tondokumente vor dem Verfall geschützt werden. „Nicht zuletzt wird ein digitalisiertes Archiv den Einsatz des Tonmaterials bei Lehrveranstaltungen vereinfachen“, erklärt der ebenfalls beteiligte Professor Andreas Meyer von der Hochschule für Musik Detmold, der das Institut einst geleitet hat. „Damit ist es auch für die Studierenden von großem Nutzen.“
Quelle: Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 9.12.2013
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/528988086/
"Mit insgesamt 59.000 Euro unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen ein Projekt der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule OWL: Die Zuwendung des Wissenschaftsministeriums ist für den Aufbau eines digitalen Musikarchivs bestimmt. Es soll den besseren Zugriff auf die Sammlung von historischen Konzertmitschnitten ermöglichen. Zudem werden damit alte Tondokumente vor dem Verfall geschützt. Zuständig ist das gemeinsame Zentrum für Musik- und Filminformatik.
Die Hochschule für Musik veranstaltet seit ihrer Gründung 1946 regelmäßig Konzerte. Ein Großteil dieser Musikveranstaltungen wird vom hauseigenen Erich-Thienhaus-Institut (ETI) mitgeschnitten. „Diese Aufnahmen entsprechen höchsten professionellen Ansprüchen hinsichtlich technischer und künstlerischer Qualität“, erklärt Projektleiter Aristotelis Hadjakos, der seit April dieses Jahres die Stiftungsprofessur an der Hochschule für Musik Detmold innehat.
Die Sammlung enthält nicht nur wertvolle Mitschnitte von renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland, sondern deckt auch einen bedeutenden Teil der Geschichte der Aufnahmetechnik ab. Auch experimentelle Aufnahmen sind vorhanden: Zum Beispiel wurden einige musikalische Aufführungen mit verschiedenen Verfahren aufgenommen. „So hat sich über die Jahre eine stilistisch-künstlerisch reichhaltige und umfangreiche Sammlung an Tondokumenten gebildet“, sagt Hadjakos.
Musikerinnen und Musiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende nutzen das Archiv regelmäßig. Ein gezielter Zugriff ist jedoch wegen der uneinheitlichen Struktur zurzeit nur mit erheblichem Aufwand möglich. „Hier setzt unsere Arbeit an“, erklärt Malte Kob, Professor für Theorie der Musikübertragung am Erich-Thienhaus-Institut der Hochschule für Musik Detmold. Im Rahmen des Projektes werden die Konzertmitschnitte aus den Jahren 1948 bis 1958 digitalisiert. „Langfristig ist beabsichtigt, die gesamte Sammlung ins neue Archiv zu überführen“, kündigt Kob an.
Die Arbeit erfolgt in vier Schritten: Auf dem Weg zum digitalen Musikarchiv muss die Expertengruppe zunächst die erforderliche Infrastruktur aufbauen, dann die Archivstruktur entwickeln und programmieren. „Abschließend richten wir eine Schnittstelle für die Nutzer ein, mit der vielfältige Aufrufe und Auswertungen des digitalisierten Materials möglich sein werden“, erläutert Professor Steffen Bock vom Fachbereich Medienproduktion der Hochschule OWL, der neben Professor Hadjakos Leiter des Zentrums für Musik- und Filminformatik ist.
Der Zugriff auf das technisch und künstlerisch vielfältige Material erlaubt zusätzliche Grundlagen für musikwissenschaftliche Arbeiten, etwa in Bereichen wie Interpretationsforschung oder Geschichte der Aufnahmetechnik. Gleichzeitig sorgt die Modernisierung dafür, dass alte analoge Tondokumente vor dem Verfall geschützt werden. „Nicht zuletzt wird ein digitalisiertes Archiv den Einsatz des Tonmaterials bei Lehrveranstaltungen vereinfachen“, erklärt der ebenfalls beteiligte Professor Andreas Meyer von der Hochschule für Musik Detmold, der das Institut einst geleitet hat. „Damit ist es auch für die Studierenden von großem Nutzen.“
Quelle: Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 9.12.2013
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/528988086/
Wolf Thomas - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 14:48 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mareike König hat sich meinen Beitrag zur Pariser Tagung 2011 gewünscht, der hier am 23. Juni 2011 unter dem Titel "Archivalia im Netz der neuen Medien" erschien:
http://archiv.twoday.net/stories/29751181/
(Eine Streichung habe ich jetzt weggelassen. Links wurden nicht aktualisiert/überprüft.)
In der Diskussiuon des Vortrags bejahte ich die an mich gerichtete Frage, ob ein Wissenschaftler, der nicht blogge, ein schlechter Wissenschaftler sei.
Siehe dazu:
http://tantner.twoday.net/stories/42993509/
http://schmalenstroer.net/blog/2011/09/wissenschaft-bloggen-und-die-ffentlichkeit/
Die Illustration, das beliebte Bullshit-Bingo Web 2.0, wurde meinem Münchner Vortrag über Archivalia 2012 beigegeben:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/392
Erstmals hier am 2. Januar 2012 veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/64022797/
Alle Türchen: #bestof
***
http://dhiha.hypotheses.org/199
Es sind ja doch nicht alles Meistererzähler. Wissenschafts-Blogs bieten nicht nur die Chance zur eitlen Selbstdarstellung und meinungsstarken Abqualifizierung unliebsamer Positionen, sie könnten in einem Wissenschaftsbetrieb, der das gesunde Mittelmaß hinreichend goutiert, belebend wirken. Alte Handwerksbräuche wie das Miszellenwesen lohnen eine Revitalisierung, Raum wäre auch für Unfertiges und Fragmentarisches. Quellen und online vorliegende Literatur können sofort verlinkt werden. Ausgehend von Erfahrungen mit « Archivalia » und dem Weblog der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit soll begründet werden, dass Web 2.0-Anwender, die das Medium Blog zugunsten von Twitter und Facebook zu « überspringen » gedenken, die Möglichkeiten von Blogs unterschätzen.
Erster Hauptteil: Archivalia in Zahlen
* Archivalia steht im Juni 2011 auf Platz 3 der Wikio-Blogcharts im Bereich Wissenschaft und kann als das führende deutschsprachige Geschichtsblog gelten.
* Archivalia ist seit dem 5. Februar 2003 online, am 23. Juni waren es 3052 Tage.
* Es gibt insgesamt 19202 Beiträge (etwa 6/Tag) und 7794 Kommentare.
* Die Auswertung einer Woche im Juni am 23. Juni 2011 ergab, dass 117 Beiträge geschrieben wurde, also etwa 16 pro Tag.
* Archivalia ist von Anfang an ein Gemeinschaftsweblog. Von den genannten 117 aktuellen Beiträgen stammen 33 von dem Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf, drei von Rechtsanwalt vom Hofe in Madrid und weitere drei von je einem Stadtarchivar, einem anonymen regelmäßigen Beiträger und einem Archäologie-Wissenschaftsblogger.
* Archivalia hat schätzungsweise mehrere hundert Besucher pro Tag. Laut Google-Reader beziehen 374 Abonennten den RSS-Feed. Hinzu kommen 13, die nur die Rubrik Open Access, und 21, die nur die englischsprachigen Beiträge in der "English Corner" abonniert haben.
* Anzahl der wegen Archivalia von mir geführten Prozesse: 3. Amtsgerichte Regensburg, Siegburg und Trier. 2 Vergleiche, 1 Sieg.
* Archivalia wird zunehmend auch in gedruckter Literatur zitiert.
* Im November 2010 benoteten 154 Personen Archivalia online mit Schulnoten:
- sehr gut (1) vergaben ca. 29 Prozent
- gut (2) ca. 30 Prozent
- befriedigend (3) ca. 15 Prozent
- ausreichend bis ungenügend: rund 26 Prozent
* Von 171 Personen, die sich an einer weiteren Online-Frage beteiligten, waren nur knapp 30 Prozent Archivierende, also Archivare und Archivarinnen.
* Unter den 25 meistgelesenen Beiträgen 3 Top-Ereignisse
- der Karlsruher Handschriftenstreit Ende 2006 (Platz 21 mit 11679 Zugriffen: "Wem gehören die badischen kroninsignien?")
- der Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009, angelegt von Thomas Wolf (Platz 17 mit 13010 Besuchen)
- zuletzt die Affäre Guttenberg im Februar dieses Jahres (Platz 3 mit 30317 Zugriffen)
Auf Platz 1 weit vorn ein schon 2003 geposteter Beitrag zur Digitalisierung alter Drucke: "Deutsche Drucke des 16. Jahrhunderts im WWW" (77178 Zugriffe).
Drei Beiträge beziehen sich auf Open Access - ich verstehe Archivalia als Sturmgeschütz, das für Open Access kämpft.
Auf Platz 13 steht ein Beitrag zu Kulturgutverlusten - ein weiteres Thema, das ich mit Sendungsbewusstsein bearbeite.
Archivalia ist streitbar und meinungsfreudig!
Zweiter Hauptteil: Wissenschaftliche Inhalte in Archivalia
Abgesehen von den (spärlichen) Kommentaren mit weiterführenden Hinweisen stammen diese nur von mir.
Es sind:
- diverse Vortragsvolltexte
http://archiv.twoday.net/stories/4991818/
Vortrag Mythos Staufer, erheblich gekürzt gedruckt in der Schwäbischen Heimat
http://archiv.twoday.net/stories/6412734/
- Miszellen, insbesondere zur Kodikologie
Beispiele:
"Die bislang unbekannte älteste Handschrift der Vita Heriberti des Rupert von Deutz in der Hofbibliothek Sigmaringen" (2010)
http://archiv.twoday.net/stories/6361153/
"Neues zu Richalm von Schöntal" (2009)
http://archiv.twoday.net/stories/5680268/
Archivierung über
http://webcitation.org
42 Beiträge zu Georg Rüxner (vor allem seit 2008)
http://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner
- Rezensionen (40+)
http://archiv.twoday.net/stories/4941756/
Zum Vergleich
http://agfnz.historikerverband.de/?p=590 (von mir)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=503 (Felicitas Nöske zu historischen Schulbibliotheken)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=461 (Frank Pohle zu einer übersehenen Quelle zur Geschichte eines Aachener Klosters in der frühen Neuzeit)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=463 (Frank Pohle: Nachträge zum Nordrheinischen Klosterbuch)
Hinweis auf Inkunabelkatalogisierungsprojekt in Cambridge
Felice Feliciano annotator of Valturio, De re militari, 1472
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/rarebooks/incblog/?p=366
Aktuell: Diskussionsbeitrag zum Stand der Informationswissenschaft
http://libreas.wordpress.com/2011/06/20/informationswissenschaft-2011/
Mitmachen!
Dritter Hauptteil: Das wissenschaftliche Potential von Weblogs
* Die Kategorie des Neuen ist sowohl für die Wissenschaft als auch für Weblogs essentiell.
Aber: Weblogs können mehr als populärwissenschaftlich über neue wissenschaftliche Ergebnisse zu berichten, sie eignen sich - anders als die Wikipedia - auch für "original research".
Andere Formen der Berichterstattung: Twitter und Facebook, Mailinglisten
* Weblogs sind nicht qualitätsgesichert (ebenso wie z.B. Bücher in manchen kommerziellen Verlagen).
Aber: Fetisch Qualitätssicherung bzw. Peer Review: Bei guter Wissenschaft ist es egal, wo sie erscheint. Entscheidend ist die Beurteilung des Forschers: Bietet der Text ihm etwas Verwertbares?
Wenn ja, muss er ihn verwerten und zitieren.
Und: Es sind ja doch nicht alles Meistererzähler. Blogs könnten in einem Wissenschaftsbetrieb, der das gesunde Mittelmaß hinreichend goutiert, belebend wirken. Alte Handwerksbräuche wie das Miszellenwesen lohnen eine Revitalisierung.
* Ist der Anteil von Retrodigitalisaten unter den herangezogenen Quellen hoch, ist es völliger Unsinn, die Möglichkeit, direkt auf die Belege zu verlinken, durch eine ausschließliche Druckveröffentlichung zu verschenken.
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/8357124/
* Einzelne Blog-Beiträge können mit einem Netz von Querverweisen verknüpft werden.
* Anton Tantner: Der spezifische Nutzen von Weblogs insbesondere für die Wissenschaften liegt wohl darin, dass sie Aufmerksamkeit für ausgefallene, abseitige Themen generieren und vielleicht dazu beitragen, diese Themen – wie Valentin Groebner es formuliert hat – „[w]ie Hefepilze oder Bakterien“ „in traditionelle gelehrte Milieus [zu] injizieren.“ (Groebner 2010: 23)
http://archiv.twoday.net/stories/29749625/
* Wir brauchen einen neuen Kult des Fragments, den Mut, auch mit Unfertigem die Wissenschaft voranzubringen.
Dafür eignen sich Weblogs bestens.
Ob derlei wirklich karrierefördernd ist, steht dahin. Aber ob der eigentliche Sinn von Wissenschaft darin besteht, die Karriere der Wissenschaftler zu fördern - diese Frage werden stromlinienförmige Flaneure sicher ganz anders beantworten als NetzbürgerInnen, die gemäß den Grundsätzen von Web 2.0 gemeinsam Wissen schaffen wollen.
Update: Videofassung
http://archiv.twoday.net/stories/43008401/
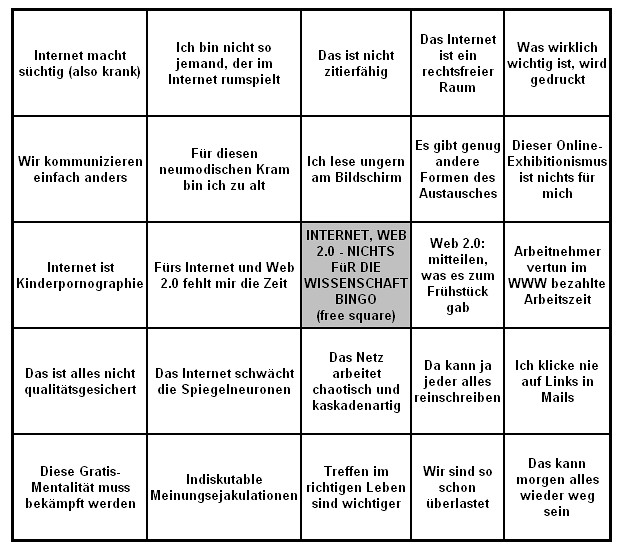
http://archiv.twoday.net/stories/29751181/
(Eine Streichung habe ich jetzt weggelassen. Links wurden nicht aktualisiert/überprüft.)
In der Diskussiuon des Vortrags bejahte ich die an mich gerichtete Frage, ob ein Wissenschaftler, der nicht blogge, ein schlechter Wissenschaftler sei.
Siehe dazu:
http://tantner.twoday.net/stories/42993509/
http://schmalenstroer.net/blog/2011/09/wissenschaft-bloggen-und-die-ffentlichkeit/
Die Illustration, das beliebte Bullshit-Bingo Web 2.0, wurde meinem Münchner Vortrag über Archivalia 2012 beigegeben:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/392
Erstmals hier am 2. Januar 2012 veröffentlicht:
http://archiv.twoday.net/stories/64022797/
Alle Türchen: #bestof
***
http://dhiha.hypotheses.org/199
Es sind ja doch nicht alles Meistererzähler. Wissenschafts-Blogs bieten nicht nur die Chance zur eitlen Selbstdarstellung und meinungsstarken Abqualifizierung unliebsamer Positionen, sie könnten in einem Wissenschaftsbetrieb, der das gesunde Mittelmaß hinreichend goutiert, belebend wirken. Alte Handwerksbräuche wie das Miszellenwesen lohnen eine Revitalisierung, Raum wäre auch für Unfertiges und Fragmentarisches. Quellen und online vorliegende Literatur können sofort verlinkt werden. Ausgehend von Erfahrungen mit « Archivalia » und dem Weblog der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit soll begründet werden, dass Web 2.0-Anwender, die das Medium Blog zugunsten von Twitter und Facebook zu « überspringen » gedenken, die Möglichkeiten von Blogs unterschätzen.
Erster Hauptteil: Archivalia in Zahlen
* Archivalia steht im Juni 2011 auf Platz 3 der Wikio-Blogcharts im Bereich Wissenschaft und kann als das führende deutschsprachige Geschichtsblog gelten.
* Archivalia ist seit dem 5. Februar 2003 online, am 23. Juni waren es 3052 Tage.
* Es gibt insgesamt 19202 Beiträge (etwa 6/Tag) und 7794 Kommentare.
* Die Auswertung einer Woche im Juni am 23. Juni 2011 ergab, dass 117 Beiträge geschrieben wurde, also etwa 16 pro Tag.
* Archivalia ist von Anfang an ein Gemeinschaftsweblog. Von den genannten 117 aktuellen Beiträgen stammen 33 von dem Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf, drei von Rechtsanwalt vom Hofe in Madrid und weitere drei von je einem Stadtarchivar, einem anonymen regelmäßigen Beiträger und einem Archäologie-Wissenschaftsblogger.
* Archivalia hat schätzungsweise mehrere hundert Besucher pro Tag. Laut Google-Reader beziehen 374 Abonennten den RSS-Feed. Hinzu kommen 13, die nur die Rubrik Open Access, und 21, die nur die englischsprachigen Beiträge in der "English Corner" abonniert haben.
* Anzahl der wegen Archivalia von mir geführten Prozesse: 3. Amtsgerichte Regensburg, Siegburg und Trier. 2 Vergleiche, 1 Sieg.
* Archivalia wird zunehmend auch in gedruckter Literatur zitiert.
* Im November 2010 benoteten 154 Personen Archivalia online mit Schulnoten:
- sehr gut (1) vergaben ca. 29 Prozent
- gut (2) ca. 30 Prozent
- befriedigend (3) ca. 15 Prozent
- ausreichend bis ungenügend: rund 26 Prozent
* Von 171 Personen, die sich an einer weiteren Online-Frage beteiligten, waren nur knapp 30 Prozent Archivierende, also Archivare und Archivarinnen.
* Unter den 25 meistgelesenen Beiträgen 3 Top-Ereignisse
- der Karlsruher Handschriftenstreit Ende 2006 (Platz 21 mit 11679 Zugriffen: "Wem gehören die badischen kroninsignien?")
- der Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009, angelegt von Thomas Wolf (Platz 17 mit 13010 Besuchen)
- zuletzt die Affäre Guttenberg im Februar dieses Jahres (Platz 3 mit 30317 Zugriffen)
Auf Platz 1 weit vorn ein schon 2003 geposteter Beitrag zur Digitalisierung alter Drucke: "Deutsche Drucke des 16. Jahrhunderts im WWW" (77178 Zugriffe).
Drei Beiträge beziehen sich auf Open Access - ich verstehe Archivalia als Sturmgeschütz, das für Open Access kämpft.
Auf Platz 13 steht ein Beitrag zu Kulturgutverlusten - ein weiteres Thema, das ich mit Sendungsbewusstsein bearbeite.
Archivalia ist streitbar und meinungsfreudig!
Zweiter Hauptteil: Wissenschaftliche Inhalte in Archivalia
Abgesehen von den (spärlichen) Kommentaren mit weiterführenden Hinweisen stammen diese nur von mir.
Es sind:
- diverse Vortragsvolltexte
http://archiv.twoday.net/stories/4991818/
Vortrag Mythos Staufer, erheblich gekürzt gedruckt in der Schwäbischen Heimat
http://archiv.twoday.net/stories/6412734/
- Miszellen, insbesondere zur Kodikologie
Beispiele:
"Die bislang unbekannte älteste Handschrift der Vita Heriberti des Rupert von Deutz in der Hofbibliothek Sigmaringen" (2010)
http://archiv.twoday.net/stories/6361153/
"Neues zu Richalm von Schöntal" (2009)
http://archiv.twoday.net/stories/5680268/
Archivierung über
http://webcitation.org
42 Beiträge zu Georg Rüxner (vor allem seit 2008)
http://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner
- Rezensionen (40+)
http://archiv.twoday.net/stories/4941756/
Zum Vergleich
http://agfnz.historikerverband.de/?p=590 (von mir)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=503 (Felicitas Nöske zu historischen Schulbibliotheken)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=461 (Frank Pohle zu einer übersehenen Quelle zur Geschichte eines Aachener Klosters in der frühen Neuzeit)
http://agfnz.historikerverband.de/?p=463 (Frank Pohle: Nachträge zum Nordrheinischen Klosterbuch)
Hinweis auf Inkunabelkatalogisierungsprojekt in Cambridge
Felice Feliciano annotator of Valturio, De re militari, 1472
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/rarebooks/incblog/?p=366
Aktuell: Diskussionsbeitrag zum Stand der Informationswissenschaft
http://libreas.wordpress.com/2011/06/20/informationswissenschaft-2011/
Mitmachen!
Dritter Hauptteil: Das wissenschaftliche Potential von Weblogs
* Die Kategorie des Neuen ist sowohl für die Wissenschaft als auch für Weblogs essentiell.
Aber: Weblogs können mehr als populärwissenschaftlich über neue wissenschaftliche Ergebnisse zu berichten, sie eignen sich - anders als die Wikipedia - auch für "original research".
Andere Formen der Berichterstattung: Twitter und Facebook, Mailinglisten
* Weblogs sind nicht qualitätsgesichert (ebenso wie z.B. Bücher in manchen kommerziellen Verlagen).
Aber: Fetisch Qualitätssicherung bzw. Peer Review: Bei guter Wissenschaft ist es egal, wo sie erscheint. Entscheidend ist die Beurteilung des Forschers: Bietet der Text ihm etwas Verwertbares?
Wenn ja, muss er ihn verwerten und zitieren.
Und: Es sind ja doch nicht alles Meistererzähler. Blogs könnten in einem Wissenschaftsbetrieb, der das gesunde Mittelmaß hinreichend goutiert, belebend wirken. Alte Handwerksbräuche wie das Miszellenwesen lohnen eine Revitalisierung.
* Ist der Anteil von Retrodigitalisaten unter den herangezogenen Quellen hoch, ist es völliger Unsinn, die Möglichkeit, direkt auf die Belege zu verlinken, durch eine ausschließliche Druckveröffentlichung zu verschenken.
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/8357124/
* Einzelne Blog-Beiträge können mit einem Netz von Querverweisen verknüpft werden.
* Anton Tantner: Der spezifische Nutzen von Weblogs insbesondere für die Wissenschaften liegt wohl darin, dass sie Aufmerksamkeit für ausgefallene, abseitige Themen generieren und vielleicht dazu beitragen, diese Themen – wie Valentin Groebner es formuliert hat – „[w]ie Hefepilze oder Bakterien“ „in traditionelle gelehrte Milieus [zu] injizieren.“ (Groebner 2010: 23)
http://archiv.twoday.net/stories/29749625/
* Wir brauchen einen neuen Kult des Fragments, den Mut, auch mit Unfertigem die Wissenschaft voranzubringen.
Dafür eignen sich Weblogs bestens.
Ob derlei wirklich karrierefördernd ist, steht dahin. Aber ob der eigentliche Sinn von Wissenschaft darin besteht, die Karriere der Wissenschaftler zu fördern - diese Frage werden stromlinienförmige Flaneure sicher ganz anders beantworten als NetzbürgerInnen, die gemäß den Grundsätzen von Web 2.0 gemeinsam Wissen schaffen wollen.
Update: Videofassung
http://archiv.twoday.net/stories/43008401/
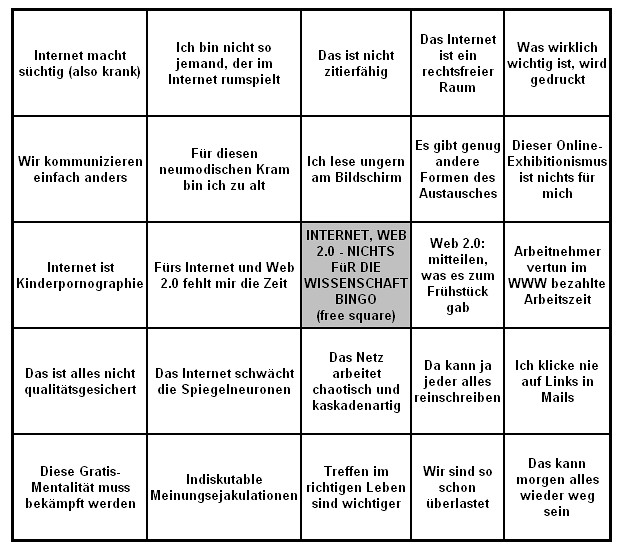
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 05:39 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz ist ja schändlicherweise wieder aus dem Netz verschwunden. Den Artikel über das Basler Wirtschaftsarchiv kann man aber kostenlos einsehen unter:
http://edoc.unibas.ch/dok/A5768147
Ebenda auch eine Broschüre zum Archiv:
http://edoc.unibas.ch/dok/A5381412
http://edoc.unibas.ch/dok/A5768147
Ebenda auch eine Broschüre zum Archiv:
http://edoc.unibas.ch/dok/A5381412
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 04:59 - Rubrik: Archivbibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 04:45 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Journal, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Teilweise sind Jahrgänge online unter:
http://canonsregular.org/osc/osc/clairlieu.html
Auch Jahrgänge von Crosier Heritage sind auf der gleichen Seite zu finden.
http://canonsregular.org/osc/osc/clairlieu.html
Auch Jahrgänge von Crosier Heritage sind auf der gleichen Seite zu finden.
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 02:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine gute und aktuelle Linksammlung der elektronischen Hilfsmittel zu mittelalterlichen Bibliothekskatalogen existiert nicht und kann auch hier nicht vorgelegt werden.
Hinweise in diesem Blog:
http://archiv.twoday.net/search?q=bibliothekskatalog
Hinweise bei Quadrivium, das ich zu harsch kritisiert hatte:
http://quadrivium.hypotheses.org/
Catalogi bibliothecarum antiqui, 1885
http://archive.org/stream/catalogibibliot00beckgoog#page/n8/mode/2up
Theodor Gottlieb: Über mittelalterliche Bibliotheken, 1890
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-15171
Vor allem Hinweise auf gedruckte Corpora bietet:
http://www.libraria.fr/fr/publications-scientifiques/acc%C3%A9der-au-livre-et-au-texte-au-moyen-%C3%A2ge-petite-bibliographie-de-base
Dem dortigen Hinweis folgend ("Indices librorum. Catalogues anciens et modernes de manuscrits médiévaux en écriture latine t. I, 1977-1983, t. II 1984- 1990, par F. Dolbeau et P. Petitmengin et alii, Paris, 1977 et 1995. Bibliographie des collections de manuscrits, médiévales et actuelles. Elle indique où trouver les publications dans quelques bibliothèques parisiennes. Une publication en ligne sur le site de l'IRHT a été envisagée pour la suite.") versuchte ich mich zunächst ohne Erfolg an einer Google-Recherche. Scheinbar ist danach (nach Ausweis vieler Treffer am Anfang der Trefferliste) nichts online. Erst eine Eingrenzung auf die site:fr brachte mich der Publikation näher. Im September 2013 wurde die Onlinestellung der beiden Bände gemeldet:
http://www.compitum.fr/annonces-diverses/6469-indices-librorum-en-texte-integral-sur-le-web
Pikanterweise war die Quelle libraria, das keine Veranlassung gesehen hat, seine eigene Linksammlung zu ergänzen.
Hier sind beide Bände einsehbar:
http://books.openedition.org/editionsulm/363
Rezensionen im DA:
http://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/53/243
http://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/43/600
Rezension von Bd. II in der Francia
http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016302,00298.html
***
Deutschland
Von der Reihe "Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz" ist Bd. 1 (1918) online. Näheres und weiteres zur Reihe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_Deutschlands_und_der_Schweiz
Die einschlägige Kommission der Bayerischen Akademie hat elektronisch außer einer Publikationsliste nichts zu bieten:
http://www.badw.de/publikationen/kommissionen_publ/mbk/index.html
Verantwortlich für dieses Versagen sind laut Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz – Kontakt
Kommissionsvorsitzender:
Prof. Dr. Helmut Gneuss (München)
Stellvertretender Vorsitzender:
Prof. Dr. Peter Landau (München)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:
Dr. Birgit Ebersperger, Telefon 089 23031-1203
Kommissionsmitglieder:
Prof. Dr. Michele C. Ferrari (Erlangen)
Prof. Dr. Raymund Kottje (Bonn)
Prof. Dr. Claudia Märtl (München)
Prof. Dr. Florentine Mütherich (München)
Prof. Dr. Peter Orth (Köln)
Prof. Dr. Peter Stotz (Zürich)
Zu wenig bekannt ist das - aus meiner Sicht unbefriedigende, aber als Kompilation unverzichtbare - Buch von Benjamin Stello: Deutschsprachige Literatur in Bibliotheken des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hamburg 2009. Hauptteil ist ein Verzeichnis der Bibliothekskataloge, Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/992158699/04. Eine Rezension ist mir nicht bekannt, zumindest online ist nichts zu finden.
Frankreich
Das Repertorium Bibliothèques médiévales de France ist online unter
http://www.libraria.fr/fr/bmf/repertoire-bmf-1-%E2%80%94-accueil
Weitere Projekte z.B. Sanderus für Belgien:
http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/ressources-biblissima
Großbritannien
Von den Materialien, die Sharpe zu British Medieval Library Catalogues bereitstellt, ist vor allem das PDF mit den Identifikationen aus dem Corpus von großem Wert.
http://www.history.ox.ac.uk/research/project/british-medieval-library-catalogues.html
http://www.history.ox.ac.uk/fileadmin/ohf/documents/projects/List-of-Identifications.pdf
Unverständlich ist, dass - schlechtem Brauch folgend - u statt v zu suchen ist, also Speculum uirginum, nicht Speculum virginum.
Zu den erwähnten Werken hat man bequem eine Angabe der maßgeblichen Edition, was von großem Nutzen sein kann.
Italien
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html vgl.
http://archiv.twoday.net/stories/97037028/
Österreich
Bd. 1 und 2 der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge sind online
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_%C3%96sterreichs
Hinweise in diesem Blog:
http://archiv.twoday.net/search?q=bibliothekskatalog
Hinweise bei Quadrivium, das ich zu harsch kritisiert hatte:
http://quadrivium.hypotheses.org/
Catalogi bibliothecarum antiqui, 1885
http://archive.org/stream/catalogibibliot00beckgoog#page/n8/mode/2up
Theodor Gottlieb: Über mittelalterliche Bibliotheken, 1890
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-15171
Vor allem Hinweise auf gedruckte Corpora bietet:
http://www.libraria.fr/fr/publications-scientifiques/acc%C3%A9der-au-livre-et-au-texte-au-moyen-%C3%A2ge-petite-bibliographie-de-base
Dem dortigen Hinweis folgend ("Indices librorum. Catalogues anciens et modernes de manuscrits médiévaux en écriture latine t. I, 1977-1983, t. II 1984- 1990, par F. Dolbeau et P. Petitmengin et alii, Paris, 1977 et 1995. Bibliographie des collections de manuscrits, médiévales et actuelles. Elle indique où trouver les publications dans quelques bibliothèques parisiennes. Une publication en ligne sur le site de l'IRHT a été envisagée pour la suite.") versuchte ich mich zunächst ohne Erfolg an einer Google-Recherche. Scheinbar ist danach (nach Ausweis vieler Treffer am Anfang der Trefferliste) nichts online. Erst eine Eingrenzung auf die site:fr brachte mich der Publikation näher. Im September 2013 wurde die Onlinestellung der beiden Bände gemeldet:
http://www.compitum.fr/annonces-diverses/6469-indices-librorum-en-texte-integral-sur-le-web
Pikanterweise war die Quelle libraria, das keine Veranlassung gesehen hat, seine eigene Linksammlung zu ergänzen.
Hier sind beide Bände einsehbar:
http://books.openedition.org/editionsulm/363
Rezensionen im DA:
http://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/53/243
http://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/43/600
Rezension von Bd. II in der Francia
http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016302,00298.html
***
Deutschland
Von der Reihe "Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz" ist Bd. 1 (1918) online. Näheres und weiteres zur Reihe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_Deutschlands_und_der_Schweiz
Die einschlägige Kommission der Bayerischen Akademie hat elektronisch außer einer Publikationsliste nichts zu bieten:
http://www.badw.de/publikationen/kommissionen_publ/mbk/index.html
Verantwortlich für dieses Versagen sind laut Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz – Kontakt
Kommissionsvorsitzender:
Prof. Dr. Helmut Gneuss (München)
Stellvertretender Vorsitzender:
Prof. Dr. Peter Landau (München)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:
Dr. Birgit Ebersperger, Telefon 089 23031-1203
Kommissionsmitglieder:
Prof. Dr. Michele C. Ferrari (Erlangen)
Prof. Dr. Raymund Kottje (Bonn)
Prof. Dr. Claudia Märtl (München)
Prof. Dr. Florentine Mütherich (München)
Prof. Dr. Peter Orth (Köln)
Prof. Dr. Peter Stotz (Zürich)
Zu wenig bekannt ist das - aus meiner Sicht unbefriedigende, aber als Kompilation unverzichtbare - Buch von Benjamin Stello: Deutschsprachige Literatur in Bibliotheken des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hamburg 2009. Hauptteil ist ein Verzeichnis der Bibliothekskataloge, Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/992158699/04. Eine Rezension ist mir nicht bekannt, zumindest online ist nichts zu finden.
Frankreich
Das Repertorium Bibliothèques médiévales de France ist online unter
http://www.libraria.fr/fr/bmf/repertoire-bmf-1-%E2%80%94-accueil
Weitere Projekte z.B. Sanderus für Belgien:
http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/ressources/ressources-biblissima
Großbritannien
Von den Materialien, die Sharpe zu British Medieval Library Catalogues bereitstellt, ist vor allem das PDF mit den Identifikationen aus dem Corpus von großem Wert.
http://www.history.ox.ac.uk/research/project/british-medieval-library-catalogues.html
http://www.history.ox.ac.uk/fileadmin/ohf/documents/projects/List-of-Identifications.pdf
Unverständlich ist, dass - schlechtem Brauch folgend - u statt v zu suchen ist, also Speculum uirginum, nicht Speculum virginum.
Zu den erwähnten Werken hat man bequem eine Angabe der maßgeblichen Edition, was von großem Nutzen sein kann.
Italien
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html vgl.
http://archiv.twoday.net/stories/97037028/
Österreich
Bd. 1 und 2 der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge sind online
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Bibliothekskataloge_%C3%96sterreichs
KlausGraf - am Dienstag, 10. Dezember 2013, 01:48 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Bestand "Scottish catholic Archives" der Universitätsbibliothek Aberdeen umfasst auch bemerkenswertes Material zu den deutschen Schottenklöstern, insbesondere in Regensburg. Es handelt sich um eine langfristige Leihgabe der katholischen Kirche in Schottland.
Übersicht:
http://www.abdn.ac.uk/library/about/special/scottish-catholic-archives/
Diese war für die Abtrennung dieses Bestands (Unterlagen vor 1878) heftig kritisiert worden. Über Pläne, Teile des Kulturguts der Kirche zu veräußern, wurde ebenfalls in der Presse berichtet.
Das für Monate geschlossene Archiv in Edinburgh wurde im November wieder geöffnet, ohne dass die gravierenden baulichen Probleme, die zur Begründung der Schließung herangezogen worden waren, gelöst worden wären.
15. November 2013
http://www.thetablet.co.uk/news/116/0/surprise-as-scots-archive-reopens
16. Juli 2013
http://blogs.telegraph.co.uk/news/tomgallagher/100226615/the-vandalism-of-scotlands-catholic-heritage/
3. Juli 2013
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10158120/Church-bungling-blamed-for-mould-attack-on-Mary-Queen-of-Scots-archive.html
9. März 2012
http://www.sconews.co.uk/news/17123/historical-catholic-archive-items-may-be-sold-off/
Übersicht:
http://www.abdn.ac.uk/library/about/special/scottish-catholic-archives/
Diese war für die Abtrennung dieses Bestands (Unterlagen vor 1878) heftig kritisiert worden. Über Pläne, Teile des Kulturguts der Kirche zu veräußern, wurde ebenfalls in der Presse berichtet.
Das für Monate geschlossene Archiv in Edinburgh wurde im November wieder geöffnet, ohne dass die gravierenden baulichen Probleme, die zur Begründung der Schließung herangezogen worden waren, gelöst worden wären.
15. November 2013
http://www.thetablet.co.uk/news/116/0/surprise-as-scots-archive-reopens
16. Juli 2013
http://blogs.telegraph.co.uk/news/tomgallagher/100226615/the-vandalism-of-scotlands-catholic-heritage/
3. Juli 2013
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10158120/Church-bungling-blamed-for-mould-attack-on-Mary-Queen-of-Scots-archive.html
9. März 2012
http://www.sconews.co.uk/news/17123/historical-catholic-archive-items-may-be-sold-off/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen