KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 23:25 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 20:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archiefschool.nl/
Das kommt natürlich bei der Archivschule in Marburg nicht in Betracht, hier ist man wie beim VdA, der ja eine Kooperation mit Archivalia abgelehnt hat, offiziell-verknöchert. Immerhin gibts einen instruktiven Bericht vom Kölner Hilfseinsatz:
http://www.archivschule.de/content/655.html
Das kommt natürlich bei der Archivschule in Marburg nicht in Betracht, hier ist man wie beim VdA, der ja eine Kooperation mit Archivalia abgelehnt hat, offiziell-verknöchert. Immerhin gibts einen instruktiven Bericht vom Kölner Hilfseinsatz:
http://www.archivschule.de/content/655.html
KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:57 - Rubrik: Kommunalarchive
published on Salon JS Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-ix.html )
Good News: Cooperation between Cologne Digital Archive (CDA) and City of Cologne (CDA, March 18th 2009 via Archivalia)
"Over the last days, we [CDA] received many enquiries concerning legal issues and the Digital Historical Archive. Even in the press and relevant news groups and mailing lists, this topic has been discussed.
Against this background, the initiators, prometheus e.V. (Cologne) in cooperation with the Department for History (Bonn), and the Cologne Historical Archive will clarify the legal situation in a cooperation contract. This will create a legal basis for the uploaders, the initiators and the CHA.
After a particular interlocution, all persons in charge agreed that this project will be continued under the supervision of the CHA and will be transformed into a 'citizen’s archive' (Buergerarchiv)."
Good News: Cooperation between Cologne Digital Archive (CDA) and City of Cologne (CDA, March 18th 2009 via Archivalia)
"Over the last days, we [CDA] received many enquiries concerning legal issues and the Digital Historical Archive. Even in the press and relevant news groups and mailing lists, this topic has been discussed.
Against this background, the initiators, prometheus e.V. (Cologne) in cooperation with the Department for History (Bonn), and the Cologne Historical Archive will clarify the legal situation in a cooperation contract. This will create a legal basis for the uploaders, the initiators and the CHA.
After a particular interlocution, all persons in charge agreed that this project will be continued under the supervision of the CHA and will be transformed into a 'citizen’s archive' (Buergerarchiv)."
Frank.Schloeffel - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:35 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
published on Salon Jewish Studies Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/orphan-works-and-public-domain.html )
Peter Brantley (Executive Director for the Digital Library Federation) on The orphan monopoly:
"There are a large number of ways that books might fall into orphan status. A quick consultation of Peter Hirtle’s copyright table at Cornell Univ. allows us to see how easy this is. The impact of foreign rights is fiendishly complicated, and even the rules for U.S. publications are baroque; for older works it is a crafty rightsholder indeed who can figure out whether they might retain a claim. As Peter Hirtle observed to me in an email, 'The lengthening copyright terms and the gradual removal of formalities (especially the automatic renewal of works published since 1963) means that works that would have passed into the public domain in the past because the rights owners weren't concerned are still protected. The chances that the rights holders are either unidentifiable or not locatable also goes up.'
[...]
There are rough estimates of around 7 million digitized volumes in GBS [Google Book Search] subtracting 750,000 newly identified works gives us 6.25 million. Let’s take a guess that there are maybe 1.5 million public domain works (this is not entirely out of the blue, but informed by earlier orphan works studies and reports), leaving 4.75 million titles. That’s a lot of books – about 2/3 of the total. It might be more, it might be less; it is a big number.
[...]
A large number of these orphans are going to be truly public domain books, just like pre-1923 works. However, we may never know that they actually have public domain status due to historically incomplete record keeping, and the lack of a national rights tracking and notification infrastructure." (via Archivalia@Twitter)
Recommended:
Article "Public domain" on Wikipedia
Articles in Archivalia ref. to "Public domain" (German)
WIKIMEDIA COMMONS a database of 4,120,985 [March, 18th 2009] freely usable media files TO WHICH ANYONE CAN CONTRIBUTE!
Peter Brantley (Executive Director for the Digital Library Federation) on The orphan monopoly:
"There are a large number of ways that books might fall into orphan status. A quick consultation of Peter Hirtle’s copyright table at Cornell Univ. allows us to see how easy this is. The impact of foreign rights is fiendishly complicated, and even the rules for U.S. publications are baroque; for older works it is a crafty rightsholder indeed who can figure out whether they might retain a claim. As Peter Hirtle observed to me in an email, 'The lengthening copyright terms and the gradual removal of formalities (especially the automatic renewal of works published since 1963) means that works that would have passed into the public domain in the past because the rights owners weren't concerned are still protected. The chances that the rights holders are either unidentifiable or not locatable also goes up.'
[...]
There are rough estimates of around 7 million digitized volumes in GBS [Google Book Search] subtracting 750,000 newly identified works gives us 6.25 million. Let’s take a guess that there are maybe 1.5 million public domain works (this is not entirely out of the blue, but informed by earlier orphan works studies and reports), leaving 4.75 million titles. That’s a lot of books – about 2/3 of the total. It might be more, it might be less; it is a big number.
[...]
A large number of these orphans are going to be truly public domain books, just like pre-1923 works. However, we may never know that they actually have public domain status due to historically incomplete record keeping, and the lack of a national rights tracking and notification infrastructure." (via Archivalia@Twitter)
Recommended:
Article "Public domain" on Wikipedia
Articles in Archivalia ref. to "Public domain" (German)
WIKIMEDIA COMMONS a database of 4,120,985 [March, 18th 2009] freely usable media files TO WHICH ANYONE CAN CONTRIBUTE!
Frank.Schloeffel - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:26 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://twitter.com/Sebastian_Post
Sebastian Post hat schlagend demonstriert, wofür Twitter gut sein kann. Statt einem mit gepflegter Langeweile erstelltem Bericht, der dann nach 1-2 Jahren im Archivar nachzulesen ist, ein offenbar mit dem Handy erstellter Live-Tweet, der die Kernaussagen der Referate zusammenfasst und hilfreich für diejenigen ist, die nicht dabei sein konnten oder wollten.
Besonders interessant:
Nun zur Novellierung des NRW Archivgesetzes: Entwurf liegt vor, d. MiPrä mit "Häckchen" versehen u. an Verbände zur Stellungnahme geleitet.
Sebastian Post hat schlagend demonstriert, wofür Twitter gut sein kann. Statt einem mit gepflegter Langeweile erstelltem Bericht, der dann nach 1-2 Jahren im Archivar nachzulesen ist, ein offenbar mit dem Handy erstellter Live-Tweet, der die Kernaussagen der Referate zusammenfasst und hilfreich für diejenigen ist, die nicht dabei sein konnten oder wollten.
Besonders interessant:
Nun zur Novellierung des NRW Archivgesetzes: Entwurf liegt vor, d. MiPrä mit "Häckchen" versehen u. an Verbände zur Stellungnahme geleitet.
KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 18:57 - Rubrik: Archivrecht
Eine gute Nachricht!
Kooperation mit der Stadt Köln
18. März 2009
In den letzten Tagen erhielten wir viele Anfragen bezüglich der rechtlichen Grundlage des digitalen Historischen Archivs. Auch in der Presse und in einschlägigen Listen wird dieses Thema bereits diskutiert.
Vor diesem Hintergrund werden die Initiatoren, prometheus e.V. (Köln) und das Institut für Geschichtswissenschaft (Bonn) mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln in Kürze die rechtliche Situation in einem Kooperationsvertrag regeln. Damit soll eine klare Rechtsgrundlage für die einstellenden Unterstützer, die Betreiber/Initiatoren und das Historische Archiv geschaffen werden.
In einem ausführlichen Gespräch, waren sich alle Verantwortlichen heute grundsätzlich darin einig, das Projekt unter der Leitung des Historischen Archivs fortzuführen und in ein zukünftiges “Bürgerarchiv” zu überführen.
http://www.historischesarchivkoeln.de
Kooperation mit der Stadt Köln
18. März 2009
In den letzten Tagen erhielten wir viele Anfragen bezüglich der rechtlichen Grundlage des digitalen Historischen Archivs. Auch in der Presse und in einschlägigen Listen wird dieses Thema bereits diskutiert.
Vor diesem Hintergrund werden die Initiatoren, prometheus e.V. (Köln) und das Institut für Geschichtswissenschaft (Bonn) mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln in Kürze die rechtliche Situation in einem Kooperationsvertrag regeln. Damit soll eine klare Rechtsgrundlage für die einstellenden Unterstützer, die Betreiber/Initiatoren und das Historische Archiv geschaffen werden.
In einem ausführlichen Gespräch, waren sich alle Verantwortlichen heute grundsätzlich darin einig, das Projekt unter der Leitung des Historischen Archivs fortzuführen und in ein zukünftiges “Bürgerarchiv” zu überführen.
http://www.historischesarchivkoeln.de
KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 17:23 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.regesta-imperii.de/nachrichten/artikel/details/mediaevistische-grundlagenforschung-hilft-koelner-verluste-zu-kompensieren.html
Zusammen mit 543 Urkunden Kaiser Friedrichs III. (1440-93), die im Stadtarchiv von Köln verwahrt wurden, muß der Verlust des sogenannten Reichstsstadtprivileg Kölns vom 19. September 1475 befürchtet werden. Mit diesem erhob der Kaiser die Stadt, die sich dem Zugriff des Erzbischofs als ihres ursprünglichen Stadtherrn sukzessive entzogen hatte, aus Dankbarkeit für ihre militärische und finanzielle Unterstützung des Reichskriegs gegen den Herzog von Burgund auf ewige Zeiten zu einer Kaiser und Reich unmittelbar unterstehenden Stadt. Er verlieh ihr damit eine Rechtsqualität, mit der sich die Erzbischöfe bis zum Ende des „Alten Reiches“ um 1800 nicht abfinden mochten.
Foto-Digitalisate aller dieser Kaiserurkunden, auf denen die Publikation moderner Regesten (abstracts) fußte (erschienen 1990 bei Böhlau), wird die Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii e.V. bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz dem Kölner Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Die Inhalte und Formen nicht nur dieser Urkunden, sondern derjenigen sämtlicher Kaiser und etlicher Päpste des Mittelalters kann jedermann im open access online recherchieren auf www.regesta-imperii.de.
Was in modernen Friedenszeiten ausgeschlossen schien, ist doch eingetreten: Die nicht selten gering geachtete historisch-philologische Grundlagenforschung ist auch unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten unersetzlich.
Besser wäre es, diese Digitalisate auch
http://www.historischesarchivkoeln.de
zur Verfügung zu stellen. Dann hätten alle etwas davon.
Zusammen mit 543 Urkunden Kaiser Friedrichs III. (1440-93), die im Stadtarchiv von Köln verwahrt wurden, muß der Verlust des sogenannten Reichstsstadtprivileg Kölns vom 19. September 1475 befürchtet werden. Mit diesem erhob der Kaiser die Stadt, die sich dem Zugriff des Erzbischofs als ihres ursprünglichen Stadtherrn sukzessive entzogen hatte, aus Dankbarkeit für ihre militärische und finanzielle Unterstützung des Reichskriegs gegen den Herzog von Burgund auf ewige Zeiten zu einer Kaiser und Reich unmittelbar unterstehenden Stadt. Er verlieh ihr damit eine Rechtsqualität, mit der sich die Erzbischöfe bis zum Ende des „Alten Reiches“ um 1800 nicht abfinden mochten.
Foto-Digitalisate aller dieser Kaiserurkunden, auf denen die Publikation moderner Regesten (abstracts) fußte (erschienen 1990 bei Böhlau), wird die Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii e.V. bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz dem Kölner Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Die Inhalte und Formen nicht nur dieser Urkunden, sondern derjenigen sämtlicher Kaiser und etlicher Päpste des Mittelalters kann jedermann im open access online recherchieren auf www.regesta-imperii.de.
Was in modernen Friedenszeiten ausgeschlossen schien, ist doch eingetreten: Die nicht selten gering geachtete historisch-philologische Grundlagenforschung ist auch unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten unersetzlich.
Besser wäre es, diese Digitalisate auch
http://www.historischesarchivkoeln.de
zur Verfügung zu stellen. Dann hätten alle etwas davon.
KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 17:19 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich erfuhr heute von der Stadt Köln, dass die Seite http://www.archiv-in-truemmern.de nicht vom Historischen Archiv der Stadt Köln autorisiert sei. Die Angabe der Archivleiterin im Impressum geschehe ohne Zustimmung der Stadt Köln und der Archivleiterin.
Weiß jemand näheres?
Der Blog war übrigens nur von 10. bis 13. März aktiv. Keine Kommentare bisher.
Weiß jemand näheres?
Der Blog war übrigens nur von 10. bis 13. März aktiv. Keine Kommentare bisher.
thomschu - am Mittwoch, 18. März 2009, 16:27 - Rubrik: Kommunalarchive
Am heutigen 18. März 2009 bloggen "computing humanists" aus der ganzen Welt über ihren Arbeitstag. So entsteht ein Gemeinschaftswerk, das Einblick in die alltäglichen Arbeitsabläufe im Bereich der EDV in den Geisteswissenschaften bieten soll.
Aus Deutschland sind, soweit ich sehe, dabei: Kai-Christian Bruhn und Patrick Sahle.
Zwei Fundstücke aus den diversen Berichten:
Cheatsheet für XML, XSLT, XPath, DTD und "Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia" (Cory Doctorow 2001).
In Twitter gibt's auch Beiträge unter dem Hashtag #lifeofdh.
Aus Deutschland sind, soweit ich sehe, dabei: Kai-Christian Bruhn und Patrick Sahle.
Zwei Fundstücke aus den diversen Berichten:
Cheatsheet für XML, XSLT, XPath, DTD und "Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia" (Cory Doctorow 2001).
In Twitter gibt's auch Beiträge unter dem Hashtag #lifeofdh.
Clemens Radl - am Mittwoch, 18. März 2009, 14:12 - Rubrik: Technik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es ware eine Schade, die Welfen Munzsammlung nach Braunschweig zu schicken. Die Sammlung muss unbedingt in Hannover bleiben.
Lili Dergaciova, Phd Student
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Institut der Kultureigentum, Zentrum Archaeologie
Academie der Wissenschaften der Rep. Moldova
Str. Bd. Stefan cel Mare 1
Chisinau Rep. Moldova
Lili Dergaciova, Phd Student
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Institut der Kultureigentum, Zentrum Archaeologie
Academie der Wissenschaften der Rep. Moldova
Str. Bd. Stefan cel Mare 1
Chisinau Rep. Moldova
Lili Dergaciova - am Mittwoch, 18. März 2009, 11:13 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Yesterday was Natasha's birthday. One of the gifts I wanted to give her was a subscription to the University of Pennsylvania library (we live right next to UPenn), so that she would have remote access to all the academic databases (the free library of Philadelphia provides remote access to some, but not all, of those databases). Natasha has long lamented her lack of access to scientific journals now that she is no longer in school. Such journals are key to both her work as a sustainable food writer. Also, it is relevant to her personal enrichment, due to her interests, and background, in biological science. Further, as a long-time graduate student myself, I remember just how useful it was to have remote access to such a treasure trove of academic work. Even now, there have been numerous times during my writing where I run up against firewalls on JSTOR. So, I figured it was time to get us access to all of this great information.
The problem is, as a I discovered, even if you are willing to spend $400 a year for access to the library as an individual, or $800 as part of a corporate account, access to many of the academic databases is still restricted. Unless you have a job with the university, or are enrolled as a student, many of the databases with the best available research are nearly impossible to access. Right now, the only way it seems that we can ever have access to many academic journals is for someone with access to illegally let us borrow their username and password. Nice.
Read more:
http://www.openleft.com/showDiary.do?diaryId=12243
The problem is, as a I discovered, even if you are willing to spend $400 a year for access to the library as an individual, or $800 as part of a corporate account, access to many of the academic databases is still restricted. Unless you have a job with the university, or are enrolled as a student, many of the databases with the best available research are nearly impossible to access. Right now, the only way it seems that we can ever have access to many academic journals is for someone with access to illegally let us borrow their username and password. Nice.
Read more:
http://www.openleft.com/showDiary.do?diaryId=12243
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 23:11 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Martin Dinges: Rezension zu: Schenk, Dietmar: Kleine Theorie des Archivs. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult, 18.03.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-226
Zitat:
Abschließend geht der Autor der grundlegenden Frage nach, wofür Archive überhaupt noch notwendig seien. Nach knapper Darstellung des mit der digitalen Revolution einhergehenden Wandels stellt Schenk fest, dass sie sicher weder Archive überflüssig mache, noch die Antwort auf deren Existenzberechtigung beinhalte. Vielmehr behielten diese gerade unter den Bedingungen der digitalen Welt ihre Aufgabe, dem Verlust von Geschichte Einhalt zu gebieten und der vielerorts zu beobachtenden Wendung hin zur Geschichte Stoff und Raum zu bieten. Schenk schließt mit einigen Bemerkungen zu Ethik und Politik des Archivs.
Insgesamt hat der Autor eine intellektuell anregende tour d’horizon vorgelegt, die sehr präzise und kenntnisreich vielfältige Aspekte des Archivs analysiert und der interessierten Öffentlichkeit zur Lektüre nur sehr empfohlen werden kann. Auch für die Fachkollegen enthält sie vielfältige Anregungen zum Nachdenken, die über die Mühen der Tagesarbeit hinausweisen. Durch gute Lesbarkeit hebt sie sich außerdem von den meisten Texten des kulturwissenschaftlichen Diskurses angenehm ab.
Zitat:
Abschließend geht der Autor der grundlegenden Frage nach, wofür Archive überhaupt noch notwendig seien. Nach knapper Darstellung des mit der digitalen Revolution einhergehenden Wandels stellt Schenk fest, dass sie sicher weder Archive überflüssig mache, noch die Antwort auf deren Existenzberechtigung beinhalte. Vielmehr behielten diese gerade unter den Bedingungen der digitalen Welt ihre Aufgabe, dem Verlust von Geschichte Einhalt zu gebieten und der vielerorts zu beobachtenden Wendung hin zur Geschichte Stoff und Raum zu bieten. Schenk schließt mit einigen Bemerkungen zu Ethik und Politik des Archivs.
Insgesamt hat der Autor eine intellektuell anregende tour d’horizon vorgelegt, die sehr präzise und kenntnisreich vielfältige Aspekte des Archivs analysiert und der interessierten Öffentlichkeit zur Lektüre nur sehr empfohlen werden kann. Auch für die Fachkollegen enthält sie vielfältige Anregungen zum Nachdenken, die über die Mühen der Tagesarbeit hinausweisen. Durch gute Lesbarkeit hebt sie sich außerdem von den meisten Texten des kulturwissenschaftlichen Diskurses angenehm ab.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 22:50 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://seekingmichigan.org/
Ein attraktives neues Angebot von Staatsarchiv und Staatsbibliothek in Michigan. Netter Viewer, feste kurze URL, aber leider keine Downloadmöglichkeit bei Mehrseitendokumenten. Bei den frühen Fotografien wird die Möglichkeit zum Abspeichern der Bilder sogar unterdrückt.
Ein attraktives neues Angebot von Staatsarchiv und Staatsbibliothek in Michigan. Netter Viewer, feste kurze URL, aber leider keine Downloadmöglichkeit bei Mehrseitendokumenten. Bei den frühen Fotografien wird die Möglichkeit zum Abspeichern der Bilder sogar unterdrückt.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 21:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Summary VI at Salon Jewish Studies Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-viii.html )

Cologne Historical Archive's head getting criticism concering copyright statement (Koeln.de March 16th 2009 via Archivalia)
Director of the Cologne Historical Archive is now getting criticism concerning the copyright statement.
Since March 7th, the initiative “Digital Historical Archive Cologne” offers the opportunity to upload copies of the material from the collapsed archive. This way, scientist can help to restore the documents.
Bettina Schmidt-Czaia (director of the CHA), she of all people criticized this ambitious project pointing out copyright issues and ensures indignations.
„Many scientists, that received ordered copies of our material in former times, are now putting them online to provied an access“, said Schmidt-Czaia to Cologne Courier. This might break „copyright-laws“ of the documents. „It would be better, if these copies would be handed to us“, she urged the scientists.
On the internet, this announcement created hard criticism. In the forum „Archivalia“ (among others), is pointed out that there do not exist copyrights for documents whose authors died over 70 years ago. Most of the documents are free to common (common free) and can be handed to others/third.
“Reconsider donation cooperativeness“
The fact that the head of the archive holds on to bureaucratical issues like copyright in this crisis caused a lot of unpleasure. Especially, when one relies on the help of active citizens to rescue the documents. At this moment, it is important not to exclude the scientists but to use their interest to reproduce as many documents as possible, as well as to receive financial support. In the forum as in the service Twitter already appeared a call to reconsider donation cooperativeness towards the archive.
User unfriendly charges in the former CHA are also criticized, taking a digital picture of a document with own camera cost 2 Euros each. The users of the archive state that these fees could be the reason why so less digitized copies were made over the last years.
Comment by Klaus Graf (Archivalia): Let us hope the CHA recognizes that Digital Historical Archive is a support and that a great offer to become a „Bürgerarchiv“ (citizen archive) is given. Hopefully the responsible body (Unterhaltsträger), the City of Cologne will understand that the standing on these fees to collect some little money is absurd in this situation, relying on civic support.
Cultural possessions are common properties, they belong to all of us. We must rap our politicians on the knuckles, when their administration trends towards removing this policy.
A more detailed position of mine towards this issue can be read in the article “Cultural possessions must be free to access” (Kulturgut muß frei sein) in the “Kunstchronik”: http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
News on the Cologne Historical Archive by Sebastian Post@Twitter from the 61. Westfaelische Archivtag (March 17th-18th 2009 in Detmold) via Archivalia
1. Archival material & finding aids
Many backup films were recovered.
The Cologne Historical Archive (CHA) queries the German government refering to the archival material backups which are stored in the Barbarastollen. The Barbarastollen is the so called "Memory of German culture". Here, 825 Mio images on microfilms are kept save.
The finding aids of the CHA are completely rescued.
2. Statement on access to digitized documents from the CHA
The CHA do not dislike! the access to uploaded digitized material from the Cologne archives collections via internet, but the CHA has to agree upon every initiative. (see also:
3. Needs and hopes
Manpower and support will be needed for a long time. For sure is: The memory of the city is not lost. We are working on the rescue!
Pictures from the Erstversorgungszentrum (EVZ), showing the divisiveness of rubble and archival material (press service city of Cologne March 16th 2009 via Archivalia)

Cologne Historical Archive's head getting criticism concering copyright statement (Koeln.de March 16th 2009 via Archivalia)
Director of the Cologne Historical Archive is now getting criticism concerning the copyright statement.
Since March 7th, the initiative “Digital Historical Archive Cologne” offers the opportunity to upload copies of the material from the collapsed archive. This way, scientist can help to restore the documents.
Bettina Schmidt-Czaia (director of the CHA), she of all people criticized this ambitious project pointing out copyright issues and ensures indignations.
„Many scientists, that received ordered copies of our material in former times, are now putting them online to provied an access“, said Schmidt-Czaia to Cologne Courier. This might break „copyright-laws“ of the documents. „It would be better, if these copies would be handed to us“, she urged the scientists.
On the internet, this announcement created hard criticism. In the forum „Archivalia“ (among others), is pointed out that there do not exist copyrights for documents whose authors died over 70 years ago. Most of the documents are free to common (common free) and can be handed to others/third.
“Reconsider donation cooperativeness“
The fact that the head of the archive holds on to bureaucratical issues like copyright in this crisis caused a lot of unpleasure. Especially, when one relies on the help of active citizens to rescue the documents. At this moment, it is important not to exclude the scientists but to use their interest to reproduce as many documents as possible, as well as to receive financial support. In the forum as in the service Twitter already appeared a call to reconsider donation cooperativeness towards the archive.
User unfriendly charges in the former CHA are also criticized, taking a digital picture of a document with own camera cost 2 Euros each. The users of the archive state that these fees could be the reason why so less digitized copies were made over the last years.
Comment by Klaus Graf (Archivalia): Let us hope the CHA recognizes that Digital Historical Archive is a support and that a great offer to become a „Bürgerarchiv“ (citizen archive) is given. Hopefully the responsible body (Unterhaltsträger), the City of Cologne will understand that the standing on these fees to collect some little money is absurd in this situation, relying on civic support.
Cultural possessions are common properties, they belong to all of us. We must rap our politicians on the knuckles, when their administration trends towards removing this policy.
A more detailed position of mine towards this issue can be read in the article “Cultural possessions must be free to access” (Kulturgut muß frei sein) in the “Kunstchronik”: http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
News on the Cologne Historical Archive by Sebastian Post@Twitter from the 61. Westfaelische Archivtag (March 17th-18th 2009 in Detmold) via Archivalia
1. Archival material & finding aids
Many backup films were recovered.
The Cologne Historical Archive (CHA) queries the German government refering to the archival material backups which are stored in the Barbarastollen. The Barbarastollen is the so called "Memory of German culture". Here, 825 Mio images on microfilms are kept save.
The finding aids of the CHA are completely rescued.
2. Statement on access to digitized documents from the CHA
The CHA do not dislike! the access to uploaded digitized material from the Cologne archives collections via internet, but the CHA has to agree upon every initiative. (see also:
3. Needs and hopes
Manpower and support will be needed for a long time. For sure is: The memory of the city is not lost. We are working on the rescue!
Pictures from the Erstversorgungszentrum (EVZ), showing the divisiveness of rubble and archival material (press service city of Cologne March 16th 2009 via Archivalia)
Frank.Schloeffel - am Dienstag, 17. März 2009, 20:49 - Rubrik: English Corner
Zu der Directmedia-CD "Deutsche Märchen und Sagen" wurde im November 2008 ein Wikipedia-Artikel angelegt, der sich nun den üblichen ignoranten Löschantrag einfing.
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_M%C3%A4rchen_und_Sagen
Da meine Rezension in der FABULA 45 (2004), S. 376-378 nicht kostenfrei online verfügbar war, dokumentiere ich sie im folgenden.
Deutsche Märchen und Sagen. ed. Hans-Jörg U t h e r (Digitale Bibliothek 80). Berlin: Directmedia Publishing GmbH 2002 (CD-ROM mit ca 37 000 S.).
Ein digitaler Meilenstein der Erzählforschung! Nunmehr können 48 teilweise mehrbändige Sammlungen von Märchen und Sagen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit etwa 24 000 Texten im Volltext durchsucht werden. Damit liegt zu einem Preis, den sich jeder Interessierte leisten kann, ein umfangreiches maschinenlesbares Korpus vor, das dank Angabe der originalen
Paginierung und wortgetreuer Wiedergabe der Vorlagen voll zitierfähig ist (wenngleich man sich dazu mit der Seitenumbruchfunktion vertraut machen und vorgeschaltete römische Zählungen ‚erraten‘ muß). Die bewährte
und einfach zu bedienende Suchoberfläche der Digitalen Bibliothek ermöglicht differenzierte Abfragen. Uthers allgemeine Einführung, die biographischen Hinweise zu den Sammlern und die abschließende Bibliographie von mehr als 20 000 Titeln sind wissenschaftlich solides Beiwerk.
Was die Auswahl der digitalisierten Werke betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß aus der Zeit vor den paradigmatischen Sammlungen der Brüder Grimm wertvolle Quellenschriften für jenen historischen Prozeß präsentiert werden, aus dem die Gattungen ‚Märchen‘ und ‚Sage‘ der sogenannten ‚Volksliteratur‘
hervorgingen. Für die Volksmärchen des Musäus (1782/86) wurde der Wortlaut der Artemis-Ausgabe von 1976 zugrundegelegt, für Benedikte Nauberts Volksmärchen (1789/92) ein Druck von 1840. In der Originalausgabe ist dankenswerterweise die erste monographische deutsche Sagensammlung von Nachtigal (1800) greifbar, desgleichen die Bücher von Büsching (1812) und Gottschalck (1814). Von den Grimmschen Märchen wurde sowohl die Erstausgabe von 1812/15 als auch die Artemis-Ausgabe von 1977 erfaßt, während bei den Sagen ausschließlich der Text der Artemis-Ausgabe von 1965 geboten wird. Der Winkler-Verlag mit seiner Artemis-Reihe lieferte auch die Märchen Bechsteins,
während als Grundlage für das Sagenbuch (1853) eine Vorlage von 1930 diente.
Mehr oder minder seltene allgemeine Märchensammlungen wurden aufgenommen von A. L. Grimm (1809 und 1837), Löhr (ca 1819/20), Karoline Stahl [S. 377] (1821), Lehnert (1829), Wolf (1851) und Pröhle (1853 und 1854). Bei den Sagensammlungen
wurde offenkundig Wert darauf gelegt, das Gebiet der heutigen
Bundesrepublik abzudecken, wobei natürlich vor allem die großen Sammlungen Grässes für Preußen und Sachsen (1868/71 und 1874) unverzichtbar waren.
Ausgeklammert wurden – ohne Begründung – das Elsaß, die Schweiz und Österreich. Den Südwesten müssen die zwei badischen Sammlungen Baaders (1851 und 1859) sowie Birlinger/Buck (1861/62) vertreten, Bayern ist nur durch Schöppner (1852/1853) sowie für die Oberpfalz Schönwerth (1857/59) repräsentiert.
Für Hessen (allerdings nur Kurhessen!) steht Lynckers Sammlung
(1854). Das Rheinland erscheint – abgesehen von den preußischen Sagen Grässes – nur mit einer wenig prominenten Kompilation Pröhles (1886), der offenbar als zweimaliger Herausgeber (1856 und 1886) von Harzsagen – im Vorwort wird exemplarisch an ihnen die Quellengeschichte von Sagensammlungen aufgezeigt
– das Wohlwollen des Herausgebers genoß. Für Nord- und Mitteldeutschland sind die frühen Sammlungen von Temme (Altmark 1839, Pommern 1840), Müllenhoff (Schleswig-Holstein 1845) sowie von Kuhn und Schwartz (1843, 1848 und 1859) zu nennen, gefolgt in der zweiten Jahrhunderthälfte
von Schambach 1855 und Bartsch (Mecklenburg 1879/80). Berücksichtigt wurde darüber hinaus Strackerjan für Oldenburg (1909).
Komplettiert wird der Inhalt durch regionale Märchensammlungen sowie Sammlungen, die mehrere Volkserzählungsgattungen im Titel führen: Sommers Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen (1846), die schwäbischen Märchen Meiers (1852), Märchen und Sagen der Brüder Colshorn aus Hannover (1854), Jahns Märchen bzw. Schwänke aus Pommern und Rügen
(1890 und 1891) sowie als jüngstes Werk Spiegels bayerische Märchen von 1914. Eine eigene Erwähnung verdient die Sammlung des meist nur als Humoristen bekannten Wilhelm Busch Ut ôler Welt (München 1910). Nicht so recht zu den beiden im Titel der CD genannten Gattungen passen die Werke von Ludwig
Aurbacher, Büchlein für die Jugend (1834), Ein Volksbüchlein (1827/29). Sie sind als literarische Rezeption von Volksliteratur einzustufen.
Die Auswahlkriterien werden in der – für ein breites Publikum recht trocken geratenen – Einführung Uthers nicht erläutert. Warum fehlt Panzer für Bayern? Vermißt werden im heutigen Baden-Württemberg Ernst Meiers württembergische
Sagen und Birlingers jüngere Sammlung Aus Schwaben. Wieso wurden Wolfs und Bechsteins weitere Sagenausgaben nicht berücksichtigt?
Im wissenschaftlichen Apparat begegnen gelegentlich Nachlässigkeiten und vermeidbare Lücken. Zu Gottschalck wird das Todesjahr nicht angegeben: Er wurde (s. Wellner, A.: Kaspar Friedrich Gottschalck, der Verfasser des ersten
Harzreise-Führers. In: Harz-Zeitschrift 46/47 [1994/95] 91–105) am 15. Juni 1772 in Sondershausen geboren und starb am 17. Juni 1854 in Dresden. Als seine Sagensammlung erschien, war er Assistenzrat des Herzogtums Anhalt-Berneburg in Ballenstedt. Wesentlich weniger einfach spürt man die Lebensdaten von Bernhard Baader auf, die der Herausgeber ebenfalls nicht kennt. Der Geheime Finanzrat Bernhard Baader, teilte mir das Generallandesarchiv Karls[S. 378]ruhe freundlicherweise mit, „wurde am 30. 4. 1790 in Mannheim geboren und
verstarb am 6. 1. 1859 in Karlsruhe. Seine Personalunterlagen befinden sich im GLA unter den Signaturen 76/190 und 232/159, 160“. Ein paar Angaben zu ihm findet man in der Biographie seiner ebenfalls sagensammelnden Ehefrau Amalie (In: Badische Biographien. Bd. 3, Karlsruhe 1881, 8 f.). Zu Bechstein
hätte man die Angabe weiterer maßgeblicher Literatur erwartet, insbesondere der Arbeiten von S. Schmidt-Knaebel (siehe nun ead.: Ludwig Bechstein als Märchenautor. In: LiLi 37,130 [2003] 137–160).
Mit der riesigen Bibliographie, die viel Wertvolles neben Kraut und Rüben bringt, wird man nicht so recht glücklich, denn auf vielen Feldern der Erzählforschung sind grundlegende Studien nicht genannt. Eine kritische Durchsicht der Materialmasse hätte Doppelungen wie Denecke/Deneke oder Peuckert/Peukert
vermieden. Die Suchfunktion wirft nicht weniger als 24 maschinenschriftliche Magisterarbeiten aus. Es darf der dringende Wunsch geäußert werden, solche Arbeiten – wenn irgend möglich – nur mit einer Standortangabe zu zitieren.
Aber das sind alles läßliche Sünden. Erzählforscher werden an den bequem zu durchpflügenden Datenmassen der vorliegenden kleinen Silberscheibe ihre helle Freude haben.
Winningen/Mosel Klaus Graf
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_M%C3%A4rchen_und_Sagen
Da meine Rezension in der FABULA 45 (2004), S. 376-378 nicht kostenfrei online verfügbar war, dokumentiere ich sie im folgenden.
Deutsche Märchen und Sagen. ed. Hans-Jörg U t h e r (Digitale Bibliothek 80). Berlin: Directmedia Publishing GmbH 2002 (CD-ROM mit ca 37 000 S.).
Ein digitaler Meilenstein der Erzählforschung! Nunmehr können 48 teilweise mehrbändige Sammlungen von Märchen und Sagen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit etwa 24 000 Texten im Volltext durchsucht werden. Damit liegt zu einem Preis, den sich jeder Interessierte leisten kann, ein umfangreiches maschinenlesbares Korpus vor, das dank Angabe der originalen
Paginierung und wortgetreuer Wiedergabe der Vorlagen voll zitierfähig ist (wenngleich man sich dazu mit der Seitenumbruchfunktion vertraut machen und vorgeschaltete römische Zählungen ‚erraten‘ muß). Die bewährte
und einfach zu bedienende Suchoberfläche der Digitalen Bibliothek ermöglicht differenzierte Abfragen. Uthers allgemeine Einführung, die biographischen Hinweise zu den Sammlern und die abschließende Bibliographie von mehr als 20 000 Titeln sind wissenschaftlich solides Beiwerk.
Was die Auswahl der digitalisierten Werke betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß aus der Zeit vor den paradigmatischen Sammlungen der Brüder Grimm wertvolle Quellenschriften für jenen historischen Prozeß präsentiert werden, aus dem die Gattungen ‚Märchen‘ und ‚Sage‘ der sogenannten ‚Volksliteratur‘
hervorgingen. Für die Volksmärchen des Musäus (1782/86) wurde der Wortlaut der Artemis-Ausgabe von 1976 zugrundegelegt, für Benedikte Nauberts Volksmärchen (1789/92) ein Druck von 1840. In der Originalausgabe ist dankenswerterweise die erste monographische deutsche Sagensammlung von Nachtigal (1800) greifbar, desgleichen die Bücher von Büsching (1812) und Gottschalck (1814). Von den Grimmschen Märchen wurde sowohl die Erstausgabe von 1812/15 als auch die Artemis-Ausgabe von 1977 erfaßt, während bei den Sagen ausschließlich der Text der Artemis-Ausgabe von 1965 geboten wird. Der Winkler-Verlag mit seiner Artemis-Reihe lieferte auch die Märchen Bechsteins,
während als Grundlage für das Sagenbuch (1853) eine Vorlage von 1930 diente.
Mehr oder minder seltene allgemeine Märchensammlungen wurden aufgenommen von A. L. Grimm (1809 und 1837), Löhr (ca 1819/20), Karoline Stahl [S. 377] (1821), Lehnert (1829), Wolf (1851) und Pröhle (1853 und 1854). Bei den Sagensammlungen
wurde offenkundig Wert darauf gelegt, das Gebiet der heutigen
Bundesrepublik abzudecken, wobei natürlich vor allem die großen Sammlungen Grässes für Preußen und Sachsen (1868/71 und 1874) unverzichtbar waren.
Ausgeklammert wurden – ohne Begründung – das Elsaß, die Schweiz und Österreich. Den Südwesten müssen die zwei badischen Sammlungen Baaders (1851 und 1859) sowie Birlinger/Buck (1861/62) vertreten, Bayern ist nur durch Schöppner (1852/1853) sowie für die Oberpfalz Schönwerth (1857/59) repräsentiert.
Für Hessen (allerdings nur Kurhessen!) steht Lynckers Sammlung
(1854). Das Rheinland erscheint – abgesehen von den preußischen Sagen Grässes – nur mit einer wenig prominenten Kompilation Pröhles (1886), der offenbar als zweimaliger Herausgeber (1856 und 1886) von Harzsagen – im Vorwort wird exemplarisch an ihnen die Quellengeschichte von Sagensammlungen aufgezeigt
– das Wohlwollen des Herausgebers genoß. Für Nord- und Mitteldeutschland sind die frühen Sammlungen von Temme (Altmark 1839, Pommern 1840), Müllenhoff (Schleswig-Holstein 1845) sowie von Kuhn und Schwartz (1843, 1848 und 1859) zu nennen, gefolgt in der zweiten Jahrhunderthälfte
von Schambach 1855 und Bartsch (Mecklenburg 1879/80). Berücksichtigt wurde darüber hinaus Strackerjan für Oldenburg (1909).
Komplettiert wird der Inhalt durch regionale Märchensammlungen sowie Sammlungen, die mehrere Volkserzählungsgattungen im Titel führen: Sommers Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen (1846), die schwäbischen Märchen Meiers (1852), Märchen und Sagen der Brüder Colshorn aus Hannover (1854), Jahns Märchen bzw. Schwänke aus Pommern und Rügen
(1890 und 1891) sowie als jüngstes Werk Spiegels bayerische Märchen von 1914. Eine eigene Erwähnung verdient die Sammlung des meist nur als Humoristen bekannten Wilhelm Busch Ut ôler Welt (München 1910). Nicht so recht zu den beiden im Titel der CD genannten Gattungen passen die Werke von Ludwig
Aurbacher, Büchlein für die Jugend (1834), Ein Volksbüchlein (1827/29). Sie sind als literarische Rezeption von Volksliteratur einzustufen.
Die Auswahlkriterien werden in der – für ein breites Publikum recht trocken geratenen – Einführung Uthers nicht erläutert. Warum fehlt Panzer für Bayern? Vermißt werden im heutigen Baden-Württemberg Ernst Meiers württembergische
Sagen und Birlingers jüngere Sammlung Aus Schwaben. Wieso wurden Wolfs und Bechsteins weitere Sagenausgaben nicht berücksichtigt?
Im wissenschaftlichen Apparat begegnen gelegentlich Nachlässigkeiten und vermeidbare Lücken. Zu Gottschalck wird das Todesjahr nicht angegeben: Er wurde (s. Wellner, A.: Kaspar Friedrich Gottschalck, der Verfasser des ersten
Harzreise-Führers. In: Harz-Zeitschrift 46/47 [1994/95] 91–105) am 15. Juni 1772 in Sondershausen geboren und starb am 17. Juni 1854 in Dresden. Als seine Sagensammlung erschien, war er Assistenzrat des Herzogtums Anhalt-Berneburg in Ballenstedt. Wesentlich weniger einfach spürt man die Lebensdaten von Bernhard Baader auf, die der Herausgeber ebenfalls nicht kennt. Der Geheime Finanzrat Bernhard Baader, teilte mir das Generallandesarchiv Karls[S. 378]ruhe freundlicherweise mit, „wurde am 30. 4. 1790 in Mannheim geboren und
verstarb am 6. 1. 1859 in Karlsruhe. Seine Personalunterlagen befinden sich im GLA unter den Signaturen 76/190 und 232/159, 160“. Ein paar Angaben zu ihm findet man in der Biographie seiner ebenfalls sagensammelnden Ehefrau Amalie (In: Badische Biographien. Bd. 3, Karlsruhe 1881, 8 f.). Zu Bechstein
hätte man die Angabe weiterer maßgeblicher Literatur erwartet, insbesondere der Arbeiten von S. Schmidt-Knaebel (siehe nun ead.: Ludwig Bechstein als Märchenautor. In: LiLi 37,130 [2003] 137–160).
Mit der riesigen Bibliographie, die viel Wertvolles neben Kraut und Rüben bringt, wird man nicht so recht glücklich, denn auf vielen Feldern der Erzählforschung sind grundlegende Studien nicht genannt. Eine kritische Durchsicht der Materialmasse hätte Doppelungen wie Denecke/Deneke oder Peuckert/Peukert
vermieden. Die Suchfunktion wirft nicht weniger als 24 maschinenschriftliche Magisterarbeiten aus. Es darf der dringende Wunsch geäußert werden, solche Arbeiten – wenn irgend möglich – nur mit einer Standortangabe zu zitieren.
Aber das sind alles läßliche Sünden. Erzählforscher werden an den bequem zu durchpflügenden Datenmassen der vorliegenden kleinen Silberscheibe ihre helle Freude haben.
Winningen/Mosel Klaus Graf
http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2009/03078/
Die Bilder zeigen die Trennung von Dokumenten und Schutt des Archivs
Ab sofort stehen auf unseren Seiten Fotos von der Arbeit im „Erstversorgungszentrum" für die geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv der Stadt Köln zum Download bereit. Sie zeigen die Archivare, Restaurateure und ehrenamtlichen Helfer bei der Trennung von Dokumenten und Schutt. Fotografen des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln haben die Bilder aufgenommen. Aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Aufnahmen von Dritten im „Erstversorgungszentrum" nicht zugelassen.
Die Fotos stehen kostenlos für die aktuelle Berichterstattung zur Verfügung. Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung die Herkunft der Aufnahmen an. CDs mit bewegten Bildern können Sie unter der Telefonnummer 0221 / 221-25787 anfordern.
Kommentar: Leider stehen diese Fotos nicht unter freier Lizenz zur Verfügung, sind also z.B. für Wikinews oder Wikipedia ungeeignet.

Die Bilder zeigen die Trennung von Dokumenten und Schutt des Archivs
Ab sofort stehen auf unseren Seiten Fotos von der Arbeit im „Erstversorgungszentrum" für die geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv der Stadt Köln zum Download bereit. Sie zeigen die Archivare, Restaurateure und ehrenamtlichen Helfer bei der Trennung von Dokumenten und Schutt. Fotografen des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln haben die Bilder aufgenommen. Aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Aufnahmen von Dritten im „Erstversorgungszentrum" nicht zugelassen.
Die Fotos stehen kostenlos für die aktuelle Berichterstattung zur Verfügung. Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung die Herkunft der Aufnahmen an. CDs mit bewegten Bildern können Sie unter der Telefonnummer 0221 / 221-25787 anfordern.
Kommentar: Leider stehen diese Fotos nicht unter freier Lizenz zur Verfügung, sind also z.B. für Wikinews oder Wikipedia ungeeignet.

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 19:36 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/228/461849/text/
Die SZ sprach mit dem Bochumer Doktoranden Alexander Berner, der über Kölner Kreuzfahrer promovieren wollte und sich nun ein neues Thema suchen muss.
Die SZ sprach mit dem Bochumer Doktoranden Alexander Berner, der über Kölner Kreuzfahrer promovieren wollte und sich nun ein neues Thema suchen muss.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 19:08 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://twitter.com/Sebastian_Post
Super! Vielen Dank! Auszüge zum Stadtarchiv Köln:
Viele Schutzfilme konnten geborgen werden: Kontakt bzgl. Barbarastollen m. Bund besteht dennoch. Problem: Filme teilweise älter.
Findmittel komplett erhalten. Sammlung v. Digitalisaten im Netz steht man nicht! ablehnend gegenüber. Jedoch nach Absprache m. Archiv!
Arbeitskraft bzw. Hilfe wird noch lange benötigt werden. Klar ist: Das Gedächtnis der Stadt ist nicht verloren. Wir arbeiten an der Rettung!
Zum Archivtag:
http://www.ad-hoc-news.de/archivare-beschaeftigen-sich-mit-koelner--/de/Politik/20112346
Super! Vielen Dank! Auszüge zum Stadtarchiv Köln:
Viele Schutzfilme konnten geborgen werden: Kontakt bzgl. Barbarastollen m. Bund besteht dennoch. Problem: Filme teilweise älter.
Findmittel komplett erhalten. Sammlung v. Digitalisaten im Netz steht man nicht! ablehnend gegenüber. Jedoch nach Absprache m. Archiv!
Arbeitskraft bzw. Hilfe wird noch lange benötigt werden. Klar ist: Das Gedächtnis der Stadt ist nicht verloren. Wir arbeiten an der Rettung!
Zum Archivtag:
http://www.ad-hoc-news.de/archivare-beschaeftigen-sich-mit-koelner--/de/Politik/20112346
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 18:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.sehepunkte.de/2009/03/14673.html
Das besprochene Buch gibts auch online, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4939325/
Das besprochene Buch gibts auch online, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4939325/
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
die DFG fördert seit 2007 die Retrokonversion archivischer Findmittel. Die Fördermittel werden unabhängig von der Größe der Bestände – sie können 1000 oder 100.000 Verzeichnungseinheiten umfassen – und der Archivsparte bewilligt. Wichtig ist lediglich, dass sich Ihr Archiv in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft befindet. Darüber hinaus dürfen die Bestände, für deren Findmittel sie Fördergelder beantragen wollen, keinen Schutz- bzw. Sperrfristen oder anderen Einschränkungen unterliegen.
Für die nächste Antragsphase 2/2009 (Antragstermin Mai/Juni 2009) sowie die darauf folgenden ist das Budget noch nicht erschöpft.
Sollten Sie Interesse an der Retrokonversion Ihrer Findmittel haben, wenden Sie sich gerne an die Koordinierungsstelle Retrokonversion an der Archivschule Marburg (http://www.archivschule.de/content/456.html).
Ansprechpartner:
Ulrike Vogel
Tel.: 06421/16971-37
Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de
Jan Jäckel
Tel.: 06421/16971-94
Mail: Jan.Jaeckel@staff.uni-marburg.de
Mit besten Grüßen
Ulrike Vogel
Leitung Koordinierungsstelle Retrokonversion
Bismarckstraße 32
35037 Marburg
Tel.: 06421/16971-37
Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de
Für die nächste Antragsphase 2/2009 (Antragstermin Mai/Juni 2009) sowie die darauf folgenden ist das Budget noch nicht erschöpft.
Sollten Sie Interesse an der Retrokonversion Ihrer Findmittel haben, wenden Sie sich gerne an die Koordinierungsstelle Retrokonversion an der Archivschule Marburg (http://www.archivschule.de/content/456.html).
Ansprechpartner:
Ulrike Vogel
Tel.: 06421/16971-37
Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de
Jan Jäckel
Tel.: 06421/16971-94
Mail: Jan.Jaeckel@staff.uni-marburg.de
Mit besten Grüßen
Ulrike Vogel
Leitung Koordinierungsstelle Retrokonversion
Bismarckstraße 32
35037 Marburg
Tel.: 06421/16971-37
Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:36 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zitat aus meinem Aufsatz "Kulturgut muß frei" sein (Kunstchronik 2007):
Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:32 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
32 Kommentare zu
http://archiv.twoday.net/stories/5583394/
sind, wenn ich mich nicht täusche, Rekord in diesem Weblog. Die Presse hat nun auch die unglückliche Äußerung aufgegriffen.
http://www.koeln.de/koeln/stadtarchivchefin_wegen_urheberrechtsaeusserung_in_der_kritik_141916.html
Stadtarchiv-Chefin wegen Urheberrechts-Äußerung in der Kritik
Die Initiative "Digitales Historisches Archiv Köln" bietet seit dem 7.März Wissenschaftlern die Möglichkeit, Reproduktionen der Archivalien aus dem eingestürzten Stadtarchiv online zu stellen, um so die Restaurierung der Dokumente zu unterstützen. Ausgerechnet die Leiterin des Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, kritisiert nun mit Hinweis auf mögliche Urheberrechtsverletzungen das ambitionierte Projekt und sorgt damit für Empörung.
"Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", sagte Schmidt-Czaia dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dies verletze jedoch die "Copyright-Rechte" der Dokumente. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", forderte sie die Wissenschaftler auf.
Im Internet stieß die Aussage auf heftige Kritik. So wird im Forum Archivalia unter anderem darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht eines Dokuments 70 Jahre nach dem Tod des Autors verfällt; die meisten der Archivalien sind somit gemeinfrei und dürfen weitergegeben werden.
"Spendenbereitschaft überdenken"
Besonderen Unmut erregt dort die Tatsache, dass sich die Leitung des Stadtarchivs in einer solchen Situation, in der sie auf die Hilfe engagierter Mitbürger angewiesen ist um die Dokumente zu retten, übertrieben bürokratisch an Dinge wie das Urheberrecht klammert. Gerade jetzt sei es wichtig, die Wissenschaftler nicht vor den Kopf zu stoßen sondern das derzeitige Interesse zu nutzen, um möglichst viele Reproduktionen der Dokumente sowie finanzielle Unterstützung zu erhalten. Sowohl im Forum als auch über den Dienst Twitter wurde sogar bereits dazu aufgerufen, seine Spendenbereitschaft gegenüber dem Archiv zu überdenken.
Bemängelt wird dort auch die benutzerunfreundliche Gebührenordnung des ehemaligen Stadtarchivs, welche eine Gebühr von je 2 Euro für ein Digitalfoto eines der Dokumente erhob, auch wenn man eine eigene Kamera mitbrachte. Diese strikte Ordnung könnte, nach Meinung der User, verhindert haben, dass mehr Archivalien digitalisiert wurden.
Kommentar: Bleibt zu hoffen, dass das Stadtarchiv erkennt, dass das Digitale Historische Archiv eine Unterstützung des Stadtarchivs und eine großartige Chance darstellt, zum "Bürgerarchiv" zu werden. Und dass es gelingt, auch den Unterhaltsträger, die Stadt Köln, zu überzeugen, dass der fiskalische Anspruch auf ein paar Kröten in einer Situation absurd ist, wenn man auf das bürgerschaftliche Engament für das Stadtarchiv vital angewiesen ist. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, es gehört uns allen. Und wir müssen den Volksvertretern auf die Finger klopfen, wenn die von ihnen kontrollierte Verwaltung geneigt ist, diesen Grundsatz kurzsichtig über Bord zu werfen.
Ausführlicher begründet habe ich meine Position in dem Beitrag "Kulturgut muß frei sein" in der "Kunstchronik", der in diesem Weblog nachlesbar ist:
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
http://archiv.twoday.net/stories/5583394/
sind, wenn ich mich nicht täusche, Rekord in diesem Weblog. Die Presse hat nun auch die unglückliche Äußerung aufgegriffen.
http://www.koeln.de/koeln/stadtarchivchefin_wegen_urheberrechtsaeusserung_in_der_kritik_141916.html
Stadtarchiv-Chefin wegen Urheberrechts-Äußerung in der Kritik
Die Initiative "Digitales Historisches Archiv Köln" bietet seit dem 7.März Wissenschaftlern die Möglichkeit, Reproduktionen der Archivalien aus dem eingestürzten Stadtarchiv online zu stellen, um so die Restaurierung der Dokumente zu unterstützen. Ausgerechnet die Leiterin des Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, kritisiert nun mit Hinweis auf mögliche Urheberrechtsverletzungen das ambitionierte Projekt und sorgt damit für Empörung.
"Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", sagte Schmidt-Czaia dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dies verletze jedoch die "Copyright-Rechte" der Dokumente. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", forderte sie die Wissenschaftler auf.
Im Internet stieß die Aussage auf heftige Kritik. So wird im Forum Archivalia unter anderem darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht eines Dokuments 70 Jahre nach dem Tod des Autors verfällt; die meisten der Archivalien sind somit gemeinfrei und dürfen weitergegeben werden.
"Spendenbereitschaft überdenken"
Besonderen Unmut erregt dort die Tatsache, dass sich die Leitung des Stadtarchivs in einer solchen Situation, in der sie auf die Hilfe engagierter Mitbürger angewiesen ist um die Dokumente zu retten, übertrieben bürokratisch an Dinge wie das Urheberrecht klammert. Gerade jetzt sei es wichtig, die Wissenschaftler nicht vor den Kopf zu stoßen sondern das derzeitige Interesse zu nutzen, um möglichst viele Reproduktionen der Dokumente sowie finanzielle Unterstützung zu erhalten. Sowohl im Forum als auch über den Dienst Twitter wurde sogar bereits dazu aufgerufen, seine Spendenbereitschaft gegenüber dem Archiv zu überdenken.
Bemängelt wird dort auch die benutzerunfreundliche Gebührenordnung des ehemaligen Stadtarchivs, welche eine Gebühr von je 2 Euro für ein Digitalfoto eines der Dokumente erhob, auch wenn man eine eigene Kamera mitbrachte. Diese strikte Ordnung könnte, nach Meinung der User, verhindert haben, dass mehr Archivalien digitalisiert wurden.
Kommentar: Bleibt zu hoffen, dass das Stadtarchiv erkennt, dass das Digitale Historische Archiv eine Unterstützung des Stadtarchivs und eine großartige Chance darstellt, zum "Bürgerarchiv" zu werden. Und dass es gelingt, auch den Unterhaltsträger, die Stadt Köln, zu überzeugen, dass der fiskalische Anspruch auf ein paar Kröten in einer Situation absurd ist, wenn man auf das bürgerschaftliche Engament für das Stadtarchiv vital angewiesen ist. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, es gehört uns allen. Und wir müssen den Volksvertretern auf die Finger klopfen, wenn die von ihnen kontrollierte Verwaltung geneigt ist, diesen Grundsatz kurzsichtig über Bord zu werfen.
Ausführlicher begründet habe ich meine Position in dem Beitrag "Kulturgut muß frei sein" in der "Kunstchronik", der in diesem Weblog nachlesbar ist:
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.nls.uk/pageturner.cfm?id=74481666
(Danke an FE)
Weitere Digitalisate:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel#Digitalisierte_Exemplare

(Danke an FE)
Weitere Digitalisate:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel#Digitalisierte_Exemplare

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 12:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/essay.html
WHY I AM GOING ON STRIKE
When I got into the bibliography business, over a decade ago, text-posting was a new thing. Sites posting texts (both html transcripts and photographic reproductions) were first being established, it was a period of initial experimentation, so it was very understandable that each site went its own way according to its managers’ ideas of how such a site ought to be operated, and that every site manager felt free to behave as a law unto himself. The situation was a kind of free-wheeling, “Wild West” one, with no agreed-upon standards or conventions. Eleven years later, the number of text-posting sites, many sponsored by well-established libraries and other institutions, has multiplied and the number of available texts has increased, both to astronomic levels, and the availability of a large number of texts in electronic form has become an important feature of contemporary literary culture. But, to my astonishment, the degree of chaos and anarchy has scarcely decreased. While I can name a number of sites which are superbly managed in the best tradition of librarianship, many others fall short of these standards, sometimes to a jaw-dropping degree. I am going to mention some gross offenses against good practice, all of which militate against users’ interests, and these will no doubt strike some readers as impossibly exaggerated, but I could easily document the reality of each and every one of them. And if you rely on posted texts for your work, gentle reader, I can also assure you that your interests are affected by the failure of posting sites to observe good standards. So this is a subject about which you should care. Although your primary reaction should, of course, be a feelingof great gratitude towards anybody who makes texts freely available to you, when you perceive that you are being victimized by shoddy practices, and that your work is being impeded by them, you should not hesitate to make your displeasure known.
What malfeasances do I have in mind? In the first place, when one begins to visit text-posting sites, it quickly becomes evident that there is nothing remotely like uniformity in their structure and design. Nearly all of them are, to some degree, different and some are downright idiosyncratic. The result is that when one visits a new site, one is confronted with the necessity of figuring out how to navigate it and find what one wants (and this sometimes involves an exasperating waste of time), since some are considerably more “user friendly” than others. I am not urging any rigorous standardization of design, but in my work I have visited hundreds of such sites, and the varying degrees to which site designers adhere to good ergonomic principles is very striking. Some sites are a joy to work with, and one immediately feels at home. In the case of others, one has the feeling of being constantly engaged in a duel of wits with the site designer (and sometimes coming out the loser). Clearly, it would be in readers’ interests if sites developed some kind of norms or guidelines regarding design and structure. It is my suspicion, by the way, that some sites are designed, and some important policy decisions made about their management, by low-level technicians with inadequate supervision by professional librarians. If I am right, this is a sure-fire formula for disastrous results. As a general rule, every text-posting site requires “hands-on” supervision by a senior librarian.
The single most important design principle involves informing the reader of what holdings the site makes available. Although some site managers appear to think that a Search function is by itself sufficient, some means for browsing the site’s holdings is no less vital a necessity than is a catalogue for a traditional library. Ideally, there should be two browsable lists, one of authors and the other of titles. And the availability of this browsing feature needs to be prominently advertised on the welcome page rather than stashed away in some obscure corner of the site, so that it is immediately accessible to the viewer. It is extremely frustrating to imagine that the people who maintain text sites lacking this feature probably maintain some sort of running list of their holdings for internal management purposes, but that it has not entered their heads that they need to share this information with the rest of the world. The absence of any kind of browsing or catalogue feature goes particularly far towards diminishing the usefulness of sites, which contain a huge number of offerings: the larger the number, the more important browsing becomes (imagine the Library of Alexandria without Callimachus’ catalogue, and you’ll have some idea of the condition of Google Books and The Internet Archive).
It is also necessary for site managers to grasp this seemingly self-evident point: as soon as they begin to post texts, people are actually going to read them and use them, and to manage their material in such a way as to respect this fact, making sure that readers are helped rather than hindered. They also need to understand that, when they post texts, they are making certain tacit commitments to their readers, which they are henceforth obliged to honor, and that they can reasonably be accused of unethical conduct if they fail to honor them.. And this immediately brings me to the subject of URLs.
There are two ways of presenting a site. The first is to assign a fixed, predictable, and permanent URL to each posted text. The second is to use a Javascript “juke box” technology, so that each time a text is accessed, it is assigned a different and temporary one. The vast superiority of the former method at least ought be obvious, although to the managers of a discouraging number of sites it is, unfortunately, not. Individual readers are going to want to bookmark links to texts of interest. Scholars may want to cite URLs in their publications. Even more, in view of the ever-rising costs associated with traditional print publication, scholarly publication is destined to shift increasingly to electronic form. And, as soon as academicians begin to publish their research electronically, they almost automatically start to explore the possibilities of hypertext, with the result that direct links supplement or even replace traditional bibliographical references. All of this is facilitated by the assignment of unique URL to individual texts, but is rendered impossible by “juke box” technology. The assignment of unique URL’s to individual texts is, in fact, is just as much a feature of good librarianship than the assignment of unique shelfmarks to individual physical holdings in a traditional library.
The key word in the preceding paragraph is “permanent.” Whether they realize this nor not, as soon as they assign a URL to a text, the managers of a site enter into a solemn relation of trust with their visitors. It is a strange thing that librarians who would not dream of tampering with, say, the shelfmarks of their manuscript collections (which in some cases have remained undisturbed for centuries), are capable of making arbitrary and capricious changes in the URLs of their electronic postings, although changes in the latter wreak no less damage than are the former. The very best sites advertise the addresses of their postings as PURL’s (Permanent URL’s), thereby issuing an iron-clad guarantee to visitors that they will remain unchanged. Such sites ought to set the standard for the profession as a whole. When this principle is violated, an important relation of trust with readers is violated. For this I guarantee: as soon as a URL is posted, it will be used, and readers need be able to rely on its continuing validity.
The concept of permanence, of course, goes deeper. Posting a text involves an implicit solemn promise to the reader that the text will stay posted. But on some sites texts can mysteriously disappear without any acknowledgement of their removal. Even entire sites vanish without explanation. Some text-sites are maintained by private individuals, as labors of love. One feels great gratitude and respect for the individuals who maintain such sites, but at the same time one cannot help cringing at how short-lived they are, in all likelihood, destined to be. To speak very much about the issue of the long-term archiving of electronic material would take me too far off-subject, so suffice it to say that as no site is very likely to enjoy great longevity if it does not have institutional sponsorship. And once an institution sets up or sponsors a text-posting site, it is, in effect, assuming a responsibility to keep it available on a long-term basis. But I can name a couple of very valuable institution-sponsored sites that suddenly disappeared, to the appreciable detriment of scholarship.
I am highly conscious that, although I am a professional scholar I am a very amateur librarian who has no business dictating rules to the professionals. But I would be so bold as to insist to librarians that the electronic reproduction of texts, both in html format and as photographic reproductions, has become such an important function performed by modern libraries that the present “Wild West” situation needs to come to an end. Detailed industry-wide uniformity of structure and design may not be necessary or even desirable, but general standards of good procedure and some kind of code of ethical behavior need to be developed and observed by site managers, so that the greatest good can be derived from them, with the least possible harm inflicted. And, clearly, this development needs to be a collective effort. Electronic postings, surely, deserve to be treated with the same systematic care and respect that is shown towards physical holdings as a matter of course. Not being a member of the librarian profession, I have no idea whether the management of text sites is yet formally regarded as a branch of library science, and taught (or even thought about) in the schools that provide instruction in that discipline. If not, it should be, and I respectfully suggest that it is high time that librarians begin talking to each other to develop a set of professional standards and ethics, for the better maintenance of such sites and to guarantee the good progress of the scholarship that depends on them. This will entail the development of some kind of “shame culture” in which errant site managers can be reformed as the result of their peers' disapproval. But the development and observations of such standards is not the exclusive business of librarians. It is the right and responsibility of every scholar who relies on posted texts, and also of the general reading public, to insist that sound managerial practices be developed and followed.
This brings me to my own situation. The dawning realization that the situation I encountered eleven years ago has not fundamentally changed entails a concomitant awareness that I cannot continue working with this bibliography. I was operating according to the assumption that a bibliographical record that was true when created would, over time, remain true, and could be represented as such to readers. Although in the past some relatively minor exceptions to this principle did occur, which I corrected as best I could, I believed that as a general rule it was valid. The fact that, by an act which I regard as a severe breach of faith with its readers, the Gallica site of the Bibliothèque Nationale has changed its URLs, thereby obviating the validity of several thousand entries in the present bibliography, has dramatically brought home to me the fact that, when it comes to maintaining text-posting sites, even the world’s premiere libraries cannot be trusted to adhere to fundamental principles of good library science. And trust between libraries, readers, and bibliographers is what it is all about. In the absence of such trust, therefore, continued effort on maintaining this bibliography would clearly be a waste of effort better spent on other projects. I am therefore going “on strike” and will not invest any more time and effort in this bibliography until the situation has materially improved.
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/
AN ANALYTIC BIBLIOGRAPHY OF ON-LINE NEO-LATIN TEXTS
DANA F. SUTTON
The University of California, Irvine
The enormous profusion of literary texts posted on the World Wide Web will no doubt strike future historians as remarkable and important. But this profusion brings with it an urgent need for many specialized on-line bibliographies. The present one is an analytic bibliography of Latin texts written during the Renaissance and later that are freely available to the general public on the Web (texts posted in access-restricted sites, and Web sites offering electronic texts and digitized photograpic reproductions for sale are not included). Only original sites on which texts are posted are listed here, and not mirror sites.
This page was first posted January 1, 1999 and most recently revised March 16, 2009 . The reader may be interested to know that it currently contains 29,750 records. I urge all those who are able to suggest additions or corrections to this bibliography, as well as those who post new texts on the Web, to inform me by e-mail, so that this bibliography can be kept accurate and up to date. I take this opportunity to express my gratitude to all the individuals who have supplied me with corrections and new information (I extend especial thanks to Klaus Graf and Tommy Tyrberg, who are both responsible for the addition of many hundreds of bibliographical items to this list).
A few further Neo-Latin on-line texts contained in various lists of such items compiled by others are not included here because an invalid URL address is provided. Over the passage of time, of course, some of the URL addresses given here may be changed or broken. If you become aware of such difficulties, I would be grateful to have them drawn to my attention.
NOTE: in addition to standard abbreviations, in this bibliography the special abbreviation dpr (“digitized photographic reproduction”) is employed; unless otherwise specified, the file in question is in PDF format.
NOTE: Access to post-1864 items on the Google Books and University of Michigan University Library sites appear to be blocked for residents of at least some non-US nations.
NOTE: Two sources of texts listed here, La Biblioteca Virtual de Andalucia, and the Universitat de Valéncia Biblioteca Digital, appear to be in the process of rebuilding their sites, and a number of texts previously posted by them are not currently available. These have therefore been at least temporarily withdrawn from this bibliography, but I would hope that they will eventually be posted once more.
EMERGENCY NOTICE
It has been drawn to my attention that the Gallica site of the Bibltiothèque Nationale has, without warning, changed the URLs of its holdings to a new system. The nearly 4000 links to their holdings listed in this bibliography are therefore invalid. At the moment I have no idea of how to cope with this situation, since the new URL scheme is not such that it can be updated in this bibliography by a simple global search-and-replace operation: it appears that each URL would have to be updated manually, which I am unwilling to do. This is, in my opinion, a grave violation of basic principles of library science (no less than if the Bibltiothèque Nationale were to alter the shelfmarks of their physical holdings in an equally arbitrary way), and represents a betrayal of the trust of scholars who use their online material. I request that all affected users of this site join me in contacting the Gallica site to protest this decision in the strongest possible terms, using your professional title, if you have one. They may be contacted at gallica2@bnf.fr
WHY I AM GOING ON STRIKE
When I got into the bibliography business, over a decade ago, text-posting was a new thing. Sites posting texts (both html transcripts and photographic reproductions) were first being established, it was a period of initial experimentation, so it was very understandable that each site went its own way according to its managers’ ideas of how such a site ought to be operated, and that every site manager felt free to behave as a law unto himself. The situation was a kind of free-wheeling, “Wild West” one, with no agreed-upon standards or conventions. Eleven years later, the number of text-posting sites, many sponsored by well-established libraries and other institutions, has multiplied and the number of available texts has increased, both to astronomic levels, and the availability of a large number of texts in electronic form has become an important feature of contemporary literary culture. But, to my astonishment, the degree of chaos and anarchy has scarcely decreased. While I can name a number of sites which are superbly managed in the best tradition of librarianship, many others fall short of these standards, sometimes to a jaw-dropping degree. I am going to mention some gross offenses against good practice, all of which militate against users’ interests, and these will no doubt strike some readers as impossibly exaggerated, but I could easily document the reality of each and every one of them. And if you rely on posted texts for your work, gentle reader, I can also assure you that your interests are affected by the failure of posting sites to observe good standards. So this is a subject about which you should care. Although your primary reaction should, of course, be a feelingof great gratitude towards anybody who makes texts freely available to you, when you perceive that you are being victimized by shoddy practices, and that your work is being impeded by them, you should not hesitate to make your displeasure known.
What malfeasances do I have in mind? In the first place, when one begins to visit text-posting sites, it quickly becomes evident that there is nothing remotely like uniformity in their structure and design. Nearly all of them are, to some degree, different and some are downright idiosyncratic. The result is that when one visits a new site, one is confronted with the necessity of figuring out how to navigate it and find what one wants (and this sometimes involves an exasperating waste of time), since some are considerably more “user friendly” than others. I am not urging any rigorous standardization of design, but in my work I have visited hundreds of such sites, and the varying degrees to which site designers adhere to good ergonomic principles is very striking. Some sites are a joy to work with, and one immediately feels at home. In the case of others, one has the feeling of being constantly engaged in a duel of wits with the site designer (and sometimes coming out the loser). Clearly, it would be in readers’ interests if sites developed some kind of norms or guidelines regarding design and structure. It is my suspicion, by the way, that some sites are designed, and some important policy decisions made about their management, by low-level technicians with inadequate supervision by professional librarians. If I am right, this is a sure-fire formula for disastrous results. As a general rule, every text-posting site requires “hands-on” supervision by a senior librarian.
The single most important design principle involves informing the reader of what holdings the site makes available. Although some site managers appear to think that a Search function is by itself sufficient, some means for browsing the site’s holdings is no less vital a necessity than is a catalogue for a traditional library. Ideally, there should be two browsable lists, one of authors and the other of titles. And the availability of this browsing feature needs to be prominently advertised on the welcome page rather than stashed away in some obscure corner of the site, so that it is immediately accessible to the viewer. It is extremely frustrating to imagine that the people who maintain text sites lacking this feature probably maintain some sort of running list of their holdings for internal management purposes, but that it has not entered their heads that they need to share this information with the rest of the world. The absence of any kind of browsing or catalogue feature goes particularly far towards diminishing the usefulness of sites, which contain a huge number of offerings: the larger the number, the more important browsing becomes (imagine the Library of Alexandria without Callimachus’ catalogue, and you’ll have some idea of the condition of Google Books and The Internet Archive).
It is also necessary for site managers to grasp this seemingly self-evident point: as soon as they begin to post texts, people are actually going to read them and use them, and to manage their material in such a way as to respect this fact, making sure that readers are helped rather than hindered. They also need to understand that, when they post texts, they are making certain tacit commitments to their readers, which they are henceforth obliged to honor, and that they can reasonably be accused of unethical conduct if they fail to honor them.. And this immediately brings me to the subject of URLs.
There are two ways of presenting a site. The first is to assign a fixed, predictable, and permanent URL to each posted text. The second is to use a Javascript “juke box” technology, so that each time a text is accessed, it is assigned a different and temporary one. The vast superiority of the former method at least ought be obvious, although to the managers of a discouraging number of sites it is, unfortunately, not. Individual readers are going to want to bookmark links to texts of interest. Scholars may want to cite URLs in their publications. Even more, in view of the ever-rising costs associated with traditional print publication, scholarly publication is destined to shift increasingly to electronic form. And, as soon as academicians begin to publish their research electronically, they almost automatically start to explore the possibilities of hypertext, with the result that direct links supplement or even replace traditional bibliographical references. All of this is facilitated by the assignment of unique URL to individual texts, but is rendered impossible by “juke box” technology. The assignment of unique URL’s to individual texts is, in fact, is just as much a feature of good librarianship than the assignment of unique shelfmarks to individual physical holdings in a traditional library.
The key word in the preceding paragraph is “permanent.” Whether they realize this nor not, as soon as they assign a URL to a text, the managers of a site enter into a solemn relation of trust with their visitors. It is a strange thing that librarians who would not dream of tampering with, say, the shelfmarks of their manuscript collections (which in some cases have remained undisturbed for centuries), are capable of making arbitrary and capricious changes in the URLs of their electronic postings, although changes in the latter wreak no less damage than are the former. The very best sites advertise the addresses of their postings as PURL’s (Permanent URL’s), thereby issuing an iron-clad guarantee to visitors that they will remain unchanged. Such sites ought to set the standard for the profession as a whole. When this principle is violated, an important relation of trust with readers is violated. For this I guarantee: as soon as a URL is posted, it will be used, and readers need be able to rely on its continuing validity.
The concept of permanence, of course, goes deeper. Posting a text involves an implicit solemn promise to the reader that the text will stay posted. But on some sites texts can mysteriously disappear without any acknowledgement of their removal. Even entire sites vanish without explanation. Some text-sites are maintained by private individuals, as labors of love. One feels great gratitude and respect for the individuals who maintain such sites, but at the same time one cannot help cringing at how short-lived they are, in all likelihood, destined to be. To speak very much about the issue of the long-term archiving of electronic material would take me too far off-subject, so suffice it to say that as no site is very likely to enjoy great longevity if it does not have institutional sponsorship. And once an institution sets up or sponsors a text-posting site, it is, in effect, assuming a responsibility to keep it available on a long-term basis. But I can name a couple of very valuable institution-sponsored sites that suddenly disappeared, to the appreciable detriment of scholarship.
I am highly conscious that, although I am a professional scholar I am a very amateur librarian who has no business dictating rules to the professionals. But I would be so bold as to insist to librarians that the electronic reproduction of texts, both in html format and as photographic reproductions, has become such an important function performed by modern libraries that the present “Wild West” situation needs to come to an end. Detailed industry-wide uniformity of structure and design may not be necessary or even desirable, but general standards of good procedure and some kind of code of ethical behavior need to be developed and observed by site managers, so that the greatest good can be derived from them, with the least possible harm inflicted. And, clearly, this development needs to be a collective effort. Electronic postings, surely, deserve to be treated with the same systematic care and respect that is shown towards physical holdings as a matter of course. Not being a member of the librarian profession, I have no idea whether the management of text sites is yet formally regarded as a branch of library science, and taught (or even thought about) in the schools that provide instruction in that discipline. If not, it should be, and I respectfully suggest that it is high time that librarians begin talking to each other to develop a set of professional standards and ethics, for the better maintenance of such sites and to guarantee the good progress of the scholarship that depends on them. This will entail the development of some kind of “shame culture” in which errant site managers can be reformed as the result of their peers' disapproval. But the development and observations of such standards is not the exclusive business of librarians. It is the right and responsibility of every scholar who relies on posted texts, and also of the general reading public, to insist that sound managerial practices be developed and followed.
This brings me to my own situation. The dawning realization that the situation I encountered eleven years ago has not fundamentally changed entails a concomitant awareness that I cannot continue working with this bibliography. I was operating according to the assumption that a bibliographical record that was true when created would, over time, remain true, and could be represented as such to readers. Although in the past some relatively minor exceptions to this principle did occur, which I corrected as best I could, I believed that as a general rule it was valid. The fact that, by an act which I regard as a severe breach of faith with its readers, the Gallica site of the Bibliothèque Nationale has changed its URLs, thereby obviating the validity of several thousand entries in the present bibliography, has dramatically brought home to me the fact that, when it comes to maintaining text-posting sites, even the world’s premiere libraries cannot be trusted to adhere to fundamental principles of good library science. And trust between libraries, readers, and bibliographers is what it is all about. In the absence of such trust, therefore, continued effort on maintaining this bibliography would clearly be a waste of effort better spent on other projects. I am therefore going “on strike” and will not invest any more time and effort in this bibliography until the situation has materially improved.
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/
AN ANALYTIC BIBLIOGRAPHY OF ON-LINE NEO-LATIN TEXTS
DANA F. SUTTON
The University of California, Irvine
The enormous profusion of literary texts posted on the World Wide Web will no doubt strike future historians as remarkable and important. But this profusion brings with it an urgent need for many specialized on-line bibliographies. The present one is an analytic bibliography of Latin texts written during the Renaissance and later that are freely available to the general public on the Web (texts posted in access-restricted sites, and Web sites offering electronic texts and digitized photograpic reproductions for sale are not included). Only original sites on which texts are posted are listed here, and not mirror sites.
This page was first posted January 1, 1999 and most recently revised March 16, 2009 . The reader may be interested to know that it currently contains 29,750 records. I urge all those who are able to suggest additions or corrections to this bibliography, as well as those who post new texts on the Web, to inform me by e-mail, so that this bibliography can be kept accurate and up to date. I take this opportunity to express my gratitude to all the individuals who have supplied me with corrections and new information (I extend especial thanks to Klaus Graf and Tommy Tyrberg, who are both responsible for the addition of many hundreds of bibliographical items to this list).
A few further Neo-Latin on-line texts contained in various lists of such items compiled by others are not included here because an invalid URL address is provided. Over the passage of time, of course, some of the URL addresses given here may be changed or broken. If you become aware of such difficulties, I would be grateful to have them drawn to my attention.
NOTE: in addition to standard abbreviations, in this bibliography the special abbreviation dpr (“digitized photographic reproduction”) is employed; unless otherwise specified, the file in question is in PDF format.
NOTE: Access to post-1864 items on the Google Books and University of Michigan University Library sites appear to be blocked for residents of at least some non-US nations.
NOTE: Two sources of texts listed here, La Biblioteca Virtual de Andalucia, and the Universitat de Valéncia Biblioteca Digital, appear to be in the process of rebuilding their sites, and a number of texts previously posted by them are not currently available. These have therefore been at least temporarily withdrawn from this bibliography, but I would hope that they will eventually be posted once more.
EMERGENCY NOTICE
It has been drawn to my attention that the Gallica site of the Bibltiothèque Nationale has, without warning, changed the URLs of its holdings to a new system. The nearly 4000 links to their holdings listed in this bibliography are therefore invalid. At the moment I have no idea of how to cope with this situation, since the new URL scheme is not such that it can be updated in this bibliography by a simple global search-and-replace operation: it appears that each URL would have to be updated manually, which I am unwilling to do. This is, in my opinion, a grave violation of basic principles of library science (no less than if the Bibltiothèque Nationale were to alter the shelfmarks of their physical holdings in an equally arbitrary way), and represents a betrayal of the trust of scholars who use their online material. I request that all affected users of this site join me in contacting the Gallica site to protest this decision in the strongest possible terms, using your professional title, if you have one. They may be contacted at gallica2@bnf.fr
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 04:59 - Rubrik: English Corner
http://de.wikisource.org/wiki/Jahrbücher_der_Deutschen_Geschichte
Die Zusammenstellung wurde erheblich überarbeitet und ergänzt.
Die Zusammenstellung wurde erheblich überarbeitet und ergänzt.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 02:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Holley, Rose: How Good Can It Get? Analysing and Improving OCR Accuracy in Large Scale Historic Newspaper Digitisation Programs
http://www.dlib.org/dlib/march09/holley/03holley.html
Basic OCR correction by public users was implemented and tested in the prototype search system released to State and Territory Libraries for testing in December 2007. User correction of text was positively received, though most Libraries asked if and how moderation would take place. It was then implemented in the Beta search system (without moderation), which had a soft release to the public without any publicity on 25 July 2008. In the first three months of use (July - October 2008) the public immediately began correcting OCR. We have found it quite hard to monitor what they are doing, how well they are doing it, and how it is affecting the overall quality of the data, since moderation is not yet in place and login to do it is not mandatory (it is optional) at this stage. We also have had difficulties measuring the accuracy of the OCR-corrected text. We have three methods of measuring text correction: number of lines corrected, number of correction "transactions" (i.e., pressing the "save corrections" button), and number of different articles corrected. However, it is questionable how useful any of the three methods are. We are assuming that all correction transactions are to improve text and make it right. No extra text can be added, only existing lines corrected. No text has been deliberately incorrectly changed as far as we are aware.
The results of user activity within the first 12 weeks of the soft launch (without publicity) are that 868 registered users have corrected text and approximately 390 unregistered users (total of 1,200 text correctors). 700,000 lines of text have been corrected within 50,000 articles. The top text corrector has corrected 50,000 lines of text within nearly 2,000 individual articles. Some articles have had corrections added by more than seven users (e.g., articles in the first Australian newspaper the 1803 Sydney Gazette). This particular issue in its entirety has had several different users working on corrections, because it is difficult to read and is an important newspaper.
User feedback returned via surveys, e-mails, phone calls and the "contact us" form has been overwhelmingly positive and interesting. Users did not expect to be able to correct OCR text. Once they discovered they could, they quickly took to the concept and method, and several reported finding correcting the text both addictive and rewarding. Users were actively correcting much more than they or we had expected to correct. In addition, our own users have the potential to achieve a 100% accuracy rate with their knowledge of English, history and context, whereas our contractors are only achieving an accuracy of 99.5% in the title headings.
See also
Holley, Rose (2009) Many Hands Make Light Work: Public Collaborative Text Correction in Australian Historic Newspapers. ISBN 978-0-642-27694-0. Available at http://www.nla.gov.au/ndp/project_details/documents/ANDP_ManyHands.pdf
Excerpt:
The Australian Newspapers beta service has clearly demonstrated that users want to engage and be
involved with full text newspaper data in new and exciting ways. The use of web 2.0 technologies can
enable this. Without publicity, ‘how‐to’ tutorials or even a familiar and refined interface or concept,
the service still rapidly harnessed an active group of users who are enthusiastically enhancing and
improving the data by use of the text correction, tagging and comments functions. Users have
demonstrated a willingness to work towards the ‘common good’, to volunteer their time, energy, skill,
knowledge and ideas and to be involved long term in a program of national historic significance. The
collaborative activity from this new community is enhancing the quality of the data and therefore the
accuracy of full‐text searching in a way that the National Library of Australia could never have
achieved using its own resources alone.
http://www.dlib.org/dlib/march09/holley/03holley.html
Basic OCR correction by public users was implemented and tested in the prototype search system released to State and Territory Libraries for testing in December 2007. User correction of text was positively received, though most Libraries asked if and how moderation would take place. It was then implemented in the Beta search system (without moderation), which had a soft release to the public without any publicity on 25 July 2008. In the first three months of use (July - October 2008) the public immediately began correcting OCR. We have found it quite hard to monitor what they are doing, how well they are doing it, and how it is affecting the overall quality of the data, since moderation is not yet in place and login to do it is not mandatory (it is optional) at this stage. We also have had difficulties measuring the accuracy of the OCR-corrected text. We have three methods of measuring text correction: number of lines corrected, number of correction "transactions" (i.e., pressing the "save corrections" button), and number of different articles corrected. However, it is questionable how useful any of the three methods are. We are assuming that all correction transactions are to improve text and make it right. No extra text can be added, only existing lines corrected. No text has been deliberately incorrectly changed as far as we are aware.
The results of user activity within the first 12 weeks of the soft launch (without publicity) are that 868 registered users have corrected text and approximately 390 unregistered users (total of 1,200 text correctors). 700,000 lines of text have been corrected within 50,000 articles. The top text corrector has corrected 50,000 lines of text within nearly 2,000 individual articles. Some articles have had corrections added by more than seven users (e.g., articles in the first Australian newspaper the 1803 Sydney Gazette). This particular issue in its entirety has had several different users working on corrections, because it is difficult to read and is an important newspaper.
User feedback returned via surveys, e-mails, phone calls and the "contact us" form has been overwhelmingly positive and interesting. Users did not expect to be able to correct OCR text. Once they discovered they could, they quickly took to the concept and method, and several reported finding correcting the text both addictive and rewarding. Users were actively correcting much more than they or we had expected to correct. In addition, our own users have the potential to achieve a 100% accuracy rate with their knowledge of English, history and context, whereas our contractors are only achieving an accuracy of 99.5% in the title headings.
See also
Holley, Rose (2009) Many Hands Make Light Work: Public Collaborative Text Correction in Australian Historic Newspapers. ISBN 978-0-642-27694-0. Available at http://www.nla.gov.au/ndp/project_details/documents/ANDP_ManyHands.pdf
Excerpt:
The Australian Newspapers beta service has clearly demonstrated that users want to engage and be
involved with full text newspaper data in new and exciting ways. The use of web 2.0 technologies can
enable this. Without publicity, ‘how‐to’ tutorials or even a familiar and refined interface or concept,
the service still rapidly harnessed an active group of users who are enthusiastically enhancing and
improving the data by use of the text correction, tagging and comments functions. Users have
demonstrated a willingness to work towards the ‘common good’, to volunteer their time, energy, skill,
knowledge and ideas and to be involved long term in a program of national historic significance. The
collaborative activity from this new community is enhancing the quality of the data and therefore the
accuracy of full‐text searching in a way that the National Library of Australia could never have
achieved using its own resources alone.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 02:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 00:35 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Also es kann doch nicht sein, daß man von so wertvollen Archiven kein Backup hat. Wie blöd muß ein Archivar sein, von den Beständen nicht zuerst ein Backup zu machen?
http://www.heise.de/foto/news/foren/S-Wo-sind-die-Backups/forum-155538/msg-16441329/read/
Bei anderen Beiträgen ("Gähn, Kulturgut!") kann man sich nur übergeben.
http://www.heise.de/foto/news/foren/S-Wo-sind-die-Backups/forum-155538/msg-16441329/read/
Bei anderen Beiträgen ("Gähn, Kulturgut!") kann man sich nur übergeben.
KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 00:22 - Rubrik: Kommunalarchive
http://infobib.de/blog/2009/03/16/eichstatter-buchvernichtung-nur-vor-schoffengericht/
Aus der Augsburger Allgemeinen http://tinyurl.com/c3vvuv
Vor zwei Jahren geriet der Stein ins Rollen, als zunächst vergeblich eine alte Schallplattensammlung gesucht wurde, die der Uni als Schenkung überlassen worden war. Dann tauchten uralte Bücher auf Flohmärkten und in Antiquaren auf. Des Rätsels Lösung: Angelika Reich, die Chefin der Bibliothek an der Katholischen Universität in der Bischofsstadt hatte geschätzt etwa 80 Tonnen Bücher und Schriften in den Container werfen lassen. Die Stücke stammten aus dem Bestand der bayerischen Kapuziner, die der Uni anvertraut worden waren.
Für 45 Euro am Flohmarkt gekauft und 5000 Euro erzielt
Darunter könnten Werke von erheblichem Wert gewesen sein. Ein Antiquar entdeckte auf einem Flohmarkt mehrere sehr gut erhaltene Bände über Gartenkulturen, für die er 45 Euro zahlte. Wenig später verkaufte er „Deutschlands Obstsorten aus dem Jahr 1905 bis 1934“ für stolze 5000 Euro.
Dagegen leistete die ehemalige Spitze der Uni Eichstätt mit dem damaligen Kanzler Gottfried Freiherr von der Heydte und dem früheren Präsidenten Ruprecht Wimmer der Bibliothekarin Schützenhilfe. Die habe von ihrem Vorgänger tatsächlich sehr viel vergammeltes und verschimmeltes Material aus den Beständen der Kapuziner übernommen.
Es seien sicher nicht strengste Maßstäbe bei Durchsicht und Aussonderung angewendet worden. Im Endeffekt sei der Schaden aber hinnehmbar, hieß es bei einer Pressekonferenz zu dem spektakulären Fall vor Jahresfrist. Eine ähnlich lautende Einschätzung kam später von der Staatsbibliothek. Kritiker sprechen von einem Gefälligkeitsgutachten, das weiteren Schaden von der Uni anwenden sollte.
Ähnlich bewertet die Sachlage jetzt aber auch das Landgericht Ingolstadt. Die Staatsanwaltschaft klagte zuletzt noch die Veruntreuung von 14 Büchern an, das Landgericht reduzierte die Zahl auf zwei. Konkret geht es um ein „Handbüchlein für Kranke, und alle, die um sie herumseyn müssen“ und das „Leben der Heiligen“ von Sirius. Beide Bücher sind aus dem Jahr 1790, also aus der Zeit vor der Säkularisation und deshalb im Besitz des Freistaats.
Das Landgericht schätzt deren Wert aber nicht besonders hoch ein und hat den gesamten Fall deshalb nun an das Schöffengericht Ingolstadt verwiesen. Die Staatsanwaltschaft wird dagegen keine Beschwere einlegen: „Wir wollen da jetzt mal ein Urteil. Das geht ja schon fast zwei Jahre“, so Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Helmut Walter zur Neuburger Rundschau. Wann die „Büchvernichtung von Eichstätt“ verhandelt wird, ist offen.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=eichstätt
Aus der Augsburger Allgemeinen http://tinyurl.com/c3vvuv
Vor zwei Jahren geriet der Stein ins Rollen, als zunächst vergeblich eine alte Schallplattensammlung gesucht wurde, die der Uni als Schenkung überlassen worden war. Dann tauchten uralte Bücher auf Flohmärkten und in Antiquaren auf. Des Rätsels Lösung: Angelika Reich, die Chefin der Bibliothek an der Katholischen Universität in der Bischofsstadt hatte geschätzt etwa 80 Tonnen Bücher und Schriften in den Container werfen lassen. Die Stücke stammten aus dem Bestand der bayerischen Kapuziner, die der Uni anvertraut worden waren.
Für 45 Euro am Flohmarkt gekauft und 5000 Euro erzielt
Darunter könnten Werke von erheblichem Wert gewesen sein. Ein Antiquar entdeckte auf einem Flohmarkt mehrere sehr gut erhaltene Bände über Gartenkulturen, für die er 45 Euro zahlte. Wenig später verkaufte er „Deutschlands Obstsorten aus dem Jahr 1905 bis 1934“ für stolze 5000 Euro.
Dagegen leistete die ehemalige Spitze der Uni Eichstätt mit dem damaligen Kanzler Gottfried Freiherr von der Heydte und dem früheren Präsidenten Ruprecht Wimmer der Bibliothekarin Schützenhilfe. Die habe von ihrem Vorgänger tatsächlich sehr viel vergammeltes und verschimmeltes Material aus den Beständen der Kapuziner übernommen.
Es seien sicher nicht strengste Maßstäbe bei Durchsicht und Aussonderung angewendet worden. Im Endeffekt sei der Schaden aber hinnehmbar, hieß es bei einer Pressekonferenz zu dem spektakulären Fall vor Jahresfrist. Eine ähnlich lautende Einschätzung kam später von der Staatsbibliothek. Kritiker sprechen von einem Gefälligkeitsgutachten, das weiteren Schaden von der Uni anwenden sollte.
Ähnlich bewertet die Sachlage jetzt aber auch das Landgericht Ingolstadt. Die Staatsanwaltschaft klagte zuletzt noch die Veruntreuung von 14 Büchern an, das Landgericht reduzierte die Zahl auf zwei. Konkret geht es um ein „Handbüchlein für Kranke, und alle, die um sie herumseyn müssen“ und das „Leben der Heiligen“ von Sirius. Beide Bücher sind aus dem Jahr 1790, also aus der Zeit vor der Säkularisation und deshalb im Besitz des Freistaats.
Das Landgericht schätzt deren Wert aber nicht besonders hoch ein und hat den gesamten Fall deshalb nun an das Schöffengericht Ingolstadt verwiesen. Die Staatsanwaltschaft wird dagegen keine Beschwere einlegen: „Wir wollen da jetzt mal ein Urteil. Das geht ja schon fast zwei Jahre“, so Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Helmut Walter zur Neuburger Rundschau. Wann die „Büchvernichtung von Eichstätt“ verhandelt wird, ist offen.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=eichstätt
Ältere Jahrgänge beim Internetarchiv:
http://tinyurl.com/d3cfkb [Link geht auf den Aachener Geschichtsverein!]
#histverein
http://tinyurl.com/d3cfkb [Link geht auf den Aachener Geschichtsverein!]
#histverein
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 23:46 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn man ein paar Selbstverständlichkeiten für ein bürgernahes Archiv auflistet
http://archiv.twoday.net/stories/5584413/
wird man mit dem Begriff Schlaraffenland konfrontiert.
Ein Schlaraffenland sähe noch ganz anders aus.
Da wären die Öffnungszeiten, die zu wenig Rücksicht nehmen auf Berufstätige. 24/7 wird sogar schon von deutschen Universitätsbibliotheken angeboten. Natürlich ist spät Abends keine Beratung mehr möglich. Aber z.B. eine Samstagsöffnung wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Oder kostenloser Scan on Demand, den im Bereich gedruckter Literatur schon die Boston Public Library via Open Library und (befristet auf die Anfangsphase) derzeit noch die ULB Düsseldorf bieten.
http://archiv.twoday.net/stories/5584413/
wird man mit dem Begriff Schlaraffenland konfrontiert.
Ein Schlaraffenland sähe noch ganz anders aus.
Da wären die Öffnungszeiten, die zu wenig Rücksicht nehmen auf Berufstätige. 24/7 wird sogar schon von deutschen Universitätsbibliotheken angeboten. Natürlich ist spät Abends keine Beratung mehr möglich. Aber z.B. eine Samstagsöffnung wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Oder kostenloser Scan on Demand, den im Bereich gedruckter Literatur schon die Boston Public Library via Open Library und (befristet auf die Anfangsphase) derzeit noch die ULB Düsseldorf bieten.
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 23:20 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
http://www.ub.uni-koeln.de/
Wurde am Wochenende und noch später vermisst
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/12975
Nichts übrigens auch auf der Hauptseite der Diözesanbibliothek:
http://www.dombibliothek-koeln.de/index1.html
Nachtrag: Zum Zeitpunkt der Abfassung des INETBIB-Beitrags und dieses Beitrags befand sich die mit dem Datum 10.3. versehene Presseerklärung zum Archiveinsturz NICHT auf der Startseite der USB.
Wurde am Wochenende und noch später vermisst
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/12975
Nichts übrigens auch auf der Hauptseite der Diözesanbibliothek:
http://www.dombibliothek-koeln.de/index1.html
Nachtrag: Zum Zeitpunkt der Abfassung des INETBIB-Beitrags und dieses Beitrags befand sich die mit dem Datum 10.3. versehene Presseerklärung zum Archiveinsturz NICHT auf der Startseite der USB.
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 21:58 - Rubrik: Kommunalarchive
Zur Anbietung und Archivierung der nicht mehr fortzuführenden standesamtlichen Nebenregister durch die Personenstandsarchive im Landesarchiv NRW
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/Behoerdeninformation/index.html
Apropos: Nette Idee, ein Intranet Extranet zu nennen.
Zu Personenstandsunterlagen:
http://archiv.twoday.net/search?q=personenstand
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/Behoerdeninformation/index.html
Apropos: Nette Idee, ein Intranet Extranet zu nennen.
Zu Personenstandsunterlagen:
http://archiv.twoday.net/search?q=personenstand
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 21:53 - Rubrik: Staatsarchive
Ist es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, einfach mal zu ahnen, was Web 2.0-Nutzer womöglich wollen können? Nämlich aktuelle Mitteilungen aus allen Kategorien in einem einheitlichen RSS-Feed abrufen zu können? Stattdessen unter "Aktuelles" eine Vielzahl von Angeboten, die teilweise zu nichtssagenden Seiten wie
http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/aus_dem_archiv/index.html
führen, die mit "Schauen Sie gelegentlich wieder rein. Sie werden neue virtuelle Galerien und interessante Dokumente finden" den Besucher verhöhnt. Gern schaue ich wieder rein, wenn mir mein RSS-Feed (oder ganz hip: Twitter) sagt, dass es z.B. eine neue Galerie gibt.
http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/aus_dem_archiv/index.html
führen, die mit "Schauen Sie gelegentlich wieder rein. Sie werden neue virtuelle Galerien und interessante Dokumente finden" den Besucher verhöhnt. Gern schaue ich wieder rein, wenn mir mein RSS-Feed (oder ganz hip: Twitter) sagt, dass es z.B. eine neue Galerie gibt.
Vor einiger Zeit habe ich mal die hier besprochenen Angebote zusammengetragen:
http://archiv.twoday.net/stories/4580594/
http://archiv.twoday.net/stories/4580594/
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 19:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
meldet der Videotext der Kölner WDR-Lokalzeit. Es folgt: "Als Konsequenz aus dem Unglück in der Kölner Severinstraße fordert der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen eine zügige Digitalisierung von Archivbeständen. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs zeige, dass die historischen Kulturschätze von Jahrhunderten innerhalb kürzester Zeit vernichtet werden können. Eine Digitalisierung könne in solchen Fällen zumindest ein detailgenaues Abbild erhalten. Am Standort des Kölner Stadtarchivs liegen Archivalien mit einem geschätzten Wert von 400 Millionen Euro unter Schutt begraben. Viele der einmaligen historischen Dokumente werden wohl für immer verloren sein."
Digitalisierung ist ja durchaus charmant; allein mir fehlt der Glaube, dass trotz der erwähnten Großkatastrophen Digitalisierung flächendeckend (!) als Schutz- oder Ersatzmedium sich durchsetzen wird. Es wäre zielführend diesen populistischen Forderungen eine belastbare Kostenrechnung beizufügen. Spätestens dann wird die erfreuliche Aufmerksamkeit nachlassen.
Quelle:
http://www.wdr.de/studio/koeln/nachrichten/index.html#r2
Digitalisierung ist ja durchaus charmant; allein mir fehlt der Glaube, dass trotz der erwähnten Großkatastrophen Digitalisierung flächendeckend (!) als Schutz- oder Ersatzmedium sich durchsetzen wird. Es wäre zielführend diesen populistischen Forderungen eine belastbare Kostenrechnung beizufügen. Spätestens dann wird die erfreuliche Aufmerksamkeit nachlassen.
Quelle:
http://www.wdr.de/studio/koeln/nachrichten/index.html#r2
Wolf Thomas - am Montag, 16. März 2009, 18:45 - Rubrik: Bestandserhaltung
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/03/google-books-settlement-at-columbia-part-1.html
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/03/google-books-settlement-at-columbia-part-2.html
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/03/google-books-settlement-at-columbia-part-2.html
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 18:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ist die Reproduktion einer veröffentlichten Reproduktion urheberrechtlich nicht geschützten Archivguts durch einen Dritten ohne Zustimmung des Archivs zulässig?"
Zu meiner Antwort von 1989 stehe ich heute noch voll und ganz.
http://archiv.twoday.net/stories/2478252/
Die Argumentation, dass bei der Reproduktion zweidimensionalen Archivguts ("Flachware") kein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG entsteht, wird ausführlicher behandelt in meinem Beitrag zur "Kunstchronik" 2008:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Prof. Dr. Polley schloss sich meiner Sichtweise an:
http://archiv.twoday.net/stories/4345664/
Zur Frage der Genehmigungsvorbehalte
http://archiv.twoday.net/stories/3177566/
Für die in Benutzungsordnungen enthaltenen Genehmigungsvorbehalte bei der Reproduktion von Archivgut gibt es keine hinreichende gesetzliche Ermächtigung. Über die Bestandserhaltung und den Schutz der Rechte Dritter (Datenschutz, Persönlichkeitsrechte usw.) hinaus sind der Archivgesetzgebung einschließlich der Amtlichen Begründungen keinerlei Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die Veröffentlichung von Archivgut reglementieren wollte. Da die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu Genehmigungsvorbehalten nicht beachtet werden, sind die entsprechenden Normen nichtig. Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/2812929/
Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von Archivgut sind unzulässig
http://archiv.twoday.net/stories/2478861/
Einige eher explorative Gedanken zur öffentlichen Hand als Inhaber von Urheberrechten:
http://archiv.twoday.net/stories/3018048/
Zur Anfertigung eigener Reproduktionen durch Benutzer:
http://archiv.twoday.net/stories/4057240/
http://archiv.twoday.net/stories/168920/
Zur "editio princeps" § 71 UrhG siehe die Hinweise
http://archiv.twoday.net/search?q=editio+princeps
Lesenswert ist unbedingt der Beitrag von Silke Clausing
http://www.hypernietzsche.org/events/lmu/clausing.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5601185/
Zu meiner Antwort von 1989 stehe ich heute noch voll und ganz.
http://archiv.twoday.net/stories/2478252/
Die Argumentation, dass bei der Reproduktion zweidimensionalen Archivguts ("Flachware") kein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG entsteht, wird ausführlicher behandelt in meinem Beitrag zur "Kunstchronik" 2008:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Prof. Dr. Polley schloss sich meiner Sichtweise an:
http://archiv.twoday.net/stories/4345664/
Zur Frage der Genehmigungsvorbehalte
http://archiv.twoday.net/stories/3177566/
Für die in Benutzungsordnungen enthaltenen Genehmigungsvorbehalte bei der Reproduktion von Archivgut gibt es keine hinreichende gesetzliche Ermächtigung. Über die Bestandserhaltung und den Schutz der Rechte Dritter (Datenschutz, Persönlichkeitsrechte usw.) hinaus sind der Archivgesetzgebung einschließlich der Amtlichen Begründungen keinerlei Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die Veröffentlichung von Archivgut reglementieren wollte. Da die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu Genehmigungsvorbehalten nicht beachtet werden, sind die entsprechenden Normen nichtig. Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/2812929/
Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von Archivgut sind unzulässig
http://archiv.twoday.net/stories/2478861/
Einige eher explorative Gedanken zur öffentlichen Hand als Inhaber von Urheberrechten:
http://archiv.twoday.net/stories/3018048/
Zur Anfertigung eigener Reproduktionen durch Benutzer:
http://archiv.twoday.net/stories/4057240/
http://archiv.twoday.net/stories/168920/
Zur "editio princeps" § 71 UrhG siehe die Hinweise
http://archiv.twoday.net/search?q=editio+princeps
Lesenswert ist unbedingt der Beitrag von Silke Clausing
http://www.hypernietzsche.org/events/lmu/clausing.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5601185/
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 17:57 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 16:56 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
An der Unglücksstelle hat die Feuerwehr mit zwei Schrägbohrungen festgestellt, dass es im Boden am Übergang von den U-Bahnröhren zum Gleiswechsel-Bauwerk vor dem Archivgrundstück keine Hohlräume oder lockeres Erdreich gibt. Weitere drei Bohrungen sind geplant. Das Notdach zum Schutz des Archivguts ist fast fertig gestellt, es fehlen nur noch fünf von 50 Metern, den Rest haben die Einsatzkräfte sorgfältig mit Planen abgedeckt. Mit Pumpen leitet die Feuerwehr in dem Gleiswechselbauwerk 160 Kubikmeter Grundwasser pro Stunde ab, damit die Bauwerksdecke nicht überspült wird.
An der Schlitzwand des U-Bahn-Bauwerks hat die Feuerwehr gestern so genannte Schreinsbücher entdeckt, historische Dokumente, die mit dem heutigen Grundbuch vergleichbar sind. Deshalb hat man sich entschlossen, entgegen den ursprünglichen Planungen auch am heutigen Sonntag zu arbeiten und die wertvollen Archivalien zu bergen. Ab morgen arbeiten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mit 50 Leuten an der Unglücksstelle. Die Bergung des Archivguts erfolgt von drei Seiten.
von Süden: hier sind Betondecken und zusammengedrückte Schränke sauber geschichtet.
von Norden: dort liegen Schutt und Archivalien völlig durcheinander
vor der Schlitzwand des U-Bahnbauwerks
http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2009/03068/
An der Schlitzwand des U-Bahn-Bauwerks hat die Feuerwehr gestern so genannte Schreinsbücher entdeckt, historische Dokumente, die mit dem heutigen Grundbuch vergleichbar sind. Deshalb hat man sich entschlossen, entgegen den ursprünglichen Planungen auch am heutigen Sonntag zu arbeiten und die wertvollen Archivalien zu bergen. Ab morgen arbeiten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mit 50 Leuten an der Unglücksstelle. Die Bergung des Archivguts erfolgt von drei Seiten.
von Süden: hier sind Betondecken und zusammengedrückte Schränke sauber geschichtet.
von Norden: dort liegen Schutt und Archivalien völlig durcheinander
vor der Schlitzwand des U-Bahnbauwerks
http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2009/03068/
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 16:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 16:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gerade festgestellt bei der Kölner Tristan-Handschrift, von der 10 SW-Bilder bei Foto Marburg vorliegen:
http://www.mr1314.de/3203
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5562438/
Es steht aber auch unter den Neuigkeiten:
http://www.handschriftencensus.de/news
Beim Einsturz des Historischen Archiv der Stadt Köln am 3. März 2009 sind auch die mittelalterlichen Handschriften verschüttet worden. Da es noch Monate oder gar Jahre dauern wird, bis endgültig feststeht, welche Stücke gerettet (und möglicherweise restauriert werden können) und welche Stücke unwiederbringlich als Verlust anzusehen sind, wird im Handschriftencensus bei den über 300 einschlägigen deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters ab sofort angegeben, in wessen Eigentum sich Mikrofilme, Kopien, digitale Aufnahmen usw. der betreffenden Stücke befinden. Alle Institutionen und Privatpersonen, die entsprechende Abbildungen besitzen, werden deshalb gebeten, sich zwecks Verzeichnung mit den Betreuern des Handschriftencensus in Verbindung zu setzen oder die entsprechenden Angaben über das 'Mitteilungsfeld' bei der jeweiligen Handschrift zu übermitteln. Beabsichtigt ist von Seiten des Handschriftencensus keine Digitalisierung oder Veröffentlichung, sondern lediglich der Nachweis, der eine Kontaktaufnahme zum Besitzer des Mikrofilms o.ä. ermöglicht.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, daß von den meisten deutschsprachigen Handschriften des Kölner Stadtarchivs ältere Mikrofilme bei Hill Museum & Monastic Library in den USA vorliegen und dort Abzüge käuflich erworben werden können. - Die Möglichkeit, Abbildungen selbst online zu stellen, bietet das von 'Prometheus' initiierte Projekt 'Das digitale Historische Archiv Köln'.
Kommentar: Es ist bedauerlich, dass der Marburger Census sich nicht selbst an der Digitalisierung beteiligt und Partnerinstitution des digitalen Archivs wird.
http://www.mr1314.de/3203
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/5562438/
Es steht aber auch unter den Neuigkeiten:
http://www.handschriftencensus.de/news
Beim Einsturz des Historischen Archiv der Stadt Köln am 3. März 2009 sind auch die mittelalterlichen Handschriften verschüttet worden. Da es noch Monate oder gar Jahre dauern wird, bis endgültig feststeht, welche Stücke gerettet (und möglicherweise restauriert werden können) und welche Stücke unwiederbringlich als Verlust anzusehen sind, wird im Handschriftencensus bei den über 300 einschlägigen deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters ab sofort angegeben, in wessen Eigentum sich Mikrofilme, Kopien, digitale Aufnahmen usw. der betreffenden Stücke befinden. Alle Institutionen und Privatpersonen, die entsprechende Abbildungen besitzen, werden deshalb gebeten, sich zwecks Verzeichnung mit den Betreuern des Handschriftencensus in Verbindung zu setzen oder die entsprechenden Angaben über das 'Mitteilungsfeld' bei der jeweiligen Handschrift zu übermitteln. Beabsichtigt ist von Seiten des Handschriftencensus keine Digitalisierung oder Veröffentlichung, sondern lediglich der Nachweis, der eine Kontaktaufnahme zum Besitzer des Mikrofilms o.ä. ermöglicht.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, daß von den meisten deutschsprachigen Handschriften des Kölner Stadtarchivs ältere Mikrofilme bei Hill Museum & Monastic Library in den USA vorliegen und dort Abzüge käuflich erworben werden können. - Die Möglichkeit, Abbildungen selbst online zu stellen, bietet das von 'Prometheus' initiierte Projekt 'Das digitale Historische Archiv Köln'.
Kommentar: Es ist bedauerlich, dass der Marburger Census sich nicht selbst an der Digitalisierung beteiligt und Partnerinstitution des digitalen Archivs wird.
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 15:46 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/koeln.html
Möglicherweise werden diese derzeit komplett digitalisiert, da die ersten Digitalisate der Liste das Datum 3/2009 tragen.
Update: Liegen nun komplett vor (April 2009).
Möglicherweise werden diese derzeit komplett digitalisiert, da die ersten Digitalisate der Liste das Datum 3/2009 tragen.
Update: Liegen nun komplett vor (April 2009).
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 15:35 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.bildindex.de
Zahlreiche besonders bedeutende Dokumente aus dem zerstörten Historischen Archiv der Stadt Köln sind im Rheinischen Bildarchiv (RBA) fotografisch dokumentiert. Über 2000 dieser Fotografien sind im 'Bildindex' nachgewiesen. Sie sind als qualitativ hochwertige Abzüge oder Scans beim RBA beziehbar.
Eine Reihe von Aufnahmen zeigen das zerstörte Archivgebäude, dessen Architektur in ihrer Funktionalität vorbildlich war.
Aufgrund irgendwelcher Rivalitäten unterstützt Foto Marburg nicht http://www.historischesarchivkoeln.de
Die Bilder sind für Forschung und akademische Lehre aber unbrauchbar, da auch bei 100 % viel zu klein!

Zahlreiche besonders bedeutende Dokumente aus dem zerstörten Historischen Archiv der Stadt Köln sind im Rheinischen Bildarchiv (RBA) fotografisch dokumentiert. Über 2000 dieser Fotografien sind im 'Bildindex' nachgewiesen. Sie sind als qualitativ hochwertige Abzüge oder Scans beim RBA beziehbar.
Eine Reihe von Aufnahmen zeigen das zerstörte Archivgebäude, dessen Architektur in ihrer Funktionalität vorbildlich war.
Aufgrund irgendwelcher Rivalitäten unterstützt Foto Marburg nicht http://www.historischesarchivkoeln.de
Die Bilder sind für Forschung und akademische Lehre aber unbrauchbar, da auch bei 100 % viel zu klein!

KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 15:13 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 14:59 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 14:41 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fotostoria.de/?p=1320
http://www.heise.de/newsticker/Einsturz-des-Koelner-Stadtarchivs-vernichtet-Foto-Kulturgut--/meldung/134653
http://www.heise.de/newsticker/Einsturz-des-Koelner-Stadtarchivs-vernichtet-Foto-Kulturgut--/meldung/134653
KlausGraf - am Montag, 16. März 2009, 14:29 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 3.3., 4.3., 9.3. und 13.3. berichtete das Kölner THW über die Arbeiten an der Unglücksstelle (mit Bildergalerien).
Quelle:
http://www.thw-koeln.de/
Quelle:
http://www.thw-koeln.de/
Wolf Thomas - am Montag, 16. März 2009, 09:48 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Waren in der Vergangenheit die Archive oft die Stiefkinder der Kulturverwaltungen, so dürfen sie nun angesichts des großen Schadens in Köln nicht das enge Zeitfenster der Aufmerksamkeit verpassen. Auch wenn dies nicht jedem passt, aber gerade jetzt ist es zwingend notwendig, dass die Institutionen ihre Schätze präsentieren und dabei auf ihre jeweilige Situation vor Ort hinweisen. Politik und Öffentlichkeit können mit Anerkennung und Akzeptanz helfen, ganz abgesehen von Vertrauen in die Gedächtnisspeicher unserer Gesellschaft. Da wäre es schon ein Zeichen gewesen, wenn die Bundesregierung sich vor Ort informiert und Zuversicht vermittelt hätte. Archivare arbeiten aber für die Zukunft, und da gehört der Blick nach vorne zum Ausbildungstornister. Das Schicksal des Kölner Stadtarchivs mag mahnen, aber bietet keinen Anlass zur Resignation."
Quelle:
http://www.welt.de/welt_print/article3382649/Selbstbewusste-Archivare.html
Quelle:
http://www.welt.de/welt_print/article3382649/Selbstbewusste-Archivare.html
Wolf Thomas - am Montag, 16. März 2009, 09:28 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen weist die künftigen Arbeitsfelder vfür Archivierende und deren Träger aus:
" ...... Ein zentraler Erinnerungsort der Kölner, der deutschen und europäischen Geschichte ist buchstäblich in der Erde versunken. Was die Ursachen waren, darüber wird nun notwendigerweise spekuliert und vor Ort ermittelt.
Was aber sind die Konsequenzen, welche Entwicklungslinie ist zu ziehen vom Elbhochwasser über den verheerenden Brand der Anna-Amalia-Bibliothek zu den Trümmern des Historischen Archivs der Stadt Köln?
Katastrophen lassen sich nicht grundsätzlich ausschließen! Es hat sie immer gegeben und wird sie immer geben. Doch wir können und müssen unsere Bemühungen weiter verstärken, in möglichst allen Belangen vorzusorgen.
1. Vorsorge ist zu treffen, dass Archiv- und Magazingebäude den Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut (DIN/ISO 11799: 2003) so weit wie möglich genügen! Die Norm muss bei Neu- und Umbauten die Richtschnur und Grundlage der Bauplanung und Kalkulation sein. Damit wäre sicherzustellen, dass das Archiv nicht „auf Sand gebaut“ ist, sondern dass Lage, Beschaffenheit, Gliederung und Stabilität der Archiv- und Magazinbauten dauerhaft und stabil sind.
Nur zu oft wurden und werden hier aus Sparsamkeitsgründen Abstriche gemacht!
2. Vorzusorgen ist ferner, dass Archivgut angemessen aufbewahrt und gelagert wird. Auch das ist Bestandteil der DIN/ISO 11799, doch scheitert oft selbst die elementare vorbeugende Maßnahme, Archivgut angemessen zu verpacken, an den zu geringen Budgets der Archive für Bestandserhaltung. Und gerade in Köln hat sich gezeigt, dass in Archivkarton verpacktes Archivgut weitaus bessere Überlebenschancen hat!
3. Vorsorge ist auch und vor allem im Sinne einer umfassenden Notfallvorsorge erforderlich. Dies machen gerade die Kölner Ereignisse ganz besonders sinnfällig! Schadensereignisse bis hin zu Katastrophen wie in Köln und Weimar werden auch künftig nicht immer abwendbar sein. Aber es muss alles getan werden, um die Folgen eintretender Schadensereignisse zu minimieren! Hierfür ist zwingend erforderlich, dass jede Kulturgut verwahrende Institution aktive Notfallvorsorge betreibt, indem sie:
• eine klare Organisationsstruktur für Schadensereignisse und Krisen aufbaut, d.h. vor allem eine/n im Notfall mit allen nötigen Befugnissen ausgestattete/n Notfallbeauftragte/n bestimmt und entsprechend fortbildet,
• gebäudebezogene Notfall- und Alarmierungspläne entwickelt und stets aktuell hält,
• alle erforderlichen Materialien für den Notfall an einem zugänglichen und zentralen Ort der Institution vorhält (Notfallboxen, Schutzkleidung),
• und vor allem sich mit allen anderen Kulturgut verwahrenden Institutionen vernetzt, indem diese sich in einem Notfallverbund zusammenschließen. Denn bei größeren Schadensereignissen, das haben bereits das Elbhochwasser und der Brand in Weimar erwiesen, müssen alle Maßnahmen nicht nur eilig, sondern vor allem möglichst koordiniert ablaufen, d.h. alle Institutionen eines Notfallverbundes brauchen einen gemeinsamen Alarmierungsplan und eindeutige Regelungen, wer im Notfall für welche Maßnahmen zuständig ist.
• Last but not least: Regelmäßig müssen in der eigenen Institution und im Notfallverbund Szenarien von Notfällen geübt werden!
4. Massiv verstärkt werden müssen schließlich die Bemühungen der Sicherungsverfilmung des Bundes, deren wahre Bedeutung gerade in Anbetracht der Ereignisse in Köln zum Vorschein kommt! Bisweilen als Relikt des Kalten Krieges und als "alter Zopf" belächelt, ist sie nun von unschätzbarem Wert! ...."
Quelle:
http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/forum/2009-03.html
" ...... Ein zentraler Erinnerungsort der Kölner, der deutschen und europäischen Geschichte ist buchstäblich in der Erde versunken. Was die Ursachen waren, darüber wird nun notwendigerweise spekuliert und vor Ort ermittelt.
Was aber sind die Konsequenzen, welche Entwicklungslinie ist zu ziehen vom Elbhochwasser über den verheerenden Brand der Anna-Amalia-Bibliothek zu den Trümmern des Historischen Archivs der Stadt Köln?
Katastrophen lassen sich nicht grundsätzlich ausschließen! Es hat sie immer gegeben und wird sie immer geben. Doch wir können und müssen unsere Bemühungen weiter verstärken, in möglichst allen Belangen vorzusorgen.
1. Vorsorge ist zu treffen, dass Archiv- und Magazingebäude den Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut (DIN/ISO 11799: 2003) so weit wie möglich genügen! Die Norm muss bei Neu- und Umbauten die Richtschnur und Grundlage der Bauplanung und Kalkulation sein. Damit wäre sicherzustellen, dass das Archiv nicht „auf Sand gebaut“ ist, sondern dass Lage, Beschaffenheit, Gliederung und Stabilität der Archiv- und Magazinbauten dauerhaft und stabil sind.
Nur zu oft wurden und werden hier aus Sparsamkeitsgründen Abstriche gemacht!
2. Vorzusorgen ist ferner, dass Archivgut angemessen aufbewahrt und gelagert wird. Auch das ist Bestandteil der DIN/ISO 11799, doch scheitert oft selbst die elementare vorbeugende Maßnahme, Archivgut angemessen zu verpacken, an den zu geringen Budgets der Archive für Bestandserhaltung. Und gerade in Köln hat sich gezeigt, dass in Archivkarton verpacktes Archivgut weitaus bessere Überlebenschancen hat!
3. Vorsorge ist auch und vor allem im Sinne einer umfassenden Notfallvorsorge erforderlich. Dies machen gerade die Kölner Ereignisse ganz besonders sinnfällig! Schadensereignisse bis hin zu Katastrophen wie in Köln und Weimar werden auch künftig nicht immer abwendbar sein. Aber es muss alles getan werden, um die Folgen eintretender Schadensereignisse zu minimieren! Hierfür ist zwingend erforderlich, dass jede Kulturgut verwahrende Institution aktive Notfallvorsorge betreibt, indem sie:
• eine klare Organisationsstruktur für Schadensereignisse und Krisen aufbaut, d.h. vor allem eine/n im Notfall mit allen nötigen Befugnissen ausgestattete/n Notfallbeauftragte/n bestimmt und entsprechend fortbildet,
• gebäudebezogene Notfall- und Alarmierungspläne entwickelt und stets aktuell hält,
• alle erforderlichen Materialien für den Notfall an einem zugänglichen und zentralen Ort der Institution vorhält (Notfallboxen, Schutzkleidung),
• und vor allem sich mit allen anderen Kulturgut verwahrenden Institutionen vernetzt, indem diese sich in einem Notfallverbund zusammenschließen. Denn bei größeren Schadensereignissen, das haben bereits das Elbhochwasser und der Brand in Weimar erwiesen, müssen alle Maßnahmen nicht nur eilig, sondern vor allem möglichst koordiniert ablaufen, d.h. alle Institutionen eines Notfallverbundes brauchen einen gemeinsamen Alarmierungsplan und eindeutige Regelungen, wer im Notfall für welche Maßnahmen zuständig ist.
• Last but not least: Regelmäßig müssen in der eigenen Institution und im Notfallverbund Szenarien von Notfällen geübt werden!
4. Massiv verstärkt werden müssen schließlich die Bemühungen der Sicherungsverfilmung des Bundes, deren wahre Bedeutung gerade in Anbetracht der Ereignisse in Köln zum Vorschein kommt! Bisweilen als Relikt des Kalten Krieges und als "alter Zopf" belächelt, ist sie nun von unschätzbarem Wert! ...."
Quelle:
http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/forum/2009-03.html
Wolf Thomas - am Montag, 16. März 2009, 09:22 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
sollen digitalisiert und zugänglich gemacht werden. Es handelt sich meist um summarische Verfahren der Militärgerichte Nummern 11, 12 und 13 (mit Sitz in Fuencarral, Madrid) und Valencia. Diese Dokumente sollen in das neue Generalarchiv (Archivo General Histórico de Defensa) in Madrid (Paseo de Moret) verlegt werden. Dort sollen sie restauriert und digitalisiert werden.
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Luz/consejos/guerra/Franco/elpepucul/20090316elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Luz/consejos/guerra/Franco/elpepucul/20090316elpepicul_1/Tes
vom hofe - am Montag, 16. März 2009, 08:49
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=6698
Friedrich Meyers Vorstellung von Teilhabe ist also nicht unbedingt diesselbe, die Bibliotheken pflegen (sollten). Wenn man wie er, warum auch immer, derart auf Konfrontationskurs geht, sollte man vielleicht mit etwas weniger feuchtem Pulver laden. Sonst wird’s nicht mal ein Börsenblattschuß.
Friedrich Meyers Vorstellung von Teilhabe ist also nicht unbedingt diesselbe, die Bibliotheken pflegen (sollten). Wenn man wie er, warum auch immer, derart auf Konfrontationskurs geht, sollte man vielleicht mit etwas weniger feuchtem Pulver laden. Sonst wird’s nicht mal ein Börsenblattschuß.
Die Causa Karlsruhe geriet in den letzten Tagen verständlicherweise etwas aus unserem Blickfeld, aber die BLB berichtet wie gehabt:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Auszug:
Zu den Kunstgütern, die nach dem Gutachten der Expertenkommission bislang unstreitig Eigentum des Hauses Baden sind und vom Land erworben werden sollen, gehören vier Skulpturen aus der Kunsthalle Karlsruhe, sowie Handschriften aus der Badischen Landesbibliothek. Darunter zwei Tulpenbücher, das Werk "Speculum Humanae Salvationis" sowie der Teilnachlass Hebel. Hinzu kommen weitere Tulpenbücher aus dem Generallandesarchiv, der künstlerische Nachlass von Joseph Kopf im Badischen Landesmuseum sowie die Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz. Nicht verkaufen wollte das Haus Baden das im Generallandesarchiv lagernde Klosterarchiv Salem.
Siehe dazu auch
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/salem/art372491,3663002
Monatelang durchliefen Scharen von Architekten und Kunsthistorikern die frostkalten Gemäuer. Jedes Bild, jeder Wandbehang, jeder Leuchter wurde inventarisiert, geschätzt und auf Besitz und Eigentum geprüft, was ein kleiner, aber erheblicher Unterschied im Streit um die badischen Kulturgüter ist. Anders als das Haus Württemberg, beließ es das Haus Baden seit Beginn des 20. Jahrhunderts bei einem rechtlich diffusen Zustand (siehe Text rechts). In den Museen und Bibliotheken des Landes hingen und standen Kunst- und Kulturgüter, die, wie die so genannten Tulpenbücher oder die Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz, eindeutig dem Haus Baden gehörten.
Im Zuge der Verhandlungen kam, gestützt auf vorhandene Expertisen, mehr Licht ins Dunkel. Experten von der Kulturstiftung der Länder rieten, badische Kulturgüter für 17 Millionen Euro zu kaufen. Dabei nahm man längst nicht alles. Mal wollte das Haus Baden sein Klosterarchiv, den alten Thronsessel oder die Abtskrümme nicht veräußern, mal lehnte das Land wie bei der Jüncke'schen Sammlung dankend ab, weil deren historischer Wert den ministeriellen Fachleuten schon sehr übersichtlich schien.
Die "Einschränkung der freien Beweglichkeit" der rund 200 Gegenstände musste ebenso geprüft werden wie deren Eintrag in der Denkmalschutzliste. Man sprach über Preise, über Abschläge und Rabatte, weil etwa ein Beichtstuhl oder ein Kruzifix aus dem Salemer Münster zwar verkauft werden kann, seinen angestammten Platz aber wohl nie verlassen wird. Ein bisschen Bazar also. Aber es gab auch Gegenstände, die nicht eindeutig zuzuordnen, also juristisch "strittig" waren. Streitwert: rund 300 Millionen Euro. Als Oettinger einen ersten Vergleich anstrebte, scheiterte er kläglich. Die internationalen Hüter der Bibliophilie schlugen Alarm, als historische Bücher und Handschriften in der Verhandlungsmasse aufgehen sollten. Und Oettinger haftete der Ruf des geschichtslosen Managers an.
Das wurmte den Christdemokraten. War er doch der einzige, der dieses heiße Eisen anpackte, während die Filbingers, Späths und Teufels die Causa Baden immer aufs Neue in der untersten Schublade abgeladen hatten. Auch wenn der schwäbische Premier das frühere Zisterzienserkloster schon mal als "alten Kasten" tituliert, mit dem man kein Geld verdienen könne, wird er ins Geschichtsbuch eingehen als Ministerpräsident, der Rechtsfrieden herstellte mit dem Haus Baden. Zwar wird es keinen formellen "Klageverzicht" geben, aber doch eine Art "Generalbereinigung": Das Haus Baden übergibt Kunst und Kultur offiziell ans Land. 15 Millionen Euro zahlt das Land im Gegenzug. "Angemessen" sei das, meint Wissenschaftsminister Peter Frankenberg. Die Summe könne man "guten Gewissens" zahlen, um "reinen Tisch zu machen".
Das Land wird sich nicht verschulden müssen für die Salemer Immobilie samt "Aufbauten und Zubehör", die ab diesem Sommer durch die Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg "bespielt" werden soll. Finanzminister Stächele gibt bereits den selbstbewussten Schlossherrn: "Vom Tag der Vertragsunterzeichnung an, muss spürbar sein, dass der Wind des Landes weht." Im Sommer ist ein großes Landesfest geplant. Dann allerdings könnte doch Manches beim Alten bleiben: Weinproben im Herbst, Weihnachtsmarkt im Advent.
Die markgräfliche Familie muss - theoretisch - für "private" Veranstaltungen auf dem Areal Raummiete zahlen, "wenn es nicht karitativ ist", so heißt es aus der ministeriellen Fachabteilung. Es scheint nur eine vertragliche Fußnote, aber für die politische Opposition bleibt es der zentrale Kritikpunkt: Das Adelshaus mit Oberhaupt Max an der Spitze residiert weiter in der Schlossanlage, genauer: in der Prälatur. Den "Prinz zum Anfassen", wie Oettinger einmal flapsig formulierte, wird es zwar nicht geben. Der Generalbevollmächtigte und Baden-Manager Bernhard wohnt mit Familie längst im früheren Forsthaus abseits. Aber das Haus Baden bleibt doch deutlich präsent. "Wir wären dumm, die Familie nicht als Ratgeber zu nutzen", verteidigt Finanz-Staatssekretär Gundolf Fleischer die öffentlich-private Lösung.
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Auszug:
Zu den Kunstgütern, die nach dem Gutachten der Expertenkommission bislang unstreitig Eigentum des Hauses Baden sind und vom Land erworben werden sollen, gehören vier Skulpturen aus der Kunsthalle Karlsruhe, sowie Handschriften aus der Badischen Landesbibliothek. Darunter zwei Tulpenbücher, das Werk "Speculum Humanae Salvationis" sowie der Teilnachlass Hebel. Hinzu kommen weitere Tulpenbücher aus dem Generallandesarchiv, der künstlerische Nachlass von Joseph Kopf im Badischen Landesmuseum sowie die Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz. Nicht verkaufen wollte das Haus Baden das im Generallandesarchiv lagernde Klosterarchiv Salem.
Siehe dazu auch
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/salem/art372491,3663002
Monatelang durchliefen Scharen von Architekten und Kunsthistorikern die frostkalten Gemäuer. Jedes Bild, jeder Wandbehang, jeder Leuchter wurde inventarisiert, geschätzt und auf Besitz und Eigentum geprüft, was ein kleiner, aber erheblicher Unterschied im Streit um die badischen Kulturgüter ist. Anders als das Haus Württemberg, beließ es das Haus Baden seit Beginn des 20. Jahrhunderts bei einem rechtlich diffusen Zustand (siehe Text rechts). In den Museen und Bibliotheken des Landes hingen und standen Kunst- und Kulturgüter, die, wie die so genannten Tulpenbücher oder die Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz, eindeutig dem Haus Baden gehörten.
Im Zuge der Verhandlungen kam, gestützt auf vorhandene Expertisen, mehr Licht ins Dunkel. Experten von der Kulturstiftung der Länder rieten, badische Kulturgüter für 17 Millionen Euro zu kaufen. Dabei nahm man längst nicht alles. Mal wollte das Haus Baden sein Klosterarchiv, den alten Thronsessel oder die Abtskrümme nicht veräußern, mal lehnte das Land wie bei der Jüncke'schen Sammlung dankend ab, weil deren historischer Wert den ministeriellen Fachleuten schon sehr übersichtlich schien.
Die "Einschränkung der freien Beweglichkeit" der rund 200 Gegenstände musste ebenso geprüft werden wie deren Eintrag in der Denkmalschutzliste. Man sprach über Preise, über Abschläge und Rabatte, weil etwa ein Beichtstuhl oder ein Kruzifix aus dem Salemer Münster zwar verkauft werden kann, seinen angestammten Platz aber wohl nie verlassen wird. Ein bisschen Bazar also. Aber es gab auch Gegenstände, die nicht eindeutig zuzuordnen, also juristisch "strittig" waren. Streitwert: rund 300 Millionen Euro. Als Oettinger einen ersten Vergleich anstrebte, scheiterte er kläglich. Die internationalen Hüter der Bibliophilie schlugen Alarm, als historische Bücher und Handschriften in der Verhandlungsmasse aufgehen sollten. Und Oettinger haftete der Ruf des geschichtslosen Managers an.
Das wurmte den Christdemokraten. War er doch der einzige, der dieses heiße Eisen anpackte, während die Filbingers, Späths und Teufels die Causa Baden immer aufs Neue in der untersten Schublade abgeladen hatten. Auch wenn der schwäbische Premier das frühere Zisterzienserkloster schon mal als "alten Kasten" tituliert, mit dem man kein Geld verdienen könne, wird er ins Geschichtsbuch eingehen als Ministerpräsident, der Rechtsfrieden herstellte mit dem Haus Baden. Zwar wird es keinen formellen "Klageverzicht" geben, aber doch eine Art "Generalbereinigung": Das Haus Baden übergibt Kunst und Kultur offiziell ans Land. 15 Millionen Euro zahlt das Land im Gegenzug. "Angemessen" sei das, meint Wissenschaftsminister Peter Frankenberg. Die Summe könne man "guten Gewissens" zahlen, um "reinen Tisch zu machen".
Das Land wird sich nicht verschulden müssen für die Salemer Immobilie samt "Aufbauten und Zubehör", die ab diesem Sommer durch die Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg "bespielt" werden soll. Finanzminister Stächele gibt bereits den selbstbewussten Schlossherrn: "Vom Tag der Vertragsunterzeichnung an, muss spürbar sein, dass der Wind des Landes weht." Im Sommer ist ein großes Landesfest geplant. Dann allerdings könnte doch Manches beim Alten bleiben: Weinproben im Herbst, Weihnachtsmarkt im Advent.
Die markgräfliche Familie muss - theoretisch - für "private" Veranstaltungen auf dem Areal Raummiete zahlen, "wenn es nicht karitativ ist", so heißt es aus der ministeriellen Fachabteilung. Es scheint nur eine vertragliche Fußnote, aber für die politische Opposition bleibt es der zentrale Kritikpunkt: Das Adelshaus mit Oberhaupt Max an der Spitze residiert weiter in der Schlossanlage, genauer: in der Prälatur. Den "Prinz zum Anfassen", wie Oettinger einmal flapsig formulierte, wird es zwar nicht geben. Der Generalbevollmächtigte und Baden-Manager Bernhard wohnt mit Familie längst im früheren Forsthaus abseits. Aber das Haus Baden bleibt doch deutlich präsent. "Wir wären dumm, die Familie nicht als Ratgeber zu nutzen", verteidigt Finanz-Staatssekretär Gundolf Fleischer die öffentlich-private Lösung.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Bürgerarchiv wäre zuallererst für seine Kunden, die Bürgerinnen und Bürger, da, als moderne Serviceeinrichtung, die sich der neuen Medien bedient und ganz dem Gedanken der Offenheit und Transparenz verpflichtet ist.
Ein Bürgerarchiv ist sich ständig bewusst, dass seine Benutzer als Steuerzahler bereits für den Unterhalt des Archivs gezahlt haben.
Ein Bürgerarchiv bietet seinen Service möglichst kostenlos, jedenfalls aber zu günstigen Preisen an und stellt in Rechnung, dass Forschung und Publizität z.B. durch Presseveröffentlichungen im öffentlichen Interesse liegen und daher unter keinen Umständen durch die Preisgestaltung behindert werden dürfen.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, ein "Eintrittsgeld" z.B. in Höhe von 2 Euro pro Tag von jedem zu verlangen, der Archivgut einsehen will.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, 30 Euro für Inanspruchnahme technischer Geräte je angefangener halber Stunde zu berechnen, wenn man einen Film ansehen oder ein Tondokument anhören will.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, die Forschung und die Bürger durch absurd hohe Kopier- und Digitalisierungsgebühren zu maßregeln.
Ein Bürgerarchiv freut sich über jede private Reproduktion und erlaubt kostenlos das Benutzen der eigenen Digitalkamera, ohne je Foto 2 Euro in Rechnung zu stellen.
Ein Bürgerarchiv orientiert sich bei seinen Kopiergebühren an den in Bibliotheken üblichen günstigeren Tarifen.
Ein Bürgerarchiv stellt ebenso wie bereits einige deutsche Bibliotheken einen Auflichtscanner auf, an dem Benutzer selbst - gegebenenfalls unter Aufsicht - Scans anfertigen und kostenlos auf dem USB-Stick abspeichern dürfen.
Ein Bürgerarchiv verzichtet auf jegliche Reproduktionsgebühren, die über die Herstellungskosten hinausgehen.
Ein Bürgerarchiv sieht in denjenigen, die Archivgut veröffentlichen wollen, Partner der eigenen Öffentlichkeitsarbeit und nicht Weihnachtsgänse, die es auszunehmen gilt.
Ein Bürgerarchiv arbeitet mit dem Medien als den Partnern der eigenen Öffentlichkeitsarbeit eng zusammen und stellt ihnen nur dann Kosten in Rechnung, wenn ein außergewöhnlicher Aufwand vorliegt.
Ein Bürgerarchiv beantwortet Anfragen kostenlos und unter Beifügung von kostenlosen Kopien oder Scans, wenn es sich um eine geringfügige Anzahl handelt (wie dies auch Bibliotheken praktizieren und kleinere Archive).
Ein Bürgerarchiv unterhält ein ständig wachsendes attraktives und benutzerfreundliches Angebot an im Internet kostenfrei zugänglichen Digitalisaten, die nach den Grundsätzen von "Open Access" libre nachnutzbar sind (z.B. Gemeinfreies ohne Beschränkungen, anderes CC-BY oder CC-BY-NC).
Ein Bürgerarchiv verzichtet auf Copyfraud, beansprucht also keine Rechte, die ihm nicht zustehen.
Ein Bürgerarchiv freut sich, wenn andere Institutionen Archivgut im Internet veröffentlichen und unterstützt insbesondere wissenschaftliche Projekte dabei.
Ein Bürgerarchiv betreibt aktives Fundraising, um alle diese Serviceangebote finanzieren zu können.
Ein Bürgerarchiv ist sich ständig bewusst, dass seine Benutzer als Steuerzahler bereits für den Unterhalt des Archivs gezahlt haben.
Ein Bürgerarchiv bietet seinen Service möglichst kostenlos, jedenfalls aber zu günstigen Preisen an und stellt in Rechnung, dass Forschung und Publizität z.B. durch Presseveröffentlichungen im öffentlichen Interesse liegen und daher unter keinen Umständen durch die Preisgestaltung behindert werden dürfen.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, ein "Eintrittsgeld" z.B. in Höhe von 2 Euro pro Tag von jedem zu verlangen, der Archivgut einsehen will.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, 30 Euro für Inanspruchnahme technischer Geräte je angefangener halber Stunde zu berechnen, wenn man einen Film ansehen oder ein Tondokument anhören will.
Ein Bürgerarchiv verzichtet darauf, die Forschung und die Bürger durch absurd hohe Kopier- und Digitalisierungsgebühren zu maßregeln.
Ein Bürgerarchiv freut sich über jede private Reproduktion und erlaubt kostenlos das Benutzen der eigenen Digitalkamera, ohne je Foto 2 Euro in Rechnung zu stellen.
Ein Bürgerarchiv orientiert sich bei seinen Kopiergebühren an den in Bibliotheken üblichen günstigeren Tarifen.
Ein Bürgerarchiv stellt ebenso wie bereits einige deutsche Bibliotheken einen Auflichtscanner auf, an dem Benutzer selbst - gegebenenfalls unter Aufsicht - Scans anfertigen und kostenlos auf dem USB-Stick abspeichern dürfen.
Ein Bürgerarchiv verzichtet auf jegliche Reproduktionsgebühren, die über die Herstellungskosten hinausgehen.
Ein Bürgerarchiv sieht in denjenigen, die Archivgut veröffentlichen wollen, Partner der eigenen Öffentlichkeitsarbeit und nicht Weihnachtsgänse, die es auszunehmen gilt.
Ein Bürgerarchiv arbeitet mit dem Medien als den Partnern der eigenen Öffentlichkeitsarbeit eng zusammen und stellt ihnen nur dann Kosten in Rechnung, wenn ein außergewöhnlicher Aufwand vorliegt.
Ein Bürgerarchiv beantwortet Anfragen kostenlos und unter Beifügung von kostenlosen Kopien oder Scans, wenn es sich um eine geringfügige Anzahl handelt (wie dies auch Bibliotheken praktizieren und kleinere Archive).
Ein Bürgerarchiv unterhält ein ständig wachsendes attraktives und benutzerfreundliches Angebot an im Internet kostenfrei zugänglichen Digitalisaten, die nach den Grundsätzen von "Open Access" libre nachnutzbar sind (z.B. Gemeinfreies ohne Beschränkungen, anderes CC-BY oder CC-BY-NC).
Ein Bürgerarchiv verzichtet auf Copyfraud, beansprucht also keine Rechte, die ihm nicht zustehen.
Ein Bürgerarchiv freut sich, wenn andere Institutionen Archivgut im Internet veröffentlichen und unterstützt insbesondere wissenschaftliche Projekte dabei.
Ein Bürgerarchiv betreibt aktives Fundraising, um alle diese Serviceangebote finanzieren zu können.
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 20:30 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Nach der Bergung des zweiten Vermissten am Donnerstagabend will sich die Feuerwehr nun auf die Rettung der Archivalien im Wert von mehreren Millionen Euro konzentrieren. Das dazu errichtete Notdach sei nahezu abgeschlossen, sagte Feuerwehrchef Stephan Neuhoff. Die Arbeiten seien über das Wochenende weiter gelaufen. Am Samstagnachmittag hätten die Einsatzkräfte mit sogenannten Schreinsbüchern «sehr wertvolle Funde aus dem Mittelalter gemacht»
http://www.derwesten.de/nachrichten/2009/3/15/news-114473715/detail.html
http://news.google.de/news?pz=1&ned=de&hl=de&q=schreinsbücher&scoring=n
http://www.derwesten.de/nachrichten/2009/3/15/news-114473715/detail.html
http://news.google.de/news?pz=1&ned=de&hl=de&q=schreinsbücher&scoring=n
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 19:01 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Satzung für das Historische Archiv der Stadt Köln
vom
30. August 2007
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19. Juni 2007 aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen:
§ 1
(1) Das Historische Archiv der Stadt Köln ist eine öffentliche Einrichtung.
(2) Das Historische Archiv der Stadt Köln verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung (AO 1977).
(3) Das Historische Archiv der Stadt Köln dient folgenden Zwecken:
1. Es unterstützt Rat und Verwaltung bei der Produktion und Organisation des digitalen und analogen Schriftgutes.
2. Es bewertet und übernimmt das zur dauernden Aufbewahrung bestimmte analoge und digitale Schrift,- Karten-, Bild-, Ton- und sonstige Registraturgut der Dienststellen, Betriebe und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Köln, das für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht mehr benötigt wird.
3. Es steht Rat und Verwaltung der Stadt Köln sowie den Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie den Gerichten zur dienstlichen Benutzung zur Verfügung.
4. Es ermöglicht die wissenschaftliche und private Nutzung seiner Bestände.
5. Es führt Veranstaltungen als Beitrag zur geschichtlichen Bildung und Unterrichtung der breiten Öffentlichkeit durch.
6. Es unterstützt und betreibt die wissenschaftliche Erforschung der Kölner Stadtgeschichte
§ 2
(1) Das Historische Archiv der Stadt Köln ist selbstlos tätig. Es verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, zum Beispiel gewerbliche oder sonstige Erwerbszwecke.
(2) Mittel des Historischen Archivs der Stadt Köln dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Köln erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Historischen Archivs.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Historischen Archivs der Stadt Köln fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(4) Bei Auflösung des Historischen Archivs der Stadt Köln oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das Vermögen des Historischen Archivs der Stadt Köln nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung).
§ 3
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für das Historische Archiv der Stadt Köln vom 21. März 1977 außer Kraft.
Quelle
vom
30. August 2007
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19. Juni 2007 aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen:
§ 1
(1) Das Historische Archiv der Stadt Köln ist eine öffentliche Einrichtung.
(2) Das Historische Archiv der Stadt Köln verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung (AO 1977).
(3) Das Historische Archiv der Stadt Köln dient folgenden Zwecken:
1. Es unterstützt Rat und Verwaltung bei der Produktion und Organisation des digitalen und analogen Schriftgutes.
2. Es bewertet und übernimmt das zur dauernden Aufbewahrung bestimmte analoge und digitale Schrift,- Karten-, Bild-, Ton- und sonstige Registraturgut der Dienststellen, Betriebe und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Köln, das für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht mehr benötigt wird.
3. Es steht Rat und Verwaltung der Stadt Köln sowie den Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie den Gerichten zur dienstlichen Benutzung zur Verfügung.
4. Es ermöglicht die wissenschaftliche und private Nutzung seiner Bestände.
5. Es führt Veranstaltungen als Beitrag zur geschichtlichen Bildung und Unterrichtung der breiten Öffentlichkeit durch.
6. Es unterstützt und betreibt die wissenschaftliche Erforschung der Kölner Stadtgeschichte
§ 2
(1) Das Historische Archiv der Stadt Köln ist selbstlos tätig. Es verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, zum Beispiel gewerbliche oder sonstige Erwerbszwecke.
(2) Mittel des Historischen Archivs der Stadt Köln dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Köln erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Historischen Archivs.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Historischen Archivs der Stadt Köln fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(4) Bei Auflösung des Historischen Archivs der Stadt Köln oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das Vermögen des Historischen Archivs der Stadt Köln nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung).
§ 3
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für das Historische Archiv der Stadt Köln vom 21. März 1977 außer Kraft.
Quelle
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 17:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641900.shtml
Ein neues Stadtarchiv in Köln könnte es nach Einschätzung von Kulturdezernent Georg Quander erst in fünf Jahren geben. Zunächst müsse ein Standort für den Bau gefunden werden, sagte Quander am Wochenende. "Wenn das neue Gebäude steht, muss es erstmal zwei Jahre durchgeheizt werden, damit die Wände so trocken sind, dass sie keine Feuchtigkeit an die Archivalien abgeben." Er rechne insgesamt mit fünf Jahren. [...]
Die Direktorin des Kölner Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, verwies darauf, dass die Bergung der Archivalien noch immer gefährlich sei, weil ständig die Gefahr bestehe, dass Schutt ins Rutschen komme. Die Bergung werde noch mindestens sechs Monate dauern. Eine großen Hilfe sei jedoch das provisorische Holzdach über dem Trümmerfeld. Seitenwände sollen die Unglücksstelle künftig auch vor schräg einfallendem Regen schützen.
[...]
Schmidt-Czaia sprach ein ganz anderes Problem an, das sich nun ergebe: "Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", erläuterte sie. Das verletze jedoch Copyright-Rechte. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", appellierte die Archiv-Direktorin an die Forscher. (epd)
Wie kann man sich nur so unklug einlassen, wenn man auf die Solidarität anderer vital angewiesen ist? http://www.historischesarchivkoeln.de steht doch voll und ganz dem Archiv zur Verfügung, aber eben auch der Öffentlichkeit. Mit der Kritik an diesem Angebot stellt sich die Direktorin auch gegen den VdA als Projektpartner. Jetzt die Solidarität einkassieren und anschließend - wie offenbar vor dem Unglück geplant - ein kostenpflichtiges Virtuelles Archiv einzurichten und abkassieren, wird hoffentlich nicht funktionieren. Ich hätte gehofft, dass man diese unerfreuliche Auseinandersetzung noch etwas vertagen könnte. Aber diese zutiefst dumme Äußerung der Direktorin darf nicht unwidersprochen bleiben.
Ein neues Stadtarchiv in Köln könnte es nach Einschätzung von Kulturdezernent Georg Quander erst in fünf Jahren geben. Zunächst müsse ein Standort für den Bau gefunden werden, sagte Quander am Wochenende. "Wenn das neue Gebäude steht, muss es erstmal zwei Jahre durchgeheizt werden, damit die Wände so trocken sind, dass sie keine Feuchtigkeit an die Archivalien abgeben." Er rechne insgesamt mit fünf Jahren. [...]
Die Direktorin des Kölner Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, verwies darauf, dass die Bergung der Archivalien noch immer gefährlich sei, weil ständig die Gefahr bestehe, dass Schutt ins Rutschen komme. Die Bergung werde noch mindestens sechs Monate dauern. Eine großen Hilfe sei jedoch das provisorische Holzdach über dem Trümmerfeld. Seitenwände sollen die Unglücksstelle künftig auch vor schräg einfallendem Regen schützen.
[...]
Schmidt-Czaia sprach ein ganz anderes Problem an, das sich nun ergebe: "Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", erläuterte sie. Das verletze jedoch Copyright-Rechte. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", appellierte die Archiv-Direktorin an die Forscher. (epd)
Wie kann man sich nur so unklug einlassen, wenn man auf die Solidarität anderer vital angewiesen ist? http://www.historischesarchivkoeln.de steht doch voll und ganz dem Archiv zur Verfügung, aber eben auch der Öffentlichkeit. Mit der Kritik an diesem Angebot stellt sich die Direktorin auch gegen den VdA als Projektpartner. Jetzt die Solidarität einkassieren und anschließend - wie offenbar vor dem Unglück geplant - ein kostenpflichtiges Virtuelles Archiv einzurichten und abkassieren, wird hoffentlich nicht funktionieren. Ich hätte gehofft, dass man diese unerfreuliche Auseinandersetzung noch etwas vertagen könnte. Aber diese zutiefst dumme Äußerung der Direktorin darf nicht unwidersprochen bleiben.
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 13:46 - Rubrik: Kommunalarchive
In den neuen VÖB Mitteilungen. Download unter
http://www.univie.ac.at/voeb/php/publikationen/vm/voebmitt6220091/
oder direkt
http://www.univie.ac.at/voeb/php/downloads/vm6220091.pdf
In der Internetfindbuchdatenbank http://scopeq.cc.univie.ac.at/query/default.aspx gibts Vorschaubilder in geringer Qualität.
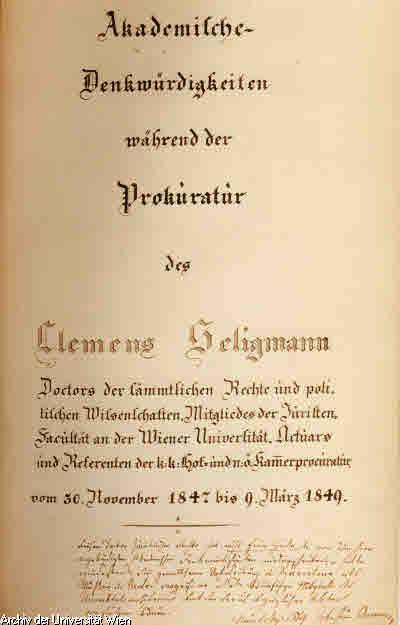
http://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=160903
http://www.univie.ac.at/voeb/php/publikationen/vm/voebmitt6220091/
oder direkt
http://www.univie.ac.at/voeb/php/downloads/vm6220091.pdf
In der Internetfindbuchdatenbank http://scopeq.cc.univie.ac.at/query/default.aspx gibts Vorschaubilder in geringer Qualität.
http://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=160903
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 13:34 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Summary VI at Salon Jewish Studies (http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-vi_13.html)
UPDATE Duration of the rescue process, the new building for the Cologne Historical Archive and COPYRIGHTS (KSTa March 15th 2009 via Archivalia)
Georg Quander (Kulturdezernent [Department for Culture]) makes an appraisal of the situation that the construction of a new Cologne Historical Archive will take at least five years. First of all, there has to be a location for constructing a building. “When the building is finished there must be constant heating for two years to dry the wall that the material will not get clammy or wet.” He amounts five years for this procedure. […]
The director of the Cologne Historical Archive, Bettina Schmidt-Czaia, points out that the rescue of material is still dangerous because the rubble could slide at any time. The rescue process will take at least another six months. The tentative wooden roof covering the rubble is a good shelter though. Wall on the side to shelter from sloping rain will be build soon. [...] Schmidt-Czaia addresses another problem that arises now: „Many scientists, that received copies of our material over the last years, are uploading it now on the internet to give access to the resources after the collapse” she explains. That breaks copyright-positions. “It would be better, if these people would give us the copies” addresses the director the scientists. (epd)
The statement of Bettina Schmidt-Czaia has already led to a controversy on Archivalia.
News on the Cologne Historical Archive's rescue process
Archivists and conservators start drying, cleaning and boxing the archival material from the rubble at the newly established Erstversorgungszentrum (EVZ) In Cologne. The aim is to identify and dry wet archival material as fast as possible to preclud must. Documents which are strongly affected will be dispatched to the Centre for freeze-drying at the Archivamt LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) in Munster. (Archiv-in-Truemmern via Archivalia)
Elmar Ries on March 12th 2009 in Westfaelische Nachrichten: “It seems derogatory to the valuable documents, how they arrived in Muenster. There are stored in two metal boxes in the trailer of a car. The valuable books and very old documents are freezing cold and quickly wrapped into Cellophane. Archivists would have torn their hair under ordinary circumstances. The first delivery amounts 8.5 l.t. During the last days, the whole material have been frozen in the Humana-Milk-Union (Hamana-Milchunion) in Everswinkel – 'minus 30 degrees Celsius, so that the documents, wet from rain and groundwater do not smite from mildews' Dr. Marcus Stumpf the head of the Archivamt says." (via Archivalia)
After covering the archive's rubble with blankets, now the work on the canopy is almost finished. (Archiv-in-Truemmern via Archivalia)
A series of pictures on the conditions of archival material reaching the EVZ (Archiv-in-Truemmern)
UPDATE Duration of the rescue process, the new building for the Cologne Historical Archive and COPYRIGHTS (KSTa March 15th 2009 via Archivalia)
Georg Quander (Kulturdezernent [Department for Culture]) makes an appraisal of the situation that the construction of a new Cologne Historical Archive will take at least five years. First of all, there has to be a location for constructing a building. “When the building is finished there must be constant heating for two years to dry the wall that the material will not get clammy or wet.” He amounts five years for this procedure. […]
The director of the Cologne Historical Archive, Bettina Schmidt-Czaia, points out that the rescue of material is still dangerous because the rubble could slide at any time. The rescue process will take at least another six months. The tentative wooden roof covering the rubble is a good shelter though. Wall on the side to shelter from sloping rain will be build soon. [...] Schmidt-Czaia addresses another problem that arises now: „Many scientists, that received copies of our material over the last years, are uploading it now on the internet to give access to the resources after the collapse” she explains. That breaks copyright-positions. “It would be better, if these people would give us the copies” addresses the director the scientists. (epd)
The statement of Bettina Schmidt-Czaia has already led to a controversy on Archivalia.
News on the Cologne Historical Archive's rescue process
Archivists and conservators start drying, cleaning and boxing the archival material from the rubble at the newly established Erstversorgungszentrum (EVZ) In Cologne. The aim is to identify and dry wet archival material as fast as possible to preclud must. Documents which are strongly affected will be dispatched to the Centre for freeze-drying at the Archivamt LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) in Munster. (Archiv-in-Truemmern via Archivalia)
Elmar Ries on March 12th 2009 in Westfaelische Nachrichten: “It seems derogatory to the valuable documents, how they arrived in Muenster. There are stored in two metal boxes in the trailer of a car. The valuable books and very old documents are freezing cold and quickly wrapped into Cellophane. Archivists would have torn their hair under ordinary circumstances. The first delivery amounts 8.5 l.t. During the last days, the whole material have been frozen in the Humana-Milk-Union (Hamana-Milchunion) in Everswinkel – 'minus 30 degrees Celsius, so that the documents, wet from rain and groundwater do not smite from mildews' Dr. Marcus Stumpf the head of the Archivamt says." (via Archivalia)
After covering the archive's rubble with blankets, now the work on the canopy is almost finished. (Archiv-in-Truemmern via Archivalia)
A series of pictures on the conditions of archival material reaching the EVZ (Archiv-in-Truemmern)
Frank.Schloeffel - am Sonntag, 15. März 2009, 10:43 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Folgendes Stellenangebot dürfte für die KollegInnen die sich ebenfalls mit elektronischen Unterlagen auseinandersetzen bzw. dies tun wollen spannend sein:
http://www.infora.de/Stellenangebot_Organisationsprojekte/
Die INFORA sucht gezielt eine(n) Archivar(in) als Berater(in) für Langzeitspeicherung und Archivierung mit Schwerpunkt in der öV. Archivierung ist hier im archivischen Sinn zu verstehen!
http://www.infora.de/Stellenangebot_Organisationsprojekte/
Die INFORA sucht gezielt eine(n) Archivar(in) als Berater(in) für Langzeitspeicherung und Archivierung mit Schwerpunkt in der öV. Archivierung ist hier im archivischen Sinn zu verstehen!
schwalm.potsdam - am Sonntag, 15. März 2009, 09:39 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/086240.pdf
ist z.B. das nur mit US-Proxy (apropos: Welcome back, http://www.sureproxy.com )zugängliche Google-Digitalisat der Jahrbücher Heinrichs I., 3. Auflage von Waitz, siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Jahrbücher_der_Deutschen_Geschichte
(Dort auch viele weitere Funde von PDFs im MGH-OPAC)
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/dokumente/086234.pdf
sind die Historischen Aufsätze zum Andenken an Waitz (ebenfalls von Google-US gespiegelt)
Eine Möglichkeit der gezielten Suche nach diesen PDFs besteht anscheinend nicht (auch nicht bei Google: http://tinyurl.com/djx4hl ). Es wurden bei frei zugänglichen Google-Büchern Internetadressen im OPAC eingetragen, aber eher sporadisch als systematisch.
Länger bekannt ist der Mirror der Altpreußischen Monatsschrift durch die MGH-Bibliothek:
http://www.mgh-bibliothek.de/bibliothek/altpreussischemonatsschrift.html
Update: PDF-Verzeichnis
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/
Paul Winterfelds Übersetzungen lateinischer Dichtungen:
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/083222.pdf
ist z.B. das nur mit US-Proxy (apropos: Welcome back, http://www.sureproxy.com )zugängliche Google-Digitalisat der Jahrbücher Heinrichs I., 3. Auflage von Waitz, siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Jahrbücher_der_Deutschen_Geschichte
(Dort auch viele weitere Funde von PDFs im MGH-OPAC)
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/dokumente/086234.pdf
sind die Historischen Aufsätze zum Andenken an Waitz (ebenfalls von Google-US gespiegelt)
Eine Möglichkeit der gezielten Suche nach diesen PDFs besteht anscheinend nicht (auch nicht bei Google: http://tinyurl.com/djx4hl ). Es wurden bei frei zugänglichen Google-Büchern Internetadressen im OPAC eingetragen, aber eher sporadisch als systematisch.
Länger bekannt ist der Mirror der Altpreußischen Monatsschrift durch die MGH-Bibliothek:
http://www.mgh-bibliothek.de/bibliothek/altpreussischemonatsschrift.html
Update: PDF-Verzeichnis
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/
Paul Winterfelds Übersetzungen lateinischer Dichtungen:
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/083222.pdf
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 02:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 00:43 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sonst werfe ich ja den "Stadtkurier" ungelesen in die blaue Altpapiertonne, aber heute fiel mir der Bericht auf der Startseite auf. Der Neusser Stadtarchivar Dr. Jens Metzdorf befindet sich mit drei Mitarbeitern in Köln, um dort den Einsatz der Kollegen aus ganz Deutschland zu koordinieren.
Das Hochschularchiv der RWTH Aachen hat natürlich auch schon ein personelles Hilfeangebot gemacht, es liegt aber noch keine konkrete Terminabsprache vor.
Das Hochschularchiv der RWTH Aachen hat natürlich auch schon ein personelles Hilfeangebot gemacht, es liegt aber noch keine konkrete Terminabsprache vor.
KlausGraf - am Sonntag, 15. März 2009, 00:35 - Rubrik: Kommunalarchive
Im Heimat- und Informationsportal, HIP, stehen dem Besucher sämtliche Ausgaben der Zeitschrift SAUERLAND und ihrer Vorgänger Sauerlandruf, Heimwacht und Trutznachtigall sowie die Kalender der Hinkende Bote und De Suerlänner/ Suerländer in hoher Qualität zum Durchsuchen zur Verfügung.
1 Jahr moving wall (Zeitverzögerung)
http://www.sauerlaender-heimatbund.de/html/zeitschrift_archiv.html
Großartig!
#histverein

1 Jahr moving wall (Zeitverzögerung)
http://www.sauerlaender-heimatbund.de/html/zeitschrift_archiv.html
Großartig!
#histverein

KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 23:43 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 23:26 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www2.genealogy.net/vereine/ArGeWe/datenschutz.htm
Man vergleiche die absurden Angriffe auf mich in Sachen Kinski in NETLAW-L:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A1=ind0903&L=netlaw-l
Man vergleiche die absurden Angriffe auf mich in Sachen Kinski in NETLAW-L:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A1=ind0903&L=netlaw-l
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 23:18 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025446/images/
Das postum in Augsburg 1538 gedruckte Gesundheitsregimen für Eberhard im Bart von Württemberg (²VL 9, 342).
Zu dem Ulmer Stadtarzt Stocker vgl. zuletzt
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

Das postum in Augsburg 1538 gedruckte Gesundheitsregimen für Eberhard im Bart von Württemberg (²VL 9, 342).
Zu dem Ulmer Stadtarzt Stocker vgl. zuletzt
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 22:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein besonders geschmackvoller Artikel der F.A.Z., 14.03.2009, Nr. 62 / Seite 11 erinnert an den Massenmörder Wagner, der in Stuttgart zahlreiche Menschen tötete, wegen Unzurechnungsfähigkeit aber nicht zum Tode verurteilte, sondern in die Heilanstalt von Winnenden eingewiesen wurde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_Wagner

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_Wagner

KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 21:53 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 21:46 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rainer Strzolka, 21 Gute Gründe für gute Bibliotheken?
http://www.libreas.eu/ausgabe14/008strz.htm
Zitat
Es wird behauptet, Bibliotheken seien Generalisten, die über ihre Kontakte jede Information auch außerhalb ihrer eigenen Bestände beschaffen würden. Ich habe einmal versucht, über eine Stadtbibliothek ein Buch per Fernleihe zu beschaffen. Kein einziger Mitarbeiter dieser Bibliothek wusste, wie so etwas geht, obwohl die Bibliothek an den Deutschen Leihverkehr angeschlossen ist. Vielleicht liegt dies daran, dass die Leiterin der Bibliothek auch Allrounderin ist. Aus Ersparnisgründen hat die Stadtverwaltung eine einzige Person eingestellt, die für ein trostloses Gehalt Museum, Archiv und Bibliothek der Stadt leitet – und für keine dieser Funktionen eine adäquate Ausbildung hat. Sie ist Allrounderin.
http://www.libreas.eu/ausgabe14/008strz.htm
Zitat
Es wird behauptet, Bibliotheken seien Generalisten, die über ihre Kontakte jede Information auch außerhalb ihrer eigenen Bestände beschaffen würden. Ich habe einmal versucht, über eine Stadtbibliothek ein Buch per Fernleihe zu beschaffen. Kein einziger Mitarbeiter dieser Bibliothek wusste, wie so etwas geht, obwohl die Bibliothek an den Deutschen Leihverkehr angeschlossen ist. Vielleicht liegt dies daran, dass die Leiterin der Bibliothek auch Allrounderin ist. Aus Ersparnisgründen hat die Stadtverwaltung eine einzige Person eingestellt, die für ein trostloses Gehalt Museum, Archiv und Bibliothek der Stadt leitet – und für keine dieser Funktionen eine adäquate Ausbildung hat. Sie ist Allrounderin.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 21:38 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Berliner Tagesspiegel (Link) widmet sich auf seiner Seite 3 diesem Thema.
Wolf Thomas - am Samstag, 14. März 2009, 21:14 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.badische-zeitung.de/bleibende-werte--12624457.html
Ein Potpourri: ein wenig Köln, GLAK, Stadtarchiv Breisach, Barbarastollen, Bestandserhaltung, digitale Daten.
Kam mit dem Kommentar "Ihr Archivare seid ja mächtig im Kurs gestiegen, Kölle sei Dank" in der clara-Liste.
Ein Potpourri: ein wenig Köln, GLAK, Stadtarchiv Breisach, Barbarastollen, Bestandserhaltung, digitale Daten.
Kam mit dem Kommentar "Ihr Archivare seid ja mächtig im Kurs gestiegen, Kölle sei Dank" in der clara-Liste.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 19:34 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aufs Bild klicken!
Zur Straßburger Vorgänger-Ausstellung:
http://www.arte.tv/de/Der-Erste-Weltkrieg/2294754.html
Einige einschlägige Medien auch auf der Website des Hochschularchivs Aachen als Bilder:
http://www.archiv.rwth-aachen.de/Online%20Praesentation%201_WK/index.htm
Dort findet man in dem PDF
http://www.archiv.rwth-aachen.de/Online%20Praesentation%201_WK/Vitrine_1.pdf
beispielsweise das Faksimile eines Einblattdrucks mit Aachener Kriegsliedern von Peter Grotzfeld (sonst m.W. nirgends nachweisbar)
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 19:14 - Rubrik: Universitaetsarchive
http://library-mistress.blogspot.com/2009/03/verbeamtete-langeweile.html
" Der Autor setzt dann fort: "Es scheint mir typisch für Leute, die vieles in ihren Bannkreis ziehen wollen, dies dann weder bewältigen noch sicher aufbewahren zu können". Hmpf. Als hätten die ArchivarInnen in Köln ihr Haus selbst zum Einsturz gebracht. "
" Der Autor setzt dann fort: "Es scheint mir typisch für Leute, die vieles in ihren Bannkreis ziehen wollen, dies dann weder bewältigen noch sicher aufbewahren zu können". Hmpf. Als hätten die ArchivarInnen in Köln ihr Haus selbst zum Einsturz gebracht. "
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 17:50 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieder ein liebevoll geschriebener Beitrag im Burgerbe-Weblog:
http://burgerbe.wordpress.com/2009/03/13/lichtenstein_schloss_aus_einem_roman/

Dazu aus meinem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb" 2008 Nr. 208:
http://www.amazon.de/Sagen-Schwäbischen-Alb-Klaus-Graf/dp/3871810312 16,90 Euro
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
Lichtenstein
Herzog Ulrichs Zuflucht
Gewiß ist aus diesem Wenigen schon ersichtlich, wie der Lichtenstein eigentlich der Glanzpunkt der Alppartie ist, die wir von Reutlingen aus angetreten haben; allein welchem Württemberger und Schwaben würde nicht, wenn er den Namen „Lichtenstein“ hört, unwillkürlich auch das Wort „Nebelhöhle“ oder „Nebelloch“, wie man es früher hieß, auf die Zunge kommen? Beide sind ja in der württembergischen Volkssage unzertrennlich, laut welcher Herzog Ulrich, als er sich von dem schwäbischen Bunde flüchtig im Lande herumtrieb, in der Nebelhöhle eine sichere Zuflucht gefunden habe und allda von dem nahem Lichtenstein aus mit Speise und Trank versehen worden sei! (108)
Wie hier Theodor Griesinger 1866 wusste schon Wilhelm Zimmermann 1836 von einer angeblichen „Volkssage“ vom Aufenthalt Ulrichs in der Nebelhöhle. Diese Überlieferung geht aber ganz auf den 1826 erschienenen Erfolgsroman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff zurück. Dieses Buch war auch der Grund für die Erbauung des historistischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein um 1840.
Während der Nebelhöhlen-Aufenthalt von Hauff erfunden wurde, gab es eine ältere Tradition über Herzog Ulrich und Schloss Lichtenstein. Schwabs Albbeschreibung, eine Quelle Hauffs, zitierte die Beschreibung des Schlosses Lichtenstein bei Martin Crusius am Ende des 16. Jahrhunderts. Diese lautet in der Übersetzung von Johann Jakob Moser:
Einen Stuck-Schuß weit von Holzelfingen, gegen Mittag sieht man das Schloß Lichtenstein, welches nicht groß ist und auf einem Felsen ligt, so daß die untere Zimmer in den Felsen gehauen sind. Dieses hat, wie man sagt, eine alte Edel-Frau erbauet; man weißt aber nicht, wer sie gewesen und zu welcher Zeit sie gelebt. Doch ist von alten Leuthen erzehlt worden, daß sie, da der Bau zu Ende war, gesagt habe: Nun bin ich GOttes Freundin, aber der gantzen Welt Feindin. Denn sie glaubte, sie sey nun wieder jedermann in demselben sicher. [...] Im obern Stockwerck ist eine überaus schöne Stuben oder Saal, rings herum mit Fenstern, aus welchen man biß an den Asperg sehen kan: Darinn hat der vertriebene Fürst, Ulrich von Würtemberg, öffters gewohnt, der des Nachts vor das Schloß kam, und nur sagte: Der Mann ist da; so wurde er eingelassen.
Quellen: Theodor Griesinger, Württemberg. Nach seiner Vergangenheit und Gegenwart in Land und Leuten, 1866, S. 169 (Ü); Martin Crusius, Schwäbische Chronick, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1733, S. 426. Vgl. Max Schuster, Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein, 1904, S. 9, 18-30; Hans Binder, Ein Fürst und ein Dichter begründen den Ruhm der Nebelhöhle, in: Abhandlungen zur Karst- und Höhlenkunde, Reihe A Heft 4,1969, S. 33-55, hier S. 47-51. Zum Schloss vgl. Barbara Potthast, Der Lichtenstein – ein Sehnsuchtsort des 19. Jahrhunderts, in: Kurzer Aufenthalt, 2007, S. 197-201.
http://burgerbe.wordpress.com/2009/03/13/lichtenstein_schloss_aus_einem_roman/

Dazu aus meinem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb" 2008 Nr. 208:
http://www.amazon.de/Sagen-Schwäbischen-Alb-Klaus-Graf/dp/3871810312 16,90 Euro
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
Lichtenstein
Herzog Ulrichs Zuflucht
Gewiß ist aus diesem Wenigen schon ersichtlich, wie der Lichtenstein eigentlich der Glanzpunkt der Alppartie ist, die wir von Reutlingen aus angetreten haben; allein welchem Württemberger und Schwaben würde nicht, wenn er den Namen „Lichtenstein“ hört, unwillkürlich auch das Wort „Nebelhöhle“ oder „Nebelloch“, wie man es früher hieß, auf die Zunge kommen? Beide sind ja in der württembergischen Volkssage unzertrennlich, laut welcher Herzog Ulrich, als er sich von dem schwäbischen Bunde flüchtig im Lande herumtrieb, in der Nebelhöhle eine sichere Zuflucht gefunden habe und allda von dem nahem Lichtenstein aus mit Speise und Trank versehen worden sei! (108)
Wie hier Theodor Griesinger 1866 wusste schon Wilhelm Zimmermann 1836 von einer angeblichen „Volkssage“ vom Aufenthalt Ulrichs in der Nebelhöhle. Diese Überlieferung geht aber ganz auf den 1826 erschienenen Erfolgsroman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff zurück. Dieses Buch war auch der Grund für die Erbauung des historistischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein um 1840.
Während der Nebelhöhlen-Aufenthalt von Hauff erfunden wurde, gab es eine ältere Tradition über Herzog Ulrich und Schloss Lichtenstein. Schwabs Albbeschreibung, eine Quelle Hauffs, zitierte die Beschreibung des Schlosses Lichtenstein bei Martin Crusius am Ende des 16. Jahrhunderts. Diese lautet in der Übersetzung von Johann Jakob Moser:
Einen Stuck-Schuß weit von Holzelfingen, gegen Mittag sieht man das Schloß Lichtenstein, welches nicht groß ist und auf einem Felsen ligt, so daß die untere Zimmer in den Felsen gehauen sind. Dieses hat, wie man sagt, eine alte Edel-Frau erbauet; man weißt aber nicht, wer sie gewesen und zu welcher Zeit sie gelebt. Doch ist von alten Leuthen erzehlt worden, daß sie, da der Bau zu Ende war, gesagt habe: Nun bin ich GOttes Freundin, aber der gantzen Welt Feindin. Denn sie glaubte, sie sey nun wieder jedermann in demselben sicher. [...] Im obern Stockwerck ist eine überaus schöne Stuben oder Saal, rings herum mit Fenstern, aus welchen man biß an den Asperg sehen kan: Darinn hat der vertriebene Fürst, Ulrich von Würtemberg, öffters gewohnt, der des Nachts vor das Schloß kam, und nur sagte: Der Mann ist da; so wurde er eingelassen.
Quellen: Theodor Griesinger, Württemberg. Nach seiner Vergangenheit und Gegenwart in Land und Leuten, 1866, S. 169 (Ü); Martin Crusius, Schwäbische Chronick, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1733, S. 426. Vgl. Max Schuster, Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein, 1904, S. 9, 18-30; Hans Binder, Ein Fürst und ein Dichter begründen den Ruhm der Nebelhöhle, in: Abhandlungen zur Karst- und Höhlenkunde, Reihe A Heft 4,1969, S. 33-55, hier S. 47-51. Zum Schloss vgl. Barbara Potthast, Der Lichtenstein – ein Sehnsuchtsort des 19. Jahrhunderts, in: Kurzer Aufenthalt, 2007, S. 197-201.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 17:27 - Rubrik: Landesgeschichte
http://archiv.twoday.net/stories/4941756/
Nicht berücksichtigt sind anderweitig erschienene Besprechungen, die in Archivalia wiedergegeben wurden.
Nicht berücksichtigt sind anderweitig erschienene Besprechungen, die in Archivalia wiedergegeben wurden.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 16:51 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Karlheinz Blaschke, Lauter alte Akten. Den von Formularen geplagten Zeitgenossen zum Trost, zur Belehrung und Erheiterung. Illustriert von Walter Gorski. Nachdruck der Originalausgabe von 1956, mit einem Geleitwort versehen von Lorenz Friedrich Beck. Berlin: BibSpider 2008. 114 S. 13 Euro
"Wohl selten ist in die bis heute nicht jedermann geläufige Welt der Archive so unterhaltsam und gemeinverständlich eingeführt worden", schreibt Lorenz Friedrich Beck in seinem kurzen Nachwort. Und er hat Recht! Das mir bislang unbekannte Büchlein ist in der DDR erschienen, hat aber keinen unangenehmen ideologischen Nachgeschmack, was auch nicht wundert, wenn man die Vita des Verfassers kennt: Der Nestor der sächsischen Landesgeschichtsforschung sah sich ja aus politischen Gründen gezwungen, den Archivdienst zu verlassen.
Was Blaschke schreibt, ist im Kern noch heute zutreffend. Wer als Archivarin oder Archivar Freunde oder Bekannte hat, die Sinn für Historisches haben (und Frakturschrift lesen können) und immer schon einmal wissen wollten, was Archivare so treiben, findet hier ein geeignetes kleines Geschenk (das mit 13 Euro leider so wohlfeil auch wieder nicht ist). Mit ironischer Distanz - 1956 hätte man wohl geschrieben: "mit flotter Feder" - porträtiert der damalige Staatsarchivar Blaschke gekonnt und humorvoll das Archivwesen in den folgenden kurzen Kapiteln: Zum Thema - Wissen Sie, was ein Archiv ist? - Brief und Siegel [Urkunden] - Ad acta [Aktenkunde] - Miscellanea [Selekte] - Wie, womit und worauf man schrieb - Gewölbe und Gewächshäuser [Archivbau] - Sinn und Zweck - Archivbenutzer - Archivstrategie [Sprengel] - Kassation - Von wirklichen und unwirklichen Geheimen Räten, Aktuaren und anderem Kanzleiinventar [Verwaltungsgeschichte] - Krankenstube der Archivalien [Bestandserhaltung] - Die Konkurrenz [Bibliothekare, Museumsleute und Denkmalpfleger] - Beruf und Berufung - Etwas zum Abschied.
Die Originalausgabe von 1956 steht übrigens auf den Seiten des Stadtarchivs Frankfurt Oder auch online zur Verfügung:
http://www.frankfurt-oder.de/data/stadtarchiv/bes_ang/alte_akten/titel.htm
http://www.stadtarchiv-ffo.de/bes_ang/alte_akten/titel.htm
War es wirklich sinnvoll, diese Publikation aus der Mottenkiste zu holen? Die Antwort fällt nicht schwer: Ja!

"Wohl selten ist in die bis heute nicht jedermann geläufige Welt der Archive so unterhaltsam und gemeinverständlich eingeführt worden", schreibt Lorenz Friedrich Beck in seinem kurzen Nachwort. Und er hat Recht! Das mir bislang unbekannte Büchlein ist in der DDR erschienen, hat aber keinen unangenehmen ideologischen Nachgeschmack, was auch nicht wundert, wenn man die Vita des Verfassers kennt: Der Nestor der sächsischen Landesgeschichtsforschung sah sich ja aus politischen Gründen gezwungen, den Archivdienst zu verlassen.
Was Blaschke schreibt, ist im Kern noch heute zutreffend. Wer als Archivarin oder Archivar Freunde oder Bekannte hat, die Sinn für Historisches haben (und Frakturschrift lesen können) und immer schon einmal wissen wollten, was Archivare so treiben, findet hier ein geeignetes kleines Geschenk (das mit 13 Euro leider so wohlfeil auch wieder nicht ist). Mit ironischer Distanz - 1956 hätte man wohl geschrieben: "mit flotter Feder" - porträtiert der damalige Staatsarchivar Blaschke gekonnt und humorvoll das Archivwesen in den folgenden kurzen Kapiteln: Zum Thema - Wissen Sie, was ein Archiv ist? - Brief und Siegel [Urkunden] - Ad acta [Aktenkunde] - Miscellanea [Selekte] - Wie, womit und worauf man schrieb - Gewölbe und Gewächshäuser [Archivbau] - Sinn und Zweck - Archivbenutzer - Archivstrategie [Sprengel] - Kassation - Von wirklichen und unwirklichen Geheimen Räten, Aktuaren und anderem Kanzleiinventar [Verwaltungsgeschichte] - Krankenstube der Archivalien [Bestandserhaltung] - Die Konkurrenz [Bibliothekare, Museumsleute und Denkmalpfleger] - Beruf und Berufung - Etwas zum Abschied.
Die Originalausgabe von 1956 steht übrigens auf den Seiten des Stadtarchivs Frankfurt Oder auch online zur Verfügung:
http://www.stadtarchiv-ffo.de/bes_ang/alte_akten/titel.htm
War es wirklich sinnvoll, diese Publikation aus der Mottenkiste zu holen? Die Antwort fällt nicht schwer: Ja!

KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 16:33 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
"Ein Schlag für die moderne Fotografie in Deutschland: Der Nachlass des Fotosammlers L. Fritz Gruber existiert nicht mehr. ....."
Quelle:
http://www.zeit.de/2009/12/Koeln
Quelle:
http://www.zeit.de/2009/12/Koeln
Wolf Thomas - am Samstag, 14. März 2009, 16:22 - Rubrik: Kommunalarchive
Eine Bilderserie der Kölner Kollegen:
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/13/zustand-der-ins-evz-kommenden-archivalienfunde/
 Bild ergänzt kg
Bild ergänzt kg
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/13/zustand-der-ins-evz-kommenden-archivalienfunde/
 Bild ergänzt kg
Bild ergänzt kgWolf Thomas - am Samstag, 14. März 2009, 16:20 - Rubrik: Kommunalarchive
Die Kammgarnspinnerei in Wernshausen steht unter Denkmalschutz, trotzdem haben die Abrissarbeiten bereits begonnen. Der Erhalt war der Gemeinde Schmalkalden zu teuer. Das von dem Thüringer Architekten Karl Behlert errichtete Gebäude aus den zwanziger Jahren soll jetzt einem Gewerbegebiet weichen.
http://www.art-magazin.de/architektur/16316/wernshausen_garnspinnerei

http://www.art-magazin.de/architektur/16316/wernshausen_garnspinnerei


DENK - am Samstag, 14. März 2009, 15:56 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rainer Nonnenmann berichte in der Online-Ausgabe der Neuen Musikzeitung über die zu befürchtenden Verluste an Musikarchiven in Köln. Er kündigt einen Artikel in der April-Print-Ausgabe der Zeitschrift an.
Link:
http://www.nmz.de/online/vom-erdboden-verschluckt-die-musikstadt-koeln-verliert-ihr-historisches-archiv
Link:
http://www.nmz.de/online/vom-erdboden-verschluckt-die-musikstadt-koeln-verliert-ihr-historisches-archiv
Wolf Thomas - am Samstag, 14. März 2009, 15:39 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... “Gerade 2006 habe ich zum Ende meiner Amtszeit als Geschäftsführer der JU Köln unsere Akten der letzten 15 Jahre ins Archiv gebracht. Es ist gute Tradition in der Jungen Union, die älteren Akten im Archiv einzulagern. Quasi seit Gründung der JU in Köln von 1946 waren alle Bestände im Archiv. Somit verlieren wir auch einen Großteil unserer eigenen Geschichte.” so berichtet Stephan Krüger, JU-Geschäftsführer von 1999 bis 2005. .....
Auch die CDU Köln und andere Parteien hatten ihre eigenen historischen Bestände im Stadtarchiv eingelagert. ...."
Quelle:
http://www.junge-union-koeln.de/ju/aktuelles/presse/letzte-chance/. (8. März 2009 )
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5569422/
Auch die CDU Köln und andere Parteien hatten ihre eigenen historischen Bestände im Stadtarchiv eingelagert. ...."
Quelle:
http://www.junge-union-koeln.de/ju/aktuelles/presse/letzte-chance/. (8. März 2009 )
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5569422/
Wolf Thomas - am Samstag, 14. März 2009, 15:32 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 14:20 - Rubrik: Kommunalarchive
Die Rechtsprechung divergiert. Entscheidungen stellt zusammen und bewertet (mit nicht schlüssigem Ergebnis)
http://www.nennen.de/blog/blog/artikel/contentklau-unter-anwaelten.html?tx_ttnews[backPid]=4&cHash=f744f66d7f
PS: Unsachliches Gepöbel von Anwälten und anderen Juristen in den Kommentaren lösche ich umstandslos.
http://www.nennen.de/blog/blog/artikel/contentklau-unter-anwaelten.html?tx_ttnews[backPid]=4&cHash=f744f66d7f
PS: Unsachliches Gepöbel von Anwälten und anderen Juristen in den Kommentaren lösche ich umstandslos.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 13:39 - Rubrik: Archivrecht
Köln verliert sein historisches Gedächtnis heißt die morgige west.art-Gesprächsrunde, die das WDR-Fernsehen ab 11.00 Uhr überträgt.
biblionaut - am Samstag, 14. März 2009, 12:28 - Rubrik: Kommunalarchive
Lesermeinung in der FAZ
http://www.faz.net/f30/kom/KomUser.aspx?lo=munatak
Politiker 1946 Wer im Glashaus sitzt.........
Der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Gründungsvater der FDP, Dr. Hermann Höpker Aschoff, sowie der erste Ministerpräsident Niedersachsens Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) bekleideten im Generalgouvernement höchste Ämter in der HTO (Haupttreuhandstelle Ost). Die HTO war die von Göring gegründete Stelle für die massive Enteignung jüdischen Vermögens. Hinrich Wilhelm Kopf sollte an Polen wegen Kriegsverbrechen ausgeliefert werden. Willy Brandt intervenierte. Zur Auslieferung kam es nicht. Bischof Williamson hat falsche Tasachenbehauptungen aufgestellt und ist von der katholischen Kirche zum Widerruf aufgefordert worden. Benedikts Position hinsichtlich der Verbrechen an Juden ist eindeutig und unzweifelhaft. Hat die FDP die Vergangenheit von Herrn Dr. Höpker Aschoff verurteilt oder die SPD das Gebaren des Herrn Kopf ? Es handelte sich um Täter. Politiker sind sehr schnell, wenn es um Effekthascherei geht, aber auch sehr gründlich, wenn es darum geht, die eigene Vergangenheit zu verschleiern. So hat das Foreign Office bis heute die Akte Kopf nicht freigegeben. Eine weitere Kopie liegt unter Verschluss in der niedersächssischen Staatskanzlei (Abteilung Hauptstaatsarchiv Hannover).
http://vierprinzen.blogspot.com/
http://www.faz.net/f30/kom/KomUser.aspx?lo=munatak
Politiker 1946 Wer im Glashaus sitzt.........
Der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Gründungsvater der FDP, Dr. Hermann Höpker Aschoff, sowie der erste Ministerpräsident Niedersachsens Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) bekleideten im Generalgouvernement höchste Ämter in der HTO (Haupttreuhandstelle Ost). Die HTO war die von Göring gegründete Stelle für die massive Enteignung jüdischen Vermögens. Hinrich Wilhelm Kopf sollte an Polen wegen Kriegsverbrechen ausgeliefert werden. Willy Brandt intervenierte. Zur Auslieferung kam es nicht. Bischof Williamson hat falsche Tasachenbehauptungen aufgestellt und ist von der katholischen Kirche zum Widerruf aufgefordert worden. Benedikts Position hinsichtlich der Verbrechen an Juden ist eindeutig und unzweifelhaft. Hat die FDP die Vergangenheit von Herrn Dr. Höpker Aschoff verurteilt oder die SPD das Gebaren des Herrn Kopf ? Es handelte sich um Täter. Politiker sind sehr schnell, wenn es um Effekthascherei geht, aber auch sehr gründlich, wenn es darum geht, die eigene Vergangenheit zu verschleiern. So hat das Foreign Office bis heute die Akte Kopf nicht freigegeben. Eine weitere Kopie liegt unter Verschluss in der niedersächssischen Staatskanzlei (Abteilung Hauptstaatsarchiv Hannover).
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Samstag, 14. März 2009, 12:02
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.libreas.eu/aktuell_index.html
Editorial zur Ausgabe 14: Open Access und Geisteswissenschaften
Postmoderne Wissensorganisation oder: Wie subversiv ist Wikipedia? – Dina Brandt | Anschlussdiskussion zwischen Ben Kaden und Dina Brandt
If Malinowski had been a Blogger – Leah Rosenblum
[Anthropologie]
Open Access und Geschichtswissenschaften – Notwendigkeit, Chancen, Probleme – Lilian Landes
[eigentlich nur Werbung für perspectivia.net]
Not Your Parents' History Professors: An Introduction to Three Digital Humanists – Elisabeth Mead Cavert Scheibel
[Dan Cohen (http://www.dancohen.org/), Tom Scheinfeldt (http://www.foundhistory.org/), and Mills Kelly (http://edwired.org/) all work in the Center for History and New Media (http://chnm.gmu.edu/) at George Mason University, in Fairfax, Virginia, USA.]
Bedeutung und Praxis von Open Access an der HU-Berlin – Nicole Henschel
[befragte Anfang 2007 266 Profs etc. zu OA]
Insgesamt wenig Bemerkenswertes, ist halt eine studentische Zeitschrift, die im übrigen keine korrekten OAI-Metadaten liefert.
Editorial zur Ausgabe 14: Open Access und Geisteswissenschaften
Postmoderne Wissensorganisation oder: Wie subversiv ist Wikipedia? – Dina Brandt | Anschlussdiskussion zwischen Ben Kaden und Dina Brandt
If Malinowski had been a Blogger – Leah Rosenblum
[Anthropologie]
Open Access und Geschichtswissenschaften – Notwendigkeit, Chancen, Probleme – Lilian Landes
[eigentlich nur Werbung für perspectivia.net]
Not Your Parents' History Professors: An Introduction to Three Digital Humanists – Elisabeth Mead Cavert Scheibel
[Dan Cohen (http://www.dancohen.org/), Tom Scheinfeldt (http://www.foundhistory.org/), and Mills Kelly (http://edwired.org/) all work in the Center for History and New Media (http://chnm.gmu.edu/) at George Mason University, in Fairfax, Virginia, USA.]
Bedeutung und Praxis von Open Access an der HU-Berlin – Nicole Henschel
[befragte Anfang 2007 266 Profs etc. zu OA]
Insgesamt wenig Bemerkenswertes, ist halt eine studentische Zeitschrift, die im übrigen keine korrekten OAI-Metadaten liefert.
KlausGraf - am Samstag, 14. März 2009, 00:33 - Rubrik: Open Access
http://scholarlykitchen.sspnet.org/author/pmd8/
Philip Davis reichte ein Nonsense-Manuskript bei Bentham Science ein, das zwar zurückgewiesen wurde - soweit die gute Nachricht - aber das hinderte den des Wissenschaftler-Spammings bezichtigten Open-Access-Verlag nicht daran, den Autor um Empfehlungen zu bitten und das nächste Manuskript zu erwarten.
[#beall]
Philip Davis reichte ein Nonsense-Manuskript bei Bentham Science ein, das zwar zurückgewiesen wurde - soweit die gute Nachricht - aber das hinderte den des Wissenschaftler-Spammings bezichtigten Open-Access-Verlag nicht daran, den Autor um Empfehlungen zu bitten und das nächste Manuskript zu erwarten.
[#beall]
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 23:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.stern.de/panorama/:K%F6lner-S%FCdstadt-Bilder-Verw%FCstung/656566.html?backref=657768&cp=1
Unter den 64 Bildern sind auch einige wenige zum Archivgut.
Unter den 64 Bildern sind auch einige wenige zum Archivgut.
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 23:06 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Schüler berichtet über seinen Besuch im Historischen Archiv der Stadt Köln vor dem Einsturz:
http://einestages.spiegel.de/static/authoralbumbackground/3783/besuch_ohne_wiederkehr.html
Unangenehm berührt der Nachruf-Charakter des Textes. Wer weiß, ob nicht viel verloren Geglaubtes wieder zur Verfügung stehen wird?
http://einestages.spiegel.de/static/authoralbumbackground/3783/besuch_ohne_wiederkehr.html
Unangenehm berührt der Nachruf-Charakter des Textes. Wer weiß, ob nicht viel verloren Geglaubtes wieder zur Verfügung stehen wird?
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 22:47 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,611647-2,00.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,druck-611647,00.html
thematisiert - wenig originell dieser Tage - die Sicherungsverfilmung des Bundes.
"Objektiv lässt sich schwer sagen, was wichtig ist", sagt Oberarchivar Martin Luchterhandt, Vorsitzender des Auswahlausschuss. Also wird abgefilmt, was die Landesarchive hergeben: Statistiken, Gerichtsakten, Gesetzestexte. Spektakuläre Beispiele lassen sich unter den Aufnahmen finden, doch in der Breite konservieren die Fässer das Vermächtnis der deutschen Verwaltung.
Für Aleida Assmann hat das wenig mit kulturellem Gedächtnis zu tun. "Es heißt ja oft: Schatztruhe der Nation - dabei ist das vor allem die Schatzkiste der Verwaltungsbürokratie", sagt die Kulturwissenschaftlerin. Sie hat den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt: Das Wissen aus und von der Vergangenheit, so ihre These, prägt unsere Persönlichkeit. Die Überlieferung durch Bibliotheken, Museen und Archive sorgt dafür, dass die Philosophie Kants ebenso wie der Holocaust noch heute dazu führen, dass wir nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kollektive, kulturelle Identität besitzen.
Für die Wissenschaftlerin ist indes nicht nachvollziehbar, warum die Entscheidung über die Einlagerung allein unter Archivaren bleibt. "Über die Auswahl gibt es keinen Diskurs, da findet ein mechanischer Ablauf statt, der einmal in Gang gesetzt wurde und nicht mehr gestoppt werden kann", so Assmann. Allerdings habe sie im letzten Jahr auf dem Deutschen Archivtag ein Umdenken bemerkt: "Ich habe dort mit vielen Archivaren gesprochen, die leiden unter einem Öffentlichkeitsentzug." Es gebe einen Paradigmenwechsel, "die Bereitschaft zur Wandlung ist immens".
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,druck-611647,00.html
thematisiert - wenig originell dieser Tage - die Sicherungsverfilmung des Bundes.
"Objektiv lässt sich schwer sagen, was wichtig ist", sagt Oberarchivar Martin Luchterhandt, Vorsitzender des Auswahlausschuss. Also wird abgefilmt, was die Landesarchive hergeben: Statistiken, Gerichtsakten, Gesetzestexte. Spektakuläre Beispiele lassen sich unter den Aufnahmen finden, doch in der Breite konservieren die Fässer das Vermächtnis der deutschen Verwaltung.
Für Aleida Assmann hat das wenig mit kulturellem Gedächtnis zu tun. "Es heißt ja oft: Schatztruhe der Nation - dabei ist das vor allem die Schatzkiste der Verwaltungsbürokratie", sagt die Kulturwissenschaftlerin. Sie hat den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt: Das Wissen aus und von der Vergangenheit, so ihre These, prägt unsere Persönlichkeit. Die Überlieferung durch Bibliotheken, Museen und Archive sorgt dafür, dass die Philosophie Kants ebenso wie der Holocaust noch heute dazu führen, dass wir nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kollektive, kulturelle Identität besitzen.
Für die Wissenschaftlerin ist indes nicht nachvollziehbar, warum die Entscheidung über die Einlagerung allein unter Archivaren bleibt. "Über die Auswahl gibt es keinen Diskurs, da findet ein mechanischer Ablauf statt, der einmal in Gang gesetzt wurde und nicht mehr gestoppt werden kann", so Assmann. Allerdings habe sie im letzten Jahr auf dem Deutschen Archivtag ein Umdenken bemerkt: "Ich habe dort mit vielen Archivaren gesprochen, die leiden unter einem Öffentlichkeitsentzug." Es gebe einen Paradigmenwechsel, "die Bereitschaft zur Wandlung ist immens".
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 22:38 - Rubrik: Bestandserhaltung
http://www.goethe.de/wis/bib/thm/urh/de4295873.htm
Zitat:
Indem die alten, aus der analogen Welt stammenden Modelle geschützt werden, verhindert das Urheberrecht mittelfristig die Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen der Informationswirtschaft, die elektronischen Umgebungen angemessen sind. Dabei ist es ganz deutlich, dass die Zukunft auch der Verlage nur bei Modellen liegt, die das Open-Access-Paradigma anerkennen. Je freier Information ist, desto mehr kann damit verdient werden. Das klingt paradox, wird aber immer mehr auf den Märkten bestätigt, siehe Google etc. Das nennen die Ökonomen „Freeconomics“: Information selber ist frei; verdient wird mit Leistungen, die an die Information angrenzen, zum Beispiel mit Werbung oder Mehrwertleistungen.
Zitat:
Indem die alten, aus der analogen Welt stammenden Modelle geschützt werden, verhindert das Urheberrecht mittelfristig die Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen der Informationswirtschaft, die elektronischen Umgebungen angemessen sind. Dabei ist es ganz deutlich, dass die Zukunft auch der Verlage nur bei Modellen liegt, die das Open-Access-Paradigma anerkennen. Je freier Information ist, desto mehr kann damit verdient werden. Das klingt paradox, wird aber immer mehr auf den Märkten bestätigt, siehe Google etc. Das nennen die Ökonomen „Freeconomics“: Information selber ist frei; verdient wird mit Leistungen, die an die Information angrenzen, zum Beispiel mit Werbung oder Mehrwertleistungen.
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 21:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch beim zweiten Start ein Flop ...
Spiegel-Autor Konrad Lischka im Selbstversuch ...
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,613158,00.html
100.704 digitale Bücher deutschsprachiger Verlage kann man nun im Web im Volltext durchsuchen. (...) Auf der Libreka-Startseite steht eine aktuelle Bestsellerliste "Belletristik". Kein Titel darauf ist anklickbar. (...) Ein zweiter Versuch mit dem Bestseller "Feuchtgebiete": Gibt man den Buchtitel in der erweiterten Libreka-Suche im Suchfeld Titel ein, teilt Libreka dem potentiellen Käufer mit: "Ihre Suchanfrage nach 'Buchen Titel enthält Feuchtgebiete' lieferte keine Ergebnisse." Was immer das heißen soll - Feuchtgebiete ist im Libreka-Katalog nicht zu finden. (...)
Wer sich registriert hat, kann auch auf einen Knopf namens "Warenkorb" klicken - und dann die Aufforderung lesen: "Bitte wählen Sie einen oder mehrere Titel aus und fügen Sie sie dem Warenkorb hinzu." Das Problem ist: Man findet einfach keine Titel, die sich in diesen Korb legen lassen. (...)
Im Klartext: Es gibt auf der zentralen Plattform zum Vertrieb von E-Books des deutschen Buchhandels keine Übersicht der als E-Book erhältlichen Titel. (...)
Warum der Verband es nicht geschafft hat, seinen Mitgliedern einfach anteilig Tantiemen auszuschütten, statt ein bizarres virtuelles Buchhandel-Shoppen einzuziehen, ist eine weitere Frage (...)
Das PDF ist geschützt - das Drucken oder Kopieren von Passagen ist unmöglich. Wer aus so einem E-Book zitieren will, muss die Textpassagen von Hand abtippen. Auch das ist wie der gesamte Bestellprozess eine sehr aufwendige Nachbildung des analogen Buchs. (...)
Spiegel-Autor Konrad Lischka im Selbstversuch ...
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,613158,00.html
100.704 digitale Bücher deutschsprachiger Verlage kann man nun im Web im Volltext durchsuchen. (...) Auf der Libreka-Startseite steht eine aktuelle Bestsellerliste "Belletristik". Kein Titel darauf ist anklickbar. (...) Ein zweiter Versuch mit dem Bestseller "Feuchtgebiete": Gibt man den Buchtitel in der erweiterten Libreka-Suche im Suchfeld Titel ein, teilt Libreka dem potentiellen Käufer mit: "Ihre Suchanfrage nach 'Buchen Titel enthält Feuchtgebiete' lieferte keine Ergebnisse." Was immer das heißen soll - Feuchtgebiete ist im Libreka-Katalog nicht zu finden. (...)
Wer sich registriert hat, kann auch auf einen Knopf namens "Warenkorb" klicken - und dann die Aufforderung lesen: "Bitte wählen Sie einen oder mehrere Titel aus und fügen Sie sie dem Warenkorb hinzu." Das Problem ist: Man findet einfach keine Titel, die sich in diesen Korb legen lassen. (...)
Im Klartext: Es gibt auf der zentralen Plattform zum Vertrieb von E-Books des deutschen Buchhandels keine Übersicht der als E-Book erhältlichen Titel. (...)
Warum der Verband es nicht geschafft hat, seinen Mitgliedern einfach anteilig Tantiemen auszuschütten, statt ein bizarres virtuelles Buchhandel-Shoppen einzuziehen, ist eine weitere Frage (...)
Das PDF ist geschützt - das Drucken oder Kopieren von Passagen ist unmöglich. Wer aus so einem E-Book zitieren will, muss die Textpassagen von Hand abtippen. Auch das ist wie der gesamte Bestellprozess eine sehr aufwendige Nachbildung des analogen Buchs. (...)
BCK - am Freitag, 13. März 2009, 18:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Als Quelle für Angaben aus der heutigen Pressekonferenz ist zugrundezulegen:
http://twitter.com/SamZidat
http://twitter.com/DieMedienprofis
Es wurde auch die zweite Handschrift von Albertus Magnus gefunden.
Ab Montag werden Montag bis Samstag 4 Gruppen zu je 9 Mann im Schichtbetrieb (zwei Schichten 7-19 Uhr) an der Bergung des Archivguts arbeiten: Feuerwehr, THW, Archivare, Gebäudewirtschaft für Logistik. Das Schutzdach ist beinahe fertiggestellt.
Feuerwehr-Chef Neuhoff konnte nicht bestätigen, dass 20 Prozent des Archivmaterials geborgen sind. Er habe dazu keine Zahlen.
Update aus anderer Quelle: Die neue Halle (Erstversorgungszentrum) weist ein erheblich besseres Raumklima auf. Bei den Rettungsarbeiten geben sich THW und Feuerwehr sehr viel Mühe. Heute Nachmittag wurden kaum Archivalien, vor allem Aktenschnipsel gefunden. Der Zustand der gefundenen mittelalterlichen Codices sei überwiegend gut gewesen, aber es habe auch einzelne zerfetzte Handschriften gegeben.
http://twitter.com/SamZidat
http://twitter.com/DieMedienprofis
Es wurde auch die zweite Handschrift von Albertus Magnus gefunden.
Ab Montag werden Montag bis Samstag 4 Gruppen zu je 9 Mann im Schichtbetrieb (zwei Schichten 7-19 Uhr) an der Bergung des Archivguts arbeiten: Feuerwehr, THW, Archivare, Gebäudewirtschaft für Logistik. Das Schutzdach ist beinahe fertiggestellt.
Feuerwehr-Chef Neuhoff konnte nicht bestätigen, dass 20 Prozent des Archivmaterials geborgen sind. Er habe dazu keine Zahlen.
Update aus anderer Quelle: Die neue Halle (Erstversorgungszentrum) weist ein erheblich besseres Raumklima auf. Bei den Rettungsarbeiten geben sich THW und Feuerwehr sehr viel Mühe. Heute Nachmittag wurden kaum Archivalien, vor allem Aktenschnipsel gefunden. Der Zustand der gefundenen mittelalterlichen Codices sei überwiegend gut gewesen, aber es habe auch einzelne zerfetzte Handschriften gegeben.
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 15:52 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 15:48 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 15:47 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RF Meyer (anonym) antwortete am 13. Mrz, 15:35:
Sammler sind Kulturträger
Völlig falsch ist es, anzunehmen, die Kultur habe einen Vorteil davon, daß alles hinter Schloß und Riegel in Bibliotheken, Archiven und dergleichen verstaut sei. Abgesehen von der Geldfrage, denn es reicht ja noch nicht einmal für die wichtigen unikalen Stücke, bliebe der (sichere!) Lagerraum und die Bearbeitung. Erst gestern hörte ich wieder von einem Dichternachlaß, der seit mehr als zehn Jahren auf seine Bearbeitung wartet.
Es scheint mir typisch für Leute, die vieles in ihren Bannkreis ziehen wollen, dies dann weder bewältigen noch sicher aufbewahren zu können.
Angesichts der großen Verluste in den Kriegen, der kleineren durch Fehlrestauration, sinnlose Neubindung und unzulängliche Bewahrung, erscheint mir eine möglichst breite Zerstreuung kultureller Güter wesentlich sinnvoller: so überlebt mehr.
Und: Kultur bleibt nur lebendig, wenn möglichst viele direkt und unmittelbar an ihr teilhaben, auch darum gehören die meisten wichtigen Bücher, Autographen etc in den Handel, damit sie von Hand zu Hand gereicht werden, damit die überhaupt noch daran Interessierten an ihnen Vergangenheit wie Gegenwart miterfahren können und diese Erfahrung wie Kristallisationskeime ausstrahlen.
Bibliotheken und Archive strahlen nur eine mehr oder weniger gediegene, verbeamtete Langeweile aus. An ihnen wird sich unsere Kultur nicht erneuern.
[Nun auch http://www.boersenblatt.net/311872/ ]
Ich habe angekündigt, auf http://archiv.twoday.net/stories/5575697 weitere Kommentare zu löschen und das auch in diesem Fall getan. Die obige ideologische Antiquars-Jauche erscheint mir aber bemerkenswert genug, um sie zu dokumentieren. Angesichts des Kölner Unglücks wird man es für verständlich erachten, dass ich solche zynischen Positionen nicht goutieren kann. Wir haben zur Zeit Wichtigeres zu tun, daher gilt:
Ende der Diskussion
Sammler sind Kulturträger
Völlig falsch ist es, anzunehmen, die Kultur habe einen Vorteil davon, daß alles hinter Schloß und Riegel in Bibliotheken, Archiven und dergleichen verstaut sei. Abgesehen von der Geldfrage, denn es reicht ja noch nicht einmal für die wichtigen unikalen Stücke, bliebe der (sichere!) Lagerraum und die Bearbeitung. Erst gestern hörte ich wieder von einem Dichternachlaß, der seit mehr als zehn Jahren auf seine Bearbeitung wartet.
Es scheint mir typisch für Leute, die vieles in ihren Bannkreis ziehen wollen, dies dann weder bewältigen noch sicher aufbewahren zu können.
Angesichts der großen Verluste in den Kriegen, der kleineren durch Fehlrestauration, sinnlose Neubindung und unzulängliche Bewahrung, erscheint mir eine möglichst breite Zerstreuung kultureller Güter wesentlich sinnvoller: so überlebt mehr.
Und: Kultur bleibt nur lebendig, wenn möglichst viele direkt und unmittelbar an ihr teilhaben, auch darum gehören die meisten wichtigen Bücher, Autographen etc in den Handel, damit sie von Hand zu Hand gereicht werden, damit die überhaupt noch daran Interessierten an ihnen Vergangenheit wie Gegenwart miterfahren können und diese Erfahrung wie Kristallisationskeime ausstrahlen.
Bibliotheken und Archive strahlen nur eine mehr oder weniger gediegene, verbeamtete Langeweile aus. An ihnen wird sich unsere Kultur nicht erneuern.
[Nun auch http://www.boersenblatt.net/311872/ ]
Ich habe angekündigt, auf http://archiv.twoday.net/stories/5575697 weitere Kommentare zu löschen und das auch in diesem Fall getan. Die obige ideologische Antiquars-Jauche erscheint mir aber bemerkenswert genug, um sie zu dokumentieren. Angesichts des Kölner Unglücks wird man es für verständlich erachten, dass ich solche zynischen Positionen nicht goutieren kann. Wir haben zur Zeit Wichtigeres zu tun, daher gilt:
Ende der Diskussion
http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641231.shtml
Der gesamte Adenauernachlass ist unversehrt aus den Trümmern des Kölner Historischen Stadtarchivs geborgen worden. "Das ist eine echte Sensation", sagte der Leiter des Rheinischen Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Arie Nabrings, am Freitag dem epd. In dem Rheinischen Zentrum soll ein Teil der beschädigten Archivmaterialien aus dem vor zehn Tagen zerstörten Kölner Stadtarchiv aufbewahrt und restauriert werden.
"Die erfolgreiche Bergung sei unter anderem den sehr stabilen und großen Kartons zu verdanken, in denen das Stadtarchiv seine Archivalien aufbewahrt habe", sagte Nabrings. In Fachkreisen würden sie die "Kölner Kartons" genannt, weil die meisten anderen Archive kleinere und weniger stabile Kartons zur Aufbewahrung nutzen. "Daraus wird man für zukünftige Archivierungen sicherlich lernen", sagte er. Etwa 20 Prozent des Bestandes sind bislang unversehrt geborgen worden.
In welchem Zustand sich die weiteren Dokumente befinden, die tief unten in den 28 Meter tiefen Krater gerutscht sind, können die Experten noch nicht abschätzen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Bergung an der Unglücksstelle bis zu einem Jahr dauern wird. "Die Archivalien werden vermutlich als feuchter Klumpen geborgen werden", sagte Nabrings. Dennoch sei er Optimist: "Heutzutage können wir mit moderner Technik viel bewirken."
Der Einsatz im Trümmerfeld bleibt weiter den gut ausgebildeten Experten von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) vorbehalten, die die geborgenen Güter schnellstmöglich Archivaren und Restauratoren übergeben. Andere der bislang geretteten Dokumente sind erstaunlich gut erhalten, andere so stark zerstört, dass es nur noch Papierschnitzel gibt. Eine dritte Gruppe befindet sich nach Angaben der Feuerwehr zufolge zwar in desolatem Zustand, kann aber restauriert werden. Von den mehr als 1500 besonders wertvollen Handschriften im Bestand des Stadtarchivs wurden bisher etwa 100 Exemplare geborgen. (epd/ddp)
Der gesamte Adenauernachlass ist unversehrt aus den Trümmern des Kölner Historischen Stadtarchivs geborgen worden. "Das ist eine echte Sensation", sagte der Leiter des Rheinischen Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Arie Nabrings, am Freitag dem epd. In dem Rheinischen Zentrum soll ein Teil der beschädigten Archivmaterialien aus dem vor zehn Tagen zerstörten Kölner Stadtarchiv aufbewahrt und restauriert werden.
"Die erfolgreiche Bergung sei unter anderem den sehr stabilen und großen Kartons zu verdanken, in denen das Stadtarchiv seine Archivalien aufbewahrt habe", sagte Nabrings. In Fachkreisen würden sie die "Kölner Kartons" genannt, weil die meisten anderen Archive kleinere und weniger stabile Kartons zur Aufbewahrung nutzen. "Daraus wird man für zukünftige Archivierungen sicherlich lernen", sagte er. Etwa 20 Prozent des Bestandes sind bislang unversehrt geborgen worden.
In welchem Zustand sich die weiteren Dokumente befinden, die tief unten in den 28 Meter tiefen Krater gerutscht sind, können die Experten noch nicht abschätzen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Bergung an der Unglücksstelle bis zu einem Jahr dauern wird. "Die Archivalien werden vermutlich als feuchter Klumpen geborgen werden", sagte Nabrings. Dennoch sei er Optimist: "Heutzutage können wir mit moderner Technik viel bewirken."
Der Einsatz im Trümmerfeld bleibt weiter den gut ausgebildeten Experten von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) vorbehalten, die die geborgenen Güter schnellstmöglich Archivaren und Restauratoren übergeben. Andere der bislang geretteten Dokumente sind erstaunlich gut erhalten, andere so stark zerstört, dass es nur noch Papierschnitzel gibt. Eine dritte Gruppe befindet sich nach Angaben der Feuerwehr zufolge zwar in desolatem Zustand, kann aber restauriert werden. Von den mehr als 1500 besonders wertvollen Handschriften im Bestand des Stadtarchivs wurden bisher etwa 100 Exemplare geborgen. (epd/ddp)
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 15:16 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vortrag von Mario Wimmer am 16.03. in Wien
Dank an und Link zu:
http://arcana.twoday.net/stories/5569767/
Dank an und Link zu:
http://arcana.twoday.net/stories/5569767/
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 14:35 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Heiko Ostendorf, Kölner Stadtanzeiger, 12.3.
http://www.ksta.de/html/artikel/1233584126446.shtml
Das geborgene Archivmaterial aus Köln wird in Münster in einem Spezialverfahren bei minus 30 Grad und Unterdruck gefriergetrocknet. So sollen die durchnässten Dokumente vor Schimmel geschützt werden....
MÜNSTER/KÖLN - Beim Anblick der beschädigten Dokumente leidet die Restaurierungstechnikerin mit. „Das ist für mich erschreckend, wie viel unseres Kulturgutes kaputt gehen kann“, sagt Anke Perske betroffen, als sie die ersten Akten in der Hand hält, die nach dem Einsturz des Stadtarchivs in Köln geborgen worden sind. Ihr Hauptfeind sei der Schimmel. Der könne innerhalb von fünf Tagen unwiederbringliche Schäden an Büchern und Akten verursachen. (...)
und Restaurierung: Archivgut soll digitalisiert werden
Von Matthias Pesch, Kölner Stadtanzeiger, 12.03.09
Die Leiterin des eingestürzten Kölner Stadtarchivs Bettina Schmidt-Czaja will die aus den Trümmern geretteten Dokumente so schnell wie möglich digitalisieren. Um das Archivgut zu restaurieren, werden die Dokumente auch an auswärtige Archive weitergeleitet. (...)
Dazu Bildergalerie: Rettung der Stadtarchiv-Dokumente
Vgl. auch Video der WDR-Mediathek, Sendung WDR 5 - Westblick, Do, 12.3.2009, Dokumente on the rocks
Sammeladresse der einschlägigen KSTA-Beiträge zum Thema:
Schätze aus dem Stadtarchiv
http://www.ksta.de/html/artikel/1233584126446.shtml
Das geborgene Archivmaterial aus Köln wird in Münster in einem Spezialverfahren bei minus 30 Grad und Unterdruck gefriergetrocknet. So sollen die durchnässten Dokumente vor Schimmel geschützt werden....
MÜNSTER/KÖLN - Beim Anblick der beschädigten Dokumente leidet die Restaurierungstechnikerin mit. „Das ist für mich erschreckend, wie viel unseres Kulturgutes kaputt gehen kann“, sagt Anke Perske betroffen, als sie die ersten Akten in der Hand hält, die nach dem Einsturz des Stadtarchivs in Köln geborgen worden sind. Ihr Hauptfeind sei der Schimmel. Der könne innerhalb von fünf Tagen unwiederbringliche Schäden an Büchern und Akten verursachen. (...)
und Restaurierung: Archivgut soll digitalisiert werden
Von Matthias Pesch, Kölner Stadtanzeiger, 12.03.09
Die Leiterin des eingestürzten Kölner Stadtarchivs Bettina Schmidt-Czaja will die aus den Trümmern geretteten Dokumente so schnell wie möglich digitalisieren. Um das Archivgut zu restaurieren, werden die Dokumente auch an auswärtige Archive weitergeleitet. (...)
Dazu Bildergalerie: Rettung der Stadtarchiv-Dokumente
Vgl. auch Video der WDR-Mediathek, Sendung WDR 5 - Westblick, Do, 12.3.2009, Dokumente on the rocks
Sammeladresse der einschlägigen KSTA-Beiträge zum Thema:
Schätze aus dem Stadtarchiv
BCK - am Freitag, 13. März 2009, 14:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Summary VI at Salon Jewish Studies (http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-vi_13.html)
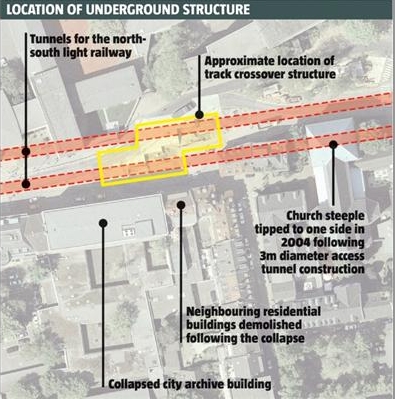 (UPDATE: Unfortunately, the picture above marks the wrong church of which the steel tipped to one side in 2004. Please follow this link [google maps] to see the correct location of St. Johann Baptist church in Severinstr. 1)
(UPDATE: Unfortunately, the picture above marks the wrong church of which the steel tipped to one side in 2004. Please follow this link [google maps] to see the correct location of St. Johann Baptist church in Severinstr. 1)
Notes on the rescue process from the new blog Archiv-in-Truemmern.de (AiT), which was launched on 10th of March 2009
Students of the Academy of Art Bern (Department for conservation and restauration), supervised by Sebastian Dobrusskin, support the rescue team at the scene. (AiT March 12th 2009 via Archivalia)
On March 12th 2009, the following material was recovered: 1) medieval handwritings 2) council records 3) files of the Adenauer inventory (902) 4) deeply damaged material from the personal papers collection of the architect Schneider-Wessling. (AiT March 12th 2009 via Archivalia)
Figures from the Digital Cologne Historical Archive
Up to now, 378 documents had been uploaded by 222 Users.
Individual experiences during the rescue process at the scene (http://twitter.com/SunshineFan via Archivalia)
S. found many modern (20th century) material: typed, construction plans in good condition but partly wet and crinkled and sometimes just snippets. S. did not find any deeds or similar things but many books of private (bequest-)collections, partly tattered and squashed. Many mikrofiches, diapositives and negatives had been found – mostly destroyed, some got cleaned. 3-D-objects such as medals, badges, gifts to the City of Cologne and others (parts of bequests) had also been found.
Consequences of the Cologne Archive's collapse for research centers, an example (Kuvi - Kultur & Visionen March 13th 2009 via Archivalia)
“The collapse of the Cologne Historical Archive (CHA) also has consequences for the students at Bochumer Ruhr- University. Many students are not able to complete their work because of the loss. Especially, the historians researching and working on Middle Ages are affected very hard. For example, there is a young researcher who has been working for a book on the topic of patrician families in Cologne for the last four years. He is that all the material for his work is submerged. His research is apruptly abandoned. The director of the concerned department at Bochum Ruhr- University wants to help his students and prevent hardship provisions. Until now, he can only wait to see how many documents can be found and restored in the end out of the rubble."
Selected news on the collapse (in English)
Authorities Uncover Second Victim of Cologne Archive Collapse (DW-World.de March 12th 2009)
While announcing the discovery of a second corpse on Thursday, March 12, a Cologne fire department spokesperson could not confirm whether the body found was that of a 24-year-old who reportedly lived in a building near the archive and has been missing since the archive suddenly collapsed on March 3.
The remains, which were found nine meters (29.5 feet) beneath ground level, had not yet been removed from the rubble and it was impossible to tell [on] Thursday evening if they were from a man or woman, the spokesman added."
Cologne collapse: no compensation grouting used for archive (Jessica Rowson, Technical reporter for New Civil Engineer on March 12th 2009)
"Cologne’s City archive building had not been underpinned or compensation grouted despite its proximity to the underground works being carried out for the Cologne North-South light railway, a Cologne transit authority Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) spokesman revealed today." (Further reports by Jessica Rowson availabe on NCE)
(Picture above: Location of underground structure published onNew Civil Engineer)
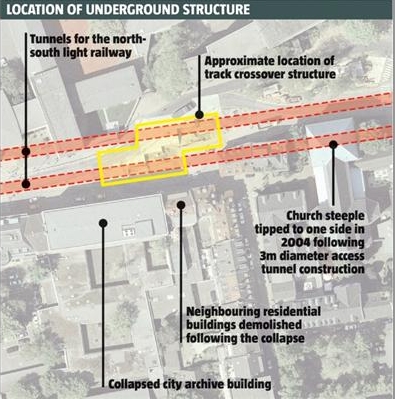 (UPDATE: Unfortunately, the picture above marks the wrong church of which the steel tipped to one side in 2004. Please follow this link [google maps] to see the correct location of St. Johann Baptist church in Severinstr. 1)
(UPDATE: Unfortunately, the picture above marks the wrong church of which the steel tipped to one side in 2004. Please follow this link [google maps] to see the correct location of St. Johann Baptist church in Severinstr. 1)Notes on the rescue process from the new blog Archiv-in-Truemmern.de (AiT), which was launched on 10th of March 2009
Students of the Academy of Art Bern (Department for conservation and restauration), supervised by Sebastian Dobrusskin, support the rescue team at the scene. (AiT March 12th 2009 via Archivalia)
On March 12th 2009, the following material was recovered: 1) medieval handwritings 2) council records 3) files of the Adenauer inventory (902) 4) deeply damaged material from the personal papers collection of the architect Schneider-Wessling. (AiT March 12th 2009 via Archivalia)
Figures from the Digital Cologne Historical Archive
Up to now, 378 documents had been uploaded by 222 Users.
Individual experiences during the rescue process at the scene (http://twitter.com/SunshineFan via Archivalia)
S. found many modern (20th century) material: typed, construction plans in good condition but partly wet and crinkled and sometimes just snippets. S. did not find any deeds or similar things but many books of private (bequest-)collections, partly tattered and squashed. Many mikrofiches, diapositives and negatives had been found – mostly destroyed, some got cleaned. 3-D-objects such as medals, badges, gifts to the City of Cologne and others (parts of bequests) had also been found.
Consequences of the Cologne Archive's collapse for research centers, an example (Kuvi - Kultur & Visionen March 13th 2009 via Archivalia)
“The collapse of the Cologne Historical Archive (CHA) also has consequences for the students at Bochumer Ruhr- University. Many students are not able to complete their work because of the loss. Especially, the historians researching and working on Middle Ages are affected very hard. For example, there is a young researcher who has been working for a book on the topic of patrician families in Cologne for the last four years. He is that all the material for his work is submerged. His research is apruptly abandoned. The director of the concerned department at Bochum Ruhr- University wants to help his students and prevent hardship provisions. Until now, he can only wait to see how many documents can be found and restored in the end out of the rubble."
Selected news on the collapse (in English)
Authorities Uncover Second Victim of Cologne Archive Collapse (DW-World.de March 12th 2009)
While announcing the discovery of a second corpse on Thursday, March 12, a Cologne fire department spokesperson could not confirm whether the body found was that of a 24-year-old who reportedly lived in a building near the archive and has been missing since the archive suddenly collapsed on March 3.
The remains, which were found nine meters (29.5 feet) beneath ground level, had not yet been removed from the rubble and it was impossible to tell [on] Thursday evening if they were from a man or woman, the spokesman added."
Cologne collapse: no compensation grouting used for archive (Jessica Rowson, Technical reporter for New Civil Engineer on March 12th 2009)
"Cologne’s City archive building had not been underpinned or compensation grouted despite its proximity to the underground works being carried out for the Cologne North-South light railway, a Cologne transit authority Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) spokesman revealed today." (Further reports by Jessica Rowson availabe on NCE)
(Picture above: Location of underground structure published onNew Civil Engineer)
Frank.Schloeffel - am Freitag, 13. März 2009, 09:50 - Rubrik: English Corner
S. Post berichtet über die Auswirkung einer PRessemitteilung der FH Potsdam.
Link:
http://www.spost.info/archives/198
Hobohm ordnet es informationswissenschaftlich ein:
http://hobohm.edublogs.org/2009/03/11/fh-potsdam-hilft-stadtarchiv-koln-medienreaktionen/
Link:
http://www.spost.info/archives/198
Hobohm ordnet es informationswissenschaftlich ein:
http://hobohm.edublogs.org/2009/03/11/fh-potsdam-hilft-stadtarchiv-koln-medienreaktionen/
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 09:12 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 09:10 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Einsturz des Stadtarchivs in Köln hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Geschichts- Studenten an der Bochumer Ruhr- Universität. Durch den Verlust der historischen Dokumente kann eine Reihe von Studenten ihre Forschungsarbeiten nicht beenden. Besonders hart sind die Historiker betroffen, die sich auf die Erforschung des Mittelalters spezialisiert haben. Zum Beispiel ein junger Forscher, der seit vier Jahren an einem Buch über Kölner Patrizier-Familien im Mittelalter arbeitet. Alle Materialien für seine Arbeit seien verschüttet, sagte er. Seine Forschungen seien damit am Ende. Der Leiter des Fachbereichs an der Ruhr Universität will seinen Studenten helfen und Härtefalle verhindern. Jedoch könne er zurzeit nur abwarten, wie viele historische Dokumente aus den Trümmern des Stadtarchivs geborgen werden können."
Quelle: Link
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 08:48 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hildegard Stausberg, Diplomatische Korrespondentin der WELT, stellt den VdA-Koordinator vor Ort vor: " ..... Der promovierte Historiker ist in der Stadt glänzend vernetzt: Sein Bruder Peter Michael ist Stadtkämmerer, sein Vater war ein bekannter Stadt- und Landespolitiker. .....Er rief Kölner Unternehmer an, die Speditionen hatten oder über freie Lagerflächen und Kühlhäuser verfügten. "Klüngel ist nicht nur schlecht", sagt er. Das Motto "man kennt sich, man hilft sich" habe sich diesmal bewährt. "Ich habe übers Handy in wenigen Stunden ein Unterstützungsnetz knüpfen können, das sich sehen lassen kann, da hat sich keiner gedrückt." ....."
Quelle:
http://www.welt.de/welt_print/article3368573/Koelscher-Kluengel.html
Quelle:
http://www.welt.de/welt_print/article3368573/Koelscher-Kluengel.html
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 08:40 - Rubrik: Kommunalarchive
Elmar Ries berichtet für die Westfälischen Nachrichten: " ....Es wirkt der alten, teilweise äußerst wertvollen Dokumente fast schon unwürdig, wie sie da in Münster ankommen müssen. Auf einem Pkw-Anhänger liegen sie in zwei der Metallkisten. Eiskalt sind die kostbaren Bücher und uralten Akten, eilends eingewickelt in Cellophanpapier und so notdürftig geschützt. Unter normalen Umständen hätten sich die Archivare die Haare gerauft. 8,5 Tonnen umfasst die erste Lieferung. Sämtliche Unterlagen sind in den vergangenen Tagen bei der Humana-Milchunion in Everswinkel tiefgefroren worden - „bei minus 30 Grad Celsius, damit die von Grundwasser und Regen völlig durchnässten Papiere nicht vom Schimmelpilz befallen werden“, sagt Dr. Marcus Stumpf, der Leiter des Archivamtes.
....."
....."
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 08:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1) Studierende der Hochschule der Künste Bern (Fachbereich Konservierung und Restaurierung) verstärken das Team im Erstversorgungszentrum.
Link:
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/12/angehende-restauratoren-im-evz/
2) Am 12.03.2009 konnten unter anderem geborgen werden:
- mehrere mittelalterliche Handschriften
- Ratsprotokolle
- Akten aus dem Bestand Adenauer (902)
- stark beschädigte Archivalien aus dem Architekten-Nachlass Schneider-Wessling.
Link:
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/12/bergung-der-archivalien-geht-voran/
Link:
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/12/angehende-restauratoren-im-evz/
2) Am 12.03.2009 konnten unter anderem geborgen werden:
- mehrere mittelalterliche Handschriften
- Ratsprotokolle
- Akten aus dem Bestand Adenauer (902)
- stark beschädigte Archivalien aus dem Architekten-Nachlass Schneider-Wessling.
Link:
http://www.archiv-in-truemmern.de/2009/03/12/bergung-der-archivalien-geht-voran/
Wolf Thomas - am Freitag, 13. März 2009, 08:16 - Rubrik: Kommunalarchive
Am 8. Dezember 2008 schrieb ich dem LG München I zu einer unveröffentlichten Entscheidung: "Es wird um kostenlose Uebermittlung einer Urteilsabschrift via Mail
gebeten (ersatzweise per Post). Diese wird zum Zweck
wissenschaftlicher Forschung, der Mitteilung in einer kostenlosen
Entscheidungssammlung im Internet und der Presseberichterstattung benoetigt." Heute, über drei Monate später, waren 12 Kopien in der Post samt Rechnung in Höhe von 7,50 Euro - und natürlich kein Wort zu meiner Bitte um kostenlose Übersendung.
Außerdem ist der Abdruck durch Schwärzungen regelrecht verstümmelt. Ein kommerzieller Verlag wäre so vermutlich nicht bedient worden:
"... zu unterlassen, Nachdrucke von Ausgaben, insbesondere Original-Ausgaben , der im -------- Musikwerke mit einem Copyright-Vermerk ... anzubieten"
"... die einzelnen Nachdrucke von Ausgaben der ------ erschienenen Musikwerke"
Daraus kann man keinen veröffentlichungsfähigen Text erstellen, auch wenn aus dem Zusammenhang klar wird, dass höchstwahrscheinlich in der ersten Lücke "im Musikverlag ... erschienenen" und in der zweiten "im Musikverlag ... erschienenen" zu ergänzen sein wird.
Besonders dreist: "unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1988, Seite 313 --------)" Es wurde also auch der publizierte Urteilsname "Auto F. GmbH" neutralisiert.
Update: das Gericht weigert sich, eine per Mail eingereichte Beschwerde zu bearbeiten.
gebeten (ersatzweise per Post). Diese wird zum Zweck
wissenschaftlicher Forschung, der Mitteilung in einer kostenlosen
Entscheidungssammlung im Internet und der Presseberichterstattung benoetigt." Heute, über drei Monate später, waren 12 Kopien in der Post samt Rechnung in Höhe von 7,50 Euro - und natürlich kein Wort zu meiner Bitte um kostenlose Übersendung.
Außerdem ist der Abdruck durch Schwärzungen regelrecht verstümmelt. Ein kommerzieller Verlag wäre so vermutlich nicht bedient worden:
"... zu unterlassen, Nachdrucke von Ausgaben, insbesondere Original-Ausgaben , der im -------- Musikwerke mit einem Copyright-Vermerk ... anzubieten"
"... die einzelnen Nachdrucke von Ausgaben der ------ erschienenen Musikwerke"
Daraus kann man keinen veröffentlichungsfähigen Text erstellen, auch wenn aus dem Zusammenhang klar wird, dass höchstwahrscheinlich in der ersten Lücke "im Musikverlag ... erschienenen" und in der zweiten "im Musikverlag ... erschienenen" zu ergänzen sein wird.
Besonders dreist: "unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1988, Seite 313 --------)" Es wurde also auch der publizierte Urteilsname "Auto F. GmbH" neutralisiert.
Update: das Gericht weigert sich, eine per Mail eingereichte Beschwerde zu bearbeiten.
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 02:30 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
F.A.Z., 13.03.2009, Nr. 61 S. 34. Inzwischen gibt es 372 Uploads von Archivalien aus dem Historischen Archiv der Stadt Köln.


KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 01:37 - Rubrik: Kommunalarchive
http://twitter.com/SunshineFan
S. hatte in erster Linie viele neueren Dokumente: maschinengeschrieben, Bauleitplanung in recht gutem Zustand, teils jedoch nur stark zerknittert oder sehr nass, manchmal aber auch nur noch einzelne Papierschnippsel. Urkunden u.ä. sind ihm nicht untergekommen, aber viele Bücher aus Nachlässen, z.T. stark zerfleddert und eingedrückt. Es wurden viele Mikrofiches, Dias und Negative gefunden - zum Teil zerstört, viele konnten aber gereinigt werden. Ebenso wurden 3-D-Objekte aus Nachlässen gefunden, z.T. in sehr gutem Zustand: Orden, Abzeichen, Gastgeschenke an die Stadt Köln, etc.
S. hatte in erster Linie viele neueren Dokumente: maschinengeschrieben, Bauleitplanung in recht gutem Zustand, teils jedoch nur stark zerknittert oder sehr nass, manchmal aber auch nur noch einzelne Papierschnippsel. Urkunden u.ä. sind ihm nicht untergekommen, aber viele Bücher aus Nachlässen, z.T. stark zerfleddert und eingedrückt. Es wurden viele Mikrofiches, Dias und Negative gefunden - zum Teil zerstört, viele konnten aber gereinigt werden. Ebenso wurden 3-D-Objekte aus Nachlässen gefunden, z.T. in sehr gutem Zustand: Orden, Abzeichen, Gastgeschenke an die Stadt Köln, etc.
KlausGraf - am Freitag, 13. März 2009, 00:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 23:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Steinhauer
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/03/12/zweitveroeffentlichungsrecht-schranke-5743943/
widerlegt überzeugend Hirschfelder über die rechtliche Umsetzbarkeit von Open Access
http://www.jurpc.de/aufsatz/20090046.htm
Auch eine arbeitsvertragliche Anbietungspflicht wäre keine Urheberrechtsschranke!Wenn verlangt werden kann, dass Dissertationen zu veröffentlichen sind, was einen Eingriff in das Veröffentlichungsrecht darstellt, ist es m.E. auch zulässig, in Anknüpfung an staatliche Leistungen eine zusätzliche Open-Access-Zweitveröffentlichung zu normieren.
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/03/12/zweitveroeffentlichungsrecht-schranke-5743943/
widerlegt überzeugend Hirschfelder über die rechtliche Umsetzbarkeit von Open Access
http://www.jurpc.de/aufsatz/20090046.htm
Auch eine arbeitsvertragliche Anbietungspflicht wäre keine Urheberrechtsschranke!Wenn verlangt werden kann, dass Dissertationen zu veröffentlichen sind, was einen Eingriff in das Veröffentlichungsrecht darstellt, ist es m.E. auch zulässig, in Anknüpfung an staatliche Leistungen eine zusätzliche Open-Access-Zweitveröffentlichung zu normieren.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 23:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen
Via http://www.urheberrecht.org/news/3573/url
http://www.sueddeutsche.de/752382/017/2795502/Vorschnelles-Verbot.html
In München zweifelte die 21. Zivilkammer die Argumentation des Freistaats an, der sich auf das Urheberrecht beruft. Vor Gericht geht es unter anderem um Faksimiles der NSDAP-Zeitung Völkischer Beobachter vom Frühjahr 1933. Der Freistaat behauptet, dass er die Urheberrechte des damaligen Herausgebers - Adolf Hitler - und die des NS-Verlags Franz Eher hält. Die Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Thomas Kaess ließ jedoch durchblicken, dass sie dieses Urheberrecht bereits für erloschen ansieht. Wenn der Freistaat solche Nachdrucke verbieten wolle, solle er entsprechende Gesetze schaffen statt im Urheberrecht "herumzustochern", hieß es. Dieses sei für solche Fragen eine schwierige Rechtsgrundlage. Adolf Hitler, so das Gericht, sei zwar offiziell Herausgeber des Völkischen Beobachters gewesen. Es sei jedoch sehr zweifelhaft, ob er auch als solcher, also schöpferisch tätig gewesen sei. Ob er etwa die Zeit hatte, zu entscheiden, welcher Artikel wo im Blatt erschien. Nur als Herausgeber genannt zu werden, reiche für das Eigentum an den Rechten aber nicht aus, so die Richter.
Ähnlich verhalte es sich mit den sogenannten Schriftleitern des NS-Blattes, Alfred Rosenberg und Wilhelm Weiß. Der Freistaat hatte sich vor Gericht auch auf das Schriftleitergesetz von 1933 berufen. Nun ist es schon an sich sehr bemerkenswert, dass Bayern seine Position mit einem NS-Gesetz zu untermauern versucht, welches unter anderem vorschrieb, dass ein Schriftleiter "arisch" zu sein habe. Das Gericht wies den Punkt aber schon deshalb zurück, weil trotz des Gesetzes nicht klar sei, ob es überhaupt eine Rechtsübertragung von Weiß und Rosenberg an den Eher-Verlag gegeben hat - und wenn ja, was für eine (einfach, ausschließlich?). Zweitens, so die Richter, sei das Gesetz erst im Oktober 1933 in Kraft getreten. Die Faksimiles stammen aber vom März "33. Verleger McGee sprach nach der Verhandlung von einem "entscheidenden Schritt in Richtung rechtlicher Klarheit". Er sei gespannt auf das Urteil.
Damit werden in Archivalia geäußerte Zweifel bestätigt.
Allerdings hätte ich gern einen Beleg für die u.a. in der WELT zitierte Aussage: "Rechte der Verlage laufen 70 Jahre nach Erscheinen der jeweiligen Ausgabe ab, erklärte der Vorsitzende Richter Thomas Kaess."
http://www.welt.de/kultur/article3358304/Zeitungszeugen-Bayern-steht-vor-Niederlage.html
Es gibt kein eigenständiges Verlagsrecht neben dem Urheberrrecht!
Wenn man auf anonyme Werke § 66 UrhG abhebt, so setzt das voraus, dass es einen Schöpfer gegeben hat, der das Sammelwerk als Ganzes, also die Zeitung zusammengestellt hat. Ist ein solcher nicht sofort ersichtlich, greift die Vermutung der Urheberschaft nach § 10 Abs. 2 UrhG, wonach der Herausgeber oder ist ein solcher nicht angegeben, der Verleger ermächtigt ist, die Rechte geltend zu machen.
Bei Sammelwerken gilt nach Schricker § 10 Rz. 15, dass der als Herausgeber bezeichnete der Urheber nach Abs. 1 ist.
Ob die Herausgebertätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde, ist irrelevant (Rz. 13).
Nachtrag: Laut http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29920/1.html verweist das Gericht auf § 134 UrhG. War eine juristische Person nach dem LUG als Urheber anzusehen, so beträgt die Dauer des Urheberrechts 70 Jahre nach Veröffentlichung, § 32 Satz 1 LUG
http://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_betreffend_das_Urheberrecht_an_Werken_der_Literatur_und_der_Tonkunst
§ 3 LUG lautet aber "Juristische Personen des öffentlichen Rechtes, die als Herausgeber ein Werk veröffentlichen, dessen Verfasser nicht auf dem Titelblatt, in der Zueignung, in der Vorrede oder am Schlusse genannt wird, werden, wenn nicht ein Anderes vereinbart ist, als Urheber des Werkes angesehen."
Wie man auf den Gedanken kommen kann, der Eher-Verlag sei eine juristische Person des öffentlichen Rechts gewesen, erschließt sich mir nicht.
§ 4 lautet: "Besteht ein Werk aus den getrennten Beiträgen Mehrerer (Sammelwerk), so wird für das Werk als Ganzes der Herausgeber als Urheber angesehen. Ist ein solcher nicht genannt, so gilt der Verleger als Herausgeber." Siehe heute dazu § 10 UrhG.
Die fraglichen Zeitungen waren Sammelwerke, die als solche ihrem Herausgeber zugerechnet werden können. Einen Anwendungsbereich für § 134 sehe ich nicht.
Via http://www.urheberrecht.org/news/3573/url
http://www.sueddeutsche.de/752382/017/2795502/Vorschnelles-Verbot.html
In München zweifelte die 21. Zivilkammer die Argumentation des Freistaats an, der sich auf das Urheberrecht beruft. Vor Gericht geht es unter anderem um Faksimiles der NSDAP-Zeitung Völkischer Beobachter vom Frühjahr 1933. Der Freistaat behauptet, dass er die Urheberrechte des damaligen Herausgebers - Adolf Hitler - und die des NS-Verlags Franz Eher hält. Die Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Thomas Kaess ließ jedoch durchblicken, dass sie dieses Urheberrecht bereits für erloschen ansieht. Wenn der Freistaat solche Nachdrucke verbieten wolle, solle er entsprechende Gesetze schaffen statt im Urheberrecht "herumzustochern", hieß es. Dieses sei für solche Fragen eine schwierige Rechtsgrundlage. Adolf Hitler, so das Gericht, sei zwar offiziell Herausgeber des Völkischen Beobachters gewesen. Es sei jedoch sehr zweifelhaft, ob er auch als solcher, also schöpferisch tätig gewesen sei. Ob er etwa die Zeit hatte, zu entscheiden, welcher Artikel wo im Blatt erschien. Nur als Herausgeber genannt zu werden, reiche für das Eigentum an den Rechten aber nicht aus, so die Richter.
Ähnlich verhalte es sich mit den sogenannten Schriftleitern des NS-Blattes, Alfred Rosenberg und Wilhelm Weiß. Der Freistaat hatte sich vor Gericht auch auf das Schriftleitergesetz von 1933 berufen. Nun ist es schon an sich sehr bemerkenswert, dass Bayern seine Position mit einem NS-Gesetz zu untermauern versucht, welches unter anderem vorschrieb, dass ein Schriftleiter "arisch" zu sein habe. Das Gericht wies den Punkt aber schon deshalb zurück, weil trotz des Gesetzes nicht klar sei, ob es überhaupt eine Rechtsübertragung von Weiß und Rosenberg an den Eher-Verlag gegeben hat - und wenn ja, was für eine (einfach, ausschließlich?). Zweitens, so die Richter, sei das Gesetz erst im Oktober 1933 in Kraft getreten. Die Faksimiles stammen aber vom März "33. Verleger McGee sprach nach der Verhandlung von einem "entscheidenden Schritt in Richtung rechtlicher Klarheit". Er sei gespannt auf das Urteil.
Damit werden in Archivalia geäußerte Zweifel bestätigt.
Allerdings hätte ich gern einen Beleg für die u.a. in der WELT zitierte Aussage: "Rechte der Verlage laufen 70 Jahre nach Erscheinen der jeweiligen Ausgabe ab, erklärte der Vorsitzende Richter Thomas Kaess."
http://www.welt.de/kultur/article3358304/Zeitungszeugen-Bayern-steht-vor-Niederlage.html
Es gibt kein eigenständiges Verlagsrecht neben dem Urheberrrecht!
Wenn man auf anonyme Werke § 66 UrhG abhebt, so setzt das voraus, dass es einen Schöpfer gegeben hat, der das Sammelwerk als Ganzes, also die Zeitung zusammengestellt hat. Ist ein solcher nicht sofort ersichtlich, greift die Vermutung der Urheberschaft nach § 10 Abs. 2 UrhG, wonach der Herausgeber oder ist ein solcher nicht angegeben, der Verleger ermächtigt ist, die Rechte geltend zu machen.
Bei Sammelwerken gilt nach Schricker § 10 Rz. 15, dass der als Herausgeber bezeichnete der Urheber nach Abs. 1 ist.
Ob die Herausgebertätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde, ist irrelevant (Rz. 13).
Nachtrag: Laut http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29920/1.html verweist das Gericht auf § 134 UrhG. War eine juristische Person nach dem LUG als Urheber anzusehen, so beträgt die Dauer des Urheberrechts 70 Jahre nach Veröffentlichung, § 32 Satz 1 LUG
http://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_betreffend_das_Urheberrecht_an_Werken_der_Literatur_und_der_Tonkunst
§ 3 LUG lautet aber "Juristische Personen des öffentlichen Rechtes, die als Herausgeber ein Werk veröffentlichen, dessen Verfasser nicht auf dem Titelblatt, in der Zueignung, in der Vorrede oder am Schlusse genannt wird, werden, wenn nicht ein Anderes vereinbart ist, als Urheber des Werkes angesehen."
Wie man auf den Gedanken kommen kann, der Eher-Verlag sei eine juristische Person des öffentlichen Rechts gewesen, erschließt sich mir nicht.
§ 4 lautet: "Besteht ein Werk aus den getrennten Beiträgen Mehrerer (Sammelwerk), so wird für das Werk als Ganzes der Herausgeber als Urheber angesehen. Ist ein solcher nicht genannt, so gilt der Verleger als Herausgeber." Siehe heute dazu § 10 UrhG.
Die fraglichen Zeitungen waren Sammelwerke, die als solche ihrem Herausgeber zugerechnet werden können. Einen Anwendungsbereich für § 134 sehe ich nicht.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 22:47 - Rubrik: Archivrecht
Update zu:
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
http://www.schirach.de/?p=346
Die psychiatrische Akte von Klaus Kinski bleibt unter Verschluss, dennoch bleibt der Leiter des Landesarchivs unbestraft. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Uwe Schaper wegen angeblichen "Verbotsirrtums" eingestellt. Schaper profitierte von der unterstützenden Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten Dix.
Unsere archivrechtliche Stellungnahme wurde mit der Einschätzung, die Offenbarung sei rechtswidrig gewesen, voll und ganz bestätigt:
http://archiv.twoday.net/stories/5080454/
Update via Twitter:
VG 1 A 374.08: Zulässigkeit der Herausgabe der Krankenakte von Klaus Kinski an Dritte. VG Berlin, Mündliche Verhandlung 29.04.2009
http://archiv.twoday.net/search?q=kinski
http://www.schirach.de/?p=346
Die psychiatrische Akte von Klaus Kinski bleibt unter Verschluss, dennoch bleibt der Leiter des Landesarchivs unbestraft. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Uwe Schaper wegen angeblichen "Verbotsirrtums" eingestellt. Schaper profitierte von der unterstützenden Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten Dix.
Unsere archivrechtliche Stellungnahme wurde mit der Einschätzung, die Offenbarung sei rechtswidrig gewesen, voll und ganz bestätigt:
http://archiv.twoday.net/stories/5080454/
Update via Twitter:
VG 1 A 374.08: Zulässigkeit der Herausgabe der Krankenakte von Klaus Kinski an Dritte. VG Berlin, Mündliche Verhandlung 29.04.2009
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 22:22 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 20:44 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Titel: "Fragmente - Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung"
Zeit: 19.3. - 21.3.2009
Ort: A-1040 Wien, Wohllebengasse 12-14, EG
Veranstalter: Zentrum Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Anmeldung: nicht erforderlich
Programm: http://www.oeaw.ac.at/zmf/zmf_symposium2009.pdf
Publikation der Kongressakten in der Reihe Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der Österr. Akademie der Wissenschaften (Ende 2009/Anfang 2010)
Zeit: 19.3. - 21.3.2009
Ort: A-1040 Wien, Wohllebengasse 12-14, EG
Veranstalter: Zentrum Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Anmeldung: nicht erforderlich
Programm: http://www.oeaw.ac.at/zmf/zmf_symposium2009.pdf
Publikation der Kongressakten in der Reihe Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der Österr. Akademie der Wissenschaften (Ende 2009/Anfang 2010)
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 20:35 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liebe Kommentatoren,
für Eure zahlreichen konstruktiven Beiträge möchte ich ausdrücklich danken. Bitte überlegt aber, ob Ihr im Einzelfall nicht einen neuen Beitrag mit Link zum Bezugsbeitrag anlegen wollt. Ihr müsst euch dafür nur kurz bei Twoday registrieren (unter einem beliebigen Pseudonym) und könnt dann selbst Beiträge erstellen.
Die Erwägungen, die mich zu der Bitte führen, sind folgende:
* Leser von Archivalia sehen immer nur die ganz wenigen Hinweise auf neue Beiträge rechts, es sind immer nur fünf. Gibt es viele Beiträge, rutschen neue Kommentare rasch weg.
* Nur wenige Leser dürften die Möglichkeit nutzen, Archivalia via RSS mit Kommentaren zu beziehen :
http://archiv.twoday.net/comments.rdf
* Emailbenachrichtigungen bei neuen Kommentaren dürften ebenso die wenigsten aktiviert haben.
* Auf der Startseite werden Kommentare bei den Beiträgen nicht angezeigt, man erfährt nur, ob solche vorhanden sind, sieht aber nicht, ob Kommentare neu sind.
Vielen Lesern entgehen dadurch wertvolle Informationen, auch wenn diese beim Einzelabruf des jeweiligen Beitrags sichtbar sind.
Heute gab es Neuigkeiten zur Psychiatrieakte Kinski in den Kommentaren - aber wer soll davon aktuell etwas erfahren? Auf der Hauptseite ist kein Hinweis mehr zu finden. Dies legt zwingend nahe, bei interessanten Kommentaren zu älteren Beiträgen in jedem Fall einen neueintrag mit Rückverweis anzulegen.
Vielen Dank für die Beachtung!
für Eure zahlreichen konstruktiven Beiträge möchte ich ausdrücklich danken. Bitte überlegt aber, ob Ihr im Einzelfall nicht einen neuen Beitrag mit Link zum Bezugsbeitrag anlegen wollt. Ihr müsst euch dafür nur kurz bei Twoday registrieren (unter einem beliebigen Pseudonym) und könnt dann selbst Beiträge erstellen.
Die Erwägungen, die mich zu der Bitte führen, sind folgende:
* Leser von Archivalia sehen immer nur die ganz wenigen Hinweise auf neue Beiträge rechts, es sind immer nur fünf. Gibt es viele Beiträge, rutschen neue Kommentare rasch weg.
* Nur wenige Leser dürften die Möglichkeit nutzen, Archivalia via RSS mit Kommentaren zu beziehen :
http://archiv.twoday.net/comments.rdf
* Emailbenachrichtigungen bei neuen Kommentaren dürften ebenso die wenigsten aktiviert haben.
* Auf der Startseite werden Kommentare bei den Beiträgen nicht angezeigt, man erfährt nur, ob solche vorhanden sind, sieht aber nicht, ob Kommentare neu sind.
Vielen Lesern entgehen dadurch wertvolle Informationen, auch wenn diese beim Einzelabruf des jeweiligen Beitrags sichtbar sind.
Heute gab es Neuigkeiten zur Psychiatrieakte Kinski in den Kommentaren - aber wer soll davon aktuell etwas erfahren? Auf der Hauptseite ist kein Hinweis mehr zu finden. Dies legt zwingend nahe, bei interessanten Kommentaren zu älteren Beiträgen in jedem Fall einen neueintrag mit Rückverweis anzulegen.
Vielen Dank für die Beachtung!
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 19:45 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
N 24 meldete vor kurzem den Fund einer zweiten Leiche in den Trümmern. Ob es der vermisste Khalil sei, stehe noch nicht fest.
Vor wenigen Minuten waren auch entsprechende Twitter-Meldungen zu lesen. Mit der Google-News-Suche war die Meldung noch nicht zu bestätigen. Gemeldet hat allerdings der KSTA den Fund:
http://www.ksta.de/html/artikel/1236692284420.shtml
19:05: Die Einsatzkräfte haben wahrscheinlich den vermissten Khalil G. gefunden. Neun Tage nach dem Einsturz des historischen Stadtarchivs haben die Hilfskräfte einen zweiten Verschütteten gefunden. Man könne noch nicht sagen, ob es der vermisste 24 Jahre alte Khalil G. sei. Die Leiche liege neun Meter unter dem Erdniveau.
Auch hier gilt unser Mitgefühl den Angehörigen, für die nun schreckliche Gewissheit ist, was zu befürchten war.
Update: http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641031.shtml
Man habe keine Zweifel, dass es der vermisste Khalil sei. Die Feuerwehr will ihre Aktivitäten nach der tagelangen personalintensiven Vermisstensuche zurückfahren. „Wir können nun in Ruhe vorgehen und die Archivalien bergen. Die großen Trümmer werden weiter mit Baggern beseitigt, der Rest wird in Handarbeit erledigt“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Bürgerhausen. Vor allem in dem Tunnelbauwerk der Stadtbahn soll intensiv nach verschütteten Schriften gesucht werden.
Update: Khalil zweifelsfrei identifiziert
http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641031.shtml
Vor wenigen Minuten waren auch entsprechende Twitter-Meldungen zu lesen. Mit der Google-News-Suche war die Meldung noch nicht zu bestätigen. Gemeldet hat allerdings der KSTA den Fund:
http://www.ksta.de/html/artikel/1236692284420.shtml
19:05: Die Einsatzkräfte haben wahrscheinlich den vermissten Khalil G. gefunden. Neun Tage nach dem Einsturz des historischen Stadtarchivs haben die Hilfskräfte einen zweiten Verschütteten gefunden. Man könne noch nicht sagen, ob es der vermisste 24 Jahre alte Khalil G. sei. Die Leiche liege neun Meter unter dem Erdniveau.
Auch hier gilt unser Mitgefühl den Angehörigen, für die nun schreckliche Gewissheit ist, was zu befürchten war.
Update: http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641031.shtml
Man habe keine Zweifel, dass es der vermisste Khalil sei. Die Feuerwehr will ihre Aktivitäten nach der tagelangen personalintensiven Vermisstensuche zurückfahren. „Wir können nun in Ruhe vorgehen und die Archivalien bergen. Die großen Trümmer werden weiter mit Baggern beseitigt, der Rest wird in Handarbeit erledigt“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Bürgerhausen. Vor allem in dem Tunnelbauwerk der Stadtbahn soll intensiv nach verschütteten Schriften gesucht werden.
Update: Khalil zweifelsfrei identifiziert
http://www.ksta.de/html/artikel/1236866641031.shtml
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 19:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?em_cnt=1688541&em_cnt_page=1
In der FR schäumt mit starken Worten Editionswissenschaftler Reuß, der uns bereits durch eine Suada gegen Open Access unliebsam auffiel
http://archiv.twoday.net/search?q=reuß+roland
gegen Googles Bibliothekspartnerschaft. Ein ziemlich dümmliches, teuilweise ahnungsloses Ressentiment, das eklatant verkennt, welche großartigen Möglichkeiten der Editionsphilologie sich durch die Volltextindizierung eröffnen.
Dass im Prinzip alle Bücher, die auf den amerikanischen Servern zu finden sind (also auch die für europäische IPs gesperrten), auch auf www.archive.org eingestellt werden, dürfte sich bei den betroffenen Verlagen zudem langsam ebenfalls herumgesprochen haben. Zur Rückgewinnung von moralischer Kraft und im Interesse einer einheitlichen Position der Verlagsbranche sollten die peinlichen Verträge mit Google allesamt gekündigt (die Kündigungsgründe liegen auf der Hand) und das Allgemeine in den Blick genommen werden.
Was auf archive.org eingestellt wird, ist in den USA legal Public Domain (und überwiegend hier auch). Welche Rechte Verlage daran haben, wäre erst einmal zu erweisen. Dass es bei Google vereinzelte Irrtümer bei der Etikettierung von Public Domain gab und gibt - wen sollte das wundern, bei diesen Büchermassen?
Die Verwertungsgesellschaft ihrerseits sollte sich darauf konzentrieren, die teilweise marodierenden nationalen Bibliotheken wieder zur Räson zu bringen (nicht nur die Frage nach den Intranets, sondern auch die nach den neuerdings wie Pilzen aus dem Boden schießenden öffentlich aufgestellten Scannern drängt sich mir auf, wo für einen Scan nichts bezahlt und folglich auch kein Pfennig an die Produzenten abgeführt wird).
Dummfug! Natürlich wird aufgrund der Geräteabgabe an die Urheber bezahlt, und ansonsten gelten auch die Vergütungsregeln unabhängig davon, ob Entgelt für eine Kopie berechnet wird.
In der FR schäumt mit starken Worten Editionswissenschaftler Reuß, der uns bereits durch eine Suada gegen Open Access unliebsam auffiel
http://archiv.twoday.net/search?q=reuß+roland
gegen Googles Bibliothekspartnerschaft. Ein ziemlich dümmliches, teuilweise ahnungsloses Ressentiment, das eklatant verkennt, welche großartigen Möglichkeiten der Editionsphilologie sich durch die Volltextindizierung eröffnen.
Dass im Prinzip alle Bücher, die auf den amerikanischen Servern zu finden sind (also auch die für europäische IPs gesperrten), auch auf www.archive.org eingestellt werden, dürfte sich bei den betroffenen Verlagen zudem langsam ebenfalls herumgesprochen haben. Zur Rückgewinnung von moralischer Kraft und im Interesse einer einheitlichen Position der Verlagsbranche sollten die peinlichen Verträge mit Google allesamt gekündigt (die Kündigungsgründe liegen auf der Hand) und das Allgemeine in den Blick genommen werden.
Was auf archive.org eingestellt wird, ist in den USA legal Public Domain (und überwiegend hier auch). Welche Rechte Verlage daran haben, wäre erst einmal zu erweisen. Dass es bei Google vereinzelte Irrtümer bei der Etikettierung von Public Domain gab und gibt - wen sollte das wundern, bei diesen Büchermassen?
Die Verwertungsgesellschaft ihrerseits sollte sich darauf konzentrieren, die teilweise marodierenden nationalen Bibliotheken wieder zur Räson zu bringen (nicht nur die Frage nach den Intranets, sondern auch die nach den neuerdings wie Pilzen aus dem Boden schießenden öffentlich aufgestellten Scannern drängt sich mir auf, wo für einen Scan nichts bezahlt und folglich auch kein Pfennig an die Produzenten abgeführt wird).
Dummfug! Natürlich wird aufgrund der Geräteabgabe an die Urheber bezahlt, und ansonsten gelten auch die Vergütungsregeln unabhängig davon, ob Entgelt für eine Kopie berechnet wird.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 17:51 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Historische Archiv des Erzbistums Köln hat heute die bisher in einer Lagerhalle aufbewahrten geretteten Pergamenturkunden des Historischen Archivs der Stadt Köln übernommen. Diese werden in den für das Stadtarchiv reservierten Archivräumen archivfachlich gelagert, teilweise auch - wie im Stadtarchiv - gehängt, soweit das möglich ist ("Kölner Hängebügelsystem"). Die Zahl lässt sich nicht angeben, aber Archivleiter Dr. Ulrich Helbach schätzt etwa 30.000 Urkunden. An der Betreuung beteiligt als als Pensionär der Vorgänger Helbachs, Prof. Dr. Toni Diederich, der auch am Stadtarchiv wirkte und als führender deutscher Sphragistiker gelten kann. Man hofft, dass man die Urkunden möglichst bald in einen Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln überführen kann.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 17:37 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.zeit.de/online/2009/11/koeln-stadtarchiv-handschriften
Auszug:
Den Verlust von Menschenleben kann man nicht gegen kulturelle Verluste aufrechnen. Quander sagt, sie seien womöglich größer als der Schaden nach dem Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
"Wir hatten sehr viele Unikate, von denen es keine Abschriften oder Sicherheitsverfilmungen gibt und die teilweise noch nie publiziert wurden.“ Bei 30 Regalkilometern habe man mit der Digitalisierung erst am Anfang gestanden. Einige Mikrofilme aus Köln zählen zwar zu den 2000 Tonnen sicherungsverfilmten Archivguts im Oberrieder Stollen im Schwarzwald. Aber Kopien ersetzen kein Original.
Das betont auch Eef Overgaauw, Leiter der Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek. Er kennt das Archiv der Kollegen. "In der Stabi lagern zwischen 7000 und 8000 mittelalterliche Handschriften, in Köln gab es weit über 1000,“ erinnert er sich. Auch Overgaauw zieht den Anna-Amalia-Vergleich: "Das historische Gebäude der Weimarer Bibliothek ist ungleich wertvoller. Aber das Kölner Gebäude von 1971 war ein seinerzeit sehr fortschrittliches Gebäude, wegen der besonderen Klimatechnik. Die Außenluft wurde nach innen geleitet, für die Regelung des Mikroklimas im Magazin.“ Und was dort lagerte, war ebenso wertvoll wie die Bücherschätze von Weimar. Wegen der Bedeutung des mittelalterlichen Köln für Europa. Und wegen der Originale.
Allein die über 500 Schreinsbücher, in denen Katastereintragungen seit dem 12. Jahrhundert verzeichnet sind. Oder Zehntausende Testamente. "Gedruckte Bücher gibt es in einer bestimmten Auflage. Wenn eins vernichtet ist, kann man es ersetzen, Handschriften nicht“, sagt Overgaauw. "Alles, was wir über die Antike und das Mittelalter wissen, kennen wir aus ihnen. Sie sind die Zeugnisse ganzer Epochen. So war zum Beispiel das Karthäuser-Kloster St. Barbara, aus dem in Köln über 100 Handschriften lagen, im frühen 16. Jahrhundert eins der intellektuellen Zentren Westdeutschlands. Die Karthäuser verfassten theologische Werke, sie waren in den Handschriften der Klosterbibliothek überliefert.“
Warum sind Dokumente in Plastikfolien, tonnenweise beschriebenes Papier in Hängeschränken oder Schriftwechsel, die in staubdichten Pappkartons verwahrt werden, so unendlich kostbar – im Zeitalter der Digitalisierung?
Robert Kretzschmar, Präsident des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archive (VdA), erklärt es so: "Archivgut gibt es oft nur ein einziges Mal. Das Haptische einer Urkunde ist unwiederbringlich dahin, wenn das Unikat zerstört ist. Es ist, wie wenn wir von der ,Mona Lisa’ nur noch eine Reproduktion hätten.“
Overgaauw spricht von der dritten Dimension. "Ein gedrucktes Buch ist zweidimensional, eine mittelalterliche Handschrift dreidimensional. Es gibt die Schrift auf Pergament oder Papier, und noch viel mehr: die Struktur, die Farben, die Beschaffenheit, den Einband.“ Overgaauw weiß, wovon er spricht: Die juristischen Handschriften aus Köln wurden in der Berliner Staatsbibliothek katalogisiert. Oft wurden später Eintragungen vorgenommen, die selbst auf einer guten Kopie kaum entzifferbar sind. Bei Codices sind die Initialen kunstvoll verziert – Meisterwerke der Buchmalerei.
Köln. Rheinische Geschichte, deutsche Geschichte, Europageschichte. "Jede Generation“, sagt Robert Kretzschmar, der auch das Landesarchiv von Baden-Württemberg leitet, "geht mit neuen Fragen an die Dokumente der Vergangenheit heran. Ein Archiv ist ein unerschöpfliches Reservoir für diese Auseinandersetzung.“ Nicht nur für die Forschung. Eine Ratsurkunde bedeutet immer auch Identitätsstiftung. Und ein Stadtarchiv birgt komprimierte, in immer neuen Facetten abrufbare Geschichte mit hohem emotionalem Faktor. Deshalb hatte sich die Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia, seit 2004 im Amt, um mehr Bürgernähe bemüht. Deshalb hatte sie erst kürzlich den Platzmangel in Deutschlands größtem kommunalen Archiv beklagt und die Forderung nach einem baldigen Neubau bekräftigt. Bis Ostern sollte der Standort für den 40-Millionen-Euro-Bau gefunden sein.
[...] Nur wenige deutsche Stadtarchive sind laut Overgaauw ähnlich reich, München, Augsburg oder Nürnberg.
Ein Schatz, der sich nun in einen Schutthaufen verwandelt hat. Dennoch warnt VdA-Präsident Kretzschmar: "Bitte noch keine Nachrufe auf das Stadtarchiv schreiben.“
Dort auch weitere Beiträge:
http://www.zeit.de/feuilleton/index
Achatz von Müller kommentiert:
Was geschah also in Köln? Nichts weniger als ein Anschlag auf unser aller Gedächtnis. Im Namen des rasenden Stillstandes werden wir verurteilt, nur noch auf uns selbst zu blicken. Tausche drei Minuten verkürzte Fahrzeit gegen 1000 Jahre Gedächtnis, lautet das Motto dieses Anschlages. Der Terrorist, der ihn verübte, sind wir selbst.
Interview mit einem verzweifelten Doktoranden:
http://www.zeit.de/2009/12/C-Gefragt-Stadtarchiv-Koeln
Auszug:
Den Verlust von Menschenleben kann man nicht gegen kulturelle Verluste aufrechnen. Quander sagt, sie seien womöglich größer als der Schaden nach dem Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
"Wir hatten sehr viele Unikate, von denen es keine Abschriften oder Sicherheitsverfilmungen gibt und die teilweise noch nie publiziert wurden.“ Bei 30 Regalkilometern habe man mit der Digitalisierung erst am Anfang gestanden. Einige Mikrofilme aus Köln zählen zwar zu den 2000 Tonnen sicherungsverfilmten Archivguts im Oberrieder Stollen im Schwarzwald. Aber Kopien ersetzen kein Original.
Das betont auch Eef Overgaauw, Leiter der Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek. Er kennt das Archiv der Kollegen. "In der Stabi lagern zwischen 7000 und 8000 mittelalterliche Handschriften, in Köln gab es weit über 1000,“ erinnert er sich. Auch Overgaauw zieht den Anna-Amalia-Vergleich: "Das historische Gebäude der Weimarer Bibliothek ist ungleich wertvoller. Aber das Kölner Gebäude von 1971 war ein seinerzeit sehr fortschrittliches Gebäude, wegen der besonderen Klimatechnik. Die Außenluft wurde nach innen geleitet, für die Regelung des Mikroklimas im Magazin.“ Und was dort lagerte, war ebenso wertvoll wie die Bücherschätze von Weimar. Wegen der Bedeutung des mittelalterlichen Köln für Europa. Und wegen der Originale.
Allein die über 500 Schreinsbücher, in denen Katastereintragungen seit dem 12. Jahrhundert verzeichnet sind. Oder Zehntausende Testamente. "Gedruckte Bücher gibt es in einer bestimmten Auflage. Wenn eins vernichtet ist, kann man es ersetzen, Handschriften nicht“, sagt Overgaauw. "Alles, was wir über die Antike und das Mittelalter wissen, kennen wir aus ihnen. Sie sind die Zeugnisse ganzer Epochen. So war zum Beispiel das Karthäuser-Kloster St. Barbara, aus dem in Köln über 100 Handschriften lagen, im frühen 16. Jahrhundert eins der intellektuellen Zentren Westdeutschlands. Die Karthäuser verfassten theologische Werke, sie waren in den Handschriften der Klosterbibliothek überliefert.“
Warum sind Dokumente in Plastikfolien, tonnenweise beschriebenes Papier in Hängeschränken oder Schriftwechsel, die in staubdichten Pappkartons verwahrt werden, so unendlich kostbar – im Zeitalter der Digitalisierung?
Robert Kretzschmar, Präsident des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archive (VdA), erklärt es so: "Archivgut gibt es oft nur ein einziges Mal. Das Haptische einer Urkunde ist unwiederbringlich dahin, wenn das Unikat zerstört ist. Es ist, wie wenn wir von der ,Mona Lisa’ nur noch eine Reproduktion hätten.“
Overgaauw spricht von der dritten Dimension. "Ein gedrucktes Buch ist zweidimensional, eine mittelalterliche Handschrift dreidimensional. Es gibt die Schrift auf Pergament oder Papier, und noch viel mehr: die Struktur, die Farben, die Beschaffenheit, den Einband.“ Overgaauw weiß, wovon er spricht: Die juristischen Handschriften aus Köln wurden in der Berliner Staatsbibliothek katalogisiert. Oft wurden später Eintragungen vorgenommen, die selbst auf einer guten Kopie kaum entzifferbar sind. Bei Codices sind die Initialen kunstvoll verziert – Meisterwerke der Buchmalerei.
Köln. Rheinische Geschichte, deutsche Geschichte, Europageschichte. "Jede Generation“, sagt Robert Kretzschmar, der auch das Landesarchiv von Baden-Württemberg leitet, "geht mit neuen Fragen an die Dokumente der Vergangenheit heran. Ein Archiv ist ein unerschöpfliches Reservoir für diese Auseinandersetzung.“ Nicht nur für die Forschung. Eine Ratsurkunde bedeutet immer auch Identitätsstiftung. Und ein Stadtarchiv birgt komprimierte, in immer neuen Facetten abrufbare Geschichte mit hohem emotionalem Faktor. Deshalb hatte sich die Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia, seit 2004 im Amt, um mehr Bürgernähe bemüht. Deshalb hatte sie erst kürzlich den Platzmangel in Deutschlands größtem kommunalen Archiv beklagt und die Forderung nach einem baldigen Neubau bekräftigt. Bis Ostern sollte der Standort für den 40-Millionen-Euro-Bau gefunden sein.
[...] Nur wenige deutsche Stadtarchive sind laut Overgaauw ähnlich reich, München, Augsburg oder Nürnberg.
Ein Schatz, der sich nun in einen Schutthaufen verwandelt hat. Dennoch warnt VdA-Präsident Kretzschmar: "Bitte noch keine Nachrufe auf das Stadtarchiv schreiben.“
Dort auch weitere Beiträge:
http://www.zeit.de/feuilleton/index
Achatz von Müller kommentiert:
Was geschah also in Köln? Nichts weniger als ein Anschlag auf unser aller Gedächtnis. Im Namen des rasenden Stillstandes werden wir verurteilt, nur noch auf uns selbst zu blicken. Tausche drei Minuten verkürzte Fahrzeit gegen 1000 Jahre Gedächtnis, lautet das Motto dieses Anschlages. Der Terrorist, der ihn verübte, sind wir selbst.
Interview mit einem verzweifelten Doktoranden:
http://www.zeit.de/2009/12/C-Gefragt-Stadtarchiv-Koeln
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 17:24 - Rubrik: Kommunalarchive
http://banger.twoday.net/stories/winnenden-medien-gehen-einem-fake-auf-den-leim/ vertritt die Ansicht, der angebliche Chat des Amokläufers von Winnenden sei ein nachträgliches Fake.
http://krautchan.net/ nimmt dazu Stellung: "Scheinbar ist recherchieren heutzutage uncool. Schlimm genug, bei Wikipedia abzuschreiben, aber hier? Grundgütiger."
Mit dem Fake-Verdacht setzt sich auseinander:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612928,00.html
Demnach habe die Polizei die Authentizität des Chats aufgrund der Einsichtnahme in den PC von Tim K. bestätigt.
Krautchan replizierte: "Was man übrigens auf dem PC des Täters gefunden haben will, wissen wir nicht. Vielleicht hat er die Site mal besucht, den durch die Presse gegangenen Beitrag hat er jedenfalls nicht verfasst, denn der hat nie existiert."
Die Netzeitung: Nun steht Aussage gegen Aussage
http://www.netzeitung.de/internet/1297457.html
Ausgezeichneter Kommentar zu den Aufgeregtheiten:
http://tinyurl.com/b9mqpl
SZ: kein klares Urteil möglich
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/496349
ntv schwenkt auf Fake-These um
http://www.n-tv.de/1119350.html
Obwohl schon am Nachmittag in Blogger- und Twitterkreisen ernsthafte Zweifel an der Ankündigung im Chat laut und belegt wurden, hat die Tagesschau, die nun zurückrudert, in der 20-Uhr-Ausgabe die Ankündigung noch als Faktum gemeldet.
SPIEGEL geht nun auch von Fake aus
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,613038,00.html
1 Tag später:
http://www.netzeitung.de/vermischtes/1297617.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,613092,00.html
Angebliches Interview mit Faker
http://blog.dieweltistgarnichtso.net/der-mediale-amoklauf-interview-mit-dem-ersteller-der-fake-grafik
Baranek und die Rolle von Twitter
http://dirk-baranek.de/internet/der-fake-ein-protokoll/
http://krautchan.net/ nimmt dazu Stellung: "Scheinbar ist recherchieren heutzutage uncool. Schlimm genug, bei Wikipedia abzuschreiben, aber hier? Grundgütiger."
Mit dem Fake-Verdacht setzt sich auseinander:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612928,00.html
Demnach habe die Polizei die Authentizität des Chats aufgrund der Einsichtnahme in den PC von Tim K. bestätigt.
Krautchan replizierte: "Was man übrigens auf dem PC des Täters gefunden haben will, wissen wir nicht. Vielleicht hat er die Site mal besucht, den durch die Presse gegangenen Beitrag hat er jedenfalls nicht verfasst, denn der hat nie existiert."
Die Netzeitung: Nun steht Aussage gegen Aussage
http://www.netzeitung.de/internet/1297457.html
Ausgezeichneter Kommentar zu den Aufgeregtheiten:
http://tinyurl.com/b9mqpl
SZ: kein klares Urteil möglich
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/496349
ntv schwenkt auf Fake-These um
http://www.n-tv.de/1119350.html
Obwohl schon am Nachmittag in Blogger- und Twitterkreisen ernsthafte Zweifel an der Ankündigung im Chat laut und belegt wurden, hat die Tagesschau, die nun zurückrudert, in der 20-Uhr-Ausgabe die Ankündigung noch als Faktum gemeldet.
SPIEGEL geht nun auch von Fake aus
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,613038,00.html
1 Tag später:
http://www.netzeitung.de/vermischtes/1297617.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,613092,00.html
Angebliches Interview mit Faker
http://blog.dieweltistgarnichtso.net/der-mediale-amoklauf-interview-mit-dem-ersteller-der-fake-grafik
Baranek und die Rolle von Twitter
http://dirk-baranek.de/internet/der-fake-ein-protokoll/
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 16:34 - Rubrik: Fotoueberlieferung
http://www.wdr.de/themen/panorama/26/koeln_hauseinsturz/090312_interview.jhtml
Wir haben über 300 Hilfsangebote aus Deutschland und auch aus angrenzenden Ländern, zum Beispiel der Schweiz. Das sind alles Archivare. Dazu kommen rund 60 Restauratoren. Sie alle wollen in den nächsten Wochen helfen. Dann haben wir Hilfsangebote von anderen Archiven. Insbesondere auch bezüglich Magazinflächen.
[...] WDR.de: Viele Kölner Bürger wollen mit anpacken. Auf der Homepage "Wir retten unser Kölner Stadtarchiv" heißt es "Wir machen es einfach wie die Trümmerfrauen"...
Soénius: Das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe mit Herrn Gahn, dem Betreiber der Homepage, gesprochen. Ich finde die Initiative super, das kann man gar nicht genug loben. Es haben sich bei ihm auch Archivare gemeldet, 60 oder 70 Leute kommen allein über ihn. Alle anderen können erst mal nicht helfen. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir Unterkünfte für die Archivare brauchen. Aber das regelt alles die Stadt. Das ist ja auch nicht diese Riesenmenge wie beim Weltjugendtag, wo Betten gesucht wurden. Und viele kommen aus einer anfahrbaren Gegend. Köln hat ja allein 40 Archive, die Mitarbeiter helfen auch alle sehr engagiert, das ist ja klar.
Der WDR hat freundlicherweise einen Link auf
http://archiv.twoday.net/stories/5569335/
spendiert. Dort habe ich auch
http://archiv.twoday.net/stories/5566219/
im Kommentar ergänzt. Es kamen bereits über 70 Leute via WDR hierher (Referrer).
Wir haben über 300 Hilfsangebote aus Deutschland und auch aus angrenzenden Ländern, zum Beispiel der Schweiz. Das sind alles Archivare. Dazu kommen rund 60 Restauratoren. Sie alle wollen in den nächsten Wochen helfen. Dann haben wir Hilfsangebote von anderen Archiven. Insbesondere auch bezüglich Magazinflächen.
[...] WDR.de: Viele Kölner Bürger wollen mit anpacken. Auf der Homepage "Wir retten unser Kölner Stadtarchiv" heißt es "Wir machen es einfach wie die Trümmerfrauen"...
Soénius: Das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe mit Herrn Gahn, dem Betreiber der Homepage, gesprochen. Ich finde die Initiative super, das kann man gar nicht genug loben. Es haben sich bei ihm auch Archivare gemeldet, 60 oder 70 Leute kommen allein über ihn. Alle anderen können erst mal nicht helfen. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir Unterkünfte für die Archivare brauchen. Aber das regelt alles die Stadt. Das ist ja auch nicht diese Riesenmenge wie beim Weltjugendtag, wo Betten gesucht wurden. Und viele kommen aus einer anfahrbaren Gegend. Köln hat ja allein 40 Archive, die Mitarbeiter helfen auch alle sehr engagiert, das ist ja klar.
Der WDR hat freundlicherweise einen Link auf
http://archiv.twoday.net/stories/5569335/
spendiert. Dort habe ich auch
http://archiv.twoday.net/stories/5566219/
im Kommentar ergänzt. Es kamen bereits über 70 Leute via WDR hierher (Referrer).
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 16:16 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 16:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 16:02 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archiv-in-truemmern.de/
Zunächst gibt es unkommentiert einige Fotos von den Aufräumarbeiten.
Umgestaltet wurde auch der Internetauftritt bei Archive NRW:
http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveI-L/K/Koeln/index.html
Zunächst gibt es unkommentiert einige Fotos von den Aufräumarbeiten.
Umgestaltet wurde auch der Internetauftritt bei Archive NRW:
http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveI-L/K/Koeln/index.html
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 15:27 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Erst mal habe ich den Verlust verdrängt, weil ja Menschen verschüttet waren. Da sind die Papiere sekundär.“
Interview DIE ZEIT, 12.03.2009 Nr. 12
Link:
http://www.zeit.de/2009/12/Interview-Wallraff
Dank dem anonymen Mitleser!
Nachtrag 16.03.2008:
Gleichlautendes Wallraf-Interview im Kölner Domradio:
http://www.domradio.de/aktuell/artikel_51432.html
Interview DIE ZEIT, 12.03.2009 Nr. 12
Link:
http://www.zeit.de/2009/12/Interview-Wallraff
Dank dem anonymen Mitleser!
Nachtrag 16.03.2008:
Gleichlautendes Wallraf-Interview im Kölner Domradio:
http://www.domradio.de/aktuell/artikel_51432.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. März 2009, 14:29 - Rubrik: Kommunalarchive
" .... Spengler: Es war das bedeutendste Kommunalarchiv nördlich der Alpen. Wie viel Prozent der historischen Archivschätze hoffen Sie, noch retten zu können?
Schramma: Die Auskunft von unserem Kulturdezernenten gestern in der Ratssitzung lautete, dass etwa 20 bis 25 Prozent bisher gerettet sei. Wir sehen aber, vor uns liegen in dem Schuttberg noch riesige Mengen eingedrückt, gepresst, aber doch zum Teil relativ gut erhaltenes Material, das wir noch hoffen zu bergen. Es wird sicherlich große Verluste geben, das ist sicher, aber ich bin dennoch der Meinung, dass wir, wenn wir etwas Glück haben und wenn uns das Wasser nicht einschlägt, doch eine Menge von diesem wichtigen Kulturgut bergen können.
Spengler: Das heißt, es könnte auch einmal ein neues Stadtarchiv geben?
Schramma: Das ist jetzt schon im Auftrag, wenn Sie so wollen. Wir sind derzeit in der Planung von Standorten. Es war ohnehin vorgesehen, für das Stadtarchiv, weil es dort aus den Nähten platzt, wegen Raummangel und auch wegen wieder modernerer Technologien, ein neues Stadtarchiv zu planen und zu bauen. Obwohl dieses Haus erst 1971 gebaut worden ist und nach den neuesten Erkenntnissen errichtet ist, die damals für Archive weltweit gültig waren, hat sich natürlich in der Zwischenzeit die Entwicklung weiter vorangetrieben, und jetzt würde man wiederum noch bessere Maßnahmen, noch bessere Sicherungsmaßnahmen einbauen.
Spengler: Welche Hilfe benötigen Sie von Bund und Land?
Schramma: Bund und Land haben sofort Zusagen gemacht. Das Land hat eine Soforthilfe in Höhe von 300.000 Euro in dieser Woche zugesagt. Ich denke aber, dass dieses historische Archiv in der Tat von nationaler Bedeutung ist, dass es auch eine landesweite und bundesweite Aufgabe ist, hier mitzuhelfen. Allerdings wird natürlich auch ein erheblicher Batzen auf die Stadt Köln zukommen. Das ist überhaupt keine Frage. ....
Spengler: Nun gab es ja an den Gebäuden längs der Strecke an mehr als 100 Gebäuden Risse. Es gab ein Statikgutachten vom Januar, das empfohlen hat, noch mal einen Sachverständigen für Bauwerkschäden beim Stadtarchiv hinzuzuziehen. Das ist nicht passiert. Da kann man doch nicht sagen, dass das alles in Ordnung war, oder?
Schramma: Das ist gerade das, was ich persönlich nicht beurteilen kann, aber was der Untersuchung jetzt unterzogen werden muss, ob das so richtig ist, dass das so bewertet und beurteilt worden ist. Ich bin kein Statiker, ich bin kein Baufachmann, kann das selbst nicht begutachten. Dafür müssen wir Fachleute haben, die habe ich auch eingefordert, und zwar neutrale, unabhängige. Die sollen uns sagen, ob diese Bewertung in Ordnung war, denn davon hängt ja nun einiges ab. Ich kann aber wie gesagt erst nach Ergebnissen hier mir ein Urteil bilden. Persönlich habe ich nicht die fachliche Ausbildung, dass ich hier selbst über diese Baumaßnahmen urteilen kann. ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/932772/
Schramma: Die Auskunft von unserem Kulturdezernenten gestern in der Ratssitzung lautete, dass etwa 20 bis 25 Prozent bisher gerettet sei. Wir sehen aber, vor uns liegen in dem Schuttberg noch riesige Mengen eingedrückt, gepresst, aber doch zum Teil relativ gut erhaltenes Material, das wir noch hoffen zu bergen. Es wird sicherlich große Verluste geben, das ist sicher, aber ich bin dennoch der Meinung, dass wir, wenn wir etwas Glück haben und wenn uns das Wasser nicht einschlägt, doch eine Menge von diesem wichtigen Kulturgut bergen können.
Spengler: Das heißt, es könnte auch einmal ein neues Stadtarchiv geben?
Schramma: Das ist jetzt schon im Auftrag, wenn Sie so wollen. Wir sind derzeit in der Planung von Standorten. Es war ohnehin vorgesehen, für das Stadtarchiv, weil es dort aus den Nähten platzt, wegen Raummangel und auch wegen wieder modernerer Technologien, ein neues Stadtarchiv zu planen und zu bauen. Obwohl dieses Haus erst 1971 gebaut worden ist und nach den neuesten Erkenntnissen errichtet ist, die damals für Archive weltweit gültig waren, hat sich natürlich in der Zwischenzeit die Entwicklung weiter vorangetrieben, und jetzt würde man wiederum noch bessere Maßnahmen, noch bessere Sicherungsmaßnahmen einbauen.
Spengler: Welche Hilfe benötigen Sie von Bund und Land?
Schramma: Bund und Land haben sofort Zusagen gemacht. Das Land hat eine Soforthilfe in Höhe von 300.000 Euro in dieser Woche zugesagt. Ich denke aber, dass dieses historische Archiv in der Tat von nationaler Bedeutung ist, dass es auch eine landesweite und bundesweite Aufgabe ist, hier mitzuhelfen. Allerdings wird natürlich auch ein erheblicher Batzen auf die Stadt Köln zukommen. Das ist überhaupt keine Frage. ....
Spengler: Nun gab es ja an den Gebäuden längs der Strecke an mehr als 100 Gebäuden Risse. Es gab ein Statikgutachten vom Januar, das empfohlen hat, noch mal einen Sachverständigen für Bauwerkschäden beim Stadtarchiv hinzuzuziehen. Das ist nicht passiert. Da kann man doch nicht sagen, dass das alles in Ordnung war, oder?
Schramma: Das ist gerade das, was ich persönlich nicht beurteilen kann, aber was der Untersuchung jetzt unterzogen werden muss, ob das so richtig ist, dass das so bewertet und beurteilt worden ist. Ich bin kein Statiker, ich bin kein Baufachmann, kann das selbst nicht begutachten. Dafür müssen wir Fachleute haben, die habe ich auch eingefordert, und zwar neutrale, unabhängige. Die sollen uns sagen, ob diese Bewertung in Ordnung war, denn davon hängt ja nun einiges ab. Ich kann aber wie gesagt erst nach Ergebnissen hier mir ein Urteil bilden. Persönlich habe ich nicht die fachliche Ausbildung, dass ich hier selbst über diese Baumaßnahmen urteilen kann. ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/932772/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. März 2009, 14:23 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Einsatz der vielen Archivarinnen und Archivare vor Ort zur Rettung des
bedrohten Archivguts ist wirklich beeindruckend - dies wird von der
örtlichen Presse auch im hohem Maße vermittelt. Viele Helfer haben sich
bereits gemeldet. Herzlichen Dank allen, die ihre Hilfsbereitschaft so
eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Nach wie vor gilt: Angebote zu Magazinräumen bitte an den
Landschaftsverband Rheinland (afz.archivberatung@lvr.de), Hilfsangebote
von Restauratoren an bert.jacek@fh-koeln.de sowie solche von Archivaren an
rwwa@koeln.ihk.de. Zum Procedere: Die Archivare werden hier in Listen
erfasst und vorsortiert. Diese Listen werden dann an Mitarbeiter der
Stadtverwaltung übersendet, die diese wiederum mit anderen Angeboten
(Restauratoren) und dem Einsatz der städtischen Archivare in einen
Dienstplan bringen und Teams bilden. Die Stadt Köln informiert die
jeweiligen freiwilligen Helfer. Daher bitte ich, das RWWA mit
telefonischen Nachfragen zu verschonen, daher wir sehr mit
Koordinierungsarbeiten für das Stadtarchiv beschäftigt sind - neben dem
normalen Archivbetrieb. Auch in den nächsten Wochen werden noch Fachleute
vor Ort gebraucht, da wir derzeit von einer mehrere Monate langen Bergung
ausgehen.
Dennoch gehen die Bergungsarbeiten voran, das provisorische Dach über dem
Trümmerberg nimmt größere Ausmaße an. Es werden laufend Archivalien
geborgen, die allerdings teilweise sehr beschädigt sind. In einem Kölner
Stadtviertel sind Räumlichkeiten gefunden worden, die den klimatischen
Anforderungen einigermaßen entsprechen und in denen nun die Archivalien
vorbehandelt und sortiert werden. Die sauberen und trockenen Archivalien
sollen in Kürze auf Magazine verteilt werden, die freundlicherweise von
anderen Archiven angeboten wurden. Dabei werden zuerst die nahen Archive
berücksichtigt, fernere später. Beachtet wird auch die Art der
Einlagerungsmöglichkeiten.
Seit Sonntag berät ein Archiv-AK die Stadt Köln bei der Bergung und
Behandlung der Archivalien. Dieser besteht aus folgenden Personen:
Historisches Archiv der Stadt Köln:
Dr. Bettina Schmidt-Czaia
Dr. Ulrich Fischer
Nadine Thiel
Claudia Tiggemann-Klein
Stadt Köln, Kulturdezernat:
Michael Lohaus
ARGE Stadtarchive beim Städtetag NRW:
Dr. Jens Metzdorf
Land Nordrhein-Westfalen:
Dr. Johannes Kistenich
Landschaftsverband Rheinland:
Dr. Arie Nabrings
Landschaftsverband Westfalen-Lippe:
Dr. Marcus Stumpf
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv / VdA- Verband deutscher
Archivarinnen und Archivare:
Dr. Ulrich S. Soénius
Fachhochschule Köln
Prof. Dr. Robert Fuchs
Bert Jacek
Diese Arbeitsgruppe berät intensiv fachlich über die Bergungs- und
Rettungsmaßnahmen.
Immer wieder tauchen in der Presse Meldungen über gerettete und teilweise
zerstörte Bestände oder einzelne Archivalien auf. Bei allem Verständnis
für das öffentliche Interesse, führen solche Meldungen nur in die Irre. So
wird in der heutigen "Zeit" über den Verlust der Fotosammlung von L. Fritz
Gruber lamentiert. Leider nehmen Jounalisten immer wieder unprofessionelle
Einzelmeinungen auf, ohne den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die
Verbreitung von solche Meldungen verunsichert nur die Depositalgeber, die
sich natürlich berechtigte Sorgen machen. Ich bin sehr gespannt, ob die
"Zeit" einen ähnlich langen Artikel über die geretteten Fotos von Gruber
bringen wird.
Leider wird auch immer wieder behauptet, das "Gedächtnis von Köln" sei
komplett zerstört worden, ebenso würde das Archiv über Jahre hinaus
geschlossen bleiben. Beide Behauptungen sind natürlich Unsinn und
kontraproduktiv - neben den geretteten Archivalien, den
sicherheitsverfilmten Quellen, den Gegenüberlieferungen in anderen
Archiven etc. sind über 40 andere Archive in Köln ebenfalls Hüter des
Gedächtnisses von Köln. Das ständige Klagen über einen angeblichen
Totalverlust führt nur dazu, dass in der Öffentlichkeit ohne Sachverstand
negativ über die sehr aufwändige Bergung gesprochen wird. Solche falschen
Behauptungen schädigen das Ansehen der Archive und der Archivare sowie
demotivieren die vielen engagierten Helfer. Zudem muss das Stadtarchiv
bald wieder - mit einer Notbesetzung - öffnen, denn nicht präsente
Institutionen verschwinden in der Versenkung. Auch wird ein baldiger
Neubau eine prima Gelegenheit zur Präsentation geben.
Statt klagen ist es sehr viel wichtiger und entscheidend, dass jetzt
politisch an der Zukunft des Stadtarchivs gebaut wird. Dies habe ich auch
in folgendem Beitrag im Kölner Stadt-Anzeiger eingefordert:
http://www.ksta.de/html/artikel/1233584110412.shtml .
Der Arbeitskreis Kölner Archivarinnen und Archivare (AKA) wird - trotz der
derzeitgen Belastung - Ende März die ersten Planungen für den Kölner
Beitrag zum Tag der Archive im nächsten Jahr aufnehmen! Da ich höre, dass
noch nicht alle Archivare in der Archivliste sind, können Sie diesen
Beitrag natürlich gerne weitersenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Soénius"
via Archivliste
der Einsatz der vielen Archivarinnen und Archivare vor Ort zur Rettung des
bedrohten Archivguts ist wirklich beeindruckend - dies wird von der
örtlichen Presse auch im hohem Maße vermittelt. Viele Helfer haben sich
bereits gemeldet. Herzlichen Dank allen, die ihre Hilfsbereitschaft so
eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Nach wie vor gilt: Angebote zu Magazinräumen bitte an den
Landschaftsverband Rheinland (afz.archivberatung@lvr.de), Hilfsangebote
von Restauratoren an bert.jacek@fh-koeln.de sowie solche von Archivaren an
rwwa@koeln.ihk.de. Zum Procedere: Die Archivare werden hier in Listen
erfasst und vorsortiert. Diese Listen werden dann an Mitarbeiter der
Stadtverwaltung übersendet, die diese wiederum mit anderen Angeboten
(Restauratoren) und dem Einsatz der städtischen Archivare in einen
Dienstplan bringen und Teams bilden. Die Stadt Köln informiert die
jeweiligen freiwilligen Helfer. Daher bitte ich, das RWWA mit
telefonischen Nachfragen zu verschonen, daher wir sehr mit
Koordinierungsarbeiten für das Stadtarchiv beschäftigt sind - neben dem
normalen Archivbetrieb. Auch in den nächsten Wochen werden noch Fachleute
vor Ort gebraucht, da wir derzeit von einer mehrere Monate langen Bergung
ausgehen.
Dennoch gehen die Bergungsarbeiten voran, das provisorische Dach über dem
Trümmerberg nimmt größere Ausmaße an. Es werden laufend Archivalien
geborgen, die allerdings teilweise sehr beschädigt sind. In einem Kölner
Stadtviertel sind Räumlichkeiten gefunden worden, die den klimatischen
Anforderungen einigermaßen entsprechen und in denen nun die Archivalien
vorbehandelt und sortiert werden. Die sauberen und trockenen Archivalien
sollen in Kürze auf Magazine verteilt werden, die freundlicherweise von
anderen Archiven angeboten wurden. Dabei werden zuerst die nahen Archive
berücksichtigt, fernere später. Beachtet wird auch die Art der
Einlagerungsmöglichkeiten.
Seit Sonntag berät ein Archiv-AK die Stadt Köln bei der Bergung und
Behandlung der Archivalien. Dieser besteht aus folgenden Personen:
Historisches Archiv der Stadt Köln:
Dr. Bettina Schmidt-Czaia
Dr. Ulrich Fischer
Nadine Thiel
Claudia Tiggemann-Klein
Stadt Köln, Kulturdezernat:
Michael Lohaus
ARGE Stadtarchive beim Städtetag NRW:
Dr. Jens Metzdorf
Land Nordrhein-Westfalen:
Dr. Johannes Kistenich
Landschaftsverband Rheinland:
Dr. Arie Nabrings
Landschaftsverband Westfalen-Lippe:
Dr. Marcus Stumpf
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv / VdA- Verband deutscher
Archivarinnen und Archivare:
Dr. Ulrich S. Soénius
Fachhochschule Köln
Prof. Dr. Robert Fuchs
Bert Jacek
Diese Arbeitsgruppe berät intensiv fachlich über die Bergungs- und
Rettungsmaßnahmen.
Immer wieder tauchen in der Presse Meldungen über gerettete und teilweise
zerstörte Bestände oder einzelne Archivalien auf. Bei allem Verständnis
für das öffentliche Interesse, führen solche Meldungen nur in die Irre. So
wird in der heutigen "Zeit" über den Verlust der Fotosammlung von L. Fritz
Gruber lamentiert. Leider nehmen Jounalisten immer wieder unprofessionelle
Einzelmeinungen auf, ohne den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die
Verbreitung von solche Meldungen verunsichert nur die Depositalgeber, die
sich natürlich berechtigte Sorgen machen. Ich bin sehr gespannt, ob die
"Zeit" einen ähnlich langen Artikel über die geretteten Fotos von Gruber
bringen wird.
Leider wird auch immer wieder behauptet, das "Gedächtnis von Köln" sei
komplett zerstört worden, ebenso würde das Archiv über Jahre hinaus
geschlossen bleiben. Beide Behauptungen sind natürlich Unsinn und
kontraproduktiv - neben den geretteten Archivalien, den
sicherheitsverfilmten Quellen, den Gegenüberlieferungen in anderen
Archiven etc. sind über 40 andere Archive in Köln ebenfalls Hüter des
Gedächtnisses von Köln. Das ständige Klagen über einen angeblichen
Totalverlust führt nur dazu, dass in der Öffentlichkeit ohne Sachverstand
negativ über die sehr aufwändige Bergung gesprochen wird. Solche falschen
Behauptungen schädigen das Ansehen der Archive und der Archivare sowie
demotivieren die vielen engagierten Helfer. Zudem muss das Stadtarchiv
bald wieder - mit einer Notbesetzung - öffnen, denn nicht präsente
Institutionen verschwinden in der Versenkung. Auch wird ein baldiger
Neubau eine prima Gelegenheit zur Präsentation geben.
Statt klagen ist es sehr viel wichtiger und entscheidend, dass jetzt
politisch an der Zukunft des Stadtarchivs gebaut wird. Dies habe ich auch
in folgendem Beitrag im Kölner Stadt-Anzeiger eingefordert:
http://www.ksta.de/html/artikel/1233584110412.shtml .
Der Arbeitskreis Kölner Archivarinnen und Archivare (AKA) wird - trotz der
derzeitgen Belastung - Ende März die ersten Planungen für den Kölner
Beitrag zum Tag der Archive im nächsten Jahr aufnehmen! Da ich höre, dass
noch nicht alle Archivare in der Archivliste sind, können Sie diesen
Beitrag natürlich gerne weitersenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Soénius"
via Archivliste
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. März 2009, 14:14 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Summary V at Salon Jewish Studies - Blog (http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-v.html)
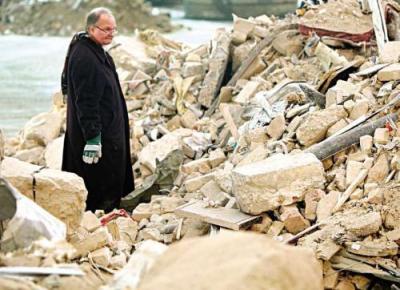
UPDATE 1 Notes on the rescue process from a circular by the Society of German Archivists (VDA) (via Archivalia)
The rescue work continues and the tentative roof to shelter the material at the scene is being improved. Documents are permanently discovered, some of them are deeply damaged. Storage room, suitable for the material was found in a Cologne district. The storage room‘s climatic conditions comply with the requirements, so the archival material is now pretreated and sorted there. The clean and dry materials will be brought to other archive storages soon, which kindly offered this possibility. First, the closest archives will be used and later on the others in a wider area. The type of storage possibilities also is important according to the decision where to bring the material.
Since last Sunday, Archiv-AK (Archive task force) advises intensely professional the City Cologne on rescuing and processing the archival material. The Archiv-AK consists of the following persons:
Historisches Archiv Koeln [Historical Archive Cologne]
Dr. Bettina Schmidt-Czaia
Dr. Ulrich Fischer
Nadine Thiel
Claudia Tiggemann-Klein
Kulturdezernat Stadt Koeln [Cultural Department of the City of Cologne]
Michael Lohaus
ARGE Stadtarchive NRW [Worgroup City Archives North Rhine-Westphalia]
Dr. Jens Metzdorf
Land Nordrhein-Westfalen [Federal State of North-Rhine Westphalia]
Dr. Johannes Kistenich
Landschaftsverband Rheinland [Society of Landscape Rhineland]
Dr. Arie Nabrings
Landschaftsverband Westfalen-Lippe [Society of Landscape Westphalia-Lippe]
Dr. Marcus Stumpf
Rheinisch-Westfaelisches Wirtschaftsarchiv [Economy Archives of Rhein-Westfalia]/ VdA- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare [Society of German Archivists]:
Dr. Ulrich S. Soénius
Fachhochschule Köln [University for Applied Sciences Cologne]
Prof. Dr. Robert Fuchs
Bert Jacek
Continually, news items are published on saved or destroyed inventories or certain documents. Appreciating the public interests, but these items are leading astray. Unfortunately, it has been stated several times, that the “memory of Cologne“ is totally destroyed, as well as the archive will be closed for several years. Both statements are absurd.
UPDATE 2 Ulrich Soénius, director of the Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv [economy archives of Rhine-Westphalia] in an interview with WDR.de on March 11th 2009. (via Archivalia)
There are 300 archivists from Germany and from bordering countries, e.g. Switzerland, who offer support . In addition ca. 60 conservators asked to help. All of them asked to provide assitance during the next weeks. [...] The restauration of the documents costs a lot of money. We talk about a figure in the hundreds of millions Euro, but a precise amount can only be figured out after rescue work is finished. The restauration of an ordinary file may cost between 15,000 and 20,000 Euro.
UPDATE 3 Parchment deeds transfered to the Historische Erzbistumsarchiv Koeln [Archbishopric Historical Archive of the city of Cologne]
Today the Historische Erzbistumsarchiv Koeln took over the recued parchment deeds of the CHA. The number cannot be specified precisly, but Dr. Ulrich Helbach, head of the Archvishophric Archive estimates the number at 30,000. (Archivalia March 12th 2009 17:37)
UPDATE 4 Action force probably found the second missed Khalil G. (KSTa March 12th 2009 19:05 via Archivalia)
Rescue-process of the archival inventory
Unfortunately, there is no official statement on the Cologne archival material from the special meeting of the Cologne city council which was held yesterday. Hence, following information is based on http://twitter.com/DieMedienprofis & http://twitter.com/SamZidat (via Archivalia). 40% of the CHA inventory was rescued undamaged from the rearward building. 20% of the CHA inventory was rescued from the rubble. (?) Up to now, 27,000 m³ rubble were dumped in Porz (a district of Cologne).
Ratsprotokolle [council protocols] as well as a cupboard loaded with wax signets from the 14th and 15th century were recovered.
A huge number of documents had been on the fourth floor. These ones dissapeared in the rubble when the archive collapsed.
Meeting of the Kulturauschuss NRW [Landtag cultural commitee of the state of North-Rhine Westphalia] in the afternoon of March 11th 2009; Chair: Dr. Fritz Behrens (Minister of the interior NRW)
The Kulturstaatssekretär (permanent secretary for Culture) Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff briefed the representatives about current action and nationwide support. Also the Landtag administration supports the Cologne Historical Archive (CHA).
Spiegel Online asked Were Subway Builders Cautious Enough? on March 9th 2009: "Workers at Bilfinger Berger, the German company leading construction of this part of the underground line, have said internally that planners may have forgotten to take account of the particular impact that the weight of the books and the water were having on this problematic soil.It's also possible that city administrators failed to take a recent report on structural damage at the city archive as seriously as it should have."
Hildegard Stausberg asked in the article Assault on Cologne's historical core (Welt Online - English News) on March 6th 2009: "Could it be that the collapse of the Cologne city archives building will mark a change in this mentality [which archives generally associated with something dried out and perhaps a little dull of] in Germany?" (via Archivalia)
Pictures from the Rescue Work at the scene
Salvaging Cologne's Destroyed Historical Archive a picture series by Spiegel Online
GERMAN: http://archiv.twoday.net/topics/Kommunalarchive
(Picture above: "An archivist [Prof. Dr. Polley, Archivschule Marburg] looks at the debris of the collapsed building of Cologne’s city archive in a hall in Cologne, Germany, yesterday." (photograph published on Times&Transsripts)
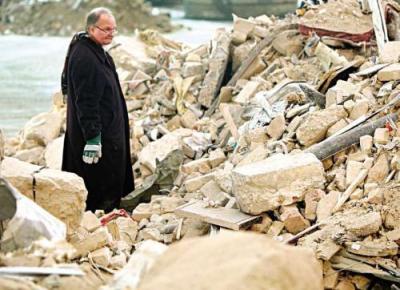
UPDATE 1 Notes on the rescue process from a circular by the Society of German Archivists (VDA) (via Archivalia)
The rescue work continues and the tentative roof to shelter the material at the scene is being improved. Documents are permanently discovered, some of them are deeply damaged. Storage room, suitable for the material was found in a Cologne district. The storage room‘s climatic conditions comply with the requirements, so the archival material is now pretreated and sorted there. The clean and dry materials will be brought to other archive storages soon, which kindly offered this possibility. First, the closest archives will be used and later on the others in a wider area. The type of storage possibilities also is important according to the decision where to bring the material.
Since last Sunday, Archiv-AK (Archive task force) advises intensely professional the City Cologne on rescuing and processing the archival material. The Archiv-AK consists of the following persons:
Historisches Archiv Koeln [Historical Archive Cologne]
Dr. Bettina Schmidt-Czaia
Dr. Ulrich Fischer
Nadine Thiel
Claudia Tiggemann-Klein
Kulturdezernat Stadt Koeln [Cultural Department of the City of Cologne]
Michael Lohaus
ARGE Stadtarchive NRW [Worgroup City Archives North Rhine-Westphalia]
Dr. Jens Metzdorf
Land Nordrhein-Westfalen [Federal State of North-Rhine Westphalia]
Dr. Johannes Kistenich
Landschaftsverband Rheinland [Society of Landscape Rhineland]
Dr. Arie Nabrings
Landschaftsverband Westfalen-Lippe [Society of Landscape Westphalia-Lippe]
Dr. Marcus Stumpf
Rheinisch-Westfaelisches Wirtschaftsarchiv [Economy Archives of Rhein-Westfalia]/ VdA- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare [Society of German Archivists]:
Dr. Ulrich S. Soénius
Fachhochschule Köln [University for Applied Sciences Cologne]
Prof. Dr. Robert Fuchs
Bert Jacek
Continually, news items are published on saved or destroyed inventories or certain documents. Appreciating the public interests, but these items are leading astray. Unfortunately, it has been stated several times, that the “memory of Cologne“ is totally destroyed, as well as the archive will be closed for several years. Both statements are absurd.
UPDATE 2 Ulrich Soénius, director of the Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv [economy archives of Rhine-Westphalia] in an interview with WDR.de on March 11th 2009. (via Archivalia)
There are 300 archivists from Germany and from bordering countries, e.g. Switzerland, who offer support . In addition ca. 60 conservators asked to help. All of them asked to provide assitance during the next weeks. [...] The restauration of the documents costs a lot of money. We talk about a figure in the hundreds of millions Euro, but a precise amount can only be figured out after rescue work is finished. The restauration of an ordinary file may cost between 15,000 and 20,000 Euro.
UPDATE 3 Parchment deeds transfered to the Historische Erzbistumsarchiv Koeln [Archbishopric Historical Archive of the city of Cologne]
Today the Historische Erzbistumsarchiv Koeln took over the recued parchment deeds of the CHA. The number cannot be specified precisly, but Dr. Ulrich Helbach, head of the Archvishophric Archive estimates the number at 30,000. (Archivalia March 12th 2009 17:37)
UPDATE 4 Action force probably found the second missed Khalil G. (KSTa March 12th 2009 19:05 via Archivalia)
Rescue-process of the archival inventory
Unfortunately, there is no official statement on the Cologne archival material from the special meeting of the Cologne city council which was held yesterday. Hence, following information is based on http://twitter.com/DieMedienprofis & http://twitter.com/SamZidat (via Archivalia). 40% of the CHA inventory was rescued undamaged from the rearward building. 20% of the CHA inventory was rescued from the rubble. (?) Up to now, 27,000 m³ rubble were dumped in Porz (a district of Cologne).
Ratsprotokolle [council protocols] as well as a cupboard loaded with wax signets from the 14th and 15th century were recovered.
A huge number of documents had been on the fourth floor. These ones dissapeared in the rubble when the archive collapsed.
Meeting of the Kulturauschuss NRW [Landtag cultural commitee of the state of North-Rhine Westphalia] in the afternoon of March 11th 2009; Chair: Dr. Fritz Behrens (Minister of the interior NRW)
The Kulturstaatssekretär (permanent secretary for Culture) Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff briefed the representatives about current action and nationwide support. Also the Landtag administration supports the Cologne Historical Archive (CHA).
- The department for information services assists the recovery and the restoration of the archival material.
- The Landtag administration offered to house a CHA staff member's on-the-job training.
- The department for information services will call for donations and install an information desk on the event Nacht der Museen (night of the museums) in Dusseldorf on May 9th 2009. Visitors will get informed about the dimensions of the Cologne catastrophe and about aspects of the protection of cultural possessions.(press release Landtag NRW via Archivalia)
Spiegel Online asked Were Subway Builders Cautious Enough? on March 9th 2009: "Workers at Bilfinger Berger, the German company leading construction of this part of the underground line, have said internally that planners may have forgotten to take account of the particular impact that the weight of the books and the water were having on this problematic soil.It's also possible that city administrators failed to take a recent report on structural damage at the city archive as seriously as it should have."
Hildegard Stausberg asked in the article Assault on Cologne's historical core (Welt Online - English News) on March 6th 2009: "Could it be that the collapse of the Cologne city archives building will mark a change in this mentality [which archives generally associated with something dried out and perhaps a little dull of] in Germany?" (via Archivalia)
Pictures from the Rescue Work at the scene
Salvaging Cologne's Destroyed Historical Archive a picture series by Spiegel Online
GERMAN: http://archiv.twoday.net/topics/Kommunalarchive
(Picture above: "An archivist [Prof. Dr. Polley, Archivschule Marburg] looks at the debris of the collapsed building of Cologne’s city archive in a hall in Cologne, Germany, yesterday." (photograph published on Times&Transsripts)
Frank.Schloeffel - am Donnerstag, 12. März 2009, 09:18 - Rubrik: English Corner
Neu in Wolfenbüttel: http://tinyurl.com/dd7ffj
Ich habe das Buch in einer lateinischen Ausgabe selbst, ist ein ganz winziges Büchlein von 1635.
Ich habe das Buch in einer lateinischen Ausgabe selbst, ist ein ganz winziges Büchlein von 1635.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 04:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Salzburg online:
http://plusbib02.plus.sbg.ac.at/repro/
Update 2010: verschwunden, siehe aber
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=slk
#histverein
http://plusbib02.plus.sbg.ac.at/repro/
Update 2010: verschwunden, siehe aber
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=slk
#histverein
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 03:51 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.scribd.com/doc/13166453/-OCLC-Policy-WorldCat-metadata-libraries
(via Twitter-Account des Autors)
Wieso Bibliothekare Scribd statt E-LIS nehmen, erschließt sich mir nicht.
Mehr dazu:
http://www.uebertext.org/2009/03/ein-artikel-uber-die-oclc-metadaten.html
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=oclc
Der Autor konstatiert, dass die OCLC-Metadaten-Policy in der deutschen Bibliothekswelt keine Resonanz gefunden hat. Wir hatten in Archivalia, wie sich aus dem vorigen Link ergibt, allein drei Beiträge zu ihr seit November 2008!
Seit Jahren bietet im übrigen das österreichische Bibliothekswerk Katalogdaten unter CC-NC an:
http://www.biblio.at/service/katalogisate/suche.html
(via Twitter-Account des Autors)
Wieso Bibliothekare Scribd statt E-LIS nehmen, erschließt sich mir nicht.
Mehr dazu:
http://www.uebertext.org/2009/03/ein-artikel-uber-die-oclc-metadaten.html
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=oclc
Der Autor konstatiert, dass die OCLC-Metadaten-Policy in der deutschen Bibliothekswelt keine Resonanz gefunden hat. Wir hatten in Archivalia, wie sich aus dem vorigen Link ergibt, allein drei Beiträge zu ihr seit November 2008!
Seit Jahren bietet im übrigen das österreichische Bibliothekswerk Katalogdaten unter CC-NC an:
http://www.biblio.at/service/katalogisate/suche.html
KlausGraf - am Donnerstag, 12. März 2009, 00:20 - Rubrik: Open Access
 Album amicorum Cgm 9256
Album amicorum Cgm 9256
