I´m looking for scary ghost stories in archives.
s. a.:
Ghost in the archives?: Link
Ghost in the archives II: Register des Geister-Archives : Link
Ghost in the archives III: Ick war allhier: Link
Ghost in the archives IV: Archivgeist wieder gesichtet: Link
Ghost in the archives V: A second, smaller ghost in my new magazin: Link
Ghost in the archives VI: My little ghost with a file trolley: Link
(E)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. Juni 2011, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"sang" Prof. Rainer S. Elkar in seinem Eröffnungsvortrag des diesjährigen Westfälischen Archivtags in Siegen: " .... Es sind häufig die kleinen Archive, die als besonders liebenswürdige und tüchtige Agenturen des Erinnerns hervortreten ....Das Lob der kleinen Archive setzt ein anderes Maß als Jahrhunderte und Regalmeter: Es hat etwas damit zu tun, wie nah das Archivpersonal seinen Archivnutzern ist. Da gibt es große, die eine solche Nähe herzustellen vermögen, doch die kleinen wissen nicht selten ihre Vorteile zu nutzen undpflegen einen sehr unmittelbaren geistigen Austausch.
Wer dort, nachdem erst einmal wechselseitiges Vertrauen begründet wurde, zu einem gemeinsamen Besuch des Magazins eingeladen wird, der tritt mit allen Sinnen ein. Der geht eine Kellertreppe hinunter wie in Hilchenbach, der renkt den Kopf weit nach oben und sucht nach einer langen Leiter wie in Laasphe, der muss im Winter mithelfen, eine schwere Matratze vor der eisernen Eingangstür zum Archivsaal zu entfernen, um dann – wie in Schloss Berleburg –in einem weiten Raum mit herrlichen Archivladen zu stehen, dort wo seit Jahrhunderten das Gedächtnis der oberen Grafschaft zuhause ist.
Wer zu solchen Besuchen ins Innerste eingeladen wird, der atmet unterschiedliche Gerüche. Sie sind in Berleburg, Laasphe, Hilchenbach oder Siegen anders, weil sich je nach dem Alter der Gemäuer, der Beschaffenheit der Regale oder Kompaktusanlage, dem natürlichen oder künstlichen Klima eine andere Luft bildet – Neubau mit Ikeageruch oder Gewölbe mit Silvanerbouquet sozusagen. Wer so eingeladen wurde, der erinnert auch Unerwartetes, weil in den Vorhöfen des Magazins – ich sage nicht in welchem – ein tierliebender Archivar zeitweilig Igeln ein Winterquartier geboten hat.
Nicht nur in den kleinen Archiven, aber vielleicht irgendwann nur noch dort, lassen sich andere Erfahrungen machen, die sich zu Erinnerungen verdichten:
Ich denke an die Patina der Geschichte, den Archivstaub, der die Kartonage umhüllt, und den Löschsand, den man aus den dicken Tintenstellen mit leichter Fingerbewegung noch heraus wischen kann. Solch unmittelbare Erfahrungen der Geschichte werden seltener werden, je mehr verfilmt wird und je öfter Handschuhe zur Vorschrift gemacht werden.
So werden die Benutzenden von der sinnlichen Erfahrung der Geschichte abgeschirmt, an der sich künftig nur noch der Archivar einsam in seinem geschlossenen Magazin erfreuen wird. So wäre mir möglicherweise jenes getrocknete Veilchen entgangen, das ich in einem nur mit größter Vorsicht zu nutzenden Bändchen in München vorfand .... Das Lob der Archivare in kleinen Archiven wäre aber unvollständig, wäre da nicht noch ein Anderes, was gewiss gleichfalls Probleme aufwirft, gibt es doch Benutzer, die nicht als voll ausgebildete Archivare zum ersten Mal den Schritt über die geheiligte Schwelle wagen, Benutzer, die alte Schrift nicht lesen können, die in der ausgefeilten Kunst der behördengerechten Bestellung von Archivalien nicht bewandert sind und die andere Untugenden mehr aufweisen.
In dieser Hinsicht leisten die Damen und Herren der kleinen Reiche nicht selten Außerordentliches. Sie gleichen an Hilfestellungen zum Teil aus, was Studierende an den Hochschulen eigentlich hätten schon lernen können und müssen – doch davon später mehr. ....Nahezu unmöglich ist es freilich, dass sich in kleinen Archiven besondere Schutzzonen bilden. Der Hinweis „Zutritt nur für Zugangsberechtigte“, womit nicht etwa das Magazin verschlossen wird, ist eine inzwischen sattsam geübte Praxis, um höhere Bedienstete vom gemeinen Nutzervolk fernzuhalten. Hinter solchen Wettertüren finden sich dann die einen, die wacker das Inventar verzeichnen dürfen, und die anderen, deren wissenschaftliche Produkte zur Vitrinenwürdigkeit heranreifen, in der Regel ausgestellt in unmittelbarer Nähe der verschlossenen Korridore.
Auch aus meiner Erfahrung ist es wichtig zu erkennen, welch langfristig prägenden Einfluss die ersten archivalischen Quellenarbeiten auf eine spätere wissenschaftliche Betätigung haben. Sie sind mit den Erfahrungen in bestimmten Archiven verbunden, folgen den Universitätserinnerungen ähnlich wie diese den Schulerinnerungen folgen. Und so sind denn nicht zuletzt in dieser Hinsicht Archive Erinnerungsorte für individuelle und überindividuelle Biographien, bleibend, nachhaltig, nicht selten mit dankbaren Gefühlen begleitet, wovon so manches Vorwort kündet. ...." (S. 3 - 5)
Elkar verwies auf ein weiteres Desiderat der Archivistik hin: " .... Die Nutzer-Biotope der hoffnungsvollen Studierenden und
zeitvertreibenden Pensionäre, der aussterbenden Spezies der Bleistiftschreibenden, der um Steckdosen kämpfenden Laptop-Klappernden, der griesgrämigen Stammplatzkämpfer wie der selig Schnarchenden, sie alle, die sich in kleinen, nicht selten aber ebenso in großen Archiven bilden, wären gewiss eine eigene Würdigung wert......" (S. 5)
Link zur überarbeiteten Redefassung (PDF)
(W)
Wer dort, nachdem erst einmal wechselseitiges Vertrauen begründet wurde, zu einem gemeinsamen Besuch des Magazins eingeladen wird, der tritt mit allen Sinnen ein. Der geht eine Kellertreppe hinunter wie in Hilchenbach, der renkt den Kopf weit nach oben und sucht nach einer langen Leiter wie in Laasphe, der muss im Winter mithelfen, eine schwere Matratze vor der eisernen Eingangstür zum Archivsaal zu entfernen, um dann – wie in Schloss Berleburg –in einem weiten Raum mit herrlichen Archivladen zu stehen, dort wo seit Jahrhunderten das Gedächtnis der oberen Grafschaft zuhause ist.
Wer zu solchen Besuchen ins Innerste eingeladen wird, der atmet unterschiedliche Gerüche. Sie sind in Berleburg, Laasphe, Hilchenbach oder Siegen anders, weil sich je nach dem Alter der Gemäuer, der Beschaffenheit der Regale oder Kompaktusanlage, dem natürlichen oder künstlichen Klima eine andere Luft bildet – Neubau mit Ikeageruch oder Gewölbe mit Silvanerbouquet sozusagen. Wer so eingeladen wurde, der erinnert auch Unerwartetes, weil in den Vorhöfen des Magazins – ich sage nicht in welchem – ein tierliebender Archivar zeitweilig Igeln ein Winterquartier geboten hat.
Nicht nur in den kleinen Archiven, aber vielleicht irgendwann nur noch dort, lassen sich andere Erfahrungen machen, die sich zu Erinnerungen verdichten:
Ich denke an die Patina der Geschichte, den Archivstaub, der die Kartonage umhüllt, und den Löschsand, den man aus den dicken Tintenstellen mit leichter Fingerbewegung noch heraus wischen kann. Solch unmittelbare Erfahrungen der Geschichte werden seltener werden, je mehr verfilmt wird und je öfter Handschuhe zur Vorschrift gemacht werden.
So werden die Benutzenden von der sinnlichen Erfahrung der Geschichte abgeschirmt, an der sich künftig nur noch der Archivar einsam in seinem geschlossenen Magazin erfreuen wird. So wäre mir möglicherweise jenes getrocknete Veilchen entgangen, das ich in einem nur mit größter Vorsicht zu nutzenden Bändchen in München vorfand .... Das Lob der Archivare in kleinen Archiven wäre aber unvollständig, wäre da nicht noch ein Anderes, was gewiss gleichfalls Probleme aufwirft, gibt es doch Benutzer, die nicht als voll ausgebildete Archivare zum ersten Mal den Schritt über die geheiligte Schwelle wagen, Benutzer, die alte Schrift nicht lesen können, die in der ausgefeilten Kunst der behördengerechten Bestellung von Archivalien nicht bewandert sind und die andere Untugenden mehr aufweisen.
In dieser Hinsicht leisten die Damen und Herren der kleinen Reiche nicht selten Außerordentliches. Sie gleichen an Hilfestellungen zum Teil aus, was Studierende an den Hochschulen eigentlich hätten schon lernen können und müssen – doch davon später mehr. ....Nahezu unmöglich ist es freilich, dass sich in kleinen Archiven besondere Schutzzonen bilden. Der Hinweis „Zutritt nur für Zugangsberechtigte“, womit nicht etwa das Magazin verschlossen wird, ist eine inzwischen sattsam geübte Praxis, um höhere Bedienstete vom gemeinen Nutzervolk fernzuhalten. Hinter solchen Wettertüren finden sich dann die einen, die wacker das Inventar verzeichnen dürfen, und die anderen, deren wissenschaftliche Produkte zur Vitrinenwürdigkeit heranreifen, in der Regel ausgestellt in unmittelbarer Nähe der verschlossenen Korridore.
Auch aus meiner Erfahrung ist es wichtig zu erkennen, welch langfristig prägenden Einfluss die ersten archivalischen Quellenarbeiten auf eine spätere wissenschaftliche Betätigung haben. Sie sind mit den Erfahrungen in bestimmten Archiven verbunden, folgen den Universitätserinnerungen ähnlich wie diese den Schulerinnerungen folgen. Und so sind denn nicht zuletzt in dieser Hinsicht Archive Erinnerungsorte für individuelle und überindividuelle Biographien, bleibend, nachhaltig, nicht selten mit dankbaren Gefühlen begleitet, wovon so manches Vorwort kündet. ...." (S. 3 - 5)
Elkar verwies auf ein weiteres Desiderat der Archivistik hin: " .... Die Nutzer-Biotope der hoffnungsvollen Studierenden und
zeitvertreibenden Pensionäre, der aussterbenden Spezies der Bleistiftschreibenden, der um Steckdosen kämpfenden Laptop-Klappernden, der griesgrämigen Stammplatzkämpfer wie der selig Schnarchenden, sie alle, die sich in kleinen, nicht selten aber ebenso in großen Archiven bilden, wären gewiss eine eigene Würdigung wert......" (S. 5)
Link zur überarbeiteten Redefassung (PDF)
(W)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 22:08 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nadine Thiel, Jahrgang 1981, hat nach ihrem Abitur zunächst ein Praktikum in Restaurierungswerkstätten in Münster und Düsseldorf absolviert, um im Anschluss „Restaurierung und Konservierung von Schriftgut, Graphik und Buchmalerei“ an der Fachhochschule Köln zu studieren. Seit ihrem Diplom 2006 arbeitet sie im Historischen Archiv der Stadt Köln, seit Anfang 2008 leitet sie die Abteilung Restaurierung. Die Katastrophe vom 3. März 2009 sieht sie wie einen Stummfilm vor sich.
In unserem Interview erzählt Nadine Thiel von ihrer Leidenschaft zu Schriftgut, dem Moment des Einsturzes des Archivgebäudes und warum eine kleine Spende eine große Wirkung hat.
Link zum Interview (PDF)
Quelle: Stiftung Stadtgedächtnis, Homepage
(F)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 21:57 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sigrun Heinen, Marc Peez und Christoph Schaab
Helferarbeiten im eingestürzten Historischen Archiv
der Stadt Köln. Ein Erfahrungsbericht , in: Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege 42. Forschungen und Berichte; Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2011; ISBN 978-3-88462-314-5, S. 179-185
Quelle: Publikationsliste der LVR-Denkmalpflege
(W)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 21:51 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The Director-General of UNESCO has designated National Archives of Australia (NAA) as the laureate of the 2011 UNESCO/Jikji Memory of the World Prize for its work, which includes publications, and innovative initiatives in the preservation of digital records.
Established in 1960, the National Archives has become a world leader in many areas notably that of digital preservation. It consistently shares its professional know-how with experts and interested members of the public through extensive publications. Furthermore, the NAA shares the fruit of its own research and development by making available open source tools for digital preservation to the global preservation community.
The Australian Archives have also developed world-class expertise in facing one of the key challenges of the digital era: how to adapt the record-creating processes of government agencies to the needs of recordkeeping to ensure the lasting access to documents that testify to the work of public bodies.
The NAA has also demonstrated innovation in its collaborative work on the preservation of documents written in iron gall ink (an ink that includes iron salts and which has been in use in Europe for many centuries).
The US$ 30,000 Prize, wholly funded by the Republic of Korea, is awarded every two years to individuals or institutions that have made significant contributions to the preservation and accessibility of documentary heritage.
The NAA has announced it will use the Prize to fund a paid work experience placement for a student of conservation, as an investment in the future of documentary heritage preservation.
The Prize-giving ceremony will take place in Cheongju City (Republic of Korea) on 2 September."
UNESCO, Pressemitteilung v. 30.05.2011
(T)
Established in 1960, the National Archives has become a world leader in many areas notably that of digital preservation. It consistently shares its professional know-how with experts and interested members of the public through extensive publications. Furthermore, the NAA shares the fruit of its own research and development by making available open source tools for digital preservation to the global preservation community.
The Australian Archives have also developed world-class expertise in facing one of the key challenges of the digital era: how to adapt the record-creating processes of government agencies to the needs of recordkeeping to ensure the lasting access to documents that testify to the work of public bodies.
The NAA has also demonstrated innovation in its collaborative work on the preservation of documents written in iron gall ink (an ink that includes iron salts and which has been in use in Europe for many centuries).
The US$ 30,000 Prize, wholly funded by the Republic of Korea, is awarded every two years to individuals or institutions that have made significant contributions to the preservation and accessibility of documentary heritage.
The NAA has announced it will use the Prize to fund a paid work experience placement for a student of conservation, as an investment in the future of documentary heritage preservation.
The Prize-giving ceremony will take place in Cheongju City (Republic of Korea) on 2 September."
UNESCO, Pressemitteilung v. 30.05.2011
(T)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 21:33 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Cycling for libraries is a politically and economically independent international unconference and a bicycle tour starting from Copenhagen, Denmark to Berlin, Germany May 28. –June 6. 2011. The event takes place for the first time in 2011 in cooperation with the German, Danish and Finnish library professionals. The purpose of the Cycling for libraries is to gather a group of 100 library professionals all around the world together to cycle a total of approximately 650 kilometers and to discuss the strategic issues of the library field in seminars along the route. Cycling for libraries is an independent event, not organized by any existing formal organization. It is made possible by a sovereign, international network of library enthusiasts.
http://www.cyclingforlibraries.org/
Anm.: Der Archivtag fährt Rad - eine amüsante Vorstellung (Korso durch Bremen?)
(T)
http://www.cyclingforlibraries.org/
Anm.: Der Archivtag fährt Rad - eine amüsante Vorstellung (Korso durch Bremen?)
(T)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 21:10 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der französische Blog "Chroniques archivistiques" berichtet vom Verlust der Lokalhistoriker als Benutzende eines Kommunalarchivs an das Internet. Sie verzichten auf Quellenrecherche zu Gunsten von Netzfundstücken.
Sind hier ähnliche Erfahrungen gemacht worden?
Link zum Blogeintrag
(T)
Sind hier ähnliche Erfahrungen gemacht worden?
Link zum Blogeintrag
(T)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 21:02 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Social Web - Da geht noch was. Praesentation für MAI-Tagung 2011
View more presentations from u.s.k.
(T)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 20:54 - Rubrik: Web 2.0
Un défilé de mode inhabituel dans un cadre hors... von Paxou
"Défilé de mode dans un cadre inhabituel, celui des Archives départementales de l'Hérault de Montpellier. Une volonté très nette d'accueillir et intéresser un public varié de jeunes et de scolaires, d'universitaires ou de chercheurs, qui peuvent par ce biais rentrer de plein pied dans le domaine de notre culture associé à notre pâtrimoine"
Publicité a la francais .....
(T)
Wolf Thomas - am Montag, 30. Mai 2011, 20:47 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die digitale Bibliothek der Universitätsbibliothek Potsdam ist neu und weist erst wenige Werke auf.
So findet man dort u. a. Rudolf Bergau: Inventare der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg 1885
Ein Download der Werke ist nicht möglich.
Ein RS-Feed informiert über die neuen Digitalisate
So findet man dort u. a. Rudolf Bergau: Inventare der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg 1885
Ein Download der Werke ist nicht möglich.
Ein RS-Feed informiert über die neuen Digitalisate
FredLo - am Montag, 30. Mai 2011, 17:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Miterbe darf Testament von Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe nicht einsehen. Es wird entgegen § 2259 BGB nicht an das Nachlassgericht abgeliefert. Es wird seltsamerweise im Bestand des sogenannten Familien- und Hausarchivs in Bückeburg verwahrt.
Wird diese rechtswidrige Praxis auch nach dem 1.1.2012 aufrecht erhalten werden ?
"Testamentsverzeichnisse sind integraler Bestandteil des Zentralen Testamentsregisters und für dessen Betrieb unverzichtbar. Sie werden in einem gesonderten Verfahren überführt werden. Dieser Prozess erstreckt sich nach § 1 I Testamentsverzeichnisüberführungsgesetz über einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren auf alle 5064 Standesämter mit geschätzten 15 Mio. Verwahrungsnachrichten und die Hauptkartei für Testamente", (Notarassessor Dr. Thomas Diehn, das Zentrale Testamentsregister, NJW 2011, 481 (484).
Zum Ablauf zur Erfassung der Testamente im Jahr 2011:
http://www.testamentsregister.de/Nutzer-Service/StA/index.php
Werden staatliche Instanzen dafür sorgen, dass das Testament Adolfs weiterhin unerfasst bleibt ?
Natürlich. Gesetzesbruch macht nichts, wenn er (auch) vom Staat begangen wird. Ist § 2259 BGB erstmal verletzt kommt es auch nicht zu einer Registrierung im Zentralen Testamentsregister, weil eine Registrierung im Testamentsverzeichnis unterblieb. Das parallele Unrechtssystem in Reinkultur.
siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/#4727783
http://goo.gl/WYYIW
vierprinzen
Wird diese rechtswidrige Praxis auch nach dem 1.1.2012 aufrecht erhalten werden ?
"Testamentsverzeichnisse sind integraler Bestandteil des Zentralen Testamentsregisters und für dessen Betrieb unverzichtbar. Sie werden in einem gesonderten Verfahren überführt werden. Dieser Prozess erstreckt sich nach § 1 I Testamentsverzeichnisüberführungsgesetz über einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren auf alle 5064 Standesämter mit geschätzten 15 Mio. Verwahrungsnachrichten und die Hauptkartei für Testamente", (Notarassessor Dr. Thomas Diehn, das Zentrale Testamentsregister, NJW 2011, 481 (484).
Zum Ablauf zur Erfassung der Testamente im Jahr 2011:
http://www.testamentsregister.de/Nutzer-Service/StA/index.php
Werden staatliche Instanzen dafür sorgen, dass das Testament Adolfs weiterhin unerfasst bleibt ?
Natürlich. Gesetzesbruch macht nichts, wenn er (auch) vom Staat begangen wird. Ist § 2259 BGB erstmal verletzt kommt es auch nicht zu einer Registrierung im Zentralen Testamentsregister, weil eine Registrierung im Testamentsverzeichnis unterblieb. Das parallele Unrechtssystem in Reinkultur.
siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/#4727783
http://goo.gl/WYYIW
vierprinzen
vom hofe - am Montag, 30. Mai 2011, 16:56 - Rubrik: Herrschaftsarchive
1. Äußerungen in Interviews, die weder in sprachlicher noch in inhaltlicher Hinsicht als schöpferisch anzusehen sind, genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.
2. Bei der Frage, in welchem Umfang eine urheberrechtlich geschützte Äußerung zitiert werden darf, muss berücksichtigt werden, dass ein zu restriktives Zitatrecht zu einer sinnentstellenden Verkürzung von Zitaten führen kann.
Ein Urteil des LG Hamburg zur Buskeismus-Seite
http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/Sprachwerke/1284-LG-Hamburg-Az-308-O-62508-Urheberrechtlicher-Schutz-von-Interviewaeusserungen.html
(RSS)
2. Bei der Frage, in welchem Umfang eine urheberrechtlich geschützte Äußerung zitiert werden darf, muss berücksichtigt werden, dass ein zu restriktives Zitatrecht zu einer sinnentstellenden Verkürzung von Zitaten führen kann.
Ein Urteil des LG Hamburg zur Buskeismus-Seite
http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/Sprachwerke/1284-LG-Hamburg-Az-308-O-62508-Urheberrechtlicher-Schutz-von-Interviewaeusserungen.html
(RSS)
KlausGraf - am Montag, 30. Mai 2011, 12:58 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.llv.li/pdf-llv-dss-taetigkeitsbericht_2010.pdf
S. 9f. kommt auch Google StreetView vor.
(RSS)
S. 9f. kommt auch Google StreetView vor.
(RSS)
KlausGraf - am Montag, 30. Mai 2011, 12:40 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt das LG München I in einer nicht rechtskräftigen Entscheidung.
http://www.ftd.de/lifestyle/:veroeffentlichtes-vermoegen-mister-bofrost-scheitert-vor-gericht/60036429.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_reichsten_Deutschen
Den Volltext stellte freundlicherweise Openjur bereit:
http://openjur.de/u/165007.html
Die Gurke des Tages geht wieder einmal an die Gerichtsverwaltung für die abstruse und zu weit gehende Anonymisierung/Neutralisierung des Urteilstextes. Leider wird wohl nie der Rechtsweg gegen eine unangemessene Neutralisierung beschritten und daher das Recht der Öffentlichkeit auf vollständige Kenntnis der Urteilsgründe unzuträglich verkürzt. Historische Aussagen über eine Veröffentlichung von 1912 sind unter keinen Umständen schützenswert:
Der Auflistung der reichsten Bürger wohnt darüber hinaus immer auch eine wirtschaftsgeschichtliche Komponente inne. Eine 1912 in Preußen erstellte Liste der reichsten Bürgerinnen und Bürger erwähnte ... und ... ... und ... an der Spitze. Alle drei Personen hatten erhebliches Vermögen im Rahmen der industriellen Revolution angehäuft und waren Montanindustrielle. Heute befinden sich Dienstleistungs- und Handelsunternehmer an der Spitze der reichsten Deutschen. Das ist greifbare Wirtschaftsgeschichte, die die Presse auch anhand konkreter Persönlichkeiten, die für diese Entwicklungen stehen, schildern darf.
(F)
http://www.ftd.de/lifestyle/:veroeffentlichtes-vermoegen-mister-bofrost-scheitert-vor-gericht/60036429.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_reichsten_Deutschen
Den Volltext stellte freundlicherweise Openjur bereit:
http://openjur.de/u/165007.html
Die Gurke des Tages geht wieder einmal an die Gerichtsverwaltung für die abstruse und zu weit gehende Anonymisierung/Neutralisierung des Urteilstextes. Leider wird wohl nie der Rechtsweg gegen eine unangemessene Neutralisierung beschritten und daher das Recht der Öffentlichkeit auf vollständige Kenntnis der Urteilsgründe unzuträglich verkürzt. Historische Aussagen über eine Veröffentlichung von 1912 sind unter keinen Umständen schützenswert:
Der Auflistung der reichsten Bürger wohnt darüber hinaus immer auch eine wirtschaftsgeschichtliche Komponente inne. Eine 1912 in Preußen erstellte Liste der reichsten Bürgerinnen und Bürger erwähnte ... und ... ... und ... an der Spitze. Alle drei Personen hatten erhebliches Vermögen im Rahmen der industriellen Revolution angehäuft und waren Montanindustrielle. Heute befinden sich Dienstleistungs- und Handelsunternehmer an der Spitze der reichsten Deutschen. Das ist greifbare Wirtschaftsgeschichte, die die Presse auch anhand konkreter Persönlichkeiten, die für diese Entwicklungen stehen, schildern darf.
(F)
KlausGraf - am Montag, 30. Mai 2011, 01:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Aufsatz beginnt mit einem Trugschluss: Für mich war immer die Frage von Interesse, inwieweit zurückliegende Ereignisse allein durch die Weitergabe von Mund zu Mund in ein allgemeines Bewusstsein der Bevölkerung Eingang finden und sich dort über Jahrhunderte hinweg einprägen. Ein dramatischer Vorfall in der Geschichte Schwabens, der nun genau 500 Jahre zurückliegt, dürfte diesem Tatbestand entsprechen. Er hat sich bei der Bevölkerung im näheren Umkreis des Tatortes bis zum heutigen Tag lebendig gehalten.
Nachdem es hinreichend schriftliche Quellen zu dem spektakulären Mordfall gab, die ins sog. Volk einsichern konnten, ist die Annahme einer jahrhundertelangen mündlichen Tradition völlig lächerlich.
Vanotti 1845
http://books.google.de/books?id=t5BAAAAAYAAJ&pg=PA454
Vochezer 1888
http://www.archive.org/details/GeschichteDesFrstlichenHausesWaldburgInSchwaben1
Steiff/Mehring Nr. 24
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_053.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_von_Sonnenberg
(D)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 22:38 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Volltext aus der "Schwäbischen Heimat":
http://schwaebischer-heimatbund.de/shb_in_eigener_sache/unsere_zeitschrift/index.php?cid=850
(D)
http://schwaebischer-heimatbund.de/shb_in_eigener_sache/unsere_zeitschrift/index.php?cid=850
(D)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 22:34 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute fand die Saisoneröffnung der Staatlichen Schlösser in Baden-Württemberg an der Wäscherburg statt. Die neue Pächterin stammt aus einer experimentellen Mittelalter-Gruppe, und so sieht denn auch die Website der Burg aus:
http://www.waescherschloss.de
Da gibt es die unvermeidlichen "Tafeleyen". Gewiss, die bisherige Präsentation war ein modriges Sammelsurium, aber gibt es keinen Weg, ein so einzigartiges Geschichtsdokument mit Respekt zu vermarkten?
Schwäbische Heimat 2011/2, S. 241
(D)

http://www.waescherschloss.de
Da gibt es die unvermeidlichen "Tafeleyen". Gewiss, die bisherige Präsentation war ein modriges Sammelsurium, aber gibt es keinen Weg, ein so einzigartiges Geschichtsdokument mit Respekt zu vermarkten?
Schwäbische Heimat 2011/2, S. 241
(D)

KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 22:25 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei der berüchtigten Marienburg-Verscherbelung der Welfen 2005 erwarb die Kunstsammlung Würth aus Künzelsau die um 1490 datierte Winser Madonna. Befristet bis 2014 darf die Kirchengemeinde nun die Skulptur wieder im angestammten Gotteshaus zeigen.
1861 kam die Madonna mit noch drei anderen Gegenständen nach einem Aufruf des letzten hannoverschen Königs Georg V. in die Sammlung für das Welfenmuseum. Eine urkundliche Erwähnung der Figur taucht im Inventarverzeichnis von 1863 des damaligen Welfenmuseums in Hannover auf. Nach Auflösung des Welfenmuseums kam die Skulptur in die Sammlung des Provinzialmuseums, des heutigen Landesmusems. 1943 gelangte sie zur Sicherstellung auf die Marienburg.
Schamlose Welfen: Kulturgut fürs vaterländische Museum einsammeln und dann im Privateigentum verschwinden lassen.
http://www.evkirche-winsenaller.de/madonna/madonna.html
+ Schwäbische Heimat 2011/2, S. 237
(D)
 http://www.evkirche-winsenaller.de
http://www.evkirche-winsenaller.de
1861 kam die Madonna mit noch drei anderen Gegenständen nach einem Aufruf des letzten hannoverschen Königs Georg V. in die Sammlung für das Welfenmuseum. Eine urkundliche Erwähnung der Figur taucht im Inventarverzeichnis von 1863 des damaligen Welfenmuseums in Hannover auf. Nach Auflösung des Welfenmuseums kam die Skulptur in die Sammlung des Provinzialmuseums, des heutigen Landesmusems. 1943 gelangte sie zur Sicherstellung auf die Marienburg.
Schamlose Welfen: Kulturgut fürs vaterländische Museum einsammeln und dann im Privateigentum verschwinden lassen.
http://www.evkirche-winsenaller.de/madonna/madonna.html
+ Schwäbische Heimat 2011/2, S. 237
(D)
 http://www.evkirche-winsenaller.de
http://www.evkirche-winsenaller.dehttp://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/kultur/regionale-kultur_artikel,-Warum-sich-die-Denkmalbehoerden-nicht-zu-S-21-aeusserten-_arid,130700.html
Norbert Bongartz, Oberkonservator im Ruhestand beim ehemaligen Landesdenkmalamt, sprach Tacheles: „Das Schweigen der Denkmalpflege liegt an den Amts-Strukturen.“ Seit Ministerpräsident Erwin Teufel die Denkmalbehörden den Regierungspräsidien und Landratsämtern zuschlug, hätten diese keine eigene Pressestelle mehr. Sie müssten bei politischen Projekten loyal zu vorgesetzten Behörden handeln und gingen darum nicht mehr an die Öffentlichkeit.
Ihre Bedenken gegen das Bahnprojekt hätten die Denkmalbehörden so deutlich wie möglich formuliert. Bongartz: „Man kann statt Integrierung in die Regierungspräsidien auch die Formel ‚Gleichschaltung‘ benutzen.“ Weder die Denkmal-Referate noch das Geologische Landesamt in Freiburg dürften sich zu S 21 äußern. „Die Fachbelange sind als Bettvorleger gelandet, wenn es hart auf hart kommt.“
+ Schwäbische Heimat 2011/2, S. 236
(D)

Norbert Bongartz, Oberkonservator im Ruhestand beim ehemaligen Landesdenkmalamt, sprach Tacheles: „Das Schweigen der Denkmalpflege liegt an den Amts-Strukturen.“ Seit Ministerpräsident Erwin Teufel die Denkmalbehörden den Regierungspräsidien und Landratsämtern zuschlug, hätten diese keine eigene Pressestelle mehr. Sie müssten bei politischen Projekten loyal zu vorgesetzten Behörden handeln und gingen darum nicht mehr an die Öffentlichkeit.
Ihre Bedenken gegen das Bahnprojekt hätten die Denkmalbehörden so deutlich wie möglich formuliert. Bongartz: „Man kann statt Integrierung in die Regierungspräsidien auch die Formel ‚Gleichschaltung‘ benutzen.“ Weder die Denkmal-Referate noch das Geologische Landesamt in Freiburg dürften sich zu S 21 äußern. „Die Fachbelange sind als Bettvorleger gelandet, wenn es hart auf hart kommt.“
+ Schwäbische Heimat 2011/2, S. 236
(D)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/Xrola = www.stuttgarter-zeitung.de
Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung haben die Besitzer des Hauses Hohentwielstraße 146b im Stuttgarter Süden, Helga und Diethard Erbslöh, vor dem Landgericht Stuttgart Berufung eingelegt gegen das Urteil des Amtsgerichts, vor dem sie in erster Instanz unterlegen waren.
Das Amtsgericht hatte Mitte März die Klage der Hausbesitzer gegen die Stadt, mit der sie die Entfernung der im Oktober 2010 verlegten Mahnmale zum Gedenken an die jüdischen NS-Opfer Mathilde und Max Henle erreichen wollten, abgewiesen.
Zur Begründung hieß es unter anderem, die beiden Kleindenkmale im öffentlichen Straßenraum stellten keine Beeinträchtigung oder Wertminderung des Eigentums der Kläger dar; die Stadt Stuttgart, in deren Besitz die Stolpersteine übergegangen sind, müsse sie nicht wieder entfernen.
(D)

Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung haben die Besitzer des Hauses Hohentwielstraße 146b im Stuttgarter Süden, Helga und Diethard Erbslöh, vor dem Landgericht Stuttgart Berufung eingelegt gegen das Urteil des Amtsgerichts, vor dem sie in erster Instanz unterlegen waren.
Das Amtsgericht hatte Mitte März die Klage der Hausbesitzer gegen die Stadt, mit der sie die Entfernung der im Oktober 2010 verlegten Mahnmale zum Gedenken an die jüdischen NS-Opfer Mathilde und Max Henle erreichen wollten, abgewiesen.
Zur Begründung hieß es unter anderem, die beiden Kleindenkmale im öffentlichen Straßenraum stellten keine Beeinträchtigung oder Wertminderung des Eigentums der Kläger dar; die Stadt Stuttgart, in deren Besitz die Stolpersteine übergegangen sind, müsse sie nicht wieder entfernen.
(D)

KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 22:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dx.doi.org/10.1002/asi.21569
Nur das Abstract ist kostenfrei einsehbar:
We investigate the extent to which open-access (OA) journals and articles in biology, computer science, economics, history, medicine, and psychology are indexed in each of 11 bibliographic databases. We also look for variations in index coverage by journal subject, journal size, publisher type, publisher size, date of first OA issue, region of publication, language of publication, publication fee, and citation impact factor. Two databases, Biological Abstracts and PubMed, provide very good coverage of the OA journal literature, indexing 60 to 63% of all OA articles in their disciplines. Five databases provide moderately good coverage (22–41%), and four provide relatively poor coverage (0–12%). OA articles in biology journals, English-only journals, high-impact journals, and journals that charge publication fees of $1,000 or more are especially likely to be indexed. Conversely, articles from OA publishers in Africa, Asia, or Central/South America are especially unlikely to be indexed. Four of the 11 databases index commercially published articles at a substantially higher rate than articles published by universities, scholarly societies, nonprofit publishers, or governments. Finally, three databases—EBSCO Academic Search Complete, ProQuest Research Library, and Wilson OmniFile—provide less comprehensive coverage of OA articles than of articles in comparable subscription journals.
Es ist eine Schande, dass von den 6568 Journals in DOAJ nur 2917 (via OAI-PMH von DOAJ weiternutzbare) Artikeldaten liefern. Die bibliographische Erfassung der Zeitschriftenproduktion ist keine Aufgabe für kommerzielle Datenbanken, sondern für Open-Access-Metasuchen, die disziplinübergreifende kostenlose Suchen ermöglichen.
(RSS)
Nur das Abstract ist kostenfrei einsehbar:
We investigate the extent to which open-access (OA) journals and articles in biology, computer science, economics, history, medicine, and psychology are indexed in each of 11 bibliographic databases. We also look for variations in index coverage by journal subject, journal size, publisher type, publisher size, date of first OA issue, region of publication, language of publication, publication fee, and citation impact factor. Two databases, Biological Abstracts and PubMed, provide very good coverage of the OA journal literature, indexing 60 to 63% of all OA articles in their disciplines. Five databases provide moderately good coverage (22–41%), and four provide relatively poor coverage (0–12%). OA articles in biology journals, English-only journals, high-impact journals, and journals that charge publication fees of $1,000 or more are especially likely to be indexed. Conversely, articles from OA publishers in Africa, Asia, or Central/South America are especially unlikely to be indexed. Four of the 11 databases index commercially published articles at a substantially higher rate than articles published by universities, scholarly societies, nonprofit publishers, or governments. Finally, three databases—EBSCO Academic Search Complete, ProQuest Research Library, and Wilson OmniFile—provide less comprehensive coverage of OA articles than of articles in comparable subscription journals.
Es ist eine Schande, dass von den 6568 Journals in DOAJ nur 2917 (via OAI-PMH von DOAJ weiternutzbare) Artikeldaten liefern. Die bibliographische Erfassung der Zeitschriftenproduktion ist keine Aufgabe für kommerzielle Datenbanken, sondern für Open-Access-Metasuchen, die disziplinübergreifende kostenlose Suchen ermöglichen.
(RSS)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 21:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jean-Baptiste Piggin macht mich darauf aufmerksam, dass Cod Sang 133 bald im Rahmen von E-Codices einsehbar sein wird:
http://macrotypography.blogspot.com/2011/05/e-codices.html
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Stichometrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Stichometry
(PM)
http://macrotypography.blogspot.com/2011/05/e-codices.html
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Stichometrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Stichometry
(PM)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 20:56 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Berliner Abgeordnetenhaus ist mehrheitlich dafür, öffentliche Bibliotheken in Deutschland auch sonntags zu öffnen. Dazu müsste das Arbeitszeitgesetz geändert werden, das Sonntagsarbeit in bestimmten Bereichen erlaubt. Der Berliner Senat will nun eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Gesetzes unterstützen. In dem Antrag heißt es, damit würden Bibliotheken als gleichwertige Orte der Kultur und der Bildung wie beispielsweise Museen, Theater und Kinos anerkannt. "
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 27.05.2011
(W)
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 27.05.2011
(W)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 19:10 - Rubrik: Bibliothekswesen
Winfried Bullinger/Markus Bretzel/Jörg Schmalfuß (Hrsg.):
Urheberrechte in Museen und Archiven. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010: Nomos Verlagsgesellschaft. 106 S., Abbildungen.
Eine verständliche Einführung in das Urheberrecht für den Archivalltag ist ein Desiderat. In diesem schmalen Band geht es jedoch so gut wie ausschließlich um die Museumspraxis, ausgehend von den Foto- und Filmbeständen des Deutschen Technikmuseums Berlin. Selbstverständlich sind die Ausführungen übertragbar, aber die wirklichen „Knackpunkte“ bei dem Umgang mit potentiell urheberrechtlich geschützten werden nicht erörtert. Dies betrifft etwa die Frage der Schöpfungshöhe von Gebrauchstexten oder die Frage, ob die bloße Vorlage von geschütztem Archivgut zulässig ist. Immerhin vertritt der Band – die Beiträge der einzelnen Autoren werden nicht ausgewiesen – die Ansicht, dass es zulässig ist, einzelnen Benutzern Originalfilme zu zeigen (S. 77f.).
Wer sich intensiver mit dem Urheberrecht im Archivbereich befasst,
wird nicht umhin kommen, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Es enthält auch für den Fachmann einige lesenswerte Passagen.
Ich möchte allerdings bezweifeln, dass der sehr hölzerne juristische
Stil tatsächlich geeignet ist, praktische Hilfe zu geben. Zwar gibt es
zu allen Themen gute „Fazit“-Abschnitte, aber schon allein die
Tatsache, dass die juristischen Abkürzungen nirgends erklärt werden, spricht für sich. Das knappe Literaturverzeichnis ignoriert, dass wichtige Informationsquellen (ja, auch Wikipedia-Artikel!) kostenlos im Internet abrufbar sind. So sehr sich das nicht gerade
preisgünstige Buch auch um Praxisnähe bemüht – gelungen ist es ihm aus meiner Sicht nicht. Juristische Umständlichkeiten etwa zu den komplizierten Schutzfristen von einfachen Lichtbildern wären
entbehrlich gewesen, da auch angesichts der europarechtlichen
Vereinheitlichung der Schutzvoraussetzungen bei Fotos aus
pragmatischer Sicht nur in Ausnahmefällen davon ausgegangen werden kann, dass kein – 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen geschütztes - Lichtbildwerk vorliegt. Auch sonst gibt es Punkte, bei denen ich mit den fachlichen Ausführungen nicht einverstanden bin. Für die Praxis wichtige Aspekte kommen zu kurz, etwa die Frage der Reproduktionsfotografie (S. 30) oder das wirklich zentrale Problem der verwaisten Werke, das nur in einer Fußnote auf S. 90 angesprochen wird.
In Weiterführung eines Aufsatzes von Bullinger (in: Festschrift für
Peter Raue, 2006) wendet sich die Schrift S. 81-88 vorsichtig gegen
die gängige Praxis der Museen, ihr gemeinfreies Kulturgut zu
monopolisieren und zu kommerzialisieren. Dass meine Position aufgrund einer Buchbesprechung aus dem Jahr 1999 referiert wird, zeugt von schlechter Recherche, denn ich habe sie seither nicht nur oft im Internet, sondern auch in gedruckten Publikationen ausführlicher begründet (siehe etwa Rezensent: Die Public Domain und die Archive, in: Die Archive im digitalen Zeitalter, 2010).
Da ich selber in einem Buch „Urheberrechtsfibel“ (2009, auch
kostenfrei im Internet einsehbar und natürlich von Bullinger et al.
als urheberrechtliche Außenseiterpublikation nicht zitiert) versucht
habe, archivische Probleme mit dem Urheberrecht allgemeinverständlich darzustellen, bin ich allerdings befangen. Das zu besprechende Buch sagt immerhin sehr deutlich, was derzeit „nicht geht“ und trägt dadurch hoffentlich dazu bei, dass sich die Archive endlich in die Debatte um die Neugestaltung des Urheberrechts einschalten.
Klaus Graf
Die Besprechung erschien in: Der Archivar 64 (2011), S. 241f.
[Online: http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2011/ausgabe2/ARCHIVAR_02-11_internet.pdf ]
(D)

Urheberrechte in Museen und Archiven. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010: Nomos Verlagsgesellschaft. 106 S., Abbildungen.
Eine verständliche Einführung in das Urheberrecht für den Archivalltag ist ein Desiderat. In diesem schmalen Band geht es jedoch so gut wie ausschließlich um die Museumspraxis, ausgehend von den Foto- und Filmbeständen des Deutschen Technikmuseums Berlin. Selbstverständlich sind die Ausführungen übertragbar, aber die wirklichen „Knackpunkte“ bei dem Umgang mit potentiell urheberrechtlich geschützten werden nicht erörtert. Dies betrifft etwa die Frage der Schöpfungshöhe von Gebrauchstexten oder die Frage, ob die bloße Vorlage von geschütztem Archivgut zulässig ist. Immerhin vertritt der Band – die Beiträge der einzelnen Autoren werden nicht ausgewiesen – die Ansicht, dass es zulässig ist, einzelnen Benutzern Originalfilme zu zeigen (S. 77f.).
Wer sich intensiver mit dem Urheberrecht im Archivbereich befasst,
wird nicht umhin kommen, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Es enthält auch für den Fachmann einige lesenswerte Passagen.
Ich möchte allerdings bezweifeln, dass der sehr hölzerne juristische
Stil tatsächlich geeignet ist, praktische Hilfe zu geben. Zwar gibt es
zu allen Themen gute „Fazit“-Abschnitte, aber schon allein die
Tatsache, dass die juristischen Abkürzungen nirgends erklärt werden, spricht für sich. Das knappe Literaturverzeichnis ignoriert, dass wichtige Informationsquellen (ja, auch Wikipedia-Artikel!) kostenlos im Internet abrufbar sind. So sehr sich das nicht gerade
preisgünstige Buch auch um Praxisnähe bemüht – gelungen ist es ihm aus meiner Sicht nicht. Juristische Umständlichkeiten etwa zu den komplizierten Schutzfristen von einfachen Lichtbildern wären
entbehrlich gewesen, da auch angesichts der europarechtlichen
Vereinheitlichung der Schutzvoraussetzungen bei Fotos aus
pragmatischer Sicht nur in Ausnahmefällen davon ausgegangen werden kann, dass kein – 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen geschütztes - Lichtbildwerk vorliegt. Auch sonst gibt es Punkte, bei denen ich mit den fachlichen Ausführungen nicht einverstanden bin. Für die Praxis wichtige Aspekte kommen zu kurz, etwa die Frage der Reproduktionsfotografie (S. 30) oder das wirklich zentrale Problem der verwaisten Werke, das nur in einer Fußnote auf S. 90 angesprochen wird.
In Weiterführung eines Aufsatzes von Bullinger (in: Festschrift für
Peter Raue, 2006) wendet sich die Schrift S. 81-88 vorsichtig gegen
die gängige Praxis der Museen, ihr gemeinfreies Kulturgut zu
monopolisieren und zu kommerzialisieren. Dass meine Position aufgrund einer Buchbesprechung aus dem Jahr 1999 referiert wird, zeugt von schlechter Recherche, denn ich habe sie seither nicht nur oft im Internet, sondern auch in gedruckten Publikationen ausführlicher begründet (siehe etwa Rezensent: Die Public Domain und die Archive, in: Die Archive im digitalen Zeitalter, 2010).
Da ich selber in einem Buch „Urheberrechtsfibel“ (2009, auch
kostenfrei im Internet einsehbar und natürlich von Bullinger et al.
als urheberrechtliche Außenseiterpublikation nicht zitiert) versucht
habe, archivische Probleme mit dem Urheberrecht allgemeinverständlich darzustellen, bin ich allerdings befangen. Das zu besprechende Buch sagt immerhin sehr deutlich, was derzeit „nicht geht“ und trägt dadurch hoffentlich dazu bei, dass sich die Archive endlich in die Debatte um die Neugestaltung des Urheberrechts einschalten.
Klaus Graf
Die Besprechung erschien in: Der Archivar 64 (2011), S. 241f.
[Online: http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2011/ausgabe2/ARCHIVAR_02-11_internet.pdf ]
(D)

KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 19:04 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 18:54 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Orphans sind eine riesige barriere, wenn es um den Online-Zugang zu Kulturgut geht. Die Probleme zeigt auf:
http://chronicle.com/article/Out-of-Fear-Institutions-Lock/127701/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
(ML)
http://chronicle.com/article/Out-of-Fear-Institutions-Lock/127701/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
(ML)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 18:35 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da Gallica keine gescheite Signaturenliste bietet, muss die folgende Zusammenstellung gerühmt werden:
http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FPnlat_online.htm
(ML)

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FPnlat_online.htm
(ML)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 18:21 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ob der Vergleich mit Anne Frank zutrifft oder nicht: Solange deutsche Kommunalarchive nichts Vergleichbares bieten, weise ich darauf hin:
http://www.archiefeemland.nl/actueel/nieuws/2011/amersfoortse-anne-frank
(W)
http://www.archiefeemland.nl/actueel/nieuws/2011/amersfoortse-anne-frank
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Christian Dietrich [Archivgründer] im Gespräch mit Stephan Karkowsky [Deutschlandradio Kultur]
Das Gedächtnis der DDR-Opposition liegt auf mehrere Privat-Archive verteilt in Ostdeutschland. Eines der bedeutendsten wurde heute vor 20 Jahren gegründet - vom ehemaligen DDR-Bürgerrechtler Christian Dietrich in Leipzig.
Stephan Karkowsky: Das Gedächtnis der DDR-Opposition liegt auf mehrere Privatarchive verteilt in Ostdeutschland. Eines der bedeutendsten wurde heute vor 20 Jahren gegründet, vom ehemaligen DDR-Bürgerrechtler Christian Dietrich in Leipzig. Guten Tag, Herr Dietrich!
Christian Dietrich: Guten Tag, ich grüße Sie!
Karkowsky: Es war im Jahr 1991, gerade erst hatte man sich geeinigt: Die Stasi-Akten bleiben erhalten, Opfer des DDR-Unrechts bekommen Einblick, nichts sollte vertuscht werden. Und da haben Sie das Archiv Bürgerbewegung gegründet, quasi als Gegenentwurf zum großen Stasi-Gedächtnis. Hatten Sie kein Vertrauen damals in die für den Osten neuen demokratischen Strukturen?
Dietrich: Ja, also ich würde gerne mal vorher anfangen: Es war nicht nur einer, der das begründet hat.
Karkowsky: Klar.
Dietrich: Ich erzähle das jetzt hier, Archiv Bürgerbewegung verrät ja schon, dass die Vorstellung war: Es sind ganz viele. Und das musste institutionalisiert werden, und das ist vor 20 Jahren passiert, und deswegen feiern wir heute. Aber gesammelt wurde schon länger, und misstraut wurde den Institutionen, die die Diktatur getragen haben. Und deswegen sind wir damals in die Archive gegangen, und dort, wo die Büros waren, die die Macht hatten - ob das die SED war, die Einsatzleitung oder die Staatssicherheit. Und ich bin froh über die Menschen, die sich damals engagiert haben, die diese Hinterlassenschaft ja gesichert haben. Dort, wo das nicht passiert ist, ist die Geschichte auch schwer zu erzählen.
Karkowsky: Nun waren ja die alten Machthaber '91 nicht mehr im Amt, und trotzdem hatten Sie dieses gesunde Misstrauen und gesagt, wir überlassen das nicht den Stasi-Archiven, sondern machen es selber.
Dietrich: Genau, es musste ja gemacht werden, und das heißt, die, die damit umgegangen sind, die haben die Chance der bürgerlichen Gesellschaft genutzt, einen Verein zu gründen, der gemeinnützig anerkannt ist, und die Auswertung der Archivalien, sprich die Bildungsarbeit und das Sammeln zu vernetzen. Und so haben wir eine eigene Struktur geschaffen in Partnerschaft mit anderen Archiven, mit Vereinen, die dies tun.
Karkowsky: Nun müssen wir vielleicht erst mal erklären, was Sie da überhaupt gesammelt haben. Sie sagen, gesammelt wurde schon länger. Haben Sie irgendeine Ahnung, wann das losging und was genau in diese Sammlung reinkam?
Dietrich: Also in einer Diktatur was Schriftliches zu haben, was oppositionell widerständig ist, ist ja schon gefährlich, also Hausdurchsuchung war ja nichts Ungewöhnliches, heimliche und auch mit dem Staatsanwalt. Die Materialien, die da unterm Schreibtisch waren, die konnten dann belastend sein für Haftstrafen. Von daher - immer was schriftlich festhalten schon ein mutiger Akt.
Karkowsky: Besser alles verbrennen gleich.
Dietrich: Besser alles verbrennen, und das haben auch manche gemacht, die sich sozusagen in der Weise geschützt haben. Angst ist ja das wichtigste Kapital von Diktatoren. Die zu durchbrechen war Verschriftung, behaupte ich. Deswegen sind literarische Texte, Resolutionen, auch Eingaben oder Briefe an Institutionsträger damals wichtige Quellen für das, wie die Macht der Diktatur zerbröselt ist.
Karkowsky: An wen wurden diese Papiere damals verteilt, ohne dass die Stasi Verdacht schöpfen konnte?
Dietrich: Also es gab diese geheimen Papiere, also die geheim gehalten weitergereicht wurden, aber es gab ja auch bewusste Publikationen, wo, wenn man es schaffte, dass es rechtzeitig sozusagen vervielfältigt war, dann auch an alle Welt ging, und dafür waren ja auch die Medien, ich sage jetzt mal RIAS oder so, auch ganz wichtig. Dann kam es sozusagen dann in jedem Haushalt in der DDR wieder an.
Karkowsky: Haben Sie ein Beispiel, was das zum Beispiel gewesen sein könnte?
Dietrich: Ja, ich kenne eine ganze Menge, also eine sehr wertvolle Resolution, das ist 1986 gemacht worden mit Oppositionellen auch aus anderen Ostblockstaaten, in Erinnerung an Ungarn 1956 und der brutalen Niederschlagung dieser Freiheitsbewegung damals. Ich denke, wir haben das noch gar nicht alles erschlossen, was es da so an Initiativen gab. Die können auf ganz unterschiedliche Notlagen reagiert haben, ökologischer Art genauso wie die Entmündigung, und dass Kommunikation ja eigentlich nicht, freie Kommunikation ja sowieso nicht gewollt war.
Karkowsky: Und verbunden hat alle diese Initiativen, dass sie nicht staatlich gelenkt waren. Diese Schriften, die Sie da gesammelt haben, in welchem Zustand sind die heute?
Dietrich: Ja, also die meisten frühen Schriften, das sind Schreibmaschinenschriften, und sogar wer eine Schreibmaschine kaufte, wurde sozusagen registriert, über lange Zeit war das schon eine schwierige Aktion. Dann sind es Ormig-Abzüge, also ich habe selber so eine Maschine besessen, das sieht blau aus und irgendwann kann man es gar nicht mehr erkennen. Also die Archive sind genötigt, diese Dokumente zu kopieren, sozusagen zu restaurieren, weil man die in wenigen Jahren nicht mehr lesen kann. Die wertvollste Form der Publikation zu Zeiten bis '89, das war, mit Wachsmatrizen zu vervielfältigen, also wenn es gut kam, waren das 500 Exemplare.
Karkowsky: Christian Dietrich spricht, der ehemalige DDR-Bürgerrechtler ist Gründer des Archivs Bürgerbewegung heute vor 20 Jahren gewesen. Herr Dietrich, vieles erklärt sich aus Ihrer Biografie. Heute sind Sie Pfarrer in Nohra bei Weimar, aber schon als 17-Jähriger haben Sie sich verbotenerweise engagiert in der DDR-Opposition. Wie kam es dazu?
Dietrich: Also ich habe Glück gehabt, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die sozusagen der Lüge wenig Raum lassen wollte, der Zwiesprach, auf der einen Seite Westmedien wahrnehmen und Literatur lesen, die verboten ist, und dann in der Schule mitmachen - das war nicht der Weg meiner Eltern. Ich habe in der Weise Glück gehabt. Das hieß aber auch, dass ich am Bildungsweg sozusagen immer beschnitten worden bin, und das hat natürlich dazu geführt, sich selber zu engagieren. Und da war Kirche ein ganz wichtiger Partner für mich. Ich habe an einer kirchlichen Schule Abitur gemacht und dann Theologie studiert, und so bin ich nach Leipzig gekommen.
Karkowsky: In zwei Stunden etwa, um 17 Uhr, sitzen Sie auf einem Podium und blicken mit internationalen Kollegen zurück auf Ihre Sammlung, 20 Jahre von Selbstzeugnissen der Opposition. Nicht ohne Grund findet das im Polnischen Institut in Leipzig statt, denn Sie sind mittlerweile gut vernetzt, das Archiv ist gut vernetzt, und es fördert die Arbeit ähnlicher Archive in anderen ehemaligen Ostblockstaaten. Wie ist das denn anderswo? Geht man da genauso akribisch ran an die Aufarbeitung der Vergangenheit wie in Deutschland?
Dietrich: Also unser Gedächtnis ist glücklicherweise schon bewahrt worden, weil das Land geteilt war. Das ist für Polen viel dramatischer, und die Charta - nicht zu verwechseln mit der Charta 77 -, aus einer Zeitschrift entstanden, eine große Initiative in Polen, die für, ich denke mal, für die Demokratie Polens auch ganz wichtig war, die hat die Geschichte auch des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und sowjetische Okkupation recherchiert und das Gedächtnis der Opfer versucht zu bewahren und zu veröffentlichen. Da gibt es einen ganz langen Weg. Und wir haben damals nur den Schnitt gemacht quasi in die 80er-Jahre, und ich habe immer gesagt, die Geschichte ist viel weiter, also mir lag da viel mehr daran, auch die frühe Geschichte - einen Stalinismus-Arbeitskreis hatte ich gehabt - auch mit in den Blick zu nehmen. Das ist in Tschechien oder in Polen ganz selbstverständlich.
Karkowsky: Warum ist es denn für die ehemaligen polnischen Bürgerrechtler schwieriger, was die Bewahrung der eigenen Erzählung angeht?
Dietrich: Also schwieriger ist es, weil nicht woanders das noch gesammelt worden ist, vielleicht gab es Exilpolen in Amerika, aber die Geschichte zum Beispiel des Polens, das heute Ukraine ist, weil dieses ... Stalin-Hitler-Pakt sozusagen die Grenzen in Europa verschoben worden sind, das kann jetzt erst aufgearbeitet werden, da kann jetzt erst richtig geforscht werden. Und wir haben kaum noch Oral History, also kaum noch persönliche Erinnerungen. Ein Archiv lebt ja auch davon, dass wir die Zeugen noch befragen können und das daneben lesen können, ein Interview machen können, das auch noch in 20 Jahren das erklärt, was da der kleine Schnipsel sozusagen bedeutet.
Karkowsky: In Deutschland haben sich gleich mehrere Archive gebildet, die die Schriften und Taten der Bürgerbewegten sammeln. Arbeiten da eigentlich alle solidarisch zusammen, oder gibt es da auch Konkurrenz?
Dietrich: Also ich muss mal sagen, wir haben das Glück in Deutschland, dass das sofort der Bundestag selber auch zum Thema gemacht hat, und die erste Enquete-Kommission hat gesagt, dass diese Archive zu unterstützen sind. Das heißt, die Vernetzung ist auch getragen worden von der Öffentlichkeit. Und heute gibt es die Stiftung Aufarbeitung, die die Vernetzung auch weit über, also in Europa bis nach Russland und so weiter fördert, und ich bin der Meinung: So kann auch nur Europa gebaut werden. Also ohne dem wird das nicht gehen. Sicher gibt es auch Konkurrenzen, wenn man sozusagen aus dem selben Topf Geld haben will, dann gibt es auch Konkurrenzen, aber in Wahrheit arbeiten wir doch an demselben: die Stärkung eines demokratischen Selbstbewusstseins."
Deutschlandradio Kultur, Radiofeuilleton v. 25.5.2011
Programm zum hoffentlich dokumentierten Jubelakt:
"Auch wir feiern ein Jubiläum.
Mit dem Ende der SED-Diktatur setzte unmittelbar die wissenschaftliche Aufarbeitung der DDR-Geschichte ein. Die sich häufenden Anfragen zu den Leipziger Ereignissen veranlassten einige Oppositionelle, 1991 den Verein zu gründen.
Feiertage sind auch immer Zäsur: Rückblick und Ausblick. Aufschlussreich ist der europäische Vergleich. Gibt es eine gesamteuropäische Geschichte? Welche Rolle spielen unabhängige Archive in der Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit?
In Kooperation mit dem Polnischen Institut - Filiale Leipzig, Markt 10, laden wir am 25. Mai 2011 ein:
17.00 Uhr
Begrüßung
Uwe Schwabe, Vorstand Archiv Bürgerbewegung
Grußworte
Dr. Anna Kaminsky, Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Siegfried Reiprich, Geschäftsführer der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten
Andreas Müller, Erster Bürgermeister und Beigeordneter der Stadt Leipzig
Vortrag und Podiumsdiskussion:
Die Rolle unabhängiger Archive bei der Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen in Europa
Jan Sicha: ehem. Bürgerrechtler in der CSSR
Tytus Jaskulowski (Polen): Mitarbeiter im Hannah-Arendt-Institut Dresden
Christian Dietrich: ehem. Bürgerrechtler in der DDR
Agim Musta (Albanien): Kurator der Ausstellung "Die Gefängnisse des Gefängnis-Staates"
Moderation: Markus Pieper (BStU)
18.30 Uhr
Diskussion
19.00 Uhr
Ausstellungseröffnung in Kooperation mit dem Europahaus: "Die Gefängnisse des Gefängnis-Staates"
Fotoausstellung zu den Gefängnissen und Arbeitslagern im kommunistischen Albanien
Gefördert von der Bundesstiftung Aufarbeitung
20.00 Uhr
Lesung mit Angela Krauß (Leipzig) und Thomas Rosenlöscher (Dresden)
Moderation: Stephan Bickhardt (Polizeiseelsorger)
Die Lesung findet in Kooperation mit dem Leipziger Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung s"
Homepage ABL
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:18 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zeeuwsarchief.nl/actueel/archief-over-suriname-als-zeeuwse-kolonie-gedigitaliseerd/
Findbuch mit Links zu den PDFs:
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=GIDS102&milang=nl&mizk_alle=suriname+zeeland
Leider gibt es keine Permanentlinks:
http://goo.gl/Yt1t5
(W)
Findbuch mit Links zu den PDFs:
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=GIDS102&milang=nl&mizk_alle=suriname+zeeland
Leider gibt es keine Permanentlinks:
http://goo.gl/Yt1t5
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:17 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
glaubt man zumindestens diesem Bericht der Südwestpresse vom 27.05.2011:

Quelle: Homepge Stadt Crailsheim
"Er ist so etwas wie ein Märchenprinz. Er hat das Crailsheimer Stadtarchiv, das bis zu seinem Dienstantritt im Dornröschenschlaf lag, wachgeküsst. Seit Folker Förtsch Leiter des Stadtarchivs ist, ist es ein lebendiger, ein manchmal geradezu quirliger Ort der Forschung und Begegnung.
Wie viel sich seit 1997, also seit dem Dienstantritt des 1963 in Bamberg geborenen Historikers, der Geschichte und Germanistik in Erlangen-Nürnberg, Bamberg und Stuttgart studiert hat und seit 1989 mit seiner Familie in Schwäbisch Hall lebt, verändert hat, lässt sich mit Zahlen belegen. Waren es 1997 gerade mal um die 100 Menschen, die das Stadtarchiv nutzten, sind es inzwischen mehr als 1000 im Jahr.
Aber es sind gar nicht so sehr die Zahlen, die den Wert der Arbeit von Folker Förtsch belegen, es ist vielmehr das lebendige Miteinander von Archiv und Bürgerschaft. Archiv - da fallen einem immer noch solche Bilder ein: ein mürrisch dreinblickender, in riesige Stapel verstaubter Archivalien "eingemauerter" Archivar mit Ärmelschonern, der jeden Anruf, jeden Besuch als Störung empfindet.
Ganz anders Folker Förtsch. Den kann man immer besuchen, jederzeit was fragen. Auch wenn er noch so viel Arbeit hat, nimmt er sich Zeit, sucht nach der gewünschten Information. Wie hoch ist der Crailsheimer Rathausturm, wie hieß nochmal der erste Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg, wie lange schon gibt es das Fränkische Volksfest? Eine schnelle Antwort bleibt er selten schuldig.
Was diesen Stadtarchivar zu einem bewundernswerten Phänomen macht, ist die Tatsache, dass er bis heute Einzelkämpfer ist. Keine Sekretärin, keinen Mitarbeiter, keine Hilfskraft, niemand. Auf dem Rathaus sollte eigentlich inzwischen bekannt sein, wie wichtig dieser Mann für die Stadt ist, deren Geschichte bis zu seinem Amtsantritt nicht systematisch und auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügend erforscht worden ist. Mit dem Umbau des Rathaus-Querbaus bekommt das Stadtarchiv ein neues Domizil. Das Geld sollte eigentlich schon auch noch zur Aufstockung des Archiv-Stellenplans reichen.
Folker Förtsch forscht und publiziert, gibt Bücher heraus, hält Vorträge, leitet Führungen, organisiert Tagungen und Exkursionen, macht Filme und Ausstellungen. Er ist ein Macher und Beweger, ein Kümmerer und Motivator, ein Historiker und Archivar, von dessen Arbeit die Allgemeinheit ungemein profitiert. "Prinz" Förtsch ist ein Glücksfall für die Stadt Crailsheim. Weiß sie das überhaupt? Andreas Harthan"
(T)

Quelle: Homepge Stadt Crailsheim
"Er ist so etwas wie ein Märchenprinz. Er hat das Crailsheimer Stadtarchiv, das bis zu seinem Dienstantritt im Dornröschenschlaf lag, wachgeküsst. Seit Folker Förtsch Leiter des Stadtarchivs ist, ist es ein lebendiger, ein manchmal geradezu quirliger Ort der Forschung und Begegnung.
Wie viel sich seit 1997, also seit dem Dienstantritt des 1963 in Bamberg geborenen Historikers, der Geschichte und Germanistik in Erlangen-Nürnberg, Bamberg und Stuttgart studiert hat und seit 1989 mit seiner Familie in Schwäbisch Hall lebt, verändert hat, lässt sich mit Zahlen belegen. Waren es 1997 gerade mal um die 100 Menschen, die das Stadtarchiv nutzten, sind es inzwischen mehr als 1000 im Jahr.
Aber es sind gar nicht so sehr die Zahlen, die den Wert der Arbeit von Folker Förtsch belegen, es ist vielmehr das lebendige Miteinander von Archiv und Bürgerschaft. Archiv - da fallen einem immer noch solche Bilder ein: ein mürrisch dreinblickender, in riesige Stapel verstaubter Archivalien "eingemauerter" Archivar mit Ärmelschonern, der jeden Anruf, jeden Besuch als Störung empfindet.
Ganz anders Folker Förtsch. Den kann man immer besuchen, jederzeit was fragen. Auch wenn er noch so viel Arbeit hat, nimmt er sich Zeit, sucht nach der gewünschten Information. Wie hoch ist der Crailsheimer Rathausturm, wie hieß nochmal der erste Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg, wie lange schon gibt es das Fränkische Volksfest? Eine schnelle Antwort bleibt er selten schuldig.
Was diesen Stadtarchivar zu einem bewundernswerten Phänomen macht, ist die Tatsache, dass er bis heute Einzelkämpfer ist. Keine Sekretärin, keinen Mitarbeiter, keine Hilfskraft, niemand. Auf dem Rathaus sollte eigentlich inzwischen bekannt sein, wie wichtig dieser Mann für die Stadt ist, deren Geschichte bis zu seinem Amtsantritt nicht systematisch und auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügend erforscht worden ist. Mit dem Umbau des Rathaus-Querbaus bekommt das Stadtarchiv ein neues Domizil. Das Geld sollte eigentlich schon auch noch zur Aufstockung des Archiv-Stellenplans reichen.
Folker Förtsch forscht und publiziert, gibt Bücher heraus, hält Vorträge, leitet Führungen, organisiert Tagungen und Exkursionen, macht Filme und Ausstellungen. Er ist ein Macher und Beweger, ein Kümmerer und Motivator, ein Historiker und Archivar, von dessen Arbeit die Allgemeinheit ungemein profitiert. "Prinz" Förtsch ist ein Glücksfall für die Stadt Crailsheim. Weiß sie das überhaupt? Andreas Harthan"
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:08 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/collecties/iconographia_zoologica
De prentenverzameling van de Artis Bibliotheek is de honderdste collectie die in het kader van het nationale digitaliseringsprogramma Het Geheugen van Nederland is gedigitaliseerd. De collectie betreft prenten van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen uit de Iconographia Zoologica van de Artis Bibliotheek, die een onderdeel is van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
Via http://goo.gl/vVpNz = www.bibliotheekblad.nl/
(W)

De prentenverzameling van de Artis Bibliotheek is de honderdste collectie die in het kader van het nationale digitaliseringsprogramma Het Geheugen van Nederland is gedigitaliseerd. De collectie betreft prenten van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen uit de Iconographia Zoologica van de Artis Bibliotheek, die een onderdeel is van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
Via http://goo.gl/vVpNz = www.bibliotheekblad.nl/
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:03 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das documenta Archiv feiert am 28. Mai sein 50-jähriges Bestehen.
Für die Festveranstaltung im Schauspielhaus konnten wir die international renommierte documenta-Künstlerin Laurie Anderson (documenta 6 und 8, 1977 und 1987) gewinnen, sie wird ihre neueste Produktion "DELUSION" präsentieren. Laurie Anderson war wegweisend für den Musikbereich, aber auch für die gängigen Grenzen sprengende "Video-Performance-Kunst" der 70-er und 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Spätestens 1981 ist Laurie Anderson durch "O Superman" für ihren innovativen Einsatz von Computertechnik und neuen Medien, besonders aber für ihre "elektronische Violine" bekannt geworden.
Die Performance "DELUSION" wird von ihr als eine Meditation über Leben und Sprache angekündigt und entwickelt sich aus unterschiedlichen Welten und Ebenen: Technik, Wissenschaft, Traum und verschiedenen Bewusstseinszuständen. Die darin erzählten Geschichten bewegen sich zwischen mystischen Anfängen und russischem Weltraumprogramm und erzählen von Zeit, Geschwindigkeit, Ahnen, Kontrolle, Stille und Tieren.
Neben diesen zwei Veranstaltungen - am 28. und 29. Mai im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel - wird die Künstlerin auch an der Tagung "Video- und Performancekunst, Laurie Anderson eine Pionierin" in der nahegelegenen Ev. Akademie Hofgeismar beteiligt sein (27.-29.05.2011). Im Vorfeld dazu werden am 26.05.2011 frühe Videos von ihr in den BALi Kinos, Kassel gezeigt.
Hintergrund für diese Form des Jubiläumsprogramms ist auch der Abschluss des Digitalisierungsprojektes "mediaartbase.de", das von den Kulturstiftungen des Bundes und der Länder initiiert wurde. Im Rahmen dieses 3-jährigen, gemeinsam mit dem Kasseler DOKFEST, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe und dem European Media Art Festival (EMAF), Osnabrück durchgeführten Pilotprojekts sind jetzt die seltenen, sehr gefährdeten Bestände dieser Institutionen digitalisiert worden.
Dazu gehören aus Kassel insbesondere documenta-Beiträge, die die Video- und Performancekunst der 70-er und 80-er Jahre zeigen sowie die zahlreichen Fernsehmitschnitte des Hessischen Rundfunks. Das Kasseler Dokfest hat in diesem Rahmen die Beiträge des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes erfasst.
26.05.2011: Filmreihe zu Laurie Anderson
BALiKino, Eintrittspreis: 6 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.
Spielzeiten werden noch bekanntgegeben
27. - 29.05.2011: Tagung "Video- und PerformanceKunst Laurie Anderson eine Pionierin"
Evangelische Akademie Hofgeismar
Leitung: Karin Stengel, Kassel und Dr. Heike Radeck, Hofgeismar
Tagungsbeitrag: 80 € (zuzüglich Eintrittskarte für 20 €)
28.05.2011:
18:00 Uhr Jubiläumsfeier Staatstheater (Schauspielhaus)
19.00 Uhr Empfang
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
29.05.2011:
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
Kartenvorverkauf im Staatstheater Kassel: 0561/1094-333
Preisstaffelung: 16 €, 28 €, 35 € und 45 € "
documenta Archiv, Aktuelles
(T)
Für die Festveranstaltung im Schauspielhaus konnten wir die international renommierte documenta-Künstlerin Laurie Anderson (documenta 6 und 8, 1977 und 1987) gewinnen, sie wird ihre neueste Produktion "DELUSION" präsentieren. Laurie Anderson war wegweisend für den Musikbereich, aber auch für die gängigen Grenzen sprengende "Video-Performance-Kunst" der 70-er und 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Spätestens 1981 ist Laurie Anderson durch "O Superman" für ihren innovativen Einsatz von Computertechnik und neuen Medien, besonders aber für ihre "elektronische Violine" bekannt geworden.
Die Performance "DELUSION" wird von ihr als eine Meditation über Leben und Sprache angekündigt und entwickelt sich aus unterschiedlichen Welten und Ebenen: Technik, Wissenschaft, Traum und verschiedenen Bewusstseinszuständen. Die darin erzählten Geschichten bewegen sich zwischen mystischen Anfängen und russischem Weltraumprogramm und erzählen von Zeit, Geschwindigkeit, Ahnen, Kontrolle, Stille und Tieren.
Neben diesen zwei Veranstaltungen - am 28. und 29. Mai im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel - wird die Künstlerin auch an der Tagung "Video- und Performancekunst, Laurie Anderson eine Pionierin" in der nahegelegenen Ev. Akademie Hofgeismar beteiligt sein (27.-29.05.2011). Im Vorfeld dazu werden am 26.05.2011 frühe Videos von ihr in den BALi Kinos, Kassel gezeigt.
Hintergrund für diese Form des Jubiläumsprogramms ist auch der Abschluss des Digitalisierungsprojektes "mediaartbase.de", das von den Kulturstiftungen des Bundes und der Länder initiiert wurde. Im Rahmen dieses 3-jährigen, gemeinsam mit dem Kasseler DOKFEST, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe und dem European Media Art Festival (EMAF), Osnabrück durchgeführten Pilotprojekts sind jetzt die seltenen, sehr gefährdeten Bestände dieser Institutionen digitalisiert worden.
Dazu gehören aus Kassel insbesondere documenta-Beiträge, die die Video- und Performancekunst der 70-er und 80-er Jahre zeigen sowie die zahlreichen Fernsehmitschnitte des Hessischen Rundfunks. Das Kasseler Dokfest hat in diesem Rahmen die Beiträge des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes erfasst.
26.05.2011: Filmreihe zu Laurie Anderson
BALiKino, Eintrittspreis: 6 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.
Spielzeiten werden noch bekanntgegeben
27. - 29.05.2011: Tagung "Video- und PerformanceKunst Laurie Anderson eine Pionierin"
Evangelische Akademie Hofgeismar
Leitung: Karin Stengel, Kassel und Dr. Heike Radeck, Hofgeismar
Tagungsbeitrag: 80 € (zuzüglich Eintrittskarte für 20 €)
28.05.2011:
18:00 Uhr Jubiläumsfeier Staatstheater (Schauspielhaus)
19.00 Uhr Empfang
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
29.05.2011:
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
Kartenvorverkauf im Staatstheater Kassel: 0561/1094-333
Preisstaffelung: 16 €, 28 €, 35 € und 45 € "
documenta Archiv, Aktuelles
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Salzburg, Landesarchiv
17. Mai 2011 - 8. Juli 2011
"Am Dienstag, 17. Mai, wird um 9.00 Uhr Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller im Salzburger Landesarchiv, Michael-Pacher-Straße 40, die Ausstellung "Von der Handbuchbinderei zum HighTech-Labor. 70 Jahre Buchbinderei im Salzburger Landesarchiv" eröffnen. Bei dieser öffentlichen Veranstaltung wird auch das gleichnamige Buch von Nikolaus Pfeifer, dem Leiter der Restaurierwerkstätte des Landesarchivs, präsentiert.
Diese Publikation befasst sich nicht nur mit der Geschichte der Buchbinderei und der Restaurierwerkstätte im Salzburger Landesarchiv, sondern es ist viel mehr ein Handbuch für die Restaurierung und Lagerung historischer Quellen. Dieses Handbuch ist damit eine weitere Maßnahme innerhalb des langfristiges Schwerpunktes des Salzburger Landesarchivs, Gemeindearchive und deren Errichtung zu fördern, erklärte der Leiter des Landesarchivs, Dr. Oskar Dohle.
Veranstaltungsort
Salzburger Landesarchiv
5020 Salzburg
Michael-Pacher-Straße 40
Veranstalter
Salzburger Landesarchiv
Michael-Pacher-Straße 40
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 8042-4527
landesarchiv@salzburg.gv.at"
Quelle: Salzburger Museen, Termine
Katalog:

"Nikolaus Pfeiffer: Von der Handbuchbinderei zum HighTech Labor
Nikolaus Pfeifer, leitender Restaurator im Salzburger Landesarchiv, hat im seinem Buch auf rund 240 Seiten die unschätzbare Erfahrung seines langen Berufslebens zu Papier gebracht. Das Buch ist aber ist nicht nur Geschichte der Buchbinderei im Salzburger Landesarchiv sowie eine Beschreibung der verschiedenen Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder in den Werkstätten. Es ist viel mehr ein Handbuch, das die wichtigsten Parameter und Richtlinien zur dauerhaften Archivierung historischer Quellen enthält, da gerade die Unterschiedlichkeit der verwendeten Materialien große Anforderungen an Erhaltung und sachgerechte Restaurierung stellen. Es bietet somit für Gemeindarchive und lokale Museen eine wertvolle Hilfestellung, damit dort mit vergleichsweise geringem Aufwand möglichst optimale Lagerungsbedingungen hergestellt werden können.
Das Buch ist somit ein weiterer Schritt im Zuge des langfristigen Schwerpunktes "Förderung der Gemeindearchive" durch das Salzburger Landesarchiv. "
salzburg.at, Service
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 16:51 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.reekx.nl/weblog/google-heeft-nu-15-miljoen-boeken-gedigitaliseerd/
Van die 15 miljoen gedigitaliseerde boeken zijn er circa 168.000 Nederlandse boeken, 746 Friese boeken en 168 uitgaven in het Middelnederlands. Volgens Jon Orwant, engineering manager bij Google books, is nu gemiddeld 10% van alle ooit gepubliceerde boeken verwerkt. [...] In samenwerking met grote Europese bibliotheken zijn nu volgens Google ca. 150.000 boeken uit de 16e en 17e eeuw gedigitaliseerd en ca. 450.000 uit de 18e eeuw.
(W)
Van die 15 miljoen gedigitaliseerde boeken zijn er circa 168.000 Nederlandse boeken, 746 Friese boeken en 168 uitgaven in het Middelnederlands. Volgens Jon Orwant, engineering manager bij Google books, is nu gemiddeld 10% van alle ooit gepubliceerde boeken verwerkt. [...] In samenwerking met grote Europese bibliotheken zijn nu volgens Google ca. 150.000 boeken uit de 16e en 17e eeuw gedigitaliseerd en ca. 450.000 uit de 18e eeuw.
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 16:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die niederländische Rundfunkmusikbibliothek hat zahlreiche Notendrucke online gestellt:
http://www.muziekschatten.nl/
Via
http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8619-muziekbibliotheek-van-de-omroep-zet-bladmuziek-online.html
(W)

http://www.muziekschatten.nl/
Via
http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8619-muziekbibliotheek-van-de-omroep-zet-bladmuziek-online.html
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 16:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 16:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wolfgangmichal.de/?p=504
Wolfgang Michal kommentiert die Aussagen von Kulturstaatsminister Neumann. Dieser sagte:
Für eine Neuformulierung des Schutzzwecks des Urheberrechts zugunsten der Nutzer besteht kein Anlass. Freier Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken kann im digitalen Zeitalter nicht auf Kosten der Kreativen erfolgen, indem das Urheberrecht in ein Verbraucherrecht umgedeutet wird.
Michal:
Das Urheberrecht soll also um Gottes willen kein Verbraucherrecht werden, sondern Verwerterrecht bleiben. Denn eine Ausdehnung der Nutzerrechte würde logischerweise zu einer Einschränkung der Verwerterrechte führen. Das ist der zentrale Konflikt bei der aktuellen Debatte ums Urheberrecht. Um die Urheber geht es am allerwenigsten.
(T)
Wolfgang Michal kommentiert die Aussagen von Kulturstaatsminister Neumann. Dieser sagte:
Für eine Neuformulierung des Schutzzwecks des Urheberrechts zugunsten der Nutzer besteht kein Anlass. Freier Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken kann im digitalen Zeitalter nicht auf Kosten der Kreativen erfolgen, indem das Urheberrecht in ein Verbraucherrecht umgedeutet wird.
Michal:
Das Urheberrecht soll also um Gottes willen kein Verbraucherrecht werden, sondern Verwerterrecht bleiben. Denn eine Ausdehnung der Nutzerrechte würde logischerweise zu einer Einschränkung der Verwerterrechte führen. Das ist der zentrale Konflikt bei der aktuellen Debatte ums Urheberrecht. Um die Urheber geht es am allerwenigsten.
(T)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 15:22 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.hist.net/archives/5451
Plagiatoren treiben nicht nur in der Wissenschaft ihr Unwesen, sondern seit eh und je auch in den Medien. Eine besonders unappetitliche Geschichte macht seit einigen Tagen in der Schweizerischen Medienszene die Runde: Letzte Woche erhielt der aus Basel stammende Jung-Journalist Maurice Thiriet, beim einstmals renommierten Tages-Anzeiger (Zürich) zuständig für «Medien, Drogen, Prostitution, Glücksspiel» den Zürcher Journalistenpreis.
Allerdings hat er die Geschichte, für die er Lob und Auszeichnung erhielt, nicht selber aufgedeckt – wie er es im bepreisten Artikel dargestellt hat – sondern im Blog des Wissenschaftsjournalisten Patrik Tschudin abgeschrieben.
Siehe auch
http://medienwoche.ch/2011/05/28/zum-dank-ins-gesicht-gespuckt/
http://blogdessennamenmansichnichtmerkenkann.wordpress.com/2011/05/26/infamously-famousmauricethiriet/
http://infam.antville.org/stories/2063245/
http://archiv.twoday.net/stories/18133371/
Kommentar: Im Gewerblichen Rechtsschutz gilt das Prinzip der "Nachahmungsfreiheit". Klaut jemand legalerweise ein nicht geschütztes Produktdesign, erwartet niemand, dass er die Quelle seiner Inspiration benennt. In der Wissenschaft und im Journalismus ist das anders: Entscheidende Quellen nicht zu nennen, ist zutiefst unredlich. Und wenn ein Printjournalist einen Blogger in schofler Weise behandelt (siehe dazu die verlinkten Quellen), dann ist obige Überschrift, die ich weblog.hist.net entnahm, mehr als gerechtfertigt.
(RSS)
Update:
http://www.sueddeutsche.de/medien/ex-handelsblatt-online-chefredakteur-raeumt-plagiate-ein-wie-guttenberg-1.1102710
Der Journalist Sven Scheffler hat abgeschrieben, und zwar massiv.

Plagiatoren treiben nicht nur in der Wissenschaft ihr Unwesen, sondern seit eh und je auch in den Medien. Eine besonders unappetitliche Geschichte macht seit einigen Tagen in der Schweizerischen Medienszene die Runde: Letzte Woche erhielt der aus Basel stammende Jung-Journalist Maurice Thiriet, beim einstmals renommierten Tages-Anzeiger (Zürich) zuständig für «Medien, Drogen, Prostitution, Glücksspiel» den Zürcher Journalistenpreis.
Allerdings hat er die Geschichte, für die er Lob und Auszeichnung erhielt, nicht selber aufgedeckt – wie er es im bepreisten Artikel dargestellt hat – sondern im Blog des Wissenschaftsjournalisten Patrik Tschudin abgeschrieben.
Siehe auch
http://medienwoche.ch/2011/05/28/zum-dank-ins-gesicht-gespuckt/
http://blogdessennamenmansichnichtmerkenkann.wordpress.com/2011/05/26/infamously-famousmauricethiriet/
http://infam.antville.org/stories/2063245/
http://archiv.twoday.net/stories/18133371/
Kommentar: Im Gewerblichen Rechtsschutz gilt das Prinzip der "Nachahmungsfreiheit". Klaut jemand legalerweise ein nicht geschütztes Produktdesign, erwartet niemand, dass er die Quelle seiner Inspiration benennt. In der Wissenschaft und im Journalismus ist das anders: Entscheidende Quellen nicht zu nennen, ist zutiefst unredlich. Und wenn ein Printjournalist einen Blogger in schofler Weise behandelt (siehe dazu die verlinkten Quellen), dann ist obige Überschrift, die ich weblog.hist.net entnahm, mehr als gerechtfertigt.
(RSS)
Update:
http://www.sueddeutsche.de/medien/ex-handelsblatt-online-chefredakteur-raeumt-plagiate-ein-wie-guttenberg-1.1102710
Der Journalist Sven Scheffler hat abgeschrieben, und zwar massiv.

KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 15:06 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das bibliothekarische Weblog gibt es schon seit Februar:
http://www.biblionline.ch/
Dort findet sich ein interessanter Hinweis auf den Schweizer Verbundkatalog Handschriften - Archive - Nachlässe (HAN)
http://aleph.unibas.ch/F?con_lng=GER&func=file&local_base=DSV05&file_name=verbund-han
Die 9 Verbundpartner unter Führung der UB Basel:
http://www.ub.unibas.ch/bibliotheksnetz/verbund-han/handschriften-archive-nachlaesse/verbundpartner/
(RSS)
http://www.biblionline.ch/
Dort findet sich ein interessanter Hinweis auf den Schweizer Verbundkatalog Handschriften - Archive - Nachlässe (HAN)
http://aleph.unibas.ch/F?con_lng=GER&func=file&local_base=DSV05&file_name=verbund-han
Die 9 Verbundpartner unter Führung der UB Basel:
http://www.ub.unibas.ch/bibliotheksnetz/verbund-han/handschriften-archive-nachlaesse/verbundpartner/
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.burghauptmannschaft.at/php/detail.php?ukatnr=12171&artnr=7091
"Die erste urkundliche Erwähnung eines Burggrafen (Michael von Maidburg) stammt aus dem Jahr 1434, die Bezeichnung Burghauptmann wird das erste Mal 1443 verwendet. Bis ins Jahr 1793 wurden Burggrafen bestellt. Da Franz I. (1768-1835) keinen Burggrafen bestellte, wurden die Aufgaben ab 1793 von einem Burginspektor übernommen. Mit der unter Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916) durchgeführten Reform der Hofdienste (1849) wurde die Hofburginspektion in Burghauptmannschaft umbenannt."
Burginspektor klingt doch weit moderner als Burghauptmann - war die Rückkehr zur alten Bezeichnung ein spätromantisches Archaisieren?
Via http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14387
Achja: Im früheren Hofkammerarchiv in der Johannesgasse will die Öst. Nationalbibliothek bis 2015 ein Literaturmuseum einrichten.
(RSS)
"Die erste urkundliche Erwähnung eines Burggrafen (Michael von Maidburg) stammt aus dem Jahr 1434, die Bezeichnung Burghauptmann wird das erste Mal 1443 verwendet. Bis ins Jahr 1793 wurden Burggrafen bestellt. Da Franz I. (1768-1835) keinen Burggrafen bestellte, wurden die Aufgaben ab 1793 von einem Burginspektor übernommen. Mit der unter Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916) durchgeführten Reform der Hofdienste (1849) wurde die Hofburginspektion in Burghauptmannschaft umbenannt."
Burginspektor klingt doch weit moderner als Burghauptmann - war die Rückkehr zur alten Bezeichnung ein spätromantisches Archaisieren?
Via http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14387
Achja: Im früheren Hofkammerarchiv in der Johannesgasse will die Öst. Nationalbibliothek bis 2015 ein Literaturmuseum einrichten.
(RSS)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 14:35 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.menschenschreibengeschichte.at/
Menschen Schreiben Geschichte ist ein von der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien konzipiertes interaktives Erinnerungsalbum, das dazu aufruft, lebensgeschichtliche Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Q: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/19441176/
(RSS)
Menschen Schreiben Geschichte ist ein von der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien konzipiertes interaktives Erinnerungsalbum, das dazu aufruft, lebensgeschichtliche Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Q: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/19441176/
(RSS)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 14:12 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"The Secret in the Cellar": Spannender Webcomic zum Thema ARCHÄOLOGIE vom Smithsonian National Museum of Natural History:
http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/XPlayer.html
(F)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:41 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(© Die Informationsgesellschaft mbH; Kunsthalle Bremen)
Als erstes Museum in Deutschland bringt die Kunsthalle Bremen im Sommer 2011 ein Computerspiel für Kinder heraus, das Kunst spielerisch vermittelt. In Kooperation mit GEOlino hatten die Leserinnen und Leser des Kindermagazins im Januar die Möglichkeit, das Spiel online zu testen und ihre Meinungen und Ideen einzubringen!

(© Die Informationsgesellschaft mbH; Kunsthalle Bremen)
"Das Spiel führt in eine magische Welt voller Bildwerke aus der Kunsthalle. Dort geht es dann auf eine abenteuerliche Suche nach Hinweisen und Gegenständen, mit denen sich die Kunstwerke spielerisch entdecken lassen.
Über das Computerspiel sollen Phantasie und Emotionen von Kindern ab acht Jahren angesprochen werden und somit ein unbeschwerter erster Kontakt mit Kunst entstehen.
230 Kinder aus ganz Deutschland haben das Computerspiel getestet. Sie bewerteten Schwierigkeitsgrad, Design und Logik und zeigten Verbesserungsmöglichkeiten auf. Fünf Kinder wurden unter den TeilnehmerInnen als Gewinner gekürt und besuchten die Entwickler, um im Rahmen eines Workshops ihre Ideen einzubringen."

Jan Jedding (Informationsgesellschaft mbH, Mitentwickler des Computerspiels für die Kunsthalle Bremen) erläutert den Kindern wie die Bildwelten im Spiel miteinander in Beziehung stehen (von links nach rechts): Erik (13 Jahre/Niedersachsen), Fabian Steffen (11 Jahre/Baden-Württemberg), Daniela (12 Jahre/Schleswig-Holstein), Isabel (13 Jahre/Bayern) und Lea (11 Jahre/Niedersachsen) / Foto: Karen Blindow
Quelle: Kunsthalle Bremen, Aktuelles
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:30 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:27 - Rubrik: Bestandserhaltung
Diese Frage beantwortet G.G. Wagner, Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, Berlin, Deutschland, auf dem Biliothekstag 2011 in Berlin.
Abstract: "Die Archivierung und vor allem der komfortable Zugang zu Forschungs-Daten war jahrzehntelang eine vernachlässigte Aufgabe im weltweiten Wissenschaftsbetrieb. Nur in wenigen Fachdisziplinen gibt es eine Archivierungs-Tradition, so insbesondere in den Sozialwissenschaften (wo auch die amtliche Statistik eine große Rolle spielt!) und z. B. in der Astronomie.
Da die Re-Analyse von Forschungs-Daten immer mehr in den Mittelpunkt der Planung von Forschungs-Infrastruktur gerät, muss die Frage beantwortet werden, wie und wo die Archivierung von Forschungsdaten und der Zugang zu den Archiv-Beständen organisiert wird.
Der Beitrag argumentiert, dass Bibliotheken im Prinzip ideale Organisationen für den benutzerfreundlichen Zugang zu Forschungsdaten sind. Dabei muss unterschieden werden in (1) die Organisation der Nutzung der Bestände und (2) die Archivierung selbst, bei der zu unterscheiden ist in die Langzeit-Archivierung von Datenbeständen, die sich nicht mehr ändern, und Datenbestände, die noch (permanent) wachsen und sich verändern.
Der Beitrag stellt die persönliche Meinung des Vortragenden dar."
Link
(W)
Abstract: "Die Archivierung und vor allem der komfortable Zugang zu Forschungs-Daten war jahrzehntelang eine vernachlässigte Aufgabe im weltweiten Wissenschaftsbetrieb. Nur in wenigen Fachdisziplinen gibt es eine Archivierungs-Tradition, so insbesondere in den Sozialwissenschaften (wo auch die amtliche Statistik eine große Rolle spielt!) und z. B. in der Astronomie.
Da die Re-Analyse von Forschungs-Daten immer mehr in den Mittelpunkt der Planung von Forschungs-Infrastruktur gerät, muss die Frage beantwortet werden, wie und wo die Archivierung von Forschungsdaten und der Zugang zu den Archiv-Beständen organisiert wird.
Der Beitrag argumentiert, dass Bibliotheken im Prinzip ideale Organisationen für den benutzerfreundlichen Zugang zu Forschungsdaten sind. Dabei muss unterschieden werden in (1) die Organisation der Nutzung der Bestände und (2) die Archivierung selbst, bei der zu unterscheiden ist in die Langzeit-Archivierung von Datenbeständen, die sich nicht mehr ändern, und Datenbestände, die noch (permanent) wachsen und sich verändern.
Der Beitrag stellt die persönliche Meinung des Vortragenden dar."
Link
(W)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:21 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://jungle-world.com/artikel/2011/21/43262.html
Karsten Kühnel behauptet auf Facebook (zulassungspflichtige Gruppe "Archivfragen"), der Artikel sei ein bösartiges Pamphlet. Nach den Beiträgen zum ITS Arolsen in Archivalia (das zitiert wird) insbesondere von Herrn Bremberger
http://archiv.twoday.net/search?q=arolsen
muss ich das zurückweisen. Seit 24. Mai liegt die Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/058/1705826.pdf
vor. Sie ist zwar nicht online einsehbar, liegt mir jedoch vor.
[Update: http://www.ulla-jelpke.de/uploads/KA_17-5862_ITS_vorab.pdf ]
Die Eigenschaft des ITS-Archivs als absurdes Geheimarchiv geht sehr schön aus der Antwort auf die erste Frage nach den Mitgliedern des Internationalen Ausschusses hervor, deren Namen geheimgehalten werden. Dass eine schriftliche Anfrage in 4-6 Wochen beantwortet wird, ist für die Bundesregierung eine "gute Arbeitsbedingung". Der Internationale Ausschuss werde das Anliegen des Beschwerdeführers (also von Herrn Bremberger) zur Kenntnis erhalten, sei aber keine Beschwerdeinstanz für die Entscheidung von Einzelfällen.
Da Kühnel auf Facebook dem Artikel vorwirft, mein Zitat aus dem Zusammenhang zu reißen, dokumentiere ich den Beitrag vom 1.12.2010 samt Diskussion als Ganzes:
http://archiv.twoday.net/stories/11430012/#11442427
Internationaler Suchdienst Arolsen stellt vier Findbücher ins Netz
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=4569&cHash=22e28073b1
Via Archivliste
Die Findbücher sind einsehbar unter:
http://www.its-arolsen.org/de/das_archiv/findbuecher/index.html
Der ITS ist keine Behörde, er nimmt für sich in Anspruch, nach Willkür Entscheidungen über den dauerhaften Ausschluss von benutzern zu treffen: "Demjenigen, der sich laut innerstaatlichem oder internationalem Recht des Missbrauchs von Daten schuldig macht, die er vom Internationalen Suchdienst erhalten hat, kann der Direktor des Internationalen Suchdienstes den weiteren Zugang zu den Archiven und Unterlagen nach freiem Ermessen verweigern." Das deutsche Verwaltungsrecht kennt kein freies Ermessen. Freies Ermessen bedeutet nichts anderes als Willkür, vermutlich ohne Möglichkeit eines Rechtsschutzes.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:51 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Karsten Kühnel (Gast) meinte am 2010/12/06 23:34:
ITS ist Institution nach internationalem Recht (kein "Privatarchiv")
Der ITS ist eine Institution unter der Leitung der Regierungen von 11 Staaten, die hierzu einen Internationalen Ausschuss für den ITS eingerichtet habenff. Das Handeln des ITS fußt somit auf internationalem Vertragsrecht. Die Nutzungsbedingungen des Archivguts des ITS sind durch gemeinsamen Beschluss von diplomatischen Vertretern dieser 11 Regierungen (darunter auch Deutschland) festgelegt. Darin ist die Pflicht festgelegt, die Archivalien bzw. deren digitale Kopien nach Maßgabe des jeweiligen innerstaatlichen Rechts des Landes, in dem sich die verwahrende Institution befindet, bereitzustellen. Jeder Nutzer verpflichtet sich vor Beginn der Archivaliennutzung in Bad Arolsen zur Anerkennung und Einhaltung dieser Regeln. Die Nichtbeachtung kann ein Ausschlusskriterium für eine künftige Archivnutzung sein. Der ITS hat hier einen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum nötig, schließlich hat er es im Kreis seiner potentiellen Nutzer nicht nur mit seriösen Forschern, sondern auch mit der Brisanz von Nutzungsversuchen durch Holocaustleugner zu tun. Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den Internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren.
Der ITS ist keine deutsche Einrichtung. Das deutsche Verwaltungsrecht findet auf das Archivwesen des ITS somit keine Anwendung. Der ITS nimmt auch nicht für sich in Anspruch, eine nationale Behörde zu sein.
Zur Zugänglichkeit und den nutzungsrechtlichen Hintergründen (bereits auf der Grundlage des Entwurfs der Neufassung der Verträge über den ITS) wird der Interessierte in der kommenden Ausgabe der "Archiefkunde" des flämischen Archivarsverbands einen Beitrag über den ITS finden, der in leicht gekürzter Fassung als Referat auf dem Programm der internationalen Archivtagung "Archives without Borders / Archivos sin Fronteras" im vergangenen Sommer in Den Haag vorgetragen wurde (Bericht s. "Archivar" 4/2010).
Karsten Kühnel
KlausGraf antwortete am 2010/12/07 00:46:
Es bleibt dabei
Rechtsstaatliche Standards sind ja in der Diplomatie, wie man spätestens seit Wikileaks weiß, wenig verbreitet.
Und was nicht online ist, nehme ich in der Regel auch dann nicht wahr, wenn es in einem so bekannten Fachorgan wie der "Archiefkunde" abgedruckt wird.
Im übrigen mag ich es nicht, wenn solche Informationen nur der beschränkten Öffentlichkeit (Achtung: Wortspiel) der Archivliste zugänglich gemacht werden, nicht aber Archivalia. Nach deutschem Recht wäre eine Gleichbehandlung von Archivalia vielleicht durchzusetzen, nach ihrer Phantasie-KriegsRechtsgrundlage ganz sicher nicht.
"Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den Internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren." Man kann [sich, nachträglich ergänzt, KG] auch mit Eingaben an den Heiligen Stuhl wenden, vielleicht ist da die Erfolgquote höher.
Halten wir fest: Es gibt keinen Rechtsschutz gegen willkürliche Fehlentscheidungen des ITS-Archivs. Das ist mit der Rechtsschutzgewährung des deutschen Grundgesetzes auch bei einem internationalen Archiv nicht zu vereinbaren. Es kann nicht sein, dass man innerstaatlich wegen einem Cent einen Verwaltungsprozess führen kann, gegen die Willkür der ITS-Archivare aber nichts in der Hand hat.
Der Beschwerdeführer möchte gern die für seine Arbeit wichtigen Ordner (Akteneinheiten) in Form von Kopien auswerten, ein in deutschen Staatsarchiven absolut legitimes Verlangen. Es ging nie um ganze Bestände, aber auch bei ganzen Beständen hätte ich gern eine schlüssige Begründung, wieso die Abgabe einer Kopie verboten werden muss.
Und eine Unverschämtheit ist die Andeutung der Bundesregierung, es sei nicht belegt, "inwieweit der Inhalt dieser Ablichtung in konkrete wissenschaftliche Arbeiten einfließen wird". Bremberger ist einer der profiliertesten Zwangsarbeit-Forscher überhaupt:
http://www.zwangsarbeit-forschung.de/
Es geht ein Archiv nicht das geringste an, in welcher Weise und in welchem Umfang Archivgut in konkrete wissenschaftliche Veröffentlichungen einfließt. Über das Ob und Wie von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu entscheiden, ist aufgrund der Forschungsfreiheit des Art. 5 GG, den die Bundesregierung wohl übersieht, einzig und allein Sache des Forschers.
Ich stehe voll und ganz auf der Seite von Herrn Bremberger, während auf Facebook ganz sicher das kollegiale Krähen-Motto zum Tragen kommen dürfte.
(F)
Karsten Kühnel behauptet auf Facebook (zulassungspflichtige Gruppe "Archivfragen"), der Artikel sei ein bösartiges Pamphlet. Nach den Beiträgen zum ITS Arolsen in Archivalia (das zitiert wird) insbesondere von Herrn Bremberger
http://archiv.twoday.net/search?q=arolsen
muss ich das zurückweisen. Seit 24. Mai liegt die Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/058/1705826.pdf
vor. Sie ist zwar nicht online einsehbar, liegt mir jedoch vor.
[Update: http://www.ulla-jelpke.de/uploads/KA_17-5862_ITS_vorab.pdf ]
Die Eigenschaft des ITS-Archivs als absurdes Geheimarchiv geht sehr schön aus der Antwort auf die erste Frage nach den Mitgliedern des Internationalen Ausschusses hervor, deren Namen geheimgehalten werden. Dass eine schriftliche Anfrage in 4-6 Wochen beantwortet wird, ist für die Bundesregierung eine "gute Arbeitsbedingung". Der Internationale Ausschuss werde das Anliegen des Beschwerdeführers (also von Herrn Bremberger) zur Kenntnis erhalten, sei aber keine Beschwerdeinstanz für die Entscheidung von Einzelfällen.
Da Kühnel auf Facebook dem Artikel vorwirft, mein Zitat aus dem Zusammenhang zu reißen, dokumentiere ich den Beitrag vom 1.12.2010 samt Diskussion als Ganzes:
http://archiv.twoday.net/stories/11430012/#11442427
Internationaler Suchdienst Arolsen stellt vier Findbücher ins Netz
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=4569&cHash=22e28073b1
Via Archivliste
Die Findbücher sind einsehbar unter:
http://www.its-arolsen.org/de/das_archiv/findbuecher/index.html
Der ITS ist keine Behörde, er nimmt für sich in Anspruch, nach Willkür Entscheidungen über den dauerhaften Ausschluss von benutzern zu treffen: "Demjenigen, der sich laut innerstaatlichem oder internationalem Recht des Missbrauchs von Daten schuldig macht, die er vom Internationalen Suchdienst erhalten hat, kann der Direktor des Internationalen Suchdienstes den weiteren Zugang zu den Archiven und Unterlagen nach freiem Ermessen verweigern." Das deutsche Verwaltungsrecht kennt kein freies Ermessen. Freies Ermessen bedeutet nichts anderes als Willkür, vermutlich ohne Möglichkeit eines Rechtsschutzes.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:51 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Karsten Kühnel (Gast) meinte am 2010/12/06 23:34:
ITS ist Institution nach internationalem Recht (kein "Privatarchiv")
Der ITS ist eine Institution unter der Leitung der Regierungen von 11 Staaten, die hierzu einen Internationalen Ausschuss für den ITS eingerichtet habenff. Das Handeln des ITS fußt somit auf internationalem Vertragsrecht. Die Nutzungsbedingungen des Archivguts des ITS sind durch gemeinsamen Beschluss von diplomatischen Vertretern dieser 11 Regierungen (darunter auch Deutschland) festgelegt. Darin ist die Pflicht festgelegt, die Archivalien bzw. deren digitale Kopien nach Maßgabe des jeweiligen innerstaatlichen Rechts des Landes, in dem sich die verwahrende Institution befindet, bereitzustellen. Jeder Nutzer verpflichtet sich vor Beginn der Archivaliennutzung in Bad Arolsen zur Anerkennung und Einhaltung dieser Regeln. Die Nichtbeachtung kann ein Ausschlusskriterium für eine künftige Archivnutzung sein. Der ITS hat hier einen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum nötig, schließlich hat er es im Kreis seiner potentiellen Nutzer nicht nur mit seriösen Forschern, sondern auch mit der Brisanz von Nutzungsversuchen durch Holocaustleugner zu tun. Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den Internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren.
Der ITS ist keine deutsche Einrichtung. Das deutsche Verwaltungsrecht findet auf das Archivwesen des ITS somit keine Anwendung. Der ITS nimmt auch nicht für sich in Anspruch, eine nationale Behörde zu sein.
Zur Zugänglichkeit und den nutzungsrechtlichen Hintergründen (bereits auf der Grundlage des Entwurfs der Neufassung der Verträge über den ITS) wird der Interessierte in der kommenden Ausgabe der "Archiefkunde" des flämischen Archivarsverbands einen Beitrag über den ITS finden, der in leicht gekürzter Fassung als Referat auf dem Programm der internationalen Archivtagung "Archives without Borders / Archivos sin Fronteras" im vergangenen Sommer in Den Haag vorgetragen wurde (Bericht s. "Archivar" 4/2010).
Karsten Kühnel
KlausGraf antwortete am 2010/12/07 00:46:
Es bleibt dabei
Rechtsstaatliche Standards sind ja in der Diplomatie, wie man spätestens seit Wikileaks weiß, wenig verbreitet.
Und was nicht online ist, nehme ich in der Regel auch dann nicht wahr, wenn es in einem so bekannten Fachorgan wie der "Archiefkunde" abgedruckt wird.
Im übrigen mag ich es nicht, wenn solche Informationen nur der beschränkten Öffentlichkeit (Achtung: Wortspiel) der Archivliste zugänglich gemacht werden, nicht aber Archivalia. Nach deutschem Recht wäre eine Gleichbehandlung von Archivalia vielleicht durchzusetzen, nach ihrer Phantasie-KriegsRechtsgrundlage ganz sicher nicht.
"Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den Internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren." Man kann [sich, nachträglich ergänzt, KG] auch mit Eingaben an den Heiligen Stuhl wenden, vielleicht ist da die Erfolgquote höher.
Halten wir fest: Es gibt keinen Rechtsschutz gegen willkürliche Fehlentscheidungen des ITS-Archivs. Das ist mit der Rechtsschutzgewährung des deutschen Grundgesetzes auch bei einem internationalen Archiv nicht zu vereinbaren. Es kann nicht sein, dass man innerstaatlich wegen einem Cent einen Verwaltungsprozess führen kann, gegen die Willkür der ITS-Archivare aber nichts in der Hand hat.
Der Beschwerdeführer möchte gern die für seine Arbeit wichtigen Ordner (Akteneinheiten) in Form von Kopien auswerten, ein in deutschen Staatsarchiven absolut legitimes Verlangen. Es ging nie um ganze Bestände, aber auch bei ganzen Beständen hätte ich gern eine schlüssige Begründung, wieso die Abgabe einer Kopie verboten werden muss.
Und eine Unverschämtheit ist die Andeutung der Bundesregierung, es sei nicht belegt, "inwieweit der Inhalt dieser Ablichtung in konkrete wissenschaftliche Arbeiten einfließen wird". Bremberger ist einer der profiliertesten Zwangsarbeit-Forscher überhaupt:
http://www.zwangsarbeit-forschung.de/
Es geht ein Archiv nicht das geringste an, in welcher Weise und in welchem Umfang Archivgut in konkrete wissenschaftliche Veröffentlichungen einfließt. Über das Ob und Wie von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu entscheiden, ist aufgrund der Forschungsfreiheit des Art. 5 GG, den die Bundesregierung wohl übersieht, einzig und allein Sache des Forschers.
Ich stehe voll und ganz auf der Seite von Herrn Bremberger, während auf Facebook ganz sicher das kollegiale Krähen-Motto zum Tragen kommen dürfte.
(F)
KlausGraf - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:03 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Almost FaMI! from fami osz on Vimeo.
Eine Darstellung des deutschen Systems der dualen BerufsausbildungWolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 13:02 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Medienvielfalt im Archiv from fami osz on Vimeo.
Ergebnis einer FAMI-Projektarbeit zum Thema "Herstellen und Gestalten von Informationsdiensten"(W)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 12:54 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
«Hinter jeder Akte steckt ein Menschenschicksal. Ich kann nur davor warnen, die Akten irgendwo in große Archive einzuordnen»
Roland Jahn, BstU-Außenstelle Halle, 26.5.2011
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 26.05.2011
Welches Archivverständnis steckt hinter dieser Aussage? Ich habe einen Traum: von einer Podiumsdiskussion mit Roland Jahn und Michael Hollmann auf dem Deutschen Archivtag. Soviel Medienbeachtung könnten wir Archivierenden nur noch mit der Entdeckung der wirklichen Hitler-Tagebücher erreichen.
(W)
Roland Jahn, BstU-Außenstelle Halle, 26.5.2011
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 26.05.2011
Welches Archivverständnis steckt hinter dieser Aussage? Ich habe einen Traum: von einer Podiumsdiskussion mit Roland Jahn und Michael Hollmann auf dem Deutschen Archivtag. Soviel Medienbeachtung könnten wir Archivierenden nur noch mit der Entdeckung der wirklichen Hitler-Tagebücher erreichen.
(W)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 12:41 - Rubrik: Staatsarchive

Quelle: theoneandonlyoddo auf instagr.am, Ort: Staatsarchiv Bremen, 2011
Dank an Jonas für die Erlaubnis das Bild hier zeigen zu dürfen!
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 11:22 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das FDCL Archiv ist 1974 aus der Solidaritäts- und "Dritte-Welt-Bewegung" entstanden. Unser Archiv leistet einen kontinuierlichen kritischen Beitrag zur Dokumentation der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Lateinamerika und dessen Beziehungen zu den Ländern des "Nordens".
Unser umfangreiches Zeitungs-, Zeitschriften-, und Bucharchiv ist mittlerweile zum größten unabhängigen, nicht-staatlichen Lateinamerika-Archiv im deutschsprachigen Raum herangewachsen und verfügt über einen in dieser Form einzigartigen Bestand, der ein sehr weitgefächertes Spektrum an Themen abdeckt.
Durch die Begleitung politischer Prozesse ist eine umfassende und vielfältige Sammlung von Materialien entstanden, die sich durch ihren besonderen zeitgeschichtlichen und historischen Wert und ihre permanente Aktualität auszeichnet. Dies macht unser Archiv unentbehrlich für eine fundierte politische Bildung, die sich kritisch mit sozialen und politischen Themen auseinandersetzt.
Der Bestand ist einfach zu recherchieren in der gemeinsamen Datenbank der bundesweiten 'Kooperation 3.Welt Archive - Archiv³' (Link). Im Archiv³ haben sich 1998 elf Archive, die aus der bundesdeutschen Solidaritäts- und Dritte Welt-Szene hervorgegangen sind, zu einem Verbund zusammengeschlossen, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten und besser zu koordinieren.
Recherche vor Ort:
Es ist jederzeit möglich zu unseren Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung vorbeizukommen und selbständig oder mit unserer Hilfe kostenlos zu recherchieren, Zeitschriften und Presseausschnitte zu kopieren und Bücher auszuleihen.
Wir bearbeiten auch Rechercheaufträge und allgemeine Anfragen, die schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-mail an das Archiv gerichtet werden können.
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
oder nach Vereinbarung:
Tel: 693 40 29,
Email: archiv@fdcl.org "
Homepage des FDCL-Archivs
(S)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 22:56 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"‘Librarians and other staff with responsibilities for archives, special collections and other history collections often feel intimidated by Web 2.0 technology. In fact, they have nothing to fear and the technology (with which many of them are familiar and already use in their personal lives, e.g. Facebook, Flickr, etc.) can be used to enhance their collections as this excellent book shows. 5/5’ - HEA-ICS
‘This book is well organized and utilizes a down-to-earth tone that is both persuasive and comforting. Easy to read in small chunks, it gives readers the tools to both use and promote Web 2.0 within their institutions. I have used a handful of Web 2.0 tools in my personal life for many years, but still found this book quite useful for figuring out how I might use them in a professional context. Particularly helpful are the examples of archival and public history institutions that have already made good use of each tool and Theimer’s well-informed suggestions for making Web 2.0 projects sustainable over the long term.’ - THE AMERICAN ARCHIVIST
In a time when increasing numbers of people use the web as their primary means of locating information, most of the websites of archives and other historical organizations have not kept pace with overall web improvements in design, usability and utility. Many of these organizations lack the resources to hire consultants to improve their sites, or the internal expertise needed to know where to start.
Many of the staff of these collections are intimidated by Web 2.0 technology, and have a requirement for a low-tech, concept-based resource that approaches their web presence as an integral part of their business. They need a book written from the point of view of someone managing a historical organization, targeted specifically at the kind of material that is key to their missions, that will focus on giving them the information to make their own decisions about their own sites – and this new publication offers just that. The key areas covered are:
archives and the web: changes and opportunities
Web 2.0 basics
evaluating your current web presence and setting goals for Web 2.0
using blogs
using podcasts
using Flickr and other image-sharing sites
using YouTube and other video-sharing sites
using Twitter (microblogging)
using wikis
using Facebook and other social networking services
more 2.0 tools to consider
measuring your success
management and other considerations
archives and the web: finding the right balance.
This introductory guide for anyone working with collections in archives and historical organizations will act as a tool to assess the current utility of an organization’s web presence, and to identify how to improve that presence using the latest Web 2.0 technologies. Drawing on examples of good practice from real archives websites, providing a wealth of checklists and pinpointing available resources, it offers all that is needed to transform a website to achieve an organization’s goals.
February 2010; 272pp; paperback; 978-1-85604-687-9; £49.95"
Rezension in: Archivar 2/2011, S. 240-241
Verlagstext
(S)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 21:08 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Stanford's Archive of Recorded Sound which features a collection over 350,000 different audio recordings, photographs, records, posters and phonographs.
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 21:02 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 18:09 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 18:03 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 17:59 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausstellung in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch
von 14. Mai bis 10. Juli 2011
Gefundenes, Geborgenes, Gesammeltes ...
all das findet man in Ernst Lorchs Laboratorium zur Sicherung von Lebensspuren, und all das zieht sich wie ein roter Faden durch sein künstlerisches Schaffen.
Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen und Installationen aus fünf Jahrzehnten geben einen Überblick über das ausgedehnte Werk.
Kontakt:
Landratsamt Sigmaringen
Stabsbereich Kultur und Archiv
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen
www.landkreis-sigmaringen.de/kreisgalerie
Film erstellt und veröffentlicht im Auftrag des Landratsamt Sigmaringen von Michael Setz
© 2011 by michaelsetz.com
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 17:45 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digi.landesbibliothek.at
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich sieht sich als Bewahrer oberösterreichischen Kulturgutes und beschäftigt sich mit der Digitalisierung landeskundlich relevanter Literatur. Insbesondere die sogenannten "Obderennsia", also landeskundlich relevante Literatur des 16., 17., 18., 19. und 20. Jahrhunderts.
Zugleich präsentiert sich die Bibliothek (die Oberfläche ist die gleiche wie in Fulda und Greifswald) als Verbreiterin von Schwachsinn, denn den Metadaten zum Scan des Handschriftenkatalogs von Wilhering
http://digi.landesbibliothek.at/viewImage.xhtml?action=open&iddoc=12324&page=1&logId=
kann man entnehmen, dass ein Persistent Identifier in Form eines URN existiert:
ooe:landesbibliothek-101757
Aber da (mir!) kein Resolver für österreichische URN bekannt ist (nbn-resolving.de löst nichts auf), könnte man genauso gut
gppl:fjlalgjfldgsä
als Permanentlink hinschreiben. Das Präfix steht für Grafs persönlichen Permanentlink, vielleicht gibt es dazu irgendwann mal einen Resolver, der daraus etwas Anklickbares (eine URL) macht ...
Da greift man sich wirklich an den Kopf. Sind alle österreichischen Bibliothekare so inkompetent?
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich sieht sich als Bewahrer oberösterreichischen Kulturgutes und beschäftigt sich mit der Digitalisierung landeskundlich relevanter Literatur. Insbesondere die sogenannten "Obderennsia", also landeskundlich relevante Literatur des 16., 17., 18., 19. und 20. Jahrhunderts.
Zugleich präsentiert sich die Bibliothek (die Oberfläche ist die gleiche wie in Fulda und Greifswald) als Verbreiterin von Schwachsinn, denn den Metadaten zum Scan des Handschriftenkatalogs von Wilhering
http://digi.landesbibliothek.at/viewImage.xhtml?action=open&iddoc=12324&page=1&logId=
kann man entnehmen, dass ein Persistent Identifier in Form eines URN existiert:
ooe:landesbibliothek-101757
Aber da (mir!) kein Resolver für österreichische URN bekannt ist (nbn-resolving.de löst nichts auf), könnte man genauso gut
gppl:fjlalgjfldgsä
als Permanentlink hinschreiben. Das Präfix steht für Grafs persönlichen Permanentlink, vielleicht gibt es dazu irgendwann mal einen Resolver, der daraus etwas Anklickbares (eine URL) macht ...
Da greift man sich wirklich an den Kopf. Sind alle österreichischen Bibliothekare so inkompetent?
KlausGraf - am Samstag, 28. Mai 2011, 00:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lost-films.eu/
LOST FILMS is a new internet portal aimed at collecting and documenting film titles, which are believed or have been declared "lost". The ARCHIVE currently contains over 3500 entries, a number of which are extensively illustrated with surviving documents contributed by archives and individuals worldwide. The IDENTIFY section contains images and short video clips of around 50 unknown or unidentified films, which face the danger of also becoming lost if not identified by members. The aim of LOST FILMS is not to produce a definitive list of lost films but to provide a platform where members can frequently - and freely - exchange, add and update information.
(ML)
LOST FILMS is a new internet portal aimed at collecting and documenting film titles, which are believed or have been declared "lost". The ARCHIVE currently contains over 3500 entries, a number of which are extensively illustrated with surviving documents contributed by archives and individuals worldwide. The IDENTIFY section contains images and short video clips of around 50 unknown or unidentified films, which face the danger of also becoming lost if not identified by members. The aim of LOST FILMS is not to produce a definitive list of lost films but to provide a platform where members can frequently - and freely - exchange, add and update information.
(ML)
KlausGraf - am Samstag, 28. Mai 2011, 00:28 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.boersenblatt.net/444816/
Im Februar 2007 wurde in einem Beitrag von Klaus Graf in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" der Vorwurf erhoben, die Eichstätter Universitätsbibliothek habe Bücher aus dem Bestand der von ihr übernommenen Zentralbibliothek der Kapuziner aus Altötting entsorgt und damit Kulturgut vernichtet ("83 Tonnen Bücher als Müll. Die Universität Eichstätt vernichtet eine Klosterbibliothek"). In der Folge fand eine fachliche Untersuchung durch die Bayerische Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt statt, die diesen Vorwurf nicht bestätigen konnte. Zudem ermittelte die Staatsanwaltschaft, die 2008 Anklage wegen Untreue in fünf Fällen gegen Angelika Reich erhob. Die Verhandlungen vor dem Amtsgericht Ingolstadt endeten 2009 mit einem Freispruch. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft zunächst Berufung ein, zog diese aber jetzt nach der Meldung in "Bibliotheksforum Bayern" zurück. Angelika Reich ist damit rechtskräftig freigesprochen.
Diese Darstellung erweckt den falschen Eindruck, als hätte ich den Vorwurf erhoben. Ich habe lediglich in der FAZ für größere Resonanz der von anderer Seite erhobenen Vorwürfe gesorgt. Es gab bereits Anfang 2007 Berichte im "Donaukurier".
Zur Berichterstattung hier siehe unter anderem:
http://archiv.twoday.net/stories/5960023/
http://archiv.twoday.net/stories/4962435/
http://archiv.twoday.net/stories/5004382/
http://archiv.twoday.net/stories/4730431/
http://archiv.twoday.net/stories/4727682/
http://archiv.twoday.net/stories/3534122/ (beste Übersicht, BCK)
(T)
Update: Das Börsenblatt hat korrigiert: Anfang 2007 wurde unter anderem in einem Beitrag von Klaus Graf in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" der Vorwurf erhoben,
Selbstverständlich stehe ich zu meinem Vorwurf, auch wenn die strafrechtliche Ahnung nicht gelungen ist. Die Causa Eichstätt ist ein Schandfleck nicht nur für das kirchliche Bibliothekswesen.
Im Februar 2007 wurde in einem Beitrag von Klaus Graf in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" der Vorwurf erhoben, die Eichstätter Universitätsbibliothek habe Bücher aus dem Bestand der von ihr übernommenen Zentralbibliothek der Kapuziner aus Altötting entsorgt und damit Kulturgut vernichtet ("83 Tonnen Bücher als Müll. Die Universität Eichstätt vernichtet eine Klosterbibliothek"). In der Folge fand eine fachliche Untersuchung durch die Bayerische Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt statt, die diesen Vorwurf nicht bestätigen konnte. Zudem ermittelte die Staatsanwaltschaft, die 2008 Anklage wegen Untreue in fünf Fällen gegen Angelika Reich erhob. Die Verhandlungen vor dem Amtsgericht Ingolstadt endeten 2009 mit einem Freispruch. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft zunächst Berufung ein, zog diese aber jetzt nach der Meldung in "Bibliotheksforum Bayern" zurück. Angelika Reich ist damit rechtskräftig freigesprochen.
Diese Darstellung erweckt den falschen Eindruck, als hätte ich den Vorwurf erhoben. Ich habe lediglich in der FAZ für größere Resonanz der von anderer Seite erhobenen Vorwürfe gesorgt. Es gab bereits Anfang 2007 Berichte im "Donaukurier".
Zur Berichterstattung hier siehe unter anderem:
http://archiv.twoday.net/stories/5960023/
http://archiv.twoday.net/stories/4962435/
http://archiv.twoday.net/stories/5004382/
http://archiv.twoday.net/stories/4730431/
http://archiv.twoday.net/stories/4727682/
http://archiv.twoday.net/stories/3534122/ (beste Übersicht, BCK)
(T)
Update: Das Börsenblatt hat korrigiert: Anfang 2007 wurde unter anderem in einem Beitrag von Klaus Graf in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" der Vorwurf erhoben,
Selbstverständlich stehe ich zu meinem Vorwurf, auch wenn die strafrechtliche Ahnung nicht gelungen ist. Die Causa Eichstätt ist ein Schandfleck nicht nur für das kirchliche Bibliothekswesen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.facebook.com/askanachaeologist
Auf Facebook kann man einem Archäologen Löcher in den Bauch fragen, was Herr Wolf und ich schon getan haben ...
(F)
Auf Facebook kann man einem Archäologen Löcher in den Bauch fragen, was Herr Wolf und ich schon getan haben ...
(F)
http://www.focus.de/wissen/campus/doktorarbeiten-plagiatsvorwuerfe-an-der-uni-wuerzburg_aid_631669.html
Die jetzige Prüfung steht im Zusammenhang mit einem Mitte März bei der Universität Würzburg eingegangenen anonymen Schreiben, wonach jahrelang am Institut für Geschichte der Medizin durch den dortigen inzwischen emeritierten Professor eine regelrechte „Doktorfabrik“ bestand. So sollen niedergelassene Ärzte und Apotheker gegen entsprechende fünfstellige Zahlungen sich den Titel nebst Arbeit aus der Feder des Professors oder seiner Mitarbeiter gekauft haben. Er wurde bereits 2009 zu einem Strafbefehl in Höhe von 14 400 Euro verurteilt, weil ihm nachgewiesen worden war, dass er von einem Promotionsberater 6000 Euro für Forschungen an seinem Institut angenommen hatte.
(T)
Die jetzige Prüfung steht im Zusammenhang mit einem Mitte März bei der Universität Würzburg eingegangenen anonymen Schreiben, wonach jahrelang am Institut für Geschichte der Medizin durch den dortigen inzwischen emeritierten Professor eine regelrechte „Doktorfabrik“ bestand. So sollen niedergelassene Ärzte und Apotheker gegen entsprechende fünfstellige Zahlungen sich den Titel nebst Arbeit aus der Feder des Professors oder seiner Mitarbeiter gekauft haben. Er wurde bereits 2009 zu einem Strafbefehl in Höhe von 14 400 Euro verurteilt, weil ihm nachgewiesen worden war, dass er von einem Promotionsberater 6000 Euro für Forschungen an seinem Institut angenommen hatte.
(T)
KlausGraf - am Freitag, 27. Mai 2011, 19:37 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Neben den unzähligen Menschenleben, die Erdbeben, Tsunami und
Reaktorkatastrophe in Japan gefordert haben, bedeutet die Verwüstung ganzer Landstriche im Nordosten des Landes auch die Zerstörung und Bedrohung der wertvollen historischen Überlieferung. Die Situation ist umso dramatischer
als historische Dokumente in Japan nicht nur in Archiven aufbewahrt werden, sondern sich vielfach auch in Tempeln und Schreinen sowie in Privatbesitz befinden. Bei früheren Erdbebenkatastrophen gingen aufgrund dieser Unübersichtlichkeit viele Archivalien verloren.
Das Rekishi-Shiryō-Net, ein Netzwerk junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schäden zu dokumentieren und Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen für historische Dokumente anzustoßen. Es sind diese Kollegen, die sich nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln sehr engagiert haben, um in Japan für Solidarität und finanzielle Unterstützung für Köln zu werben. Jetzt brauchen sie unsere Unterstützung.
Bitte spenden Sie auf folgendes Konto:
Beneficiary Bank: Japan Post Bank
Branch Office: 099
Beneficiary Bank Address: 3-2, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8798, Japan
Payee Account Number: 00930-1-53945
Payee Name: rekishishiryonetwork
Payee Address: 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Please follow the below link for extra information.
Deposit to Japan Post Bank Account: http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html
Contact Address:
Rekishi Shiryo Network
Address: c/o Faculty of Letters, Kobe University 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel/Fax: 81-78-803-5565 pm1:00-pm5:00 (Tel: Japanese only )
http://blogs.yahoo.co.jp/siryo_net
http://rekishishiryonet.wordpress.com
e-mail: s-net@lit.kobe-u.ac.jp
(PM) Dr. Andreas Rutz
Weitere Informationen:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie auf ein Netzwerk junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Bewahrung des lokalen historischen und kulturellen Gedächtnisses in Form historischer Dokumente in Japan aufmerksam machen, das sich gegenwärtig stark für den Erhalt historischer Dokumente in der Erdbebenregion im Nordosten Japans engagiert.
Was ist das Rekishi-Shiryō-Net (Netzwerk für Historische Dokumente)?
Das „Netzwerk für Historische Dokumente“ wurde am 4. Februar 1995 zur Rettung und Bewahrung historischer Dokumente, die während und nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben verloren zu gehen drohten, von verschiedenen historischen Organisationen in der Region Kansai (Ōsaka, Kyōto und Kōbe) zunächst als „Informationsnetzwerk für die Sicherstellung historischer Dokumente“ gegründet. 1996 wurde es in „Netzwerk für Historische Dokumente“ umbenannt. Dabei handelt es sich um eine Organisation, in der junge Wissenschaftler wie Universitätsdozenten, Doktoranden, Mitarbeiter der Quellen aufbewahrenden Institutionen sowie Historiker der Regionen ehrenamtlich tätig sind. Das Büro des Netzwerks ist am „Zentrum der Zusammenarbeit der Regionen“ an der Universität Kōbe angesiedelt.
Hier ein Überblick über die Entwicklung unseres Netzwerks:
- 4. Februar 1995: Okumura Hiroshi (Philosophische Fakultät der Universität Kōbe) und Vertreter lokaler historischer Organisationen (Mitglieder des „Council for Historical Science Ōsaka“, der „Ōsaka Historical Association“ und der „Japanese Society of Historical Studies“) besuchten das Städtische Archiv Amagasaki und kamen überein, eine Dachorganisation historischer Vereine anlässlich des Hanshin-Awaji-Erdebens (Hanshin daishinsai taisaku rekishi gakkai renraku-kai) zu gründen und in dem Archiv ein Informationsbüro einzurichten. Dieser Initiative schlossen sich die „Kyōto Historical Science Association“ und die „Historical Science Society of Japan” an.
- 13. Februar 1995: Im Städtischen Archiv Amagasaki wurde ein „Informationsnetzwerk für die Sicherstellung historischer Dokumente“ eingerichtet. Ehrenamtliche Helfer begannen mit der Informationssammlung und standen für Anfragen und Beratungen zur Verfügung.
- 10. April 1995: An der Philosophischen Fakultät der Universität Kōbe wurde das „Kōbe-Zentrum“ des Netzwerkes eingerichtet, das ab Juni 1995 dann die Aufgaben, die bisher in Amagasaki ausgeführt wurden, übernahm.
- 19. Juni 1995: Im Städtischen Archiv Kōbes wurde eine Zweigstelle des Netzwerkes eingerichtet. Gemeinsam mit Vertretern des Archivs arbeitete man bis Oktober an der Untersuchung beschädigter Dokumente.
- April 1996: Als Zusammenschluss Freiwilliger wurde der Status der Organisation verändert und in „Netzwerk für Historische Dokumente“ umbenannt.
- 26. Mai 2002: Die Organisationsstruktur des Netzwerks wurde ein weiteres Mal verändert und auf ein Mitgliedsschaftssystem umgestellt.
Das große Erdbeben und der Tsunami in Tohoku und der Region Kantō am 11. März verursachten enorme Schäden in vielen Gebieten, vor allem in den Präfekturen Miyagi, Iwate, Fukushima und Ibaraki. Wir drücken den Betroffenen, die auch heute noch den Alltag in großer Unbequemlichkeit ertragen müssen, unser Mitgefühl und den Familienangehörigen und Freuden der Opfer unser tief empfundenes Beileid aus.
Das „Netzwerk für historische Dokumente“ bemüht sich momentan um das Sammeln von Informationen über den Umfang des durch das Erdbeben und den Tsunami verursachten Schadens durch den Kontakt zu verschiedenen lokalen Einrichtungen im Katastrophengebiet. Der Umfang der Schäden durch das diesmalige Megabeben erstreckt sich über ein so weites Gebiete, sodass zu vermuten ist, dass künftig langfristige Aktivitäten zur Sicherstellung und für den Erhalt historischer Dokumente erforderlich sein werden.
Viel Zeit und erhebliche finanzielle Mittel werden benötigt werden, wenn mit Rettungs- und Aufbewahrungsaktionen der historischen Dokumente und Kulturgüter begonnen werden kann, in der die lokalen Netzwerke für das Sicherstellen der historischen Dokumente im Katastrophengebiet (Netzwerk Miyagi, Netzwerk Fukushima, Netzwerk Yamagata, Netzwerk Niigata sowie Netzwerk Chiba) eine zentrale Rolle spielen werden.
Bisher haben wir leider schon die Erfahrung machen müssen, dass in Katastrophensituationen historische Dokumente in Privathäusern und Speichern, in den Gemeindearchiven oder in Tempeln und Schreinen oft im Chaos verloren gingen bzw. gestohlen, verkauft oder vernichtet wurden. Dadurch gingen kostbare Erinnerungen der Familien und der Regionen verloren. Um solche Verluste historischer Dokumente in den Katastrophengebieten zu verhindern, ist es nötig, unverzüglich mit der Sicherstellung und gegebenenfalls mit der Restaurierung historischer Dokumente in Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Einrichtungen zu beginnen.
Weiterführende Informationen zu unseren bisherigen und zukünftigen Tätigkeiten können sie im Internet - in japanischer Sprache – unter http: //blogs.yahoo.co.jp/siryo_net einsehen.
Reaktorkatastrophe in Japan gefordert haben, bedeutet die Verwüstung ganzer Landstriche im Nordosten des Landes auch die Zerstörung und Bedrohung der wertvollen historischen Überlieferung. Die Situation ist umso dramatischer
als historische Dokumente in Japan nicht nur in Archiven aufbewahrt werden, sondern sich vielfach auch in Tempeln und Schreinen sowie in Privatbesitz befinden. Bei früheren Erdbebenkatastrophen gingen aufgrund dieser Unübersichtlichkeit viele Archivalien verloren.
Das Rekishi-Shiryō-Net, ein Netzwerk junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schäden zu dokumentieren und Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen für historische Dokumente anzustoßen. Es sind diese Kollegen, die sich nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln sehr engagiert haben, um in Japan für Solidarität und finanzielle Unterstützung für Köln zu werben. Jetzt brauchen sie unsere Unterstützung.
Bitte spenden Sie auf folgendes Konto:
Beneficiary Bank: Japan Post Bank
Branch Office: 099
Beneficiary Bank Address: 3-2, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8798, Japan
Payee Account Number: 00930-1-53945
Payee Name: rekishishiryonetwork
Payee Address: 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Please follow the below link for extra information.
Deposit to Japan Post Bank Account: http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html
Contact Address:
Rekishi Shiryo Network
Address: c/o Faculty of Letters, Kobe University 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel/Fax: 81-78-803-5565 pm1:00-pm5:00 (Tel: Japanese only )
http://blogs.yahoo.co.jp/siryo_net
http://rekishishiryonet.wordpress.com
e-mail: s-net@lit.kobe-u.ac.jp
(PM) Dr. Andreas Rutz
Weitere Informationen:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie auf ein Netzwerk junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Bewahrung des lokalen historischen und kulturellen Gedächtnisses in Form historischer Dokumente in Japan aufmerksam machen, das sich gegenwärtig stark für den Erhalt historischer Dokumente in der Erdbebenregion im Nordosten Japans engagiert.
Was ist das Rekishi-Shiryō-Net (Netzwerk für Historische Dokumente)?
Das „Netzwerk für Historische Dokumente“ wurde am 4. Februar 1995 zur Rettung und Bewahrung historischer Dokumente, die während und nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben verloren zu gehen drohten, von verschiedenen historischen Organisationen in der Region Kansai (Ōsaka, Kyōto und Kōbe) zunächst als „Informationsnetzwerk für die Sicherstellung historischer Dokumente“ gegründet. 1996 wurde es in „Netzwerk für Historische Dokumente“ umbenannt. Dabei handelt es sich um eine Organisation, in der junge Wissenschaftler wie Universitätsdozenten, Doktoranden, Mitarbeiter der Quellen aufbewahrenden Institutionen sowie Historiker der Regionen ehrenamtlich tätig sind. Das Büro des Netzwerks ist am „Zentrum der Zusammenarbeit der Regionen“ an der Universität Kōbe angesiedelt.
Hier ein Überblick über die Entwicklung unseres Netzwerks:
- 4. Februar 1995: Okumura Hiroshi (Philosophische Fakultät der Universität Kōbe) und Vertreter lokaler historischer Organisationen (Mitglieder des „Council for Historical Science Ōsaka“, der „Ōsaka Historical Association“ und der „Japanese Society of Historical Studies“) besuchten das Städtische Archiv Amagasaki und kamen überein, eine Dachorganisation historischer Vereine anlässlich des Hanshin-Awaji-Erdebens (Hanshin daishinsai taisaku rekishi gakkai renraku-kai) zu gründen und in dem Archiv ein Informationsbüro einzurichten. Dieser Initiative schlossen sich die „Kyōto Historical Science Association“ und die „Historical Science Society of Japan” an.
- 13. Februar 1995: Im Städtischen Archiv Amagasaki wurde ein „Informationsnetzwerk für die Sicherstellung historischer Dokumente“ eingerichtet. Ehrenamtliche Helfer begannen mit der Informationssammlung und standen für Anfragen und Beratungen zur Verfügung.
- 10. April 1995: An der Philosophischen Fakultät der Universität Kōbe wurde das „Kōbe-Zentrum“ des Netzwerkes eingerichtet, das ab Juni 1995 dann die Aufgaben, die bisher in Amagasaki ausgeführt wurden, übernahm.
- 19. Juni 1995: Im Städtischen Archiv Kōbes wurde eine Zweigstelle des Netzwerkes eingerichtet. Gemeinsam mit Vertretern des Archivs arbeitete man bis Oktober an der Untersuchung beschädigter Dokumente.
- April 1996: Als Zusammenschluss Freiwilliger wurde der Status der Organisation verändert und in „Netzwerk für Historische Dokumente“ umbenannt.
- 26. Mai 2002: Die Organisationsstruktur des Netzwerks wurde ein weiteres Mal verändert und auf ein Mitgliedsschaftssystem umgestellt.
Das große Erdbeben und der Tsunami in Tohoku und der Region Kantō am 11. März verursachten enorme Schäden in vielen Gebieten, vor allem in den Präfekturen Miyagi, Iwate, Fukushima und Ibaraki. Wir drücken den Betroffenen, die auch heute noch den Alltag in großer Unbequemlichkeit ertragen müssen, unser Mitgefühl und den Familienangehörigen und Freuden der Opfer unser tief empfundenes Beileid aus.
Das „Netzwerk für historische Dokumente“ bemüht sich momentan um das Sammeln von Informationen über den Umfang des durch das Erdbeben und den Tsunami verursachten Schadens durch den Kontakt zu verschiedenen lokalen Einrichtungen im Katastrophengebiet. Der Umfang der Schäden durch das diesmalige Megabeben erstreckt sich über ein so weites Gebiete, sodass zu vermuten ist, dass künftig langfristige Aktivitäten zur Sicherstellung und für den Erhalt historischer Dokumente erforderlich sein werden.
Viel Zeit und erhebliche finanzielle Mittel werden benötigt werden, wenn mit Rettungs- und Aufbewahrungsaktionen der historischen Dokumente und Kulturgüter begonnen werden kann, in der die lokalen Netzwerke für das Sicherstellen der historischen Dokumente im Katastrophengebiet (Netzwerk Miyagi, Netzwerk Fukushima, Netzwerk Yamagata, Netzwerk Niigata sowie Netzwerk Chiba) eine zentrale Rolle spielen werden.
Bisher haben wir leider schon die Erfahrung machen müssen, dass in Katastrophensituationen historische Dokumente in Privathäusern und Speichern, in den Gemeindearchiven oder in Tempeln und Schreinen oft im Chaos verloren gingen bzw. gestohlen, verkauft oder vernichtet wurden. Dadurch gingen kostbare Erinnerungen der Familien und der Regionen verloren. Um solche Verluste historischer Dokumente in den Katastrophengebieten zu verhindern, ist es nötig, unverzüglich mit der Sicherstellung und gegebenenfalls mit der Restaurierung historischer Dokumente in Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Einrichtungen zu beginnen.
Weiterführende Informationen zu unseren bisherigen und zukünftigen Tätigkeiten können sie im Internet - in japanischer Sprache – unter http: //blogs.yahoo.co.jp/siryo_net einsehen.
KlausGraf - am Freitag, 27. Mai 2011, 15:11 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlydutchbooksonline.nl
De website Early Dutch Books Online is live! De databank geeft toegang tot bijna 10.000 gedigitaliseerde titels uit de periode 1780-1800. Tot de gratis te downloaden boeken behoren onder meer populaire uitgaven zoals griezelromans, toneelstukken, liedbundels, erotische romans en literaire hoogtepunten als de briefroman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. De website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de KB en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.
Bücher in Niederländisch in toller Auflösung mit Volltextsuche im OCR-Text. Schicker Viewer.
Negativ ist anzumerken, dass man den Permalink nur findet, wenn man den unscheinbaren Link zum STCN (unter einem Bild - ! - rechts unten) aufruft, wo man dann z.B. den URN
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9258:mpeg21
entdeckt.
(ML)
Update:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/05/27/a-new-dutch-digital-library/

De website Early Dutch Books Online is live! De databank geeft toegang tot bijna 10.000 gedigitaliseerde titels uit de periode 1780-1800. Tot de gratis te downloaden boeken behoren onder meer populaire uitgaven zoals griezelromans, toneelstukken, liedbundels, erotische romans en literaire hoogtepunten als de briefroman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. De website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de KB en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.
Bücher in Niederländisch in toller Auflösung mit Volltextsuche im OCR-Text. Schicker Viewer.
Negativ ist anzumerken, dass man den Permalink nur findet, wenn man den unscheinbaren Link zum STCN (unter einem Bild - ! - rechts unten) aufruft, wo man dann z.B. den URN
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9258:mpeg21
entdeckt.
(ML)
Update:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/05/27/a-new-dutch-digital-library/
KlausGraf - am Freitag, 27. Mai 2011, 12:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Tagung
des LWL-Institus für westfälische Regionalgeschichte
der LWL-Literaturkommission für Westfalen
des Westfälischen Heimatbundes
Straßennamen dienen Bewohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern eines Ortes vorrangig zur räumlichen Orientierung. Darüber hinaus sollen sie die Erinnerung wach halten, das Gedenken fördern sowie der Ehrenbezeugung dienen. Straßennamen verweisen auf die Zeit ihrer Verleihung: auf die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, die Kultur und den Raum. Sie sind damit sichtbarer Teil der Vergangenheitspolitik einer Stadt und ihrer Repräsentanten.
Straßenumbenennungen hingegen greifen in die Erinnerungskultur ein, indem sie einzelne Personen, Ereignisse oder Orte aus dem offiziellen Gedächtnis einer Stadt streichen. Zumeist sind solche Umbenennungen in Deutschland Folgen und Zeichen politischer Zäsuren gewesen, so während der Umbrüche 1918/19, 1933, 1945 und 1989/90. In jüngerer Zeit sind sie vor allem Ausdruck eines sich wandelnden Verständnisses und gesellschaftspolitischen Umgangs mit der NS-Diktatur, insbesondere mit Tätern und Opfern.
Die Tagung behandelt im ersten Teil die Benennungspraxis von Straßen in Westfalen und Lippe seit dem 19. Jh. und beleuchtet, ausgehend von einzelnen Personennamen, vorwiegend die Umbenennungen während der NS-Zeit und nach 1945.
Im zweiten Teil werden ausgewählte "Grenzfälle" thematisiert, deren Leben und Wirken heute kontrovers beurteilt wird und folglich Straßenumbenennungen bereits erfolgt sind oder weiterhin diskutiert werden. Die Tagung greift diese tagespolitischen Debatten auf und bietet damit ein Forum, um die lokalen Argumentations- und Umgangsweisen im Hinblick auf Straßenumbenennungen transparent zu machen.
Programm
ab 9.00 Uhr
Anmeldung im Tagungsbüro
(LWL-Landeshaus)
9.30 Uhr
Moderation der Tagung
Anke Bruns
Begrüßung und Eröffnung
Dr. Wolfgang Kirsch
Prof. Dr. Bernd Walter
10.00 Uhr
PD Dr. Rainer Pöppinghege
Politik per Stadtplan. Zur Erinnerungsfunktion von Straßennamen
10.45 - 11.15 Uhr
Kaffeepause
11.15 Uhr
Dr. Marcus Weidner
"Wir beantragen?unverzüglich umzubenennen."
Straßenumbenennungen in Westfalen und Lippe im
Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
12.00 Uhr
Prof. Dr. Walter Gödden
Belastete westfälische Autorinnen und Autoren auf
Straßenschildern. Eine quantifizierende Analyse
13.00 - 14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
PD Dr. Karl Ditt
Karl Wagenfeld - Heimatdichter, Heimatfunktionär,
Nationalsozialist?
14.45 Uhr
Dr. Steffen Stadthaus
Agnes Miegel und Friedrich Castelle.
Schriftsteller als Beispiel regionaler Vergangenheitspolitik
15.30 - 15.45 Uhr
Kaffeepause
15.45 Uhr
Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer
Hindenburg und die Stadt Münster
16.30 Uhr
Abschlussdiskussion
gegen 17.00 Uhr
Ende der Tagung
INFO
Kontakt/Anmeldung bis zum 30.06.2011
Dr. Matthias Frese
Katharina Stütz
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstr. 33, 48147 Münster
Tel.: (0251) 591-5706
E-Mail: katharina.stuetz@lwl.org
Veranstaltungsdaten:
Tagung "Fragwürdige Ehrungen !? Straßennamen als Instrument von
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur"
Datum: 12.07.2011
Plenarsaal im LWL-Landeshaus
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 Münster"
Quelle: Mailingliste "Westfälische Geschichte"
(ML)
des LWL-Institus für westfälische Regionalgeschichte
der LWL-Literaturkommission für Westfalen
des Westfälischen Heimatbundes
Straßennamen dienen Bewohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern eines Ortes vorrangig zur räumlichen Orientierung. Darüber hinaus sollen sie die Erinnerung wach halten, das Gedenken fördern sowie der Ehrenbezeugung dienen. Straßennamen verweisen auf die Zeit ihrer Verleihung: auf die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, die Kultur und den Raum. Sie sind damit sichtbarer Teil der Vergangenheitspolitik einer Stadt und ihrer Repräsentanten.
Straßenumbenennungen hingegen greifen in die Erinnerungskultur ein, indem sie einzelne Personen, Ereignisse oder Orte aus dem offiziellen Gedächtnis einer Stadt streichen. Zumeist sind solche Umbenennungen in Deutschland Folgen und Zeichen politischer Zäsuren gewesen, so während der Umbrüche 1918/19, 1933, 1945 und 1989/90. In jüngerer Zeit sind sie vor allem Ausdruck eines sich wandelnden Verständnisses und gesellschaftspolitischen Umgangs mit der NS-Diktatur, insbesondere mit Tätern und Opfern.
Die Tagung behandelt im ersten Teil die Benennungspraxis von Straßen in Westfalen und Lippe seit dem 19. Jh. und beleuchtet, ausgehend von einzelnen Personennamen, vorwiegend die Umbenennungen während der NS-Zeit und nach 1945.
Im zweiten Teil werden ausgewählte "Grenzfälle" thematisiert, deren Leben und Wirken heute kontrovers beurteilt wird und folglich Straßenumbenennungen bereits erfolgt sind oder weiterhin diskutiert werden. Die Tagung greift diese tagespolitischen Debatten auf und bietet damit ein Forum, um die lokalen Argumentations- und Umgangsweisen im Hinblick auf Straßenumbenennungen transparent zu machen.
Programm
ab 9.00 Uhr
Anmeldung im Tagungsbüro
(LWL-Landeshaus)
9.30 Uhr
Moderation der Tagung
Anke Bruns
Begrüßung und Eröffnung
Dr. Wolfgang Kirsch
Prof. Dr. Bernd Walter
10.00 Uhr
PD Dr. Rainer Pöppinghege
Politik per Stadtplan. Zur Erinnerungsfunktion von Straßennamen
10.45 - 11.15 Uhr
Kaffeepause
11.15 Uhr
Dr. Marcus Weidner
"Wir beantragen?unverzüglich umzubenennen."
Straßenumbenennungen in Westfalen und Lippe im
Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
12.00 Uhr
Prof. Dr. Walter Gödden
Belastete westfälische Autorinnen und Autoren auf
Straßenschildern. Eine quantifizierende Analyse
13.00 - 14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
PD Dr. Karl Ditt
Karl Wagenfeld - Heimatdichter, Heimatfunktionär,
Nationalsozialist?
14.45 Uhr
Dr. Steffen Stadthaus
Agnes Miegel und Friedrich Castelle.
Schriftsteller als Beispiel regionaler Vergangenheitspolitik
15.30 - 15.45 Uhr
Kaffeepause
15.45 Uhr
Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer
Hindenburg und die Stadt Münster
16.30 Uhr
Abschlussdiskussion
gegen 17.00 Uhr
Ende der Tagung
INFO
Kontakt/Anmeldung bis zum 30.06.2011
Dr. Matthias Frese
Katharina Stütz
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstr. 33, 48147 Münster
Tel.: (0251) 591-5706
E-Mail: katharina.stuetz@lwl.org
Veranstaltungsdaten:
Tagung "Fragwürdige Ehrungen !? Straßennamen als Instrument von
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur"
Datum: 12.07.2011
Plenarsaal im LWL-Landeshaus
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 Münster"
Quelle: Mailingliste "Westfälische Geschichte"
(ML)
Wolf Thomas - am Freitag, 27. Mai 2011, 12:03 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliothekarisch.de/blog/2011/05/27/mit-den-buchern-kamen-die-probleme/
Als Nachschlagewerk konzipiert weist der Band “Lesewelten – Historische Bibliotheken”, herausgegeben von Katrin Dziekan und Ute Pott, “Büchersammlungen des 18. Jahrhunderts in Museen und Bibliotheken Sachsen-Anhalts” auf einem Blick und im Einzelnen nach. [...]
In 30 Aufsätzen, eingeteilt in sechs Abteilungen, werden 30 Sammlungen vorgestellt. Da ist zum einen ein Beitrag über die evangelische Marienbibliothek in Halle. Diese Bibliothek war bis ins späte 17. Jahrhundert die einzige öffentliche Bibliothek in Halle und wurde in den vergangenen 20 Jahren wieder in einen vorbildlichen Zustand gebracht. Beschrieben wird auch die Francisceumsbibliothek in Zerbst, die Bücherei Gleims in Halberstadt und der Grimms in Haldensleben, die Bibliotheken in Dessau, Ballenstedt, Quedlinburg und Köthen, sowie im Klopstock-, Händel- und Winckelmann-Museum.
Zu den Adelsbibliotheken heißt es:
Besonders interessant sind die Erkenntnisse, die zu den verlorene Sammlungen der Familie Alvensleben, der Stolbergs in Wernigerode, der Sammlung im Schloss Wörlitz und der Klaus-Synagoge in Halberstadt gesammelt wurden. Deren Verluste entstanden oft schon lange vor den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges. So wurden in Folge der Wirtschaftkrise um 1930 herum wertvolle Bestände von ihren Besitzern in Wernigerode, Wörlitz und Wiederstedt verkauft.
(RSS)
Als Nachschlagewerk konzipiert weist der Band “Lesewelten – Historische Bibliotheken”, herausgegeben von Katrin Dziekan und Ute Pott, “Büchersammlungen des 18. Jahrhunderts in Museen und Bibliotheken Sachsen-Anhalts” auf einem Blick und im Einzelnen nach. [...]
In 30 Aufsätzen, eingeteilt in sechs Abteilungen, werden 30 Sammlungen vorgestellt. Da ist zum einen ein Beitrag über die evangelische Marienbibliothek in Halle. Diese Bibliothek war bis ins späte 17. Jahrhundert die einzige öffentliche Bibliothek in Halle und wurde in den vergangenen 20 Jahren wieder in einen vorbildlichen Zustand gebracht. Beschrieben wird auch die Francisceumsbibliothek in Zerbst, die Bücherei Gleims in Halberstadt und der Grimms in Haldensleben, die Bibliotheken in Dessau, Ballenstedt, Quedlinburg und Köthen, sowie im Klopstock-, Händel- und Winckelmann-Museum.
Zu den Adelsbibliotheken heißt es:
Besonders interessant sind die Erkenntnisse, die zu den verlorene Sammlungen der Familie Alvensleben, der Stolbergs in Wernigerode, der Sammlung im Schloss Wörlitz und der Klaus-Synagoge in Halberstadt gesammelt wurden. Deren Verluste entstanden oft schon lange vor den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges. So wurden in Folge der Wirtschaftkrise um 1930 herum wertvolle Bestände von ihren Besitzern in Wernigerode, Wörlitz und Wiederstedt verkauft.
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
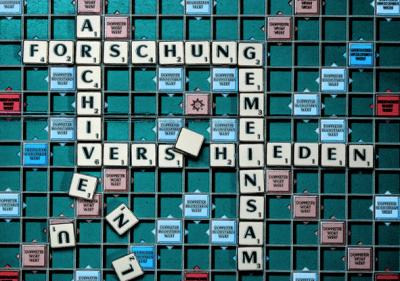
Im 19. Jahrhundert lagen die Berufsbilder des Historikers und des Archivars eng beieinander. Historiker und Archivare verstanden sich als gleichgesinnte und gleichberechtigte Partner auf der Suche nach der historischen Wahrheit. Beginnend mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert änderte sich diese Situation. Mittlerweile ist eine Kluft zwischen Archiven und geschichtswissenschaftlicher Forschung entstanden, die bereits mehrfach konstatiert und beklagt worden ist. Geändert hat sich indes bislang wenig. Im Gegenteil: Die fachlich-professionelle Eigendynamik und knappe Ressourcen auf beiden Seiten führen eher zu einer weiteren Entfremdung als zu einer Wiederannäherung von Archiven und historischer Forschung. Infolge der Ausweitung kulturgeschichtlicher Ansätze greift die Geschichtswissenschaft heute zunehmend auf nicht-archivische Quellen zurück. Diese Quellen besitzen zudem den Vorteil, dass sie meist leichter zugänglich sind als die archivische Überlieferung. Natürlich versuchen die Archive, durch den Aufbau digitaler Infrastrukturen den Zugang zu Archivgut zu verbessern. Die damit verbundenen Aufgaben bedeuten aber eine Herausforderung, die in den Archiven kurz- bzw. mittelfristig durchaus zu Lasten des historisch-wissenschaftlichen Auswertungs- und Bildungsauftrags (und damit auch zu Lasten der archivisch-historischen Netzwerke) gehen können; die dringend gebotene Sicherung elektronischer Unterlagen verlagert darüber hinaus den Schwerpunkt der aktuellen archivischen Aufgaben auf Bestände, die erst kommenden Historiker/innen-Generationen zur Verfügung stehen.
Die Podiumsdiskussion will das Gespräch zwischen Historikern und Archivaren neu aufnehmen. Führende Vertreter des deutschen Archivwesens einerseits und des Historikerverbandes andererseits wollen die Entwicklungen der vergangenen Jahre mit Blick auf die fachlichen Methoden sowie die institutionellen Rahmenbedingungen in beiden Aufgabenbereichen analysieren und aufzeigen, welche Gefahren bestehen, wenn die Kluft weiterbesteht oder sich noch vergrößert. Für die Zukunft sollen die gegenseitigen Erwartungen der Archive und der Forschung neu abgesteckt und auf dieser Grundlage Perspektiven einer verbesserten Kooperation entwickelt werden. Das Plenum hat Gelegenheit, sich mit Fragen und eigenen Statements in die Diskussion mit einzubringen.
Die Ergebnisse der Podiumsdiskussion sollen im Spätherbst des Jahres in Heft 4/2011 der Zeitschrift ARCHIVAR veröffentlicht werden.
Programm
Beginn: 10:30 Uhr
Dr. Evelyn Brockhoff
Leitende Direktorin des Instituts für Stadtgeschichte
Frankfurt am Main
Begrüßung
Podiumsdiskussion
Die Archive und die historische Forschung
Es diskutieren:
Prof. Dr. Christoph Cornelißen, Historisches Seminar Universität Kiel, Mitglied des Ausschusses des Historikerverbandes
Prof. Dr. Dirk van Laak, Historisches Institut Universität Gießen, Mitglied des Ausschusses des Historikerverbandes
Dr. Clemens Rehm, Landesarchiv Baden-Württemberg, Erster stellvertretender Vorsitzender des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen
Moderation
Dr. Andreas Pilger, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen/Redaktion ARCHIVAR
Veranstaltungsort
Institut für Stadtgeschichte
Münzgasse 9
60311 Frankfurt am Main
Sie erreichen das Institut mit der U-Bahn (Linien U1 bis U5 und U8, Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“) oder fußläufig vom Hauptbahnhof in ca. 15 min.
Die Podiumsdiskussion wird veranstaltet vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und vom VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bitte melden Sie sich vorher an unter archivar@lav.nrw.de.
Kontakt
Dr. Andreas Pilger
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Graf-Adolf-Str. 67
40210 Düsseldorf
E-Mail: archivar@lav.nrw.de
Tel. +49 211 159238-201
Andreas Pilger - am Freitag, 27. Mai 2011, 09:08 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.arl.org/sparc/partnering/planning/index.shtml
Hilfe für das Aufsetzen eines Open-Access-Journals.
(T)
Hilfe für das Aufsetzen eines Open-Access-Journals.
(T)
KlausGraf - am Freitag, 27. Mai 2011, 00:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 23:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/index.html
Adenauer spricht:
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/1961/panorama1841.html
(T)
Adenauer spricht:
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/1961/panorama1841.html
(T)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 23:47 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(T)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 23:44 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/scholar-guide/histoire-en-allemagne/bretschneider-guilbaud_archives
Falk Bretschneider, Juliette Guilbaud versuchen sich an einem Archivführer für junge französische Forscher. Besonders geglückt finde ich das nicht. Anstelle des kommerziellen Findbuch.nets hätte ein Hinweis auf die Zusammenstellung der Metasuchen http://archiv.twoday.net/stories/6424341/ gegeben werden müssen.
(W)
Falk Bretschneider, Juliette Guilbaud versuchen sich an einem Archivführer für junge französische Forscher. Besonders geglückt finde ich das nicht. Anstelle des kommerziellen Findbuch.nets hätte ein Hinweis auf die Zusammenstellung der Metasuchen http://archiv.twoday.net/stories/6424341/ gegeben werden müssen.
(W)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 23:19 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Hinweis auf einen Bericht in der c't:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg44934.html
(ML)
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg44934.html
(ML)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 21:04 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bergungsstelle.de/
Die Akten einer kleinen Berliner Dienststelle, die nur wenige Monate von Juli 1945 bis Februar 1946 existiert hat, wecken immer mehr das Interesse von Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt – die Berichte der „Bergungsstelle für wissenschaftliche Bibliotheken“.
Die Bergungsstelle hat während dieser kurzen Zeit über 200 private und öffentliche Bibliotheken im gesamten Stadtgebiet Berlins sichergestellt. Auf der Grundlage vorhandener Verzeichnisse und von Meldungen aus den Bezirksämtern war damals eine Liste von Bibliotheken erstellt worden, je Bibliothek wurde ein Bergungsauftrag vergeben und der Vorgang genau protokolliert.
Diese Bergungsaufträge und -berichte wurden nun komplett digitalisiert und stehen unter http://www.bergungsstelle.de allen Interessierten für eine detaillierte Auswertung zur Verfügung.
Die Akten stammen aus dem Landesarchiv Berlin.
(RSS) VÖBBLOG
Die Akten einer kleinen Berliner Dienststelle, die nur wenige Monate von Juli 1945 bis Februar 1946 existiert hat, wecken immer mehr das Interesse von Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt – die Berichte der „Bergungsstelle für wissenschaftliche Bibliotheken“.
Die Bergungsstelle hat während dieser kurzen Zeit über 200 private und öffentliche Bibliotheken im gesamten Stadtgebiet Berlins sichergestellt. Auf der Grundlage vorhandener Verzeichnisse und von Meldungen aus den Bezirksämtern war damals eine Liste von Bibliotheken erstellt worden, je Bibliothek wurde ein Bergungsauftrag vergeben und der Vorgang genau protokolliert.
Diese Bergungsaufträge und -berichte wurden nun komplett digitalisiert und stehen unter http://www.bergungsstelle.de allen Interessierten für eine detaillierte Auswertung zur Verfügung.
Die Akten stammen aus dem Landesarchiv Berlin.
(RSS) VÖBBLOG
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 21:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Jürgen Vielmeier legt den Finger in eine Wunde:
http://www.basicthinking.de/blog/2011/05/26/blogs-als-quelle-fur-traditionelle-medien-keine-lust-mehr-euer-fusvolk-zu-sein/
Plagiatkultur!
Update:
http://netzwertig.com/2011/05/27/blogs-contra-mainstream-medien-dilettanten-gibt-es-auf-beiden-seiten/
Onlinejournalismus im Netz hat ein enormes Imageproblem. Dabei ließe sich dies relativ einfach beheben:
1. Mehr Links zu externen Websites und Blogs
2. Mehr Sorgfalt und Genauigkeit bei Quellenangaben
3. Weniger Statusdenken bei der Wahl der Quellen (auch das Wall Street Journal hat nicht immer recht)
4. Mehr Anerkennung der Tatsache, dass manchmal Leser mehr wissen als man selbst
5. Meinung im Text deutlicher zulassen, statt Objektivität vorzugaukeln
6. Mehr transparente Korrektur von Artikeln, wenn sich Angaben als falsch herausgestellt haben
(RSS)
http://www.basicthinking.de/blog/2011/05/26/blogs-als-quelle-fur-traditionelle-medien-keine-lust-mehr-euer-fusvolk-zu-sein/
Plagiatkultur!
Update:
http://netzwertig.com/2011/05/27/blogs-contra-mainstream-medien-dilettanten-gibt-es-auf-beiden-seiten/
Onlinejournalismus im Netz hat ein enormes Imageproblem. Dabei ließe sich dies relativ einfach beheben:
1. Mehr Links zu externen Websites und Blogs
2. Mehr Sorgfalt und Genauigkeit bei Quellenangaben
3. Weniger Statusdenken bei der Wahl der Quellen (auch das Wall Street Journal hat nicht immer recht)
4. Mehr Anerkennung der Tatsache, dass manchmal Leser mehr wissen als man selbst
5. Meinung im Text deutlicher zulassen, statt Objektivität vorzugaukeln
6. Mehr transparente Korrektur von Artikeln, wenn sich Angaben als falsch herausgestellt haben
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Keine Offenbarung:
http://faz-community.faz.net/blogs/antike/archive/2011/05/26/so-selbstverstaendlich-wie-dosenbier-die-wikipedia-und-das-altertum.aspx
(RSS)
http://faz-community.faz.net/blogs/antike/archive/2011/05/26/so-selbstverstaendlich-wie-dosenbier-die-wikipedia-und-das-altertum.aspx
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 20:05 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Popstar? Junkie? Genie? Oder einfach bloß verrückt? Wer war Ludwig II. wirklich? Zwei Münchner Autoren haben die Boulevardpresse seiner Zeit und das Geheime Hausarchiv der Wittelsbacher durchforstet und ein verblüffendes Buch geschrieben: "Ludwig forever. Die phantastische Welt der Märchenkönigs".
König Ludwig II. starb vor 125 Jahren. Zu lesen gibt es über den "Märchenkönig" zwar schon mehr als genug, dennoch ist Thomas Endl und Klaus Reichold jetzt ein Buch über ihn gelungen, das ganz neue Blicke auf den "Kini" ermöglicht. Sie haben die Presse seiner Zeit durchforstet, sich durch Klatschspalten gearbeitet, sind Tagebücher von Zeitgenossen durchgegangen und haben im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher nach bislang wenig beachteten Fakten gesucht. So haben sie beispielsweise herausgefunden, dass schon während Ludwigs Regierungszeit Gerüchte die Runde machten, dass der König homoerotische Verhältnisse hatte.
"Es herrschte Krieg" - der Krieg gegen Österreich von 1866 - "und der König spielt auf der Roseninsel im Starnberger See mit dem Fürsten von Thurn und Taxis 'Fangermandl', das geht natürlich gar nicht", fasst Thomas Endl die zeitgenössische Kritik zusammen. In ihrem Buch "Ludwig forever" halten die Autoren auch fest, dass vieles am exzentrischen Verhalten des Königs auf etwas äußerst Banales zurückzuführen ist - beispielsweise Zahnschmerzen, die ihn zeitlebens plagten. Zum Schluss hatte er nur noch sechs Zähne im Mund. Ludwig II. nahm das Schmerzmittel Laudanum, ein Opiat, das sowohl Euphorie als auch Übellaunigkeit als Nebenwirkungen auslösen konnte - und ihn wohl so launisch werden ließ.
Auch zum Einschlafen brauchte der König ein Medikament. Das Chloralhydrat, das er nahm, hatte wahrscheinlich die Wirkung, seinen Schlafrhythmus immer weiter zu verschieben. "Es wäre denkbar, dass das bei Ludwig dazu geführt hat, dass er immer später aufgestanden ist, bis er eines Tages eigentlich erst um 19 Uhr aus dem Bett kam, gefrühstückt hat, nachts zwischen zwölf und eins gab es das Mittagessen, und um sieben Uhr in der Früh ist er dann ins Bett gegangen", sagt Klaus Reichold. Mit ihrem spannend geschriebenen Buch zeigen Endl und Reichold, dass man große Geschichte oft über Kleinigkeiten aus dem Alltag besser begreift - verblüffend und unterhaltsam."
Klaus Reichold, Thomas Endl
"Ludwig forever. Die phantastische Welt der Märchenkönigs"
Hoffmann & Campe 2011
ISBN-13:978-3-455-50200-8
Quelle: 3sat Kulturzeit, Lesezeit v. 18.5.2011
(S)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 18:50 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
mitgeteilt vom DAV (Deutscher Anwaltverein)
"Am 11. Mai 2011 hat das EU-Parlament die Einführung eines gemeinsamen Transparenz-Registers zwischen Kommission und EU-Parlament beschlossen. Dieses soll ab Juni 2011 online zugänglich sein. Auch der Rat wurde aufgefordert, dem Register beizutreten. Im Register eintragen sollen sich Beratungsfirmen, Wirtschafts- und Verbandsvertreter, NGOs, aber auch Rechtsanwälte, die Tätigkeiten ausüben, mittels derer auf zukünftige Gesetzgebung oder Entscheidungen Einfluss genommen werden soll. Erforderlich sind Angaben zu den Auftraggebern sowie deren Anteil am Umsatz. Wichtig für die Anwaltschaft ist, dass Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rechtsberatung ausgenommen sind. Nicht in den Anwendungsbereich fallen Kontakte mit den Institutionen, die dazu bestimmt sind, Mandanten über die allgemeine Rechtslage oder ihre Rechtsstellung zu informieren. Ebenfalls ausgenommen sind bestimmte anwaltliche Tätigkeiten zur Vermeidung von oder Vertretung in Verwaltungsverfahren. Nicht erfasst sind ferner Tätigkeiten eines Rechtsanwalts, der seinen Mandanten zu zukünftiger Gesetzgebung berät, ohne dabei Einfluss auf den Gesetzgeber zu nehmen. Errichtet werden soll zudem ein System für einen „legislativen Fußabdruck“, der im Annex von Berichten zu Gesetzestexten angeführt wird. Dieser beinhaltet u. a. die Auflistung der Personen, mit denen ein Abgeordneter während seiner Arbeit an den Normen Kontakt hatte (s. EiÜ 6/11)."
"Am 11. Mai 2011 hat das EU-Parlament die Einführung eines gemeinsamen Transparenz-Registers zwischen Kommission und EU-Parlament beschlossen. Dieses soll ab Juni 2011 online zugänglich sein. Auch der Rat wurde aufgefordert, dem Register beizutreten. Im Register eintragen sollen sich Beratungsfirmen, Wirtschafts- und Verbandsvertreter, NGOs, aber auch Rechtsanwälte, die Tätigkeiten ausüben, mittels derer auf zukünftige Gesetzgebung oder Entscheidungen Einfluss genommen werden soll. Erforderlich sind Angaben zu den Auftraggebern sowie deren Anteil am Umsatz. Wichtig für die Anwaltschaft ist, dass Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rechtsberatung ausgenommen sind. Nicht in den Anwendungsbereich fallen Kontakte mit den Institutionen, die dazu bestimmt sind, Mandanten über die allgemeine Rechtslage oder ihre Rechtsstellung zu informieren. Ebenfalls ausgenommen sind bestimmte anwaltliche Tätigkeiten zur Vermeidung von oder Vertretung in Verwaltungsverfahren. Nicht erfasst sind ferner Tätigkeiten eines Rechtsanwalts, der seinen Mandanten zu zukünftiger Gesetzgebung berät, ohne dabei Einfluss auf den Gesetzgeber zu nehmen. Errichtet werden soll zudem ein System für einen „legislativen Fußabdruck“, der im Annex von Berichten zu Gesetzestexten angeführt wird. Dieser beinhaltet u. a. die Auflistung der Personen, mit denen ein Abgeordneter während seiner Arbeit an den Normen Kontakt hatte (s. EiÜ 6/11)."
vom hofe - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 18:44 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Link
Dieser Ausschnitt aus Paul Klees "Hoffmanneske Scene" (Lithografie 1921) des Bauhaus-Archivs ziert den "Nobel-Sekt" eines großen Discounters.
Sind den LeserInnen noch weitere archivische Weinetiketten bekannt? Wenn ja, Hinweise sind als Kommentare erbeten.
(E)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 18:23 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.tiltfactor.org/metadata-games
There’s no shortage of fabulous archival material lurking in college and university collections. The trick is finding it.
Without good metadata—labels that tell researchers and search engines what’s in a photograph, say—those archives are as good as closed to many students and scholars. But many institutions don’t have the resources or manpower to tag their archives thoroughly.
Enter Metadata Games, an experiment in harnessing the power of the crowd to create archival metadata. A team of designers at Dartmouth College, working with archivists there, has created game interfaces that invite players to tag images, either playing alone or with a partner (sometimes a human, sometimes a computer). Solo players think up tags to describe the images they see; in the two-player scenario, partners try to come up with the same tag or tags. Read more at
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/gaming-the-archives/31435
See also
http://metadatagames.dartmouth.edu/mg/arcade/
http://thedartmouth.com/2011/05/25/news/metadata
http://archiv.twoday.net/stories/4568398/
(RSS)
There’s no shortage of fabulous archival material lurking in college and university collections. The trick is finding it.
Without good metadata—labels that tell researchers and search engines what’s in a photograph, say—those archives are as good as closed to many students and scholars. But many institutions don’t have the resources or manpower to tag their archives thoroughly.
Enter Metadata Games, an experiment in harnessing the power of the crowd to create archival metadata. A team of designers at Dartmouth College, working with archivists there, has created game interfaces that invite players to tag images, either playing alone or with a partner (sometimes a human, sometimes a computer). Solo players think up tags to describe the images they see; in the two-player scenario, partners try to come up with the same tag or tags. Read more at
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/gaming-the-archives/31435
See also
http://metadatagames.dartmouth.edu/mg/arcade/
http://thedartmouth.com/2011/05/25/news/metadata
http://archiv.twoday.net/stories/4568398/
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 17:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) testet seit Jahren Plagiaterkennungssysteme und hat die fünf besten auf die Guttenberg-Dissertation angesetzt: PlagAware, Turnitin/iThenticate, Ephorus, PlagScan und Urkund. Die Ergebnisse wurden anschließend mit denen des GuttenPlagWiki verglichen.
Anzeige
Keines der Systeme fand so viel wie die GuttenPlag-Gruppe, resümiert der in der aktuellen iX 6/11 veröffentlichte Bericht. Zudem variierten die angegebenen Prozentzahlen und Fundstellen bei einigen Systemen von Tag zu Tag. Die Tester der HTW Berlin empfehlen, bei einem Anfangsverdacht mehrere verschiedene Systeme einzusetzen und für die Interpretation fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich alle Arbeiten durch ein Plagiaterkennungssystem zu schicken, um dann oberhalb einer einfachen "Schwelle" die Lehrkräfte zu alarmieren, halten sie für übertrieben. Viel zu viele Fehlalarme wären die Folge.
"Die aktuellen Plagiaterkennungssysteme funktionieren am besten mit kleineren Texten wie Hausarbeiten. Für komplexe Texte mit vielen Zitaten und Fußnoten sind sie nur begrenzt geeignet", resümiert die iX.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Plagiaterkennungssysteme-auf-dem-Pruefstand-1250787.html
http://plagiat.htw-berlin.de/software/
(RSS)
Anzeige
Keines der Systeme fand so viel wie die GuttenPlag-Gruppe, resümiert der in der aktuellen iX 6/11 veröffentlichte Bericht. Zudem variierten die angegebenen Prozentzahlen und Fundstellen bei einigen Systemen von Tag zu Tag. Die Tester der HTW Berlin empfehlen, bei einem Anfangsverdacht mehrere verschiedene Systeme einzusetzen und für die Interpretation fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich alle Arbeiten durch ein Plagiaterkennungssystem zu schicken, um dann oberhalb einer einfachen "Schwelle" die Lehrkräfte zu alarmieren, halten sie für übertrieben. Viel zu viele Fehlalarme wären die Folge.
"Die aktuellen Plagiaterkennungssysteme funktionieren am besten mit kleineren Texten wie Hausarbeiten. Für komplexe Texte mit vielen Zitaten und Fußnoten sind sie nur begrenzt geeignet", resümiert die iX.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Plagiaterkennungssysteme-auf-dem-Pruefstand-1250787.html
http://plagiat.htw-berlin.de/software/
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 16:35 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Lateinischer Druck aus dem Jahr 1612:
http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/viewImage.xhtml?action=open&iddoc=1902869&page=1
(RSS)

http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/viewImage.xhtml?action=open&iddoc=1902869&page=1
(RSS)

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 16:32 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 16:14 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gemäß
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16535
möchte man es hoffen.
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/11446525/
(RSS)
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16535
möchte man es hoffen.
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/11446525/
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 16:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://collections.nlm.nih.gov/muradora/browse.action?parentId=nlm%3ADREPMHL-coll&type=1
"On May 23rd NLM announced the release of Medicine in the Americas, over 300 digital reproductions of early American printed books, now freely available, which showcases the early development of American medicine. "
http://openbiomed.info/2011/05/historical-oa-nlm/
(RSS)
"On May 23rd NLM announced the release of Medicine in the Americas, over 300 digital reproductions of early American printed books, now freely available, which showcases the early development of American medicine. "
http://openbiomed.info/2011/05/historical-oa-nlm/
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 15:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
a) Bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 konnten zwar Nutzungsrechte für noch nicht
bekannte Nutzungsarten wirksam eingeräumt werden. Dies setzte allerdings eine eindeutige Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung solcher Nutzungsrechte oder eine angemessene Beteiligung des Berechtigten an
den Erlösen aus deren Verwertung voraus. Auch die Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten an Filmwerken durch Filmurheber an Filmhersteller war nur unter dieser Voraussetzung wirksam.
b) Von einer eindeutigen Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht
bekannte Nutzungsarten konnte nach der bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 geltenden Rechtslage nur ausgegangen werden, wenn die Vertragspartner eine solche Rechtseinräumung ausdrücklich erörtert und vereinbart und damit erkennbar zum Gegenstand von Leistung und Gegenleistung gemacht haben.
Dafür reicht es regelmäßig nicht aus, dass die Vertragspartner pauschal auf Tarifordnungen oder Tarifverträge Bezug genommen haben, die unter anderem eine solche Rechtseinräumung vorsehen.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%2018/09&nr=56309 PDF I ZR 18/09
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=nutzungsart
(RSS)
bekannte Nutzungsarten wirksam eingeräumt werden. Dies setzte allerdings eine eindeutige Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung solcher Nutzungsrechte oder eine angemessene Beteiligung des Berechtigten an
den Erlösen aus deren Verwertung voraus. Auch die Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten an Filmwerken durch Filmurheber an Filmhersteller war nur unter dieser Voraussetzung wirksam.
b) Von einer eindeutigen Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht
bekannte Nutzungsarten konnte nach der bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 geltenden Rechtslage nur ausgegangen werden, wenn die Vertragspartner eine solche Rechtseinräumung ausdrücklich erörtert und vereinbart und damit erkennbar zum Gegenstand von Leistung und Gegenleistung gemacht haben.
Dafür reicht es regelmäßig nicht aus, dass die Vertragspartner pauschal auf Tarifordnungen oder Tarifverträge Bezug genommen haben, die unter anderem eine solche Rechtseinräumung vorsehen.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%2018/09&nr=56309 PDF I ZR 18/09
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=nutzungsart
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 15:41 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein sächsischer Journalist stellte dem Amtsgericht Weißwasser Fragen. Er wollte wissen, ob und in welchem Umfang ein dort tätiger Richter nebenberuflich Thailand-Reisen organisiert. In seiner Anfrage erwähnte er auch, dass der Anbieter sich durch den Begriff “Spezialreisen” von seinen Wettbewerbern abgrenzt.
Statt einer vernünftigen Antwort flatterte dem Journalisten nun ein Strafbefehl ins Haus. Natürlich vom Amtsgericht Weißwasser. Der Vorwurf: Der Journalist soll den Richter beleidigt haben, denn die Verwendung des Begriffs Spezialreisen beinhalte den Vorwurf, der Betreffende sei auf dem Gebiet des Sextourismus tätig.
Hierbei dürfte es sich um eine sehr einseitige Interpretation handeln. Der Journalist beteuert jedenfalls, dass er in seiner Anfrage lediglich den Begriff Spezialreisen aufgegriffen und keinerlei Unterstellung damit verbunden hat. Der Betroffene will sich gegen den Strafbefehl wehren. Er wird von Journalistenverbänden unterstützt, die einen Einschüchterungsversuch gegenüber der Presse sehen.
Das tue ich auch.
So Udo Vetter:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/05/26/wie-sachsens-justiz-journalisten-antwortet/
ZAPP-Beitrag:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_wirtschaft/sachsensumpf111.html
(RSS)
Statt einer vernünftigen Antwort flatterte dem Journalisten nun ein Strafbefehl ins Haus. Natürlich vom Amtsgericht Weißwasser. Der Vorwurf: Der Journalist soll den Richter beleidigt haben, denn die Verwendung des Begriffs Spezialreisen beinhalte den Vorwurf, der Betreffende sei auf dem Gebiet des Sextourismus tätig.
Hierbei dürfte es sich um eine sehr einseitige Interpretation handeln. Der Journalist beteuert jedenfalls, dass er in seiner Anfrage lediglich den Begriff Spezialreisen aufgegriffen und keinerlei Unterstellung damit verbunden hat. Der Betroffene will sich gegen den Strafbefehl wehren. Er wird von Journalistenverbänden unterstützt, die einen Einschüchterungsversuch gegenüber der Presse sehen.
Das tue ich auch.
So Udo Vetter:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/05/26/wie-sachsens-justiz-journalisten-antwortet/
ZAPP-Beitrag:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_wirtschaft/sachsensumpf111.html
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 15:27 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14145 weist auf die neue Suche der ÖNB Wien aufmerksam.
http://search.obvsg.at/ONB/de_DE
Mit dem Reiter "Digitale Ressourcen" kann man auch Digitalisate finden, die über die allzu lückenhafte Liste der digitalen Projekte nicht auffindbar sind:
http://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_lesesaal.htm
Man hat dann aber das Problem, die Digitalisate zu verlinken. Dazu muss man in den "Details" den Link unter "Digitales Objekt" kopieren (in der Hoffnung, dass der persistent bleibt). Beispiele:
http://data.onb.ac.at/dtl/582093
http://data.onb.ac.at/dtl/1274607 Inkunabel
http://data.onb.ac.at/dtl/2382867 Laienspiegel 1511
Erfasst sind auch die seit 2007 einsehbaren ANNO-Buchdigitalisate:
http://archiv.twoday.net/stories/3514233/
Verlinkt ist dabei sowohl die bisherige Präsentation als auch der Standard-Viewer:
http://data.onb.ac.at/book/AC06710039 Anzengruber
http://data.onb.ac.at/dtl/282867
(RSS)
Update:
http://agfnz.historikerverband.de/?p=799

http://search.obvsg.at/ONB/de_DE
Mit dem Reiter "Digitale Ressourcen" kann man auch Digitalisate finden, die über die allzu lückenhafte Liste der digitalen Projekte nicht auffindbar sind:
http://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_lesesaal.htm
Man hat dann aber das Problem, die Digitalisate zu verlinken. Dazu muss man in den "Details" den Link unter "Digitales Objekt" kopieren (in der Hoffnung, dass der persistent bleibt). Beispiele:
http://data.onb.ac.at/dtl/582093
http://data.onb.ac.at/dtl/1274607 Inkunabel
http://data.onb.ac.at/dtl/2382867 Laienspiegel 1511
Erfasst sind auch die seit 2007 einsehbaren ANNO-Buchdigitalisate:
http://archiv.twoday.net/stories/3514233/
Verlinkt ist dabei sowohl die bisherige Präsentation als auch der Standard-Viewer:
http://data.onb.ac.at/book/AC06710039 Anzengruber
http://data.onb.ac.at/dtl/282867
(RSS)
Update:
http://agfnz.historikerverband.de/?p=799

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 14:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aber die meisten Gerichte ignorieren das:
http://www.internet-law.de/2011/05/filesharing-wie-die-gerichte-argumentieren.html
(RSS)
http://www.internet-law.de/2011/05/filesharing-wie-die-gerichte-argumentieren.html
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 14:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 14:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nach Ansicht der CDU/FDP-Regierung in Kiel sollen personenbezogene Daten nur noch im Internet veröffentlicht werden dürfen, wenn eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Ausnahmen sollen lediglich für Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen oder durch die Betroffenen selbst veröffentlichte Informationen gelten."
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=4925
Gilt natürlich nur für öffentliche Stellen, siehe
http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Achtung-LDSG-richtet-sich-nur-an-Behoerden/forum-200729/msg-20291525/read/
Aber natürlich auch für Archivfindbücher im Netz ...
(RSS)
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=4925
Gilt natürlich nur für öffentliche Stellen, siehe
http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Achtung-LDSG-richtet-sich-nur-an-Behoerden/forum-200729/msg-20291525/read/
Aber natürlich auch für Archivfindbücher im Netz ...
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 14:35 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.stgallplan.org/stgallmss/index.html
Since the first half of the ninth century, the librarians at the monasteries of Reichenau and St. Gall kept records of the books owned by the monasteries. Both possessed extensive libraries, which contained books produced in their own scriptoria as well as those acquired elsewhere. Many of these books survive to this day. The manuscripts collected here are intended to be a virtual presentation of the two monasteries’ libraries as they were in the ninth century. These manuscripts give us a window into the intellectual context that inspired the creation of the Plan and informed the monastic tradition visible in the Plan.
By selecting one of the manuscripts from the drop-down menu on the left, you can examine that manuscript page by page. Each manuscript is accompanied by a table of contents and codicological description. Further bibliography on the manuscripts and their contents can be found via links to the International Medieval Bibliography and the Lexikon des Mittelalters (n.b.: these are external sites with subscription requirements). For some manuscripts, a standard edition text for a work within the codex has been provided, and for a small portion, there are also English translations. Please note that in most instances these are not transcriptions of the manuscript.
By June 2012 the virtual library will contain 168 manuscripts. The process of expansion begins with the publication of images of the manuscripts, and is followed by adding the table of contents for each manuscript and a codiocological description. Manuscripts that are already have some cataloging information are indicated with an asterisk next to their shelfmark in the drop-down menus. Currently there is no search function available for the library, but a brief catalog of the contents is available here (note: the production blog can be searched via the option in the upper left corner). We shall also be adding a series of virtual tours of the library, which will highlight selected manuscripts and will provide insight into the life of the monasteries of Reichenau and St. Gall as well as the Carolingian world that sustained them.
Terms of Use: The manuscripts on this site are provided solely for individual, non-commercial use. Reproduction of these images for publication, redistribution, licensing or sale is not permitted, nor is downloading of the images. All images are provided by the permission of the institutions that own the images and/or manuscripts. All inquiries concerning downloading or reproduction should be referred to the owning institution. Contact information for the owning institution is provided with each manuscript. By proceeding past this page into the virtual library, users agree to these terms.
Zugänge vermerkt das Blog:
http://reichenau-stgall-library.blogspot.com/
Da sowohl die BLB Karlsruhe ihre Reichenauer Handschriften digitalisiert als auch die Stiftsbibliothek St. Gallen ihre frühmittelalterlichen Codices sind die Digitalisate vor allem dann von Bedeutung, wenn die Handschriften dort noch nicht vorliegen sowie bei dem in anderen Bibliotheken (Cambridge, Neapel, Wien usw.) gelandetem Streugut.
So löst sich übrigens auch das in
http://archiv.twoday.net/stories/6069073/
thematisierte Rätsel. Die Digitalisate des Projekts liegen auch auf dem UCLA-Server:
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0015vcjk
(W)
Since the first half of the ninth century, the librarians at the monasteries of Reichenau and St. Gall kept records of the books owned by the monasteries. Both possessed extensive libraries, which contained books produced in their own scriptoria as well as those acquired elsewhere. Many of these books survive to this day. The manuscripts collected here are intended to be a virtual presentation of the two monasteries’ libraries as they were in the ninth century. These manuscripts give us a window into the intellectual context that inspired the creation of the Plan and informed the monastic tradition visible in the Plan.
By selecting one of the manuscripts from the drop-down menu on the left, you can examine that manuscript page by page. Each manuscript is accompanied by a table of contents and codicological description. Further bibliography on the manuscripts and their contents can be found via links to the International Medieval Bibliography and the Lexikon des Mittelalters (n.b.: these are external sites with subscription requirements). For some manuscripts, a standard edition text for a work within the codex has been provided, and for a small portion, there are also English translations. Please note that in most instances these are not transcriptions of the manuscript.
By June 2012 the virtual library will contain 168 manuscripts. The process of expansion begins with the publication of images of the manuscripts, and is followed by adding the table of contents for each manuscript and a codiocological description. Manuscripts that are already have some cataloging information are indicated with an asterisk next to their shelfmark in the drop-down menus. Currently there is no search function available for the library, but a brief catalog of the contents is available here (note: the production blog can be searched via the option in the upper left corner). We shall also be adding a series of virtual tours of the library, which will highlight selected manuscripts and will provide insight into the life of the monasteries of Reichenau and St. Gall as well as the Carolingian world that sustained them.
Terms of Use: The manuscripts on this site are provided solely for individual, non-commercial use. Reproduction of these images for publication, redistribution, licensing or sale is not permitted, nor is downloading of the images. All images are provided by the permission of the institutions that own the images and/or manuscripts. All inquiries concerning downloading or reproduction should be referred to the owning institution. Contact information for the owning institution is provided with each manuscript. By proceeding past this page into the virtual library, users agree to these terms.
Zugänge vermerkt das Blog:
http://reichenau-stgall-library.blogspot.com/
Da sowohl die BLB Karlsruhe ihre Reichenauer Handschriften digitalisiert als auch die Stiftsbibliothek St. Gallen ihre frühmittelalterlichen Codices sind die Digitalisate vor allem dann von Bedeutung, wenn die Handschriften dort noch nicht vorliegen sowie bei dem in anderen Bibliotheken (Cambridge, Neapel, Wien usw.) gelandetem Streugut.
So löst sich übrigens auch das in
http://archiv.twoday.net/stories/6069073/
thematisierte Rätsel. Die Digitalisate des Projekts liegen auch auf dem UCLA-Server:
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0015vcjk
(W)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 14:14 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mehrfach eingedrungenes Regenwasser hat zu erheblichen Schäden bei der UB Erlangen-Nürnberg geführt, etwa 450 Werke mussten aufgrund Schimmelbefalls weggeworfen werden.
http://bibliothekarisch.de/blog/2011/05/25/wasserschaden-in-der-ub-erlangen-nurnberg/
(RSS)
http://bibliothekarisch.de/blog/2011/05/25/wasserschaden-in-der-ub-erlangen-nurnberg/
(RSS)
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 13:53 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.friulinprin.beniculturali.it
Friuli in prin is the title chosen for the data bank on the historical registering of families in Friuli. The Friulian language sounded just right – “in prin” suggesting immediately not only the passing of time but also the realisation of changes which have happened. Time and change are after all the two cardinal points for the study of history and the interpretation of the past. Il tempo e il mutamento sono infatti i due cardini dello studio storico e dell’interpretazione del passato.
The project was conceived by the State Archive of Udine to promote the sources of the history of the people. It has been recognised by the President of the Council of Ministers for the quality of service it offers citizens and is financed by law 482/99 concerning the protection of minority languages. Friuli in prin is a data bank which organises registry documents, connects them to people and fixes important biographical events of generations of Friulians who lived between the second half of the 19th century and the 20th century.
(RSS)

Friuli in prin is the title chosen for the data bank on the historical registering of families in Friuli. The Friulian language sounded just right – “in prin” suggesting immediately not only the passing of time but also the realisation of changes which have happened. Time and change are after all the two cardinal points for the study of history and the interpretation of the past. Il tempo e il mutamento sono infatti i due cardini dello studio storico e dell’interpretazione del passato.
The project was conceived by the State Archive of Udine to promote the sources of the history of the people. It has been recognised by the President of the Council of Ministers for the quality of service it offers citizens and is financed by law 482/99 concerning the protection of minority languages. Friuli in prin is a data bank which organises registry documents, connects them to people and fixes important biographical events of generations of Friulians who lived between the second half of the 19th century and the 20th century.
(RSS)

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 13:47 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"At the National Archives, we’re always trying to think of new ways to make our historical records more accessible to the public. We have only a small fraction of our 10 billion records online, so it’s clear we’ve got to get creative.
It’s vital that we learn how other institutions address this challenge. One approach we’re seeing is for institutions to engage citizens in crowdsourcing or microvolunteering projects. These projects leverage the enthusiasm and willingness of online volunteers to transcribe or geotag historical records online.
Yesterday, we hosted a public program in the McGowan Theater called “Are You In? Citizen Archivists, Crowdsourcing, and Open Government. We heard about three innovative projects:
the World Archives Project ( http://community.ancestry.com/wap/download_ie.aspx ) from Ancestry.com,
the Map Warper Project ( http://maps.nypl.org/warper/ ) from the New York Public Library, and
the North American Bird Phenology Program ( http://www.pwrc.usgs.gov/bpp/ ) from the U.S. Geological Survey "
AOTUS, 19.05.2011
(W)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 09:09 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stellten das neue Schreibkursangebot des Gemeindearchivs und der Senioren-Service-Stelle der Gemeinde Burbach vor: Archivarin Patricia Ottilie, Bürgermeister Christoph Ewers und Seniorenbeauftragte Christine Sahm.
"Wer den Einkaufszettel der Uroma endlich lesen möchte, für den bieten das Gemeindearchiv Burbach und die Senioren-Service-Stelle der Gemeinde das passende Angebot. Im Juni beginnt der erste Lese- und Schreibkurs zur Offenbacher Schrift, einer Artverwandten der Sütterlin-Schrift.
Unter fachkundiger Leitung der Gemeindearchivarin Patricia Ottilie können Interessierte an jedem Dienstag im Juni die auch als „Rudolf-Koch-Kurrent“ bezeichnete Schrift erlernen. Mit Lese- und Schreibproben sowie dem Erlernen der Buchstaben werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, alte Tagebücher von Verwandten oder Postkarten aus vergangenen Zeiten zu lesen. Nach Kursende können selbst Briefe in der Offenbacher Schrift verfasst werden.
Wer bereits Kenntnisse hat, ist ebenfalls herzlich zur Auffrischung willkommen.
Die Offenbacher Schrift wurde 1927 von Rudolf Koch entwickelt. Sie war in Süd- und Mitteldeutschland sowie den Rheinlanden verbreitet und wurde vereinzelt an bundesdeutschen Grundschulen bis Mitte der 1960er Jahre als Zweitschrift gelehrt. Diese Kurrentschrift zählt zu den Sütterlin-Handschriften und soll leichte Schreibbarkeit mit ästhetischer Schönheit verbinden.
Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich entweder bei dem Archiv oder der Senioren-Service-Stelle der Gemeinde Burbach anmelden. Ansprechpartner sind Patricia Ottilie, Telefon 02736/45-46, E-Mail p_ottilie@burbach-siegerland.de oder Christine Sahm, Telefon 02736/45-56, E-Mail c_sahm@burbach-siegerland.de. Der Kurs findet jeweils von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule Burbach, Marktplatz, statt und kostet pro Person 12 € zzgl. Material. Das Teilnahmeentgelt wird am ersten Kursabend eingesammelt. "

Die Offenbacher Schrift, eine Artverwandte der Sütterlin-Schrift, können Interessierte jetzt in Burbach erlernen.
Link zum Flyer (PDF)
Quelle: Gemeinde Burbach, Pressemitteilung v. 19.05.2011
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=gemeindearchiv+burbach
(S)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Mai 2011, 08:53 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Literaturzentrum Neubrandenburg hat fünf Originalbriefe des französischen Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Romain Rolland an Hans Fallada erworben. "Die Briefe dokumentieren eine frühe Etappe auf dem Entwicklungsweg des jungen Rudolf Ditzen zum Schriftsteller, der später unter dem Pseudonym Hans Fallada weltberühmt wurde", sagte Geschäftsführerin Erika Becker der Nachrichtenagentur dpa.
Die Briefe aus den Jahren 1912/13 sollen Forschern im Hans-Fallada-Archiv in Carwitz bei Feldberg (Mecklenburg-Vorpommern) zur Verfügung stehen."
Quelle: 3satText 25.05.11 S.508-1
(S)
Die Briefe aus den Jahren 1912/13 sollen Forschern im Hans-Fallada-Archiv in Carwitz bei Feldberg (Mecklenburg-Vorpommern) zur Verfügung stehen."
Quelle: 3satText 25.05.11 S.508-1
(S)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 21:59 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Akademie der Künste erhält einen schriftlichen Teilnachlass des Malers Eugen Spiro. Ermöglicht wurde dieser Archivzuwachs durch die Vermittlung des heute in London lebenden Sohns Peter Spiro. Anlässlich der Archivübernahme würdigt die Akademie am Mittwoch, den 1. Juni, Leben und Werk des Künstlers mit einer Veranstaltung am Pariser Platz. Ebenfalls am 1. Juni wird an Eugen Spiros ehemaliger Wohnung und einstigem Atelier (Reichsstraße 106) eine Gedenktafel enthüllt.
Eugen Spiro, 1874 in Breslau geboren, zählte zu den bekanntesten Porträtisten der Berliner Prominenz während der Weimarer Republik. Heute gilt er als Chronist des Kultur- und Geisteslebens zwischen den Kriegen. Als zumeist ehrenamtlicher Kulturorganisator sah er sich – in unterschiedlichsten Funktionen – der Sache der bildenden Kunst verpflichtet. Sein außerordentliches Organisationstalent setzte er als führendes Mitglied der Berliner Secession, als Vorsitzender des Kartells der Vereinigten Verbände bildender Künstler und als Mitglied der Auftragskommission der Berliner Nationalgalerie ein, bis er nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 seine Ämter niederlegte. 1935 emigrierte er nach Paris und gründete dort 1938 mit den Malern Heinz Lohmar und Gert Wollheim sowie dem Kunstkritiker Paul Westheim den Freien Deutschen Künstlerbund (L’union des artistes libres). Als Präsident des Künstlerbundes trat er für die Vereinigung aller deutschen und österreichischen Künstler im Ausland ein, um damit der Kulturzerstörung in Deutschland entgegenzutreten. Unterstützt von zahlreichen Künstlern und Intellektuellen wurde im Pariser „Maison de la Culture“ 1938 eine Gegenausstellung zur Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ von 1937 ausgerichtet. 1941 emigrierte Spiro in die USA, wo er 1972 in New York verstarb.
Das Eugen-Spiro-Archiv enthält u.a. den Schriftwechsel Eugen Spiros in seiner Funktion als Erster Vorsitzender des Freien Deutschen Künstlerbundes, Unterlagen über die Pariser Ausstellung (1938-1939) und Briefe Pauls Westheims (1937-1938), dessen Nachlass ebenfalls im Archiv Bildende Kunst der Akademie betreut wird.
Das Archiv Bildende Kunst der Akademie der Künste ist eine der umfangreichsten Quellensammlungen zur deutschen Kunstgeschichte seit 1900. Es sammelt, bewahrt und erschließt die schriftlichen Nachlässe von Malern, Grafikern, Bildhauern, Kunsthistorikern und Publizisten sowie die Bestände von Künstlervereinigungen und -verbänden.
Veranstaltungsdaten
Eugen Spiro. Künstler, Organisator, Exilant
Archivpräsentation in der Akademie der Künste u.a. mit Peter Spiro und Wolfgang Unterzaucher
Mittwoch, 1. Juni 2011, 20 Uhr, Pariser Platz 4, Plenarsaal
Eintritt € 5,- / ermäßigt 3,-
Kartenreservierung 030 20057-1000
Pressekarten: Um Anmeldung wird gebeten. Tel. unter 030 20057-1514 oder per E-Mail an presse@adk.de
Für Rückfragen: Michael Krejsa, Leiter Archiv Bildende Kunst, Tel. 030 20057-4051, krejsa@adk.de "
Quelle: Akademie der Künste, Pressemitteilung v. 25.5.2011
s. a. 3satText 25.05.11 S.506
Wikipedia-Artikel zu Eugene Spiro
(S)
Eugen Spiro, 1874 in Breslau geboren, zählte zu den bekanntesten Porträtisten der Berliner Prominenz während der Weimarer Republik. Heute gilt er als Chronist des Kultur- und Geisteslebens zwischen den Kriegen. Als zumeist ehrenamtlicher Kulturorganisator sah er sich – in unterschiedlichsten Funktionen – der Sache der bildenden Kunst verpflichtet. Sein außerordentliches Organisationstalent setzte er als führendes Mitglied der Berliner Secession, als Vorsitzender des Kartells der Vereinigten Verbände bildender Künstler und als Mitglied der Auftragskommission der Berliner Nationalgalerie ein, bis er nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 seine Ämter niederlegte. 1935 emigrierte er nach Paris und gründete dort 1938 mit den Malern Heinz Lohmar und Gert Wollheim sowie dem Kunstkritiker Paul Westheim den Freien Deutschen Künstlerbund (L’union des artistes libres). Als Präsident des Künstlerbundes trat er für die Vereinigung aller deutschen und österreichischen Künstler im Ausland ein, um damit der Kulturzerstörung in Deutschland entgegenzutreten. Unterstützt von zahlreichen Künstlern und Intellektuellen wurde im Pariser „Maison de la Culture“ 1938 eine Gegenausstellung zur Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ von 1937 ausgerichtet. 1941 emigrierte Spiro in die USA, wo er 1972 in New York verstarb.
Das Eugen-Spiro-Archiv enthält u.a. den Schriftwechsel Eugen Spiros in seiner Funktion als Erster Vorsitzender des Freien Deutschen Künstlerbundes, Unterlagen über die Pariser Ausstellung (1938-1939) und Briefe Pauls Westheims (1937-1938), dessen Nachlass ebenfalls im Archiv Bildende Kunst der Akademie betreut wird.
Das Archiv Bildende Kunst der Akademie der Künste ist eine der umfangreichsten Quellensammlungen zur deutschen Kunstgeschichte seit 1900. Es sammelt, bewahrt und erschließt die schriftlichen Nachlässe von Malern, Grafikern, Bildhauern, Kunsthistorikern und Publizisten sowie die Bestände von Künstlervereinigungen und -verbänden.
Veranstaltungsdaten
Eugen Spiro. Künstler, Organisator, Exilant
Archivpräsentation in der Akademie der Künste u.a. mit Peter Spiro und Wolfgang Unterzaucher
Mittwoch, 1. Juni 2011, 20 Uhr, Pariser Platz 4, Plenarsaal
Eintritt € 5,- / ermäßigt 3,-
Kartenreservierung 030 20057-1000
Pressekarten: Um Anmeldung wird gebeten. Tel. unter 030 20057-1514 oder per E-Mail an presse@adk.de
Für Rückfragen: Michael Krejsa, Leiter Archiv Bildende Kunst, Tel. 030 20057-4051, krejsa@adk.de "
Quelle: Akademie der Künste, Pressemitteilung v. 25.5.2011
s. a. 3satText 25.05.11 S.506
Wikipedia-Artikel zu Eugene Spiro
(S)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 21:49 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Selbstporträt, um 1932 (LAB F Rep. 290-02-06)
"Ort: Rathaus Schöneberg, Foyer, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin
Dauer der Ausstellung: 25.5. – 29.6.2011, Mo - So, 10 - 18 Uhr, Eintritt frei
Gerichtsreportagen waren in der Weimarer Republik ein journalistisches Genre, das auf ein breites öffentliches Interesse stieß. In dieser vom Landesarchiv Berlin konzipierten Ausstellung, die im Kontext mit der Ausstellungsinstallation „Wir waren Nachbarn – 136 Biografien jüdischer Zeitzeugen“ steht, wird das frühe fotografische Werk des Gerichtsreporters des „Vorwärts“, Leo Rosenthal (1884-1969) präsentiert. Sie zeigt heimlich aufgenommene Fotografien aus dem Gerichtssaal in der durch soziale und politische Umbrüche geprägten Zeit zwischen Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre. Leo Rosenthal erfasste mit seiner Kamera insbesondere Prozesse mit politischem Hintergrund, u.a. den Sexualreformer Magnus Hirschfeld und den später von den Nationalsozialisten verfolgten Rechtsanwalt Hans Litten. Im April 1933 musste der Jude und Sozialdemokrat Leo Rosenthal Deutschland verlassen. In New York arbeitete er später als Fotograf, u.a. für die Bildagentur PIX und bei den Vereinten Nationen.
Neben den Fotografien vermitteln biographische Materialien, unter anderem aus seiner Entschädigungsakte, einen Eindruck von dem Leben des Juristen, Journalisten und Fotografen Leo Rosenthal.
Für weitere Informationen, Anforderung kostenlosen Pressematerials und zur Vereinbarung von Presseführungen wenden Sie sich bitte an:
Barbara Esch Marowski Kunstamt Tempelhof - Schöneberg, Fon 90277 – 7465/ -6964, Mail: esch-marowski@ba-ts.berlin.de"
Quelle: Berlin, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Pressemitteilung Nr. 181 vom 19.04.2011
"Anlässlich des 40. Todestages erfährt das frühe fotografische Werk des Gerichtsreporters des "Vorwärts" in der Ausstellung "Leo Rosenthal. Ein Chronist in der Weimarer Republik" in der Zeit vom 19. November 2009 bis 20. März 2010 im Landesarchiv Berlin eine Würdigung.
Gerichtsberichterstattung - schreibend und fotografierend - war in der Weimarer Republik ein journalistisches Genre, das auf ein breites öffentliches Interesse stieß und eng verknüpft ist mit Namen wie Erich Salomon, Gabriele Tergit oder Paul Schlesinger. Mit Leo Rosenthal wird in der Ausstellung ein Vertreter der sozialdemokratischen Presse vorgestellt.
Die Fotografien Leo Rosenthals dokumentieren die Berliner Gerichtssäle einer Zeit, die durch soziale und politische Umbrüche geprägt war. Rosenthals Interesse galt den Hintergründen der politischen Skandale, den Zwischentönen des sozialen Lebens gegen Ende der Weimarer Republik. Seine politische Haltung spiegelt sich in seinen zeitgenössisch und nachträglich erstellten Bildkommentaren wider. Kritisch reflektiert er Standesdünkel und zeigt die zur Macht drängenden Nationalsozialisten. Seine Sympathien galten den "kleinen Leuten".
Rosenthal hielt Szenen aus spektakulären Prozessen fest. Im "Edenpalast-Prozess" 1931 fotografierte er einen angespannten Adolf Hitler nach der Vernehmung durch den Rechtsanwalt und NS-Gegner Hans Litten. Gefälschte Bilder im Stil des Malers Vincent van Gogh boten das faszinierende Motiv für eine Bilderserie über den aufsehenerregenden Prozess gegen den Kunsthändler Otto Wacker im April 1932. Rosenthals Fotos zeigen Kunstsachverständige wie Julius Meier-Gräfe und Ludwig Justi und Vincent Wilhelm van Gogh, den Neffen des Malers.
Rosenthal fertigte Aufnahmen von Prominenten und Unbekannten der Weimarer Republik - auf der Anklagebank, als Zuschauer, als Zeugen. Zu sehen sind unter anderem die Schauspielerin Gitta Alpar (1932), Oberbürgermeister Gustav Böss (1929), der Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein (1931), der SPD-Fraktionsvorsitzende im Preußischen Landtag Ernst Heilmann (1930), der Sexualreformer Magnus Hirschfeld (1930) und der später von den Nationalsozialisten verfolgte Rechtsanwalt und Hitlergegner Hans Litten (1931/32).
Leo Rosenthals Leben war durch das Exil geprägt. Stationen seines Lebens waren Riga, Moskau, Berlin, Paris und New York. Am 25. August 1884 in Riga als Sohn eines Juweliers geboren, studierte Rosenthal Jura und praktizierte als Rechtsanwalt in Moskau. 1922 kam er nach Berlin, wo er als Gerichtsberichterstatter für die sozialdemokratische Zeitung "Vorwärts" arbeite. Im April 1933 musste der Jude und Sozialdemokrat Leo Rosenthal Deutschland verlassen. Seine Familie in Lettland wurde im Holocaust ermordet. Als die Deutschen Frankreich besetzten, floh Rosenthal erneut, diesmal in die Vereinigten Staaten. In New York arbeitete er als Fotograf, u.a. für die Bildagentur PIX und bei den Vereinten Nationen. Am 28. Oktober 1969 starb Rosenthal in New York.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 57 in thematischen Gruppen angeordnete Motive, die gleichsam exemplarisch für das Werk Rosenthals stehen: Prozesse mit politischem Hintergrund - Nationalsozialisten, Sozialdemokraten, Kommunisten und Pressevertreter vor Gericht, Sensationsprozesse, Zeugen und Zuhörer, Gerichtsalltag. Ausgewählte Straf- und Ermittlungsakten mit Asservaten ermöglichen Einblicke in prozessuale Abläufe und ergänzen die dargestellten Motive. Biographische Materialien, unter anderem aus seiner Entschädigungsakte, vermitteln einen Eindruck von einem Leben des Juristen, Journalisten und Fotografen Leo Rosenthal. "
Quelle: Landesarchiv Berlin
Presseecho:
Die Welt, 22.5.11
TAZ Hamburg, 23.5.11
Auszug aus der Beständeübersicht des Landesarchivs Berlin zu F Rep. 290-02-06 Sammlung Leo Rosenthal
(W)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 21:21 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Anfang April wurde hier darüber informiert, dass der Internationale
Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen die Herausgabe bestellter Kopien verweigert mit eigenwilligen Interpretationen des Begriffs "Bestände" (siehe http://archiv.twoday.net/stories/16556128/).
In einzelnen Archivalien enthaltene Listen, beispielsweise 13 Blatt mit niederländischen Zwangsarbeitern, gelten dort als "Bestände" und dürfen daher angeblich nicht als Kopie herausgegeben werden.
Ich habe den ITS um die dort gültige Definition von "Bestand" gebeten. Bislang habe ich aber weder eine Definition aus Arolsen bekommen noch die im Januar bestellten Kopien zur Auswertung. Zumindest ist es dem ITS bislang gelungen, damit die Forschung zu Zwangsarbeit, Holocaust und Widerstand in Berlin-Neukölln erst einmal für mehr als ein Vierteljahr zu blockieren.
Der ITS hat das Ganze vertagt bis zur Sitzung des Internationalen
Ausschusses - eines Aufsichtsgremiums, das aus Regierungsvertretern von elf Nationen besteht. Möglicherweise wird da bei der vermutlich Ende Mai stattfindenden Jahressitzung neu festgelegt, was unter "Beständen" zu verstehen ist.
Der ITS hatte Ende vergangenen Jahres geschrieben
>"Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren." (https://archiv.twoday.net/stories/11430012/)
Dies hatte Klaus Graf so kommentiert:
>Man kann auch mit Eingaben an den Heiligen Stuhl wenden, vielleicht ist da die Erfolgquote höher.
Das fürchte ich auch und bin gespannt, wie das Diplomatengremium den Begriff definiert und wo das Protokoll der Sitzung einzusehen ist.
Bernhard Bremberger
-----------------------------------
Dr. Bernhard Bremberger
Reuterstrasse 78
12053 Berlin
Tel. 030 / 6237187
www.zwangsarbeit-forschung.de
Anfang April wurde hier darüber informiert, dass der Internationale
Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen die Herausgabe bestellter Kopien verweigert mit eigenwilligen Interpretationen des Begriffs "Bestände" (siehe http://archiv.twoday.net/stories/16556128/).
In einzelnen Archivalien enthaltene Listen, beispielsweise 13 Blatt mit niederländischen Zwangsarbeitern, gelten dort als "Bestände" und dürfen daher angeblich nicht als Kopie herausgegeben werden.
Ich habe den ITS um die dort gültige Definition von "Bestand" gebeten. Bislang habe ich aber weder eine Definition aus Arolsen bekommen noch die im Januar bestellten Kopien zur Auswertung. Zumindest ist es dem ITS bislang gelungen, damit die Forschung zu Zwangsarbeit, Holocaust und Widerstand in Berlin-Neukölln erst einmal für mehr als ein Vierteljahr zu blockieren.
Der ITS hat das Ganze vertagt bis zur Sitzung des Internationalen
Ausschusses - eines Aufsichtsgremiums, das aus Regierungsvertretern von elf Nationen besteht. Möglicherweise wird da bei der vermutlich Ende Mai stattfindenden Jahressitzung neu festgelegt, was unter "Beständen" zu verstehen ist.
Der ITS hatte Ende vergangenen Jahres geschrieben
>"Im übrigen bleibt es jedem Nutzer, der sich ungerecht behandelt fühlen sollte, unbenommen, an das "Governing Body" (den internationalen Ausschuss) oder an das "Managing Body" (das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf) zu appellieren." (https://archiv.twoday.net/stories/11430012/)
Dies hatte Klaus Graf so kommentiert:
>Man kann auch mit Eingaben an den Heiligen Stuhl wenden, vielleicht ist da die Erfolgquote höher.
Das fürchte ich auch und bin gespannt, wie das Diplomatengremium den Begriff definiert und wo das Protokoll der Sitzung einzusehen ist.
Bernhard Bremberger
-----------------------------------
Dr. Bernhard Bremberger
Reuterstrasse 78
12053 Berlin
Tel. 030 / 6237187
www.zwangsarbeit-forschung.de
Bremberger - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 20:55 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Rahmen des Wettbewerbs "Archiv und Jugend" des Landes Nordrhein-Westfalen arbeiten Schüler der Albert-Einstein-Gesamtschule Remscheid seit vier Monaten mit dem Archiv der Stadt Remscheid und der Museumspädagogik des Deutschen Werkzeugmuseums zusammen. Das Projekt trägt den Titel "kids@hiz – podcast und radio" und verknüpft klassische Archivbereiche mit interaktiven Interview-Elementen und medialer Präsentation. Schwerpunkt ist die Beschäftigung der Jugendlichen mit der Remscheider Mundart, dem "Remscheder Platt". Die Ergebnisse sollen später in einer von den jungen Leuten selbst erstellten Radiosendung verwertet werden.
Remscheider Platt ist für alle der teilnehmenden Jugendlichen eine "fremde" Sprache – sowohl für die Schüler, deren Wurzeln nicht im deutschen Sprachraum liegen, als auch für solche ohne Migrationshintergrund. Am Samstag, den 28. Mai 2011, von etwa 10 bis 12 Uhr wollen die Projektteilnehmer im Remscheider Alleecenter ihre neu erworbenen Fähigkeiten in Interview-Situationen anwenden.&edsp;
Es soll gezeigt werden, wie die Jugendlichen mit dieser fremden Art zu sprechen umgehen und testen, ob sie im außerschulischen Raum mit den erlernten Ausdrücken verstanden werden. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Passanten wollen die Schülerinnen und Schüler auf Remscheider Platt ansprechen. Die gesamte Aktion wird von den Mitwirkenden an dem Projekt audiovisuell festgehalten; die Ergebnisse werden später für die Radiosendung verwendet und in Form einer Videokollage zur Projektdokumentation verarbeitet.
Zeitgleich wird das Historische Zentrum der Stadt Remscheid – Bereich Stadtarchiv – als Ansprechpartner für Interessierte mit einem Stand im Alleecenter präsent sein und für Fragen zum Projekt zur Verfügung stehen.
Das Projekt wurde als besonders innovativ bewertet und vom Land NRW mit einem namhaften Betrag gefördert. Die Restmittel, die vom Historischen Zentrum nicht selbst finanziert werden können, steuert die durch Werner Schaaf vertretene Remscheider Eugen Moog Stiftung bei."
Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid vom 24. Mai 2011
(W)
Remscheider Platt ist für alle der teilnehmenden Jugendlichen eine "fremde" Sprache – sowohl für die Schüler, deren Wurzeln nicht im deutschen Sprachraum liegen, als auch für solche ohne Migrationshintergrund. Am Samstag, den 28. Mai 2011, von etwa 10 bis 12 Uhr wollen die Projektteilnehmer im Remscheider Alleecenter ihre neu erworbenen Fähigkeiten in Interview-Situationen anwenden.&edsp;
Es soll gezeigt werden, wie die Jugendlichen mit dieser fremden Art zu sprechen umgehen und testen, ob sie im außerschulischen Raum mit den erlernten Ausdrücken verstanden werden. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Passanten wollen die Schülerinnen und Schüler auf Remscheider Platt ansprechen. Die gesamte Aktion wird von den Mitwirkenden an dem Projekt audiovisuell festgehalten; die Ergebnisse werden später für die Radiosendung verwendet und in Form einer Videokollage zur Projektdokumentation verarbeitet.
Zeitgleich wird das Historische Zentrum der Stadt Remscheid – Bereich Stadtarchiv – als Ansprechpartner für Interessierte mit einem Stand im Alleecenter präsent sein und für Fragen zum Projekt zur Verfügung stehen.
Das Projekt wurde als besonders innovativ bewertet und vom Land NRW mit einem namhaften Betrag gefördert. Die Restmittel, die vom Historischen Zentrum nicht selbst finanziert werden können, steuert die durch Werner Schaaf vertretene Remscheider Eugen Moog Stiftung bei."
Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid vom 24. Mai 2011
(W)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 20:21 - Rubrik: Archivpaedagogik

"Das Rheinische Literaturarchiv im Heinrich-Heine-Institut möchte Euch seine akustischen Bestände vorstellen. Mit unserem "Hörbar-Mobil" kommen wir dorthin, wo Ihr Euch aufhaltet: in Jugendzentren, Schulen, Kinos oder in die Fußgängerzone. Auf unseren iPods könnt Ihr Euch historische Reden, Radio von damals und Dichterlesungen anhören, aber auch neueste "Stimmen" aus dem Popliteratur- und Poetry-Slam-Bereich. Und natürlich könnt ihr auch selber aktiv werden!
Das bietet unser "Hörbar-Mobil:
Geräuscheraten: Wir veranstalten ein kleines Gewinnspiel, bei dem Jugendliche sich ganz dem Hörsinn anvertrauen müssen, um zu erkennen, welche Geräusche wir vorbereitet haben. Die Teilnehmer erhalten eine kleine Belohnung.
Hörarchiv: zu Themen wie Liebe, Schule, Freundschaft, Humor, Politik, Nationalsozialismus, Pop und Spoken Word, Klanglandschaften werden Archivinhalte aus dem Heine-Institut aufbereitet und kommentiert. Damit kombiniert ist ein Quiz, die richtigen Lösungen sind in den Klangbeispielen zu finden. Als Gewinn winkt ein iPod nano.
Kreativbar: Hier könnt ihr eigene Clips erzeugen, entweder vor Ort mit unserem Aufnahmegerät oder auch mit dem eigenen Handy, wer möchte, kann damit am "Sound-Clip-Award" des Heinrich-Heine-Instituts Teil nehmen, einem Wettbewerb, bei dem die besten Beiträge prämiert werden - es gibt drei Kategorien:
a) Rezitation: Lese Deinen Lieblingstext vor oder einen der Texte, die das "Hörbar"-Team mit bringt (Kategorie: Bester Vortrag).
b) Eigener Text: Lese einen Text, den du selbst verfasst hat - Gedichte, Geschichten Raps (Kategorie: Bester Text).
c) Klanglandschaften: Welchen Klang hat die Stadt? Nimm auf, was Dich umgibt. Hier wird die beste kreative Idee gesucht (Kategorie: Freestyle).
Eure Clips, die ihr auch zu Hause produzieren und per Mail an das Heinrich-Heine-Institut schicken könnt, werden hier präsentiert.
Wann ist das Rad wo?.....
Donnerstag, 26.5.2011, 14:00-18:00 Uhr: Bücherei Bilk, Friedrichstr. 127 (Düsseldorf Arcaden), 40217 Düsseldorf, Tel.: 0211.89-99290
Montag, 20.6.2011, 16:00-20:00 Uhr: AWO, Jugendfreizeiteinrichtung Unterbilk, Siegstr. 2, 40219 Düsseldorf, Tel.: 0211.60025247
Dienstag, 9.8.2011, 11:00-14:00 Uhr: Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Icklack, Höherweg 12, 40233 Düsseldorf, Tel.: 0211.8929815
Weitere Termine finden im St.-Ursula-Gymnasium und in der Hulda-Pankok-Gesamtschule statt.
Außerdem wird sich die Crew des Hörbar-Mobils ab und an spontan in der Fußgängerzone blicken lassen. Informationen drüber werdet Ihr auch auf dieser Seite finden.
Samstag, 27.8.2011, 18:00-22:00 Uhr: Abschlussparty mit Adrian Pauly
Bei der offiziellen Preisverleihung im Heinrich-Heine-Institut wird der Düsseldorfer Songwriter Adrian Pauly auftreten. Bei freien Getränken werden hier die besten Soundbeiträge vorgestellt, der iPod nano wird dem oder der glücklichen Gewinner/in übergeben und nicht zuletzt werden Geldpreise von insgesamt 500 EUR unter den Gewinnern des "Sound-Clip-Awards" aufgeteilt!"
Quelle: Stadt Düsseldorf, Projektseite
(W)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 20:14 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Internationale Suchdienst (ITS/International Tracing Service) in Bad Arolsen hat heute eine Liste der noch im Archiv verbliebenen Effekten aus Konzentrationslagern im Internet veröffentlicht. „Unser Ziel ist die Rückgabe einer möglichst hohen Anzahl an Überlebende der NS-Verfolgung und an Familienangehörige“, sagte ITS-Direktor Jean-Luc Blondel. Zurzeit sind im Archiv des ITS noch circa 2.900 Effekten vorhanden, deren Eigentümer namentlich bekannt sind. Sie stammen vorwiegend aus den Konzentrationslagern Neuengamme und Dachau. Dank eines umfangreichen Forschungsprojektes konnten 476 Effekten erstmals den Namen von ehemaligen Häftlingen zugeordnet werden.
Die jetzt erfolgte Veröffentlichung der Effektenliste auf der Website des ITS unter www.its-arolsen.org soll die Kontaktaufnahme und Rückgabe erleichtern. Zugriff auf die passwortgeschützte Liste erhalten Überlebende sowie Familienangehörige. Außerdem baut der ITS auf die Unterstützung durch Partnerorganisationen, Opferverbände, Gedenkstätten, Forscher und Journalisten bei der Suche nach Angehörigen. „Denn häufig können wir nicht sagen, in welchen Ländern die Familien heute leben“, erklärte Blondel.
Die Effekten stammen hauptsächlich aus den Konzentrationslagern Neuengamme (2.400) und Dachau (330). Daneben befinden sich Gegenstände einiger weniger Häftlinge der Gestapo Hamburg (50), aus den Konzentrationslagern Natzweiler und Bergen-Belsen sowie den Durchgangslagern Amersfoort und Compiègne darunter. Bei den Effekten handelt es sich um persönliche Gegenstände, die den KZ-Insassen bei ihrer Einlieferung abgenommen wurden. Dazu zählen vor allem Brieftaschen, Ausweispapiere, Fotos und Briefe. Geld und Wertgegenstände hatten die Nationalsozialisten damals konfisziert. „Die persönlichen Gegenstände haben keinen materiellen, aber einen hohen ideellen Wert“, so Blondel. „In den Familien sind die Erinnerungsstücke aus unserer Sicht am besten aufgehoben.“
Ende 2009 hat der ITS ein umfangreiches Projekt gestartet, um 900 bisher als unbekannt deklarierte Effekten aus dem KZ Neuengamme zu überprüfen. In 476 Fällen konnten erstmals die Eigentümer identifiziert werden, was vor allem anhand hinterlegter Häftlingsnummern möglich war. Aber auch Briefe, Rechnungen oder Krankschreibungen dienten als Grundlage zur Identifizierung. Insgesamt werden im Archiv des ITS noch circa 3.400 Effekten verwahrt. Sie gelangten 1963 über das Verwaltungsamt für Innere Restitution Stadthagen sowie das Bayerische Landesentschädigungsamt München in die Obhut des Suchdienstes. „Die Effekten bestimmten Häftlingsgruppen zuzuordnen, erweist sich als schwierig“, erläuterte Dr. Susanne Urban, Leiterin des Bereichs Forschung beim ITS. „Jüdische Inhaftierte sowie Sinti und Roma sind nur in Ausnahmefällen darunter. Vor allem politisch Verfolgte sind dagegen zahlreich vertreten.“ Die Mehrzahl der einstigen Eigentümer stammte aus Osteuropa."
Quelle: ITS Arolsen, Pressemeldung v. 19.5.2011
(W)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 20:09 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
so ein Werbeslogan für den neuen Citroen DS 4.
Gibt es einen analogen Slogan für Bibliotheken - "Sei Poet keine Bibliothek" oder für Archive - "Sei aktiv kein Archiv"?
Anregungen werden als Kommentare gerne gesehen.
(E)
Gibt es einen analogen Slogan für Bibliotheken - "Sei Poet keine Bibliothek" oder für Archive - "Sei aktiv kein Archiv"?
Anregungen werden als Kommentare gerne gesehen.
(E)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 19:51 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"13 Fachwirte für Informationsdienste aus den Bereichen Bibliothek, Archiv und Dokumentation legten heute in Frankfurt am Main erfolgreich ihre Fortbildungsprüfung ab und bereichern damit das Spektrum möglicher Abschlüsse im Bibliotheks- und Informationswesen."
Lasen wir gerade in INETBIB.
Mag jemand eines dieser Wesen kontaktieren, ob es auch einen archivierenden Fachwirt gibt?
(ML)
Lasen wir gerade in INETBIB.
Mag jemand eines dieser Wesen kontaktieren, ob es auch einen archivierenden Fachwirt gibt?
(ML)
KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 18:19 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.flickr.net/en/2011/05/18/welcome-the-tyne-wear-archives-and-museums-to-the-commons/
"Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) is a joint service of the five local authorities in Tyne and Wear: Newcastle (which acts as lead authority and legal body), Sunderland, South Tyneside, North Tyneside, and Gateshead, with additional support and contributions from the Department for Culture, Media and Sport (DCMS). TWAM has a separate management agreement with Newcastle University, to manage the Great North Museum."
(RSS)

"Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) is a joint service of the five local authorities in Tyne and Wear: Newcastle (which acts as lead authority and legal body), Sunderland, South Tyneside, North Tyneside, and Gateshead, with additional support and contributions from the Department for Culture, Media and Sport (DCMS). TWAM has a separate management agreement with Newcastle University, to manage the Great North Museum."
(RSS)

KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 15:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.english-heritage.org.uk/professional/protection/process/national-heritage-list-for-england/
"The National Heritage List for England is an online database which brings together information on all nationally designated heritage assets in one place for the first time. "
(RSS)
"The National Heritage List for England is an online database which brings together information on all nationally designated heritage assets in one place for the first time. "
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 15:39 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Schwung, den heute der RSS-Reader bot (vor allem Reichenauer Handschriften), greife ich nur Donaueschingen 54 (Vocabularius ex quo) heraus:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-10023
(RSS)
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-10023
(RSS)
KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 15:37 - Rubrik: Kodikologie
http://www.boersenblatt.net/444428/
Siehe auch
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14141
Update:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14177
Text des Vorschlags:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/proposal_de.pdf
(RSS)
Siehe auch
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14141
Update:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=14177
Text des Vorschlags:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/proposal_de.pdf
(RSS)
KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 15:34 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzleikompa.de/2011/05/24/wikimedia-haut-200-000-euro-raus/
Siehe auch
http://blog.wikimedia.de/2011/05/24/wissenswert-berichte-aus-den-projekten-ii/
http://blog.wikimedia.de/2011/04/11/wissenswert-berichte-aus-den-projekten-i/
(RSS)
Siehe auch
http://blog.wikimedia.de/2011/05/24/wissenswert-berichte-aus-den-projekten-ii/
http://blog.wikimedia.de/2011/04/11/wissenswert-berichte-aus-den-projekten-i/
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Goldene Worte aus meinem Beitrag vom 30. August 2007 zum Nürnberger Stadtlexikon:
http://archiv.twoday.net/stories/4214839/
Anlässlich eines Kommentars zu
http://archiv.twoday.net/stories/11512037/
ist auf den gehaltvollen und zugleich kritischen Artikel
http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Stadtlexikon_N%C3%BCrnberg
hinzuweisen. Nach wie vor ist die EDV-technische Präsentation des Stadtlexikons ein Unding, für das sich der Vorsitzende des VdA (!) wirklich schämen sollte.
(E)
http://archiv.twoday.net/stories/4214839/
Anlässlich eines Kommentars zu
http://archiv.twoday.net/stories/11512037/
ist auf den gehaltvollen und zugleich kritischen Artikel
http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Stadtlexikon_N%C3%BCrnberg
hinzuweisen. Nach wie vor ist die EDV-technische Präsentation des Stadtlexikons ein Unding, für das sich der Vorsitzende des VdA (!) wirklich schämen sollte.
(E)
KlausGraf - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 13:19 - Rubrik: Kommunalarchive
Untitled from Der Vorst on Vimeo.
"Mit Unterstützung des Fördervereins konnte der Geschichtsort Villa ten Hompel zusammen mit dem LWL Medienzentrum für Westfalen die von Daniel Gollmann konzipierte Audio-CD "Gestern kein Recht - heute keine Gerechtigkeit" veröffentlichen. Am 17.5.2011 wurde sie dem Präsidenten des Landgerichts, Klaus Schelp übergeben, der einen wesentlichen Impuls für die Entstehung des Hörbuchs gab.In einer Collage aus zeitgenössischen Dokumenten, nachgesprochenen Quellen, Zeitzeugeninterviews und Expertenkommentaren begegnet den Hörerinnen und Hörern die große Geschichte im Kleinen. Für dieses Hörbuch wurden zahlreiche Quellen gesichtet und ausgewertet. Unter anderem sichtete Gollmann für das Kapitel zu den Prozessen um das Bundesentschädigungsgesetz einen Bestand von knapp 1.800 Prozessakten, der in der Villa ten Hompel lagert und aus den Registraturkellern des Landgerichts Münster stammt.
Landgerichtspräsident Klaus Schelp zeigte sich bei der Präsentation der CD davon beeindruckt, wie nur schwer zu lesende, sperrige Akten in ein eindringliches Hörerlebnis übersetzt worden seien. Durch den konzentrierten Prozess auf einzelne Fälle werde ein abstrakter bürokratischer Prozess erfahrbar und auch für Laien gut verständlich.
INFO
Geschichtsort Villa ten Hompel
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster
Tel.: 02 51/4 92-71 01
Fax: 02 51/4 92-79 18
E-Mail: tenhomp(at)stadt-muenster.de
Weitere Informationen zur Veröffentlichung finden Sie auf den
Internetseiten der Villa ten Hompel sowie des
LWL-Medienzentrums für Westfalen."
(ML Westfälische Geschichte)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 12:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Berliner Zeitung vom 25.05.2011 berichtet über Prof. Thomas Simeon, der sich via Youtube an die Öffentlichkeit wendet, weil einem Plagiatsverdacht an der HTW nicht entschieden genug nachgegangen worden sei:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0525/berlin/0028/index.html
Hier der Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=DpKFlY6u02Y
(D)
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0525/berlin/0028/index.html
Hier der Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=DpKFlY6u02Y
(D)
ingobobingo - am Mittwoch, 25. Mai 2011, 10:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"SiLK, der SicherheitsLeitfaden Kulturgut der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen KNK dient mit seinen einführenden Abhandlungen, Fragebögen und seinem Wissenspool der Schärfung des Bewusstseins für das Thema Sicherheit und dem Kulturgutschutz in Museen, Bibliotheken und Archiven. Er unterstützt die Mitarbeiter dabei, ihre Einrichtung im Bereich Sicherheit zu evaluieren, und zeigt Tipps und Lösungsmöglichkeiten auf. Auch für andere Interessierte hält er vielfältige Informationen bereit.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies zum allgemeinen Sicherheitsmanagement sowie zu den Themen Brand, Diebstahl, Flut, Licht, Schädlinge und Schadstoffe möglich. Die Themen Vandalismus, Abnutzung, Klima, Unwetter, Erdbeben, Gewalttaten und Havarien / Unfälle sollen folgen. Zu jedem Thema gibt es eine Einführung, einen Fragebogen und einen Wissenspool.
Der Fragebogen bildet den zentralen Teil jeden Themas. Nach Beantwortung aller Fragen erhält der Nutzer eine Auswertung nach dem Ampel-Prinzip: Wird der Mindeststandard nicht erfüllt („Rot“) oder besteht Dauergefahr („Gelb“), werden in der Auswertung Handlungsempfehlungen bzw. Kompensationsmaßnahmen angezeigt. Die Auswertung kann als PDF-Dokument gespeichert und gedruckt werden.
Der Wissenspool beinhaltet zu jedem Thema weiterführende Informationen, u. a. eine Übersicht der Fachpublikationen, der Normen und Richtlinien, Notfallpläne, Links sowie Adressen von Ansprechpartnern.
Der SicherheitsLeitfaden Kulturgut bietet zur Zeit ein Evaluations- und Beratungsinstrument für die erste Hälfte der potentiellen Risiken für Kultureinrichtungen. Die zweite Hälfte soll in 2011 folgen. Alle Nutzer seien auf diese „Unvollständigkeit“ und damit „Vorläufigkeit“ hingewiesen und gleichzeitig herzlich eingeladen, sich mit Anregungen, Kritik, Kommentaren und Wünschen in die weitere Ausarbeitung und Verbesserung von SiLK einzubringen.
E-Mail-Kontaktadresse: knk-sicherheit@ses.museum. "
Quelle: Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, Homepage
(S)
Wolf Thomas - am Dienstag, 24. Mai 2011, 20:35 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Lösung: "... Stadtarchiv
Fahren Sie zur Ecke Broadway und 1st Street. Folgen Sie dem Broadway in Richtung Norden, um auf der rechten Straßenseite nach einigen Metern das Stadtarchiv zu entdecken. Dort angelangt, steigen Sie die Treppen hinauf, gehen durch den Raum des Hausmeisters und balancieren über das dahinter liegende Stahlseil auf den Kronleuchter. Hier finden Sie Deidra Mollers Uhr und die dritte Nachricht. ...."
Quelle: Computerbild, 22.05.2011
s. a. Spiegel online, 24.05.2011
(W)
Wolf Thomas - am Dienstag, 24. Mai 2011, 20:19 - Rubrik: Unterhaltung
I´m looking for scary ghost stories in archives.
s. a.:
Ghost in the archives?: Link
Ghost in the archives II: Register des Geister-Archives : Link
Ghost in the archives III: Ick war allhier: Link
Ghost in the archives IV: Archivgeist wieder gesichtet: Link
Ghost in the archives V: A second, smaller ghost in my new magazin: Link
(E)
Wolf Thomas - am Dienstag, 24. Mai 2011, 18:44 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ca. 600 Exlibris der Sammlung Exlibris 2 wurden digital zugänglich gemacht:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1291902334&recherche=ja&ordnung=sig
(ML)
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1291902334&recherche=ja&ordnung=sig
(ML)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.blha.de/filepool/brbgarchive_28_2011_web.pdf
Aus dem Inhalt:
Ordnung von archivischem Sammlungsgut: Das Beispiel Nachlässe (Wilhelm Füßl, Nürnberg)
Grundfragen der Bestandsbildung und Tektonik eines Stadtarchivs (Steffen Kober, Cottbus)
Modelle zur Ordnung archivalischer Überlieferungen der Kreise und Städte (1952 – 1990) (Brigitta Heine, Eberswalde)
Ordnung durch Gebühren: Grundfragen von Gebührenordnungen in Archiven (Michael Scholz, Potsdam)
Ordnung in Magazinen: Technische Bearbeitung, Verpackung und Lagerung von Archivgut (Marion Niendorf, Ingrid Kohl, Potsdam)
Die Aufgaben und die Arbeit der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur (LakD) (Rainer Potratz, Potsdam)
Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Zwei Namen – Eine Geschichte
Gemeinsames Ausstellungsprojekt des polnischen Staatsarchivs Gorzów Wielkopolski und des BLHA (Klaus Neitmann, Potsdam)
Das Führerprinzip im Landsberger Stadttheater: Theaterdirektor Schneiders unfreiwilliger Abgang 1936 (Falko Neininger, Potsdam)
Fortsetzung folgt (Hanna Delf von Wolzogen/Christine Reinhardt, Potsdam)
Brandenburgischer Archivpreis 2010 (Wolfgang Krogel, Berlin)
Informationen für Archive im Land Brandenburg Nr. 3 vom 25.5.2011
Die Hennickendorfer Heuschrecken von 1805 (Jana Sprenger, Göttingen)
(Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive – eine neue Beständeübersicht des BLHA (Werner Heegewaldt, Potsdam)
(ML)
Aus dem Inhalt:
Ordnung von archivischem Sammlungsgut: Das Beispiel Nachlässe (Wilhelm Füßl, Nürnberg)
Grundfragen der Bestandsbildung und Tektonik eines Stadtarchivs (Steffen Kober, Cottbus)
Modelle zur Ordnung archivalischer Überlieferungen der Kreise und Städte (1952 – 1990) (Brigitta Heine, Eberswalde)
Ordnung durch Gebühren: Grundfragen von Gebührenordnungen in Archiven (Michael Scholz, Potsdam)
Ordnung in Magazinen: Technische Bearbeitung, Verpackung und Lagerung von Archivgut (Marion Niendorf, Ingrid Kohl, Potsdam)
Die Aufgaben und die Arbeit der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur (LakD) (Rainer Potratz, Potsdam)
Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Zwei Namen – Eine Geschichte
Gemeinsames Ausstellungsprojekt des polnischen Staatsarchivs Gorzów Wielkopolski und des BLHA (Klaus Neitmann, Potsdam)
Das Führerprinzip im Landsberger Stadttheater: Theaterdirektor Schneiders unfreiwilliger Abgang 1936 (Falko Neininger, Potsdam)
Fortsetzung folgt (Hanna Delf von Wolzogen/Christine Reinhardt, Potsdam)
Brandenburgischer Archivpreis 2010 (Wolfgang Krogel, Berlin)
Informationen für Archive im Land Brandenburg Nr. 3 vom 25.5.2011
Die Hennickendorfer Heuschrecken von 1805 (Jana Sprenger, Göttingen)
(Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive – eine neue Beständeübersicht des BLHA (Werner Heegewaldt, Potsdam)
(ML)
KlausGraf - am Dienstag, 24. Mai 2011, 14:48 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
SAGE recently published its first articles in SAGE Open, the only broad-based open access journal featuring content from the social and behavioral sciences and the humanities. SAGE Open supports the growing number of authors who require their articles to be freely available on publication, either because of personal preference or because of university or government mandates.
Since the beginning of the year, SAGE Open has received more than 400 submissions from across the whole breadth of the social sciences.
“We’re excited about the launch of SAGE Open and thrilled with the number of authors responding in just four months,” said Jayne Marks, Vice President and Editorial Director for SAGE's Library Information Group. “The flexibility of the format allows SAGE to explore publishing research from emerging fields and provides a service to authors who are looking for the maximum dissemination of their work.”
Unlike traditional journals, SAGE Open does not limit content due to page budgets or thematic significance. Rather it accepts articles solely on the basis of the quality of the research, evaluating the scientific and research methods of each article for validity.
Today marks the availability of that content online, with the following inaugural articles published at www.sageopen.com:
“Designing for Explanation in Health Care Applications of Expert Systems” by Keith W. Darlington: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408618.full.pdf+html
“Lars and the Real Girl: Lifelike Positive Transcendence” by Ted Remington: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408346.full.pdf+html
“A Transformative Collegiate Discourse” by Evan Ortlieb: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408346.full.pdf+html
“Intangible Heritage of Standard English Learners: The “Invisible” Subgroup in the United States of America? Implications for Closing the Achievement Gap” by Ogo Okoye-Johnson: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408441.full.pdf+html
“Fostering Collaborative and Interdisciplinary Research in Adult Education: Interactive Resource Guides and Tools” by Elizabeth Anne Erichsen and Cheryl Goldenstein: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408441.full.pdf+html
“Personal Meaning Orientations and Psychosocial Adaptation in Older Adults” by Gary T. Reker and Louis C. Woo: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011405217.full.pdf+html
http://www.sagepub.com/press/2011/may/SAGE_openLaunches4sandbscientists.sp
(RSS)
Since the beginning of the year, SAGE Open has received more than 400 submissions from across the whole breadth of the social sciences.
“We’re excited about the launch of SAGE Open and thrilled with the number of authors responding in just four months,” said Jayne Marks, Vice President and Editorial Director for SAGE's Library Information Group. “The flexibility of the format allows SAGE to explore publishing research from emerging fields and provides a service to authors who are looking for the maximum dissemination of their work.”
Unlike traditional journals, SAGE Open does not limit content due to page budgets or thematic significance. Rather it accepts articles solely on the basis of the quality of the research, evaluating the scientific and research methods of each article for validity.
Today marks the availability of that content online, with the following inaugural articles published at www.sageopen.com:
“Designing for Explanation in Health Care Applications of Expert Systems” by Keith W. Darlington: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408618.full.pdf+html
“Lars and the Real Girl: Lifelike Positive Transcendence” by Ted Remington: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408346.full.pdf+html
“A Transformative Collegiate Discourse” by Evan Ortlieb: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408346.full.pdf+html
“Intangible Heritage of Standard English Learners: The “Invisible” Subgroup in the United States of America? Implications for Closing the Achievement Gap” by Ogo Okoye-Johnson: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408441.full.pdf+html
“Fostering Collaborative and Interdisciplinary Research in Adult Education: Interactive Resource Guides and Tools” by Elizabeth Anne Erichsen and Cheryl Goldenstein: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011408441.full.pdf+html
“Personal Meaning Orientations and Psychosocial Adaptation in Older Adults” by Gary T. Reker and Louis C. Woo: http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/04/28/2158244011405217.full.pdf+html
http://www.sagepub.com/press/2011/may/SAGE_openLaunches4sandbscientists.sp
(RSS)
KlausGraf - am Dienstag, 24. Mai 2011, 00:51 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Webers Gutachten ist online:
http://www.gruene.at/uploads/media/GutachtenWeber.pdf
Via
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/anti-intellektualismus-osterreichischer-art/
(RSS)
http://www.gruene.at/uploads/media/GutachtenWeber.pdf
Via
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/anti-intellektualismus-osterreichischer-art/
(RSS)
KlausGraf - am Dienstag, 24. Mai 2011, 00:36 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

